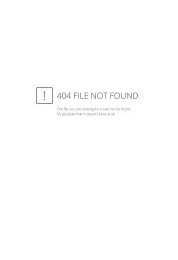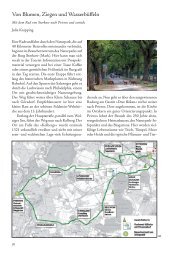Der Kurpark Wildau - NABU Dahmeland
Der Kurpark Wildau - NABU Dahmeland
Der Kurpark Wildau - NABU Dahmeland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Der</strong> <strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong><br />
Karl-Heinz Wollenberg<br />
Zur Entstehung des <strong>Kurpark</strong>es<br />
<strong>Der</strong> <strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong> entstand am Südrand der<br />
Waldsiedlung <strong>Wildau</strong> zur Erholung und somit<br />
zum Wohle der Bürger. Hier erstreckt sich der<br />
Park in Ost-West-Richtung auf einer Länge von<br />
etwa einem Kilometer. Er liegt zwischen den<br />
Straßen Wildgarten (im Norden) und Pirschgang<br />
(im Süden). Sein Haupteingang befindet<br />
sich an der Birkenallee am Ostrand des Parks.<br />
Um es gleich vorweg zu nehmen: Es handelt sich<br />
hierbei nicht um einen «Kur»-Park; dies war nur<br />
ein erster Wunschgedanke bei der Planung. Man<br />
kann hier also nicht mit seinem Kurschatten<br />
wandeln.<br />
Die Planung und Einrichtung des Parks erfolgten<br />
im Zusammenhang mit der ausgedehnten<br />
Grundstücks-Parzellierung Mitte der 30er<br />
Jahre dieses Jahrhunderts im nördlich angrenzenden<br />
Waldgebiet, wo die Waldsiedlung <strong>Wildau</strong><br />
entstand. Diese reicht heute im Norden bis<br />
Zeuthen. Die Grundstücke der Waldsiedlung<br />
weisen einen beachtlichen Altkiefern-Bestand<br />
auf, den es auch künftig zu erhalten gilt.<br />
Die eigentliche «Geburtsstunde» des <strong>Kurpark</strong>s<br />
<strong>Wildau</strong> lag in den Jahren 1937–1938.<br />
Unter einem heute ca. 125-jährigen Kiefern-Altholz-Schirm<br />
wurden zahlreiche Ziergehölze gepflanzt.<br />
Hierbei handelte es sich um heimische<br />
als auch um exotische Arten in größerer Anzahl.<br />
Es erfolgten die Unterpflanzungen mit Bäumen,<br />
so dass eine weitere Baumschicht, und zwar<br />
aus Laubbäumen, entstand. Dominierende<br />
Baumgehölze dieser Pflanzungen sind Eichen-,<br />
Ahorn- und Lindenarten sowie Hainbuche, Robinie<br />
und Späte Traubenkirsche. Besonders<br />
schön und prägend sind aber auch die zahlreichen<br />
Zierapfel- und Wildapfelarten und -formen.<br />
Sie empfangen uns bereits im März mit<br />
auffallend zeitigem Grün und mit einem überreichen<br />
Blütenflor im April und Mai.<br />
Weiterhin wurde der <strong>Kurpark</strong> noch durch<br />
die Pflanzung von Ziersträuchern bereichert und<br />
ergänzt. Vorrangig gepflanzt wurden damals u.a.<br />
Wildrosen-, Strauchmispel- und Fliederarten,<br />
Großer Pfeifenstrauch und Gemeiner Erbsenstrauch.<br />
Interessant ist generell ein Blick auf die<br />
Arten-Garnitur von Parkanlagen. Sie lässt genauere<br />
Rückschlüsse auf den Zeitraum der Entstehung<br />
der einzelnen Parkanlagen zu, denn in<br />
den unterschiedlichen Zeitabschnitten wurden<br />
meist auch unterschiedliche Gehölzarten, je nach<br />
Geschmack und Bezugsmöglichkeit, verwendet.<br />
So wurde z.B. im <strong>Kurpark</strong> bei der Erstbepflanzung<br />
sehr häufig die Vielblütige Strauchmispel<br />
(Cotoneaster multiflorus) gepflanzt. Dieser Wildstrauch<br />
aus China ist hier auch heute noch in bis<br />
drei Meter hohen Exemplaren vertreten. Seinen<br />
schönen, weiß überschäumenden Blütenmassen<br />
steht ein recht aufdringlicher, strenger Geruch<br />
gegenüber. So ist die Art heute aus der Mode gekommen<br />
und wird nur noch wenig verwendet.<br />
Betrachtet man rückwirkend die ehemaligen<br />
Gehölzpflanzungen im <strong>Kurpark</strong>, so kommt man<br />
zu dem Schluss, dass schon bei der Erstgestaltung<br />
oft Arten verwendet wurden, die in ökologischer<br />
Hinsicht recht wertvoll waren. Sie hatten<br />
meist einfache, für Insekten leicht zugängliche<br />
Blüten und ein reichhaltiges Früchteangebot.<br />
Auch waren viele Ziersträucher gute Nistplätze<br />
für die hiesigen Vogelarten.<br />
Die Durchführung der Pflanzungen im <strong>Kurpark</strong><br />
<strong>Wildau</strong> erfolgte in den Jahren 1937/38<br />
durch die noch immer recht bekannte Baumschule<br />
L. SPÄTH aus Berlin-Baumschulenweg.<br />
Bei der Erstbepflanzung des <strong>Kurpark</strong>es war die<br />
hiesige Gärtnerei Ganßauge beteiligt, die auch<br />
heute noch direkt an den <strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong> angrenzt.<br />
In den Folgejahren gedieh der <strong>Kurpark</strong> in<br />
<strong>Wildau</strong> prächtig. Zur Zeit des 2. Weltkrieges<br />
mussten dann Kriegsgefangene die Pflegearbeiten<br />
durchführen.
<strong>Der</strong> Niedergang des <strong>Kurpark</strong>s nach 1945<br />
Seit Ende des Krieges ab 1945 verfiel der <strong>Kurpark</strong><br />
zusehends. Das rustikale, aus Baumstämmen<br />
gefertigte Eingangstor sowie eine sehr schön<br />
gearbeitete Holzbrücke über den ehemaligen<br />
Schiessgraben verschwanden bald. <strong>Der</strong> damals<br />
noch weitgehend offene Schiessgraben, der die<br />
südlichste Saumzone im <strong>Kurpark</strong> bildet, wurde<br />
als Mülldeponie genutzt. Aber auch weitere Flächen<br />
des <strong>Kurpark</strong>s waren mit Müll und Unrat<br />
aller Art durchsetzt.<br />
Im Laufe von Jahrzehnten überwucherten<br />
Robinien, Eschen-Ahorne und Späte Traubenkirschen<br />
rasch, massiv und in dichten Beständen<br />
die Ziergehölze und bedrängten sogar die Kiefernkronen.<br />
Selbst ehemals weitgehend freie<br />
Räume, wie die alten Schießgräben, überwuchsen<br />
gnadenlos.<br />
Auf den allerletzten, noch mehr oder weniger<br />
freien Standorten machten sich zusätzlich<br />
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Topinambur<br />
(Helianthus tuberosus) – beide Staudenarten<br />
ebenfalls aus Nordamerika – sowie Japanischer<br />
Staudenknöterich (Reynoutria japonica)<br />
als Garten-Flüchtlinge und weitere Arten<br />
breit und überwucherten die heimische Staudenflora.<br />
Alle diese Arten wurden weitgehend<br />
mit Gartenabfällen in den <strong>Kurpark</strong> hineingetragen.<br />
Die Verwilderung von Pflanzenarten ist ein<br />
allgemein schwerwiegendes Problem. Hierbei<br />
handelt es sich um fremdländische Gehölze und<br />
Stauden, die dank stärkerer Konkurrenzkraft<br />
(rascheres Wachstum, stärkere Vermehrung<br />
durch Samen und Wurzelausläufer) den bei uns<br />
heimischen Arten derzeit überlegen sind und<br />
diese verdrängen.<br />
So kam es im <strong>Kurpark</strong> schließlich, wie es<br />
kommen musste! Bedingt durch extreme Beschattung<br />
und hohen Konkurrenzdruck starben<br />
besonders lichtliebende Ziergehölze zunehmend<br />
ab. Einzelne Parkgehölze überdauerten nur noch<br />
in schlechtester Wuchsform mit Peitschenwuchs<br />
zum Licht hin und schütterer Belaubung. Auch<br />
blühten und fruchteten die Gehölze kaum noch.<br />
Hiermit gingen sowohl ihr ästhetischer Anblick<br />
als auch ihr ökologischer Wert weitgehend verloren<br />
und der Park machte einen völlig verwahrlosten<br />
Eindruck!<br />
Die Wiederherstellung und Neugestaltung<br />
ab 1993<br />
Nach gemeinsamer Planung und Abstimmung<br />
zwischen dem Gemeindeamt <strong>Wildau</strong>, der neu<br />
gegründeten ABS <strong>Wildau</strong> und der Fachfirma<br />
Baumdienst Strübing und Braun Eichwalde<br />
konnte im Jahr 1993 die Wiederherstellung und<br />
Neugestaltung des <strong>Kurpark</strong>s in Angriff genommen<br />
werden. Seit dem Februar 1993 wurde der<br />
Waldpark durch das ABM-Projekt «<strong>Kurpark</strong><br />
<strong>Wildau</strong>» vor seinem weiteren Verfall bewahrt<br />
und wieder zu einem gern besuchten Kleinod<br />
entwickelt. Hierdurch fanden gleichzeitig 50 arbeitslose<br />
Bürger als ABM-Leute – wenigstens<br />
vorübergehend – wieder eine neue, sinnvolle Arbeit.<br />
Ich bin für die Gestaltung des <strong>Kurpark</strong>s aus<br />
ökologischer Sicht verantwortlich. Dies betrifft<br />
die Planung der Biotopgestaltung, die Pflanzenauswahl,<br />
die Pflanzenbeschaffung und die<br />
Durchführung der Pflanzungen einschließlich<br />
ihrer Pflege.<br />
Durch Gestaltung wurde aus einem Kiefernforst eine Parklandschaft · Foto: Wolfgang Klaeber
Die Wiederherstellung und Neugestaltung wurde in folgenden Schritten durchgeführt<br />
– Massenentfernung von Robinien, Eschenahornen und Späten Traubenkirschen durch Absägen<br />
beziehungsweise Ausgraben. Die größeren Stubben wurden angehackt, damit sie eher absterben<br />
und rasch von holzabbauenden Pilzen besiedelt werden. Hierbei stellte sich heraus,<br />
dass vor allem die Stubben des Eschenahorns rasch von Pilzen, insbesondere vom Schuppen-<br />
Porling (Polyporus squamosus), besiedelt werden;<br />
– Freistellung ehemaliger Offen-Biotope in den alten Schießgräben entlang des Südsaumes des<br />
<strong>Kurpark</strong>s;<br />
– Schreddern des angefallenen Zweigmaterials in großem Umfang und Verwendung des Schreddermaterials<br />
zum Mulchen und für spezielle Artenschutzmassnahmen;<br />
– Verwendung gefällter und geschälter Robinienstämme als Zaunpfähle, als Kletterstämme im<br />
Tiergehege des Parkes sowie zum Bau von Sitzbänken für den <strong>Kurpark</strong>, die <strong>Wildau</strong>er Schulen,<br />
die Kita;<br />
– Entmüllung und Entschrottung des <strong>Kurpark</strong>s in grossem Umfang;<br />
– Anteilige Pflasterung der Wege mit Robinienholz;<br />
– Neupflanzung einer grossen Anzahl von Bäumen, Ziersträuchern, Klettergehölzen und Stauden<br />
verschiedenster Arten und Formen;<br />
– Anlegen zweier Ökoteiche als Amphibien-Laichgewässer;<br />
– Anlegen eines Naturlehrpfades und Aufstellung von Schautafeln über Tier- und Pflanzenarten,<br />
die vorrangig im <strong>Kurpark</strong> vertreten sind, Beschilderung der Zugangswege zum Gelände;<br />
– Neubau einer 115 Meter langen Trockenmauer (ehemals aus Rüdersdorfer Muschelkalk,<br />
heute aus hartem Bayerischen Jurakalk) und Bepflanzung;<br />
– Errichtung eines neuen Eingangsportals aus Holz und Bau eines Kinderspielplatzes am<br />
Haupteingang des <strong>Kurpark</strong>s;<br />
– Anlegen von Nist- und Versteckmöglichkeiten für Vögel u.a. Tiere aus Reisigmaterial, Ausbringung<br />
von Vogelnistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter<br />
Das Tiergehege im Zentrum des <strong>Kurpark</strong>s<br />
Privat betrieben und offiziell in das <strong>Kurpark</strong>-<br />
Projekt integriert, befindet sich ein Tiergehege<br />
im <strong>Kurpark</strong> direkt am Zugang Rehfährte. Bewohnt<br />
wird es von einer Gruppe Afrikanischer<br />
Zwergziegen und einem Shetland-Pony. Auffällig<br />
sind hier recht hohe Kletterstämme, die von<br />
dieser besonders kletterfreudigen Ziegenrasse<br />
gern und oft in rasantem Tempo genutzt werden.<br />
Auch sonnen sich die Tiere dort gern. Das Tiergehege<br />
bildet einen weiteren Anziehungspunkt<br />
im <strong>Kurpark</strong>, wo die Parkbesucher – und vor<br />
allem die Kinder – besonders gern verweilen.<br />
<strong>Der</strong> jährliche Nachwuchs der Zwergziegen wird<br />
an Interessenten abgegeben. Für die Tiere im Gehege<br />
gehen uns von den <strong>Kurpark</strong>-Besuchern täglich<br />
Futterspenden zu, wofür wir uns auf diesem<br />
Wege recht herzlich bedanken möchten.<br />
Vorgestellt – Biotope im <strong>Kurpark</strong><br />
Die Neugestaltung des <strong>Kurpark</strong>s erfolgte neben<br />
der ästhetischen Betrachtung weitgehend aus<br />
ökologischer Sicht, denn auch Parkanlagen sind<br />
wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen.<br />
Grundsätzlich wurde eine sinnvolle Einbindung<br />
des Parkes in die umgebende Landschaft angestrebt.<br />
Als Lebensraum erhalten wurde der gesamte<br />
Waldbestand des <strong>Kurpark</strong>s. Er hat u.a. eine<br />
wichtige Verbundfunktion für den Artenaustausch<br />
zu den direkt angrenzenden, weit ausgedehnten<br />
Waldgrundstücks-Flächen im Norden<br />
und Süden, ebenso zum westlich anschließenden<br />
Kiefernforst.<br />
Zusätzlich neu geschaffen wurden im Bereich<br />
der ehemaligen Schießgräben Offen-Biotope. Sie<br />
erstrecken sich entlang des <strong>Kurpark</strong>-Südrandes.
Zu den zukünftig sehr wichtigen, zeitaufwendigen<br />
und arbeitsintensiven Pflegemaßnahmen<br />
gehören<br />
– Wässern der Gehölze, Stauden, Gräser und<br />
Farne, ggf. Rückschnitt<br />
– Entfernen der Neuaustriebe und Sämlinge<br />
von Robinie, Eschen-Ahorn und Später<br />
Traubenkirsche<br />
– Ständige Unkraut-Entfernung bei den<br />
Pflanzungen, Ausstechen stark wuchernder<br />
Arten wie Kanadische Goldrute, Staudenknöterich,<br />
Topinambur, Quecke, Landreitgras,<br />
Brombeeren und weitere Arten<br />
– Wasserergänzung in den Ökoteichen und<br />
Entfernung der Fadenalgen<br />
– Ständige Wartung und Sauberhaltung des<br />
Parkgeländes, des Kinderspielplatzes, Winterdienst<br />
auf dem Hauptweg<br />
– Mulchen der Gehölze mit Schreddermaterial<br />
zur Verbesserung des Bodensubstrats,<br />
gegen stärkere Bodenaustrocknung und zur<br />
Verminderung der Unkrautentwicklung<br />
– Kontrolle und Neuaufstockung der Niststätten<br />
– Durchführung notwendiger Nachpflanzungen<br />
bzw. Ergänzungen von Stauden<br />
und Gehölzen<br />
Anteilig unterbrochen sind sie durch einige<br />
Grundstücke, die jedoch lichter sind als der <strong>Kurpark</strong>-Wald.<br />
Weiter nach Westen weiten sie sich<br />
in eine größere Trockenrasen-Fläche aus.<br />
Schließlich leiten sie – schon außerhalb des <strong>Kurpark</strong>s<br />
– in die ausgedehnten Trockenrasen im<br />
Naturschutzgebiet «Höllengrund – Pulverberg»<br />
über. Somit wurde vom <strong>Kurpark</strong> her ein weitreichender<br />
Lebensraum - Verbund geschaffen.<br />
Aber auch vom Ostrand der Offen-Biotope<br />
im <strong>Kurpark</strong> ist es nach Nordosten zum Flächennaturdenkmal<br />
(FND) «Trockenrasen Bahn <strong>Wildau</strong>»<br />
und nach Süden zum FND «Trockenrasen<br />
Hoherlehme» nicht weit. <strong>Der</strong>art kurze Strecken<br />
werden zumindest von flugfähigen Tieren (Vogelarten,<br />
Fledermäusen und zahlreichen Insekten)<br />
mit Leichtigkeit gemeistert. Aber auch von<br />
anderen Tieren (Wildschweinen, Rehen, Füchsen)<br />
werden sie nachweislich überbrückt.<br />
Somit haben die Offen-Biotope des <strong>Kurpark</strong>s<br />
gleich nach mehreren Richtungen hin Bedeutung<br />
als Verbundsystem für einen möglichen Artenaustausch<br />
an Tier- und Pflanzenarten. Ein Artenaustausch<br />
ist deshalb so wichtig, damit auf<br />
längere Sicht Inzucht-Erscheinungen vermieden<br />
werden und somit keine Arten der Fauna und<br />
Flora aussterben.<br />
Da die Offen-Biotope im <strong>Kurpark</strong> jeweils gut<br />
besonnt sind und geschützt vor kalten Nordwest-Winden<br />
am Südrand des Waldes liegen,<br />
sind sie ganz besonders wärmegetönt und somit<br />
ideale Lebensräume für besonders licht- und<br />
wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten.<br />
Neue Offen-Biotope<br />
<strong>Der</strong> Steingartenhügel wurde mit Kalksteinblökken<br />
errichtet. Die Bepflanzung erfolgte mit<br />
Steingartenpflanzen vorwiegend aus Südeuropa.<br />
Dominant sind eine Anzahl von Duftpflanzen<br />
wie Echter Lavendel (Lavandula angustifolia),<br />
Echter Salbei (Salvia officinalis), Weinraute (Ruta<br />
graveolens), Echter Thymian (Thymus vulgaris),<br />
Zitronen-Thymian (Thymus x citriodorus) und<br />
Karst-Bergminze (Satureja montana) aber auch<br />
andere Arten wie Portugal-Malve (Lavatera<br />
olbia) und Schwefel-Nelke (Dianthus knappii).<br />
Randlich sehr auffallend sind zwei chinesische<br />
Wildrosen: Die gelb blühende Dukaten-Rose<br />
(Rosa hugonis) und die weiß blühende Stacheldraht-Rose<br />
(Rosa omeiensis f. pteracantha), letztere<br />
mit auffallend großen, rotbraunen Stacheln!<br />
<strong>Der</strong> Kalk-Trockenrasen folgt gleich links hinter<br />
dem Steingartenhügel. Auf nur sanftem Hügel<br />
enthält er Arten, die auch meist in Mitteleuropa<br />
auf warmen, kalkhaltigen Standorten auftreten.<br />
Hier grüßen uns u.a. Gemeiner Hornklee (Lotus<br />
corniculatus), Sonnenröschen (Helianthemum<br />
‹Hybridum›), Große Anemone (Anemone sylvestris),<br />
Goldhaar-Aster (Aster linosyris) und eine<br />
schöne Gruppe des Diptams (Dictamnus albus).<br />
<strong>Der</strong> Sand-Trockenrasen liegt – jenseits des Mittelweges<br />
– gleich gegenüber dem Kalk-Trockenrasen.<br />
Hier treffen wir meist auf heimische<br />
Arten. Sie treten in der Natur auf sehr nährstoffarmen<br />
Silikat-Sanden auf. Zu finden sind
z. B. Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum),<br />
Sand-Nelke (Dianthus arenarius), Wermut<br />
(Artemisia absinthium), Blaugrünes Schillergras<br />
(Koeleria glauca) und Schaf-Schwingel (Festuca<br />
ovina).<br />
Bei der Heide-Gesellschaft handelt sich um eine<br />
Trockenheide von größerer Fläche. Dominierend<br />
sind Besen-Heide (Calluna vulgaris) in Wildform<br />
und Kultursorten, Thymian-Teppiche (Thymus<br />
sp.) in verschiedenen Arten bzw. Formen, Gruppen<br />
und Einzelsäulen des Irischen Säulen-<br />
Wacholders ( Juniperus communis ‹Hibernica›),<br />
Besen-Ginster (Cytisus scoparius), Behaarter<br />
Ginster (Genista pilosa) und weitere Ginsterarten,<br />
Wildrosen wie Hunds-Rose (Rosa canina),<br />
Wein-Rose (Rosa rubiginosa) und Glanz-Rose<br />
(Rosa nitida) sowie heimische Wildgräser und<br />
andere Wildstauden.<br />
Integriert in das Heide-Biotop sind nordische<br />
Geschiebe unterschiedlicher Gesteinsarten. An<br />
seinem Westende grenzt die Heidefläche an den<br />
Kleinen Ökoteich mit dessen Randbepflanzung.<br />
Zur Neugestaltung des <strong>Kurpark</strong>s<br />
aus ökologischer Sicht<br />
Insgesamt gesehen erfolgte die Neugestaltung im<br />
Sinne des erhaltenden und gestaltenden Natur-<br />
schutzes. Dies bedeutet die Erhaltung und weitere<br />
Vermehrung der hier lebenden Tier- und<br />
Pflanzenarten. Darüber hinaus konnten weitere<br />
neue, geeignete Lebensräume geschaffen werden.<br />
Bei den Gehölzen und Stauden werden weitgehend<br />
Arten gekauft und gepflanzt, die nur einfache<br />
oder – stark untergeordnet – nur halb gefüllte<br />
Blüten besitzen. So können Insekten ungehindert<br />
an die Nahrungsquellen gelangen, da<br />
Nektar und Pollen frei zugänglich sind. Bewusst<br />
angesiedelt wurden auch Gehölze, die lange Röhrenblüten<br />
besitzen. Sie sind wichtige Nahrungs-<br />
Die Wildrosen-Blüten im <strong>Kurpark</strong> sind wichtige Nahrungsquellen für den Rosenkäfer; Die mit gelben Blütenschalen<br />
dicht besetzte Dukaten-Rose blüht bereits im Mai. Sie stammt aus China. · Foto: Karl-Heinz Wollenberg
quellen für langrüsslige, darauf spezialisierte Insekten<br />
(Hummel- und Nachtfalterarten). Hierfür<br />
wurde z. B. in größerer Anzahl von den<br />
Rankgehölzen das Waldgeißblatt (Lonicera periclymenum)<br />
gepflanzt, dies sowohl an etlichen<br />
Niststätten als auch an Baumstämmen. Jetzt<br />
kann man mit etwas Glück das hübsche Taubenschwänzchen<br />
(Macroglossum stellatarum) wie<br />
einen Kolibri schwirrend vor den Geißblattblüten<br />
in der Luft stehen sehen. Als Nachtfalter ist<br />
das Taubenschwänzchen aber auch recht tagaktiv.<br />
Als gute Vermehrungsmöglichkeit des Nashornkäfers<br />
(Oryctes nasicornis) wurde im <strong>Kurpark</strong><br />
ein mehrere Quadratmeter großer Haufen<br />
aus Schreddermaterial angelegt. Das Ergebnis<br />
übertraf unsere kühnsten Erwartungen! Hier<br />
entwickelten sich die bis zwölf Zentimeter langen<br />
Larven in sehr großer Anzahl. Dies merkten<br />
Grünspechte, Dachs und Wildschweine rasch.<br />
<strong>Der</strong> Schredderhaufen sah nach deren Nahrungsuche<br />
nach solcherart Delikatessen gründlich<br />
umgeackert aus. Erstaunlicherweise schlüpften<br />
dann trotzdem noch unbeschadet eine ganze Anzahl<br />
von Nashornkäfern aus. <strong>Der</strong> schöne, glänzend<br />
kastanienbraune Grosskäfer wird jetzt wieder<br />
alljährlich nachgewiesen.<br />
Mit den Insekten ging es nach 1993 im <strong>Kurpark</strong><br />
überhaupt steil aufwärts. Nach Schaffung<br />
und Bepflanzung der Offen-Biotope trat eine<br />
Einwanderungswelle zahlreicher licht- und wärmeliebender<br />
Arten ein. Weniger auffallend, aber<br />
deutlich zunehmend, eroberten etliche Feldheuschrecken-Arten<br />
das neue Terrain. Sie wiederum<br />
sind begehrte Nahrungstiere für Vogelarten des<br />
<strong>Kurpark</strong>s. Besonders erstaunt sind die <strong>Kurpark</strong>-<br />
Besucher oft über die auffallend zahlreichen<br />
Hummeln, Honig- und Wildbienen insbesondere<br />
zwischen blühenden Thymian-Polstern.<br />
Hier wie auch über dem Steingartenhügel und<br />
den Trockenrasen gaukeln und segeln bunt und<br />
vielfältig zahlreiche Tagfalter-Arten. Besonders<br />
bunt gefärbte, auffallend große und z. T. auch seltenere<br />
Schmetterlingsarten wie Admiral, Trauermantel,<br />
Schwalbenschwanz und Kaisermantel<br />
sind vertreten.<br />
Von den Greifvögeln kreist und rüttelt im<br />
Flug jetzt häufig der Turmfalke über den neuen<br />
Offen-Biotopen bei der Nahrungssuche. Er erbeutet<br />
meist Mäuse.<br />
Die neu errichteten Ökoteiche sind ebenfalls<br />
eine gern von Tieren genutzte Bereicherung im<br />
<strong>Kurpark</strong> und bereichern das Landschaftsbild. Einerseits<br />
sind sie alljährlich genutztes Laichgewässer<br />
für die Erdkröte, andererseits trinken und<br />
baden hier sehr zahlreiche Vogelarten. Auch die<br />
Eichhörnchen stillen hier ihren Durst.<br />
Zum Artenerhalt und zur Wiederansiedlung von<br />
Tieren werden gezielt Bäume mit Baumhöhlen<br />
erhalten. Hier brüten Spechte, Kleiber, Meisen<br />
u. a. Höhlenbrüter. Mehrere Höhlenbäume sind<br />
z. Z. mit Fledermäusen besetzt.<br />
Günstig ist der Umstand, dass der <strong>Kurpark</strong><br />
nicht umzäunt ist. Somit sind ein Artenaustausch<br />
und eine Artenzuwanderung aller Tierarten<br />
ungehindert möglich.<br />
<strong>Der</strong> Park ist für Wildtiere im wahrsten Sinne<br />
des Wortes offen. In bestimmten Bereichen des<br />
Parks wurden keine Bänke aufgestellt, um für<br />
Rehwild u. a. Tiere Ruhezonen zu erhalten.<br />
<strong>Der</strong> Hallimasch ziert den urigenStamm eines Eschen-Ahorns · Foto: Karl-Heinz Wollenberg;<br />
Im <strong>Kurpark</strong> ist der Tisch für den Kleibernachwuchs reich gedeckt · Foto: Wolfgang Klaeber
Einige Gestaltungs-Grundsätze<br />
Grundsätzlich geschützt bleiben die schönen<br />
Efeu-Teppiche am Waldboden und die herrlichen<br />
Efeu-Behänge auf den Bäumen des Parks.<br />
Wichtig ist die naturnahe Gestaltung dieser<br />
Parkanlage. Umgestürzte Bäume außerhalb der<br />
Wege werden belassen. Sie werden meist ebenfalls<br />
vom Efeu oder anderen Rankgewächsen<br />
überwachsen. Werden sie endgültig morsch, verrotten<br />
die Stämme zu Holzmulm für die nächste<br />
Waldgeneration. Stehende Totbäume an Wegrändern<br />
werden so eingekürzt, dass nur noch<br />
Stümpfe übrigbleiben.<br />
Zur Gestaltung und zur Vermehrung des floristischen<br />
Artenreichtums wurden bevorzugt stark<br />
mit Dornen und Stacheln besetzte Gehölze gepflanzt.<br />
Hierbei handelt es sich um Weißdorne,<br />
Schlehdorn, Feuerdorne, Berberitzen, Wild- und<br />
Strauchrosen. Gleichzeitig sind sie ausgezeichnete<br />
Brutgehölze für zahlreiche Heckenbrüter<br />
und Bodenbrüter, zumal sie durch ihre starke<br />
Bewehrung Katzen und andere Vogelfeinde fernhalten.<br />
Die genannten Arten blühen und fruchten<br />
sehr reichlich. Die Früchte dieser Gehölze wie-<br />
derum bilden eine wichtige Herbst- und Winternahrung<br />
für heimische und durchziehende<br />
Vogelarten.<br />
Die immergrünen Berberitzen, Feuerdorne,<br />
Mahonien, Buchsbäume und Stechpalmen bereichern<br />
den Park im Winterhalbjahr durch ihre<br />
schönen, glänzenden Blätter.<br />
Als Nahrungsquelle für besonders frühzeitig<br />
im Jahr erscheinende Insekten wurden Winterjasmin<br />
( Jasminum undiflorum) und zahlreiche<br />
Kornelkirschen (Cornus mas) im <strong>Kurpark</strong> eingebracht.<br />
■<br />
<strong>Der</strong> <strong>Kurpark</strong> ist ganzjährig zugänglich.<br />
Besondere Blühaspekte sind im Frühjahr die<br />
blühenden Wildobstgehölze. Im Sommer<br />
sind es die farbenprächtig blühenden Thymian-Teppiche<br />
mit ihrem Duft. Im August<br />
blüht leuchtend die Besenheide. Im Herbst<br />
tragen viele Gehölze ihre bunten Früchte.<br />
Auch leuchtet das Herbstlaub an Sträuchern<br />
und Bäumen.<br />
Lieber Leser, besuchen auch Sie einmal den<br />
<strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong> zur Erholung!