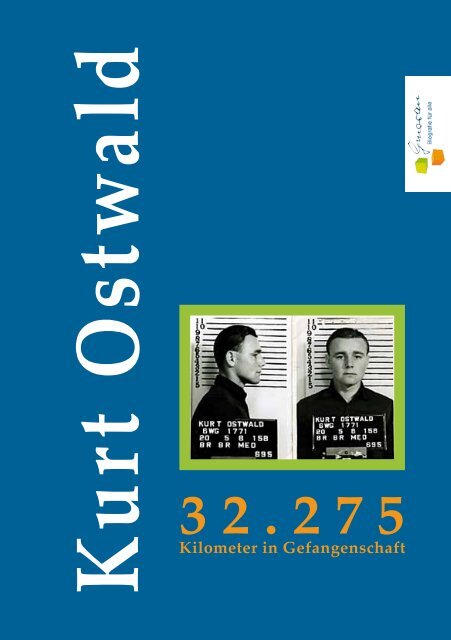Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong><br />
32.275<br />
Kilometer in Gefangenschaft
<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong>: 32.275 Kilometer in Gefangenschaft<br />
Eine Biografie
<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong>:<br />
32.275<br />
Kilometer in Gefangenschaft<br />
Eine Biografie
31. August 2012<br />
© <strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong>, 2012<br />
<strong>Gurran</strong> - Biografie für alle<br />
http://kurt-ostwald.gurran.eu/<br />
Lektorat: Andreas Trunschke<br />
Einbandgestaltung: Andreas Trunschke<br />
Satz: Andreas Trunschke<br />
Druck und Binden: Kuss GmbH, Potsdam
Kindheit in armen Verhältnissen (1923 – 1934)<br />
Geburt, Jugendjahre und Familie<br />
Am 31. August 1923<br />
wurde ich in Werdershof<br />
bei Schlagenthin geboren.<br />
Es war und ist<br />
auch heute noch ein<br />
kleines Kaff hinter<br />
Vehlen, etwa einen<br />
Kilometer hinter der<br />
damaligen und heutigen<br />
Landesgrenze<br />
von Brandenburg zu<br />
Gutshof Werdershof<br />
Sachsen-Anhalt. Also bin ich kein Brandenburger, sondern<br />
ein Anhaltiner.<br />
Meine Eltern Walter und Frieda <strong>Ostwald</strong>, meine Großeltern<br />
Marie und Karl Goldbach, meine Tante Hilde und mein<br />
Onkel Willi, beide<br />
Goldbach, arbeiteten<br />
alle auf dem Gut<br />
„Rodewald“ als Tagelöhner.<br />
In diesem Dorf<br />
(!!!!) gab es noch vier<br />
Kleinbauernhöfe und<br />
das Tagelöhnerhaus<br />
des Gutes, das ca. 300<br />
Meter entfernt stand,<br />
Geburtsstätte Gesindehaus<br />
und in dem meine<br />
Familie lebte und<br />
wohnte. Das Dorf war idyllisch gelegen, umgeben von Wald,<br />
Wiesen und Feldern. Von der Idylle konnten wir nicht leben,<br />
5
denn die Jahre 1923/24 waren Inflationsjahre, und das Geld<br />
war keinen Pfifferling wert.<br />
Die Not machte erfinderisch. Nach den überlieferten Erzählungen<br />
meiner Familie wurden sogar die Kartoffelschalen gekocht,<br />
durch ein Sieb geseiht, mit Zucker gesüßt - und fertig<br />
war die Flasche für mich. Im Winter 1923/24 wurde ich an<br />
besonders kalten Tagen in die Bratröhre des Kachelofen gelegt<br />
und so warm gehalten.<br />
Umzug nach Brandenburg a.d.H.<br />
1924 zog die gesamte Familie Brandenburg an der Havel.<br />
Trotz der Wohnungsnot bekamen meine Eltern in der Große<br />
Gartenstraße 8, Hinterhof, erste Etage eine Wohnung. Oma<br />
Marie und Opa Karl sowie Tante Hilde und Onkel Willi zogen<br />
in das Deutsche Dorf 4. In den Jahren 1925 und 1928 wurden<br />
mein Bruder Gerhard und meine Schwester Ingeborg geboren.<br />
Für uns fünf Personen waren die ca. 25 qm, eine Stube und<br />
eine Küche, zwar ziemlich beengt, für damalige Verhältnisse<br />
und unseren Klassenstand jedoch normal.<br />
Meine frühesten erhaltenen Erinnerungen gehen zurück auf<br />
das Jahr 1928/29. Ich erinnere mich daran, dass mich mein<br />
Vater mit zur Arbeit nahm. Er arbeitete als Kutscher bei der<br />
Speditionsfirma „Taege“ in der Steinstraße. Wenn ich am Tage<br />
bei ihm bleiben durfte, erlaubte er es mir, auf dem Kutschbock<br />
mitzufahren und als besonderes Erlebnis auch die Zügel<br />
zu halten. Mein Vater war ein ruhiger, ausgeglichener Mann.<br />
Für mich ein guter Vater. Wir Kinder bekamen nie Schläge,<br />
höchstens hin und wieder einen kleinen „Katzenkopf“. Dass<br />
soll ja bekanntlich das Denkvermögen anregen.<br />
6
Hungerhahn und Kommunisten<br />
Als mein Vater Anfang 1930 arbeitslos wurde, krähte so einige<br />
Male der Hungerhahn bei uns zu Hause. Mein Vater war<br />
ein solider Mann. Er rauchte und trank nicht und ließ sich<br />
so manches einfallen, damit dem Hungerhahn wenigsten<br />
hin und wieder der Schnabel gestopft werden konnte. Einige<br />
Male nahm er mich mit auf „Fechttour“. Das hieß, wir fuhren<br />
über die Dörfer, gingen von Tür zu Tür, klopften und bettelten<br />
bei den Bauern um Lebensmittel. Mein Vater bot sich dabei<br />
an, Arbeiten für Lohn zu verrichten. Einige Bauern gaben ihm<br />
Arbeit, andere jagten ihn fort. Ich lernte bei diesen Klopftouren<br />
das Verhalten der unterschiedlichsten Menschen in guten wie<br />
auch in schlechten Zeiten kennen. Wenn wir zwei Dörfer<br />
abgeklappert hatten, war meistens der Rucksack voll mit<br />
Kartoffeln, Brot, Schlackwurststullen und ab und zu sogar<br />
mit ein paar Eiern.<br />
1930 bekam mein Vater Arbeit als Gleisbauarbeiter bei der<br />
Deutschen Reichsbahn in Brandenburg. Die Gleise in der<br />
Rotte, so nannte man eine Gruppe Gleisbauarbeiter, zu<br />
setzen, war eine schwere körperliche Arbeit. Wenn er nach 10<br />
Stunden Arbeit nach Hause kam und am Abendbrottisch saß,<br />
fiel ihm der Kopf vor Müdigkeit beinahe in den Teller. Meine<br />
Mutter war eine junge, lebenslustige Frau und wollte immer<br />
gern tanzen gehen. Aber mein Vater war zu kaputt, und<br />
deshalb kam es oft zu Streitigkeiten.<br />
Neue Wohnung, eigenes Kinderzimmer<br />
Die Wohnung wurde zu eng. Fünf Personen in einem so kleinen<br />
Haushalt waren einfach nicht mehr erträglich. Wir hatten<br />
Glück und bekamen eine Wohnung in der Neustätter Wassertorstr.<br />
6. Ein riesiges Zimmer, das zugleich als Wohn- und<br />
Schlafstätte diente, zwei kleine Kammern und eine Küche.<br />
7
Endlich hatten wir Kinder ein eigenes Zimmer, und ich musste<br />
nicht mehr bei Dunst und Küchengeruch schlafen.<br />
Die Wohnung hatte auch noch einen weiteren Vorteil. Wir<br />
wohnten jetzt ganz in der Nähe von meiner Oma, denn unser<br />
Hof hatte auch einen Ausgang in Richtung „Deutsches Dorf“.<br />
So konnte ich, wann immer ich wollte, Oma einen kurzen<br />
Besuch abstatten. Wenn ich dort war, gab es außer lieben Worten<br />
immer etwas zu futtern. Für mich war ein Besuch bei ihr<br />
immer aufregend und etwas ganz Besonderes.<br />
Mein Vater begann mit der Aufzucht von Kanarienvögel, was<br />
zur Folge hatte, dass eine Wand des Wohnzimmers voller<br />
kleiner Zuchtkäfige war. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele<br />
es waren, denn ich habe sie nie gezählt. Die Jungvögel<br />
wurden an Interessenten oder an die Zoohandlung „ Piekowski“<br />
verkauft.<br />
An den Abenden saßen meine Eltern nach dem Abendbrot<br />
beim Schein der Gaslampe am Wohnzimmertisch und pinselten<br />
kleine Lineolsoldaten für die Spielzeugfabrik „Wiederholz“<br />
an. So verdienten sie für die Familie ein Zubrot, das dem<br />
Haushalt und somit uns Kindern zugute kam.<br />
Einschulung<br />
Im April 1930 wurde ich eingeschult. Das ließ sich meine Oma<br />
nicht nehmen. Sie übernahm für ihren ersten Enkel die finanziellen<br />
Kosten der Einschulung, einschließlich Anzug und<br />
Tüte. Auch Oma putzte sich heraus, mit langem Rock,<br />
Rüschenbluse und Kompotthut, einem Hut in Obstform. Stolz<br />
ging ich an Omas Hand. Hinter uns die Eltern und Geschwister.<br />
Ich wurde in die weltliche Schule am Katharienkirchplatz eingeschult.<br />
An dieser Schule gab es keinerlei körperliche Züchtigung<br />
und auch keinen Religionsunterricht.<br />
8
Meine Oma war im „Deutschen Dorf“ bekannt als “rote<br />
Marie“ bekannt. Sie war Mitglied der Kommunistischen Partei<br />
Deutschlands KPD und in der „Roten Hilfe“ als Sanitäterin<br />
tätig. Bei Aufmärschen von Parteien, vor allem der Nazis, der<br />
SPD oder der KPD fanden immer Straßen- und Saalschlachten<br />
statt. Und so blieb es nicht aus, dass es bei den von ihr<br />
betreuten KPD-Anhängern immer zu Blessuren und starken<br />
Beulen kam. Oma verarztete sie alle und gab nicht nur<br />
tröstende Worte. Meist bekam auch jeder, der behandelt wurde,<br />
außerdem eine Stulle oder Suppe zur Stärkung. Meine Oma<br />
war eine hilfsbereite und gutmütige Frau. Mein Großvater<br />
dagegen hielt sich aus allem raus.<br />
Die Jahre 1930 bis 1933 bis zur Machtübernahme durch Hitler<br />
waren politisch sehr unruhige Jahre und durch Arbeitslosigkeit<br />
geprägt. Durch die Sanitätertätigkeit meiner Oma lernte<br />
ich einige Funktionäre der Brandenburger KPD persönlich<br />
kennen. Später sollten einige von ihnen auch wichtige Funktionen<br />
in der Aufbauphase nach dem Krieg und in den jungen<br />
Jahren der DDR bekleiden. So unter anderen Max Herm<br />
(1. Bürgermeister der Stadt Brandenburg nach 1945), Robert<br />
Fremde (in der Aufbauzeit nach 1945 Personalleiter des Stahl-<br />
und Walzwerkes Brandenburg), Rudi Märksch (Angestellter<br />
der Stadtverwaltung) und „Schiefkopf“ Hamann (Personalleiter<br />
der Thälmannwerft nach 1945).<br />
Sozialer Abstieg<br />
Die ersten Schuljahre bis 1934 verliefen ohne erwähnenswerte<br />
Ereignisse. Erwähnenswert aus dieser Zeit sind jedoch unsere<br />
familiären Veränderungen.<br />
In einer Märznacht im Jahr 1932 wurde ich durch ein Streitgespräch<br />
meiner Eltern wach. Mein Vater packte einige Sache<br />
in einen Karton, nahm meinen jüngeren Bruder Gerd bei der<br />
9
Hand und sagte: „Frida, ich habe die Schnauze voll. Ich gehe<br />
nach Lippspringe zu meiner Mutter. Der Große (damit meinte<br />
er mich) kann dich ja später ernähren.“ Meine Eltern trennten<br />
sich, und aus war es mit der schönen Wohnung, dem eigenen<br />
Zimmer, den Kanarienvögeln und dem Bemalen der Lineolsoldaten.<br />
Der soziale Abstieg begann mit dem Umzug in einen Sozialbau,<br />
wo „die Miete mit einem Revolver“ kassiert wurde. Mit<br />
diesem Spruch bezeichneten die Brandenburger die Verhältnisse<br />
in den Sozialwohnungen der Stadt. Diese Sozialwohnungen<br />
gab es an drei Standorten in Brandenburg.<br />
Ich war knapp zehn Jahre alt, als wir dort einzogen, und<br />
noch heute beschleicht mich Unbehagen, wenn ich an diese<br />
Wohnung denke. Es war eine der schlimmsten Zeiten meiner<br />
Jugend. Im späteren Verlauf meiner Entwicklung bekam ich<br />
immer wieder auf die eine oder andere Weise zu spüren, dass<br />
ich einst dort wohnte.<br />
Der Sozialbau war eine ehemalige Zigarettenfabrik in der<br />
Karl-Legien-Straße, heute Venise-Gosnat-Str. Rings um die<br />
Fabrik war alles Ackerland, und es gab nur einen Zugangsweg<br />
zum Gebäude. Die Fabrik selbst war ein alter Klinkerbau.<br />
Die uns darin zugewiesene Wohnung bestand aus einem<br />
großen und sehr hohen Raum mit hohen, breiten Fenstern<br />
aus Winkelrahmen, die in kleine Scheiben unterteilt waren.<br />
Die wenigen Möbel, die wir besaßen, wirkten verloren. Alles<br />
in allem, war es eine unwirtliche, ungemütliche und kalte<br />
Wohnung. Auch das gesamte Umfeld machte das Leben dort<br />
für mich unerträglich.<br />
In dem ehemaligen Fabrikhaus lebten ca. 40 Familien mit<br />
vielen Kindern. Der lange Gang war ständig getränkt von<br />
unerträglichem Gestank, der vom Hof hereindrang, auf dem<br />
sich die Fallklosetts für die Bewohner befanden. Ich fühlte<br />
10
mich dort elendig und hatte nur den einen Wunsch, so schnell<br />
wie es irgend ging von diesem Ort fort zu kommen.<br />
Da meine Mutter in keinem Arbeitsverhältnis<br />
stand, wurden wir<br />
zu Sozialempfängern. Aber auch<br />
wenn das Geld selten für mehr<br />
als das Nötigste reichte, so erinnere<br />
ich mich an zwei Leistungen, die<br />
mir als Kind sehr gut gefielen.<br />
Das eine war die Tatsache, dass<br />
ich als Sozialkind täglich in der<br />
Schule Anrecht auf eine Flasche<br />
Milch bzw. wahlweise Kakao<br />
hatte. Zum anderen gab es jeden<br />
Tag eine Streuselschnecke. Dass<br />
Leben konnte also auch soooo<br />
Meine Mutter<br />
gut sein!<br />
Zweimal wöchentlich ging meine Mutter mit uns Kindern in<br />
eine Suppenküche in der Grabenstraße. Mit diesen Lebensumständen<br />
waren wir in der damaligen Zeit kein Einzelfall.<br />
Um Anspruch auf Leistungen zu bekommen, musste meine<br />
Mutter zweimal wöchentlich in das Sozialamt in der Magdeburger<br />
Straße. Dieses Amt befand sich in einem schmucklosen,<br />
roten Klinkerbau, der währen des 2. Weltkrieges bei<br />
Kampfhandlungen um die Stadt zerstört wurde. An dieser<br />
Stelle steht heute das Ehrenmal für die Opfer des Faschismus.<br />
Geschenk des Himmels<br />
Es ergab sich, dass meine Mutter eines Tages zufällig unseren<br />
ehemaligen Vermieter der Wohnung in der Großen Gartenstraße<br />
in der Stadt traf. Ein Gespräch zwischen den beiden<br />
ergab, dass eine Wohnung in der Großen Gartenstraße frei<br />
11
war, allerdings auf dem Hinterhof und im Parterre. Ein<br />
Geschenk des Himmels, nach dem wir griffen. Ein großer<br />
Planenwagen wurde beim Kohlenhändler „Venske“ ausgeliehen,<br />
und die ganze Familie half beim Umzug mit. Weihnachten<br />
1933 feierten wir das erste Weihnachten in dieser Wohnung.<br />
Im Gegensatz zur Sozialwohnung war diese Wohnung klein,<br />
aber gemütlich und sauber. Das eine Zimmer war Wohn- und<br />
Schlafraum zugleich. Zwei Betten, Vertiko, Schrank, Sofa und<br />
Tisch gingen gerade so rein. Mein Bett stand in der Küche unter<br />
dem Fenster. Wieder Küchengeruch und feuchter Dunst. Aber<br />
ich war dennoch zufrieden, denn ich hatte mein eigenes Bett.<br />
Das Leben hatte für meine Mutter nicht viel zu bieten, und so<br />
suchte sie Abwechslung und Unterhaltung in Vergnügungsgaststätten.<br />
Sie ließ nur selten eine der Tanzveranstaltungen<br />
ausfallen, die jeweils am Mittwoch und Freitag stattfanden.<br />
Von einer dieser „Vergnügen„ brachte sie das Unheil Namens<br />
Alfred Bergemann mit.<br />
Das Unheil namens Bergemann<br />
Er war einer dieser Menschen, bei dem das äußere Erscheinungsbild<br />
dem Charakter entsprach. Unangenehm!!!<br />
Er war ein Mann von kleiner Gestalt mit einem sogenannten<br />
Menjou-Bärtchen. Für mich das ekelhafteste an ihm waren<br />
seine Tätowierungen, die den gesamten Körper bedeckten.<br />
Wir Kinder bezeichneten ihn als kleinen Erdnuckel. Er blieb<br />
gleich am ersten Abend, und ich ahnte zu diesem Zeitpunkt<br />
nicht, dass er die Zukunft meines weiteren Lebens maßgeblich<br />
mitgestalten würde.<br />
Ich war erst zehn Jahre alt, und die Welt der Lust, der<br />
Begierde, des Sex und der Erotik waren mir völlig fremd. In<br />
dieser ersten Nacht, in der er bei uns blieb, wurde ich durch<br />
12
ein Stöhnen, das immer lauter wurde, geweckt. Ich dachte, er<br />
würde meine Mutter umbringen und verkroch mich völlig<br />
verängstigt unter meiner Bettdecke. Am nächsten Morgen<br />
saßen beide, zu meinem großen Erstaunen, heiter und vergnügt<br />
beim gemeinsamen Frühstück. Ich hatte nicht verstanden,<br />
was vorgefallen war, aber ich hatte verstanden, dass ich ihn<br />
nicht mochte. Denn ich ahnte wohl schon an diesem ersten<br />
Morgen, dass er meiner Mutter und unserer Familie nicht gut<br />
tun würde. Irgendwie spürte ich ebenso ganz deutlich, dass<br />
auch er mich eher duldete als mochte.<br />
Im Jahr 1934 wurde meine Halbschwester Margitta und ein<br />
Jahr später, 1935, mein Halbbruder Alfred geboren, den aber<br />
alle Heiner nannten. Zum Zeitpunkt der Geburt Margittas<br />
war meine Mutter noch nicht von meinem Vater Walter <strong>Ostwald</strong><br />
geschieden. Deshalb bekam sie nach damaligem BGB-<br />
Recht auch den selben Nachnamen. Als Alfred jedoch geboren<br />
wurde, war meine Mutter schon eine geschiedene Frau und<br />
nach geltendem Recht bekam er den Mädchennamen meiner<br />
Mutter, Hartmann. Somit war Margitta ein eheliches und<br />
Alfred ein uneheliches Kind. Heiner war ein ruhiger, stiller<br />
Junge, den ich als meinen Bruder voll anerkannte.<br />
In der Wohnung wurde es zu eng. Wir waren nun sechs<br />
Personen, und Konflikte waren unausweichlich. Es kam oft<br />
zu Streitereien zwischen Bergemann und meiner Mutter. Im<br />
Gegensatz zu meinem Vater Walter <strong>Ostwald</strong>, der, wie bereits<br />
beschrieben, ein ruhiger und sanftmütiger Mann war, neigte<br />
Bergemann zu Wutausbrüchen und Gewaltattacken gegen<br />
meine Mutter. Nicht selten war eines ihrer Augen durch ein<br />
Hämatom zugeschwollen. Bergemann trank immer öfter.<br />
Besonders an Tagen, an denen es Geld gab. Es war widerlich<br />
mit ansehen und anhören zu müssen, welche hässlichen Szenen<br />
sich zu Hause abspielten.<br />
13
Das Schicksal war etwas gnädig, denn Bergemann stahl<br />
gemeinsam mit einem Kumpanen Kleinvieh und diverse andere<br />
Dinge. Kurz nach Heiners Geburt wurde er verhaftet und<br />
ging für zwei Jahre in das Zuchthaus Brandenburg.<br />
14
Jugend zwischen Prügel und Jungenstreichen<br />
(1934 – 1938)<br />
Schule und Prügel<br />
Rückblickend möchte ich noch erwähnen, dass im April 1934<br />
die weltliche Schule, die ich bis dahin besuchte, geschlossen<br />
wurde. Meine neue Schule, die Rochow-Schule, war ganz in<br />
der Nähe unserer Wohnung in der kleinen Gartenstraße. Trotz<br />
des nun so kurzen Schulweges war diese Schule keine Verbesserung.<br />
Denn während es an der weltlichen Schule keine Züchtigungen<br />
gab, gehörten sie in der Rochow-Schule zum Alltag.<br />
Ich war ein aufgeweckter Junge voller Energie und Neugierde<br />
auf das Leben. Es entspräche nicht meinem Weltbild, wenn<br />
ich an dieser Stelle sagen würde, ich hätte die Prügel verdient,<br />
aber die Lehrer hatten zumindest meist einen Grund für die<br />
Prügel. Meinem Klassenlehrer kam mein Temperament gelegen,<br />
denn so konnte er legal seine Fehde gegen mich führen. Der<br />
Grund dieser Fehde und meines Widerstandes, lag im Religionsunterricht<br />
und meiner weltlichen Haltung gegenüber dem<br />
lieben Gott begründet. In der weltlichen Schule gab es, wie<br />
der Name beinhaltet, keinen Religionsunterricht, und auch zu<br />
Hause genoss ich keine christliche Erziehung. Somit wusste ich<br />
nicht viel über Gott und kannte keines der zehn Gebote.<br />
Für große Unkenntnis gab es oft etwas mit dem Rohrstock<br />
übers Kreuz, und für kleine Irrungen wurde zumindest an den<br />
Haaren hinter den Ohren gerissen. Gewalt war in meiner späten<br />
Kindheit und frühen Jugend täglich gegenwärtig. Wenn man<br />
diese perfide Gewalt gegenüber Schwächeren dennoch mit<br />
Humor betrachtet, so waren die Schläge und Schikanen in der<br />
Schule ein solides Härtetraining für zu Hause. Meine Mutter,<br />
die, seit Bergemann im Zuchthaus war, für uns Kinder allein<br />
sorgen musste, war offensichtlich überfordert und eine harte<br />
15
Frau geworden. Schon für Kleinlichkeiten bekam ich von ihr<br />
Schläge, und nicht selten nahm sie ein loses Schemelbein aus<br />
Holz und verprügelte mich damit.<br />
Mein Jugendfreund Heiner<br />
Das erste Jahr in der Rochow-Schule war auch insofern<br />
schwer für mich, weil ich von meinen Mitschülern noch als<br />
„Fremdkörper“ angesehen wurde. Um akzeptiert zu werden,<br />
musste ich mich der Disziplin und dem Gruppengeist<br />
unterwerfen. Der Schulalltag bestimmte mein Leben. Ich<br />
hatte mich eingelebt, aber Freunde hatte ich noch keine. Doch<br />
das sollte sich bald ändern. Nach Schulschluss ließ ich mir<br />
immer Zeit auf dem Heimweg. Eines Tages bog ich in eine<br />
Nebenstrasse ein, in der ich zuvor immer eine Gruppe Jungen<br />
hatte spielen sehen. Es wurde Schlagball gespielt, Leute sahen<br />
uns aus den Fenstern zu, spendeten sogar Beifall, wenn ein<br />
Schlag gut gelungen war. Ich spielte einfach mit. Aber da ich<br />
nicht willkommen war, musste ich viele Schläge einstecken.<br />
Einer dieser Jungen ging in meine Klasse. Als wir eines Tages<br />
auf dem Heimweg waren, kamen wir fürchterlich ins Streiten.<br />
Erst wurde der Streit mit dem Mund und später mit den Fäusten<br />
ausgetragen. Erst ein Mann trennte uns und gab jedem eine<br />
Backpfeife. So war dass damals. Wir wurden danach die besten<br />
Freunde, Heiner Lotsch und ich.<br />
Beide blieben wir in der 6. Klasse sitzen, beide erlernten wir<br />
nach der Schule den Beruf des Metall-Formers, und vor allem<br />
liebten wir beide den Radsport.<br />
Frida Kiwitt<br />
Wirtschaftlich ging es unserer Familie schlecht. Der Bergemann<br />
saß hinter Gittern, und meine Mutter bekam Sozial-<br />
16
unterstützung. Eine Zeitlang hat sie auch mal bei Lumpen-<br />
Müller in der Bauhofstraße Lumpen sortiert und Papier<br />
gebündelt. Bei einem Bauern in der Brielower Straße hat sie<br />
bei der Kartoffelernte gerackert, wobei ich mithelfen musste.<br />
Pro Sack Kartoffeln bekamen wir einen Hungerlohn von 0,23<br />
Reichsmark (RM).<br />
Immer wenn Mutter diversen Aushilfsarbeiten nachging,<br />
passte Frida Kiwitt auf meine Geschwister auf. Ich meinerseits<br />
nutzte diese Zeit, um mit meinen Kumpels herumzustromern.<br />
Frida Kiwitt war eine Seele von Mensch, und ihre Beziehung<br />
zu unserer Familie resultierte aus einer Nachbarschaft nach<br />
unserem Umzug aus Werdershof nach Brandenburg. Sie war<br />
eine gutmütige und warmherzige Frau, mit der es die Natur<br />
aber nicht gut gemeint hatte. Sie musste einen Buckel auf der<br />
linken Seite mit sich herumtragen und war somit immer Zielscheibe<br />
des Gespöttes der Leute, vor allem der Kinder.<br />
Ich habe diese kleine freundliche Frau gerngehabt. Wenn ich<br />
mal nicht parierte, dann stürmte sie immer mit dem Teppichklopfer<br />
hinter mir her, ohne die geringste Chance, mich hinter<br />
den Bettgestellen, hinter denen ich mich versteckte, zu<br />
erreichen. Aber sie war nie lange böse auf mich und nannte<br />
mich immer zärtlich „ihren Großen“. So nannten mich alle in<br />
der Familie.<br />
Obwohl sie eine kleine Frau mit Handicap war, hatte sie ein<br />
mutiges Herz. Ich erinnere mich deutlich daran, dass sie sich<br />
einmal schützend vor mich stellte, als Bergemann mich wieder<br />
einmal schlagen wollte. Sie stellte sich nicht nur dazwischen,<br />
sie ging den Schläger auch an wie eine Katze. Für diesen Mut<br />
hatte sie meinen ganzen Respekt.<br />
17
Lebensgefährliche Erkrankung<br />
Im Juli 1935 erkrankte ich schwer an einer doppelseitigen<br />
Lungenentzündung. Mutter holte Dr. Milatz, mittlerweile ein<br />
zackiger, strammer SS-Mann. Aber er konnte mir nicht helfen,<br />
denn die von ihm verordneten Pillen zeigten keine Wirkung.<br />
Die Situation war ernst, und ich denke, es bestand tatsächlich<br />
Lebensgefahr für mich, denn mittlerweile war ich schon einige<br />
Tage bewusstlos. Als meine Oma kam, war sie entsetzt<br />
über meinen Zustand. Sie führte ein kurzes, resolutes Gespräch<br />
mit meiner Mutter, in dem es darum ging, unseren langjährigen<br />
Hausarzt Dr. Löwenthal zu ordern. Meine Mutter hatte jedoch<br />
starke Bedenken, denn Dr. Löwenthal war Jude, und die Hetze<br />
gegen Juden war beängstigend. Für meine Oma zählte dies<br />
alles nicht. Zum einen war ihr Enkel schwer krank, und zum<br />
anderen war Dr. Löwenthal ein guter Arzt und Mensch.<br />
Als meine Oma mit Dr. Löwenthal kam, bekam ich wohl eine<br />
große Spritze in die Lendenseite. Allerdings konnte er meiner<br />
Mutter keine großen Hoffnungen machen, dass ich das alles<br />
überleben würde. Aber er kam in dieser Nacht nochmals<br />
nach mir sehen und ebenfalls in den drei darauf folgenden<br />
Tagen. Nach drei Tagen war die Krise überstanden, und Dr.<br />
Löwenthal meinte, dass er schließlich meine Halbgeschwister<br />
auf die Erde geholt hat, da wäre es doch Unsinn, wenn gerade<br />
ich in den Himmel müsste.<br />
Meine Genesung ging nur sehr langsam voran, denn es gab<br />
immer zu wenig und zu nährstoffarmes Essen. Gute Tage<br />
waren es immer, wenn ich vom Schlächter Wehe von der gegenüberliegenden<br />
Straßenseitefür 0,30 RM Zippelwurst holen<br />
konnte. Dann gab es reichlich Wurst auf der Stulle. Auch bei<br />
Oma staubte ich hin und wieder ein wenig Essen ab, obwohl<br />
sie arbeitslos war und selber nicht viel hatte.<br />
18
Zur Kur beim Förster in Schlesien<br />
Völlig überraschend stand eines Tages eine Frau von der NS-<br />
Frauenschaft vor unserer Tür und teilte meiner Mutter mit,<br />
dass ich einen Kurplatz zur Erholung in Schlesien bei einer<br />
Försterfamilie bekommen hatte. Ich war dreizehn Jahre alt,<br />
und diese Kur war ein Segen für meine Entwicklung. Meine<br />
Mutter kümmerte sich kaum noch um mich, und so war ich<br />
für mein Alter ein sehr selbständiger Bursche. Einen Koffer<br />
besaßen wir nicht, und meiner Mutter war es offensichtlich<br />
egal, wie ich nach Schlesien kommen würde. So organisierte<br />
ich gemeinsam mit meiner Oma, die sich im Gegensatz zu<br />
meiner Mutter um mich sorgte, einen stabilen Karton in den<br />
meine Kleidung verstaut werden konnte.<br />
Die Fahrkarten hatte ich per Post zugeschickt bekommen, und<br />
so machte ich mich mit meinen dreizehn Jahren allein auf die<br />
Bahnreise nach Schlesien. Angst hatte ich keine. Da war nur<br />
Freude, Spannung und Neugierde auf das, was mich erwarten<br />
würde. Und da war ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl, der<br />
Armut und Not zumindest für eine kurze Weile entfliehen zu<br />
können.<br />
Nach vielen anstrengenden aber auch spannenden Stunden<br />
Zugfahrt war ich in dem kleinen Ort Neudorf angekommen.<br />
Ein Einspänner, an dem ein freundliches Ehepaar in mittleren<br />
Jahren stand, wartete bereits am Bahnhof auf mich. Die Frau<br />
des Försters, winkte mir aufmunternd zu. Als ich näher kam<br />
schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und sagte mitleidig:<br />
„Ja, wie siehst du denn aus?! Da haben wir ja ganz schön<br />
was zu füttern!“ In dieser wohligen und so augenscheinlich<br />
satten Umgebung stellte ich mir erstmalig die Frage: „Ja, wie<br />
sah ich denn aus?“ Dünne Arme, dünne Beine, und der Kopf<br />
war größer als meine Schultern breit.<br />
19
Das Ehepaar Krafzyk mochte ich von Beginn an, und es dauerte<br />
nur wenige Momente, bis wir uns gegenseitig ins Herz<br />
geschlossen hatten. Die Försterei lag etwa zwei Kilometer<br />
außerhalb des Dorfes, und die Aufregung und Spannung<br />
stieg ins Unermessliche, als mir Frau Krafzyk das Zimmer<br />
zeigte, dass für vier Wochen mir ganz allein gehören sollte.<br />
Ein eigenes Zimmer, MEIN Zimmer!!! Ein Zimmer ohne<br />
Küchendunst und ohne abgestandenen Essengeruch. Vor allem<br />
aber ein weiches, weißes Daunenbett, ganz ohne Klumpen, in<br />
wie meinem zu Hause in der Küche. Kurz vor dem Abendessen<br />
kam Herr Krafzyk in mein Zimmer. Er unterhielt sich<br />
sehr freundlich mit mir, stellte viele Fragen und erklärte mir<br />
dann geduldig, was er mit mir in der Zeit meines Aufenthaltes<br />
gemeinsam unternehmen wollte. Und er versprach nicht zu<br />
viel. Bald jeden Tag nahm er mich mit auf seine Fahrten und<br />
Gänge durchs Revier und sogar auf die Pirsch.<br />
Der Wald wurde zum großen Abenteuer und erweckte meinen<br />
ersten ernsthaften Berufswunsch. Förster! Die Stunden im<br />
Wald mit Förster Krafzyk waren Balsam und Futter für meine<br />
Seele. Die Stunden auf den verschiedenen Bauernhöfen, mit<br />
dem Bruder von Herrn Krafzyk, stillten meinen ewigen Hunger.<br />
Herr Krafzyks Bruder war Hausschlachter, und wenn bei einem<br />
Bauern geschlachtet wurde, spannte der Förster Krafzyk seinen<br />
Einspänner, und die Brüder und ich fuhren zur Schlachtung.<br />
Die Bauern dort hatten alle ein weites Herz, und wo immer<br />
ich mit war, bekam ich satt zu essen. Meine Leibgerichte waren<br />
Wurstbrühe, Schlachteplatte mit Sauerkraut und natürlich<br />
frisches Hackepeter. Hmmm....!<br />
Diese vier Wochen bei den Förstersleuten war die schönste<br />
Zeit meiner Kindheit. Ich wurde bemuttert wie ein eigener<br />
Sohn, hatte immer satt zu essen, und es war eine Zeit voller<br />
neuer Eindrücke. Als ich abreiste, hatte ich acht Kilogramm<br />
zugenommen und fühlte mich wie ein Fisch im Wasser. Viel<br />
20
zu schnell war die Zeit um, und als es zum Abschied kam,<br />
flossen auf beiden Seiten viele Tränen.<br />
Durch die Krankheit und Kur hatte ich etwa drei Monate<br />
Schulausfall. Es war nicht verwunderlich, dass ich den Lernstoff<br />
nicht nachholen konnte. So drehte ich die Runde der<br />
sechsten Klasse ein zweites Mal.<br />
Mit der Clique auf Bengs Wiesen<br />
Der Alltag hatte mich wieder, aber wir hatten in unserer Clique<br />
viel Spaß bei gemeinsamen Streichen. Da sich zu Hause sowieso<br />
niemand um mich scherte, und es niemanden kümmerte, ob<br />
ich Schulaufgaben machte oder nicht, flog nach der Schule<br />
der Ranzen auf den Wohnzimmerschrank, und ich war verschwunden.<br />
Die Hausaufgaben erledigte ich übrigens immer<br />
morgens vor der Schule. Dazu stand ich immer eine Stunde<br />
früher auf und setzte mich auf die Stufen vor unserem Haus.<br />
Das Aktionsfeld meiner Clique waren Bengs Wiesen und das<br />
Breite Bruch. Das Breite Bruch war in unserer Fantasie unsere<br />
Prärie, es war die unendliche Freiheit. Nicht die Enge von zu<br />
Hause, der Streit, die Unruhe der Geschwister, der Dunst der<br />
Küche.<br />
Das Breite Bruch waren in der Realität die Flutwiesen der<br />
Stadt und boten ihr Schutz. Dort konnte bei Hochwasser im<br />
Herbst und Winter das Wasser auslaufen. Durch das Breite<br />
Bruch schlängelte sich der Neujahrsgraben an den Schmerzker<br />
Wiesen vorbei bis Göttin und mündete in der Plane. Der<br />
Neujahrsgraben war größtenteils knietief, hatte aber auch<br />
Untiefen. Fische und Krebse gab es ausreichend. Wir besorgten<br />
uns vom Händler leere Zwiebelsäcke, trennten sie auf und<br />
nähten sie als Netz wieder zusammen. Beim Fischen gab es<br />
immer reiche Beute. Die Fische rösteten wir über dem Lager-<br />
21
feuer, und für die Krebse hatten wir einen alten Topf, in dem<br />
wir sie brühten. Das Breite Bruch würde man heute wohl zum<br />
Naturschutzgebiet machen. Es war eine Idylle, die ihresgleichen<br />
in Brandenburg suchte. Es gab unzählige große Weidenbüsche<br />
in denen die Lietzen (Blesshühner) ihre Nester bauten.<br />
In einem dieser großen Weidenbüsche hatten wir uns eine<br />
Bude gebaut. Eine Seite wurde als Eingang etwas ausgelichtet,<br />
die abgeschnittenen Ruten wurden mit anderen in Kopfhöhe<br />
verbunden und mit Heu, Stroh und Resten von Dachpappe,<br />
die wir auf der Müllkippe gefunden hatten, ausgestopft. Die<br />
Bude diente uns nicht nur zum Schutz vor Unwetter. In ihr<br />
versteckten wir auch unsere Waffen. Pfeile, Bogen und<br />
Fletschen (Katapult). Dinge, die wir natürlich nicht hätten<br />
mit nach Hause nehmen dürfen. Täglich streiften wir über<br />
unsere Prärie, bis Göttin oder Schmerzke.<br />
Als Sammler und Jäger<br />
Jeder Garten auf unseren Streifzügen war uns bestens bekannt.<br />
Wir wussten ganz genau, wo die leckersten Pflaumen, die<br />
saftigsten Birnen, die größten Kartoffeln und die längsten<br />
Karotten wuchsen. Auch Kohlköpfe jeder Art verschmähten<br />
wir nicht. Die Jagd in der Prärie machte einen Indianer oder<br />
Cowboy eben hungrig. Wir nahmen uns zwar fremdes Obst<br />
oder Gemüse, aber wir zerstörten dabei niemals sinnlos anderer<br />
Menschen Eigentum.<br />
Wenn wir Hunger auf Fleisch hatten, gingen wir eben wie<br />
echte Indianer auf Jagd. Auf Entenjagd! Wir beherrschten<br />
verschiedene Jagdmethoden. Entweder mit der Fletsche, mit<br />
Pfeil und Bogen oder aber mit einer Bierflasche, Schnur und<br />
Haken. Die Flasche wurde soweit mit Wasser gefüllt, dass<br />
der Hals nur noch 3 bis 5cm aus dem Wasser ragte. Am Verschluss<br />
wurde eine Schnur mit Angelhaken befestigt, an dem<br />
22
ein Stück Brot angebracht wurde. Einige Brotkrumen warfen<br />
wir zum Anlocken ins Wasser. Wir selbst versteckten uns im<br />
hohen Gras. Wenn eine Ente nun in ihrer Gier die Krume samt<br />
Haken verschluckt hatte, zottelte sie die Flasche hin und her.<br />
Solange bis der Flaschenhals unter Wasser kam. Dann zog die<br />
Flasche den Kopf der Ente unter Wasser, und sie ersoff. Wenn<br />
der Sterz der Ente in die Luft ragte holten wir sie raus. Eine<br />
recht rabiate, jedoch effektive Jagdmethode, die wir auch bei<br />
Blesshühnern (Litzen) mit Erfolg anwandten.<br />
Wenn wir erfolgreich gejagt hatten, wurde ein Lagerfeuer<br />
gemacht. Links und rechts vom Feuer schlugen wir Gabeln<br />
in die Erde. Das Tier spießten wir auf einen Stahlstab und<br />
rösteten es über dem offenen Feuer. Bei den Blesshühnern<br />
musste man dass Federkleid samt Haut abziehen, denn<br />
ansonsten schmeckte sie ranzig. Es dauerte ewig lange, bis<br />
das jeweilige Tier gar war. Da wir weder Salz, noch Gewürze<br />
oder gar Fett hatten, schmeckte es meist scheußlich. Aber der<br />
Hunger überwand alles.<br />
Krieg der Cliquen, Katastrophe<br />
So streiften wir täglich über unsere „Prärie“, und es war ein<br />
wundervolles Gefühl der Unabhängigkeit und Unbesorgtheit.<br />
Aber wie alles im Leben gab es nicht nur schöne<br />
Augenblicke. Und in unsere Abenteuerlust gingen auch wir<br />
als Clique einen Schritt zu weit. Wie sich der Leser denken kann,<br />
waren wir nicht die einzigen Kinder der Stadt, die die Wiesen<br />
für sich entdeckt hatten. Es gab Macht- und Revierkämpfe.<br />
In der Linienstraße, bekannt als „Schwindelschweiz“, lebten<br />
bedeutend mehr Kinder unseren Alters. Des Öfteren wurden<br />
Straßenkämpfe ausgetragen, die nicht selten mit Verletzungen<br />
endeten. Die Clique der Linienstraße hatte ihre Buden in den<br />
Büschen des Gleisdreiecks.<br />
23
Das Gleisdreieck wurde von der Hauptstrecke Berlin-Magdeburg<br />
und der Nebenstrecke Brandenburg-Belzig gebildet.<br />
Diese Nebenstrecke führte für ein kurzes Stück an der Göttiner<br />
Straße im Bogen vorbei über eine Brücke und dann weiter<br />
nach Belzig. In diesem Bogen waren genau wie bei uns<br />
Wiesen mit Buden darauf, die in der gleichen Bauweise wie<br />
unsere entstanden waren.<br />
Die Katastrophe geschah im August 1937. Es war schon<br />
mehrere Tage sehr heiß und vor allem sehr trocken gewesen.<br />
Unsere Späher hatten erkundet, dass keiner der Kinder aus<br />
der Linienstraße in oder an ihren Buden war. Ich kann heute<br />
nicht mehr sagen, was uns da geritten hat. Fantasie und Wirklichkeit<br />
verschmolzen. Wir acht Jungs zogen los in den Kampf<br />
gegen die Feinde. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen, mit einigen<br />
Lumpenfetzen und einer Flasche Petroleum. Vom Banddamm<br />
aus, schossen wir ihre Buden in Brand.<br />
Die Kraft des Feuers hatten wir nicht vorhersehen. In rasanter<br />
Geschwindigkeit bereitete sich das Feuer aus. Innerhalb kurzer<br />
Zeit brannte das gesamte Dreieck. Die Feuerwehr rückte mit<br />
mehren Löschzügen an. Es war das reinste Chaos. Die Feuerwehr<br />
versuchte verzweifelt, den Übergriff des Feuers auf ein Sägewerk,<br />
das hinter dem Kleinbahndamm lag, sowie auf eine<br />
Müllkippe, die in Richtung Linienstraße lag, zu verhindern.<br />
Zum Glück konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden<br />
und Schlimmeres wurde verhindert.<br />
Wir Kinder waren geschockt, fühlten uns aber dennoch so sicher,<br />
dass ich völlig perplex war, als mich die Polizei von zu Hause<br />
holte und zur Vernehmung in die Magdeburger Straße brachte.<br />
Auf der Polizeiwache II ( diese wurde im Krieg zerstört)<br />
bekam ich zuerst eine kräftige Ohrfeige von einem Polizisten,<br />
dann wurde eine Anzeige aufgenommen. Als die Anzeige bei<br />
uns zu Hause auf den Tisch flatterte, rastete meine Mutter aus.<br />
24
Wir hatten in der Küche einen Schemel. Wenn man den etwas<br />
anhob ging ein Schemelbein ab. Und zu genau diesem Schemelbein<br />
griff meine Mutter in ihren Zornesausbrüchen immer.<br />
Es war nach dieser Anzeige nicht die erste Prügel mit<br />
dem Schemelbein, aber eine der schlimmsten Attacken. Aber<br />
ich hatte Erfahrung im „geprügelt werden“ und so war ich<br />
mit einem Satz am Sofa und griff mir ein Kissen, das ich<br />
schützend vor den Kopf hielt. Ich denke, dass mich dieses<br />
Kissen vor schweren Verletzungen gerettet hat, denn meine<br />
Mutter war es in ihrer Rage egal, wo mich das Holz traf. Sie<br />
hätte mir das Gehirn herausgeprügelt.<br />
Rundlaufeisen<br />
Meine anderen Körperteile schienen schon immun gegen die<br />
auf mich einprasselnden Schläge zu sein. Der Schmerz der<br />
Hiebe war nach kurzer Zeit vergessen, aber was mir wirklich<br />
lange wehtat, das war die Geldstrafe. Zur Beschaffung des<br />
Geldes hatten wir uns eine besondere Methode ausgedacht.<br />
Am Rande der Kleinbahn hatte der Schrotthändler Gebhard<br />
ein Lager, in dem er den Schrott sortierte und verlud. Seine<br />
Hauptgeschäftsstelle hatte er allerdings in der Neuendorferstraße.<br />
Da der Chef nicht immer im Lager war, sammelten wir<br />
kurzerhand dort einen Handwagen voll und verkauften diesen<br />
in seinem Hauptgeschäft in der Neuendorferstraße. Natürlich<br />
in größeren Abständen, um uns nicht verdächtig zu machen.<br />
Diese Aktion nannten wir unser „Rundlaufeisen“. Aber eines<br />
Tages erwischte uns der alte Gebhard doch. Da das Schrottlager<br />
nur knapp 4 m oberhalb der Wiesen am Jakobsgraben und<br />
nur ca. 200 Meter von unserer Badestelle lag, flüchteten wir<br />
automatisch in diese Richtung. Unser Ziel war das Wasser.<br />
Wir wussten, dass er uns nicht schwimmend verfolgen würde.<br />
Dennoch rannte Gebhard mit der Peitsche in der Hand hinter<br />
uns her. Zwei von uns erwischte er noch mit einem Schlag. Einer<br />
25
der Jungs war ich. Als wir aber mit einem Hechter sicher im<br />
Wasser waren, waren wir wieder mutig genug, um ihm eine<br />
lange Nase zu drehen. Aber der Peitschenschlag hatte wehgetan,<br />
und so schworen wir Rache.<br />
Im Laufe der Zeit hatten wir heraus, wann Gebhard immer<br />
auf seinem Lagerplatz war. Wir kannten seine Gewohnheiten.<br />
So legten wir uns ins hohe Gras, das uns gute Deckung bot,<br />
und warteten geduldig. Dann war es soweit. Gebhard kam<br />
auf die Wiese hinter seinem Lager. Er schaute sich kurz um<br />
und dann ging alles sehr schnell. Er zog seine Hose runter<br />
und ging in die Hocke. Wir zogen unsere Fletschen raus, legten<br />
die Kieselsteine in die Lederlaschen, zogen die Gummi voll<br />
durch und dann – acht mal Feuer frei. Der Hintern bot ein<br />
breites Zielfeld, aber wie das bei einem Zielschießen so ist, ein<br />
fehlgeleiteter Schuss traf wohl sein empfindlichstes Teil, das<br />
da zwischen den Beinen hing, und er kippte plötzlich nach<br />
vorn über. Wir hatten ihm buchstäblich die Beine weggehauen.<br />
Wieder retteten wir uns mit einem Sprung ins Wasser, an<br />
unserem geliebten und vertrauten Gänsewerder.<br />
Die Aktion „Rundlaufeisen“ hatte sich ein für allemal erledigt.<br />
Zudem waren auch die Ferien zu Ende, und ich kam in eine<br />
neue sechste Klasse.<br />
Lehrerschreck<br />
Ich lernte neue Schulkameraden kennen. Da waren ganz schöne<br />
Früchtchen dabei, die nur an Dummheiten dachten. Aber<br />
meine Streiche und Dummheiten spielten sich im normalen<br />
Bereich ab. Das heißt, alles was die Lehrerschaft auf die Palme<br />
brachte, lag in meinem Interesse und inspirierte mich zu<br />
manchem Einfall. Wobei sich nicht jeder Einfall als gute Idee<br />
herausstellte und ohne schmerzliche Folgen für uns blieb.<br />
26
Eine solche schlechte Idee ist mir in besonderer Erinnerung<br />
geblieben. Objekt unserer Tat war das Fräulein Noack. Eine<br />
stark taillierte und äußerst phlegmatische Dame. Sie war tatsächlich<br />
so träge, dass sie nicht einmal den Stuhl, auf den sie<br />
sich zu setzen gedachte, selbst verrückte. Der Primus unserer<br />
Klasse, ein kleiner Schleimer, rückte den Stuhl in jeder Pause<br />
auf den entsprechenden Platz und platzierte präzise Lineal,<br />
Klassenbuch und Rohrstock auf dem Lehrerpult. Damit hatte<br />
der Primus seine Arbeit getan. Wir vier Jungen hatten wieder<br />
einmal Strafarbeit zu verrichten und mussten dazu in der<br />
Pause im Klassenraum verbleiben. Das von uns schon lange<br />
geplante Unheil nahm seinen Lauf.<br />
Schielke und Peters saugten den Rohrstock voll Tinte.<br />
Schuricke und ich platzierten unter die hinteren Stuhlbeine,<br />
handelsübliche und käuflich erworbene Stinkbomben. Um<br />
ein vorzeitiges Zerdrücken durch das Eigengewicht des Stuhles<br />
zu verhindern, falteten wir kleine Stücken Pappe und legten<br />
sie schützend dazwischen. Unsere einzige Sorge war, dass<br />
der Aber diese Sorge war unberechtigt. Fräulein Noack kam,<br />
pflanzte sich behäbig auf den Stuhl - und es stank. Aber nur<br />
sehr dezent, denn leider war eine Stinkbombe nicht geplatzt,<br />
da sie sich verschoben hatte. Dennoch war Fräulein Noack<br />
erzürnt. Sie griff in ihrer Wut zum Rohrstock, holte aus und<br />
donnerte den Rohrstock auf den Lehrerpult.<br />
Beim ersten Hieb war sie geschockt und wir erschreckt. Beim<br />
zweiten Hieb fing ein großes Geschrei an. Die ersten Reihen<br />
waren bis zur Hälfte mit Tinte bespritzt. Aber diesen Effekt<br />
hatten wir weder so geplant noch als Möglichkeit bedacht.<br />
Unser Plan hatte vorgesehen, dass, wenn ein Schüler vor die<br />
Klasse treten musste, um sich seine Bestrafung abzuholen,<br />
dass die Tinte auf den Fußboden spritzen würde.<br />
Die Folgen dieses Streiches bekamen nicht nur wir vier in<br />
brutaler Art zu spüren, sondern auch unsere Familien. Wir<br />
27
ekamen die Prügel und unsere Eltern mussten zahlen. Wir<br />
alle vier musste natürlich unverzüglich zum Direktor. In<br />
dieser Beziehung hatten wir noch Glück. An dem Tag war nur<br />
Herr Senkpiel, der stellvertretende Direktor anwesend. Herr<br />
Senkpiel war von der weltlichen Schule an die Rochow Schule<br />
übernommen worden und lehnte nach wie vor die Prügelstrafe<br />
ab. So blieb uns zumindest diese erste Tracht erspart. Aber<br />
nicht strafende Worte, ein schriftlicher Vorkommnisbericht<br />
und die Mitteilung an die Eltern.<br />
Das Martyrium ging am Tag darauf los. Jeder Lehrer fühlte<br />
sich in seiner Unterrichtsstunde ermächtigt, uns ein paar Rohrstockhiebe<br />
zu verpassen. Einen besonderen Ehrgeiz, entwickelte<br />
dabei unser Erdkundelehrer Erdmann. Wir nahmen an, er ließ<br />
den ganzen Frust seiner Ehescheidung an uns aus.<br />
Das ging mehrere Wochen so. Dann verebbte alles langsam,<br />
und zumindest der Schulalltag wurde für uns wieder normal.<br />
Kleiner Aufschwung<br />
Anders dagegen war es zu Hause. Die Tracht Prügel von meiner<br />
Mutter hatte ich ertragen können, aber nicht ihren vorwurfsvollen<br />
Blick, der mich täglich traf. Dieser Blick schürte tatsächlich<br />
mein schlechtes Gewissen. Er schien zu sagen: „Das Geld<br />
reicht jetzt schon nicht für das Nötigste, wie soll ich den von<br />
dir verzapften Unsinn bezahlen?“ Ich nahm mir fest vor, nie<br />
wieder solchen Unsinn zu verzapfen und von nun an meiner<br />
Mutter zu helfen, dieses Geld zu verdienen. So lungerte<br />
ich also täglich nach Schulschluss in der Hauptstraße vor den<br />
Kaufhäusern Flakowskie, Egege und Kepa herum. Da schon<br />
in meiner Zeit Fahrraddiebstähle keine Seltenheit waren, fragte<br />
ich jeden Fahrradbesitzer, der ins Kaufhaus wollte, ob ich auf<br />
sein Fahrrad aufpassen solle. In einigen Stunden hatte ich dann<br />
zwischen 0,70 RM und 1,20 RM verdient. Meine Mutter freute<br />
sich über jeden Sechser, den ich ihr gab.<br />
28
Als der Herbst kam und die Kastanien und Eicheln von den<br />
Bäumen fielen, kaufte ich mir für 0,20 RM bei Kepa, einem<br />
großen Kaufhaus, eine Leergutkiste. Auf der Müllkippe fand<br />
ich einen Satz Kinderwagenräder, und so baute ich mir einen<br />
kleinen Karren zusammen. Das Sammeln von Kastanien und<br />
Eicheln war ein einträgliches Geschäft, denn die Chaussee<br />
bis Jeserig in Richtung Potsdam war beidseitig mit Bäumen<br />
bestückt. Für einen Zentner Kastanien gab es in der Kirchhofstraße<br />
bei Siegels in der Aufkaufstelle 1,50 RM und für<br />
Eicheln sogar 2,50 RM. Es war eine mühsame und anstrengende<br />
Arbeit. Aber das Gefühl, Geld zu haben, trieb mich an.<br />
Ich wollte wiedergutmachen und meiner Mutter helfen, die<br />
Schuld abzutragen.<br />
Wir steckten in großen finanziellen Schwierigkeiten. Ein<br />
Sprichwort besagt: „Ist die Not am größten, ist dir Gott am<br />
nächsten.“ Und auch wenn ich kein gläubiger Mensch bin, so<br />
war es doch ein großer Segen, als meine Mutter Arbeit als<br />
Küchenhilfe in der Gaststätte „ Bühnenhaus“ bekam. Endlich!<br />
Die Gaststätte war ein beliebtes Ausflugslokal, das an einer<br />
Dampferanlegestelle lag. Leider steht heute nur noch die Ruine<br />
der einst so schönen Gaststätte. So schön es auch war, dass<br />
Mutter wieder Geld verdiente, für mich hatte das einen erheblichen<br />
Nachteil. Da es von der Gaststätte bis zur Straßenbahnhaltestelle<br />
etwa 3 Kilometer Fußweg waren, der an der Plane<br />
entlang führten, musste ich meine Mutter jeden Abend von<br />
der Arbeit abholen.<br />
Aber auch ich hatte Glück und bekam eine Laufstelle beim<br />
Schuhmachermeister Bosdorf in der Großen Gartenstraße<br />
gegenüber unserer Wohnung. Schuhe von der Kundschaft<br />
abholen, reparieren lassen und wieder zurückbringen. Diese<br />
29
Stelle war allerdings auf 1 bis 2 Stunden täglich beschränkt.<br />
Mein Wochenlohn betrug 1,50 RM plus Trinkgeld.<br />
Fahrrad Marke Eigenbau<br />
Eines Tages kam der Aufruf der NSDAP zu einer Schrottsammlung.<br />
Die Wirtschaft brauchte Stahl, denn es zeichnete<br />
sich ab, dass aufgerüstet wird. Vor den meisten Häusern<br />
lagen Schrotthaufen. Mein Freund Heiner und ich stromerten<br />
durch die Strassen und begutachteten die Haufen. Dabei fiel<br />
uns auf, dass viele gute Fahrradteile dabei lagen. Bei diesem<br />
Anblick kam uns der Gedanke, uns selbst ein Fahrrad zusammenzubasteln.<br />
Die Ausbeute war gut. Hier ein Vorderrad, dort<br />
ein ausgeschlachteter Rahmen usw. Doch es fehlten noch die<br />
Schläuche, Pedalen und diverse Kleinigkeiten. Meine Schulden<br />
waren abbezahlt, und so sammelte ich fleißig weiter Kastanien<br />
und Eicheln und trug weiter fleißig anderer Leute Schuhe hin<br />
und her. Aber diesmal wurde jeder erarbeitete Pfennig in das<br />
Fahrrad investiert. Wir hatten eine sinnvolle Aufgabe für uns<br />
gefunden. Fast täglich bastelten und schraubten wir an den<br />
Räder herum.<br />
Die Beschaffung der fehlenden Teile war nicht allzu schwierig,<br />
denn es gab noch eine zusätzliche Geldquelle. Auch meine<br />
Oma hatte eine Arbeitsstelle im „Caffee Oske“ am Molkenmarkt.<br />
Sie war dort „bloß“ Toilettenfrau. Aber diese Stelle<br />
war eine wahre Goldgrube. Das „ Caffee Oske“ zählte zu den<br />
größten Vergnügungshäusern Brandenburgs. Wo viel getanzt<br />
wird, wird auch viel getrunken, und wo viel getrunken wird,<br />
fordert das menschliche Bedürfnis auch sein Recht. Wer also<br />
musste, musste zahlen. Dies war ein einträgliches Geschäft<br />
für meine Oma. Auch für mich, denn sie spendete mir einiges<br />
Geld für mein Fahrrad.<br />
Oma war auch vom „Deutschen Dorf“ zur Büttelstraße gezogen.<br />
Tante Hilde und Onkel Willi waren schon längere Zeit verhei-<br />
30
atet und hatten ihren eigenen Haustand. Tante Hilde hatte einen<br />
Sohn geboren, der Georg hieß, genau wie sein Vater. Auch<br />
Onkel Willi war Vater geworden. Seine Tochter hieß Eva.<br />
Als die Weihnachtszeit sich näherte, war meine Mutter wieder<br />
ohne Arbeit, denn das Buhnenhaus hatte im Winter geschlossen.<br />
Auch ich musste mir eine neue Erwerbsquelle suchen, denn<br />
der Schuhmacher Bosdorf hatte seine Schusterei in der Großen<br />
Gartenstraße geschlossen und stattdessen ein Schuhgeschäft<br />
in der Jakobsstraße eröffnet.<br />
Mit der Kriegsaufrüstung Deutschlands begann der Handel<br />
zu blühen. In der Stadt Brandenburg wurden neue Werke<br />
gebaut. Zum Beispiel das Opelwerk, das Havelwerk und das<br />
Arado-Flugzeugwerk. Es waren ausschließlich Rüstungsbetriebe,<br />
und um die Betriebe zu bewirtschaften, wurden aus<br />
allen Teilen Deutschlands Arbeiter geworben. Dementsprechend<br />
wurden auch Wohnungen gebaut. So entstanden die Walzwerk-,<br />
die Opel- und die Havelwerksiedlung.<br />
Weihnachten<br />
Als Kind empfand ich Weihnachten in meiner Stadt als die<br />
stimmungsvollste Zeit des Jahres. Die Geschäfte, Kaufhäuser<br />
und Straßen waren festlich geschmückt, und auf allen Plätzen<br />
der Stadt wurden Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten.<br />
Am Trauerberg, in der Nähe unserer Wohnung, hatte Gärtnermeister<br />
Dossow seinen Verkaufsstand für Weihnachtsbäume.<br />
Ich fragte ihn, ob ich helfen durfte, die Bäume aufzustellen.<br />
Er gab mir die Stelle, und ich stellte nicht nur Bäume auf,<br />
sondern ich durfte den Kunden auch die Bäume nach Hause<br />
tragen. Kundschaft gab es genug, und ich bemerkte, dass die<br />
Menschen in einer freudigeren und fröhlicheren Stimmung<br />
als in der restlichen Zeit des Jahres waren. Sie waren gebefreudiger<br />
als sonst, und ich bekam üppige Trinkgelder. Mit einem<br />
31
Teil des Geldes konnte ich meine Mutter unterstützen, denn<br />
es musste immer noch einiges Geld durch meine Dummheit<br />
abgezahlt werden.<br />
Weihnachten bei uns zu Hause war weniger beschaulich. Es<br />
war vielmehr jedes Jahr das Gleiche. Es gab einen kleinen,<br />
von Gärtner Dossow gespendeten Baum und ein Paar hohe,<br />
derbe Schuhe als Geschenk. Die alten Schuhe hatte ich zwei<br />
Jahre, ohne das sie besohlt wurden, getragen. Die Sohle war<br />
mit Eisennägeln beschlagen, und die Hacken hatten einen<br />
hufeisenförmigen Beschlag. Wenn ich im Dauerlauf durch die<br />
Straßen lief, hörte es sich an, als würde ein Pferd galoppieren.<br />
Pimpf<br />
Ich erinnere mich, dass am heiligen Abend auch unser Hauswirt<br />
zu Besuch kam. Er brachte für meine Geschwister Süßigkeiten<br />
und für mich eine Uniform. Es war die Winteruniform<br />
des Jungvolkes. Der Kinder- und Jugendorganisation der<br />
NSDAP. Eine Organisationseinheit der 10 bis 14 jährigen<br />
Jungen. Zu den Mitgliedern des Jungvolkes sagte man auch<br />
Pimpfe.<br />
Die Uniform bestand aus Hose, Jacke und Mütze. Sie war aus<br />
herrlich weichem, schwarzem Wollstoff und ideal für den kalten<br />
Winter. Es war eine stille Eintrittsaufforderung des Hauswirtes<br />
an mich, auch wenn er es nicht aussprach.<br />
Am ersten Weihnachtstag zog ich diese warme und flauschige<br />
Uniform voller Stolz an. Ich wollte meiner Oma einen Besuch<br />
abstatten. Aber an Stelle eines Komplimentes, das ich irgendwie<br />
erwartet hatte, gab sie mir bei meinem Anblick eine schallende<br />
Ohrfeige. Sie raunzte mich an, dass ich mir erst mal was<br />
„Anständiges“ anziehen solle. Ich war verletzt und irritiert,<br />
32
und so ließ ich mich einige Tage erst mal bei meiner Oma<br />
nicht mehr sehen. Zu den Pimpfen ging ich auch nicht.<br />
Alfred ist zurück<br />
In der Schule ging es nicht besonders gut, und ich schlug<br />
mich eher schlecht als recht durch. Immer geradeso, das ich<br />
das Schuljahr nicht noch einmal wiederholen muss. Wie sollte<br />
ich auch bessere Leistungen bringen? Meine Mutter hatte ihre<br />
eigenen Sorgen, und der liebe Alfred, der mittlerweile aus der<br />
Haft entlassen worden war, interessierte sich nicht für mich.<br />
Es war gegenseitige Abneigung!<br />
Wieder begann eine Zeit der Demütigungen. Alfred kam oft<br />
betrunken nach Hause. Dann stritten sich meine Eltern wieder,<br />
meine Mutter bekam wieder Schläge, und anschließend gab<br />
es wieder die Versöhnung im Bett. Dies alles mitzuerleben<br />
traumatisierte mich, und ich dachte mit großer Wehmut an<br />
die ruhige und vergleichsweise glückliche Zeit mit meinem<br />
Vater zurück. Es war schon seltsam, denn ich hasste Alfred<br />
nicht einmal. Auch für meine Mutter empfand ich kein Mitleid.<br />
Vielmehr trieb es mich nur weg. Weg aus der Enge der<br />
Wohnung, weg von der Kühle der Seelen, weg von der kleinlichen<br />
und gewalttätigen Ignoranz der Menschen, die vorgaben,<br />
meine Eltern zu sein.<br />
Freude, Frohsinn und Sauberkeit der Gedanken fand ich bei<br />
meiner Oma, die mich einige Male bei sich aufnahm und mir<br />
ein eigenes Zimmer gab, bei meinem Freund Heiner und<br />
dessen Familie, die mich wie ihr sechstes Kind aufnahmen,<br />
und bei denen ich ein harmonisches Miteinander einer Familie<br />
erleben dufte. Vater Lotsch war eine Seele von Mensch, und<br />
in einem unserer vielen Gespräche stellte sich heraus, dass er<br />
meinen Vater, Wilhelm <strong>Ostwald</strong>, von einer gemeinsamen Arbeit<br />
bei der Reichsbahn kannte.<br />
33
Laufbursche<br />
Das Gefühl der Freiheit empfand ich aber auch bei meinen<br />
Gängen als Laufbursche. Im Frühjahr 1937 bekam ich eine<br />
Laufjungenstelle beim Radiohändler Wendefeuer. Sofort nach<br />
Schulschluss ging es an die Arbeit. Er brachte mir bei, wie<br />
die Batterien aufgeladen werden mussten. Die ersten Radios<br />
wurden noch mittels Detektoren mit Spindeln, Röhren und<br />
Batterien betrieben. Diese Batterien, ähnlich den heutigen<br />
Autobatterien, nur kleiner im Format, wurden zur Kundschaft<br />
gebracht und entladene Batterien abgeholt. Oft fuhren<br />
wir mit seinem alten Hanomag zu den Bauern übers Land,<br />
um Leitungen für die Radios zu installieren. Antennen waren<br />
zur damaligen Zeit noch unbekannt, und so wurde von der<br />
Scheune zum Wohnhaus ein Kabel gespannt, kurz vor dem<br />
Haus ein Kabelstück abgeleitet und fertig war die Antenne.<br />
Diese Arbeit machte mir Spaß, denn ich durfte immer aufs<br />
Scheunendach klettern und das Kabel befestigen. Für diese<br />
akrobatischen Leistungen bekam ich meist nicht nur Lob,<br />
sondern auch ein deftiges Essen und manchmal auch ein paar<br />
Pfennige.<br />
Aber es gab etwas an der Arbeitsstelle, das mir ganz und gar<br />
nicht behagte. Nach meinem Feierabend gegen 18 Uhr forderte<br />
mich die Frau von Wendfeuer wiederholt auf, für sie<br />
Einkäufe zu erledigen. Ich tat es nur widerwillig, und nach<br />
einigen Monaten schmiss ich diese Stelle hin und wollte mir<br />
eine andere Stelle als Laufjunge suche. Das war allerdings gar<br />
nicht so einfach, denn diese Stellen waren begehrt, und ich<br />
war nicht der einzige Junge in der Stadt, der Geld verdienen<br />
wollte. Zu dieser Zeit hatte ich endlich die Schulden für den<br />
dummen Streich bei meiner Mutter abgezahlt. Zudem hatten<br />
meine Mutter und Alfred Arbeit, und so gab es für den Moment<br />
keine Sorgen.<br />
34
Rache am Gärtner<br />
Eine zeitlang ging ich mit meiner Clique wieder auf Tour. Das<br />
Breite Bruch und die Gärten waren unsere Ziele. Aber es ging<br />
alles gemäßigter zu, denn Streiche mit Folgen blieben aus.<br />
Nur einmal rasteten wir noch aus. Gärtner Kraatz hatte eine<br />
Gärtnerei am Trauerberg. Diese war hinter seinem Wohnhaus<br />
in Richtung Gänsewerder. Im Garten am Ende der Gewächshäuser<br />
standen die schönsten und besten Obstbäume. Als wir<br />
mal wieder den Garten „besuchten“, muss er bereits auf der<br />
Lauer gelegen haben. Wir sprinteten wie die Verrückten<br />
davon, aber unser Kleinster war nicht schnell genug. Kraatz<br />
bekam ihn am Genick zu fassen und schleifte ihn durch ein<br />
ein Meter hohes Brennnesselfeld. Der Kleine schrie wie am<br />
Spieß, denn er war, wie wir alle, nur mit einer kurzen Hose<br />
bekleidet. Wir konnten nicht helfen und mussten das Trauerspiel<br />
mit ansehen. Unser Kleiner sah aus wie eine reife Erdbeere,<br />
und wir schworen Rache.<br />
Kraatz hatte etwas abseits der Gärtnerei ein ca. 400 m² großes<br />
Gladiolenfeld. Dieses Feld lag etwa einen Meter unterhalb<br />
eines Weges und war deshalb gut einsehbar. Mit unseren<br />
Fletschen und Kieselsteinen bewaffnet zogen wir los zum<br />
Übungsschießen. Ziel waren natürlich die Gladiolen. Als ein<br />
idealer Treffer galt die Platzierung des Steines unterhalb der<br />
Blüte, So dass der Blütenkopf abknickte. Aber auch ein Treffer<br />
direkt auf die Blüten zählte als Erfolg. Die Schlacht war<br />
erfolgreich gewonnen, denn die meisten Gladiolen büßten<br />
ihre Pracht ein. Natürlich blieben wir nicht unerkannt, und so<br />
gab es für uns als Nachspiel eine Tracht Prügel zu Hause, und<br />
wieder einmal eine finanzielle Strafe.<br />
Aber ein Gutes hatte diese Sache doch. Auch der Gärtner<br />
wurde wegen Körperverletzung angezeigt und musste eine<br />
Geldstrafe bezahlen. Unser Kleiner war gerächt. Aber dies<br />
35
war mein letzter erwähnenswerter Streich. Danach versuchte<br />
ich mich in verschiedenen sportlichen Disziplinen, um meine<br />
Freizeit sinnvoll zu gestalten. Versuchsweise ging ich zum<br />
Training der Turner in die Hammerstraße. Bockspringen und<br />
Barrenübungen gingen ja noch, aber als ich es an den Ringen<br />
versuchen sollte, da war es aus mit meinem Können. Ich hing<br />
an den Ringen wie ein nasser Sack. Turnen war kein Sport für<br />
mich, denn ich war viel zu schwer.<br />
36
Vorkriegsjahr und Kriegsbeginn, Radsport und<br />
Lehre (1938 – 1940)<br />
Das Haus, in dem wir lebten<br />
Frau Imme (li.) und meine<br />
Schwiegermutter<br />
Im Hinterhaus, in dem wir wohnten,<br />
lebten vier Mietparteien. Es<br />
war ein freundliches und ruhiges<br />
Miteinander. Unser linker Nachbar<br />
im Parterre, Herr Baron, stolzierte<br />
immer in seiner SA-Uniform<br />
umher. Arbeiten habe ich ihn nie<br />
gesehen. Im ersten Weltkrieg war<br />
er in russische Gefangenschaft geraten,<br />
hatte sich aber nach seiner<br />
Entlassung eine Russin mitgebracht<br />
und geheiratet. Anna, so<br />
hieß sie, war trotz ihrer Robustheit<br />
eine sehr hübsche und freundliche<br />
Frau. Sie hatte schöne, lange,<br />
schwarze Haare, die ihr bis zum<br />
Gesäß reichten. Manchmal hatte sie die Haare auch zu einem<br />
wuchtigen, schönen Dutt gebunden. In besonderer Erinnerung<br />
ist mir geblieben, dass sie immer barfuss lief. Sogar im<br />
Winter, wenn sie im Hof die Wäsche aufhing.<br />
Mieter Imme wohnte eine Treppe links und hatte einen Sohn,<br />
der Erwin hieß und vier Jahre älter als ich war. Bei Immes war<br />
immer Frohsinn und Heiterkeit. Oft trällerten sie die schönsten<br />
Lieder. Seine Tätigkeit als Korbmacher konnte er zu Hause<br />
ausüben. Vielleicht war das das Geheimnis des steten Frohsinns.<br />
Der Sonntag war immer Angeltag für Herrn Imme. Er<br />
nahm mich oft mit, doch nicht nur zum Angeln. Ich musste<br />
ihn immer im Kahn bis zur Angelstelle rudern.<br />
37
Meist musste ich<br />
ihn mit seinem<br />
Kahn zur Krakauer<br />
Schleuse<br />
rudern. An der<br />
Stelle, an der wir<br />
angelten, war<br />
ein Sägewerk.<br />
Am Ufer der<br />
Havel lagen die<br />
Baumstämme zu<br />
Flössen zusammengebunden.<br />
Beim Angeln<br />
Zwischen diesen Stämmen tummelten sich ganze Schwärme<br />
von Rotfedern, und man konnte sie fast mit der Hand fangen.<br />
Es waren schöne Zeiten, in denen ich wohl glücklich war.<br />
Frau Arnswald (2.v.l.), daneben: Inge<br />
Arnswald, Frau Imme, Herr Imme,<br />
außerdem Freunde der Familie<br />
38<br />
Zu meiner großen Freude<br />
hatte ich bald wieder eine<br />
Stelle gefunden. Diesmal<br />
war es bei Herrn Lauzius<br />
in der Hauptstraße, Ecke<br />
Packhofstraße. (Heute ist die<br />
Firma Biedermeier Inhaber).<br />
Herr Lauzius führte ein Tapeten-<br />
und Linoleumgeschäft.<br />
Er selbst war ein<br />
hochgewachsener, lediger<br />
Mann, der immer korrekt gekleidet<br />
war. Ich bewunderte<br />
immer seine Wandlungsfähigkeit.<br />
Wenn wir zur Kundschaft<br />
fuhren, um Linoleum<br />
zu verlegen, trug er immer<br />
einen Arbeitsanzug und war
nicht der Chef, sondern Facharbeiter und Lehrmeister. Er hatte<br />
in der Paulinenstraße ein kleines Haus, in dem er mit seiner<br />
netten Schwester zusammenlebte. Die Arbeit war körperlich<br />
schwer und der Verdienst mit 3,- RM pro Woche gering. Aber<br />
ich blieb bei ihm bis zum Frühjahr 1938, bis meine Schulzeit<br />
zu Ende ging. Herr Luzius bot mir auch die Lehrstelle als Verkäufer<br />
in seinem Geschäft an, aber dazu hatte ich absolut keine<br />
Lust.<br />
Die ausgefallene Konfirmation<br />
Einige Ereignisse des Jahres 1938 stimmten mich nachdenklich<br />
und machten mich traurig, aber auch wütend. 1938 sollte<br />
das Jahr meine Konfirmation sein. Unter großen finanziellen<br />
Anstrengungen hatte meine Mutter alles Notwendige bereits<br />
besorgt. Ich war vollständig mit Schuhen, Anzug und Hut<br />
ausgestattet. Doch vier Wochen vor dem Fest sollte ein Vorkommnis<br />
alles anders kommen lassen. Auch wenn ich mich<br />
nicht mehr an Streichen mit schweren Folgen beteiligte, war<br />
ich doch mit meinen knapp 15 Jahren zu keinem Musterschüler<br />
mutiert. Kleine Streiche machten immer noch Spaß.<br />
Auch der Religionsunterricht war keine streichfreie Zone.<br />
Unser Religionsunterricht wurde im Pfarrhaus der Katharienkirche<br />
durchgeführt. Wir Schüler saßen in einer Reihe hintereinander<br />
auf ganz normalen Stühlen. Vor mir saß ein Junge, der<br />
eine Trachtenjacke trug, wie man sie in Bayern trägt. Trachtenjacken<br />
waren in der Hitlerzeit große Mode. Ich öffnete also<br />
die Hirschhornknöpfe am hinteren Steg der Jacke. Dann band<br />
ich die Stegenden an der Querleiste des Stuhles an. Als der<br />
Schüler zur Beantwortung einer Frage des Pfarrers aufstehen<br />
wollte, hob er den Stuhl mit großem Gepolter mit an. Pfarrer<br />
Schubert war schnell klar, wer der Verursacher des Streiches<br />
war. Er orderte mich nach vorn und gab mir ohne Vorwarnung<br />
mehrere schmerzhafte Ohrfeigen. Züchtigungen und<br />
39
Prügel war ich ja von zu Hause gewohnt. Wenn ich für mich<br />
selbst eingestand, dass ich über ein Ziel hinausgeschossen<br />
war, dann ertrug ich Prügel stets klaglos. Doch fühlte ich mich<br />
zu Unrecht und über Maßen bestraft, dann wurde ich rebellisch.<br />
So war es auch in diesem Fall. Ich fand die Strafe zu hart<br />
und fühlte mich gedemütigt.<br />
Das konnte doch nicht Gottes Art sein. In den vier Jahren<br />
Religionsunterricht in der Rochow-Schule hatte ich Gottes<br />
Wort anders verstanden. In meinem Zorn griff ich das<br />
Gebetsbuch, das auf dem Pfarrerpult lag, und schleuderte<br />
es in Richtung Pfarrer, in der festen Absicht, ihn am Kopf zu<br />
treffen. Doch ich verfehlte ihn und das Gebetbuch traf eine<br />
Engelsfigur, die auf einer kleinen Konsole an der Wand stand.<br />
Sie wurde das unschuldige Opfer meiner Wut. Der Pfarrer<br />
beschimpfte mich als Gotteslästerer und verwies mich sofort<br />
des Pfarrhauses.<br />
Zu Hause war die Hölle los. Auch hier wieder Prügel und<br />
Gezeter. Meine Mutter bettelte förmlich beim Pfarrer um<br />
meine Teilnahme an der Konfirmation. Aber vergebens.<br />
Dennoch ging ich am Tag der Feier in die Kirche und schaute<br />
mir die Zeremonie an. Ich fand alles sehr festlich, aber es bewegte<br />
mich in keiner Weise. Aber als da saß, dachte ich an all<br />
die Prügel, die ich bekommen hatte, und an die Worte meiner<br />
Oma: „Lass mal Großer. Auch ohne Gottessegen kann der<br />
Lebensweg gut oder schlecht sein. Bleibe nur so wie du bist,<br />
vor allem anständig.“<br />
Die Progrome<br />
Man kann lapidar sagen, dass die Ereignisse der Pogromtage<br />
so unerfreulich wie das Wetter in dieser Zeit waren. Doch<br />
wogegen Wetter nur unerfreulich sein kann, waren die Tage<br />
der Pogrome unmenschlich und verabscheuenswert. Die SA<br />
40
wütete wie eine Räuberbande in der Stadt. Juden wurden wie<br />
Vieh aus den Häusern getrieben und auf LKW’s gejagt. Die<br />
Geschäfte und Firmen der Juden wurden geplündert und<br />
zerstört. Aber keiner rührte die Hände, um diesen Menschen<br />
zu helfen. Aber ich sah sehr wohl Frauen und auch Männer,<br />
die weinten vor Wut oder Hilflosigkeit. Denn jeder Versuch<br />
zu helfen, bedeutet mit Sicherheit, selbst eingesperrt zu werden.<br />
Auch im Nachbarhaus, in der Großen Gartenstraße Nr. 7, wurden<br />
die Familie Papendick mit<br />
ihrem Sohn Joshi, mit dem<br />
ich des Öfteren gespielt<br />
hatte, und der Tuchhändler<br />
Wollenweber, bei dem man<br />
Anschreiben oder auf Abzahlung<br />
kaufen konnte, Opfer<br />
dieser Verfolgung.<br />
In der Familie gab es ebenfalls<br />
ein trauriges Ereignis.<br />
Meine Tante Charlotte,<br />
Tante Charlotte<br />
Onkel Willis Frau, starb an<br />
Schwindsucht. Sie war eine<br />
so hübsche junge Frau mit<br />
blonden, lockigen Haaren<br />
und einer Pfirsichhaut. Ich<br />
glaube, ich war heimlich in<br />
sie verliebt, ohne dass es mir<br />
bewusst war, denn ich bewunderte sie sehr. Oft hatte ich mich<br />
gefragt, wie mein Onkel solch’ eine Frau hatte bekommen<br />
können. Er hatte das Aussehen eines Boxers. Aber ich wusste<br />
auch, dass er sie auf Händen getragen hatte.<br />
41
Der Ernst des Lebens<br />
Der sogenannte Ernst des Lebens begann, denn mein Freund<br />
Heiner und ich mussten auf Lehrstellensuche gehen. Meine<br />
Mutter wollte unbedingt, dass ich aufs Land als Knecht gehe.<br />
Doch da funkte meine Oma dazwischen. Sie fauchte meine<br />
Mutter an: “Wir sind doch nicht in die Stadt gezogen, damit<br />
einer unserer Kinder oder Enkel wieder ein Knechtsein erlebt.“<br />
Heiner und ich hatten gehört, dass in der Elisabethhütte und<br />
in der Schiffswerft „Wiemann“ Lehrlinge gesucht wurden.<br />
Wir bewarben uns beide und hatten enormes Glück. Wir bekamen<br />
beide eine Lehrstelle als Former in der Elisabethhütte.<br />
Als ich meiner Mutter den Vertrag zur Unterschrift vorlegte,<br />
kam es wieder zu einem großen Krach, denn meine Mutter<br />
weigerte sich, mir ihre Unterschrift zu geben. Ich ahnte, dass<br />
Bergemann die Ursache für ihre Verweigerung war. Er wollte<br />
unbedingt, dass ich eine Lehrstelle außerhalb Brandenburgs<br />
annahm, denn dann wäre er mich losgewesen.<br />
Da ich die Lehrstelle unbedingt haben wollte, unterschrieb<br />
ich den Vertrag mit dem Namen meiner Mutter selbst. Strafrechtlich<br />
war das wohl Urkundenfälschung, moralisch war es<br />
aber ein Notstand. Natürlich hatte meine Mutter den Betrug<br />
herausgefunden und tobte wie immer umher. Aber sie ließ den<br />
Schwindel auch nicht auffliegen. Ich konnte die Lehre antreten.<br />
Bis sich der Ärger zu Hause gelegt hatte, nahm mich Oma<br />
einige Tage bei sich auf. Das Abschlusszeugnis, das ich<br />
bekam, war nicht berauschend, aber für meinen neuen Lebensabschnitt<br />
reichte es.<br />
42
Lehrbeginn und Radsport<br />
Am 1. April 1938 trat ich, gemeinsam mit meinem Freund<br />
Heiner, meine Lehre als Metallformer in der Elisabethhütte<br />
der Firma Wiederholz an. Im ersten Lehrjahr hatten wir einen<br />
alten, grummeligen Lehrgesellen, der uns ganz schön auf Trab<br />
brachte, betreffs Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz.<br />
Aber er war ein guter Lehrgeselle, der uns viel beibrachte. Die<br />
Arbeit eines Formers war eine körperlich schwere Arbeit, und<br />
als Lehrling verdiente ich für diese Knüppelei gerade einmal<br />
5,- RM in der Woche. Von den alten Formern und Hilfsarbeitern<br />
bekamen Heiner und ich Spitznamen verpasst. Heiner wurde<br />
auf Grund seiner wulstigen Lippen Negus gerufen. Mich riefen<br />
sie immer Tommi. Weshalb, ist mir ein ewiges Rätsel geblieben.<br />
Mit Beginn der Lehre wurden wir auch verpflichtet,<br />
der damaligen Gewerkschaft „Arbeitsfront“ und der Hitlerjugend<br />
beizutreten. Für den Eintritt in die Hitlerjugend gab es<br />
für uns keine politischen Motive. Aber für unsere sportlichen<br />
Ambitionen beim Radsport sollte uns das Vorteile bringen.<br />
Heiner und ich hatten uns entschlossen, in der Freizeit aktiv<br />
Radsport zu betreiben. Wir traten dem Sportverein Havel 08<br />
bei, der seinen Sitz in der Brielower Landstraße hatte. Dieser<br />
Sportverein war die Hochburg des Radsportes in Brandenburg.<br />
Die Stadt hatte einige Größen des deutschen Radsportes<br />
hervorgebracht. Einer der Radsportgrößen der Stadt wohnte<br />
sogar in meiner Straße. Er hieß Richard Drange und war in<br />
den Brennabor-Werken als Kontrolleur beschäftigt. Er war<br />
ein sogenannter Halbprofi. Die Brennabor-Werke stellten ihm<br />
die Räder zur Verfügung, und er konnte auch während der<br />
Arbeitszeit trainieren. Er war unser Idol und wohl auch der<br />
Auslöser für unser großes Interesse am Radsport.<br />
Wenn an Sonntagen Radrennen in der Stadt ausgetragen<br />
wurden, kamen Rennfahrer aus den verschiedensten Städten<br />
43
am Hauptbahnhof an. Ich erinnere mich an einen Sonntag, als<br />
unsere Helden nach Brandenburg kamen. Sie hießen Thoma<br />
und Schadebroth. Wir waren begeisterte Fans der beiden. Wir<br />
durften ihre Räder tragen und sie während des Rennens betreuen.<br />
Der erste Schritt<br />
Bei einer anderen Sportveranstaltung wurde der „Erste<br />
Schritt“ ausgetragen. Das bedeutete, dass jeder Jugendliche,<br />
der ein Rad besaß, egal was für einen Schinken, sich seine ersten<br />
Lorbeeren verdienen konnte. Dazu mussten fünf Runden<br />
gefahren werden. Heiner hatte Pech, denn bei ihm sprang<br />
die Kette ab. Wäre ihm dies nicht passiert, wäre er vermutlich<br />
Erster geworden. Denn in allen späteren Rennen war er<br />
immer der beste Sprinter. Aber bei diesem ersten Rennen<br />
wurde ich Erster. Ich bekam eine Siegerschleife in die Hand<br />
gedrückt und sollte eine Ehrenrunde fahren. Ich war sehr stolz<br />
auf diesen Sieg, aber auch mächtig aufgeregt, mich vor Publikum<br />
präsentieren zu müssen. Dennoch schwang ich mich<br />
voller Freude auf mein Rad und winkte mit der Schleife dem<br />
Publikum zu. Doch als ich wenig später meine Hand mit der<br />
Schleife senkte gab es plötzlich eine Ruck, und ich verspürte<br />
einen so heftigen reißenden Schmerz in meiner Hand, dass<br />
ich im ersten Moment dachte, sie würde mir abgerissen werden.<br />
Natürlich ging ich zu Boden, und es dauerte noch einige<br />
Sekunden, bis ich realisiert hatte, weshalb die Massen sich vor<br />
Lachen bogen und warum ich auf dem Boden lag. Die Schleife<br />
hatte sich beim Senken der Hand im Kettenkasten verfangen<br />
und mich so umgerissen. Eben war ich noch der strahlende<br />
Sieger, der sich nun durch eine Unachtsamkeit lächerlich<br />
gemacht hatte. Ich schämte mich sehr und wollte nur weg von<br />
der voll Häme grölenden Masse. Das war meine erste Erfahrung<br />
mit dem Radsport.<br />
44
Erste Begegnung<br />
Der Sommer 1938 war heiß, und ich hatte Urlaub. Um der<br />
Hitze zu entfliehen, ging ich gemeinsam mit meiner Mutter<br />
und meinen Geschwistern am Gänsewerder baden. Wobei<br />
meine Mutter nie baden ging. Sie saß auf der Wiese und erzählte<br />
mit den anderen Frauen. Wir Kinder hingegen tollten<br />
im und am Wasser herum, bauten Sandburgen und lernten<br />
uns auf diese Weise kennen. Hier am Gänsewerder lernte ich<br />
auch Inge Arnswald kennen.<br />
Inge zur Konfirmation 17 Jahre alt<br />
Sie fiel mir auf, weil mich ihre natürliche, offene und für ein<br />
Mädchen der damaligen Zeit auch recht burschikose Art beeindruckte.<br />
Nach Brandenburger Mundart hätte man sie als<br />
kesse Bolle bezeichnet. Ich war erstaunt zu hören, dass sie<br />
45
schon einige Male bei uns im Haus in der Großen Gartenstraße<br />
war. Denn ihr Vater und Herr Imme arbeiteten in<br />
derselben Fabrik. Das wir uns bis zu diesem Tag nicht begegnet<br />
sind, ist nicht verwunderlich, denn ich war ja tagsüber auf<br />
Arbeit, und sie ging noch zur Schule.<br />
Seit diesem Tag trafen wir uns öfter, wenn ihre Eltern bei Immes<br />
zu Besuch waren. Dann saßen wir auf der Treppe vor dem<br />
Haus und unterhielten uns stundenlang. Worüber, das weiß<br />
ich heute nicht mehr. Aber schon bei diesen ersten Begegnungen<br />
merkte ich, dass ich gern mit ihr sprach, und irgendwie ging<br />
uns schon damals der Gesprächsstoff nie aus. Es begann eine<br />
gute Freundschaft, die - was wir beide damals nicht ahnten -<br />
unser beiden Leben bestimmen sollte.<br />
Das Jahr ging ohne besondere persönliche Ereignisse zu Ende.<br />
Es war nur das Übliche. Lehre, Training, Zoff mit Bergemann<br />
und wie jedes Jahr vermieste Weihnachten.<br />
Bei Onkel Willi<br />
Im neuen Jahr 1939 zog ich auf<br />
Angebot von Onkel Willi zu ihm.<br />
Dafür gab es mindestens zwei<br />
gute Gründe. Zum einen war<br />
Onkel Willi seit dem Tod von<br />
Tante Charlotte sehr allein, zum<br />
anderen hatte ich ständig Streit<br />
mit Bergemann.<br />
Es war eine angenehme Zeit für<br />
mich. Ich fühlte mich wohl bei<br />
Onkel Willi. Abends gingen wir<br />
manchmal ins Kino. Dann sahen<br />
wir uns mit Vorliebe entweder<br />
Kriminalfilme oder aber Wes- Onkel Willi<br />
46
ternfilme an. Einige Male waren wir auch in einer Gaststätte.<br />
Onkel Willi achtete aber streng darauf, dass ich keinen Alkohol<br />
bekam.<br />
Bevor wir abends zur Ruhe gingen, lasen wir beide im Bett<br />
immer Schmöker. Onkel Willi liebte es, Krimis zu lesen, und<br />
ich verschlang mit Eifer Abenteuergeschichten von Rolf<br />
Tourings oder Jörn Farnows. In den Hinterhöfen der Stadt<br />
Brandenburg gab es Ende der dreißiger Jahre noch nicht überall<br />
Anschluss an das Stromnetz. Deshalb hing über dem Ehebett,<br />
in dem wir beide schliefen, eine Petroleumlampe. Eines<br />
Abends schliefen wir über dem Lesen ein und vergaßen die<br />
Lampe zu löschen. Am nächsten Morgen war die Wohnung<br />
voller Rußflecken und unsere Nasenlöcher waren schwarz.<br />
Wir hatten eben einen klassischen Männerhaushalt.<br />
Verbrennungen<br />
So ging der Sommer zu Ende, und die kalte Jahreszeit begann.<br />
In den Wintermonaten war es in der Halle der Formerei bitterkalt.<br />
Um die Halle etwas zu erwärmen und um zu verhindern,<br />
dass der Formersand über Nacht gefriert, wurden zwei große<br />
Kanonenöfen aufgestellt. Wir Lehrlinge hatten die Aufgabe,<br />
die Öfen zu beheizen und zu verhindern, dass sie ausgingen.<br />
Zum Anheizen wurden die Öfen mit Holz belegt, mit Öl übergossen<br />
und angezündet. Wenn das Holz brannte, wurde Koks<br />
nachgeschüttet, und die Sache war erledigt. Damit der Ofen<br />
nicht ausging, wurde hin und wieder Koks nachgelegt. Diese<br />
Öfen hatten eine Höhe von 2,50 Meter und einen Durchmesser<br />
von einem Meter. Jugendliche Unerfahrenheit fordert Opfer,<br />
und ich war eines davon. Das Feuer, das ich angezündet hatte,<br />
ging aus, und es fing fürchterlich an zu qualmen. Also rollte<br />
ich eine Zeitung zusammen und wollte damit der Flamme<br />
neue Nahrung geben. Doch kaum hatte ich die Lunte in das<br />
47
Ofenloch gehalten, gab es eine Stichflamme, die mich von den<br />
Beinen riss. Ich hatte mir bei dieser Aktion nicht nur fast alle<br />
Haare verbrannt, sondern auch die komplette linke Gesichtshälfte.<br />
Da man zur damaligen Zeit der medizinischen Ansicht<br />
war, dass bei Verbrennungen Öl auf der Haut ein Heilmittel<br />
ist, schmierte mein Lehrmeister, Herr Derschau, mein Gesicht<br />
mit Öl ein. Dann wurde ich zu einem Arzt gebracht.<br />
Die Schmerzen waren fürchterlich. Aber ich hatte Glück, denn<br />
es blieben keine Narben zurück. Weitere Monate der Lehre<br />
vergingen ereignislos. Bis eines Tages ein Ereignis das Leben<br />
von Onkel Willi in tragischer Weise verändern sollte und meine<br />
Mitgliedschaft in der HJ beeinflusste.<br />
Pöbelei und Konzentrationslager<br />
Wir beide, Onkel Willi und ich, gingen eines Abends in die<br />
Gaststätte zur „Sonne“ in der Flutstraße, Ecke Werderstraße.<br />
Es war eine Eckkneipe, in der sich die Arbeiter trafen, um sich<br />
gemütlich einen hinter die Binde zu kippen. Onkel Willi wollte<br />
sich dort mit einem Kumpel treffen, aber als wir dort ankamen,<br />
war der noch nicht da. Aber da war schon ein anderer Mann,<br />
den Onkel Willi wohl aus früheren Zeiten kannte. Damals waren<br />
sie beide Genossen im Rotfrontkämpfer-Bund in Brandenburg<br />
gewesen. Aber gleich nach der Machtübernahme Hitlers<br />
war dieser Mann in die SA eingetreten. Er pöbelte meinen<br />
Onkel dauernd an, so dass schon die anderen Gäste aufmerksam<br />
wurden. Bald war das Gepöbel unerträglich, und Onkel<br />
Willi und ich beschlossen, nach Hause zu gehen. Aber wir<br />
kamen nicht weit, denn der SA Mann kam hinter uns her. Er<br />
griff meinen Onkel nun mit den Fäusten an, und Onkel Willi<br />
verteidigte sich. Es war nur eine kurze Schlägerei. Ein paar<br />
Faustschläge, und der SA Mann stolperte über die Bordsteinkante<br />
und lag am Boden. Wir beide ließen ihn liegen und gingen<br />
weiter in Richtung unserer Wohnung.<br />
48
Aber es dauerte nicht lange, und vier Polizisten standen vor<br />
der Tür. Von unserer Wohnung bis zum Rathaus, in dem das<br />
Polizeirevier war, waren es nur ca. 250 Meter. Aber die<br />
gesamte Strecke gingen sie mit großer Brutalität gegen<br />
meinen Onkel vor, in dem sie ihn mit Schlagstöcken traktierten.<br />
Auch wenn ich durch meine Minderjährigkeit Glück hatte<br />
und nur als Zeuge vernommen wurde, so war ich doch zutiefst<br />
entsetzt über die Brutalität. Unter Schock ging ich nach Hause.<br />
Über lange, lange Zeit konnte ich die Bilder dieser Nacht nicht<br />
aus meinen Gedanken verbannen.<br />
Dieser Vorfall wurde als politisch motiviere Straftat eingestuft<br />
und entsprechend bei Gericht verhandelt. Onkel Willi wurde<br />
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er kam bei Ausbruch des<br />
Krieges in das Konzentrationslager Buchenwald. Wenn auch<br />
erst 1951, so sah ich ihn doch zumindest lebend wieder.<br />
Nach der Gerichtsverhandlung wurde ich aus der Hitlerjugend<br />
ausgeschlossen. Ich nahm diese Tatsache nicht weiter tragisch,<br />
denn so hatte ich doch mehr Freizeit und brauchte an keiner<br />
Versammlung teilnehmen.<br />
Radfahrer<br />
Meine Familie blieb durch diesen Vorfall unbehelligt und alles<br />
beim Alten. Unsere Clique, die aus fünf Rennbegeisterten aus<br />
unserer Straße bestand, trainierte zweimal in der Woche. Dabei<br />
führten unsere Rennstrecken wahlweise von Brandenburg<br />
nach Rathenow oder Belzig oder Potsdam. Das waren immerhin<br />
pro Strecke 60 bis 80 Kilometer, und für unsere selbst gebauten<br />
Drahtesel eine ordentliche Leistung. Das Training musste<br />
sein, denn pro Monat fanden regelmäßig an der Brielower<br />
Rennbahn Rennen statt. Hier konnte auch teilnehmen, wer<br />
kein professionelles Rennrad besaß. Diese Rennen hatte den<br />
49
Namen „Der erste Schritt“ und war für meine Freunde und<br />
mich unser erstes angestrebtes Ziel.<br />
Heiner und ich wurden durch den Verein ermuntert, uns ein<br />
Rennrad auf Pump zu kaufen. Aber dazu reichte unser Lehrlingsgeld<br />
nicht aus. Außerdem hätte ich zu Hause die Hölle auf<br />
Erden durchlebt, wenn meine Mutter von solch einer Sache<br />
erfahren hätte. Von einem professionellen Rennrad konnte ich<br />
weiterhin nur träumen.<br />
Da die Ausbildung zum Former eine schwere körperliche Arbeit<br />
war, mussten wir Lehrlinge einmal im Jahr zu einer ärztlichen<br />
Reihenuntersuchung. Organisch war ich kerngesund. Aber<br />
der Arzt meinte, ich sei irgendwie nicht proportional entwickelt.<br />
Mein Unterkörper, also Beine, Waden Schenkel wären ordentlich<br />
kräftig ausgebildet, mein Oberkörper zeige dagegen<br />
Schwäche in Form von Hühnerbrust und Null Armmuskulatur.<br />
Der Arzt wies mir an, zwei Mal pro Woche schwimmen oder<br />
rudern zu gehen.<br />
Wasserfahrer<br />
Also trat ich in den Verein „Freie Wasserfahrer“ (in der DDR<br />
Zeit „Einheit“) am Wiesenweg ein. Das Training mit dem Rad<br />
wurde in der Woche zeitmäßig halbiert. Bei den Wasserfahrern<br />
im Wander-Gig-Vierer zweimal trainiert und zusätzlich einmal<br />
schwimmen im Hallenbad. Auch bei Heiner stellte der Arzt<br />
den gleichen Befund. Aber der ließ sich davon nicht beeindrucken.<br />
Bald war ich vom Rudern mehr begeistert als vom Radfahren.<br />
Denn sonntags ging es auf Wanderfahrt auf den Gewässern<br />
Brandenburgs und am Wochenende oft zum Zelten. Es war<br />
eine herrliche Zeit. Außerdem lernte ich viele neue Sportfreunde<br />
aus anderen Stadtteilen Brandenburgs kennen.<br />
50
Die veränderte Freizeitgestaltung brachte meine Lebensweise<br />
in eine ganz andere Bahn. Ich selbst war ja ein Kind aus der<br />
eher ärmlichen Arbeiterklasse. Im Ruderverein aber lernte<br />
ich junge Sportlerinnen und Sportler aus kleinbürgerlichen<br />
Schichten kennen. Mit Neugierde, Stauen und Interesse<br />
beobachtete ich diese Menschen, ihre Art sich zu kleiden, zu<br />
sprechen, sich zu benehmen. Vieles beeindruckte mich positiv,<br />
anderes stimmte mich nachdenklich. Aber es war auf alle Fälle<br />
eine Bereicherung meines Bewusstseins.<br />
Durch die Reduzierung des Rennradtrainings litt auch meine<br />
Freundschaft zu Heiner. Denn neben dem Interesse für den<br />
Wassersport war auch mein Interesse für Mädchen erwacht.<br />
Heiner indes lebte nach wie vor ausschließlich für den Radsport,<br />
und so war es nicht verwunderlich, dass er bald eifersüchtig<br />
auf meine anderen Interessen war. Ich konnte ihn ja<br />
sogar verstehen, denn er wollte unbedingt, dass ich sein Partner<br />
beim Radsport bleibe. Und wir hielten zusammen.<br />
Kriegsbeginn und der erste Tote<br />
Im September 1939 traf ich auch Inge wieder, als sie bei einem<br />
Besuch bei Herrn Imme war. Am ersten September begann<br />
der Ausbruch des Krieges mit dem Überfall Hitlers auf Polen.<br />
Dies sollte unser aller Leben verändern. Bereits am fünften<br />
Tag nach dem Polenfeldzug war Nachbar Immes Sohn Erwin<br />
gefallen. Er war erst 20 Jahre alt. Als wir von dessen Tod<br />
erfuhren, war die gesamte Hausgemeinschaft tief erschüttert.<br />
Der ferne Tod hatte plötzlich ein Gesicht, einen Namen, und<br />
er tat weh.<br />
Es kamen die Wintermonate mit viel Kälte und Schnee. Wir<br />
sahen de ersten polnischen Gefangenen, die zum Schneeschippen<br />
eingesetzt waren. Viele dieser Gefangenen waren für<br />
diese Kälte nur dürftig bekleidet, und an ihren ausgemergelten<br />
51
Gestalten konnte man erkennen, dass sie wenig zu essen<br />
bekamen. Menschen, die versuchten, die Gefangenen mit Brot<br />
oder Bekleidung zu versorgen, wurden als Volksverräter betitelt<br />
und von den Nazis des Platzes verwiesen. Wenn ein „Supernazi“<br />
dabei war, wurden sie sogar zur Anzeige gebracht.<br />
Aber es gab auch genug Brandenburger, die diese armen<br />
Menschen zusätzlich anpöbelten. Es war schlimm, das mit<br />
ansehen zu müssen. Den Menschen war ideologisch eingeimpft<br />
worden, dass dies unsere Feinde seien. Aber diese Ideologie<br />
kam nicht bei jedem an. Das lag einfach daran, dass wir alle<br />
Kinder von Arbeitern waren, deren Eltern entweder Sozis<br />
oder Kommunisten waren und sich gegen Hitlers Ideologien<br />
wehrten.<br />
Als der Frühling 1940 kam, zogen auch schon die nächsten<br />
dunklen Wolken auf. Sie kamen von Westen. Hitler begann<br />
den Krieg gegen Frankreich vorzubereiten.<br />
In der Formerei änderten sich auch einige Dinge. Der alte<br />
Lehrmeister war in Rente gegangen. Wir bekamen einen neuen<br />
Lehrgesellen, der im Polenfeldzug verwundet wurde und ein<br />
steifes Bein behalten hatte.<br />
Die Kriegsproduktion lief auf Hochtouren. Auch wir Lehrlinge<br />
wurden mit einbezogen und sollten Akkord arbeiten. Wir erhielten<br />
aber nur 60 Prozent des Lohnes. Zudem bekamen wir<br />
nur den „Fummelkram“, wo es ohnehin nicht viel zu verdienen<br />
gab. Dennoch verbesserte sich unsere finanzielle Situation<br />
deutlich. Denn statt der bisher gezahlten 6,- RM gab es nun<br />
bis zu 15,- RM in der Woche. Heiner und ich waren begeistert.<br />
Nun konnten wir unseren Traum von einem richtigen Rennrad<br />
wahr werden lassen.<br />
52
Das eigene Rennrad<br />
Heiner Eltern gestatteten<br />
ihm, ein Rennrad<br />
auf Abzahlung zu<br />
kaufen. Bei mir sah<br />
dass schon ganz anders<br />
aus. Der „liebe“<br />
Bergemann arbeitete ja<br />
ebenfalls in der Fabrik,<br />
in der ich meine Ausbildung<br />
machte. Nur<br />
eben in der Abteilung<br />
Maschinenformerei.<br />
Ich löste das Problem,<br />
indem ich erst mal zu<br />
Hause nichts erzählte.<br />
Aber mit Heiner fuhr<br />
ich eines Tages nach<br />
Nennhausen. Hier<br />
wohnte der Sportfreund<br />
Glagow. Er war<br />
Mit meinem Rennrad<br />
selbst Radrennfahrer,<br />
und er betrieb in Nennhausen eine Werkstatt mit Fahrradverkauf.<br />
Ich suchte mir ein herrliches Rennrad aus, gab mein altes Rad<br />
in Zahlung und handelte auch mit ihm den Vertrag aus. Da<br />
ich den Vertrag aber noch nicht selbst unterschreiben durfte,<br />
nahm ich diesen mit nach Hause und erklärte Herrn Glagow,<br />
dass ihn meine Mutter unterschreiben würde. Ich hatte Talent<br />
und sicherlich auch etwas kriminelle Energie. Denn die Urkundenfälschung<br />
kam nie heraus. Aber der Grund, weshalb alles so<br />
reibungslos klappte und niemals aufflog, lag zum einen daran,<br />
dass mein Rad bei Heiner untergestellt blieb, und daran, dass<br />
ich die Raten für das Rad immer pünktlich bezahlte. Den Tag<br />
53
der Ratenzahlung nutzte ich gleichzeitig als Trainingseinheit,<br />
denn es war immerhin eine Tour von 60 Kilometern.<br />
Der Krieg interessierte uns nicht wesentlich, nur dass Kartensystem,<br />
das eingeführt wurde. Wir trainierten fleißig und<br />
nahmen an jedem Renn teil. Egal, ob auf der Bahn oder auf der<br />
Straße. Wir fuhren für die HJ-Renngruppe und feierten viele<br />
Erfolge. So war es selbstverständlich, dass Heiner und ich in<br />
die Gau Kurmark-Auswahl berufen wurden. Gau Kurmark<br />
war die damalige Bezeichnung für das Land Brandenburg.<br />
Wir waren zwanzig Fahrer aus den Städten Potsdam, Brandenburg,<br />
Rathenow, Fürstenwalde und Cottbus. Die Partei<br />
setzte einen Sportleiter ein, der die Organisation leitete.<br />
Sein Name ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Wohl aber,<br />
dass er ein korpulenter, behäbiger, aber netter Kerl war, der<br />
über manche Dummheit, die wir verzapften, hinweg sah.<br />
Trotz des Krieges wurden im August 1940 in Erfurt die<br />
Sommerspiele der Jugend und Studenten aus allen Gauen<br />
durchgeführt. In Vorbereitung dieser Festspiele wurden<br />
Ausscheidungsrennen gegen die Jugendlichen der anderen<br />
Städte der Gau Kurmark gefahren. Heiner und ich schafften<br />
die Qualifikation und wurden delegiert.<br />
Die anderen Fahrer kamen aus Potsdam, Rathenow, Fürstenberg<br />
und einer aus Nennhausen. Hoch motiviert und voller<br />
Zuversicht fuhren wir nach Erfurt. Aber es wurde ein Desaster<br />
für uns Kurmärker. Keiner unserer Sportler schaffte es in<br />
irgend einer Disziplin, weder auf der Bahn noch auf der Straße,<br />
zu einem Platz unter die ersten Fünf. Wir hatten uns blamiert<br />
und fuhren deprimiert, aber trotzdem voller Eindrücke nach<br />
Hause.<br />
54
Vorbereitung auf den Fronteinsatz (1941)<br />
Musterung<br />
Das Leben ging weiter seinen gewohnten Gang. Arbeiten<br />
und trainieren, trainieren und arbeiten. Das Jahr 1940 ging<br />
zu Ende, und Deutschland hatte seine „Feinde“ Dänemark,<br />
Belgien, Norwegen und Holland erobert. Das Jahr 1941 kam,<br />
und durch die Siege herrschte bei den meisten Menschen eine<br />
Stimmung der Euphorie. Es wurden Jubelfeiern durchgeführt,<br />
und eine Sondermeldung jagte die nächste.<br />
Für mich und Heiner aber kam der Hammer. Wir mussten<br />
zur Musterung. Gesundheitlich wurden wir als „sehr gut“<br />
eingestuft und für die Waffengattung der Panzergrenadier als<br />
tauglich befunden. Am Ende des Saales saßen drei Offiziere<br />
vom Heer, Luftwaffe und Marine. Der vom Heer stempelte<br />
unsere Papiere ab, und damit war besiegelt, dass wir zu den<br />
Panzergrenadieren kommen würden. Heiner ging sofort nach<br />
Hause. Ich blieb etwas dort und sah und hörte mich noch etwas<br />
um. So stellte ich fest, dass die Offiziere der Luftwaffe und der<br />
Marine Freiwillige anwarben. Die Vorstellung, zur Marine zu<br />
gehen, reizte mich, und so stellte ich mich in dieser Reihe an.<br />
Es waren noch zwei Mann vor mir. In dieser Zeit des Wartens<br />
ging mir vieles durch den Kopf. Ich dachte an die Enge<br />
unserer Wohnung, an den Dunst der Küche, in der ich doch<br />
immer schlief, an die vielen Streitereien und den ewigen Zank<br />
zwischen meiner Mutter und Bergemann.<br />
Für mich stand fest. Ich wollte raus aus diesem Milieu. Als ich<br />
an der Reihe war, stand mein Entschluss fest. Ich wollte weg<br />
von Zuhause!! So wurde ich als Freiwilliger registriert, und<br />
in den kommenden Wochen und Monaten wartete ich voller<br />
Ungeduld auf den Bescheid aus Potsdam.<br />
55
Ein Anzug<br />
Die Heimlichkeit mit dem Verdienst im Akkord beendete ich<br />
mit einer Mitteilung an meine Mutter, denn es war erklärungsbedürftig,<br />
wohin mein altes Rad abhanden gekommen war<br />
und woher ich meine Bekleidung hatte. Meine Oma und Tante<br />
Hilde gaben mir einige Punkte von ihrer Bekleidungskarte<br />
ab, so dass ich mir einige Sachen kaufen konnte. Alles war ja<br />
seit dem Kriegsbeginn rationiert worden. Im Prinzip hatte ich<br />
nicht viel. Ein Tagesanzug, Sakko und Hosen. Dennoch war<br />
es im Kleiderschrank eng, und meine Sachen hingen immer<br />
an der Seite, außerhalb des Schrankes auf einem Bügel.<br />
Heiner und ich gingen gerne ins Theater in der Blumenstraße. So<br />
stand für mich fest, dass ich unbedingt einen Anzug brauchte.<br />
Also kaufte ich mir von den geschenkten Punkten einen Anzug,<br />
denn mit dem Tagesanzug konnte ich nicht in ein Theater<br />
gehen. Dieser Anzug und zwei Oberhemden plus ein Schlips<br />
verblieben bei Heiner, wo ich mich immer zum Besuch ins<br />
Theater umzog. Mutter Lotsch wusch meine Hemden mit. Ich<br />
war ja wie zu Hause in dieser Familie.<br />
Harzrundfahrt<br />
Für mich waren es schöne Tage und Wochen 1941, denn es<br />
wurden viele Radrennen gefahren. Mal mit Erfolg und mal mit<br />
Niederlagen. Zu Pfingsten nahmen wir an der Harzrundfahrt<br />
teil, die ich noch heute in Erinnerung habe.<br />
Pfingstsonntag sollte das Rennen stattfinden. Wir fuhren<br />
Sonnabend nach Feierabend gleich los, denn die 80 Kilometer<br />
bis Magdeburg mussten wir bis zur Anmeldung um 16:00 Uhr<br />
schaffen. Als wir in Magdeburg an der Anmeldestelle ankamen,<br />
wurden wir jedoch enttäuscht. Man hatte das Rennen auf den<br />
Montag verschoben. Also wieder zurück nach Hause.<br />
56
Am Sonntag fuhren wir wieder nach Magdeburg und meldeten<br />
uns an. Aber wo sollten wir übernachten? Das blieb uns selbst<br />
überlassen. Also fuhren wir acht Kilometer zurück in das Dorf<br />
Biederitz und haben bei den Bauern an den Türen geklopft.<br />
Wir hatten Glück, denn gleich der zweite war ein Sportfan.<br />
Wir wurden gut verköstigt und konnten auf dem Heuboden<br />
übernachten. Im Heu zu schlafen war wunderbar, aber den<br />
Geruch der Schlafdecken nach Pferdeschweiß habe ich noch<br />
heute in der Nase.<br />
Als Entschädigung erwarteten uns ein gutes Frühstück und<br />
viel Glück. Der Tag war sehr heiß, und die 80 Kilometer<br />
Rundstrecke für uns Jugendliche sehr anstrengend. In der<br />
Nähe von Egeln stürzte ich, und durch den weichen Asphalt<br />
hatte ich am linken Arm und am Oberschenkel eingebrannte<br />
Teerflecken und Hautabschürfungen. Ich belegte den 8. Platz,<br />
und der Preis war ein Satz Pedalen. Dafür hatte ich mich drei<br />
Tage lang 400 Kilometer abgestrampelt. Aber es war ein<br />
Erlebnis, dass mir immer in Erinnerung blieb.<br />
Unfall und Gesellenprüfung<br />
Ich hatte Inge längere Zeit nicht gesehen, und wollte ihr doch<br />
mein neues Rad zeigen. Deshalb fuhr ich nach dem Training<br />
des Öfteren durch die Kleiststraße, in der sie wohnte. Sie bei<br />
ihren Eltern zu besuchen fehlte mir der Mut. Ihr Vater hatte<br />
sehr seltsame Ansichten zu Freundschaften zwischen Mädchen<br />
und Jungen. Er befürchtete immer etwas Schlechtes. Aber eines<br />
Tages bei der Tour sah ich Mutter Arnswald und Inge aus<br />
dem Fenster schauen. Es wurden einige nichts sagende Worte<br />
ausgetauscht. Auf Wiedersehen, und das war es. Die Monate<br />
zogen sich dahin. Auf der Arbeit hatte ich einen Unfall. Beim<br />
Abgießen der Form hatte ich die Belastung des Formerkastens<br />
nicht richtig bedacht. Beim Gießen hob sich der obere Deckel,<br />
und das heiße Silicium spritzte mir an den linken Unterschenkel.<br />
57
Ich konnte mir eine Krankschreibung nicht erlauben, da ich<br />
in dieser Zeit meine Gesellenprüfung machen musste. Meine<br />
Prüfungen waren gut gelaufen, aber meine Wunde war stark<br />
vereitert. Als ich dann zum Arzt ging, erhielt ich eine mächtige<br />
Standpauke.<br />
Sportliche Erfolge<br />
Der Russlandfeldzug hatte begonnen, aber das Leben ging<br />
immer noch seinen gewohnten Gang. Im August wurden trotz<br />
des Krieges wieder „Sommerspiele der Jugend und Studenten“<br />
durchgeführt, diesmal in Breslau. Die Bombenangriffe der<br />
Engländer und Amerikaner führten schon bis Berlin. Deshalb<br />
war Breslau der sicherere Ort. Die Ausscheidungsrennen<br />
hatten wir wieder bestanden und waren somit delegiert. Und<br />
diesmal lief es für uns etwas besser. Beim 80-Kilometer-<br />
Straßenrennen belegten wir im 6er-Mannschaftsfahren den<br />
dritten Platz. Heiner holte auf der Bahn beim Verfolgungsrennen<br />
sogar den zweiten Platz. Es war noch mal eine Woche lang, ein<br />
tolles Erlebnis. Tage der Freundschaft und des Vergessens, dass<br />
Krieg war.<br />
Als wir zurückfuhren, sahen wir nur noch Militärtransporte.<br />
Und als ich zu Hause ankam, erlebte ich die freudige Überraschung,<br />
dass mein Dienst in der Marine am 1. September<br />
in Brake an der Weser beginnt. Hinter mir lagen die Tage der<br />
ärztlichen Untersuchungen und Prüfungen, und die Vorbereitungen<br />
zur Abreise wurden getroffen.<br />
Einberufen<br />
Am Abend der Abreise, es ging um 23.00 Uhr los, verabschiedete<br />
ich mich bei Oma, Tante und Heiners Familie. Mit<br />
großer Erwartung und Freude, aber ohne Schamgefühl, so<br />
58
still und ohne Abschiedsworte zu meiner Mutter und Bergemann,<br />
fuhr ich meinem neuen Lebensweg entgegen.<br />
Brake an der Weser war ein idyllisches Fischerdorf mit einem<br />
großen Kasernenkomplex. Hier hatte die “2. Schiffsstammabteilung<br />
Nordsee“ ihre Zentrale. Hier wurden wir acht Wochen<br />
als Rekruten geschliffen. Uns<br />
wurden die Grundbegriffe des<br />
Militärs beigebracht. Aber<br />
was sind schon acht Wochen<br />
Ausbildung? Die Zeit war hart,<br />
aber zu ertragen. Ich lernte viele<br />
Kameraden aus allen Landesteilen<br />
kennen. Vor allem aber<br />
lernte ich Kameradschaft,<br />
Ordnung und Disziplin.<br />
Anfang November ging es<br />
bei Nacht und Nebel nach<br />
Wilhelmshaven in die Jachtmann-Kaserne.<br />
Dort wurden<br />
wir noch einmal ärztlich untersucht<br />
und auf Seetauglichkeit<br />
überprüft. Voller Spannung<br />
erwartete ich das Ergebnis,<br />
denn jeder hatte ja den Wunsch, zu einer fahrenden Einheit<br />
zu kommen. Egal ob Kreuzer, Zerstörer oder U-Boot.<br />
Abschied von der Familie<br />
Als Rekrut in Brake<br />
Das Urteil! U-Boot- und tropentauglich. Ich muss ehrlich sagen,<br />
zur U-Bootgattung zu gehen, hatte ich kein großes Verlangen.<br />
Tagelang im Mief ausharren und nur ab und zu<br />
an Deck um frische Luft zu schnappen, und nur Wasser<br />
sehen. Aber zunächst einmal ging es, für vier Wochen, von<br />
59
Wilhelmshaven nach Wesermünde ins Durchgangslager. Von<br />
dort aus schrieb ich an meine Oma einen Brief, um ihr mitzuteilen,<br />
dass ich Kürze zum Einsatz kommen würde.<br />
Eines Tages wurde ich zur Wache gerufen. Und wer stand da?<br />
Zornesrot im Gesicht Oma, verdattert mein Opa und meine kleine<br />
Cousine Eva. Meine Oma wollte mich unbedingt noch einmal<br />
sehen, bevor ich ins Feld ziehen würde. An der Wache hatte<br />
man ihr gesagt, dass kein Soldat Ausgang bekommt. Daraufhin<br />
haute sie mit dem Regenschirm auf den Tisch des Wachhabenden<br />
und machte ganz schön Rabatz. Sie sei schließlich<br />
den weiten Weg von Brandenburg nach Wesermünde nicht<br />
aus Vergnügen gefahren. Nach dieser Vorstellung bekam ich<br />
Ausgang. Sogar bis zum Wecken.<br />
Ich wurde in das größte Restaurant der Stadt „Reichskanzler“<br />
geführt, und wir speisten großzügig. Oma hatte dafür ihre<br />
letzten Lebensmittelkarten geopfert.<br />
Ich war eben ihr „Großer“, an dem sie besonders hing. Unter<br />
Tränen nahmen wir Abschied auf dem Bahnhof. Nur Opa sagte<br />
kein Wort zu mir. Er war wie immer schweigsam.<br />
Letzter Schliff<br />
Einige Tage später kam der Marschbefehl. Bei Nacht und Nebel<br />
ging es los. Keiner von uns wusste, wohin die Reise gehen<br />
sollte.<br />
Am nächsten Morgen, noch in der Dunkelheit, kamen wir in<br />
Kiel an und gingen an Bord des Linienschiffes „Schlesien“.<br />
Für direkte Kampfeinsätze war sie ausgemustert worden und<br />
diente als Schulschiff für Kadetten und junge Matrosen für<br />
Großkampfschiffe. Das war der letzte Ausbildungslehrgang,<br />
und wir operierten nur in der Ostsee bis Finnland. An Bord<br />
waren außer der Besatzung 120 Kadetten und 120 Jungmatrosen.<br />
Wir hatten alle die gleiche Ausbildung. Der Unterschied<br />
bestand darin, dass die Kadetten nach neun Monaten<br />
60
Ausbildung Offiziere wurden und wir nach bereits sieben<br />
Monaten Gefreite.<br />
Die Ausbildung dauerte auf dem Schiff sechs Monate. Es war<br />
schwer, auf engstem Raum kameradschaftlich zusammen zu<br />
leben. Schließlich kamen wir aus allen Teilen Deutschlands.<br />
Aber es wurden uns Ordnung, Sauberkeit, Disziplin und<br />
Kameradschaft beigebracht. Diese Schule prägte mein zukünftiges<br />
Leben. Nachhaltig beeindruckt hat mich die Kameradschaft<br />
zwischen der Mannschaft und den Offizieren.<br />
Da die Ausbildung sehr hart war, kamen mir hin und wieder<br />
Zweifel, ob es richtig gewesen war, sich freiwillig zu melden.<br />
Es gab Augenblicke, da lag ich in meiner Hängematte und<br />
heulte Blasen.<br />
Es war schrecklich, bei - 40 °C Wache an den Geschützen zu<br />
stehen. Trotz Schafpelzmütze und Filzstiefel, fror ich erbärmlich.<br />
Schöne und interessante Momente waren für mich,<br />
wenn ich am Ruder oder am Maschinentelegraphen stehen<br />
durfte. Dann hatte ich das erhebende Gefühl, die Führung des<br />
Schiffes läge in meiner Hand.<br />
Die „Schlesien“ diente auch als Eisbrecher. Mitunter mussten<br />
für die Versorgungsschiffe bis zu einem Meter starke Eisdecken<br />
aufgebrochen werden, um die Fahrrinne zu öffnen. In<br />
den sechs Monaten Ausbildung kamen wir insgesamt nur<br />
zwei Mal an Land. Einmal in Stettin und einmal in Gotenhafen.<br />
Da immer nur eine Seite des Schiffes, also Back- oder<br />
Steuerbord, an Land gehen durften, kam es immer zu kleineren<br />
Schikanen. Die Verlierer mussten dann folgenden Spruch über<br />
sich ergehen lassen: „Was wollt ihr denn an Land gehen, das<br />
Land könnt ihr von Bord aus sehen.“<br />
61
Feindberührungen hatten wir nur zwei Mal, jeweils im finnischen<br />
Meerbusen, als wir für zwei Transportschiffe durch das Eis<br />
eine Fahrrinne brechen mussten.<br />
Der Nachschub zur Ostfront über See war sehr schwierig. Die<br />
Angriffe der russischen Rata-Kampfflugzeuge waren für uns<br />
hingegen wenig aufregend.<br />
Im April, wir ankerten im Hafen von Stettin, erhielt ich Post<br />
von zu Hause. Mein Freund Heiner war in Russland, in der<br />
Nähe von Orel gefallen. Ich war schockiert. Mein bester<br />
Freund war tod. Ich brauchte lange, um diese Nachricht zu<br />
verarbeiten. Heiner war nur einen Monat nach mir zu den<br />
Panzergrenadieren eingezogen worden und kam nach der<br />
Rekrutenausbildung gleich an die Front.<br />
Jetzt war von den sechs Kindern in seiner Familie schon der<br />
zweite Sohn gefallen. Heiners ältester Bruder war in Frankreich<br />
geblieben.<br />
62
Im Krieg in Mittelmeer und Adria (1941 – 1943)<br />
Richtung Front<br />
Ende Mai war die Ausbildung zu Ende und es ging wieder<br />
zurück nach Wilhelmshafen. Von nun an ging es zügig voran.<br />
Ärztliche Untersuchung,<br />
Einkleidung mit der Tropenuniform.<br />
Meine Sorge, zur<br />
U-Bootflotte zu kommen,<br />
war unbegründet. Mittlerweile<br />
war ich sehr froh darüber,<br />
denn es hatte sich<br />
herumgesprochen, dass die<br />
U-Boote durch die Radarsysteme<br />
der Alliierten kaum<br />
eine Chance hatten und<br />
große Verluste hinnehmen<br />
mussten.<br />
Vielleicht fragt sich an dieser<br />
Stelle der Leser, weshalb ich<br />
mich freiwillig gemeldet<br />
In Tropenuniform<br />
habe, wenn ich doch nicht<br />
bereit war, für Volk und<br />
Führer zu sterben? Mein Hauptgrund war, dass ich meinem<br />
häuslichen Milieu entfliehen wollte. Ich wollte einfach weg<br />
von Zuhause, und die Armee kam mir gelegen. Natürlich<br />
war ich als junger Mensch auch Idealist. Ich wollte patriotisch<br />
meinem Land dienen. Aber sterben wollte ich auf keinen Fall.<br />
Außerdem wäre ich, wie mein Freund Heiner, einen Monat<br />
nach meiner Freiwilligkeit sowieso gezogen worden. Diesem<br />
Krieg hätte ich mich nicht entziehen können.<br />
63
Endlich ging es los. Wir fuhren in Richtung Süden, aber wegen<br />
der Geheimhaltung wussten wir zunächst nicht, wohin genau.<br />
Der erste Halt war in München, und wir wurden in einer<br />
Kaserne der Gebirgsjäger einquartiert. Wir pausierten hier<br />
zwei Tage. Es wurde lediglich ein Propagandamarsch durch<br />
München durchgeführt, dann hatten wir freien Ausgang. Es<br />
war Kirmeszeit, und ganz ohne Fliegeralarm konnten wir uns<br />
amüsieren. Das Amüsieren wurde uns auch leicht gemacht,<br />
denn als Marinesoldaten hatten wir viele Sympathisanten, die<br />
uns auch viel spendierten.<br />
Die Fahrt ging weiter über die Alpen. Wir passierten den<br />
Brenner, dann Bologna, Florenz und Rom, weiter ging es bis<br />
Neapel. Hier war unser Flottenstützpunkt.<br />
Ich war glücklich, denn ein Traum ging in Erfüllung. Ich<br />
konnte andere Länder und ihre Menschen kennen lernen.<br />
Schon die Zugfahrt empfand ich als ein großes Abenteuer. Die<br />
rasend schnelle Fahrt durch die Dolomiten beeindruckte mich<br />
sehr. Auf der einen Seite des Zuges hohe Felswände und auf<br />
der anderen Seite tiefe und steile Abhänge. Dann ging es ins<br />
Flachland, in die Po-Ebene. Dieses Land wurde in der Zeit des<br />
Faschismus von Sumpfland in Ackerland kultiviert. Während<br />
meiner Einsatzzeit in Italien fuhr ich später diese Strecke noch<br />
zweimal, und es war immer ein großes Erlebnis.<br />
Erster Einsatz<br />
In Neapel wurden wir in das Hotel “Albergo Universo“ einquartiert.<br />
Es lag ganz in der Nähe des Hafens. Aber die Freude,<br />
in einem Hotel wohnen zu dürfen und das Leben in vollen<br />
Zügen genießen zu können, war nur von kurzer Dauer. Im<br />
Hafen gab es ein riesiges Terminalgebäude mit einer großen<br />
Halle. Seitlich des Gebäudes befanden sich die Diensträume<br />
der Marine. Wir waren der II. Bordflak-Süd unterstellt, die<br />
64
selbst keine Kriegsschiffe hatte, aber Transportschiffe, die für<br />
Rommel Nachschub nach Afrika brachten. Auf diese Transportschiffe<br />
wurden wir als Flakschutz kommandiert. Da wir auf<br />
dem Schulschiff an allen Flak-Waffen jeden Kalibers ausgebildet<br />
worden waren, waren wir praktisch spezialisiert für diese<br />
Aufgabe.<br />
Unsere Enttäuschung war verständlich, zumal wir angenommen<br />
hatten, nach der Ausbildung auf Schlachtschiffe, Kreuzer<br />
oder Zerstörer zu kommen. Aber dem war nicht so. Es war<br />
Anfang Juli 1942 und mein erstes Kommando auf einer Siebelfähre,<br />
die im Hafen von Toronto lag. Mein Gott, waren wir<br />
12 Matrosen enttäuscht. Mit diesem Schlickenrutscher sollten<br />
wir den Feind besiegen? Diese Fähre bestand aus zwei großen<br />
Pontons, quer rüber mit Stahlträger verbunden und mit dicken<br />
Bohlen belegt. Achtern je zwei Ponton, ein großer BMW Motor,<br />
bestückt mit 2-cm-Flakgeschützen und 2 MG’s.<br />
Als Transportgut waren 10 Fässer mit je 200 l Treibstoff für<br />
Panzer geladen worden. Rommel hatte Ende Juni Tobruk erobert<br />
und brauchte dringend Nachschub, denn das Afrika-Korps<br />
war schon bis kurz vor El Alamein vorgedrungen.<br />
Ich muss ehrlich eingestehen, dass ich mir den Krieg so nicht<br />
vorgestellt hatte. Es war herrliches Wetter bei blankem Sonnenschein,<br />
und die See lag spiegelglatt. Wir machten manchmal<br />
sogar Halt, um zu schwimmen. Nur die Nächte waren kühl.<br />
Als wir nach zwei Tagen in Tobruk ankamen, wurden wir mit<br />
großem Hallo, aber auch mit ungläubigen Gesichtern begrüßt.<br />
Ein Offizier des Afrika-Korps dankte uns für die „heldenhafte<br />
Fahrt.“ Er sagte, dass es ihm unverständlich sei, warum uns<br />
unser Marinekorps ohne jeglichen Schutz los geschickt hatte.<br />
Mit einem leeren Frachter ging es dann am nächsten Tag zurück<br />
zu unserem Stützpunkt. Dort bekamen wir einige freie Tage,<br />
65
und dann ging er los, der Krieg. Im Hafen von Neapel wurde<br />
ein Konvoi zusammengestellt. Zwölf Frachtschiffe erhielten<br />
Begleitschutz von sechs italienischen Zerstörern. Es waren alles<br />
Schiffe aus verschiedenen Ländern des Mittelmeerraumes.<br />
Sie alle waren erobert worden.<br />
Feuertaufe und „Badefahrt“<br />
Ich wurde der „Trentino“ zugeteilt, einem italienischen Schiff,<br />
dass mit sechs Flakständen bestückt war. Während dieses<br />
Geleitzuges erhielt ich meine erste wirkliche Feuerprobe.<br />
Wir wurden durch sechs Torpedoflugzeuge angegriffen. Von<br />
sämtlichen Schiffen dieses Konvois wurde mit allen Flaks auf<br />
die Flieger geschossen. Sie hatten keine wirkliche Chance.<br />
Vier wurden abgeschossen bevor sie ihre Torpedos abwerfen<br />
konnten. Zwei jedoch warfen ihre Torpedos ab und es traf ein<br />
Schiff des Konvois. Es versank. Bis zum Zielhafen in Tripolis<br />
erlebte ich mehrere Angriffe dieser Art. Wir verloren insgesamt<br />
fünf Frachter.<br />
Auf diese Fahrt erlebte ich den wahren Krieg und meine Feuertaufe.<br />
Ich sah die ersten Verwundeten und Toten. Ich spürte<br />
Angst wie noch nie in meinem Leben zuvor. Aber die war,<br />
solange die Waffe keine Ladungshemmung hatte, nicht gleich<br />
da. Sie kam mit der Machtlosigkeit, sich nicht wehren zu können.<br />
Diese Ängste verloren sich aber schon in kurzer Zeit bei den<br />
nächsten Fahrten. Mit jeder Fahrt und den immer wiederkehrenden<br />
Angriffen wurde ich erfahrener - und gleichgültiger.<br />
Ich konnte meinem Schicksal nicht entrinnen, denn ich war<br />
den Befehlen untergeordnet.<br />
In Tobruk wurden die Ladungen schnell gelöscht, und es<br />
ging zurück nach Taranto, wo wir zwei Seefrachter und zwei<br />
italienische Zerstörer als Bewacher begleiteten. Auf der<br />
„Trentino“, während meiner zweiten Fahrt auf ihr, erlebte ich<br />
66
meine erste „Badefahrt“. Rommel hatte El Alamain, kurz vor<br />
Alexandrien, erreicht, und es war dringend notwendig, den<br />
Nachschub so schnell wie möglich nach Afrika zu bringen.<br />
Wieder ging es mit einem Konvoi südwärts nach Tobruk.<br />
Neun Frachter und zwei Zerstörer gingen in voller Fahrt an<br />
der Westküste Siziliens vorbei und machten einen großen Bogen<br />
um Malta, da vermutet wurde, dass die Engländer Malta wieder<br />
belegt hatten.<br />
Es war ein heißer Augustnachmittag, als sich von Osten her<br />
zwölf Torpedoflugzeuge vom Typ“ Beaufort“ auf unseren<br />
Konvois stürzten. Dieser Angriff war für uns überraschend,<br />
da wir Angriffe aus Malta, also aus Richtung Westen erwartet<br />
hatten. Es war ein kurzer Kampf. So schnell wie sie kamen,<br />
waren sie wieder weg. Wir hatten drei Frachter verloren, und<br />
ein Zerstörer war schwer beschädigt worden. Ich war auf einem<br />
der drei Frachter. Er wurde zwischen dem Vorderschiff und<br />
dem Maschinenraum durch ein Torpedo getroffen. Der vordere<br />
Flakstand war samt Mannschaft vollständig wegrasiert worden.<br />
Auch die Maschinisten sind alle umgekommen. Meine Flakmannschaft,<br />
kam mit einigen Blessuren lebend davon. Ich<br />
und meine Kameraden hatten viel Glück. Erstens schlug der<br />
Treffer im Bug ein und mein Flakstand war Achtern. Zweitens<br />
erhielten wir den sofortigen Befehl vom Flakleiter, von Bord zu<br />
springen, so dass wir genügend Zeit hatten, aus dem Sog des<br />
sinkenden Schiffes zu schwimmen. Wir wurden von einem<br />
andren Frachter aufgenommen und mussten wieder nach<br />
Tobruk zurück. Zwei Tage später wurden wir mit einer Ju52<br />
nach Kreta geflogen. Dort landeten wir auf dem Flughafen<br />
Iraklion. In Iraklion wurden drei Kameraden und ich auf ein<br />
Landungsboot kommandiert, das mit defekten Militärfahrzeugen<br />
nach Bari fahren sollte. An Deck wurde tatsächlich<br />
eine Vierlingsflak aufgebaut, die wir bedienen sollten. Diese<br />
67
Fahrt war eine Sonntagsfahrt. Es gab keine besonderen Vorkommnisse!!!<br />
Erster Heimaturlaub<br />
Von Bari aus ging es nach Neapel zum Stützpunkt. Hier wurde<br />
ich neu eingekleidet und bekam zwei Wochen Urlaub, was<br />
nach einer „Versenkung“ Usus war. Nach Empfang des<br />
Urlaubsscheines und des Soldes, ging es ans Einkaufen. Damenstrümpfe,<br />
Seidenschals, Tabakwaren und vor allem Bohnenkaffee<br />
für Oma. Bohnenkaffee war ihre Leidenschaft, und mit<br />
ihm konnte man bei ihr alles erreichen.<br />
Die Eisenbahnfahrt von Neapel nach Berlin habe ich sehr<br />
genossen. Ich machte einen Abstecher nach Breslau, denn ich<br />
hatte genügend Zeit, um für einen Kameraden, dessen Eltern<br />
eine Bäckerei in Lohbrück bei Breslau hatten, einige Geschenke<br />
abzugeben.<br />
Seine Eltern, das Ehepaar Nitschke, waren nette, freundliche<br />
Leute, deren Freude riesig war, und sie bedrängten mich,<br />
noch drei Tage zu bleiben, was ich gern tat. Denn so konnte<br />
ich wieder einmal Breslau besichtigen, wo ich 1941 die Sommerspiele<br />
der Jugend als Radfahrer erlebt hatte.<br />
Nitschkes bemutterten mich wie einen Sohn, und ich erlebte<br />
wiederum, wie bei den Försterleuten in Schlesien, ein geordnetes,<br />
sauberes und führsorgliches Familienleben. Mit gemischten<br />
Gefühlen nahm ich Abschied von meinen Gasteltern.<br />
Es war ein rührender Moment, mit Tränen, Umarmungen<br />
und sogar einem Küsschen von Mutter Nitschke. Wo hatte ich<br />
so etwas zu Hause schon einmal erlebt? Höchstens bei Oma<br />
natürlich.<br />
Nach meiner Ankunft in Brandenburg ging ich erst nach Hause,<br />
denn unsere Wohnung war in der Nähe des Bahnhofes. Ich<br />
68
überbrachte nur die Geschenke für meine Mutter und Geschwister<br />
und verschwand nach kurzer Zeit wieder.<br />
Mein Zuhause während des Urlaubs war bei meiner Oma. Sie<br />
wohnte in der Büttelstraße 8 und hatte eine geräumige Drei-<br />
Zimmer-Wohnung. Als ich in die Nähe der Wohnung kam,<br />
sah ich am Fenster schon meinen Opa mit einem Sofakissen<br />
unter den Armen und wie immer an seiner Pfeife saugend.<br />
Meine Oma war ganz aus dem Häuschen, denn ich hatte mich<br />
nicht angemeldet.<br />
Ihre ersten Worte waren: “Großer, hast du Bohnenkaffee mitgebracht?“,<br />
erst dann schloss sie mich herzlich in die Arme.<br />
Obwohl sie Rentnerin war, arbeitete sie immer noch als Toilettenfrau<br />
im Kaffeehaus „Cafe Oske“ am Neustädtischen Markt.<br />
Den Bohnekaffee versteckte meine Oma in einer Gasmasken-<br />
Büchse, die ich ihr gegeben hatte. Aus Dankbarkeit für den<br />
Kaffee hatte ich immer Taschengeld in meinem Kolanie<br />
(Marinejacke).<br />
Aber der Urlaub war<br />
nicht nur unbeschwert.<br />
Ich hatte einen schweren<br />
Gang vor mir, den<br />
Beileidsbesuch bei den<br />
Eltern meines besten<br />
Freundes Heiner. Ich<br />
hatte das Gefühl, ihm<br />
das schuldig zu sein.<br />
Aufgeregt und mit<br />
klopfendem Herzen<br />
stand ich vor der Tür.<br />
Mein Jugendfreund Heiner Lotsch (re.)<br />
in Frankfurt (Oder)<br />
Am liebsten hätte ich wieder kehrt gemacht. Sie waren für<br />
mich wie Pflegeeltern gewesen, denen ich viel zu verdanken<br />
hatte. Zu meiner Überraschung wurde ich freundlich, wenn<br />
auch zurückhaltend empfangen. Mutter Lotsch umarmte<br />
69
mich sogar. Nach dem Abspulen der Beileidsworte übergab<br />
ich Muter Lotsch Parfüm und Seife als ihre Geschenke. Für<br />
Vater Lotsch hatte ich Tabak mitgebracht. Es war dennoch ein<br />
bedrückender Besuch für mich, denn ich hatte das Gefühl,<br />
dass Muter Lotsch mich ständig mit Blicken ansah, die ich<br />
nicht deuten konnte. Mir war elend zumute, und ihre Blicke<br />
gingen mir lange Zeit nicht aus dem Kopf.<br />
Die folgenden Tage waren ausgefüllt mit der Suche nach Unterhaltung<br />
und mit Treffen mit Kameraden und Bekannten. Einen<br />
Marinekameraden zu treffen war schwierig, denn ich hatte auf<br />
dem Wehrmachtsamt gehört,<br />
dass außer mir nur noch einer<br />
in Brandenburg auf Urlaub<br />
war. Ich war etwas enttäuscht,<br />
denn so konnte ich<br />
nicht mit mehreren Marinekameraden<br />
die Sau rauslassen.<br />
Mit einer Marineuniform<br />
in einer Garnisonsstadt wie<br />
Brandenburg, die voll von<br />
Grauröcken war, waren wir<br />
als Marinesoldaten schon<br />
etwas Besonderes. Und die<br />
Aufmerksamkeit, die ich mit<br />
meiner Uniform bekam,<br />
machte mich stolz und auch<br />
ein wenig eingebildet.<br />
Im Fronturlaub<br />
So trödelten die Urlaubstage<br />
dahin, bis ich eine Freundin<br />
von Inge Arnswald traf. Wir gingen, wie es in der damaligen<br />
Zeit üblich war, ins Kino und hielten Händchen. Mehr war da<br />
nicht, denn sie war nicht mein Typ. Während eines Treffens,<br />
erzählte sie mir, das Inge ihr Pflichtjahr in Trechwitz ableisten<br />
70
würde. Ich beschloss, Inges Mutter zu besuchen. Ihr Vater war<br />
an der Front, ansonsten hätte mir wohl der Mut zu dem Besuch<br />
gefehlt. Frau Arnswald erzählte mir, dass Inge bei einem<br />
Bauern in Trechwitz sei und ich sie doch mal besuchen solle,<br />
denn sie würde sich sehr darüber freuen. Mein eigenes Rennrad<br />
hatte ich gut verpackt und ich wollte es nicht auspacken.<br />
So teilte ich Frau Arnswald mein Bedauern darüber mit, dass<br />
ich kein Rad hätte, worauf sie mir prompt ihr Fahrrad anbot.<br />
Also sprang ich aufs Rad<br />
und fuhr zu Inge. Als ich<br />
bei ihr ankam, war sie total<br />
überrascht. Die Bäuerin, Frau<br />
Brüggemann, war eine nette<br />
und freundliche Frau. Als<br />
sie mich sah, sagte sie zu<br />
Inge: “Na, du hast mir ja<br />
noch gar nichts von deinem<br />
Freund erzählt.“ Inge machte<br />
das verlegen, und ich war<br />
verdattert. Ich wurde zum<br />
Abendbrot eingeladen, und<br />
wir tauschten Erinnerungen.<br />
Dabei klärten wir Frau Brüggemann<br />
freundlich über Inge<br />
und unser Kennenlernen und<br />
Verhältnis zueinander auf. Da<br />
Inge Arnswald mit Dieter Brüggemann<br />
es schon Dunkel war, als ich<br />
aufbrechen wollte, lud mich<br />
Frau Brüggemann ein, zu übernachten. Inges Kammer war<br />
ohnehin leer, denn sie schlief bei der Bäuerin im Schlafzimmer,<br />
wenn deren Ehemann nicht da war. Diese Begegnung mit<br />
Inge war im August 1942. Inge war 16 Jahre und ich 19 Jahre<br />
alt, und unsere Begegnung verlief freundschaftlich.<br />
71
Auch meine ehemaligen Kollegen in der Formerei stattete ich<br />
einen Besuch ab. Von ihnen gab es viel Trara und Schulterklopfen,<br />
weil ich mich freiwillig zum Kampf für „Führer und<br />
Vaterland“ gemeldet hatte. (Als ich 1947 aus der Gefangenschaft<br />
kam und wieder in der Formerei anfing, wurde ich von<br />
einigen wenigen mit den Worten empfangen: “Da kommt ja<br />
der Kriegsverlängerer“.)<br />
Rückkehr in den Krieg<br />
Es war insgesamt kein weltbewegender Urlaub, und ich war<br />
auch zufrieden, als ich wieder bei meiner Einheit in Neapel eintraf.<br />
Der Stützpunkt war in der Nähe des „Castell de Mare“.<br />
Als ich mich dort meldete, wurde ich mit schlechten Nachrichten<br />
empfangen. Es waren wieder Schiffe versenkt worden, und<br />
wir hatten hohe Verluste hinnehmen müssen.<br />
Einige Tage später erhielt ich den Marschbefehl nach Brindisi an<br />
der Ostküste. Ich kam auf die „Roselli“, einem italienischen<br />
Frachter, und wurde wieder an das Geschütz Achtern befohlen.<br />
Die Zusammenstellung des Konvois war wieder die gleiche.<br />
Einige Zerstörer bewachten den Konvoi. Jedes Schiff, das sein<br />
Ziel erreichte, war ein Gewinn für das Afrika Korps. Uns wunderte<br />
sehr, dass die Angriffe durch englische Torpedoflugzeuge gering<br />
waren.<br />
Schicksalsfahrt vor Malta<br />
Wir bekamen die Meldung, dass Malta täglich durch unsere<br />
Luftwaffe mit Bomben belegt worden war und die Engländer<br />
dadurch ihren Stützpunkt auf Malta nicht mehr richtig nutzen<br />
konnten. Der Flugplatz war zerstört worden und zum großen<br />
Teil auch die Flugzeuge. Malta war, zwischen Sizilien und Afrika<br />
gelegen, wie ein Klotz am Bein, denn von dort erfolgten die<br />
72
meisten und verlustreichsten Angriffe der Briten. Die Ausschaltung<br />
Maltas verschaffte uns eine große Erholungspause.<br />
Bis Ende September fuhr ich drei Blockadefahrten. Die Dritte<br />
der Fahrten sollte meine Schicksalsfahrt mit glücklichem Ausgang<br />
werden.<br />
Wir sahen schon die Küste von Tobruk, als aus der grellen<br />
Sonne der überraschende Angriff kam. Wir hatten keine<br />
Chance. Alle Frachter fuhren Flächenförmig auseinander, um<br />
den Flugzeugen kein kompaktes Angriffsziel zu bieten. Malta<br />
war durch den zerstörten Flugplatz kein intakter Stützpunkt<br />
mehr für die Briten. Woher also kam der Angriff? Der Angriff<br />
der Briten kam aus Ägypten. Der Angriff war dank des Überraschungseffekts<br />
nur kurz. Mein Schiff erhielt einen Treffer<br />
mittschiffs, und wir sprangen alle über Bord. Die Matrosen<br />
kappten noch einige Rettungsflöße. Für das Abhieven der Rettungsboote,<br />
war die Schräglage des Schiffes schon zu groß. Die<br />
Kameraden der Flak mittschiffs waren sofort tot. Es gab noch<br />
einige Verwundete, aber insgesamt hätte für mich alles noch<br />
schlimmer ausgehen können. Der Materialverlust war enorm<br />
hoch. Die Hälfte des Konvois war versenkt bzw. beschädigt<br />
worden. Nach zwei Stunden im Wasser wurden wir von zwei<br />
Landungsbooten aus Tobruk ans Land gebracht. Wir waren<br />
ein jämmerlicher Haufen, ohne Schuhe und Jacken und zum<br />
Teil verwundet. Ich hatte zum Glück keine Verletzungen. Da<br />
in Tobruk ein Materialdepot des Afrika-Korps war, wurden<br />
wir mit einer Tropenuniform und anderen nötigen Sachen<br />
eingekleidet.<br />
Wir waren in der Annahme, dass wir sofort nach Italien zurückkehren<br />
würden. In dieser Annahme wurden wir enttäuscht.<br />
Es ging ab in die Wüste, in ein Zeltlager, das ca.<br />
5 Kilometer von Tobruk entfernt war. Hier sollten neue Einheiten<br />
zusammengestellt werden. Wir sollten als Marineflak<br />
mit Vierlingsflakgeschützen auf Landlafetten die Luftsicherung<br />
73
übernehmen. Durch die hohen Verluste beim Nachschub waren<br />
große Versorgungslücken entstanden. Aber für mich es ging<br />
wieder zurück nach Tobruk, weil keine Flakgeschütze zur<br />
Verfügung standen. Die Tage im Zeltlager, das Tropenklima,<br />
heiße Tage bis 34 Grad Hitze und kalte Nächte bis 6 Grad,<br />
bekamen mir gesundheitlich nicht. Ich bekam einen blutigen<br />
Durchfall. Diese Übel sollte für mich ein Glücksfall sein, der<br />
mir wohl das Leben gerettet hat. Aber dazu an späterer Stelle<br />
mehr.<br />
Mit einem Landungsboot wurden wir nach Italien gebracht.<br />
In der Nacht setzte ein großer Sturm ein, und Wasser drang<br />
durch die Landungsklappe am Bug. Auf den Laufgängen<br />
Back- und Steuerbord wurden Handpumpen angesetzt. Je<br />
zwei Mann an jeder Pumpe mussten diese eine Stunde lang<br />
bedienen, dann wurde abgelöst. Mir war auf dieser Fahrt<br />
kotzübel. Ich litt bei hohem Wellengang auf fast jedem Frachter<br />
an der Seekrankheit. Was ich mir an Essen einverleibt hatte,<br />
kotzte ich im hohen Bogen wieder aus. Ein Ratschlag eines<br />
älteren Matrosen half mir. Kotzen, Zwieback essen, kotzen,<br />
wieder Zwieback essen usw.. Nach einer gewissen Zeit führte<br />
diese Methode bei mir immer zum Erfolg, und es stellte sich<br />
Besserung ein. Zwieback oder Hartkekse gehörten also immer<br />
in meine Kolanitasche. Im Stützpunkt von Neapel gab es für<br />
meine Kumpel eine große Enttäuschung, als wir dort ankamen.<br />
Wir hatten auf Urlaub gehofft, aber man gewährte uns nur<br />
drei Tage Erholung in einem Hotel „Albergo Universo“, in der<br />
Nähe des Hafens. Da ich erst im August/September Urlaub gehabt<br />
hatte, war ich nicht so enttäuscht.<br />
Glück oder Intuition?<br />
Nach den drei Tagen erhielt ich meinen neuen Dienstauftrag.<br />
Es war ein französischer Frachter, der im Hafen von Bari lag.<br />
Wenn man an Bord eines neuen Frachters ging, kam es routine-<br />
74
mäßig zu einem gegenseitigen „beschnuppern“ untereinander.<br />
Ich fragte mich, wie die Mannschaft so sei. Waren alte Bekannte<br />
an Bord, welche Ladung gab es und wohin sollte die Fahrt<br />
gehen. Ein Laderaum war voll mit Verpflegung, was mir sehr<br />
sympathisch war. Im zweiten befanden sich Militärfahrzeuge<br />
und Ersatzteile. Im dritten Laderaum waren Tellerminen und<br />
das gab mir zu denken. Es war also eine hochbrisante Fracht!<br />
Dabei fiel mir ein, dass ich immer noch einen leichten, blutigen<br />
Durchfall hatte. Also meldete ich mich beim Flakleiter ab<br />
zum Sani-Revier. Meine abgegebene Stuhlprobe war positiv,<br />
und so kam ich nicht zurück aufs Schiff, sondern in die Klinik<br />
„Bagnoli“ in Neapel. Dort gab es eine eigene Abteilung<br />
für deutsche Soldaten. Ich hatte Blut im Stuhl, und das genügte<br />
mir. Ja, liebe Nachkommen,<br />
ihr könnt darüber<br />
denken, wie ihr wollt.<br />
Ich war sicherlich kein Held<br />
der militärischen Kriegsführung,<br />
aber ein Dummkopf<br />
war ich auch nicht. Vielleicht<br />
war es Intuition, oder Erfahrung<br />
und Erkenntnis, wie sie<br />
jemand erwirbt, der schon<br />
zweimal nach Abschüssen<br />
von Bord gehen musste.<br />
So verbrachte ich zehn Tage<br />
im Krankenhaus bei Grießbrei<br />
und Haferschleim. Der<br />
französische Frachter war<br />
inzwischen ausgelaufen.<br />
Nach meiner Entlassung aus<br />
dem Krankenhaus führte<br />
mich mein erster Weg in eine Vor der Klinik „Bagnoli“ in Neapel<br />
75
Osteria, und ich gönnte mir mit Heißhunger ein Hühnchen<br />
mit Reis. Endlich wurde ich mal wieder satt. Nach einigen<br />
Tagen der Erholung im Hotel „Albergo Universo“ wurde ich<br />
nach Livorno in die Nähe von Pisa abkommandiert.<br />
Ich ging an Bord des italienischen Frachters „San Pedro“. Dort<br />
erfuhr ich, dass der französische Frachter, auf dem ich hätte<br />
fahren sollen, durch ein Torpedo versenkt worden war, und<br />
nur sechs Matrosen überlebt hatten. Ich fragte mich, ob es Glück<br />
gewesen sei, oder ob jemand schützend seine Hand über mich<br />
gehalten hatte. In meiner jugendlichen Unbekümmertheit, hatte<br />
ich alle Fahrten auch als ein großes Abenteuer betrachtet.<br />
Aber bei Kämpfen, wenn es zu Flugzeugangriffen kam und<br />
wir getroffen wurden, war ich mir stets der großen Gefahr<br />
bewusst, denn ich hatte Angst. Todesangst!<br />
Die Nachrichten, die ich hörte, waren nicht berauschend und<br />
deuteten nicht auf Sieg. Die Verluste an Menschen und Frachtern<br />
nahmen immer größere Ausmaße an. Die Briten hatten Malta<br />
wieder aufgerüstet, und von unserer Luftwaffe konnten wir<br />
keine große Hilfe erwarten. Im Oktober starteten die Briten<br />
eine Offensive bei El Alamain, und im deutschen Afrika-<br />
Korps herrschte die Devise „Rette sich wer kann“. Mit den<br />
Afrikafahrten war es für mich vorbei, denn die „San Pedro“<br />
befuhr die Linie Livorno-Bastia nach Korsika. Ich machte<br />
zwei dieser Fahrten, und wir wurden von den Briten kaum<br />
belästigt. In einem sicheren Abstand sahen wir lediglich Aufklärungsflugzeuge.<br />
Nach der zweiten Fahrt, musste ich überraschend wieder ins<br />
Krankenhaus nach Neapel zu einer Nachuntersuchung, da<br />
der Verdacht der Ruhr bei mir bestand. Blut im Stuhl hatte ich<br />
nicht mehr. Aber durch die Ereignisse der Afrikafahrten hatte<br />
ich oft Alpträume und schlief sehr schlecht. Nach dieser Untersuchung<br />
waren Fahrten auf Frachtern nach Afrika für mich<br />
76
endgültig beendet. Anfang Dezember wurde ich nach Triest<br />
in Norditalien abkommandiert. Zu meiner Überraschung sollte<br />
dort für die Flottille ein neuer Stützpunkt eingerichtet werden.<br />
Nachrichten zum Kriegsverlauf erhielten wir nur spärlich.<br />
Aber der Buschfunk meldete, dass nach der Offensive der<br />
Briten der Rückzug des Afrika-Korps zügig vorangehen soll.<br />
Die Briten hatten schon Anfang Dezember Massa-Matruk<br />
eingenommen, und um Tobruk wurde auch schon gekämpft.<br />
Für uns waren es Horrormeldungen, als wir hörten, dass die<br />
Amerikaner in Marokko und Algier gelandet sein sollen.<br />
Neue Verantwortung als Geschützführer<br />
Meine Abkommandierung sollte eine Fahrt mit Hindernissen<br />
werden. Da ich nun schon Erfahrungen gesammelt hatte,<br />
wurde ich zum Geschützführer benannt und mit weiteren<br />
fünf Kameraden nach Triest beordert.<br />
Jugendlicher Übermut ließ mich manchmal Dinge tun, die<br />
dann auch Folgen hatten. Erst wurde das Kennenlernen ausgiebig<br />
gefeiert. Dann ging es mit Pferdedroschken zum Hauptbahnhof<br />
„Terminal“, wo uns bei unserer Ankunft ein Fliegerangriff<br />
überraschte. Es war ein Gedränge und Geschiebe, denn<br />
alle Menschen wollten aus dem Bahnhof raus. Züge fuhren<br />
ohnehin nicht. In diesem Chaos gingen zwei meiner Kameraden<br />
verloren. Aber die Zeit drängte, denn wir mussten vor dem<br />
Auslaufen des Schiffes in Triest sein. Ich hatte ein schlechtes<br />
Gewissen und Angst vor einer Bestrafung, weil meine beiden<br />
Kameraden verloren gegangen waren. Ich hatte ja schließlich<br />
die Verantwortung für die beiden. Ich tröstete mich mir dem<br />
Gedanken, dass der Westfale Gerhard Scharley und der Tiroler<br />
Eugen Feuerstein eine Möglichkeit finden würden, um allein<br />
nach Triest zu finden. Eine große Schwierigkeit für die beiden<br />
war, dass sie keinen Marschbefehl bei sich hatten, denn den<br />
hatte ja ich für uns alle.<br />
77
Ich hatte Sorge, dass sie die Kettenhunde, so nannten wir die<br />
Militärpolizei, aufgreifen würde, die auf uns Marinesoldaten<br />
nicht gut zu sprechen waren. Aber meine Sorge sollte unbegründet<br />
sein, denn die beiden hatten ein italienisches Militärauto<br />
angehalten und wurden bis Rom mitgenommen. Die<br />
Italiener waren für uns Mariner gute Kameraden und immer<br />
sehr hilfsbereit. In Rom gingen die beiden in die Kommandantur,<br />
schilderten die Lage und bekamen neue Papier für die Weiterfahrt<br />
nach Triest.<br />
Ich für meinen Teil, der von all dem nichts ahnte, musste mich<br />
ohne die beiden an Bord melden. Der Flakleiter Gelber, ein<br />
gemütlicher Endvierziger aus Thüringen, nahm es nicht so tragisch,<br />
denn wir hatten noch einen Tag Zeit bis zum Auslaufen. Am<br />
nächsten Tag, zwei Stunden vor dem Auslaufen, kamen die<br />
beiden dann auch an Bord und wurden mir großen Hallo<br />
empfangen. Ich war glücklich,<br />
denn ich hatte nun auch<br />
keine Bestrafung zu fürchten.<br />
Monate auf dem Mittelmeer<br />
Die „Cagliaris“, so hieß unser<br />
Frachter, war ein alter Schlickenrutscher.<br />
Er hatte seine Jahre<br />
auf dem Buckel und Rost angesetzt.<br />
Wir waren zwölf Mann<br />
Flakbesatzung und mit dem<br />
Kapitän noch zwölf Matrosen.<br />
Es war ein gemischtes Volk aus<br />
Kroaten, Slowenier, Griechen,<br />
Italienern und Deutschen.<br />
Mittlerweile hatte ich mich damit<br />
abgefunden, trotz meiner<br />
78<br />
Mit Besatzung der Nachbarflak<br />
(hinten Mitte)
Mit Flakbesatzung in Piräus<br />
(vorn rechts)<br />
Ausbildung auf der „Schlesien“ nie<br />
auf einem Kriegsschiff eingesetzt<br />
zu werden. Im Mittelmeer hatte<br />
die Marine auch keine Kriegsschiffe.<br />
So wie mir ging es vielen<br />
meiner Kameraden. Ich war damit<br />
zufrieden.<br />
Wenn man es unter dem Zeichen<br />
des Krieges so nennen darf, dann<br />
sollten die folgenden Monate auf<br />
dem Mittelmeer die schönsten der<br />
Kriegszeit für mich sein. Denn<br />
im Bereich der Adria waren wir<br />
mit unserem Frachter weit weg<br />
von Kriegshandlungen und auch<br />
recht sicher vor Luftangriffen. Wir fuhren Nachschub für die<br />
Südfront in Griechenland, Kreta und für die Besatzungen der<br />
Inseln im Ägäischen Meer.<br />
Weshalb soll ich aus meinem<br />
Herzen eine Mördergrube<br />
machen. Mir gefiel das Leben<br />
auf diesem Rostkahn, mit<br />
dem glücklichen Gefühl,<br />
wieder an einem Flakstand<br />
Achtern zu sein. Meine Kommandierung<br />
wurde von meinem<br />
Flakleiter akzeptiert.<br />
Diesmal hatte wir keine<br />
deutsche 2-cm-Flak, sondern<br />
eine „Örlikan“ eines Schweizer<br />
Fabrikats mir sechzig Schuss<br />
Magazin. Es war ein gutes<br />
Fabrikat, das ziemlich stö-<br />
Auf dem Flakstand der „Cagliaris“<br />
79
ungsfrei war. Aber es hatte einen Nachteil. Bevor es schussbereit<br />
war, mussten zwei Mann mit einem Spannbügel die starke<br />
Feder spannen. Und wenn das nicht zeitgleich geschah, hing<br />
man wie ein nasser Sack an der Waffe.<br />
Auf Wache auf der „Cagliaris“<br />
80<br />
An Bord herrschte eine gute<br />
Kameradschaft unter den<br />
Marinern, ein gutes Verhältnis<br />
zu den Matrosen, gutes Wetter<br />
mit viel Sonne und ein häufig<br />
besoffener Kapitän. Damit<br />
will ich nicht sagen, dass alle<br />
Fahrten auf der „Cagliari“<br />
ohne Angriffen von Flugzeugen<br />
blieben, aber gegen<br />
die vorherigen Nachschubfahrten<br />
nach Afrika mit den<br />
Kämpfen und Versenkungen<br />
waren die folgenden Fahrten<br />
Sonntagsausflügen.<br />
Auf der ersten Fahrt lernte ich<br />
die Männer aus vielen Ländern<br />
und unterschiedlichsten Alters kennen und schätzen. Wir<br />
Flakleute waren, mit Ausnahme unseres geschätzten Flakleiters,<br />
junge Hasen. Wir passten uns den älteren Seemännern<br />
an und waren während der gesamten Zeit eine verschworene<br />
Gemeinschaft. Es wurde während der Liegezeit in den Häfen<br />
viel gefeiert, Fische gefangen, geräuchert und gemeinsam an<br />
Deck gegessen. Ich genoss diese Zeit und wünschte mir, es<br />
würde bis Kriegsende so bleiben.<br />
In dieser Zeit bis Ende Juli 1943 lernte ich die gesamte Küste vom<br />
Norden Italien bis zum ägäischen Meer einschließlich der Insel<br />
Kreta kennen. Am besten gefielen mir die Stadt Dubrovnik
und die Inselwelt vor der Küste Sloweniens und Kroatiens.<br />
Zwischen diesen Inseln suchten wir vor Flugzeugangriffen<br />
Schutz, die zum Glück, wie bereits erwähnt, selten waren.<br />
Noch ahnte ich nicht, dass sich vor der Insel Korčula mein weiteres<br />
Schicksal ändern<br />
würde, denn drei Monate<br />
später, am 16. Oktober<br />
1943 geriet ich<br />
genau vor dieser Insel<br />
in englische Kriegsgefangenschaft.<br />
Aber<br />
alles der Reihe nach.<br />
Waffenreinigen (ganz rechts)<br />
Im Hafen von Patras<br />
kam ein „Feudelschwenker“<br />
an Bord.<br />
Er hieß Günter Hoff-<br />
mann. Feudelschwenker, so nannten wir die Männer vom<br />
Marinenachrichtendienst. Es waren sogenannte Signalgäste, die<br />
durch Armzeichen mit<br />
blauweißen Fähnchen<br />
Signale von Schiff zu<br />
Schiff gaben. Dieser<br />
Signalgast gehört nicht<br />
zu unserer Einheit,<br />
hatte besondere Privilegien<br />
und hatte im<br />
Kapitänsbereich eine<br />
eigene Kabine. Wobei<br />
wir auf Deck einen<br />
selbstgezimmerten<br />
Holzaufbau für sechs<br />
Bei einer Übung (vorn rechts)<br />
Mann hatten. Jede Geschützbesatzung hatte so eine solche<br />
Holzbude. Wären wir unter Deck untergebracht gewesen,<br />
81
hätten wir bei einem Torpedoangriff oder Minenkontakt keine<br />
Überlebenschance gehabt.<br />
An dem Tag, an dem der Feudelschwenker Hoffmann an<br />
Bord kam, hatte ich mit ihm gleich eine Karambolage, eine<br />
Auseinandersetzung, die auf meiner Bude beinahe zu einer<br />
Schlägerei ausgeartet wäre. Und das alles nur wegen eines<br />
Missverständnisses, an dem ich unschuldig war.<br />
Der Flakleiter hatte mir den Sold ausgezahlt, den Hoffmann<br />
eigentlich im nächsten Hafen bekommen sollen. Darüber war<br />
er erbost, kam zu mir und beschimpfte mich mit dem Wort<br />
„Wackesse“, das bis dahin für mich ein Fremdwort war, und<br />
auch mit anderen Worten, so dass meine Kameraden ihn aus<br />
der Bude feuerten.<br />
Am nächsten Tag kam Günter an meinen Flakstand und entschuldigte<br />
sich bei mir. Er dankte mir auch dafür, dass ich ihn<br />
nicht beim Flakleiter angeschissen hatte. Aber ehrlich gesagt,<br />
hatte ich daran nicht einmal gedacht.<br />
Das war meine erste Begegnung mit Günter Hoffmann aus<br />
Saarbrücken, der mir auf den weiteren gemeinsamen Fahrten<br />
ein guter Freund wurde, und mit dem sich die Freundschaft<br />
nach fünfzig Jahren auch noch bestätigen sollte.<br />
Weihnachtsstimmung, Haare auf der Brust<br />
Es war Heiligabend, und wir lagen vor dem Kanal von Korinth.<br />
Die Stimmung war bedrückt, jeder ging wohl seinen Gedanken<br />
nach. Wie geht es den Lieben zu Hause? Die Nachrichten aus<br />
Russland über den „Kampf um Stalingrad“ waren nicht<br />
berauschend, und außerdem belästigte uns immer wieder ein<br />
Fernaufklärer der Tommies. Zur Ermunterung der gesamten<br />
Mannschaft spendierte unser leutseliger und ein wenig angesäuselter<br />
Kapitän ein 50-Liter-Faß Bier für alle. Die Temperatur<br />
82
war noch immer angenehm mild. Bei abgeblendetem Licht<br />
wurde gefeiert, nur die Posten auf den Flakständen hielten<br />
ihre Lauscher in den Wind. Der Mond war des Öfteren durch<br />
Wolken bedeckt, und falls ein Angriff erfolgt wäre, dann nur<br />
aus der Dunkelheit heraus gegen die Mondseite.<br />
Ich war zu dieser Zeit Nichtraucher und dem Alkohol gegenüber<br />
zurückhaltend. Doch an diesem Abend wurde ich provoziert,<br />
und ich ließ mich auch darauf ein. Der Bootsmann der<br />
Seeleute foppte uns junge Mariner: „Ihr seid doch noch keine<br />
richtigen Seeleute, ihr habt ja noch keine Haare auf der<br />
Brust.“ Ich befühlte meine Brust und stellte fest, tatsächlich,<br />
keine Haare, nur Flämmchen, drei Härchen in sechs Reihen.<br />
Der Bootsmann sagte: „Haare bekommt ihr nur, wenn ihr einen<br />
anständigen Kümmel zur Brust nehmt.“ Gesagt, getan. Ein<br />
Bierglas halb voll, nach Seemannsbrauch auf Ex hinein. Wenn<br />
man das Zeug in einem Zug runterkippt, spürt man erst<br />
nichts. Doch als ich das Glas absetzte, hatte ich das Gefühl,<br />
jemand hämmerte mit einem Hammer auf meine Brust. Mir<br />
blieb nicht nur für einen Moment die Luft weg. Es war wohl<br />
nicht der richtige Kümmel gewesen, denn ich habe bis heute<br />
keine Haare auf der Brust. Im Nachhinein erfuhren wir, dass<br />
es 55prozentiger Slivowitz (Kroatischer Pflaumenschnaps)<br />
gewesen war. Die Seeleute hatten jedenfalls ihren Spaß, und<br />
ich hatte am nächsten Tag einen Kater. Danach gab es noch<br />
öfter alkoholische Feiern.<br />
Nach Kreta<br />
Am anderen Tag ging es durch den Kanal. Es ist ein wenig<br />
grummelig. Bei 100 Meter hohen, steilen Felswänden und nur<br />
ca. 20 Meter Breite fühlte man sich wie in einer Mausefalle.<br />
Gleichzeitig war es für uns natürlich eine Sehenswürdigkeit.<br />
Dieser Kanal trennt den Peloponnes vom Festland. Es gab nur<br />
eine Brücke als Verbindung.<br />
83
Die Fahrt ging weiter am Hafen von Piräus vorbei in die Inselgruppe<br />
der Kykladen nach Kreta, wohin wir den Nachschub<br />
bringen sollten. In diesem Gewirr der Inselgruppe<br />
waren wir vor U-Booten sicher, nicht aber vor Bomben- oder<br />
Torpedoflugzeugen vom Typ Beaufort oder Bristol-Blendheim.<br />
Unser Bestimmungshafen war Heraklion (Iraklio) im Nordosten<br />
der Insel Kreta. Dort hatten wir drei Tage Aufenthalt,<br />
bis die Ladung gelöscht und wir neue Fracht für Piräus übernahmen.<br />
Diese Tage waren ausgefüllt mit Training an der<br />
Waffe, Flugzeugerkennungsdienst und Landgängen. Meine<br />
Kameraden und ich erkundeten die Umgebung und lernten<br />
Land und Leute kennen. Vor allem die Bergbauern waren<br />
sehr gastfreundliche Menschen, so dass wir Einladungen zu<br />
einem kleinen Umtrunk und Imbiss nicht ausschlagen konnten.<br />
Es waren arme Bauern mit ihren paar Ziegen oder einer Kuh<br />
im Stall. Die Verständigung erfolgte, da keiner von uns<br />
Griechisch konnte, mit Handgesten und Zeichnen im Sand.<br />
Wir wurden vor Partisanen gewarnt, aber ich habe während<br />
meiner Fahrten auf Kreta und in Griechenland nichts von<br />
Partisanen bemerkt.<br />
Seemänner helfen einander<br />
Bis Ende Juli bin ich mehrfach von Triest oder anderen Häfen der<br />
Levante entlang der Küste gefahren. Wir brachten Nachschub an<br />
Lebensmitteln, Munition, Ersatzteilen für Panzer und anderes<br />
Kriegsmaterial nach Kreta und Griechenland. Auf der Rückreise<br />
beförderten wir Wolfram oder Bauxit-Erze aus Griechenland<br />
oder Kroatien nach Triest, die von dort per Bahn nach<br />
Deutschland weitergingen. Alle Fahrten in der Adria und<br />
Ägäis zu beschreiben wäre zu langatmig, und so will ich mich<br />
auf die Höhepunkte beschränken.<br />
84
1943 herrschte in Griechenland eine Hungersnot, denn unsere<br />
Truppen versorgten sich auf Kosten der Griechen. Um die<br />
Not zu lindern, fuhren schwedische Schiffe im Auftrag des<br />
Internationalen Roten Kreuzes Getreide von Kanada nach<br />
Griechenland. Einmal lagen wir im Hafen von Piräus vor einem<br />
solchen Schwedendampfer an der Pier. Wir kamen mit den<br />
Matrosen ins Gespräch. Ein Teil der Mannschaft sprach gut<br />
Deutsch und fragte uns, ob wir ihnen keine Mädchen besorgen<br />
könnten, denn sie wären schon lange unterwegs, wir wissen<br />
doch wohl, was sie meinten. Ja, wir wussten es. Für unsere<br />
Bemühungen würden sie sich erkenntlich zeigen.<br />
Seeleute helfen sich in jeder Notlage. Die Schweden durften<br />
selbst nicht an Land. Also machten sich zwei Mann auf die Socken,<br />
gingen in ein Bordell und brachten ein Mädel mit, in einem<br />
mit Decken ausgepolsterten Seesack. Der Posten wurde von<br />
zwei anderen Mariners mit zwei Packungen Zigaretten in ein<br />
Gespräch verwickelt, um so eine Kontrolle des Seesacks zu<br />
verhindern. Am anderen Morgen staunte ein anderer Posten, als<br />
ein Schwede mit der Frau ans Tor kam. Sie konnte passieren,<br />
kommentarlos, denn der Posten hatte sich jeden Tag bei<br />
der Aufsicht der Griechen, die bei uns die Ladung löschten,<br />
durchgefuttert. Wir tranken den schwedischen Schnaps, den<br />
wir als Dank erhalten hatten, eine willkommene Abwechslung<br />
zum deutschen Schnaps.<br />
Zechtour mit tragischem Ende<br />
Immer, wenn wir in irgendeinem Hafen Ladung aufnahmen<br />
oder löschten, hatten wir zwei Tage Freizeit. Wir waren keiner<br />
so strengen Disziplin wie an Bord eines Kriegsschiffes untergeordnet.<br />
Wir waren ein richtiger Gammelhaufen. An Land<br />
gingen wir stets piekfein angezogen, aber nach der zweiten<br />
Kneipe war von dem Piekfeinen nichts mehr erhalten. Das<br />
betraf weniger die Uniform und mehr unseren trunkenen<br />
85
Zustand. Wer wollte uns das verübeln, wir waren junge Burschen,<br />
und es war Krieg. Der Gedanke, dass könnte unsere letzte<br />
Sause und Fahrt sein, ließ uns über die Strenge schlagen.<br />
Wir lagen im Hafen von Ancona an der Ostküste Italiens und<br />
übernahmen Kriegsmaterial und Lebensmittel für die Besatzung<br />
auf Kreta. Es war wie immer eine lustige Zechtour und schon<br />
spät am Abend. Unser Dampfer lag nicht längsseits an der Pier,<br />
sondern quer dazu, der Bug war zur Hafenmitte zugewandt<br />
und durch den Anker in der Richtung gehalten. Das Heckteil<br />
war mit dicken Hanftauen an der Pier befestigt. Da das Heckteil<br />
aber ca. 8 Meter von der Pier weg war, musste uns die Bordwache<br />
mit einem Beiboot rüberholen. Wir wollten jedoch wegen<br />
der späten Abendstunde den Flakleiter nicht durch unser<br />
Rufen wecken. Stille war angesagt. Es war ja nicht das erste<br />
Mal, dass wir über die dicken Hanfseile mit acht Zentimeter<br />
Durchmesse im Reitersitz an Bord hangelten. Wir nannten es<br />
„Eierreiten“.<br />
Auch dieses Mal ging alles klar, wie wir in unseren vernebelten<br />
Gedanken glaubten. Jeder huschte in seine Bude, und das<br />
war’s dann. Da unser Dampfer Einzelfahrer war, das heißt nicht<br />
im Konvoi fuhr, liefen wir noch nachts aus dem Hafen in<br />
Richtung Kreta aus. Das war erforderlich, damit die Spionage<br />
nicht gleich unsere Route erkennen konnten, denn bei Morgengrauen<br />
waren wir schon in der Nähe der Kroatischen Küste.<br />
Als wir schon auf See waren, stellten wir fest, dass unser<br />
Kamerad Reimann vom vorderen Geschütz nicht an Bord<br />
war. Wir konnten uns das nicht erklären. Per Funk wurde<br />
der Kamerad Reimann als Fahnenflüchtiger gemeldet. Aber<br />
es war anders. Als wir nach 14 Tagen wieder in Ancona im<br />
Hafen lagen, wurde Kamerad Reimann tot aus dem Wasser<br />
gefischt. Der Anblick war furchtbar. Er muss beim „Eierreiten“<br />
die Balance verloren und sich den Kopf aufgeschlagen<br />
86
haben. Das war eins meiner schlimmsten Erlebnisse auf der<br />
„Cagliari“.<br />
Schlecht waren auch die Nachrichten vom Afrika-Korps. Seitdem<br />
die Tommies ihren Stützpunkt auf Malta gefestigt hatten,<br />
waren die Angriffe auf unserer Geleitzüge dermaßen intensiv,<br />
dass kaum noch Nachschub zu Rommel kam. Der Kampf ums<br />
Mittelmeer war ab April 1943 für uns verloren. Dass ich auf<br />
der „Cagliari“ in der Adria Dienst tat, war für mich ein Segen.<br />
Ich war glücklich, „so weit“ vom direkten Kriegsschauplatz<br />
entfernt zu sein. Wir fuhren weiterhin unseren Nachschub<br />
nach Griechenland und Kreta. Auf dem Rückweg aus Eleusis<br />
oder Dubrovnik nahmen wir weiter Bauxit oder Wolfram-Erze<br />
mit nach Triest.<br />
Torpedoangriff<br />
Auf einer der Fahrten nach Kreta wurden wir nachts von einem<br />
Torpedoflugzeug angegriffen. Es war heller Mondschein. Das<br />
Flugzeug kam aus dem Dunkeln in Richtung Mondlicht. Der<br />
Alarm wurde frühzeitig gegeben, denn die Wache hörte das<br />
Brummen der Motoren früh genug, um auf Gefechtsstation zu<br />
sein. Zuerst vermuteten wie einen Fernaufklärer der Engländer,<br />
da wir von diesen schon öfter damit belästigt worden waren.<br />
Doch es handelte sich um ein Torpedoflugzeug.<br />
Alle Geschütze feuerten beim Abdrehen des Flugzeugs volle<br />
Breitseite, es fing Feuer und verwand in der Dunkelheit. Zuvor<br />
hatte es seine Last abgeworfen. Durch das phosphorisierende<br />
Wasser sahen wir die Blasenbahn des Torpedos direkt auf uns<br />
zulaufen. Wir erwarteten den Treffer und die Explosion. Doch<br />
zu unserer Überraschung blieben sie aus. Der Torpedo ging<br />
unter dem Dampfer durch. Die Tiefeneinstellung muss versagt<br />
haben. Es war einer der glücklichsten Zufälle des Lebens.<br />
87
Als wir am nächsten Tag im Hafen von Heraklion einliefen,<br />
erhielten wir die Nachricht, dass der Engländer brennend östlich<br />
von Kreta abgestürzt war. Wir konnten auf einer unserer<br />
„Urlaubsfahrten“ einen Erfolg verbuchen.<br />
Erste Gefangenschaft<br />
Im Juni 1943 wurde die Hafenstadt Tobrik von den Engländern<br />
eingenommen, und das Afrika-Korps musste sich immer<br />
weiter in Richtung Tunis zurückziehen. Der Nachschub nach<br />
Afrika war völlig außer Kontrolle geraten. Als wir Anfang<br />
August im Hafen von Bari an der Ostküste Italiens einliefen,<br />
wurden wir von italienischen Fallschirmjägern von Bord geholt<br />
und mussten uns an der Kaimauer in Reihe aufstellen.<br />
Der Offizier erklärte uns für Gefangene, und wir wussten<br />
überhaupt nicht, was los war. Es gab das Gerücht, dass die<br />
Italiener kapitulieren wollten.<br />
Ein Priester in schwarzer Soutane und schwarzem Hut, also<br />
ein Priester in einem Gewand, das Vertrauen und Seelsorge<br />
verkörpern sollte, hatte eine Pistole in<br />
der Hand und rannte unsere Reihe<br />
ab, geiferte „Schweine Deutsche,<br />
Schweine Deutsche“ und fummelte<br />
mit der Pistole uns vor den Gesichtern<br />
herum. Das war wieder einmal<br />
so eine Lage, in der ich wie zuvor<br />
schon in der Schule die Thesen<br />
der Religion und die Worte Gottes<br />
missverstanden haben muss.<br />
Der Spuk dauerte nicht lange,<br />
dann kamen unsere Soldaten und<br />
klärten uns die Lage. In der italienischen<br />
Regierung war man sich In Triest<br />
88
noch nicht einige, ob man uns im Krieg weiter unterstützen<br />
wollte oder kapitulieren sollten. Wir gingen auf unser Schiff<br />
zurück und dampften ab nach Triest. Irgendetwas lag in der<br />
Luft. Die Menschen in Triest waren nicht mehr so freundlich,<br />
einige sahen uns hasserfüllt an und es kam der Tag, an dem<br />
wir Landgangverbot bekamen. Über Funk erhielten wir die<br />
Nachricht, dass Mussolini, der faschistische Busenfreund Hitlers,<br />
gestürzt, gefangen und nach Kroatien auf eine Bergfestung<br />
gebracht worden war.<br />
In kritischer Lage, Abschied von der „Cagliari“<br />
Die Lage war für uns kritisch, denn mit uns lagen nur noch<br />
zwei weitere Dampfer mit zirka 60 Mariners im Hafen. Die<br />
Lage war deshalb für uns unangenehm, weil am Hafeneingang<br />
eine Batterie Kanonen stationiert war. Diese Batterie bestand<br />
aus sechs Kanonen und einer Belegschaft ca. 60 Soldaten, wie<br />
wir vermuteten. Ein Oberbootsmann vom einem der anderen<br />
Schiff übernahm das Kommando, und im Morgengrauen wurde<br />
der Stützpunkt eingenommen. Die Italiener waren überrascht,<br />
denn sie schliefen noch, und die zwei Posten sahen<br />
nicht zum Hafen, sondern in Richtung Meer. Außerdem war<br />
der Weg zum Eingang zur Batterie mit Stückgut belegt, das uns<br />
als Deckung diente. Es waren nicht mehr Soldaten auf dem<br />
Stützpunkt als von angenommen. Sie wurden zu je einem Drittel<br />
auf unseren drei Schiffen gefangen gehalten. Sie dienten zu<br />
unserer Sicherheit und als Schutz vor einem Angriff. Strategisch<br />
war unsere Lage nicht aussichtslos, denn die Autostraße<br />
längs des Hafens lag ca. 10 Meter höher als das Hafengebiet,<br />
und die sechs Geschütze waren von uns Richtung Stadt gedreht<br />
worden und konnten auch das einzige Hafentor unter<br />
Beschuss nehmen. Italienisches Militär war nicht in der Stadt<br />
stationiert, und so sahen wir der Sache mit Zuversicht entgegen.<br />
Die politische und militärische Situation war so unübersichtlich,<br />
dass keine Seite wusste, was eigentlich Sache war. Abordnungen<br />
89
der Stadt versicherten uns, dass keine feindlichen Handlungen<br />
gegen uns durchgeführt werden würden. Am vierten Tag sahen<br />
wir auf der Bergstraße deutsche Panzer, und somit war die<br />
Sache friedlich verlaufen.<br />
Dieser Tag wurde gefeiert und auch gleich noch meine Abschied<br />
von meinen Kameraden und der „Cagliari“. Ich war auf ein<br />
anderes Schiff abkommandiert worden. In diesen sechs Monaten<br />
war unsere Schiffsbesatzung eine großartige Gemeinschaft geworden,<br />
wie sie sich nur durch längeres Zusammenleben und<br />
in Gefahrensituationen bilden können. Mit meiner Geschützbesatzung<br />
wurden Adressen ausgetauscht. Wir schworen, uns<br />
nach dem Krieg wieder zu sehen. Tatsächlich wurden meine<br />
Frau und ich 1992, nach 49 Jahren, und noch einmal 1994 von<br />
meinem Freund Günter Hoffmann nach Saarbrücken eingeladen.<br />
Ärger und Freude im Heimaturlaub<br />
Als ich mich in der Dienststelle Neapel gemeldet hatte, war<br />
ich freudig erstaunt, denn ich bekam Heimaturlaub. Mit großen<br />
Erwartungen fuhr ich nach Hause. Die Fahrt dauerte 32 Stunden<br />
und wurde teilweise durch Fliegeralarm unterbrochen. Ich<br />
tröstete mich mit den schönen, sonnigen Augusttagen, die nur<br />
hin und wieder durch einige Gewitter gestört wurden.<br />
Familiär gab es gleich wieder Ärger, als ich zu meiner „lieben<br />
Mama“ ging, um die mitgebrachten Geschenke für meine<br />
Geschwister abzuliefern. Es kam der „liebe Alfred“ dazu. Mein<br />
kleiner Koffer war offen, und er sah einige Päckchen mit Tabakwaren<br />
darin liegen und sagte: „Na, Großer, haste nicht eine<br />
Schachtel für mich übrig?“ Ich war durch die lange Bahnfahrt<br />
übermüdet und durch die schlechten Waschmöglichkeiten<br />
etwas vergammelt und entsprechend gereizt. Ich sagte ihm:<br />
„Sieh mal meine Hände und Fingernägel an, ich gebe dir noch<br />
90
nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln.“ Er fasste mich<br />
an der Schulter und schnaubte wie ein Walroß. Ich fasste in<br />
den Koffer und holte meine Pistole, eine Beretta 6,35, raus. Die<br />
Pistole hatte ich bei der Einnahme des Stützpunktes in Triest<br />
einem italienischen Soldaten abgenommen. Ich habe sie bis<br />
zu meiner endgültigen Gefangennahme behalten. Ich sagte<br />
ihm: „Mich kannst du anfassen, aber nicht die Uniform.“ Er<br />
ließ sofort von mir ab und ging aus der Wohnung. Das war das<br />
letzte Mal, dass ich ihn so sah. Das mit der Uniform hatte ich<br />
gesagt, weil er vom Staat als Krimineller eingestuft und wehruntauglich<br />
war. Ich hätte mich nicht so gehen lassen müssen,<br />
aber als ich sein verlebtes und vom Alkohol aufgedunsenes<br />
Gesicht sah und die Erinnerung in mir aufkam, wie er mir<br />
meine Jugendjahre versauert hatte, da konnte ich mich nicht<br />
zurückhalten.<br />
Meine Mutter sagte nichts, ich sah nur ihre traurigen Augen.<br />
Sie drehte sich um und ging in die Küche. Ich ging zu Oma,<br />
wo ich während des Urlaubs mein Zuhause hatte. Oma hatte<br />
immer noch ihre Stelle als Toilettenfrau bei „Cafe Oske“<br />
und schlürfte mit Genuss den mitgebrachten Bohnenkaffee.<br />
Wenn ich abends durch die Gaststätten schlenderte, um den<br />
einen oder anderen Bekannten zu treffen, war meine letzte<br />
Station stets bei Oma. Sie saß geduldig auf ihrem Stuhl im Toilettenvorraum<br />
und wartete auf Kundschaft. Kundschaft kam<br />
ständig. Frauen haben Wünsche, wenn sie ein Rendezvous<br />
oder Bekanntschaften mit Männern haben, und vor allem<br />
junge Frauen möchten von weisen alten Omas Ratschläge einholen.<br />
Oma war ein Geheimnisträger und Lieferant von Make<br />
Up und Ratschlägen. Mit ihrem Verdienst als Toilettenfrau<br />
konnte sie mit dem Lohn jedes Rüstungsarbeiters mithalten.<br />
Im Urlaub profitierte auch ich davon. Wenn ich kam gab<br />
es stets Begrüßung mit Küsschen und Umarmung vor allen<br />
Gästen. Ich war natürlich stolz in meiner Uniform und in den<br />
Armen von Oma, im Blickpunkt der Gäste. Das war schon<br />
91
ein Erlebnis. Zum Abschied griff immer Oma in ihre Kasse,<br />
und in meiner Marinejacke klimperten die Markstücke, die<br />
ich dann mit leichtsinnigen Händen ausgab.<br />
Ich machte einen Anstandsbesuch bei den Eltern meines<br />
Freundes. Es war ein kühler Empfang und eine gedrückte<br />
Stimmung, denn die zweitälteste Tochter von Heiners Schwester<br />
Anneliese war in Tobruk beim Bombenangriff auf das liebe<br />
Vaterland gefallen. Mutter Lotschs Blicke sagten mir alles. Ich<br />
fühlte mich unbehaglich. Mit unbeholfenen Worten verabschiedete<br />
ich mich. Auch die Eltern meines Freundes sah ich<br />
nie wieder. Als ich aus Gefangenschaft kam, waren die beiden<br />
verstorben.<br />
Es war ein durchwachsener Urlaub, aber es gab ja auch<br />
freundvolle Tage. Ich traf einige Mädels, mit denen ich mal ins<br />
Kino, mal in einem Cafe zu Kaffee und Kuchen ging. Marken<br />
hatte ich von Oma. Für größere Liebeleien reichte es nicht,<br />
höchstens ein bisschen knutschen. Diese Küsse waren mehr<br />
freundschaftlicher Art, nur bei einer, sie hieß Inge Fischer und<br />
war eine Sportfreundin, die ich in meiner Zeit beim Rudersports<br />
kennen gelernt hatte, war es mehr. Sie war ein flottes<br />
Mädchen, für meine Begriffe zu flott. Seit dem ersten Urlaub<br />
war sie öfter bei meiner Mutter gewesen und hatte sich als<br />
Freundin ausgegeben. Als ich eines Abends ins „Cafe Oske“<br />
eintrat ,sah ich sie mit ihrer Freundin und zwei Luftwaffensoldaten<br />
in einer Nische sitzen. Mir war klar, dass ich nicht<br />
ihr Einziger war. Das konnte mich nicht erschüttern, denn ich<br />
hatte sowieso nicht die Absicht, mich in meinen jungen Jahren<br />
zu binden, schon gar nicht, solange Krieg war.<br />
„Eisen im Feuer“<br />
Ich hatte ja noch ein Eisen im Freuer, weniger eine Liebelei,<br />
sondern mehr eine freundschaftliche Verbindung. Inge Arnswald.<br />
92
Ich fasste mein bisschen Mut zusammen und besuchte sie.<br />
Aber es sollte nicht sein. Mutter Arnswald eröffnete mit, dass<br />
Inge im Havelwerk ist und Spätschicht hat. Das Havelwerk<br />
war ein Rüstungsbetrieb, in dem Flakgeschütze hergestellt<br />
wurden. Inge Arnswald arbeitete dort als Fräser, bediente<br />
aber auch andere Maschinen.<br />
Ich stellte mich um 22 Uhr in der Nähe des Werktores auf.<br />
Es war Feierabend und dunkel, der Halbmond warf noch einen<br />
Schimmer auf die nach Hause eilenden Arbeiter. Dann sah<br />
ich sie. In Erwartung einer freudigen Überraschung und<br />
Umarmung näherte ich mich ihr. Überraschung und Freude<br />
war da. Aber ein freundliches Küsschen? Fehlanzeige. So war<br />
Inge eben. So kannte und achtete ich sie, zurückhaltend, burschikos<br />
und spitzbübisch. Quirlig wie ein kleiner Spatz. Ich mochte<br />
ihre Art, sie war anders als die anderen Mädchen, die ich<br />
kennen gelernt hatte und die sich gleich abknutschen ließen.<br />
Ich brachte Inge nach Hause,<br />
und wir verabredeten<br />
uns für Sonntag auf einen<br />
Spaziergang. Am verabredeten<br />
Sonntag wartete ich<br />
pünktlich vor ihrer Haustür.<br />
Als sie kam, hat es mich fast<br />
aus den Schuhen gehoben,<br />
Inge und ihr Bruder Heinz (Mitte)<br />
denn sie kam nicht allein.<br />
Bei ihr waren Mutter Arnswald<br />
als Anstandsdame und ihr neun Jahre jüngerer Bruder<br />
Heinz. Der kleine rotznasige, verzogene Junge erwies sich<br />
nach unserem Kennenlernen als sehr liebenswert.<br />
Ich hatte die „Ehre“, ihn die zwei Kilometer von Hohenstücken<br />
bis Butterlake Huckepack zu tragen. In Butterlake lernte ich<br />
die Großeltern von Inge kennen. Oma Groczek, eine kleine<br />
93
Inge und ihr Bruder Heinz (Mitte)<br />
94<br />
Frau, die immer ein<br />
leichtes Schmunzeln<br />
auf den Lippen trug,<br />
schloss mich gleich in<br />
ihr Herz. Opa Groczek,<br />
ein von schwerer Arbeit<br />
gebeugter Mann, war<br />
ruhig und zurückhaltend.<br />
Es wurde ein schöner Tag für mich. Opa hatte schon Tage vorher<br />
einen Karnickel geschlachtet, und so gab es ein Mittagessen<br />
wie in Friedenszeiten. Nachmittags saßen wir bei Kaffee und<br />
Kuchen. Ich hatte das Gefühl der Geborgenheit und mein Innere<br />
sagte mir, hier bist du angekommen,<br />
diese Menschen mögen Dich. Das<br />
war mein bestes Erlebnis in diesem<br />
Urlaub.<br />
Am Ende des Urlaubs machte ich<br />
es wie immer, still und leise, ohne<br />
Abschied von irgend einer Person,<br />
auch nicht von meiner Oma, fuhr<br />
ich zurück zum Einsatz. Ich wollte<br />
keine Tränen sehen, sondern die<br />
fröhlichen Gesichter, die ich gesehen<br />
hatte, in meinen Gedanken behalten.<br />
Wie auf der Heimfahrt genoss ich<br />
Inges Großeltern<br />
die Bahnfahrt durch die schönen<br />
Landschaften unserer Heimat, Österreichs und Italiens. Abgesehen<br />
von einigen Luftalarm-Meldungen erreichte ich wohlbehalten<br />
Neapel.
Partisanensuche mit Straßenbahn<br />
Doch der Stützpunkt war zu meiner großen Überraschung<br />
nach Norden in den Hafen von Triest verlegt worden. Dort<br />
wurden zurückkehrende Urlauber und Mariners von versenkten<br />
Schiffen gesammelt. Die Tage dort waren eintönig<br />
und stupide, nur Wache schieben und warten auf ein neues<br />
Kommando.<br />
Eine Abwechselung gab es, die lustig gewesen wäre, wenn<br />
nicht es nicht einen ernsten Hintergrund gegeben hätte. Nach<br />
dem Sturz von Mussolini war die Lage in Italien politisch<br />
und militärisch instabil. Das Gerücht machte die Runde, dass<br />
sich Partisanengruppen gebildet haben. Im einem Vorort vier<br />
Kilometer vor Triest war der Ölhafen, und von dort wurden<br />
verdächtige Bewegungen gemeldet. Ein Stoßtrupp wurde<br />
zusammengestellt, um die Lage zu sondieren. Wir, ein Leutnant<br />
und 18 Matrosen, kaperten einen Straßenbahnwagen,<br />
denn es führte eine Linie dort hin. Ein Kamerad fühlte sich<br />
fachlich zur Führung der Straßenbahn prädestiniert. Es ging<br />
los, nach ca. einem Kilometer ging es leicht bergab und die<br />
Fahrt beschleunigte sich in beunruhigender Weise. Die<br />
ersten Häuser waren erreicht und der Bremsvorgang wurde<br />
eingeleitet, aber die Fahrgeschwindigkeit verringerte sich<br />
nicht wesentlich. Der Fahrer war wahrscheinlich doch nicht<br />
so fachlich geschult. Aber dann musste er doch irgendwie den<br />
richtigen Hebel erwischt haben. Es gab ein ohrenbetäubendes<br />
Quietschen und mit einmal einen Ruck. Wir quetschten uns<br />
wie die Heringe in einer Büchse im vorderen Bereich des Wagens.<br />
Wenn Partisanen dort gewesen und das gesehen hätten, wäre<br />
ihnen vor lauter Lachen das Schießen vergangen. Das war an<br />
Land mein „großer kämpferischer Einsatz“. Von einem<br />
Partisanen war weit und breit nichts zu sehen.<br />
95
Abschuss<br />
Endlich ging es wieder los, Richtung Livorno an der Westküste.<br />
Es war die „San Pedro“ mit Nachschub für die Besatzung<br />
der Insel Korsika. Die vorherige Besatzung war abgelöst und<br />
die meisten verhaftet worden. Nach Kenntnis unseres neuen<br />
Flakleiters hatte diese Truppe Heeresgut gestohlen, und zwar<br />
in einem so hohen Umfang, dass eine Division einen Monat<br />
lang hätte verpflegt werden können.<br />
Die „San Pedro“ war ein 6000 BRT großes Schiff und mit 40<br />
Mariners an sechs Flakständen bewaffnet. Ich war wieder<br />
auf einen der drei Stände Achtern und zum Geschützführer<br />
ernannt. Zum zweiten Mal übernahm ich eine derart verantwortliche<br />
Aufgabe.<br />
Diese Fahrt war von keinen großen Ereignissen geprägt, außer,<br />
dass wir einen unserer Fesselballons, die als Schutz vor Luftangriffen<br />
dienten, in einer stürmischen Gewitternacht selbst<br />
abgeschossen. Die ereignete sich nicht aus Unkenntnis, sonder<br />
aus Versehen. Die Nacht war so dunkel, dass man noch nicht<br />
einmal den Nebengeschützstand sehen konnte, wenn nicht<br />
gerade ein Blitz durch die Nacht zuckte. Der hintere Ballon<br />
war entweder durch den starken Regen heruntergedrückt<br />
worden, oder er hatte Wasserstoffgas verloren, was die näher<br />
liegende Annahme war, denn der vordere Ballon war ja oben.<br />
Wir bemerkten diesen Umstand nicht. Wenn die Blitze durch<br />
die Nacht zuckten, sah der Ausguck ein Objekt, das uns verfolgte<br />
und angriff. Er löste Feueralarm aus. Nach ein paar<br />
Feuerstößen mit Leuchtspurmunition gab es eine Explosion<br />
mit kurzem Feuerschein, und der Spuk war zu Ende. Wir<br />
hatten kein feindliches Schnellboot, keinen Zerstörer erlegt,<br />
sondern unseren Ballon. Mit solchen Kriegserlebnissen konnte<br />
man die Heimatfront nicht begeistern, man machte sich<br />
höchstens lächerlich. Aber was soll’s, so makaber es klingen<br />
96
mag, ein Krieg hat auch seine lustigen Seiten und nicht nur<br />
Tot und Verderben.<br />
Das Schicksal meint es gut mit mir<br />
In Afrika war es noch ernster geworden. Rommel war inzwischen<br />
von Hitler abgelöst worden, und der neue General machte es<br />
auch nicht besser. Ohne ausreichenden Nachschub kann kein<br />
Heer Siege vollbringen. Das Afrika-Korps zog sich immer mehr<br />
Richtung Tunesien zurück. Nach Löschen der Ladung im Hafen<br />
von Bastia ging es nach zwei Tagen zurück nach Liverno. Die<br />
Zufälle des Lebens sind wunderlich und manchmal mit nichts<br />
zu erklären. Wir hatten Freiwache, und ich fuhr mit meiner<br />
Mannschaft mit dem Vorortzug nach Pisa, die wunderschöne<br />
Stadt in der Toscana. Wir erlebten einen Fliegeralarm, aber<br />
keinen Angriff von Flugzeugen. Nach einer Stunde war wieder<br />
Ruhe eingekehrt. Wir verlebten noch einen feuchtfröhlichen<br />
Tag. Nach der Rückkehr zum Hafen Livorno sahen wir die<br />
Verwüstungen im Hafen und in der Stadt. Ein Schiff war versenkt<br />
worden, einige Schiffe teils schwer, teils leicht beschädigt.<br />
Auch an unserem Schiff war die vordere Backbordseite aufgerissen.<br />
Es gab einige Tote und Verletzte. Das Schicksal hatte<br />
es mit mir gut gemeint. Was wäre gewesen, wenn ich keine<br />
Freiwache gehabt hätte? Die Frage bohrte noch lange in mir.<br />
Gefangennahme<br />
Es war der 10. Oktober 1943, als ich die „Argentina“ betrat.<br />
Ich weiß dieses Datum so genau, weil es nur wenige Tage vor<br />
meiner Gefangennahme durch die Engländer war.<br />
Ich hatte keine Freude beim Antritt meiner neuen Dienstaufgabe.<br />
Die „Argentina“ war ein kleines 3600 BRT großes italienisches<br />
Schiff. Die Seeleute waren aus der Region, und wir<br />
97
waren mit vierzehn Mariners und einem unsympathischen<br />
Flakleiter an Board. Der Mann posierte sich in voller Größe<br />
als Person mit Spitzbart wie ein Admiral und mit dem Orden<br />
„Deutsche Kreuz in Gold“. Seine „zündende“ Rede gipfelte<br />
im Durchhalteappell für Führer und Vaterland. Aber es zündete<br />
nicht mehr so bei uns, denn die Kriegslage war uns bekannt.<br />
In Russland bahnte sich die Katastrophe an, und auch im<br />
Staub der Wüste Lybiens war das Afrika-Korps in den letzten<br />
Zügen. General Badoglio in Italien ergab sich den Alliierten,<br />
und die Italiener waren uns gegenüber nicht sonderlich gut<br />
gestimmt. Wir mussten wachsam sein. Wir waren überwiegend<br />
junge Burschen, und einige der Seeleute sahen nicht gerade<br />
vertrauenswürdig aus. Am 14. Oktober liefen wir aus, das<br />
Ziel war Griechenland, denn da sah es für unsere Wehrmacht<br />
auch nicht rosig aus. Die Partisanen machen ihnen sehr zu<br />
schaffen.<br />
Im Hafen von Split (auf Italienisch Spalato genannt) übernahmen<br />
wir Heu- und Strohballen, die über das ganze Deck gelagert<br />
wurden, angeblich als Schutz bei Bombenangriffen.<br />
Der 16. Oktober 1943, der Schicksalstag meines Marinelebens.<br />
In früher Morgenstunde liefen wir aus dem Hafen Split aus.<br />
Wir fuhren Richtung Süden, schlängelten uns durch die Inseln.<br />
Gegen 14.00 Uhr näherte sich ein Fernaufklärer vom Typ<br />
„Wellington“. Er kam nicht bis in die Nähe unserer Geschütze<br />
und drehte nach zwei Umkreisungen in respektvollem Abstand<br />
wieder Richtung Italien ab. Wir waren in der Nähe der Insel<br />
Korcula. Die Adria war glatt wie ein Spiegel, es wehte kein<br />
Lüftchen, und ich genoss diese Ruhe.<br />
Gegen 16.00 Uhr legte ich mich auf dem Geschützstand auf<br />
einer Matratze zum Schlafen. Im Unterbewusstsein hörte<br />
ich ein leichtes Wummern, dann ein Pfeifen, und dann in<br />
unmittelbarer Nähe den Einschlag der Granate. Ich war im Nu<br />
98
wach. Durch das Fernglas waren nur zwei Rauchsäulen zu<br />
sehen, und es war klar, es konnten nur Zerstörer sein. Aber<br />
wie kommen Feindzerstörer hierher, die Front war doch in<br />
Afrika? Mit größter Geschwindigkeit kamen sie immer näher<br />
und ihre Buggeschütze feuerten mit ihren 100mm-Kanonen<br />
unablässig. Die Aufschläge waren jedoch sehr ungenau und<br />
gingen weit vor uns oder weit an Steuerbordseite ins Wasser.<br />
Der Flakleiter gab Anweisung zur Bewachung der Italiener,<br />
die sich freuten, und den Befehl zur Versenkung des Schiffes.<br />
Zwei Mariners gingen in den Maschinenraum und legten die<br />
Sprengsätze an. Ich baute mit einem Kameraden die Flakwaffen<br />
ab, die wir anschließend einzeln über Bord warfen.<br />
Anschließend wurden die Heu- und Strohballen mit Benzin<br />
übergossen und angesteckt.<br />
Die Tommys hatten das Schießen eingestellt. Dadurch war<br />
die Hektik nicht mehr so groß, und wir konnten mit weniger<br />
Erregung und Nervosität die Backbordboote durch die Seeleute<br />
zu Wasser bringen lassen. Dass wir von ihnen eventuell<br />
angegriffen werden könnten, das war unsere geringste Sorge,<br />
denn wir waren ja noch bewaffnet. Wir wollten versuchen, vor<br />
Eintreffen der Zerstörer an die Küste zu kommen, denn die<br />
Insel war keine 500 Meter von unserem Schiff entfernt.<br />
In unserem Boot waren acht italienische Seeleute und wir<br />
Mariners vom Achterngeschütz. Die Seeleute waren nicht<br />
begeistert, und ich merkte auch beim Rudern, wie lustlos sie<br />
die Riemen durch das Wasser zogen. Als das letzte Boot vom<br />
Schiff abgelegt und außer Gefahr war, erfolgten die zwei<br />
Explosionen auf der Steuerbordseite. Das Schiff hatte unmittelbar<br />
danach Schlagseite. Wir konnten die Zerstörer nicht sehen,<br />
da unser Schiff zwischen ihnen und uns lag. Um so erstaunter<br />
war ich, als ein Zerstörer schon kurz danach am Bug zu sehen<br />
war. Als sie sahen, dass wir versuchten, zur Küste zu gelangen,<br />
feuerten sie ein paar Maschinengewehrschüsse über unsere<br />
99
Köpfe ab. Die Seeleute warfen die Riemen über Bord, standen<br />
von ihren Sitzen auf, winkten und klatschten in die Hände<br />
und riefen: „Bravo Inglesis! Bravo Inglesis!“<br />
Mir wurde ganz mulmig zumute, aber zwei meiner Kameraden<br />
hatten noch ihre Maschinenpistolen und ich meine Beretta.<br />
Bevor der Zerstörer in Rufnähe war, holte ich meinen Wehrpass<br />
aus der Tasche, zerriss ihn und ließ die Schnipsel ins Wasser<br />
fallen, ebenso meine Pistole. Auch die Maschinenpistolen<br />
wurden auf diese Weise entsorgt.<br />
Als wir an Bord des englischen Zerstörers gingen, war der<br />
Empfang ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Die<br />
Italiener kletterten zuerst am Fallreep an Bord, mit viel Palaver.<br />
Doch sie wurden nicht als Verbündete begrüßt, sondern einige<br />
bekamen sogar von den Matrosen einen Tritt in den Hintern.<br />
Sie wurden an der Bugspitze, wo die Kettenlast ist, eingesperrt.<br />
Wir folgten den Italienern mit der bangen Frage, was<br />
die Engländer wohl mit uns machen werden, wenn schon<br />
die Italiener einen Tritt kriegen? Doch es geschah etwas für<br />
mich Unfassbares. Als wir an Bord kletterten, reckten sich uns<br />
hilfsbereite Hände entgegen. Wir mussten uns in einer Reihe<br />
hinstellen, wurden abgetastet und auf Waffen kontrolliert.<br />
Als ich an die Reihe kam, wurden auch meine Taschen durchsucht,<br />
und dabei fand der Matrose noch zwei Pistolenkugeln,<br />
die ich in der Aufregung ganz vergessen hatte zu entsorgen.<br />
Er sah mich an, mir war kotzübel, ich schloss die Augen, und<br />
da spürte ich etwas an meinen Lippen. Als ich die Augen aufschlug,<br />
fummelte er mit einer Zigarette vor meinem Mund<br />
rum. Ich nahm sie dankbar und mit Erleichterung an. Anschließend<br />
wurden wir in den Mannschaftsraum geführt.<br />
Dort wurden wir von einem Offizier, der deutsch sprach, zu<br />
Gefangenen seiner Majestät erklärt und über die militärische<br />
Lage aufgeklärt.<br />
100
Ein verlorenes Jahr als Kriegsgefangener in Afrika<br />
(1943)<br />
Im Zwiespalt der Gefühle<br />
Ich wusste nicht, sollte ich über die Gefangennahme glücklich<br />
oder enttäuscht sein! Ich war im Zwiespalt meiner Gefühle. Die<br />
gesamte Mannschaft hatte die Gefangennahme ohne Schaden<br />
überstanden, und das machte mich froh. Dass ich mir durch<br />
„Heldenmut“ kein „Eisernes Kreuz“ verdienen konnte, aber<br />
mit „gesundem Kreuz“ in Gefangenschaft kam, machte mich<br />
überglücklich. Hoffentlich komme ich auch eines Tages gesund<br />
nach Hause.<br />
Nach der Aufklärung durch den englischen Offizier über die<br />
militärische Lage war mir die Behandlung der Italiener<br />
einigermaßen klar. Die Alliierten waren Anfang Oktober auf<br />
Sizilien gelandet. Der Überläufer Marschall Badoglio putschte<br />
am 8. September 1943 und fiel der deutschen Wehrmacht in den<br />
Rücken. Doch die Engländer liebten den Verrat, nicht aber<br />
den Verräter.<br />
Auf dem englischen Zerstörer<br />
Nach den Ausführungen des Offiziers mussten wir uns entkleiden<br />
und unter die Dusche stellen. Nach dem Abtrocknen<br />
wurden die Haare, Schamhaare und Achselhaare mit einem<br />
Entlausungsmittel besprüht. Dann konnten wir uns wieder<br />
anziehen. An unseren Uniformen fehlten einige Knöpfe und<br />
Abzeichen, auch mein Käppi war nicht mehr auffindbar. Ich<br />
konnte diese Sachen verschmerzen, denn dafür gab es ein<br />
sehr gutes Essen. Zusätzlich fühlten einige Tommys kameradschaftlich<br />
mit uns und gaben uns Zigaretten und Schokolade.<br />
101
Ich sah mich in den Mannschaftsräumen um und musste feststellen,<br />
dass die Backen (Tische) und Banken genauso an der<br />
Decke mit Halterungen zur Schlafenszeit befestigt waren, wie<br />
auf dem Schulschiff, auf dem ich ausgebildet worden war.<br />
Auch die Hängematten und die kleinen Schränkchen für den<br />
persönlichen Bedarf waren ganz ähnlich beschaffen.<br />
Es war Schlafenszeit. In der Hängematte ließ es sich gut liegen.<br />
Bei mir weckte es Erinnerungen an die Schulschiffzeit auf<br />
der „Schlesien“. Ich hatte eine gute seemännische Ausbildung<br />
erhalten und hatte einige Waffensysteme kennengelernt, so<br />
dass ich damals die Hoffnung hatte, weiter auf einem Kriegsschiff<br />
Dienst tun zu können. Dazu war es nicht gekommen.<br />
Die Zeit bei der Bordflak-Süd Mittelmeer war mit gefahrvollen<br />
Fahrten und Kämpfen gegen Flugzeuge verbunden. Wenn ich<br />
andererseits an die letzten drei Dampfer denke, auf denen ich<br />
gefahren war, so waren es in gewisser Hinsicht Erholungsfahrten<br />
gewesen, die am Ausgang des Krieges keinen Anteil<br />
hatten. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich nie direkt auf<br />
einen Menschen schießen musste. Jetzt machte mir nur Sorgen,<br />
was wird sein, wenn der Krieg zu Ende ist. Was erwartet mich<br />
zu Hause? Mit diesen Gedanken schlief ich ein.<br />
Von Italien nach Tunesien<br />
Am Morgen wurden wir früh geweckt und bekamen wieder<br />
ein gutes Essen vorgesetzt. Die Mannschaft war sehr kulant<br />
zu uns, es gab keine bösen Worte. Die Anlandung war der<br />
Hafen Bari. Als wir von Bord gingen, wurden wir mit militärischem<br />
Gruß verabschiedet. Der Offizier, der deutsch sprach,<br />
wünschte uns eine annehmbare Gefangenschaft und eine gesunde<br />
Heimkehr nach dem Krieg.<br />
Im Hafen wurden wir von englischen Fallschirmjägern übernommen,<br />
die schon mehrere Gefangene in ihrer Obhut hatten.<br />
102
In Marschordnung ging es quer durch die Stadt bis am anderen<br />
Ende, wo ein Fußballstadion war, das als Sammelstelle<br />
für Gefangene aller Waffengattungen diente. Ich staunte sehr<br />
über die Organisation. Als wir ankamen, wurden wir registriert,<br />
bekamen gleich eine Büchsenration zum Essen (Meat and<br />
Beans), und gegen Mittag wurde ein Transport zusammengestellt<br />
und ab ging es zum Bahnhof, wo uns eine johlende<br />
Meute Italiener erwartete. Aber unsere Bewachung, es waren<br />
meistens Schwarze, sorgte dafür, dass keiner der Gefangenen<br />
körperlich zu Schaden kam.<br />
In den Abendstunden kamen wir in der Hafenstadt Taranto<br />
an. Es war der 17. Oktober. Wieder war ein Fußballstadion<br />
unser Aufenthaltsort. Dieser Aufenthalt dauerte drei Tage bis<br />
zum 20. Oktober. Es waren harte Tage. Nur mit einer Decke<br />
und auf blankem Boden zu schlafen war nicht angenehm.<br />
Aber ich habe es ohne Erkältung überstanden.<br />
Am 21. Oktober wurden wir ca. 200 Gefangene im Hafen von<br />
Taranto auf ein Landungsboot der Amis verfrachtet und landeten<br />
nach eineinhalb Tagen in Tunesien an der nördlichen Spitze<br />
im Hafen von Bzerta. Das Lager Bizerta war einige Stunden<br />
entfernt von der Stadt in einer flachen, ebenen Gegend, wo<br />
kaum ein Strauch oder Baum stand.<br />
Im Lager Bizerta<br />
Wir Neuankömmlinge wurden mit Hallo begrüßt. Ich suchte<br />
den Teil des Lagers, zu dem ich hingehörte. Entlang der Lagerstraße<br />
waren Schilder aufgestellt, die für mich fremd waren.<br />
So stand auf den Schildern „Freies Saxonia“, „Für Sachsen“,<br />
„Freies Colonia“ (Westfalen), „Freies Bavaria“ (Bayern), „Freies<br />
Thuringia“. Ich suchte vergebens „Freies Prussia“, mein Preußen.<br />
Ich fand es nicht. Wo war das großdeutsche Reich, wo waren<br />
Führer und Vaterland? Ich reihte mich ein in die Masse<br />
103
Mensch, in der alle Schattierungen noch eine Einheit bildeten,<br />
Landsleute aus allen Gauen unserer Heimat, einschließlich<br />
der Österreicher, der Auslandsdeutschen, der sogenannten<br />
Beutegermanen, die als Soldat zu dienen gezwungen worden<br />
waren. Die sogenannten „Freien“, die sich zusammengefunden<br />
hatten, waren nur eine kleine Zahl Abtrünniger. Wir<br />
wurden in 2-Mann-Zelten untergebracht und einmal am Tag<br />
mit Kost aus Büchsen abgefüttert.<br />
Algier, Lager 210<br />
Am 25. Oktober ging es ab nach Algier Lager 210. Es war ein<br />
großes Lager mit einigen 80 Personen fassenden Zelten. Wir<br />
von unserem Dampfer waren noch immer zusammen. Die<br />
erste Maßnahme, die wir über uns ergehen lassen mussten,<br />
war die Entlausung. Wir mussten alle Bekleidungsstücke bis<br />
auf die nackte Haus ausziehen, die Bekleidung in einen netzartigen<br />
Sack werfen, die anschließend durch die Entlausungsmaschine<br />
musste. In dieser Zeit wurden wir von einem Ärzteteam<br />
auf Ungeziefer untersucht. Die Kopf- und Schamhaare<br />
sowie die Haare in den Achselhöhlen wurden mit einem<br />
Pulver bestäubt.<br />
Nun begann das eintönige Lagerleben, und eine Latrinenparole<br />
jagte die andere. Jeder versuchte,, durch positive Nachrichten,<br />
die meist Wunschgedanken waren, die Stimmung unter den<br />
Gefangenen zu verbessern. Eines Morgens beim Zählappell<br />
wurde mein Name aufgerufen, und ich stellte mich zu einigen<br />
anderen Gefangenen, die vor mir aus dem Glied raus getreten<br />
waren. Mir war nicht wohl bei dieser Sache, denn ich war der<br />
einzige von unserem Schiff. Aber meine Sorgen waren unbegründet.<br />
104
In der Wüste<br />
Wir waren 20 Mann, und es ging per LKW in die Wüste. Nach<br />
drei Stunden Fahrt kamen wir in unserem neuen Lager an. Es<br />
war das Verhörlager 203. Ein kleines Lager für uns 20 Mann,<br />
ein Zelt für die Wachmannschaft, eines für die Verhöre und<br />
zwei 10-Mann-Zelte für uns. Das Zelt für die Verhörzeremonie<br />
lag etwas abseits von unseren Zelten. Zur Ehrenrettung der<br />
Britten muss ich sagen, dass wir korrekt und anständig in den<br />
Verhören behandelt wurden.<br />
Mit Ausnahme der Verpflegung. Es gab täglich eine Schüssel<br />
Reis, mit Wasser und Salz gekocht, eine Mandarine und einen<br />
Kanten Weißbrot. Man konnte die Hoffnung haben, gesundheitlich<br />
über die Runden zu kommen.<br />
Als ich zum ersten Mal zum Verhör musste, war es ein Auftritt<br />
in drei Akten. Beim ersten Eintritt ins Verhörzelt stramme<br />
Haltung und Ehrenbezeugung mit Hitlergruß. Von den rechts<br />
und links neben den Eingang stehenden Wachsoldaten wurde<br />
ich aufgefordert, raus zu gehen.<br />
Beim zweiten Mal der gleicher Auftritt, gleiche Ehrenbezeugung<br />
- und von links eine Backpfeife mit der Aufforderung, nochmals<br />
vor das Zelt zu treten und beim Eintreten anständig zu grüßen.<br />
Da habe ich begriffen, dass der Führerbefehl, im Heer ab 1943<br />
mit dem Hitlergruß Ehrenbezeugung zu leisten, hier keine<br />
Gültigkeit mehr hatte. Beim dritten Eintritt zackig gegrüßt,<br />
höfliche Aufforderung zum Sitzen.<br />
Vor mir hinter dem Tisch saßen ein französischer, ein englischer<br />
und ein amerikanischer Offizier. Alles aufzuführen, was und<br />
wie gefragt wurde und wie das Verhör geführt wurde, würde<br />
zu weit führen. Ich konnte nur darüber staunen, was<br />
die Alliierten über unsere Schiffe, Ausrüstung und Standorte<br />
wussten. Sogar über die Besatzungen einzelner Schiffe wussten<br />
105
sie Bescheid. Ich war und bin überzeugt, dass durch uns bei<br />
den Verhören lediglich ihr Wissens über die deutsche Marine<br />
im Mittelmeer gefestigt werden sollte.<br />
Es waren langweilige Tage, wenn man nicht wieder zum Verhör<br />
musste. Einen lustigen Tag hatte ich aber doch durch meine<br />
Unkenntnis im Kochen geschaffen. Jeden Tag musste ein<br />
anderer Kamerad die zwei Kochkessel mit fünfzig Liter<br />
Fassungsvermögen anheizen, den einen für den Reis, den<br />
anderen für Kaffee. An dem Tag, an dem ich dran war, lief<br />
zunächst alles glatt. Die Kessel mit Wasser waren schnell<br />
geheizt. Als das Wasser zum Sieden kam, nahm ich den 25-Kilogramm-Reissack<br />
und schüttete den gesamten Inhalt in den<br />
Kessel. Es dauerte nicht lange, und das Wasser kochte wieder,<br />
und ich rührte den Reis mit der Kelle, damit er nicht anbrennt.<br />
Wer wollte schon angebrannten Reis essen!<br />
Ich rührte und rührte. Der Reis wurde dickbreiig, und das<br />
Rühren wurde mir immer schwerer. Ich füllte Wasser nach,<br />
denn ich hatte im Kessel noch genug Freiraum, um Wasser<br />
nachgießen zu können. Der Brei wurde immer dicker und<br />
dicker, und im Kessel sagte es „Blub, blub!“ Und mit jedem<br />
Blubbern wurde der Brei noch dicker. In meiner Aufregung<br />
füllte ich mit dem Schöpfbecher Reis in den zweiten Kesse,<br />
aber im ersten blubberte es immer weiter. Nochmals mit dem<br />
Schöpfbecher Reis vom ersten in den zweiten Kessel umfüllen,<br />
Wasser in Kessel eins nachgießen - es blubberte immer noch.<br />
Endlich kam die Rettung in Gestalt unseres verantwortlichen<br />
Kochs ehrenhalber. Wladislaus Wabinski, ein Oberschlesier,<br />
der sich bereit erklärt hatte, während unserer Zeit im Verhörlager<br />
uns zu bekochen. Er hatte lediglich verlangt, dass jeder<br />
mal früh morgens die Kessel anheizen musste. Und ich war<br />
derjenige, der sich am dämlichsten anstellte. Doch er war ein<br />
Gemütsmensch und sagte nur: „Pironje, du bist ein Dussel,<br />
kennen wir jetzt jeden Tag morgens, mittags und abends Reis<br />
fressen.“ Er bereinigte die Chose, indem er den zweiten Kessel<br />
106
leerte und den Inhalt beider Kessel im Wüstensand vergrub.<br />
Die Briten haben davon nichts mitbekommen.<br />
Einigen Tagen danach wurden wir zurück ins Durchgangslager<br />
210 gebracht, wo noch täglich mehrere Gefangene ankamen,<br />
meistens Afrika-Kämpfer, denn der Kampf um Afrika war<br />
seit der Landung der Amis endgültig verloren.<br />
Im Lager in Oran<br />
Am 10. November ging es ab nach Oran, einen weiteres Durchgangslager.<br />
Am 11. November kamen wir an. Die Zelte für<br />
je 10 Mann waren auf einer leichten Anhöhe aufgebaut, was<br />
uns noch viel Ärger verursachen sollte. Der Tagesrhythmus<br />
war langweilig. Der Buschfunk brachte eine nicht beweisbare<br />
Meldung nach der anderen. Ich hielt Ausschau nach eventuellen<br />
Bekannten, mit denen ich gemeinsam auf einem der Dampfer<br />
gefahren war, und nach Landsleuten aus der Heimat.<br />
Dabei lernte ich einen kennen, der war aus Götz bei Brandenburg.<br />
Er war in Italien in Gefangenschaft geraten und Infanterist.<br />
Sein Interesse galt meinen Bordschuhen, leichten Halbschuhen<br />
aus Segeltuch und einem Sohlenrand mit Leder. Er bot mir<br />
seine Knobelbecher als Tausch an, und nach vielem Drängen<br />
gab ich nach, denn er hatte am linken Bein oberhalb des<br />
Knöchels eine starke Wunde und in den Stiefeln viele Schmerzen.<br />
Mehr als vier Wochen verbrachte ich in diesem Lager. Es waren<br />
eine eintönige und langweilige Zeit, und ich immer in Gedanken<br />
an zu Hause und daran, wie es weitergehen wird.<br />
Dann setzte die Regenzeit setzte ein. Ströme von Wasser stürzten<br />
die Anhöhe runter. Einziger Trost war, dass die Zelte dicht<br />
hielten. An der Rückseite hatten wir viel Sand angeschüttet,<br />
so dass kein Wasser ins Zelt fließen konnte. Nur eins bereitete<br />
uns Sorgen. Zum Essenfassen oder zur Toilette mussten wir<br />
107
ei diesem starken Regen immer ca. 80 Meter bis Essenbaracke<br />
laufen, die unterhalb der Baracken an der Zufahrtstraße lag.<br />
Das Essenholen war stets ein Wettlauf mit den Wassermassen,<br />
zumal der Boden aufgeweicht und schlammig war. Das<br />
Urinieren war dagegen einfach, kurze Schritte vor das Zelt, das<br />
war’s. Meine Stiefel waren in dieser Zeit Gold wert. Ich hatte<br />
keinen schlechten Tausch gemacht.<br />
Casablanca<br />
Nach langen Wochen, es war der 21. Dezember, ging es für<br />
mich weiter in Richtung Casablanca. Es war nun kurz vor<br />
Weihnachten, und unter uns herrschte eine gedrückte Stimmung,<br />
gepaart mit der frohen Erwartung, wohin es geht, was uns<br />
Neues erwartet. Die Fahrt in Viehwagons war nicht gerade<br />
angenehm zu ertragen. Am Tag vor Heilig Abend erreichten<br />
wir Casablanca.<br />
Es war noch immer Regenzeit. Kalte Winde fegten vom<br />
Atlantik über unser Lager. Im eigentlichen Sinn war es gar kein<br />
Lager, sondern nur eine große freie Fläche Land, umzäunt<br />
von doppelt gesichertem Stacheldrahtzaun, mit Furchen<br />
und Löchern im Boden, und jeder hat nur eine Wolldecke,<br />
die keinen Schutz vor dem Regen bot. Einige Gefangene<br />
musste man aus dem Lager ins Lazarett bringen. Ich habe es<br />
überstanden, ohne Erkältung, ohne Husten. Es ist für mich<br />
wie ein Wunder.<br />
Weihnachten in Casablanca, Heiligabend, das schlimmste<br />
Fest, das ich bisher erlebt habe.<br />
Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, traten<br />
wir wieder zum Abmarsch an. Wohin? Zirka 200 Gefangene<br />
setzten sich in Bewegung, teils mit Hoffnung auf eine Besserung<br />
unseres Zustands, teils mit Zweifeln in den Gesichtern.<br />
108
Nach Amerika<br />
Wir betraten das Hafengelände und sahen nur amerikanische<br />
Kriegsschiffe, Transporter und Kriegsmaterial. Wir mussten<br />
einen der Transporter betreten, am Bug sah ich den Namen.<br />
Es ist die „Empress of Shanghai“, ein Amerikaner. Am Hafenkai<br />
sehe ich eine Uhr, es ist 12:30 Uhr MEZ. Ich betrat das Schiff<br />
und damit amerikanischen Boden und sah einer ungewissen<br />
Zeit entgegen. Ich bin nicht gottgläubig, aber in diesem<br />
Moment hoffe ich, dass das ungewisse Etwas, das immer in<br />
meinen Gedanken war und mich bisher begleitet hat, weiter<br />
meine Hoffnung tragen möge.<br />
Die „Empress of Shanghai“ war nach meiner Schätzung ein<br />
10.000 BRT großes Schiff. Außer uns ca. 200 Gefangenen<br />
waren Soldaten auf Urlaub, Verwundete und auch ein Teil<br />
Zivilisten an Bord. Als wir an Bord waren, stürzten sich die<br />
Soldaten wie die Wilden auf die Holzbetten, die als Doppelt<br />
übereinander installiert waren. Wir von der Marine, wir waren<br />
vierzehn, sahen uns dagegen erst einmal um und entdeckten<br />
ein Shap (Raum) mit Hängematten. Sie waren in derselben<br />
Art, wie sie auch auf unseren Schiffen üblich waren. Hängematten<br />
sind vor allem bei Seegang besser als Betten, aber auf<br />
dieser Überfahrt hatten wir so gut wie keinen großen Seegang.<br />
Jeden Tag durften wir einmal für eine Stunde an Deck frische<br />
Luft schnappen. Die Verpflegung war gut. Diese Umstellung<br />
auf die gute Verpflegung hat ein Teil der Gefangenen nicht<br />
gleich vertragen, und so wurden die Toiletten übermäßig in<br />
Beschlag genommen.<br />
109
110
Drei Jahre als Kriegsgefangener in den USA<br />
(1944 - 1946)<br />
Ankunft in Virginia<br />
Am 2. Januar 1944 liefen wir im Hafen Norfolk im Staate<br />
Virginia ein. Als wir von Bord gingen mussten wir ein Spalier<br />
von Home-Guard, Armeesoldaten und Polizei durchlaufen.<br />
Alle zwei Meter stand links und rechts ein Bewacher. Ich<br />
hatte den Eindruck, dass die Amis mehr Furcht vor uns hatten<br />
als wir vor ihnen. Die Zivilisten bestaunten uns Ankömmlinge,<br />
aber es gab kein Pöbeln, sondern nur stille und mitleidige<br />
Gesichter.<br />
Die weitere Organisation ließ uns Deutsche erstaunen, zumal<br />
wir politisch durch die Nazi-Partei so geschult waren, die besten<br />
Arbeiter, die besten Techniker, überhaupt die Herrenrasse der<br />
Welt zu sein. Hier wurden wir eines Besseren belehrt.<br />
Von der Erfassung der Personalangaben, über Fotografieren,<br />
Entlausung und danach Empfang der Gefangenenkleidung<br />
mit Schuhen, Unterwäsche, Jacken bis zur Wollmütze, es war<br />
ja Winter, bis zum Einstieg in einen Waggon zum Abtransport<br />
in ein Lager dauerte es für uns ca. 200 Mann gerade einmal<br />
vier Stunden.<br />
Der Zug war ein Sonderzug der Pullman Corporation mit<br />
normalen Wagen. Es gab gepolsterte Sitze, rückklappbare<br />
Lehnen, so dass man bequem auf gegenüberliegenden Sitzen<br />
schlafen konnte. Ich konnte es bei diesem Komfort, der uns<br />
geboten wurde, kaum glauben, dass ich Kriegsgefangener<br />
war.<br />
Die Fahrt dauerte zwei Tage und führte uns von Norfolk über<br />
Cincinnati West-Virginia, Indianapolis bis nach Rockfort Illinois,<br />
111
in die Nähe des Michigansees. Es sollte für mich und meine<br />
Kameraden nur ein Durchgangslager sein, das „Lager Camp<br />
Grant“, das wir am 5. Januar 1944 erreichten.<br />
Im Lager Camp Grant<br />
In diesem Lager waren alle Waffengattungen der Wehrmacht<br />
vertreten. Meine Annahme, unsere ehemaligen Vorgesetzten<br />
hätten keine Befehlsgewalt mehr, war ein gefährlicher Irrtum.<br />
Fanatische Nazis wachten darüber, dass keine abwertenden<br />
Äußerungen über den sich als verloren abzeichnenden Krieg<br />
gemacht wurden. Das hatte bereits einer meiner Kameraden<br />
als Warnung erfahren, nachdem er nur geäußert hatte, dass<br />
der Krieg bald verloren ist und wir glücklich sein sollten, hier<br />
zu sein. Prompt lag auf seinem Bett ein Seil zur Schlinge<br />
geformt, als wir vom Essen zurückkamen. Diese Warnung war<br />
eindeutig.<br />
“Papago Park“ in der Nähe von Phönix in Arizona<br />
Am 2. Februar 1944 wurden alle kriegsgefangenen Mariner aufgerufen,<br />
mit Verpflegung versorgt und zum Bahnhof Rockford<br />
gefahren. Wir waren ca. 60 Mann und wurden in einem<br />
Pullman-Wagen untergebracht. An den beiden Eingängen war<br />
während der dreitägigen Fahrt Militärpolizei als Bewachung<br />
postiert. Es war für mich wie ein Traum und unvorstellbar,<br />
aber es war doch die Wirklichkeit. Ich erlebte Amerika mit<br />
seinen unendlichen Weiten, nachts die voll beleuchteten<br />
Städte, ganz ohne Angst vor Bomben. Die Fahrt zum neuen<br />
Lager ging durch die vielfältigsten Landschaftsformen, über<br />
flaches, grünes Land, über Berge und Täler, durch steiniges<br />
ödes Flachland und durch trockene Wüsten. Unser neues<br />
Lager, „Papego Park Arizona“, lag in der Nähe der Hauptstadt<br />
Phönix. Was mir sehr gefiel war, dass es in diesem Lager nur<br />
112
Angehörige der Kriegsmarine gab, die Offiziere eingeschlossen.<br />
Das Lager war in vier Compound (Teillager) für Matrosen und<br />
ein Compound für Offiziere eingeteilt. Insgesamt 2300 Mariners<br />
und 100 Offiziere, unter ihnen Kapitänleutnant Friedrich<br />
Guggenberger, der zweimal vergeblich ausbrach und später in<br />
der Bundeswehr diente.<br />
Arizona ist ein Staat mit viel Wüste, die durch zahlreiche<br />
Bewässerungskanäle durchzogen ist. Das typische Bild seiner<br />
Landschaft sind die Saguaro-Kaktusbäume und der Baumwollanbau.<br />
Unser Lager bestand aus primitiven Baracken, die uns<br />
als Unterkünfte dienten. Das Essen und die Betreuung in<br />
sozialen und ärztlichen Dingen waren hervorragend. Für die<br />
Anschaffung persönlicher Dinge wie Seife, Zahnpasta und<br />
andere Toilettendinge bekam man drei Dollar in 10 und 50<br />
Cent aufgeteilt als Coupons. Wer arbeiten ging, der konnte<br />
sich bis zu 10 Dollar hinzu verdienen und sich damit im Lagershop<br />
Dinge des persönlichen Bedarfs kaufen.<br />
In der Baumwollernte<br />
Arbeit gab es genug. Wir wurden vorwiegend auf den<br />
Baumwollfeldern eingesetzt. Nach dem Frühstück und dem<br />
Zählappell warteten die Farmer mit ihren alten, wackligen<br />
LKW’s schon vor dem Tor. Baumwolle selbst ist leicht, aber<br />
das Pflücken ist gar nicht so leicht. Nach acht Stunden Arbeit<br />
spürt man es stark im Kreuz. Diese Arbeit war gewöhnungsbedürftig.<br />
Die Baumwollkapsel war bei der Reife vorn spitz<br />
wie eine Nadel, und beim Herausziehen der Baumwollknospe<br />
konnte man sich, und das passierte täglich, die Fingerspitzen<br />
aufreißen. Eine andere Gefahr war die Black Widow (Schwarze<br />
Witwe), eine Spinne, die manchmal in der Knospe war.<br />
Wurde man gebissen, schwoll der Arm an. Das war unangenehm,<br />
aber mit einer Spritze war das nach einigen Tagen<br />
wieder vorbei. Die andere Gefahr lauerte zwischen den Reihen<br />
113
im Schatten, wohin sich Klapperschlangen gern verkrochen.<br />
Zum Glück kam das selten vor, denn meistens halten sich diese<br />
Schlangen im steinigen Geröllgebiet auf.<br />
Mit Spinnen und Schlangen habe ich selbst keine Bekanntschaft<br />
gemacht, aber die tägliche Hitze von 35 Grad machte<br />
mit am Anfang zu schaffen, nicht nur mir, sondern auch den<br />
meisten meiner Kameraden. So wurde auch mal das Khaki-<br />
Hemd ausgezogen, das verschwitzt am Körper klebte. Das<br />
wurde aber nicht gern gesehen, wegen der Moral, so bigott<br />
waren die Amis. So kam es mal zu einem Streik, als ein Sheriff<br />
vorbei kam und uns so oben ohne sah. Unser Wachposten und<br />
der Sheriff bekamen sich in die Wolle, und wir sollten wieder<br />
unsere Hemden anziehen. Wir hatten nicht die Absicht und<br />
legten die Arbeit nieder und wollten zurück ins Lager. Als der<br />
Farmer kam, waren der Posten und der Farmer für uns und<br />
der Sheriff musste sich geschlagen geben. So lernte ich ein<br />
bisschen Freiheit in Amerika kennen.<br />
Eines Tages wurde ich in eine Truppe delegiert, die an den<br />
Bewässerungskanälen das Gras beseitigen musste. Einige von<br />
uns, die mähen konnten und sich dafür gemeldet hatten,<br />
bekamen eine Sense. Ich wurde mit einigen Kameraden dazu<br />
bestimmt, an einer Straßenbrücke, unter der ein einen Meter im<br />
Durchmesser messendes Rohr hindurch führte, lange Stangen<br />
wie ein Gitter ins Wasser zu stecken, damit das abgemähte<br />
Gras aufgefangen wurde. Mittels einer Gabel mussten wir anschließend<br />
das aufgefangene Gras rausfischen. Durch diese<br />
Arbeit an der Straße hatte ich das erstmal Kontakt mit der<br />
Zivilbevölkerung. Die Leute, mit denen wir sprechen konnten,<br />
waren sehr wissbegierig, aber sehr unwissend. Zu mir kam<br />
mal ein Mann, nahm mir meinen Hut vom Kopf, sah mich<br />
ungläubig an, fasst mich an die Stirn. Ich fragte ihn, was das<br />
bedeuten soll, und er sagte: „Wo sind deine Hörner und das<br />
Hakenkreuz auf der Stirn?“ Der Posten klärte mich auf. In<br />
114
den Comic- und Hetzfilmen wurden wir „Krauts“, wie sie<br />
uns nannten, öfters mit Hörnern gezeigt, so, wie die Wikinger<br />
früher ihre Helme mit Hörnern hatten. Viele Amis wussten<br />
noch nicht einmal, dass Deutschland in Europa lag und wo<br />
ihre Boys kämpften.<br />
Rotes-Kreuz-Delegation<br />
Eines Tages im Mai 44 inspizierte eine Schweizer Rote-Kreuz-<br />
Delegation unser Lager. Es gab ja bei uns im Lager keine<br />
Beanstandungen. Die Verpflegung war gut, und wir bekamen<br />
unsere Salztablette, da wir wegen der großen Hitze viel schwitzten<br />
und der Körper dadurch viel Salz verlor. Auch die notwendigen<br />
Impfungen gegen Krankheiten erhielten wir. Die ärztliche<br />
Betreuung war ausgezeichnet. Vom Zahnarzt bekam ich meine<br />
erste Plombe verpasst.<br />
Warum diese Delegation? Zu meinem Erstaunen wurde ich<br />
mit einigen Mariner aufgerufen, nach vorn zu kommen. Ein<br />
Mitarbeiter der Delegation musterte uns einen Moment und<br />
putzte uns vor versammelter Mannschaft runter. Wir waren<br />
die, die noch nicht an unsere Angehörigen geschrieben hatten.<br />
Ja, wem sollte ich schon schreiben? Ich war gewillt, nach<br />
Kriegsende nicht mehr nach Deutschland zurück zu gehen.<br />
Meine Familienbande waren ja nicht mehr so ausgeprägt,<br />
allein durch das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Aber<br />
da war ja noch Oma und Tante Hilde, mit denen ich immer verbunden<br />
war. Und Freunde? Mein Freund Heiner war schon<br />
1943 in Russland gefallen. Das Rote Kreuz gab mir eine rote<br />
Karte, mit der ich verpflichtet war, irgendeinen Angehörigen<br />
zu benachrichtigen. Ich schrieb an Oma. Als die Karte der<br />
Delegation übergeben wurde, zögerte ich noch, ob es richtig<br />
war, nicht an meine Mutter zu schreiben. Doch die Bedenken<br />
ließ ich fallen, sie wird sich schon mit ihrem Alfred weiterhin<br />
amüsieren.<br />
115
Die Lampe und der Arrest<br />
Das Lagerleben lief weiter seinen Gang. Ich hatte mich damit<br />
beschäftigt, eine Tischlampe aus Sperrholz zu bauen. Laubsäge<br />
und das benötigte Material bekam ich aus dem Materiallager.<br />
Ein Elektriker, der außerhalb des Lagers arbeitete,<br />
besorgte mir eine Fassung sowie Schalter und Kabel. Es war<br />
ein sechseckiger Schirm mit Märchenmotiven. Ich war stolz<br />
auf meine Arbeit, aber die Freude sollte nicht lange anhalten.<br />
Bei einer Baracken-Kontrolle sah der Master-Sergeant, was bei<br />
uns dem Hauptfeldwebel entspricht, die Lampe und wollte<br />
sie haben. Ich sollte auch einige Dollar dafür bekommen. Ich<br />
verneinte.<br />
Nach der Kontrolle dauerte es nicht lange, und er kam mit<br />
einem Militärpolizisten zurück. Als ich ihn an der Tür sah,<br />
nahm ich die Lampe vom Nachttischschrank und zerschlug<br />
sie auf dem Boden. Ich war in den jungen Jahren sehr impulsiv,<br />
und meine Unvernunft war stärker als mein Verstand. Als<br />
der Sergeant die zerschlagene Lampe sah, war er erst sehr erstaunt.<br />
Er sagte kein Wort zu mir, zum Polizisten nur einige<br />
Worte, und dann wurde ich abgeführt. Außerhalb des Lagers<br />
war ein ca. 50 mal 40 Meter großes, mit Stacheldraht umzäuntes<br />
Gelände, eine Baracke für 20 Personen, nur mit Holzpritschen<br />
und zwei Toiletten. An der einen Ecke ein kleines Holzhäuschen<br />
mit Toilette und Möglichkeit zum Waschen und Duschen.<br />
Mir war gar nicht wohl zumute. Jeden Morgen bekam ich<br />
einen Liter Wasser und einen Kanten Weißbrot. Ich wartete<br />
schon den dritten Tag auf eine Verurteilung. Aber es tat sich<br />
nichts. Am vierten Tag kam der Sergeant mit einer großen<br />
Einkaufstüte, sah mich an und übergab sie mir. Ohne ein Wort<br />
zog er wieder ab.<br />
Es war eine Wundertüte mit gut belegten Broten, Apfelsinen<br />
und Pepsi-Cola. Ich war baff. Da ich schon mal gelesen<br />
116
hatte, dass Halbverhungerte oder Verdurstete, was auf mich<br />
noch nicht zutraf, sich nicht gleich den Bauch voll schlagen<br />
sollen, teilte ich mir alles ein. Es ist mir gut bekommen. Am<br />
sechsten Tag holte mich der Sergeant raus und machte mir<br />
den Vorschlag, gegen Bezahlung eine Lampe zu bauen. Ich<br />
war einverstanden und beschämt über seine kulante Art, mit<br />
mir umzugehen.<br />
Für die neue Lampe bekam ich vier Dollar, für die damalige<br />
Zeit eine Menge Geld. Einige Tage später wurde ich in einer<br />
Truppe von 150 Mann nach „Camp Beale“ in Kalifornien zur<br />
Obsternte abkommandiert.<br />
Zur Obsternte nach Kalifornien<br />
Es war nach internationalem Recht möglich, alle drei bis sechs<br />
Monate mit den Gefangenen einen Lagerwechsel durchzuführen.<br />
Der Sinn war, mögliche Vorbereitungen für Fluchtversuche zu<br />
unterbinden. Aber wer dachte schon an Fluchtversuch, da wir<br />
doch ein bombiges Leben hatten.<br />
Am 5. Juni 1944 kamen wir an. Die Fahrt mit der Bahn im<br />
Pullman-Coupe war schon Luxus und die Durchfahrt durch<br />
den Staat Arizona mit seinen Wüstengebieten und die Rocky<br />
Mountains berauschend. Geprägt wird der Südwesen Arizonas<br />
durch die Sonora-Wüste mit ihren riesigen Saguaro-Kaktusbäumen.<br />
Das Klima in Kalifornien ist trockene, und die Luft<br />
ist sauber. Im Sommer steigt die Temperatur manchmal bis<br />
auf 40 Grad.<br />
Bei der ersten Ansicht des Lagers nahm ich an, dass wir am<br />
Rande einer Stadt waren. Aber es war ein riesiges Militärareal.<br />
Links und rechts der Straßen standen einstöckige Holzbaracken.<br />
In jeder Straße gab es einen Einkaufsshop, ein Kasino,<br />
sogar eine kleine Kirche. Die Gebäudekomplexe waren alle<br />
117
quadratisch angeordnet. Für uns 150 Mann war ein mit<br />
Doppelzaun abgezäuntes Gelände borgesehen. Wir hatten<br />
einen Sportplatz, einen Einkaufsshop und, was ich als das<br />
Beste empfand, voll klimatisierte Baracken.<br />
An dieser Militärstadt schloss sich war ein Truppenübungsplatz<br />
an. Er sollte dem Hörensagen nach fünfzig Quadratkilometer<br />
groß sein.<br />
Aprikosen- und Pfirsichernte<br />
In den ersten zwei Monaten war ich zur Aprikosen- und<br />
Pfirsichernte eingeteilt. Diese Arbeit machte mir sehr viel Spaß,<br />
da die vom Baum gepflückten Früchte am besten schmecken.<br />
Doch nach einiger Zeit wollte ich keine mehr sehen. Ich hatte<br />
mich übergegessen. Außerdem wurde ich davon stark hartleibig.<br />
In diesen riesigen Plantagen wurde die Arbeit von Wanderarbeitern<br />
ausgeführt, die aus vielen Staaten der USA kamen.<br />
Diese Wanderarbeiter führten nach meiner Auffassung eine<br />
Art Zigeunerleben. Ihr Zuhause war ein PKW mit Wohnwagen.<br />
Mit Kind und Kegel zogen sie von Staat zu Staat, dorthin, wo<br />
gerade Saisonarbeit angeboten wurde, ob Baumwolle-,<br />
Gemüse- oder Obsternte. Sie fühlten sich als freie Bürger,<br />
waren immer fröhlich. Ich dagegen war bei dieser Akkordarbeit<br />
nach Feierabend fix und alle. Unsere Gruppe, wir waren<br />
fünfzehn Mann, schaffte selten die geforderte Norm, und so<br />
wurden wir von der Erntearbeit abgezogen. Einige Zeit des<br />
Nichtstuns tat mir ganz gut.<br />
Ich beschäftigte mich mit Tätigkeiten, die mich früher entweder<br />
nicht interessierten oder von denen ich keine Ahnung hatte. So<br />
spielte ich Fuß- und Handball, lernte Kartenspiele von Rommè,<br />
Doppelkopf bis Skat. Ich nahm mir vor, auch an einem Lehr-<br />
118
gang der englischen Sprache teilzunehmen. Aber noch fehlte<br />
eine Lehrkraft.<br />
Suche nach Blindgängern<br />
Eine neue Arbeit stand bevor: Blindgänger suchen. Wir waren<br />
zwölf Mann, ausgerüstet mit einem Seitengewehr, Gamaschen<br />
und einem Beutel. Diese Ausrüstung hatte folgende Bedeutung:<br />
Die Gamaschen waren der Schutz gegen Schlangenbisse, das<br />
Seitengewehr diente dazu, Stöcke von den Büschen zu schneiden,<br />
und in dem Beutel war giftiger Weizen, der an den Rand der<br />
Erdhörnchenhöhlen gestreut wurde. Erdhörnchen waren voller<br />
Ungeziefer und Krankheitsüberträger.<br />
Unsere Arbeit war nicht gefährlich, aber strapaziös, nur<br />
laufen und nochmals laufen. Auf dem Truppenübungsplatz<br />
wurden täglich Artillerie-Schießübungen durchgeführt.<br />
Bevor wir das Lager per LKW verließen, wurden im Hauptquartier<br />
die Zeit und die Planquadrate festgelegt, damit wir<br />
nicht in einen Schussbereich gerieten. In einer Linie in einem<br />
Abstand von Mann zu Mann von 10 Metern durchkämmten<br />
wir das Gelände nach Blindgängern. Wurde einer gefunden,<br />
wurde ein Stock von einem Gebüsch abgeschnitten, ein rotes<br />
Fähnchen daran befestigt und so die Stelle gekennzeichnet.<br />
Der Posten meldete den Fund per Feldtelefon, dann kam das<br />
Sprengkommando mit einem Jeep. Wurde ein Erdloch beim<br />
Suchen der Granaten gesehen, wurden rings um das Loch ein<br />
paar Giftkörner gestreut. Entfernte man sich ein paar Schritte,<br />
kamen die Erdhörnchen aus ihrem Bau und fraßen die<br />
Körner. Es dauerte dann keine Minute, und sie hatten das<br />
Zeitliche gesegnet.<br />
Die Gefahren in unserer Tätigkeit gingen von den im Busch<br />
lebenden Tieren aus. Schlangen, Taranteln, Vogelspinnen,<br />
Hyänen und sogar Pumas. Aber wir hatten ja unseren Förster<br />
119
und den Wachposten. Der Posten war ein putziges Kerlchen.<br />
Er sprach gut deutsch und war der Sohn jüdischer Einwanderer<br />
aus dem Fränkischen. Da er Plattfüße hatte, war er nicht fronttauglich.<br />
Aber auch bei unserer Bewachung war er nicht gerade<br />
eine Größe. Es war ja verständlich, dass er uns in dem teils<br />
unübersichtlichen Gelände mit Büschen, Senken und leichten<br />
Anhöhen nicht alle in Sicht hatte. Aber sein Ausspruch „Wenn<br />
ihr abhauen wollt, schieß ich euch in den Arsch“ ging uns auf<br />
den Geist.<br />
Bei unserer Aktion hatten wir täglich eine Stunde Ruhepause,<br />
die wir im Schatten der wenigen Bäume genossen. Nach dieser<br />
Lauferei in der Hitze überwältigte uns regelmäßig die Müdigkeit.<br />
Auch unseren Posten überfiel sie. Sein Gewehr lehnte<br />
er an einen Baum, während er im Gras lag und selig schnarchte.<br />
Einer unserer Kameraden schlich zum Gewehr, entfernte<br />
das Schloss, nahm es auseinander und verteilte es auf sechs<br />
Mann. Ich schlief nicht, beobachtete die Aktion und war über<br />
das Desinteresse des Försters erstaunt, der mit Gleichmut die<br />
Sache betrachtete. Als der Posten munter wurde und das Malheur<br />
sah, wurde er erst rot im Gesicht, dann blass. Nun wollte<br />
er keinem mehr in den Arsch schießen und bettelte um das<br />
Schloss. So fuhren wir ins Camp zurück, mit einem bitterbösen<br />
Posten und wir in Sorge, was mit den sechs Kameraden passieren<br />
wird, die die Schlossteile hatten. Sie bekamen alle drei Tage<br />
Arrest, und der Posten wurde umgesetzt.<br />
Es kamen sechs Neue, und die Arbeit ging noch 14 Tage, dann war<br />
ich einige Zeit arbeitslos. Unser Kamerad, der als Dolmetscher<br />
fungierte, fragte den Förster, warum er die Sache nicht<br />
unter bunden hatte. Er sagte „Ich wusste, dass ihr nicht flüchten<br />
wolltet. Ihr wolltet nur euren Spaß, na ja, den hattet ihr.“<br />
120
Ärger in der Wäscherei<br />
Nach einigen Tagen Nichtstun bekam ich Arbeit in der Wäscherei,<br />
an der Bügelmaschine für Hosen. Die Wäscherei unterhielt<br />
ein Jude im Range eines Obersts als Privatunternehmer. Alle<br />
Shops und anderen Unternehmen des riesigen Militärobjektes<br />
lagen in jüdischer Hand, und alle waren Offiziere. Ich hatte<br />
nichts gegen Juden, zumal ich mit meinem Nachbarsohn Joshi<br />
Papendick immer ein gutes Verhältnis hatte, und wir immer<br />
auf Abzahlung bei den Juden kaufen konnten. Aber es war nicht<br />
gerecht, dass einige der jüdischen Offiziere ihre Verachtung uns<br />
gegenüber offen zum Ausdruck brachten. Und so war unsere<br />
Reaktion entsprechend. Wir wussten es damals nicht besser.<br />
Da ich wieder die Norm nicht erfüllte, dieses Mal wollte ich<br />
nicht, kam ich an die Mangelmaschine. Wir waren acht Mann,<br />
die Bettlaken und Bezüge durch die Rollen jagen mussten. Auf<br />
jeder Seite war vor der Mangel eine Schiene mit einem Querbrett.<br />
Darauf wurden die Laken von zwei Mann handgerecht<br />
gepackt und auf die untere Rolle gelegt, wobei die obere Rolle<br />
das Laken mit einer rasenden Geschwindigkeit in die anderen<br />
Rollen zog, während mein Gegenüber und ich die Seiten der<br />
Laken glattziehen mussten. Dass Glattziehen gelang bei der<br />
Geschwindigkeit nicht immer, und so kamen einige Laken<br />
zerknautscht am Ende heraus. Ich stand am Kontroller und<br />
stellte die Geschwindigkeit etwas langsamer. Es dauerte nicht<br />
lange, und der Oberst kam zur Kontrolle, schimpfte mit mir<br />
und stellte den Kontroller auf Schnelldurchlauf. Als er weg<br />
war, stellte ich den Kontroller wieder langsam. Wir waren uns alle<br />
einige, dass durch diese Geschwindigkeit die Laken einwandfrei<br />
gemangelt wurden. Aber der Oberst sah das anders.<br />
Das Spielchen mit dem Kontroller, er Geschwindigkeit rauf,<br />
ich wieder runter, sobald er weg war, verschaffte mir nach<br />
einigen Stunden die Bekanntschaft mit zwei Militärpolizisten.<br />
121
Sie begleiteten mich zu einem Jeep. Ich hatte ganz schön<br />
Muffsausen. Mein Verdacht, dass ich das Lager eine Weile<br />
nicht wiedersehen würde, sollte sich bestätigen. Ich landete<br />
im Arrest.<br />
Erneut im Arrest<br />
Von außen sah er wie eine Holzbaracke aus, aber innen waren<br />
15 cm dicke Betonwände, ein vergittertes Fenster, ca. 25 cm<br />
im Quadrat, wahrscheinlich zum Luftholen, denn Sicht nach<br />
Draußen gab es keine, schließlich eine Holzpritsche und zwei<br />
Decken.<br />
Gespeist wurde vorzüglich, pro Tag ein Liter Wasser und ein<br />
Kanten Brot. Ich verfluchte mich selber, dass ich durch meine<br />
Dummheit in diese Lage gekommen war. Jetzt hatte ich Zeit<br />
und Muße, auch einmal an zu Hause zu denken. Die zweite<br />
Karte vom „Roten Kreuz“ musste ich an meine Mutter schicken,<br />
da machte ich mir kaum Hoffnung, Nachricht zu erhalten,<br />
zumal, wenn der liebe Alfred, ihr Liebhaber, die Karte abgefangen<br />
haben sollte. Das lag durchaus im Bereich des Möglichen,<br />
denn unser Verhältnis war sehr gespannt. Was machten meine<br />
Freundinnen, vor allem Inge Arnswald, der kleine freche Spatz,<br />
die Unnahbare? Wenn man in einer Einzelzelle eingesperrt<br />
ist, kommt das Gehirn ins Trudeln, und es kommen nur krause<br />
Gedanken in den Sinn.<br />
Einige Tage hatte ich schon abgesessen, ohne dass eine Verurteilung<br />
durch einen Gerichtsoffizier erfolgte, als ich etwas<br />
sehr überraschendes erlebte. Die Wache der Arrestbaracke<br />
erfolgte im 12-Stunden-Takt. Die Wachmannschaft bestand<br />
jeweils aus einem Sergeanten und sechs Soldaten. Eine neue<br />
Ablösung erfolgte, und gegen Abend, ich wollte mich gerade<br />
zum Schlafen hinlegen, kam der Wachhabende in meine Zelle.<br />
Das selbst war schon merkwürdig, da das Wasser und das<br />
122
Brot nur durch die Türklappe gereicht wurden und lediglich<br />
zur Notdurft die Tür aufgeschlossen wurde.<br />
Wir führten ein langes Gespräch, als Verhör betrachtete ich<br />
das nicht, denn ich erzählte auf seine Fragen hin meine halbe<br />
Lebensgeschichte - und er mir die seine. Seine Eltern hatten eine<br />
kleine Landwirtschaft in der Nähe der polnischen Westgrenze.<br />
Er sprach ein gutes Deutsch mit oberschlesischem Akzent.<br />
Seine Mutter war deutscher Abstammung, sein Vater Pole.<br />
Seine Anwesenheit in den USA verdankte er seiner Flucht vor<br />
Kriegsbeginn über das englische Konsulat.<br />
Ich fragte ihn, warum er mich so freundlich behandelt. Er<br />
sagte sinngemäß, dass ich kein Soldat in Polen oder Russland<br />
war, sondern nur Matrose in Italien, also konnte ich in seiner<br />
Heimat keine Verbrechen begangen haben. Sein Vater habe<br />
auch gute Deutsche kennen gelernt.<br />
Solange er mit seiner Truppe Nachtdienst hatte, genoss ich<br />
diese Nächte mit ihm bei belegten Broten und Pepsi-Cola<br />
oder Mineralwasser.<br />
Das Gegenteil lernte ich nach der Wachablösung kennen. In<br />
dieser Truppe war auch unser ehemaliger Wachposten vom<br />
Blindgänger-Suchkommando. Zwei Tage musste ich mich mit<br />
hartem Weißbrot und erwärmtem Wasser begnügen, das er<br />
zuvor einige Stunden bei Sonnenlicht auf das Fensterbrett der<br />
Wachstube gestellt hatte. Ich nahm es mit Gleichmut, mich<br />
dagegen zu beschwerden wäre sinnlos gewesen.<br />
Am zwölften Tag meiner Inhaftierung war Appell mit dem<br />
Lagerkommandanten angesagt. Ich war der einzige Häftling<br />
im Arrest und musste Dienstgrad, Name Alter und Grund der<br />
Haft melden. Bei dieser Aussage „Haft“ schwieg ich, und der<br />
Wachhabende informierte ihn, auch, dass nicht bekannt ist,<br />
wieviele Tage ich Arrest habe. Ich kam zurück in meine Zelle.<br />
Eine Stunde später wurde ich mit einem Jeep zum Provost-<br />
123
Marchel (Militär-Richter) gebracht und zur Urteilverkündung<br />
vorgeführt. Ich wurde zu 14 Tagen bei Wasser und Brot verurteilt.<br />
Da ich schon 12 Tage eingesessen hatte, musste ich noch zwei<br />
Tage absitzen. Ich habe es überstanden. Der Nachteil war nur,<br />
dass ich in dieser Zeit keine Arbeit hatte und mir somit die<br />
Möglichkeit genommen war, außer den drei Dollar Taschengeld<br />
zusätzlich Geld zu verdienen, um meinen Lagerlebensstandard<br />
mit Eis und Schokolade zu versüßen. Ich war Nichtraucher,<br />
und so reichten die drei Dollar vom Internationalen Roten<br />
Kreuz für die täglichen Bedürfnisse an Seife, Rasierseife,<br />
Zahnputzmittel und neue Unterwäsche. Meine Sturheit und<br />
mein Übermut hatte mich das zweite Mal ins Kalabusch, so<br />
nannten wir Mariner den Arrest, gebracht.<br />
Hier im „Camp Beale“ ging der Aufenthalt zu Ende, und es<br />
ging zurück nach Arizona. Aber es ging nicht nach Papego<br />
Park, sondern in das „Camp Mesa“ östlich der Hauptstadt<br />
Phönix.<br />
Camp Mesa<br />
Ankunft war der 20. Oktober<br />
1944. „Camp Mesa“ war aber<br />
kein Marinelager, sondern hier<br />
waren alle Waffengattungen<br />
vertreten. Von meiner alten<br />
Truppe war nur noch Gerhard<br />
Baatz mit mir zusammen.<br />
Als Unterkunft gab es keine<br />
Baracken, sondern nur 6-Mann-<br />
Zelte, die mit Holzpritschen,<br />
je zwei Decken und einem<br />
Kanonenofen in der Mitte eingerichtet<br />
waren. Es war sehr In Camp Mesa 1944<br />
124
primitiv. Als Arbeit war Baumwollpflücken und nochmals<br />
Baumwollpflücken angesagt.<br />
Ich kannte die harte Arbeit ja schon aus der Zeit in „Papego<br />
Park“, aber hier gab es nur Akkordarbeit. 67 englische Pfund<br />
mussten geschafft werden. Diese Norm wurde nur von sehr<br />
wenigen geschafft, von mir nicht. Aufgrund dessen gab es<br />
keine Entlohnung, auch nicht für die geschaffte Menge.<br />
Die Lagerleitung bestand aus Unteroffizieren und Feldwebeln<br />
der anderen Waffengattungen. Da waren noch viele alte<br />
stramme Nazis dabei, und sie bestimmten das Lagerlebens.<br />
Streik und selbst genähte Hose<br />
Deshalb wurde gestreikt. Sechs Wochen mussten wir bei Wasser<br />
und Brot sowie wöchentlich einmal eine warme Suppe<br />
auskommen. Die Folge? Gereizte<br />
Stimmung und zwei Tote durch<br />
Schwarzwasserfieber. Als Repressalie<br />
durchsuchten die<br />
Amis täglich unsere Zelte. Tätlichkeiten<br />
durch die Amis habe<br />
ich nicht festgestellt. Zugleich<br />
habe ich ihre Gelassenheit bewundert<br />
und mich gefragt,<br />
was in Deutschland mit Kriegsgefangenen<br />
passiert wäre, die<br />
im Lager gestreikt hätten?<br />
Als der Streik beendet war, gab<br />
es für uns keine Arbeit. Langeweile<br />
machte sich breit. Sport<br />
und Kartenspiele waren die<br />
einzige Zerstreuung, aber das Mit Gerhart Baats<br />
125
konnte mich nicht zufrieden stellen. Von „Camp Beale“ hatte<br />
ich aus der Wäscherei zwei weiße Bettlaken mitgehen lassen.<br />
Ich wollte mir eine Hose mit breitem Hosenbeinschlag selbst<br />
nähen, aber mit fehlte das Schnittmuster. In einem Camp mit<br />
Hunderten von PW (Prisoners of War) muss sich doch ein<br />
Schneider finden lassen! Und ich fand ihn. Er nahm Maß,<br />
machte den Zuschnitt und erklärte mir die Nähtechnik. Ich<br />
bezahlte mit zwei Stangen Zigaretten Camel. Billiger konnte<br />
ich keine Hose bekommen. Die Langeweile war wie weggeblasen,<br />
ich hatte eine Aufgabe. Stich für Stich, Naht für Naht,<br />
teilweise wieder auftrennen usw., aber in vier Wochen war<br />
die Hose fertig. (Bild mit zwei Kameraden vorhanden.)<br />
Erste Nachrichten von Zuhause<br />
Im Frühjahr 1945 ging es wieder auf die Baumwollfelder. Die<br />
neue Saat war aufgegangen, und die Pflänzchen mussten<br />
verzogen werden.<br />
Weite Felder, Kilometer lang und der Planet brannte unbarmherzig<br />
auf den Leib. Es war schlimmer als die Pflückarbeit. Der<br />
Schweiß machte die Innenhand wund, Salben und Kühlung<br />
brachten kaum Linderung. Ich habe es überstanden, und das<br />
Vergessen dere Schmerzen kam in Form eines lieben Briefes<br />
aus der Heimat. Inge Arnswald hatte mir die erste Hoffnung<br />
und Freude nach Amerika gebracht. Den ganzen Inhalt kann<br />
ich nicht wiedergeben, aber die Freude, dass ich gesund bin,<br />
und die Traurigkeit, wieviele Bekannte gefallen oder durch<br />
Bombenangriffe umgekommen waren, war dem Brief zu entnehmen.<br />
Mein Zuhause Große Gartenstraße 8 war zerbombt.<br />
Mama und Alfred waren im Moment des Bombenangriffs<br />
nicht zu Hause. Inge Arnswald hatte meine Schwester Inge<br />
bei sich aufgenommen, von der sie auch meine Adresse hatte.<br />
126
Von nun an kamen öfter Briefe, auch von Oma und Mama.<br />
Aber meine Gedanken und Träume drehten sich seit dem ersten<br />
Brief von Inge Arnswald nur noch um sie. Ich begann zu<br />
spinnen. Träumte von Haus und zwei Kindern in einer glücklichen<br />
Ehe. Aber wollte sie mich überhaupt, mich, der in einem<br />
solchen sozialen Milieu aufgewachsen war? Ihre Eltern<br />
lebten in geordneten Verhältnissen. Bisher waren wir uns in<br />
Freundschaft verbunden, was ihr Vater auch duldete. Aber<br />
mehr? Immerhin, seit ich im letzten Urlaub bei Mutter Oma<br />
Groczek in Butterlake war, wusste ich, dass ich bei den Großeltern<br />
angekommen war. Es war eine große Herzlichkeit.<br />
Der Krieg neigte sich dem Ende entgegen, und ich ließ meinen<br />
Gedanken freien Lauf.<br />
Kriegsende<br />
Am 6. Mai 1945 wurde ich abkommandiert ins Nebenlager<br />
Continental (Nebenlager Compound) direkt an der Hauptstraße<br />
10 zwischen Tucson und Nogales an der Mexikanischen<br />
Grenze.<br />
Es war ein kleines Lager für 150 Mann mit Sechs-Mann-Zelten<br />
wie in Camp Mesa. Unser Kommandant war Leutnant Beppo<br />
Beaumont, ein kleiner, dicklicher, gutmütiger Mann. Hier<br />
wurden wir zur Kartoffel- und Möhrenernte eingesetzt. In der<br />
Kartoffelernte, die vollmechanisiert war, wurden wir nur am<br />
Sortierband eingesetzt.<br />
Mit uns auf den Feldern arbeiteten nur Latinos, Menschen<br />
aus Mittel- und Südamerika. Sie arbeiteten und lebten unter<br />
unmenschlichen Bedingungen, wenig Lohn und schlechte<br />
Unterkünfte. Ihr Vorgesetzter war ein Mexikaner, fies und<br />
brutal.<br />
Hier im Lager Continental überraschte uns das Kriegsende,<br />
der V-Day, der 8. Mai, der Siegestag der Amis. Die Bewohner<br />
127
der Städte, die Farmer und Bewacher waren wie berauscht,<br />
und wir natürlich niedergeschlagen. Wir waren die Verlierer<br />
und bekamen das kurzfristig zu spüren. Das Essen wurde<br />
mies, der Shop wurde geschlossen, und es gab keine Sachen<br />
des täglichen Bedarfs mehr. Vor allem keine Zigaretten. Für<br />
die Raucher war das wie ein moralisches Todesurteil.<br />
Ich war immun, kein Raucher, mir war ein Becher Eis lieber.<br />
Meine neue Arbeitsstelle war die SS-Ranch in der Nähe der<br />
mexikanischen Grenze. Wir nannten sie so, weil der Rancher<br />
Samuel Strong hieß.<br />
Auf der SS-Ranch<br />
Er hatte Tausende Rinder und dementsprechend ein riesiges<br />
Weideland. Wir, wir waren 10 Mann, hatten die Aufgabe,<br />
Kleeheu unter Dach zubringen. Es war eine gute Arbeit, teilweise<br />
jedoch auch schwer. Technisch und organisatorisch war<br />
die Farm auf einem so hohen Niveau, wie ich es in der Heimat<br />
noch nie gesehen hatte. Mein Nationalgefühl, wir sind die<br />
Besten, wir haben die beste Technik der Welt, bekam einen<br />
Riss.<br />
Der Ablauf war rationell durchorganisiert. Ein kleiner Caterpillar<br />
(Kleintraktor mit Raupen), seitwärts ein Elevator zur<br />
Heuaufnahme mit einer Presse, links und rechts je ein Mann,<br />
der eine steckte den Draht im oberen und unteren Drittel des<br />
Heuballens durch, der andere machte einen Kreuzknoten.<br />
Wenn der gepresste Ballen ausgestoßen wurde, entspannte<br />
sich der Ballen und wurde in seiner Form gehalten. Hinter der<br />
Presse war eine Einachser-Plattform von ca. 2 x 2 Meter angekoppelt.<br />
Auf dieser Plattform wurden 16 Stück von einem<br />
Mann gestapelt. War die Plattform voll, zog er einen Hebel,<br />
die Plattform senkte sich nach hinten und die Ballen blieben<br />
in Quadratform auf dem Feld liegen. Die Ballen wurden<br />
128
von vier Mann auf einen Plattenwagen aufgeladen und unter<br />
Dach gebracht. Das war wie eine Scheune nur mit Dach und<br />
Stützpfeilern, aber ohne Wände.<br />
Der Planet brannte unbarmherzig auf uns nieder, und die<br />
Versorgung durch den Rancher für uns und seine Cowboys<br />
mit eisgekühltem Wasser und geschnittenen Pampelmusen in<br />
50-Liter-Metallbehältern war immer gewährleistet. Konnte man<br />
es als Kriegsgefangener besser haben? Mittag um 12 Uhr war<br />
Feierabend, und es gab ein kräftiges Essen, meist ein Stück<br />
Fleisch mit roten Bohnen.<br />
Als wir schon 14 Tage dort waren fragte uns der Vormann im<br />
Auftrag des Ranchers, ob wir jeden Tag eine Stunde länger<br />
arbeiten würden, denn die Regenzeit würde bald einsetzen,<br />
und das Heu müsste unters Dach. Wir mussten das nicht<br />
machen, sprachen uns jedoch mit den Posten ab und sagten<br />
zu. Für uns war das sehr gewinnbringend, denn in dieser<br />
Stunde schafften wir zwei Wagen mehr, und jeder bekam<br />
einen Dollar und eine Schachtel Zigaretten. Ein Labsal für die<br />
Raucher. Die Sonne machte mir ganz schön zu schaffen. Aber<br />
nach fünf Tagen war die Arbeit beendet, und es ging wieder<br />
zurück zum Hauptslager Papago Park. Am dem 14. September<br />
wurde Papego Park wieder für eine lange Zeit mein Zuhause.<br />
Für ein langes Jahr in Papago Park<br />
Es war ein Jahr ohne besondere Ereignisse, nur mit viel Arbeit<br />
in den Bauwollfeldern, oder bei der Bereinigung der Bewässerungsanlagen.<br />
Ich besuchte einige Male Seminare für englische<br />
Sprache. Aber in Rechtschreibung und Grammatik war ich ja<br />
schon in der Schule nicht besonders gut gewesen. Durch meine<br />
Lungenentzündung und zwei Kuraufenthalte 1935 war ich<br />
ein halbes Jahr der Schule fern geblieben, so dass ich in der 5.<br />
Klasse sitzen bleiben musste. Ich will mich damit nicht ent-<br />
129
schuldigen, denn ich hatte ja auch die Möglichkeit, durch die<br />
Abendschule einiges nachzuholen. Aber eine gewisse Trägheit<br />
und der Sport waren ein schlechter Ratgeber. In den Seminaren<br />
war ich gemeinsam mit Schülern, die schon das Abitur oder<br />
Reifezeugnis hatten. Ich merkte schon bei einigen ihre Überheblichkeit<br />
und spürte an ihren dummen Bemerkungen, dass<br />
ich nicht in dieses Seminar passte. Mein Selbstwertgefühl litt<br />
sehr darunter, und ich hörte wieder auf.<br />
130
Fußball, Handball und Kartenspiele waren nun meine Freizeitgestaltung,<br />
bis ich einen älteren Kameraden kennen lernte,<br />
der in der Schachmannschaft spielte. Er wollte einer Gruppe<br />
junger Soldaten das Schachspielen beibringen. Ich war begeistert,<br />
und das war meine Schule, an der ich immer teilnahm, wenn<br />
ich nicht in einem anderen Lager zum Arbeitseinsatz war.<br />
131
Blackfoot, Idaho<br />
Der Tag der Verlegung kam schneller als gedacht. Meine<br />
Abkommandierung erfolgte am 26. September 1945 nach<br />
Blackfoot, Idaho. Blackfoot liegt am Highway 15 zwischen<br />
Pocatello und Idaho Falls.<br />
Idaho ist Kartoffel- und Rübenland, und unsere Aufgabe<br />
wurde es, diese aus der Erde zu holen. Untergebracht waren<br />
wir in einer heißluftbeheizten Landwirtschaftshalle. Die<br />
Ernte erfolgte meist mit Körperkraft, die Kartoffeln zwar<br />
auch maschinell, die Rüben jedoch nur manuell. Es war, Gott<br />
sei Dank, nur eine kurze Zeit, die zudem betreffs der Freizeit<br />
auch ihr Gutes hatte. Um die Halle herum war in drei Meter<br />
Abstand ein nur 50 Zentimeter hoher Stacheldrahtzaun<br />
gezogen, als Zeichen einer „Verbotenen Zone“. Nicht für uns,<br />
sondern für die Bevölkerung. Ich benutzte, wie ein großer Teil<br />
meiner Kameraden, die Gelegenheit, abends in der Dunkelheit<br />
Stadtbesichtigungen zu machen. Die Menschen beachteten<br />
uns nicht so besonders, sie waren es gewöhnt, denn zur Saison<br />
waren des Öfteren Kriegsgefangene hier.<br />
Weiter nach Camp Bukey<br />
Am 5. November 1945 waren wir wieder in Papago Park.<br />
Anschließend ging es am 17. November gleich ins Camp<br />
Bakey ca. 30 Kilometer von Phönix zur Baumwollernte. Camp<br />
Bakey war ein kleines Zeltlager für uns 15 Mann und 3 Posten. Es<br />
lag am Rande eines Feldweges. Hinter unserem Lager befand<br />
sich ein riesiges Weideland. Um das Lager herum war wie in<br />
Idaho ein bisschen Stacheldrahtzaun. In der Nähe standen<br />
zwei kleine Zelte, in denen Mexikaner campierten, die dort<br />
ihre große Schafherde hüteten. Es war eine idyllische Zeit.<br />
132
Einige Kameraden und ich gingen öfter zu den Mexis, denn<br />
wenn es Abend wurde, klimperten sie bis spät abends auf ihren<br />
Gitarren, und wir waren ihre Gäste. Es waren arme Burschen,<br />
die Hirten, aber gastfreundlich, und das trockene Fladenbrot<br />
aus Mais schmeckte.<br />
Die Posten kümmerten sich kaum um uns, nur um zehn Uhr<br />
zur Zählung mussten wir da sein. Und wir waren immer<br />
pünktlich da, denn wer wollte nach Ende des Krieges und bei<br />
dieser Betreuung noch abhauen. In diesem Zeltlager fühlte ich<br />
mich nicht als Kriegsgefangener. Das riesige Weideland ringsherum,<br />
nur hier und da ein Baum. Wenn ich träumte, wurde<br />
der Stacheldraht mit seiner geringen Höhe zur grünen Hecke<br />
um einen Garten. Sentimental zu sein hat auch etwas Gutes.<br />
Es ist keine Schwäche, sondern es kommen die Gedanken,<br />
wie man sich sein weiteres Leben vorstellt. Zurückblickend<br />
auf mein Jugendleben wollte ich nicht mehr zurück in das<br />
soziale Umfeld meiner Familie. Mein Traum, und träumen<br />
darf man ja, waren eine liebe Frau, ein Haus und zwei Kinder.<br />
Mein Beruf als Former würde mir die finanzielle Grundlage<br />
ermöglichen.<br />
Das Weihnachtsfest 1945 war trostlos. Wir erhielten zwar eine<br />
Sonderration vom Hauptlager, aber die gewisse Feierlichkeit fehlte.<br />
Wenn ich im Hauptlager gewesen wäre, hätte ich vielleicht<br />
den Weg zur Weihnachtsmesse gefunden, auch wenn ich im<br />
Prinzip kein Kirchgänger war. Dazu widersprachen meine<br />
Erfahrungen mit einigen Vertretern Gottes zu sehr meinen<br />
christlichen Vorstellungen. Aber mein seelisches Gemüt war<br />
aus dem Gleichgewicht geraten, und Weihnachten sind nun<br />
einmal Tage, an denen das Herz eine andere Meinung hat als<br />
das Gehirn.<br />
Einige Wochen später änderte sich alles schlagartig. Mit dem<br />
Auftrag, das Lager in einigen Tagen aufzulösen, kam auch<br />
133
Post. Ich erhielt wieder einen Brief von Inge Arnswald. Es war<br />
ein trauriger Brief, aber auch mit einigen hoffnungsvollen<br />
Zeilen, die meine Gedanken anregten. Die traurige Nachricht<br />
war, dass mein Großvater gestorben war. Oma lebte jetzt mit<br />
Tante Hilde zusammen. Inges Freundin Melitta, mit der<br />
gemeinsam sie beim Reichsarbeitsdienst war, war bei<br />
dem schweren Bomben angriff am 20. April 45 ums Leben<br />
gekommen. Brandenburg war stark zerstört, aber die lieben<br />
Zeilen von Inge Arnswald gaben mir große Hoffnung auf eine<br />
Zukunft zu zweit.<br />
Aufbruch Richtung Europa<br />
Am 5. Februar 1946 war ich wieder zurück in Papago Park.<br />
Zu meiner großen Überraschung wurde ich neu eingekleidet<br />
und gegen Tetanus sowie Paratyphus geimpft. Außerdem<br />
konnte ich im Shop einkaufen. Es ging nach Hause. Am 19.<br />
Februar 1946 ging es mit der Bahn nach Kalifornien, nach San<br />
Francisco.<br />
Am 21. Februar trafen wir in San Francisco ein und wurden<br />
gleich weiter zum Hafen Oakland und um 17 Uhr an Bord auf<br />
der „DS Cap Douglas“ gebracht. Es war ein Schiff der Lyberti-<br />
Klasse, die in 100 Tagen zusammengeschweißt worden war.<br />
Die Meinung der Amis war, dass dieser Typ ein „Seelenverkäufer“<br />
ist, also kein sicheres Schiff, dem man eine große<br />
Fahrt über den Atlantik zutrauen konnte. Dieser Überzeugung<br />
war ich nicht, denn es brachte uns heil nach England. Bei<br />
ruhiger See auf dem Pazifiks ging es entlang der Küste bis<br />
zum Panama-Kanal. Der Dampfer hatte nicht viel drauf, die<br />
Fahrt dauerte 12 Tage.<br />
134
Durch den Panama-Kanal nach Liverpool<br />
Am 3. März 1946 kamen wir in Panama an, und nach einigen<br />
Stunden begann die Durchschleusung durch den Kanal. In<br />
einer Enzyklopädie habe ich einmal gelesen, dass man kaum<br />
irgendwo in Lateinamerika die Pracht und die Vielfalt des<br />
Dschungels mit seinen Mangrovenbäumen, Liliengewächsen,<br />
Papageien und Affen ruhiger und gefahrloser genießen kann<br />
als an Deck eines Schiffes im Panama-Kanal. Tatsächlich<br />
wurde die Durchfahrt ein für mich einmaliges Erlebnis.<br />
Am 6. März 46 erreichten wir den Hafen Colón an der Ostküste<br />
Panamas. Am nächstfolgenden Tag ging es gleich<br />
weiter, südlich an Kuba vorbei Richtung England. Mit der<br />
Ankunft am 20. März 46 im Hafen von Liverpool (England)<br />
war für uns die Hoffnung verbunden, dass es gleich weiter<br />
nach Deutschland gehen würde. Das war ein großer Irrtum<br />
und eine große Enttäuschung. Nach der Anlandung ging es<br />
in eine große Lagerhalle der Hapag-Lloyd. Wir mussten uns<br />
alle entkleiden, und unsere Seesäcke wurden kontrolliert.<br />
Zur Ehrenrettung der englischen Soldaten muss ich sagen,<br />
es waren genau solche arme Hunde wie wir, und es war für<br />
mich verständlich, dass sie mit ihren gierigen und hungrigen<br />
Augen auf unsere aus Amerika mitbrachten Sachen schielten<br />
- und sich bedienten.<br />
Nach der Filzung war mein Seesack bloß noch halbvoll.<br />
Nach der Filzung wurden wir auf Militärfahrzeuge verladen,<br />
und es ging ab zum Lager 17 Cheffild. Dort verbrachte ich<br />
meine trostloseste Zeit meiner Gefangenschaft. Es war ein<br />
Durchgangs lager. Entweder nach Hause fahren oder noch in<br />
England bleiben, wir sollten es ganz schnell erfahren. Ich war<br />
ja im Oktober 43 von der englischen Marine gefangen genommen<br />
worden, dann aber in amerikanische Obhut gegeben, da sie<br />
1943 selbst nicht in der Lage waren, uns zu verpflegen.<br />
135
136
Kriegsgefangenschaft in England (1946 - 1947)<br />
In Yorkshire<br />
Nach ca. drei Wochen Nichtstun, in den sogenannten Nissenhütten<br />
vegetierend und von schmaler Kost lebend, kam ich<br />
ins Hauptlager 53 Brayton-Selby Yorkshire. Es war einen Tag<br />
vor Inge Arnswald zwanzigstem Geburtstag am 12. April 1946.<br />
Ich bekam in Cheffild noch einen lieben Brief, in dem ich für<br />
mich eine Hoffnung sah, dass meine Träume in Erfüllung gehen<br />
könnten.<br />
Im Lager 53 Yorkshire (vorn, 2. von rechts)<br />
Im Hauptlager waren sämtliche Waffengattungen und Gefangene<br />
aus allen Gauen Deutschlands vertreten. Es bildeten<br />
sich Parteien sämtlicher Couleurs mit einigen Agitatoren. Sogar<br />
ein Kommunist hielt Seminare ab und erhielt von den älteren<br />
Kameraden Zulauf. Ich hielt mich da raus, trotz meiner Vorbe-<br />
137
lastung durch Oma und Onkel Willi, denn ich wollte erst einmal<br />
abwarten, was sich zu Haus alles tun wird.<br />
Von meinen alten Kameraden war ich jetzt vollständig getrennt,<br />
aber ich fand einen neuen Kameraden, mit dem mich eine<br />
gute Freundschaft bis zu unserer Trennung in der Heimat<br />
verband. Es dauerte eine<br />
gewisse Zeit, bis ich mit<br />
der neuen Umgebung<br />
vertraut war. Die Engländer<br />
waren toleranter als<br />
die Amis. Wir erhielten<br />
einen Ausweis, mit dem<br />
wir berechtigt waren, uns<br />
bis zum Einbruch der<br />
Dunkelheit im Umkreis von<br />
Yorkshire-Land frei zu bewegen.<br />
Die meisten PW’s<br />
arbeiteten in der Landwirtschaft,<br />
einige hatten<br />
schon Liebschaften mit<br />
den englischen Mädchen<br />
angefangen, und sogar<br />
Kinder waren schon ge-<br />
Geburtsstätte Gesindehaus<br />
138<br />
zeugt worden. Außerdem<br />
waren schon Maßnahmen<br />
für die Rückführung der<br />
PW’s in die Heimat eingeleitet worden. Es ging nach der politischen<br />
Einordnungen eines jeden, nämlich A = Nazi, B = Mitläufer<br />
und C = keine Partei. Ich war unter C 9 = September 47<br />
eingeteilt, und so konnte ich hoffen, nach Hause zu kommen.<br />
Ich nutzte die Tage auf meine Art.
Hühnerfarm und Hühnerjagd<br />
Das Lager lag auf einer leichten Anhöhe direkt an der Hauptstraße<br />
Brayton-Selby. Meine erste Arbeit war bei einem Bauern,<br />
auf dessen Viehweiden ich die Diesteln und Brennnessel<br />
umzumähen hatte. Eintöniger ging es nun wirklich nicht.<br />
Aber ich erhielt in dieser kurzen Zeit meiner Schwerstarbeit<br />
immer ein gutes Frühstück!!! Anfang Mai 46 wurde ich auf eine<br />
Hühnerfarm beordert. In der Nähe von Selby hatte ein Lord<br />
riesige Ländereien, und die Hühnerfarm war einige Kilometer<br />
entfernt von unserem Lager.<br />
Für mich war das Neuland und ein interessantes Arbeitsgebiet,<br />
wobei ich eine gute Lehrmeisterin hatte. Helen, so hieß<br />
sie, war 49 Jahre alt. Ihr Mann arbeitete in der Rinderaufzucht,<br />
ebenfalls bei „seiner Lordschaft“. Helen und ich hatten täglich<br />
ca. 3000 Hühner zu versorgen. Meine Aufgabe bestand darin,<br />
Kot von den Litzen zu kratzen und Eier einzusammeln. Es war<br />
ein riesiges Freilauf-Areal mit 12 ehemaligen Militärbaracken.<br />
Das Futter wurde uns per LKW geliefert, die Wege zu den<br />
Baracken waren zementiert, und der große Handwagen für<br />
den Futtertransport gummibereift. Es war für uns beide eine<br />
Zeit ausfüllende und schwere Arbeit. Ich hatte mich schnell<br />
eingearbeitet, und mir machte es sogar Freude, mit dieser<br />
freundlichen Frau zusammen zu arbeiten. Nach Feierabend<br />
war ich die erste Zeit ganz schön groggi. Die ca. 400 m bis zu<br />
der Wegkreuzung, an der ich von einem Militär-LKW immer<br />
abgeholt und morgens abgeladen wurde, fielen mir schwer.<br />
Als ich bei der Durchsuchung in der Hapag-Lloyd-Lagerhalle<br />
in Liverpool durch die Wachsoldaten vom Inhalt meines Seesacks<br />
erleichtert worden war, hatte ich mir geschworen, das<br />
bei bestmöglicher Gelegenheit wieder zu beschaffen. Hier war<br />
die Möglichkeit gegeben. In der Nähe eines kleinen Wäldchens<br />
war ein ca. 500 qm großes, wildwachsendes Areal mit hohen<br />
139
Brennnesselpflanzen. Dort jagte ich einige Hühner und erschlug<br />
sie mit einer Weidengerte. Dies passierte so zwei- bis<br />
dreimal die Woche. Es fiel<br />
nicht auf, wenn in der Nähe<br />
Federn und Blut lagen,<br />
zumal ab und an auch mal<br />
Füchse ihr Leckerli holten.<br />
Durchs Lagertor nahm ich<br />
es in meinem Regenmantel<br />
(heute Natopelle genannt)<br />
mit. Wir wurden ja kaum<br />
kontrolliert. Josef Oesterreich,<br />
mein neuer Freund,<br />
hatte einen Landsmann aus<br />
Hessen, der Koch war, und<br />
der lies schon mal einige<br />
Schilling für die Hühner<br />
springen.<br />
Zum Geldverdienen hatte ich<br />
auch noch andere Möglichkeiten,<br />
z.B. auch durch Ver-<br />
In englischer Gefangenschaft<br />
bindungen von Josef, indem<br />
wir in der Rüben- und Kartoffelpflanzzeit die Jungpflanzen<br />
durch Hacken verzogen. Sonnabends und sonntags war ich<br />
mit dabei, damit diese Tage nicht so öde waren.<br />
Zukunftsträume<br />
Die Tage der Freude konnte ich zählen. Das waren die, an denen<br />
wieder Post ankam und auch ein lieber Brief von Inge<br />
Arnswald dabei war. Ich sehnte schon sehr den Tag herbei, an<br />
dem wir uns das erste Mal wieder gegenüberstehen. Werden<br />
sich meine Hoffnungen erfüllen? Was wird uns nach dieser<br />
Kriegsnot erwarten? Was wird ihr Vater sagen, der nichts<br />
140
dagegen hatte, dass ich ihr Freund war, würde er mich als ihren<br />
Mann akzeptieren? Ich hatte nur Gedanken für sie. Wenn ich<br />
sie als Frau bekomme, würde ich ihr ein guter Ehemann sein.<br />
Zwei Kinder wären mein Wunsch, ihnen ein guter Vater zu sein<br />
und sie in einem besseren Milieu aufzuziehen als das, in dem<br />
ich groß geworden bin. Mit guten Ratschlägen verheirateter,<br />
älterer Kameraden wurde ich sehr bedacht. Aber nicht nur die<br />
Liebe zu Inge Arnswald beschäftigte mich, sondern auch der Gedanke,<br />
was wird, wenn sich meine Wünsche nicht erfüllen.<br />
Mein anderer Zukunftsgedanke war abstrakter, aber, wie mir<br />
damals schien, keines falls abwegig. Ich würde versuchen, von<br />
Westdeutschland nach Kanada auszu wandern. Der Gedanke, in<br />
dem alten Milieu der Familie mit dem lieben Alfred zusammen<br />
leben zu müssen, war für mich nicht akzeptabel. Doch ich<br />
glaubte fest an eine Zukunft mit Inge Arnswald. Noch war<br />
ich Gefangener, aber schon im Einbürgerungsprozess ins zivile<br />
Leben. Der englische Ausweis gab mir das Gefühl, ein freier<br />
Mann zu sein, wenn nicht noch das Barackenleben wäre.<br />
Ich konnte ins Kino, zum Fußballspiel und sonst wohin im<br />
Gebiet Yorkshire gehen, allerdings nur bis zum Einbruch der<br />
Dunkelheit.<br />
Landwirtschaft und Fallen stellen<br />
Im Oktober wurde ich von der Hühnerfarm abgezogen. Die<br />
Legetätigkeit nahm ab, und das Schlachten begann, um Platz<br />
für die Aufzucht neuer Küken zu schaffen. Für mich folgten<br />
einige Tage in der Kartoffelernte und anschließend beim<br />
Dreschen - und Weihnachten kam immer näher. Die Dreschzeit<br />
war sehr interessant. Es gab noch keine Mähdrescher. Die<br />
Ernte erfolgte wie bei unseren Bauern: Getreide mähen, Garben<br />
aufstellen, einige Tage trocken lassen und anschließend das<br />
Getreide auf einem freien Feld in Dieme lagern. Dieme sind<br />
große, rechteckige Lagerstätten in der Größenordnung von<br />
141
30 x 10 m. An der Ernte beteiligte sich das ganze Dorf. In der<br />
Winterzeit wurde das Getreide gedroschen. Eine Dampfmaschine,<br />
unseren Dampfwalzen ähnlich, nur breite Vorderräder<br />
statt der Walze und hintendran eine riesige Dreschmaschine,<br />
die mit den Riemen der Dampfmaschine angetrieben<br />
wurde. Rings um den Diemen stand eine Unmenge Terrier,<br />
die auf die Ratten und Mäuse warten, die aus den Diemen<br />
huschten. Je näher wir dem Boden kamen, desto mehr Ratten<br />
und Mäuse flohen den Terriern vor die Schnauze. England<br />
war als Ratten-, Karnickel- und Kräheninsel benannt. Es gab<br />
Unmengen von dem Viehzeug.<br />
Karnickel und Krähen fangen war Josefs und mein Spaß. Als<br />
wir in der Kartoffelernte waren, beobachteten wir den Jäger<br />
seiner Lordschaft, wie er seine Schlingen für den Karnickelfang<br />
aufstellte und eigneten uns etliche der Schlingen an. Wir<br />
stahlen sie. Alle Felder in dieser Gegend sind mit Steinwällen<br />
oder Hecken eingefasst. In diesen Hecken stellten wir Sonnabend<br />
am späten Nachmittag die Schlingen auf, und Sonntagmorgen<br />
kontrollierten wir. Zwei bis drei Karnickel waren immer im<br />
Sack. Für uns gab es einige Schillinge und für den Koch Arbeit,<br />
der die natürlich auch nicht umsonst tat. Das Weihnachtsfest<br />
wurde von der Lagerleitung dürftig beliefert. Wir spürten,<br />
dass das Land genau wie unsere Heimat noch an den Folgen<br />
des Krieges zu knabbern hatte.<br />
Harter Winter<br />
Es kam der erste Schnee, und ich freute mich zunächst wie ein<br />
kleiner Junge, denn es war nach sieben Jahren, nach Einsatz<br />
im Mittelmeer und Gefangenschaft in Afrika und im Süden<br />
der USA der erste Winter für mich. Dieser Winter wird lange<br />
in meiner Erinnerung bleiben. Es war ein strenger und sehr<br />
kalter Winter mit ungeheuer viel Schnee. Wir wurden alle zum<br />
142
Schneeräumen eingesetzt, und die Bevölkerung honorierte das<br />
und bedachte uns mit heißem Tee und Sandwichbroten.<br />
Der Winter ging so langsam zu Ende, und es sollte danach<br />
noch schlimmer kommen. Die Schneeschmelze setzte rasant<br />
ein, und im ganzen Bereich Yorkshire gab es Hochwasser so weit<br />
das Auge sehen konnte. Felder und Straßen waren überflutet.<br />
Zum Glück lag unser Lager auf etwas höherer Ebene, doch<br />
wir waren ringsherum vom Wasser eingeschlossen. Die Verpflegung<br />
musste rationiert werden, aber am Hungertuch<br />
brauchten wir nicht nagen. Als nach ca. drei Wochen die Straßen<br />
wieder frei und die Wiesen und Felder noch etwas unter Wasser<br />
waren, gingen Josef und ich wieder auf Karnickelfang. Die<br />
Karnickel suchten vor dem Wasser Schutz und hielten sich<br />
auf den Hecken oder auf größeren Baumstümpfen auf. Es war<br />
ein leichtes, sie zu fangen. Nur das Wasser war sehr kalt, denn<br />
wir mussten schon die Schuhe ausziehen und die Hosenbeine<br />
hochkrempeln. Zu dieser Zeit gab es für uns Gefangene zwar<br />
keine Arbeit, doch Langeweile gab es für uns zwei nicht.<br />
Auf Krähenjagd<br />
Von April bis Mai war die Brutzeit der Krähen, und die Krähen<br />
waren eine Sorge für die Gutsbesitzern. Die meisten Zufahrtswege<br />
ihrer Schlösser oder Herrschaftshäuser waren mit Pappeln<br />
umsäumt. Auch in ihren Parkanlagen sind diese Bäume<br />
Standard. In den Pappeln nisteten und brüteten die Krähen.<br />
Bevor die Jungvögel flügge wurden und am Nestrand das<br />
Flügelschlagen trainierten, begann unsere Jagd. Krähen bauen<br />
ihre Nester bis in die äußerste Spitze des Baumes, dorthin,<br />
wo es sehr wackelig wird. Die Jagd war einfach, aber anstrengend.<br />
Mit einem drei Meter langen Stab kletterte einer von<br />
uns rauf und stieß mit dem Stab gegen das Nest, bis je nach<br />
Gelegegröße ein oder zwei Jungkrähen zu Boden segelten. Der<br />
143
Untenstehende nahm sie in Empfang, auf dem Boden waren sie<br />
unfähig zu entkommen, und drehte ihnen den Hals um. In der<br />
Zeit, in der der erste wieder runter kletterte, stieg der zweite<br />
den nächsten Baum hoch. An einem Jagdausflug schafften wir<br />
beide acht bis zehn Bäume. Der Fang war zufriedenstellend.<br />
Unser Fang von 10 bis 14 Stück wurde an Ort und Stelle samt<br />
Federkleid enthäutet und ausgenommen.<br />
Josefs Landsmann, der Koch, machte noch eine kleine Füllung<br />
rein und briet sie so. Die Krähen gingen weg wie warme Semmeln<br />
- als Täubchen.<br />
Einmal wurden wir von einem Bediensteten seiner Lordschaft<br />
erwischt, aber zu unserem Erstaunen lediglich ermahnt, keine<br />
Äste abzubrechen.<br />
In Goole<br />
Die Zeit der Untätigkeit sollte bald zu Ende gehen. Am<br />
17. Mai 1947 kam ich in das Städtchen Goole an der Humber.<br />
Dort gab es eine kleine Hafenstadt. Die Schiffe, die dort einliefen,<br />
wurden nicht am Kai entladen, sondern in Schleusenkammern.<br />
Das war wegen der Gezeiten erforderlich. Mit der<br />
Flut liefen die Schiffe ein, die Tore wurden geschlossen, denn<br />
sonst würden die Schiffe bei Ebbe auf Grund liegen, da der<br />
Humberfluss nicht tief ist.<br />
Ich war enttäuscht von Goole. Wir waren 20 Mann, die dorthin<br />
abkommandiert worden waren und in einem saalartigen<br />
Gebäude untergebracht. In der ganzen Zeit bis zum 8. August<br />
1947 haben wir nur rumgelungert. Diese Tage waren nur zum<br />
Spazierengehen gedacht. Eines Tages ging ich an der Humber<br />
entlang und setze mich am Deich ins Gras und beobachtete<br />
das Ein- und Auslaufen der Schiffe. Ich träumte, wie es sein wird,<br />
wenn ich eines Tages mit einem Schiff nach Hause komme. Ich<br />
war bei diesen Träumen eingeschlafen und wurde erst wach,<br />
144
als das kalte Wasser meine Beine umspülte. Ich hatte nicht an<br />
die Flut gedacht.<br />
Eine Abwechselung waren unsere täglichen Tanzübungen, die<br />
ein Kamerad, der Tanzlehrer war, mit uns durchführte. Aber<br />
außer einem langsamen Walzer mit dem Lied „Ich tanze mit<br />
dir in den Himmel hinein“ habe ich nichts gelernt.<br />
Was mir an Goole gefallen hatte, das war das Fish-and-Chips-<br />
Essen. Fish and Chips waren ein vorzüglicher Snack und sehr<br />
billig.<br />
Wertvolles Honorar<br />
Bei einem Spaziergang wurde ich von einem salopp gekleideten<br />
Neger auf Deutsch angesprochen. Er sei Reporter und möchte<br />
über Gefangene, über ihr Leben in England und über ihre<br />
Gedanken für die Zukunft schreiben, auch darüber, wohin sie<br />
entlassen werden. Es war ein interessantes Gespräch. Vor<br />
allem seine intelligente Art, wie er alles formulierte, erstaunte<br />
mich. Meine Bereitschaft, ihm meine Gedanken, wie ich alles<br />
hier empfunden habe, offen darzulegen, imponierte ihm wohl.<br />
Wir führt unser Gespräch im Cafe Bistro des Kaufhauses<br />
Woolworth. Als „Honorar“ konnte ich mir einige Dinge des<br />
täglichen Bedarfs wie Rasierpinsel, Klingen, Seife aussuchen.<br />
Für mich war es selbstverständlich, bescheiden zu sein und<br />
nach einigen Sachen aufzuhören, den Korb weiter zu füllen.<br />
Aber er forderte mich auf, weitere Dinge zu nehmen. Ich war<br />
überglücklich, und in der Heimat wurde mir erst richtig<br />
bewusst, was für ein kleines Vermögen ich bekommen hatte.<br />
145
Endlich zurück nach Deutschland<br />
Am 9. August 1947 kam ich wieder zurück zum Hautlager 53,<br />
wo mir eröffnet wurde, dass ich in die Heimat entlassen werde.<br />
Nachdem ich neu eingekleidet war, ging es mit einem Trupp<br />
ab nach Lager 9 in der Nähe Leicesters.<br />
Die 14 Tage Wartezeit waren noch grausame Tage des Zweifelns<br />
und der Unsicherheit, aber dann ging es Schlag auf Schlag. Am<br />
26. August 1947 in Harwick 17.00 Uhr auf die Fähre, nachts um<br />
1 Uhr am 27. August 1947 in Hoek van Holland angelandet.<br />
Umsteigen auf die Bahn, und um 8:00 Uhr am 27. August 1947<br />
passierte ich die Grenze bei Bentheim. Am 27.8.47 kam ich um<br />
17:30 Uhr in Münsterlager, Niedersachsen an.<br />
146
Sie wollten in Kontakt bleiben!<br />
147
148
Ein neues Leben, der Zukunft entgegen (1947)<br />
Chaoslager<br />
Münsterlager war ein Auffanglager für alle ehemaligen<br />
Gefangenen. Es war ein Chaotenlager. Schlägereien und Diebstahl<br />
waren an der Tagesordnung, und man konnte sich nur mit<br />
Seesack unter dem Kopf schlafen legen. Ehemalige Mariners<br />
zu finden war nicht schwer. Auch wir aus Brandenburg und<br />
Umgebung fanden uns.<br />
Wir waren sieben Mann. Während der ärztlichen Untersuchung,<br />
des Toilettengangs und des Essenfassens waren immer zwei<br />
Mann als Wache eingeteilt, und ich konnte beruhigt diese Sachen<br />
erledigen.<br />
Am schlimmsten sahen die aus der russischen Gefangenschaft<br />
aus. Hohlwangig, abgemagert, in zerschlissenen Wattejacken<br />
oder Mänteln und teilweise nur mit Lumpen um die Beine.<br />
Als ich dieses Elend sah, wurde mir erst bewusst, dass meine<br />
Gefangenschaft gegenüber ihrer ein Erholungsurlaub gewesen<br />
war.<br />
In die russische Zone?<br />
Es war schon sonderbar, mit welchen Mitteln wir davon abgehalten<br />
werden sollten, nicht in die russische Zone einzureisen.<br />
Die Hetze gegen die Russen, ihre ehemaligen Verbündeten im<br />
Kampf gegen Deutschland, war schon widerlich. Das Hauptargument<br />
der Engländer war die Drohung, wir würden gleich<br />
bei Ankunft im Heimatort von den Russen nach Sibirien<br />
transportiert.<br />
149
Wir sieben Brandenburger ließen uns von dieser Hetze nicht<br />
abschrecken, zumal einige von uns schon von ihren Eltern<br />
aufgeklärt worden waren, wie es in der Heimat war. Wir sollten<br />
Entlassungsschein Vorderseite<br />
150
nur nicht gleich nach Hause kommen, sondern ins russische<br />
Quarantänelager Glöwen fahren.<br />
Entlassungsschein Rückseite<br />
151
Nachdem wir ärztlich untersucht worden waren und 50<br />
Reichsmark sowie die Entlassungspapiere erhalten hatten,<br />
ging es am 5. September 1947 ins Lager Friedland, für mich<br />
der letzte Aufenthalt in einem Flüchtlingslager in Westdeutschland.<br />
Am gleichen Tag ging es bei Heiligenstadt zu<br />
Fuß über die Zonengrenze. Ich hatte doch ein mulmiges<br />
Gefühl, als ich den ersten russischen Soldaten, einen Mongolen,<br />
sah. Von Heiligenstadt ging es gleich weiter nach Glöwen ins<br />
Quarantänelager.<br />
In Magdeburg hatten wir Aufenthalt. Als wir auf den nächsten<br />
Zug nach Glöwen warteten kam mir der Gedanke, doch<br />
gleich nach Brandenburg zu fahren. Die Sehnsucht auf ein<br />
Wiedersehen mit Oma und Inge Arnswald war groß. Aber die<br />
Vernunft siegte. Ich wollte kein Risiko eingehen.<br />
Im Quarantänelager Glöwen<br />
Als wir in Glöwen ankamen, empfingen uns der deutsche<br />
Lagerleiter und anschließend ein russischer Offizier. Der<br />
russische Offizier war ganz schön dickleibig und mit viel Orden<br />
behangen. Ich glaube, er war schon im Rentenalter. Er war<br />
ganz jovial. Wir mussten uns in eine Linie anstellen, die Seesäcke<br />
öffnen, und er kontrollierte mit dem Hinweis „Soldatten,<br />
ich nur gucken“ die Seesäcke. Er sah mal hier rein, mal dort,<br />
grabbelte mit der Hand in einigen rum, drehte sich um und<br />
ging zum Tor. Das war’s.<br />
Dann kam ein deutscher Sanitäter. Nachdem wir uns ausgezogen<br />
hatten, bestäubte er jedem von uns die Kopf- und<br />
Schamhaare und die Haare unter den Achseln. Diese Aktion<br />
wurde noch zweimal durchgeführt. Gleich am Tag der Ankunft<br />
mussten wir unsere Angehörigen benachrichtigen.<br />
152
Wiedersehen<br />
Die Vorstellung, dass ich hier vier Wochen nutzlos verbringen<br />
sollte, war grauenhaft. Eines Tages, es war der zwölfte Tag<br />
meines stumpfen Daseins, wurde ich zur Wache gerufen. Was<br />
war da los? Voller gemischter Gefühle trottete ich los. Als ich<br />
die Wache betrat, traute ich meinen Augen nicht. Da standen<br />
meine Oma und Inge Arnswald im Raum. Ich war wie im<br />
Traum. Oma nicht betrachtend, wie ich zu meiner Schande<br />
gestehen muss, ging ich Inge entgegen, und wir lagen uns<br />
in den Armen und küssten uns voller Freude im Glück des<br />
Wiedersehens. Dann kam der Schreck. War nicht Oma die<br />
wichtigste Person, der mein Willkommensgruß gehörte? Ich<br />
drehte mich zu Oma um und stammelte einige Worte zur Entschuldigung,<br />
Aber sie lächelte nur unter Tränen und sagte: „Du<br />
bist gesund wieder zu Hause, und das ist gut, deine Freundin<br />
hat mit mir um dich bange gehabt.“ Jetzt heulten wir alle drei.<br />
Nachdem wir uns einige Zeit unterhalten hatten, sagte Oma<br />
beiläufig, dass sie beide in der Nähe bei einer Frau Klettwitz<br />
übernachten und erst am anderen Tag wieder abreisen.<br />
Das Haus, indem sie übernachteten, war ganz in der Nähe,<br />
hinter einem Wäldchen, das an unser Lager grenzte. Das Lager<br />
hatte keine Wachtürme. Nur eine Streife ging im Stundentakt<br />
ums Lager. Das hatte ich schon ausgekundschaftet. Meine Sehnsucht,<br />
Inge zu sehen, war so groß, die Unruhe stark. Ich musste<br />
es wagen, aus dem Lager zu flüchten. Ich nahm ein Stück<br />
Palmolive-Seife und aus der Kaffeebüchse ca. 150 Gramm<br />
Kaffee. Als es dunkel war, stand ich in der Nähe des Zaunes<br />
am letzten Haus und wartete die Streife ab. Mir schlug das<br />
Herz bis zum Hals. Auch Angst war dabei. Dann war es soweit,<br />
die Streife war um die Ecke, und ich kroch unter dem Stacheldrahtzaun<br />
durch. Das Haus fand ich sofort, als ich durch das<br />
kleine Wäldchen hindurch war.<br />
153
Zukunftsplanung, Ende der Gefangenschaft<br />
Oma und die Hausbesitzerin waren sehr erschrocken, nur<br />
Inge machte ein glückliches Gesicht, und wir lagen uns gleich<br />
wieder in den Armen. Nach Übergabe des Geschenks an die<br />
Gastgeberin war der Schreck verschwunden. Beide Damen<br />
brühten sich gleich einige Tassen Bohnenkaffee auf. Sie genossen<br />
diesen Trank. Wir hörten ihr Plappern bis ins Schlafzimmer.<br />
Inge und ich hatten uns viel zu erzählen, aber es blieb nicht<br />
aus, dass wir uns in seliger und glücklicher Umarmung liebten.<br />
In dieser Nacht wurde unsere Zukunft geplant. Wir legten<br />
fest, dass wir auch gegen<br />
den Widerstand ihres Vaters<br />
gemeinsam durchs Leben<br />
gehen werden.<br />
Noch bevor es hell wurde<br />
schlich ich mich zurück ins<br />
Lager. Zu meiner Überraschung<br />
wurde ich zwei<br />
Tage später, am 20. September<br />
1947 aus der Quarantäne<br />
entlassen. Ich erhielt eine<br />
Fahrkarte zum Heimatort<br />
und einen russischen Entlassungsschein.<br />
Nach vier<br />
Jahren Gefangenschaft ver-<br />
Entlassungsschein Vorderseite<br />
ließ ich Glöwen als freier<br />
Mensch. Es war ein erhabenes<br />
Gefühl, in das sich die bange Frage nach der Zukunft<br />
mischte. Ich dachte an die gehässige Propaganda in England<br />
und Münsterland über die Russen, die angeblich alle, die in<br />
westlicher Gefangenschaft waren, nach Sibirien bringen würden.<br />
Diese Gedanken verwischten schnell, da ich Inge und Oma<br />
vertraute, die mir versicherten, dass nur Soldaten, die in Russ-<br />
154
land gekämpft haben,<br />
wegen Verbrechen in<br />
Russland überprüft<br />
werden.<br />
So stand ich nun auf<br />
dem Bahnhof von<br />
Glöwen und wartete<br />
auf den Zug Wittenberg-Berlin.<br />
Dann kam<br />
der Zug am späten<br />
Nachmittag und war<br />
voller Menschen. Die<br />
Abteile waren voll,<br />
auf den Dächern der<br />
Waggongs und auf<br />
den Trittbrettern an<br />
den Seiten, überall<br />
Menschen über Menschen.<br />
Wie sollten wir<br />
Bescheinigung<br />
sieben Brandenburger<br />
da noch mitkommen? Ein Päckchen Lucky Strike tat Wunder,<br />
zwei Personen zogen mich durch das Fenster ins Abteil. So<br />
kam ich heil bis Berlin. Mit der S-Bahn ging es von dort weiter<br />
bis Potsdam, und anschließend zügig mit dem Personenzug<br />
nach Hause.<br />
Zurück in Brandenburg<br />
Auf dem Hauptbahnhof in Brandenburg kannten meine<br />
Gefühle keine Grenzen. Ich konnte meine Glückstränen nicht<br />
mehr aufhalten. Ich war zu Hause, ich war wieder ein freier<br />
Mann.<br />
155
156
157
Auf dem Bahnsteig wurden wir sieben Mann von Schwarzhändlern<br />
und anderen zwielichtigen Gestalten bestürmt, ob<br />
wir was kaufen oder verkaufen wollten. Wir konnten uns<br />
kaum erwehren. Die waren wie die Flöhe im Pelz. Auf dem<br />
Bahnhofsvorplatz verabschiedeten wir sieben Mann uns mit<br />
den besten Wünschen auf ein Wiedersehen. Vom Bahnhof<br />
führte die Große Gartenstraße, die Straße meiner Jugendzeit,<br />
direkt zur Stadtmitte. An der Ecke Blumenstraße blieb ich stehen<br />
und betrachtete das Straßenbild. Es war schockierend für<br />
mich. Außer den Eckhäusern war die Blumenstraße, die Straße<br />
meiner Freunde und der Ausgangspunkt unserer Streiche,<br />
total zerbombt. Links und rechts die Gartenstraße war bis<br />
zum Trauerberg ebenfalls ein Opfer englischer Bomben geworden.<br />
Da auch das Haus meiner Kindheit nicht mehr stand, führte mein<br />
erster Weg mich zu Oma. Die Steinstraße und die Nebenstraßen<br />
waren dem Bombenhagel entgangen. Mama und Tante Hilde<br />
waren ausgebrannt und wohnten jetzt bei Oma, Mama in<br />
einer verwanzten Dachwohnung, während Tante Hilde ein<br />
Zimmer in der Wohnung von Oma hatte. Auch Onkel Willi<br />
war nach der Entlassung aus dem KZ Buchenwald bei Oma<br />
eingezogen und schlief auf der Couch im Wohnzimmer. Ich<br />
konnte da also nicht wohnen und musste mir eine andere<br />
Bleibe suchen.<br />
Zuhause<br />
Mir kam der Gedanke, dass mir Inge helfen könnte. So ging<br />
ich zu ihrer Wohnung in der Kleiststraße 4, und Mutter Arnswald<br />
empfing mich wie einen verlorenen Sohn, unter Tränen<br />
und mit freudiger Überraschung. Ich konnte ja nicht ahnen,<br />
dass Inge ihr schon das Treffen und den Beischlaf in Glöwen<br />
gebeichtet hatte.<br />
158
Inge arbeitete bei der Firma Roll in der Hauptstraße als Näherin.<br />
Es war kurz vor Feierabend, und ich wartete klopfenden<br />
Herzens auf das Widersehen. Dann stürmte eine große Gruppe<br />
Frauen aus der Tür, darunter Inge. Sie sah mich in meiner<br />
schwarz gefärbten Ami-Uniform, und wir lagen uns vor allen<br />
Menschen in den Armen und schämten uns nicht unserer<br />
Tränen. Nach einer kurzen Erklärung für die Kolleginnen ging<br />
es nach Hause. Ich hatte ein Zuhause gefunden und war der<br />
glücklichste Mensch. Aus unserer jahrelangen Jugendfreundschaft<br />
war eine Liebe geworden. Trotz der Abneigung meiner<br />
Mutter und Schwester gegen Inge und trotz des Widerstandes<br />
ihres Vaters in eine Heirat mit mir armen Schlucker, bauten<br />
wir unser Leben in Liebe und Treue selbständig auf. Doch es<br />
sollten noch harte Jahre vor uns liegen.<br />
„Einbürgerung“<br />
Meine ersten Maßnahmen waren die Gänge zur sowjetischen<br />
Kommandantur, zur deutschen Meldestelle und zum Arbeitsamt,<br />
um die nötigen Papiere und Stempel zu erhalten. In zwei<br />
Tagen waren die Gänge erledigt, und ich war wieder anerkannter<br />
Bürger der Stadt Brandenburg. Nach einer Aussprache mit<br />
Mama und Schwester Inge war ich vor die Tatsache gestellt,<br />
dass von meinen Sachen, einschließlich meines Rennrads,<br />
nichts mehr vorhanden war. Angeblich ausgebombt.<br />
Später erfuhr ich von Bekannten, dass alles für Lebensmittel<br />
verscherbelt wurde. Ich zog die Konsequenzen, und der Fall<br />
war für mich erledigt.<br />
Da Inge und ich uns schon versprochen hatten, wohnte ich<br />
mit Genehmigung von Mutter Arnswald bei ihnen, war aber<br />
in der Büttelstraße 8 bei Oma gemeldet. Als Heimkehrer hatte<br />
ich bis vier Wochen Zeit, mir eine Arbeitsstelle zu suchen. Ich<br />
nahm mir diese Zeit, holte mir erstmal einen Herrenanzug<br />
von der Volkssolidarität und 50,- Mark Heimkehrergeld. Die<br />
159
erste Zeit ging ich jedoch am liebsten in meiner Heimkehreruniform<br />
auf die Dienststellen, denn da hatte man immer Vorteile.<br />
Inge arbeitete ja in einer Näherei, die mit Stoff zu tun hatte. Ich<br />
machte auf Bitten von Inge meine Aufwartung bei der Chefin,<br />
bei Frau Roll. Ich wurde überschwänglich empfangen und<br />
musste über meine Gefangenschaft berichten. Es hatte sich<br />
gelohnt. Ich bekam Stoff, der für die Anfertigung eines<br />
Anzuges reichte.<br />
Arbeit<br />
Anfang Oktober ging ich zu meiner ehemaligen Arbeitsstelle<br />
Elisabeth-Hütte. Als ich meine, vom Kriegsdienst verschonten<br />
Kollegen traf, wurde ich mit dem schon Satz begrüßt: „Na, da<br />
kommt ja der Kriegsverlängerer.“ Ich hätte mich wohl damals<br />
doch nicht freiwillig melden sollen.<br />
Am 4. Oktober 1947 wurde ich vom Arbeitsamt vermittelt,<br />
und am 17. Oktober als Former eingestellt. Die Hallen der<br />
Metall- und Graugußgießerei waren durch die Bombenangriffe<br />
auf das Arado-Flugzeugwerk, das in der Nähe lag, mit<br />
zerstört worden. An der Havelseite war aber die seit der Nazi-<br />
Zeit leerstehende Halle heil geblieben und diente jetzt als<br />
Arbeitsstätte für die Belegschaft. Ich gewöhnte mich schnell<br />
ein.<br />
Der Fabrikant Wiederholz war enteignet und dafür zu meiner<br />
Verwunderung der ehemalige Arbeitsfront-Leiter als Betriebsleiter<br />
eingesetzt worden. Die Arbeitsfront war die Nazi-<br />
Gewerkschaft. Es war also nicht nur in Westdeutschland so,<br />
dass Nazis in Positionen eingesetzt wurden, sondern auch bei<br />
uns. Meine Sorge sollte es nicht sein, ich hatte Arbeit, nur das<br />
zählte für mich.<br />
160
Die Lebensmittelkarte war nicht berauschend. Sie reichte nur<br />
für die Hälfte des Monats. Wir Former hatten aber die Möglichkeit,<br />
einen Kochtopf im Monat aus Silumin, einer Aluminium-<br />
Legierung, für den eigenen Gebrauch herzustellen. Manchmal<br />
gelang es mir, zwei im Monat aus dem Werk zu schaffen. Die<br />
Töpfe tauschten wir am Wochenende bei den Bauern gegen<br />
Nahrungsmittel.<br />
Hochzeitsvorbereitungen<br />
Es war eine schwierige Zeit, und es ging dem Winter zu. Die<br />
Lebensmittelkarten reichten nicht bis zum Monatsende. Ich<br />
konnte den Gürtel immer enger schnallen. Der Kampf ums<br />
Überleben war allgegenwärtig. Mutter Arnswald, einst eine<br />
dralle Person mit einer wohlgeformten Figur, war nur noch<br />
ein Schatten ihrer selbst.<br />
Inge und ich waren trotz dieser zeitmäßig bedingten Misere<br />
frohen Mutes, unser Los zu verbessern. Wir beide waren fest<br />
entschlossen, eine Familie aufzubauen.<br />
Wir saßen abends des Öfteren mit Mutter Arnswald zusammen<br />
und schmiedeten Pläne. Wir waren der festen Überzeugung,<br />
dass es besser werden wird, dass der Aufschwung wird<br />
kommen muss. Hauptsache, wir beide behalten unsere Arbeit.<br />
Mutter Arnswald machte sich Sorgen wegen unserer Hochzeitsabsichten.<br />
Sie meinte, wir sollten damit noch warten, bis der<br />
Vater aus der Gefangenschaft kommt. Ich wusste oder konnte<br />
es mir vorstellen, dass er mich nicht als Schwiegersohn<br />
akzeptieren würde. Inge sprach mit mir darüber, wollte aber<br />
auch nicht vom Vater an einen Bauernsohn auf dem Lande<br />
verkuppelt werden. So beschlossen wir, so bald wie möglich<br />
zu heiraten.<br />
161
Bis zum Hochzeitstag ereigneten sich Dinge, die zum Teil<br />
gut, zum anderen Teil schlecht waren. Onkel Willi kam nach<br />
Brandenburg zurück, da er den Posten als Bürgermeister eines<br />
Dorfes in Thüringen, den er zwischenzeitlich wahrgenommen<br />
hatte, aufgegeben hatte. Ich konnte Pfarrer Gobel in der<br />
Tismarstraße mit 100 Gramm Bohnenkaffee und einem Päckchen<br />
Zigaretten davon überzeugen, dass er uns kirchlich traut,<br />
obwohl ich nicht konfirmiert war. Die kirchliche Trauung war<br />
Inges Wunsch.<br />
Zu den schlechten Dingen gehörte, dass Margitta und Heiner<br />
bei einem Diebstahl erwischt worden waren, Mama entzogen<br />
wurden und ins Heim in der Landesanstalt Görden kamen.<br />
Außerdem spürte ich in einem Gespräch mit Mama ihre<br />
Abneigung gegen Inge. Wir konnten keinen Besuch meiner<br />
Familie zu unserer Hochzeit erwarten.<br />
Das Leben ging weiter. Die Liebe zu Inge ging mir über alles. In<br />
meinem Herzen war das Gefühl, war die feste Überzeugung,<br />
die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Mit Inge wollte ich<br />
das Familienleben aufbauen, das ich mir in meinen Träumen<br />
ersehnt und das ich in meiner Kindheit nicht hatte.<br />
Hochzeit<br />
Der Termin wurde auf den 6. Dezember 1947, auf den Nikolaus-<br />
Tag, festgelegt. Inge und ich hatten alles gut organisiert. Mutter<br />
Arnswald verstand es - wie, wusste ich allerdings nicht -<br />
zum Polterabend einige Bleche mit Streuselkuchen zu backen.<br />
So viele Kinder wie an diesem Tag hatte ich noch nie in der<br />
kleinen Kleiststraße gesehen. Am Abend feierten wir mit den<br />
meisten Arbeitskollegen bei Alkohol und einem kleinen Imbiss.<br />
Die Beseitigung der gepolterten Scherben war anstrengend. Es<br />
kamen zwei Waschkörbe voll Scherben zusammen.<br />
162
Die Hochzeitszeremonie fand im Standesamt in der Kanalstraße<br />
statt. Die Hochzeitskutsche der Firma Dankert, eine weiße<br />
Kutsche, die von zwei Schimmeln gezogen wurde, war in dieser<br />
Notzeit schon ein Ereignis. Die Außenstehenden wussten<br />
nicht, dass unser beider Hochzeitskleidung nur geliehen war.<br />
Alle spendeten, Freunde und Arbeitskollegen, und trugen<br />
zum Gelingen der Trauung bei.<br />
Die kirchliche Trauung fand in der Jakobskapelle in der Jakobstraße<br />
statt. Pfarrer Gobel tat sein Bestes. Es war ein sonniger,<br />
kalter Wintertag, und die kleine Kapelle konnte gar nicht alle<br />
Menschen fassen, die in dieser Notzeit mal eine glückliche<br />
Stunde mit uns miterleben wollten. Ich erlebte die Freude<br />
und das Glück meiner Inge, dass ich ihren Wunsch nach einer<br />
kirchlichen Trauung erfüllen konnte. Es war gar nicht so leicht<br />
gewesen, Pfarrer Gobel zu dieser Trauung zu überreden, da<br />
ich zwar getauft, aber nicht konfirmiert war. Ich war eben ein<br />
Atheist. Aber die Liebe siegt immer, und „der liebe Gott war<br />
mit uns“.<br />
Die Hochzeitsfeier fand nur im keinem Kreis der Familie in<br />
der kleinen Wohnung von Inges Mutti, die ich auch Mutti<br />
nennen durfte, statt. Von Inges Familie sind alle zur Feier gekommen,<br />
nur von meiner kam keiner. Es war eine bescheidene<br />
Feier, aber trotzdem eine glückliche. Onkel Willi war einen<br />
Tag vorher gekommen und brachte uns eine Gans. Weiß der<br />
Teufel, woher er die organisiert hatte. Es war für diese Zeit ein<br />
Festessen, und alle waren einmal für einen Tag satt. Inge und<br />
ich waren die glücklichsten Menschen in dieser Runde.<br />
Für mich war es eine eigenartige Lage, denn von meiner<br />
Familie kam niemand. Richtig vermisst habe ich nur Oma.<br />
Warum kam sie nicht? Ich habe sie nie danach gefragt, und<br />
trotzdem hatte Inge mit ihr danach bis zu ihrem Tod ein gutes<br />
163
Verhältnis. Wir dachten an meinen Schwiegervater, der noch<br />
in französischer Gefangenschaft war.<br />
Wir hatten das Glück, ein eigenes Zimmer zu bekommen. Der<br />
Nachbar meiner zukünftigen Schwiegermutter, Herr Thiele, war<br />
Witwer und hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ein Zimmer<br />
davon hatte einen separaten Eingang vom Flur aus. Das wurde<br />
unser Zimmer.<br />
Die Hochzeitsnacht verbrachten wir in unserem Zimmer. Wir<br />
liebten uns, schmiedeten Pläne für die Zukunft. Wir hatten<br />
beide Arbeit und blickten voller Zuversicht voraus.<br />
Die Tage danach sahen schon etwas anders aus. Der Alltag<br />
hatte uns wieder. Es ging auf die Weihnachtsfeiertage zu, und<br />
die sollten besinnliche Tage werden. Außer den Lebensmittelkarten<br />
gab es zum Fest Sonderzuteilungen, außerdem tauschte<br />
ich den Anzugsstoff von Inges Chefin gegen Naturalien ein.<br />
Der Enthusiasmus von Inge, ihre Fröhlichkeit, ihre Fähigkeit,<br />
aus dem Bisschen, das wir hatten, ein gutes Weichnachtsfest mit<br />
einem ausgezeichneten Festessen zu gestalten, überwältigten<br />
mich.<br />
Ich habe ein Juwel gefunden, und es hat sich gelohnt, um es<br />
zu kämpfen. Mein Anteil an unserer Ehe wird sein, ihr ein guter<br />
Ehemann und guter Vater unserer Kinder zu werden. Den<br />
Querelen von Mama und Schwester werde ich ohne Wenn und<br />
Aber widerstehen.<br />
164
Inhalt<br />
Kindheit in armen Verhältnissen<br />
(1923 – 1934) 5<br />
Jugend zwischen Prügel und Jungenstreichen<br />
(1934 – 1938) 15<br />
Vorkriegsjahr und Kriegsbeginn, Radsport und Lehre<br />
1938 – 1940) 37<br />
Vorbereitung auf den Fronteinsatz<br />
(1941) 55<br />
Im Krieg in Mittelmeer und Adria<br />
(1941 – 1943) 63<br />
Ein verlorenes Jahr als Kriegsgefangener in Afrika<br />
(1943) 101<br />
Drei Jahre als Kriegsgefangener in den USA<br />
(1944 - 1946) 111<br />
Kriegsgefangenschaft in England<br />
(1946 - 1947) 137<br />
Ein neues Leben, der Zukunft entgegen<br />
(1947) 149
<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong> wurde am 31. August 2923 in Werdershof im<br />
Sächsisch-Anhaltinischen geboren. Schon bald nach der<br />
Geburt zog seine Familie nach Brandenburg an der Havel. In<br />
dieser Stadt verbrachte er nicht nur seine Kindheit, sondern<br />
auch sein Berufsleben.<br />
Diese Biografie reicht von seiner Geburt am 23. August 1923<br />
bis zu seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr<br />
1947 und der anschließenden Hochzeit mit seiner Jugendfreundin<br />
Inge.<br />
<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong> schildert eindringlich die Hungerjahre um<br />
1930 und die bedrückenden Verhältnisse in seiner Familie.<br />
Der Vater hatte die Familie verlassen, der Stiefvater erwies<br />
sich als Kleinkrimineller. Lebhaft erzählt <strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong> von<br />
den vielen Streichen seiner Jugendzeit, aber auch von seiner<br />
Liebe zum Radsport und zum Rudern.<br />
Um dem familiären Milieu zu entfliehen, meldete er sich freiwillig<br />
zur Marine. Während des Krieges wurde er im Mittelmeer<br />
zwischen Italien, Tunesien und Griechenland als Schütze<br />
auf verschiedenen Transportschiffen eingesetzt. Am<br />
16. Oktober 1943 geriet er in Gefangenschaft, aus der er erst<br />
vier Jahre später wieder freikam.<br />
Sein Weg als Kriegsgefangener führte ihn auf 32.275 Kilometern<br />
von Italien über Afrika in die USA und schließlich<br />
nach England. Sehr detailreich und spannend schildert er die<br />
Bedingungen in den verschiedenen Lagern sowie seine<br />
Erlebnisse im Guten wie im Schlechten. Es sind Jahre der Entbehrungen,<br />
aber auch der kleinen Freuden. Kraft gaben ihm<br />
der feste Glaube an einen Neubeginn in besseren sozialen<br />
Verhältnissen und die Hoffnung auf ein gemeinsames Leben<br />
mit Inge Arnswald. So wird dieser Abschnitt seiner Biografie<br />
auch die Geschichte einer großen Liebe. Einer Liebe, die bis<br />
heute andauert.<br />
http://kurt-ostwald.gurran.eu/