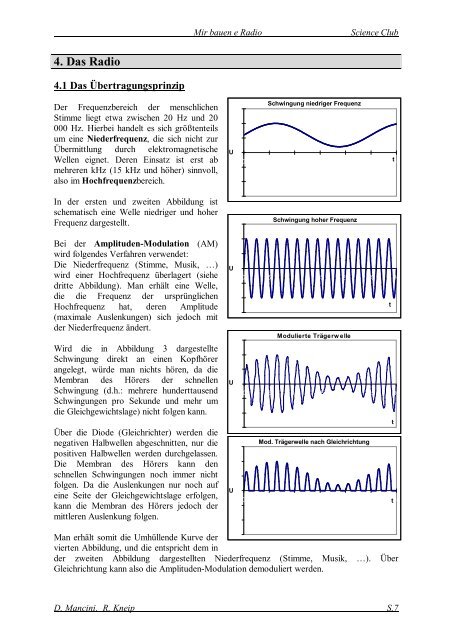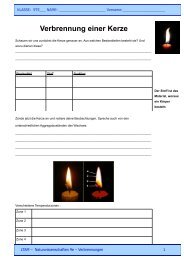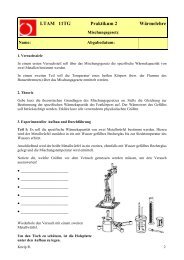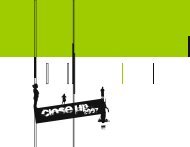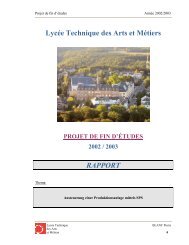4. Das Radio
4. Das Radio
4. Das Radio
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>4.</strong> <strong>Das</strong> <strong>Radio</strong><br />
<strong>4.</strong>1 <strong>Das</strong> Übertragungsprinzip<br />
Der Frequenzbereich der menschlichen<br />
Stimme liegt etwa zwischen 20 Hz und 20<br />
000 Hz. Hierbei handelt es sich größtenteils<br />
um eine Niederfrequenz, die sich nicht zur<br />
Übermittlung durch elektromagnetische<br />
Wellen eignet. Deren Einsatz ist erst ab<br />
mehreren kHz (15 kHz und höher) sinnvoll,<br />
also im Hochfrequenzbereich.<br />
In der ersten und zweiten Abbildung ist<br />
schematisch eine Welle niedriger und hoher<br />
Frequenz dargestellt.<br />
Bei der Amplituden-Modulation (AM)<br />
wird folgendes Verfahren verwendet:<br />
Die Niederfrequenz (Stimme, Musik, …)<br />
wird einer Hochfrequenz überlagert (siehe<br />
dritte Abbildung). Man erhält eine Welle,<br />
die die Frequenz der ursprünglichen<br />
Hochfrequenz hat, deren Amplitude<br />
(maximale Auslenkungen) sich jedoch mit<br />
der Niederfrequenz ändert.<br />
Wird die in Abbildung 3 dargestellte<br />
Schwingung direkt an einen Kopfhörer<br />
angelegt, würde man nichts hören, da die<br />
Membran des Hörers der schnellen<br />
Schwingung (d.h.: mehrere hunderttausend<br />
Schwingungen pro Sekunde und mehr um<br />
die Gleichgewichtslage) nicht folgen kann.<br />
Über die Diode (Gleichrichter) werden die<br />
negativen Halbwellen abgeschnitten, nur die<br />
positiven Halbwellen werden durchgelassen.<br />
Die Membran des Hörers kann den<br />
schnellen Schwingungen noch immer nicht<br />
folgen. Da die Auslenkungen nur noch auf<br />
eine Seite der Gleichgewichtslage erfolgen,<br />
kann die Membran des Hörers jedoch der<br />
mittleren Auslenkung folgen.<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
Schwingung hoher Frequenz<br />
U0.0<br />
0<br />
-0.5<br />
5 10 15 20 25 30<br />
Man erhält somit die Umhüllende Kurve der<br />
vierten Abbildung, und die entspricht dem in<br />
-1.5<br />
der zweiten Abbildung dargestellten Niederfrequenz (Stimme, Musik, …). Über<br />
Gleichrichtung kann also die Amplituden-Modulation demoduliert werden.<br />
D. Mancini, R. Kneip S.7<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
U0.0<br />
-0.5<br />
-1.0<br />
-1.5<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
-1.0<br />
-1.5<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
U 0<br />
-1<br />
-1.5<br />
Schwingung niedriger Frequenz<br />
0 5 10 15 20 25 t30<br />
Modulierte Trägerwelle<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
-0.5<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
U<br />
0<br />
-0.5<br />
-1<br />
Mod. Trägerwelle nach Gleichrichtung<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
t<br />
t<br />
t
<strong>4.</strong>2 Die einfachsten Schaltungen<br />
Übersicht über die gängigen Frequenzverteilungen:<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
Wellenlänge Frequenz<br />
Langwellen (LW) ca. 2 000 m bis 1 000 m ca. 150 kHz bis 300 kHz<br />
Mittelwellen (MW) ca. 600 m bis 200 m ca. 500 kHz bis 1 500 kHz<br />
Kurzwellen (KW) ca. 100 m bis 10 m ca. 3 MHz bis 20 MHz<br />
Ultrakurzwellen (UKW) ca. 10 m bis 1m ca. 30 MHz bis 300 MHz<br />
Einfach nachzuweisende Sender liegen im Langwellenbereich. In<br />
unserer näheren Umgebung ist der stärkste Sender RTL bei 236 kHz.<br />
In der einfachsten Schaltung, die das Empfangen von <strong>Radio</strong>-Sendern<br />
ermöglicht, benötigt man nur eine Antenne, eine Diode und einen<br />
Hörer. Eine Energiequelle (z.B. eine Batterie) ist nicht erforderlich, da<br />
die Energie zum Bewegen der Membran des Hörers ausschließlich<br />
über die Antenne empfangen wird (also vom Sender stammt).<br />
Notwendig, um in diesem Fall überhaupt etwas zu hören, ist eine<br />
möglichst lange Antenne (10 … 30 m) und ein Sender in der Nähe des<br />
Empfängers. Nicht vergessen: Masse-Anschluss z.B. an einer<br />
Heizung! Nachteile der Schaltung sind:<br />
• Es kann keine Auswahl zwischen Sendern getroffen werden. Alle<br />
(starken) Sender können gleichzeitig empfangen werden.<br />
• Sehr geringe Lautstärke!<br />
Werden ein Kondensator und eine Spule zusätzlich<br />
benutzt, kann die Resonanzfrequenz auf die<br />
Sendefrequenz abgestimmt werden. Eine selektive<br />
Auswahl an Sendern ist prinzipiell möglich. Die<br />
Abstimmung kann über einen Drehkondensator oder<br />
über das Einführen eines Ferrit-Kerns in die Spule<br />
erreicht werden. Mit dem hier dargestellten Aufbau<br />
sind jedoch nur wenige Sender zu empfangen; in<br />
unserer Gegend wäre das RTL bei etwa f = 235 kHz.<br />
Mit einem Luftdrehkondensator (aus einem alten<br />
<strong>Radio</strong> ausgebaut) konnten zwei Sender getrennt<br />
werden (RTL: 236 kHz und xxx: 180 kHz).<br />
D. Mancini, R. Kneip S.8
<strong>4.</strong>3 Unser erstes <strong>Radio</strong><br />
Wickeln der Spule<br />
• Etwa 10 cm vom lackierten Draht<br />
sollen zum Anschließen an die<br />
Schaltung vorgesehen werden;<br />
• Draht (siehe erste Abbildung) durch<br />
die beiden kleinen Öffnungen führen<br />
(sicherheitshalber auch zweimal);<br />
somit wird ein Herausrutschen des<br />
Drahtes während des Aufwickelns<br />
vermieden;<br />
• Draht durch z.B. Drehen des<br />
Plastikrohres möglichst gleichmäßig<br />
aufwickeln, bis man etwa 150<br />
Wicklungen hat;<br />
• Draht wiederum (zweimal) durch die<br />
beiden Öffnungen führen, um ein<br />
Verrutschen des Drahtes auf der<br />
fertigen Spule zu verhindern;<br />
• Mit einem Cutter ist die Isolierung an<br />
den beiden Enden (auf einigen cm<br />
Länge) des Drahtes herabzukratzen.<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
Will man den Aufwand des Selbstwickelns einer Spule vermeiden, kann auch eine<br />
Induktivität benutzt werden. Hierzu sind in den zwei Abbildungen der Seite 11 die<br />
Schaltungen einmal mit Spule, einmal mit Induktivität schematisch dargestellt.<br />
Zum Aufbau der Schaltung: Schrauben mit Unterlegscheiben zu 2/3 einschrauben,<br />
Drahtenden biegen und unter die Unterlegscheiben legen; Schrauben festziehen und darauf<br />
achten, dass die Drähte eine gute elektrische Verbindung untereinander haben.<br />
D. Mancini, R. Kneip S.9
Aufbauschritte für die erste Schaltung<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
1 – 2: Plastikrohr mit selbstgewickelter Spule<br />
alternativ: 1a – 2a: Induktivität 320 μH<br />
3 – 4: Kondensator 1500 pF<br />
3 – 6 und 4 – 5: Draht für Verbindung zur Masse bzw. zur Antenne<br />
3 – 7: Draht<br />
4 – 8: Ge-Diode<br />
7 – 8: Widerstand 100 kΩ<br />
an 5: Befestigung der Antenne<br />
an 6: Befestigung des Drahtes, der z.B. mit der Heizung (Erde)<br />
verbunden wird.<br />
Parallel zum Widerstand wird der Hörer angeschlossen.<br />
Bei einer Antennenlänge von etwa 10 m ist ein Sender zu hören. Die Werte vom Kondensator<br />
und der Spule wurden für die Frequenz von 235 kHz optimiert. Um den Schwingkreis für<br />
andere Frequenzen zu optimieren, kann der Kondensator durch einen Drehkondensator ersetzt<br />
werden. Alternativ bietet sich auch an, die Induktivität der Spule durch das Einführen eines<br />
Ferrit-Kerns (z.B. aus einem alten <strong>Radio</strong>) zu verändern.<br />
Um eine größerer Lautstärke zu erreichen kann man das nachgewiesene Signal über einen<br />
Transistor verstärken.<br />
Aus Sicherheitsgründen soll keine Antenne bei Unwettergefahr im Freien aufgehängt<br />
werden (Gefahr des Blitzeinschlags)!<br />
D. Mancini, R. Kneip S.10
Einfache Schaltung mit selbstgewickelter Spule:<br />
Einfache Schaltung mit Induktivität:<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
D. Mancini, R. Kneip S.11
<strong>4.</strong>4 Verstärkung über einen Transistor<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
Die bereits aufgebaute Schaltung kann verbessert werden, indem über einen Transistor das<br />
Ausgangssignal verstärkt wird.<br />
<strong>Das</strong> schwache Signal am Widerstand wird (über einen Kondensator) zur Basis des Transistors<br />
geführt. Hier erfolgt dann die Verstärkung (Prinzip: siehe Seite 6). Am Drehpotentiometer<br />
kann die Betriebsspannung am Transistor nach Fertigstellung der Schaltung eingestellt<br />
werden. Um das Zusammenbauen zu vereinfachen, ist die Basis des Transistors bereits mit<br />
der Mittenanzapfung des Drehpotentiometers verlötet.<br />
Aufbauschritte für die erweiterte Schaltung:<br />
8 – 9: Verbindungsdraht<br />
9 – 11: Kondensator xxx nF<br />
7 – 10: Verbindungsdraht<br />
an 10: Emitter, Potentiometer (Mittenanschluss), Draht von 7 und Draht<br />
zum – Pol der Batterie; darauf achten, dass diese 4 Drähte durch<br />
eine Schraube leitend miteinander verbunden sind.<br />
an 11: zweiter Draht vom Potentiometer und Kondensator festschrauben<br />
an 13: dritter Draht vom Potentiometer<br />
13 – 14: Widerstand 47 kΩ<br />
an 14: + Pol der Batterie und Hörer befestigen<br />
an 12: Befestigung des Kollektoranschlusses und des Hörers<br />
15: kann benutzt werden um Potentiometer besser zu halten<br />
D. Mancini, R. Kneip S.12
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
Letzter Schritt: Masse und Antenne befestigen,<br />
und ein Sender müsste über das selbstgebaute <strong>Radio</strong> zu empfangen sein … Viel Spaß.<br />
Mit dieser Schaltung kann weiter experimentiert werden:<br />
• Die Schaltung über einen Transformator und einen kleinen (niederohmigen) Lautsprecher<br />
erweitern;<br />
• Kondensator 1500 pF durch einen Drehkondensator (z.B.:Luftdrehkondensator aus altem<br />
<strong>Radio</strong>) ersetzen;<br />
• Spule mit mehreren Anzapfungen herstellen, um unterschiedliche Induktivitäten zu<br />
erhalten;<br />
• passende Spulen und Kondensatoren verwenden um andere Frequenzbereiche zu erreichen;<br />
• und vieles mehr, siehe z.B. Internet-Links.<br />
Zum Testen der Schaltungen ist ein Oszilloskop von großem Vorteil<br />
5. Internet-Links<br />
Kleine Auswahl an Internet-Links, die beim Vorbereiten hilfreich waren:<br />
http://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/Detektrortechnik.htm<br />
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm<br />
http://www.geocities.com/molerat1964/control.htm<br />
“Es hat gefunkt – Prinzip der Rundfunkübertragung” Steve Niewisch<br />
http://www.creative-center.org.uk/main.html<br />
http://www.open2.net/science/roughscience/index.htm<br />
6. Materialliste<br />
1 Holzbrett (25 cm x 15 cm)<br />
15 Holzschrauben 15 Unterlegscheiben<br />
1 Plastikrohr (Ø: 2.5 cm; l = 20 cm)<br />
1 lackierter Draht (Ø: 0.3 mm; l = 12.5 m)<br />
alternativ zur selbstgewickelten Spule: 1 Induktivität 320 μH<br />
1 Kabel (Antenne) l = 10 m (oder mehr) 1 Kabel (Masse) l = 1 m<br />
1 Kondensator 1500 pF 1 Ge-Diode<br />
1 Widerstand 100 kΩ 1 Hörer 2 kΩ<br />
1 Ferrit-Kern<br />
1 Kondensator ??? nF 1 Drehpotentiometer 10 kΩ<br />
1 Widerstand 47 kΩ 1 Transistor BC 337<br />
1 Batterie 9 V mehrere kurze Kabelstücke<br />
und ein <strong>Radio</strong>, falls alles schief gehen sollte …<br />
D. Mancini, R. Kneip S.13
7. Kleine Bildergalerie<br />
Kleines Experimental-Labor<br />
Einfache <strong>Radio</strong>-Schaltung<br />
Fertiges <strong>Radio</strong>, mit Transistor-Verstärkung<br />
und Lautsprecher<br />
Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />
D. Mancini, R. Kneip S.14