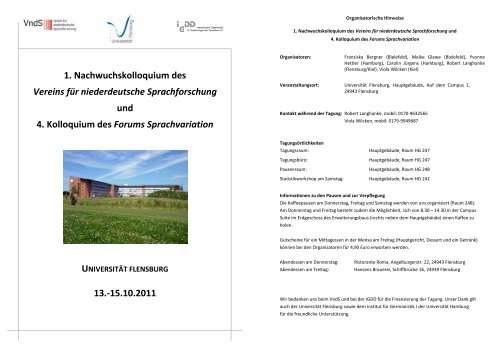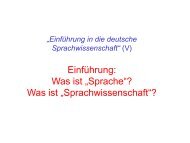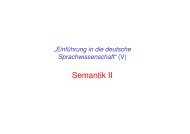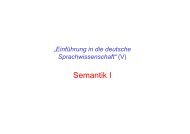1. Nachwuchskolloquium des Vereins für niederdeutsche ...
1. Nachwuchskolloquium des Vereins für niederdeutsche ...
1. Nachwuchskolloquium des Vereins für niederdeutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1.</strong> <strong>Nachwuchskolloquium</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Vereins</strong> <strong>für</strong> <strong>niederdeutsche</strong> Sprachforschung<br />
und<br />
4. Kolloquium <strong>des</strong> Forums Sprachvariation<br />
UNIVERSITÄT FLENSBURG<br />
13.‐15.10.2011<br />
Organisatorische Hinweise<br />
<strong>1.</strong> <strong>Nachwuchskolloquium</strong> <strong>des</strong> <strong>Vereins</strong> <strong>für</strong> <strong>niederdeutsche</strong> Sprachforschung und<br />
4. Kolloquium <strong>des</strong> Forums Sprachvariation<br />
Organisatoren: Franziska Bergner (Bielefeld), Meike Glawe (Bielefeld), Yvonne<br />
Hettler (Hamburg), Carolin Jürgens (Hamburg), Robert Langhanke<br />
(Flensburg/Kiel), Viola Wilcken (Kiel)<br />
Veranstaltungsort: Universität Flensburg, Hauptgebäude, Auf dem Campus 1,<br />
24943 Flensburg<br />
Kontakt während der Tagung: Robert Langhanke, mobil: 0170‐9632565<br />
Viola Wilcken, mobil: 0179‐9949687<br />
Tagungsörtlichkeiten<br />
Tagungsraum: Hauptgebäude, Raum HG 247<br />
Tagungsbüro: Hauptgebäude, Raum HG 247<br />
Pausenraum: Hauptgebäude, Raum HG 248<br />
Statistikworkshop am Samstag: Hauptgebäude, Raum HG 242<br />
Informationen zu den Pausen und zur Verpflegung<br />
Die Kaffeepausen am Donnerstag, Freitag und Samstag werden von uns organisiert (Raum 248).<br />
Am Donnerstag und Freitag besteht zudem die Möglichkeit, sich von 8.30 – 14.30 in der Campus<br />
Suite im Erdgeschoss <strong>des</strong> Erweiterungsbaus (rechts neben dem Hauptgebäude) einen Kaffee zu<br />
holen.<br />
Gutscheine <strong>für</strong> ein Mittagessen in der Mensa am Freitag (Hauptgericht, Dessert und ein Getränk)<br />
können bei den Organisatoren <strong>für</strong> 4,90 Euro erworben werden.<br />
Aben<strong>des</strong>sen am Donnerstag: Ristorante Roma, Angelburgerstr. 22, 24943 Flensburg<br />
Aben<strong>des</strong>sen am Freitag: Hansens Brauerei, Schiffbrücke 16, 24939 Flensburg<br />
Wir bedanken uns beim VndS und bei der IGDD <strong>für</strong> die Finanzierung der Tagung. Unser Dank gilt<br />
auch der Universität Flensburg sowie dem Institut <strong>für</strong> Germanistik I der Universität Hamburg<br />
<strong>für</strong> die freundliche Unterstützung.
Donnerstag, 13. Oktober 2011<br />
Programm<br />
14.00 Begrüßung und Grußwort <strong>des</strong> Vizepräsidenten der Universität Flensburg, Prof. Dr.<br />
Stephan Panther<br />
14.30 – 15.00<br />
15.00 – 15.30<br />
15.30 – 16.00<br />
16.00 – 16.30 Kaffeepause<br />
16.30 – 17.00<br />
17.00 – 17.30<br />
17.30 – 18.00<br />
Mads Christiansen (Aarhus)<br />
Die Präposition‐Artikel‐Enklise im Deutschen ‐ Schriftsprache, Umgangssprache,<br />
Dialekt. Mit einem sprachgeschichtlichen Exkurs<br />
Saskia Schröder (Kiel)<br />
Zur Dynamik der g‐Spirantisierung in den deutschen Regionalsprachen<br />
Nicole Palliwoda (Kiel)<br />
„Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ (W. Brandt) – Die ehemalige<br />
innerdeutsche Grenze als Forschungsgegenstand<br />
Jens Philipp Lanwer (Münster)<br />
Gesprochener Standard <strong>des</strong> Gegenwartsdeutschen. Hochdeutsch auf<br />
Niederdeutschem Substrat?<br />
Karina Lammert (Paderborn)<br />
Interaktionale Funktionen <strong>des</strong> Varietätenwechsels im sauerländischen Raum<br />
Nele Twilfer (Münster)<br />
Sprachvariation bei Frauen und Männern – Quantitative und qualitative<br />
Untersuchungen zum geschlechtspräferierten Sprachgebrauch in Norddeutschland<br />
ab 19.00 Gemeinsames Aben<strong>des</strong>sen im Ristorante Roma, Angelburgerstr. 22<br />
- 3 -<br />
Freitag, 14. Oktober 2011<br />
9.15 Begrüßung<br />
9.30 – 10.00<br />
10.00 – 10.30<br />
10.30 – 1<strong>1.</strong>00<br />
1<strong>1.</strong>00 – 1<strong>1.</strong>30 Kaffeepause<br />
1<strong>1.</strong>30 – 12.00<br />
12.00 – 12.30<br />
12.30 – 13.00<br />
13.00 – 14.30 Mittagspause<br />
14.30 – 15.00<br />
15.00 – 15.30<br />
15.30– 16.00 Kaffeepause<br />
Programm<br />
Ulrike Thumberger (Wien)<br />
Rufnamen als lexikalische Einheiten im Hauptkatalog der bairischen Mundarten in<br />
Österreich ‐ eine Bestandsaufnahme<br />
Christina Schrödl (Wien)<br />
Zur soziolinguistischen Dynamik im Burgenland<br />
Susanne Oberholzer (Zürich)<br />
Kommunikative<br />
Gottesdienst<br />
Funktionen von Code‐Switching im Deutschschweizer<br />
Alexander Scheufens (Köln)<br />
Gruppen und Gesellschaft im altsächsischen Heliand<br />
Elmar Schilling (Münster)<br />
„Ermenrîkes dôt“ und das <strong>niederdeutsche</strong> „Jüngere Hildebrandslied“:<br />
Frühneuzeitliche Nachklänge heldenepischer Tradition<br />
Luise Czajkowski (Leipzig)<br />
Sprachbewegungen und Sprachausgleich im niederdeutsch‐ostmitteldeutschen<br />
Interferenzraum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit<br />
Simon Kasper (Marburg)<br />
Dialektsyntaktische Phänomene, die <strong>niederdeutsche</strong> Sprachgrenze und das<br />
Projekt „Syntax hessischer Dialekte (SyHD)“<br />
Timo Ahlers (Wien)<br />
Erhebung bairischer Syntaxdaten: theoretische Herangehensweise und<br />
Aufgaben<strong>des</strong>ign<br />
16.00 – 17.30 Hauptvortrag<br />
Alfred Lameli (Marburg):<br />
Die Gliederung der Dialekte und das „Problem“ der sprachlichen Komplexität<br />
danach gemeinsamer Stadtrundgang und gemeinsames Aben<strong>des</strong>sen in Hansens Brauerei,<br />
Schiffbrücke 16<br />
- 4 -
Samstag, 15. Oktober 2011<br />
9.00 Begrüßung<br />
9.15 – 09.45<br />
09.45 – 10.15<br />
10.15 – 10.45<br />
10.45 – 1<strong>1.</strong>30 Kaffeepause<br />
Programm<br />
Sandra Weber (Lüttich)<br />
Sprachliche Identität, Spracheinstellungen und Sprachwahrnehmung in der<br />
deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens<br />
Rebekka Studler (Basel)<br />
Zur Genese von Spracheinstellungen zum Standarddeutschen in der<br />
Deutschschweiz<br />
Zukunftsplanungen <strong>für</strong> das <strong>Nachwuchskolloquium</strong> <strong>des</strong> VndS und das Forum<br />
Sprachvariation<br />
1<strong>1.</strong>30 – 13.00 Jana Brunner (Potsdam)<br />
Workshop Einführung in die Statistik <strong>für</strong> LinguistInnnen<br />
13.00 Verabschiedung<br />
- 5 -<br />
ReferentInnen<br />
MADS CHRISTIANSEN (AARHUS)<br />
Die Präposition‐Artikel‐Enklise im Deutschen ‐ Schriftsprache,<br />
Umgangssprache, Dialekt. Mit einem sprachgeschichtlichen Exkurs<br />
Das Thema meines Vortrags ist die Präposition‐Artikel‐Enklise im Deutschen. Nübling (2005)<br />
hat dieses Phänomen als eine „Grammatikalisierungsbaustelle“ charakterisiert, worunter sie<br />
die Tatsache versteht, dass aus synchroner Sicht »„das gesamte Spektrum zwischen<br />
Verschmelzungsblockade und Verschmelzungsobligatorik“« (Nübling 2005, S. 106) vorliegt.<br />
So haben im heutigen Deutsch sechs bis neun Verschmelzungsformen (am, beim, im, vom,<br />
zum, zur; am Rande: ans, aufs, ins) die Stufe der „speziellen Klise“, die unmittelbare Vorstufe<br />
von Flexion, erreicht und stehen somit in (beinahe) komplementärer Distribution zu den<br />
jeweiligen unverschmolzenen Konstruktionen. Im Bereich der speziellen Klise besteht<br />
Verschmelzungsobligatorik I) bei Zeitangaben: am Freitag, im August II) bei Unika: der Flug<br />
zum Mond, der Besuch beim Papst, III) bei Eigennamen: im Libanon, ins Wallis, IV) bei<br />
substantivierten Infinitiven: beim Schwimmen, zum Rudern V) im Superlativ: am schönsten,<br />
am besten, VI) bei idiomatischen Ausdrücken und Wendungen: das fünfte Rad am Wagen,<br />
jemanden ans Messer liefern, VII) bei Abstrakta und Stoffbezeichnungen: zum Trost, im<br />
Sand, VIII) bei indirekt anaphorischer Referenz: Haus – im Fenster und IX) bei generisch<br />
verwendeten Substantiven: das Gute im Menschen. Die formale Seite der am stärksten<br />
grammatikalisierten Verschmelzungsschicht zeichnet sich durch die kategoriale Festlegung<br />
der Artikelform auf den Dativ, den Singular und das Maskulinum/Neutrum aus, und zwar in<br />
Kombination mit einsilbigen, primären Präpositionen (vgl. am, beim, im, vom, zum). Die<br />
einzige Ausnahme bildet feminines zur. Auf tokenfrequenzieller Ebene spiegelt sich der hohe<br />
Grammatikalisierungsgrad deutlich wider. Die klitisierte Variante dominiert in der<br />
geschriebenen Standardsprache bei über 90% gegenüber den analytischen Konstruktionen<br />
(Nübling 2005, S. 115‐120). Im Bereich der „einfachen Klise“, in dem etwa zehn<br />
Verschmelzungen (durchs, <strong>für</strong>s, hinterm, hinters, unterm, unters, vorm, vors, überm, übers)<br />
mit einiger Häufigkeit in der geschriebenen Standardsprache vorkommen, besteht<br />
weitgehende Austauschbarkeit zwischen den beiden Konstruktionstypen. Hier kommen<br />
nicht nur dativische, sondern auch akkusativische Verschmelzungen vor. In der<br />
gesprochenen Sprache, am weitesten vorangeschritten in gewissen Dialekten <strong>des</strong><br />
Deutschen, findet sich zusätzlich eine Reihe von Allegroformen (z. B. auf ’e, auf ’er, <strong>für</strong> ’n, in<br />
’e, in ’er, nach ’m). Schließlich gibt es Präposition‐Artikel‐Kombinationen, bei denen die<br />
Bildung von Kontraktionen ausgeschlossen ist (Nübling 2005, S. 112‐115). Der Vortrag<br />
gliedert sich in zwei Teile. Zunächst wird der Grammatikalisierungsgrad <strong>des</strong> Phänomens in<br />
Schriftsprache, Umgangssprache und Dialekt in Vergleich gestellt, dann wird auf der<br />
Grundlage mittelhochdeutscher und frühneuhochdeutscher Prosaquellen der Diachronie <strong>des</strong><br />
Flexivierungsprozesses nachgegangen.<br />
Literatur (in Auswahl):<br />
Christiansen, Mads (2012): Die Präposition‐Artikel‐Enklise im Mittelhochdeutschen und Frühneuhochdeutschen, erscheint<br />
voraussichtlich in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB).<br />
Nübling, Damaris (1992): Klitika im Deutschen – Schriftsprache, Umgangssprache, alemannische Dialekte, Tübingen:<br />
Niemeyer.<br />
Nübling, Damaris (1998): Wann werden die deutschen Präpositionen flektieren? Grammatisierungswege zur Flexion, in:<br />
Fabri, R. et al. (Hrsg.): Models of Inflection, Tübingen: Niemeyer. S. 266‐289.<br />
Nübling, Damaris (2005): Von in die über in’n und ins bis im. Die Klitisierung von Präposition und Artikel als<br />
‚Grammatikalisierungsbaustelle‘, in: Leuschner, T. et al. (Hrsg.): Grammatikalisierung im Deutschen, Berlin/New York: de<br />
- 6 -
ReferentInnen<br />
Gruyter. S. 105‐13<strong>1.</strong><br />
Schiering, René (2005): Flektierte Präpositionen im Deutschen? Neue Evidenz aus dem Ruhrgebiet, Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Dialektologie und Linguistik 72. S. 52‐79.<br />
Steffens, Rudolf (2010): Zur Diachronie der Präposition‐Artikel‐Enklise. Evidenz aus Flurnamen, Beiträge zur<br />
Namenforschung 45. S. 245‐292.<br />
SASKIA SCHRÖDER (KIEL)<br />
Zur Dynamik der g‐Spirantisierung in den deutschen Regionalsprachen<br />
Die Dialektologie <strong>des</strong> Deutschen steht seit einiger Zeit deutlich unter dem Einfluss der von<br />
SCHMIDTund HERRGEN kürzlich publizierten Sprachdynamiktheorie (2011). Diese befasst<br />
sich mit dem Zusammen‐ und Gegenwirken von sprachlichen Varietäten und versucht somit<br />
großräumige Wandelprozesse der deutschen Regionalsprachen zu erklären. Dass diese<br />
Theorie jedoch auch im Kleinen anwendbar ist, zeigt die vorliegende Arbeit, eingereicht zur<br />
Erlangung <strong>des</strong> akademischen Gra<strong>des</strong> „Master of Arts“ an der Philipps‐Universität in<br />
Marburg. Die g‐Spirantisierung ist den meisten Sprechern <strong>des</strong> Deutschen im Kontext einer<br />
umgangssprachlichen Sprechlage bekannt und wird auch vom Duden (82009) als erlaubte<br />
Alternative zum standardsprachlichen Plosiv am Silbenauslaut genannt. Entgegen diesem<br />
Status als Merkmal kolloquialer Sprache steht der dialektale Ursprung in einigen Dialekten.<br />
Die Frage, wie sich das Verhältnis dieser beiden Varianten in der deutschen<br />
Dialektlandschaft darstellt, ist ein zentrales Moment der Arbeit. Dabei werden <strong>für</strong> eine ältere<br />
und eine jüngere Sprechergruppe in den Dialektgebieten Ripuarisch, Westfälisch und<br />
Thüringisch Variablenanalysen durchgeführt, um so ein Bild von der Verteilung<br />
spirantisierter Varianten in unterschiedlichen Erhebungssituationen zu erhalten. Unter<br />
Einbeziehung sprachbiographischer und kultureller Aspekte ist es möglich, Aussagen zur<br />
Dynamik der g‐Spirantisierung im Nieder‐ und Mitteldeutschen zu formulieren.<br />
NICOLE PALLIWODA (KIEL)<br />
„Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“ (W. Brandt)<br />
Die ehemalige innerdeutsche Grenze als Forschungsgegenstand<br />
Die Äußerung Willy Brandts 1989 stellt in meinem Dissertationsprojekt die zentrale<br />
Forschungsfrage dar und untersucht, inwieweit das Konstrukt ‚der Mauer in den Köpfen‘ der<br />
ost‐ und westdeutschen Bürger noch vorhanden ist. Dass diese Thematik auch nach über 20<br />
Jahren Wiedervereinigung noch immer nicht an Interesse verloren hat, zeigen<br />
Monographien und Sammelbände, die diese Fragestellung unter verschiedenen<br />
Gesichtspunkten analysieren. Neben Büchern, in denen Autoren über ihre Erinnerungen und<br />
Empfindungen zur Grenzeröffnung und der ehemalige DDR bzw. BRD berichten, lassen sich<br />
Beiträge und Aufsätze finden, die den Wortschatz, die Namensgebung, die Eigen‐ und<br />
Fremdbenennung und Beiträge, die die Spracheinstellung zu West‐ und Ostdeutschen der<br />
beiden ehemaligen deutschen Staaten untersuchen (vgl. u.a. Hellmann/Schröder (2008) u.<br />
Roth/Wienen (2008)). In meinem Forschungsvorhaben steht nicht die objektsprachliche<br />
- 7 -<br />
ReferentInnen<br />
Komponente im Fokus, sondern die subjektiven Wahrnehmungen der Personen, die an<br />
dieser ehemaligen Grenze aufgewachsen und sozialisiert wurden. Erste dialektologische<br />
Untersuchungen im thüringisch‐bayerischen Raum, die sich mit dieser sprachlichen Situation<br />
objektsprachlich beschäftigen (vgl. Harnisch (2009) u. Fritz‐Scheuplein (2001)), lassen<br />
Unterschiede sowohl in der Aussprache als auch in der Einstellung der Probanden deutlich<br />
werden. Gleichfalls zeigen Studien, die sich wahrnehmungsdialektologisch der Fragestellung<br />
nähern (vgl. Dailey‐O’Cain (1999) u. Kennetz (2010)), dass Unterschiede in der<br />
Repräsentation <strong>des</strong> ‚Gegenübers‘ bestehen.<br />
Im Beitrag selbst sollen das Forschungs<strong>des</strong>ign sowie die unterschiedlichen<br />
Untersuchungsgebiete vorgestellt und die ersten Herangehensweisen und Ergebnisse der<br />
wahrnehmungsdialektologischen Untersuchung thematisiert werden.<br />
Literatur:<br />
Dailey‐O’Cain, Jennifer (1999): The Perception of Post‐Unification German Regional Speech. In: Prestion, Dennis R.:<br />
Handbook of Perceptual Dialectology. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia. (Vol. 1). S. 227‐242.<br />
Fritz‐Scheuplein, Monika (2004): Zur Dialektsituation entlang der Grenze zwischen Bayern und Thüringen. In: Gaisbauer,<br />
Stephan/Scheuringer, Hermann (Hrsg.): Linzerschnitten. Beiträge zur 8. bayerisch‐österreichischen Dialektologentagung.<br />
19.‐23.09.2001 in Linz. S. 109‐16.<br />
URL: (3<strong>1.</strong>03.2010).<br />
Harnisch, Rüdiger (2010): Dialektentwicklung am Rande <strong>des</strong> Eisernen Vorhangs. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. H. 8. S.<br />
21‐26.<br />
Hellmann, Manfred W./Schröder, Marianne (Hrsg.) (2008): Sprache und Kommunikation in Deutschland Ost und West. Ein<br />
Reader zu fünfzig Jahren Forschung. In: Germanistische Linguistik 192/194.<br />
Kennetz, Keith (2010): German and German Political Disunity: An Investigation into the Cognitive Patterns and Perceptions<br />
of Language in Post‐Unified Germany. In: Anders, Christina A./Hundt, Markus/Lasch, Alexander (Hrsg.): Perceptual<br />
Dialectology. Neue Wege der Dialektologie. Berlin/New York: de Gruyter. S. 317‐335.<br />
Roth, Kersten Sven/Wienen, Markus (Hrsg.) (2008): Diskursmauern. Aktuelle Aspekte der sprachlichen Verhältnisse<br />
zwischen Ost und West. Bremen: Hempen Verlag.<br />
JENS PHILIPP LANWER (MÜNSTER)<br />
Gesprochener Standard <strong>des</strong> Gegenwartsdeutschen<br />
Hochdeutsch auf <strong>niederdeutsche</strong>m Substrat?<br />
In der dialektologischen Forschung wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass es<br />
aufgrund <strong>des</strong> sprachstrukturellen Abstan<strong>des</strong> zwischen <strong>niederdeutsche</strong>m Dialekt auf der<br />
einen und hochdeutschem Standard auf der anderen Seite in der Phase <strong>des</strong> diglossisch<br />
situierten Varietätenkontakts im <strong>niederdeutsche</strong>n Sprachraum zu deutlich weniger<br />
Systeminterferenzen gekommen sei als in anderen deutschen Dialektregionen (vgl. bspw.<br />
MENKE 1992:224ff.). Als besonders gering wird hier der Einfluss der Dialekte auf die<br />
überdachende Standardsprache eingeschätzt (vgl. u.a. SPIEKERMANN 2008:20f.). Letztere<br />
Einschätzung beruht jedoch sehr wahrscheinlich eher auf der synchron beobachtbaren<br />
sprachstrukturellen Nähe der regionalen Gebrauchsnormen im Norden zur kodifizierten<br />
Standardlautung; was allerdings sicher auch nicht <strong>für</strong> den gesamten norddeutsche Raum in<br />
gleicher Weise zutreffend ist (vgl. in diesem Zusammenhang bspw. LAUF 1996:216f.). In der<br />
Forschungsliteratur finden sich jedoch m.E. verschiedene sowohl soziolinguistische als auch<br />
systemlinguistische Befunde, die zusammengenommen deutliche Hinweise da<strong>für</strong> liefern,<br />
dass der gesprochene Standard <strong>des</strong> Gegenwartsdeutschen zwar grammatisch als<br />
Hochdeutsch zu bezeichnen ist, phonetisch – d.h. den Lautbestand (nicht das<br />
- 8 -
ReferentInnen<br />
Phoneminventar!) und die Akzent‐ sowie Intonationsmuster betreffend – jedoch ggf. eher<br />
auf <strong>niederdeutsche</strong> Wurzeln zurückweist.<br />
In meinem Vortrag sollen derartige Befunde zusammengetragen und zu folgender<br />
Argumentation verdichtet werden: Die artikulatorische Umsetzung der neuhochdeutschen<br />
Schriftsprache in eine gesprochene Form <strong>des</strong> Neuhochdeutschen führt seit dem 17. Jh.<br />
zunehmend zur Herausbildung von Oralisierungsnormen, die zunächst innerhalb der<br />
Grenzen großlandschaftlicher Dialektverbände Gültigkeit besitzen (vgl. hierzu u.a. SCHMIDT<br />
2005:284f.). Für „Lautbildung und Lautkombinatorik [werden] durchschnittlich die<br />
landschaftlichen Mittel, wie sie bereits im Dialekt vorliegen, eingesetzt […], wie ja auch<br />
weitgehend die landschaftliche Intonation weiterwirkt“ (WIESINGER 1997:34). So entstehen<br />
im norddeutschen Raum regionale Oralisierungsnormen, die, was die Phonetik betrifft,<br />
sicher auf <strong>niederdeutsche</strong>m Fundament stehen. Eine dieser niederdeutschgeprägten<br />
Oralisierungsnormen oder ggf. eine sprechsprachliche Koiné, die verschiedene<br />
<strong>niederdeutsche</strong> Dialektverbände überkuppelt, avanciert im Laufe <strong>des</strong> 18. bzw. 19 Jhs. zur<br />
Leitvarietät und wird schließlich seit Beginn <strong>des</strong> 20. Jhs. zunehmend institutionell normiert<br />
und vor allem durch den Sprachgebrauch in den audiovisuellen Massenmedien überregional<br />
etabliert (vgl. ähnlich auch bereits BESCH 2003:17f. bzw. KÖNIG 2005:109f.). Dieser<br />
Annahme folgend wäre also der gesprochene Standard <strong>des</strong> Gegenwartsdeutschen<br />
(zumin<strong>des</strong>t in seiner idealtypischen Ausprägung) als ‚Hochdeutsch auf <strong>niederdeutsche</strong>m<br />
Substrat‘ zu sehen und zu beschreiben, was <strong>für</strong> die Untersuchung der gegenwärtigen<br />
Dialekt/Standard‐Konstellationen in den verschiedenen Regionen <strong>des</strong> deutschsprachigen<br />
Raumes eine nicht unerhebliche Neuperspektivierung bedeuten würde.<br />
KARINA LAMMERT (PADERBORN)<br />
Interaktionale Funktionen <strong>des</strong> Varietätenwechsels im sauerländischen Raum<br />
Im Bereich der Alltagskommunikation ist das Niederdeutsche im sauerländischen Raum im<br />
Rückgang begriffen. Während die ältere Generation noch auf weitreichende<br />
Niederdeutschkompetenzen zurückgreifen kann, fristet das Niederdeutsche bei jüngeren<br />
Sprechern ein eher relikthaftes Dasein. Doch gerade vor diesem Hintergrund ist es<br />
interessant zu fragen, welcher kommunikative Mehrwert dem Niederdeutschen in<br />
Alltagsgesprächen noch zugerechnet werden kann. Welche Funktionen hat das<br />
Niederdeutsche im Gespräch, an welchen Stellen finden sich Varietätenwechsel und welcher<br />
Art sind sie? Ausgehend von stark divergierenden Niederdeutschkompetenzen in<br />
unterschiedlichen Sprechergruppen stellt sich außerdem die Frage, ob es sich beim Einsatz<br />
<strong>des</strong> Niederdeutschen an verschiedenen Stellen um stabilisierten, formelhaften Gebrauch<br />
handelt, oder ob es noch immer flexibel verwendet wird. Der Vortrag soll erste Ergebnisse<br />
einer Untersuchung zu interaktionalen Funktionen <strong>des</strong> Wechsels zwischen dem<br />
Hochdeutschen und dem Niederdeutschen präsentieren.<br />
- 9 -<br />
ReferentInnen<br />
NELE TWILFER (MÜNSTER)<br />
Sprachvariation bei Frauen und Männern – Quantitative und qualitative<br />
Untersuchungen zum geschlechtspräferierten Sprachgebrauch in<br />
Norddeutschland<br />
Im Vortrag wird ein Promotionsprojekt zum Thema geschlechtspräferierte Sprachvariation<br />
vorgestellt. Innerhalb der Soziolinguistik belegen viele Studien einen Zusammenhang<br />
zwischen Sprache und Geschlecht. Hier wurde immer wieder beobachtet, dass Frauen<br />
„korrekter“ sprechen und – vor allem auf der phonetisch‐phonologischen Ebene – mehr zur<br />
Standardvarietät neigen als Männer (vgl. u.a. Labov 1966; Trudgill 1972). Für den<br />
norddeutschen Raum liegen jedoch keine aktuellen Untersuchungen vor. Ältere Ergebnisse<br />
basieren zudem größtenteils auf subjektsprachlichen Untersuchungen (vgl. Diercks 1986;<br />
Berner 1996); objektsprachliche Auswertungen sind rar (vgl. Stellmacher 1975/1976) und auf<br />
kleinere Regionen beschränkt (vgl. Kremer 1986). Darüber hinaus sind pauschale Aussagen<br />
über stabile Geschlechterdifferenzen mit eindeutigen dichotomen Zuordnungen vor dem<br />
Hintergrund neuerer theoretischer Ansätze und empirischer Befunde der<br />
Geschlechterforschung zu hinterfragen (vgl. Braun et al. 2000).<br />
Neben einem Forschungsüberblick wird im Beitrag das Korpus und methodische Vorgehen<br />
vorgestellt: als Datengrundlage dient das umfangreiche objektsprachliche Material <strong>des</strong><br />
überregionalen DFG‐Projektes Sprachvariation in Norddeutschland (vgl. Elmentaler et al.<br />
2006). Im Rahmen der Erhebung wurden u.a. Tischgespräche aufgenommen, die einen<br />
analytischen Zugriff auf ungezwungene und alltägliche Kommunikation ermöglichen. Im<br />
Fokus stehen die Gesprächsbeiträge der mittleren Generation zwischen 40‐55 Jahren, wobei<br />
sich die quantitative und qualitative Variablenanalyse auf Merkmale der phonetisch‐<br />
phonologischen Ebene konzentrieren wird. Anhand ausgewählter Beispiele werden im<br />
Beitrag erste Auswertungen diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Berner, Elisabeth (1996): Dialekt, Umgangssprache und Standardsprache im Sprecherurteil von Frauen und Männern. Zur<br />
Wahrnehmung <strong>des</strong> aktuellen Sprachgebrauchs im Land Brandenburg. In: Brandt, Gisela (Hrsg.): Bausteine zu einer<br />
Geschichte <strong>des</strong> weiblichen Sprachgebrauchs II. Stuttgart: Akademischer Verlag. S. 5‐28.<br />
Braun, Friederike/ Geyer, Klaus/Gottburgsen, Anja/Oelkers, Susanne (2000) (Hrsg.): Auf dem richtigen Weg? Weibliche<br />
Standardorientierung als linguistischer Mythos. In: Muttersprache 3. S. 196‐213.<br />
Diercks, Willy (1986): Geschlechtstypisches im Mundartgebrauch und ‐bewertung. In: Debus, Friedhelm/Dittmar, Ernst<br />
(Hrsg.): Sandbjerg 85. Dem Andenken von Heinrich Bach gewidmet. Neumünster (= Kieler Beiträge zur deutschen<br />
Sprachgeschichte 10). S. 127‐152.<br />
Elmentaler, Michael et al. (Hrsg.) (2006): Sprachvariation in Norddeutschland. Ein Projekt zur Analyse <strong>des</strong> sprachlichen<br />
Wandels in Norddeutschland. In: Gessinger, Joachim/Voeste, Anja. (Hgg.): Dialekt im Wandel. Perspektiven einer neuen<br />
Dialektologie. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (= OBST 71). Duisburg. S. 159‐178.<br />
Kremer, Ludger (1986): "Froulöpraot" und "Mannslöspraoke". Über Unterschiede im Sprachverhalten von Frauen und<br />
Männern in Westfalen. In: Westfälische Forschungen 36. S. 2‐12.<br />
Labov, William (1966): The social stratification of English in New York City. Washington.<br />
Trudgill, Peter (1972): Sex, Covert Prestige and Linguistic Change in the Urban British English of Norwich. Language in<br />
Society 1<strong>1.</strong> S. 179–195.<br />
Stellmacher, Dieter (1975/1976): Geschlechtsspezifische Differenzen im Sprachverhalten <strong>niederdeutsche</strong>r Sprecher. In:<br />
Niederdeutsches Jahrbuch 98/99. S. 164‐175.<br />
- 10 -
ReferentInnen<br />
ULRIKE THUMBERGER (WIEN)<br />
Rufnamen als lexikalische Einheiten im Hauptkatalog der<br />
bairischen Mundarten Österreichs – eine Bestandsaufnahme<br />
Bei der Materialsammlung <strong>für</strong> das Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich<br />
wurden auch zahlreiche Eigennamen (Rufnamen) erhoben, die sich bei genauerer<br />
Betrachtung nicht eindeutig der appellativischen oder proprialen Sprachsphäre (Šrámek<br />
2007) zuordnen lassen, sondern lexikalisierte Formen mit einem eher appelativischen<br />
Charakter sind und oftmals sogar in den Bereich der Schimpfwörter fallen. Es handelt sich<br />
dabei um (zumeist deminuierte) Formen wie Hansl, Hiasl, Urschel oder Regerl, die teilweise<br />
auch in Komposita vorkommen können (bspw. Prozesshansl).<br />
Im Rahmen der Dissertation soll der Bestand solcher Rufnamen, die die propriale Sphäre<br />
verlassen haben, anhand der Belege im Hauptkatalog der bairischen Mundarten erfasst<br />
werden und nach lexikologischen Gesichtspunkten kategorisiert werden; damit soll ein<br />
Forschungs<strong>des</strong>iderat zwischen den Teildisziplinen Namenforschung, Dialektologie und<br />
Lexikologie bearbeitet werden. Es soll versucht werden, die erwähnten Formen sowohl aus<br />
namentheoretischer Sicht zu beschreiben als auch sie in eine lexikalisch‐semantische Theorie<br />
einzubetten. Schließlich stellen sich noch Fragen <strong>für</strong> die lexikographische Praxis: welchen<br />
Bezug haben solche Formen zu den Eigennamen, von denen sie sich ursprünglich ableiten,<br />
und in welcher Form kann man am besten ein Lemma da<strong>für</strong> ansetzen?<br />
Literatur:<br />
Fritz, Gerd (2006): Historische Semantik. 2., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Metzler.<br />
Kalverkämper, Herwig (1978): Textlinguistik der Eigennamen. Stuttgart: Klett‐Cotta.<br />
Schippan, Thea (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 2. Auflage. Tübingen: Niemeyer.<br />
Šrámek, Rudolf (2007): Die appellativische und die propriale Sprachspäre. In: Šrámek, Rudolf: Beiträge zur allgemeinen<br />
Namentheorie, Hrgg. v. Ernst Hansack, Wien: Präsens (Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 16). u. a. S. 72‐77.<br />
WBÖ = Institut <strong>für</strong> Österreichische Dialekt‐ und Namenlexika (Hrsg.): Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich<br />
(WBÖ). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1970‐lfd.<br />
CHRISTINA SCHRÖDL (WIEN)<br />
Zur soziolinguistischen Dynamik im Burgenland<br />
Das Burgenland bietet sich aufgrund der bescheidenen Forschungslage und seiner<br />
Geschichte als Arbeitsgebiet geradezu an.<br />
Aufgrund seiner Lage im äußersten Osten Österreichs, direkt am Eisernen Vorhang, konnte<br />
es sich sowohl wirtschaftlich, als auch sprachlich, nur nach Westen orientieren. Bis 1921 war<br />
Ungarisch die Dachsprache im Burgenland, da es bis dahin ein Teil <strong>des</strong> Königreichs Ungarn<br />
war. Heute werden dort Deutsch, Kroatisch, Ungarisch und Romani gesprochen. Derzeit<br />
leben etwa 284.000 Einwohner im Burgenland. Es ist relativ dünn besiedelt und besitzt nur<br />
wenige städtische Zentren. In den 1950er Jahren waren noch 61 % der Bevölkerung in der<br />
Landwirtschaft tätig, heute sind es nur noch ca. 7 %. 30 % der Bevölkerung pendelt nach<br />
Wien oder Graz aus.<br />
Die oben angeführten Gründe sprechen da<strong>für</strong>, dass die Sprache bzw. die Dialekte im<br />
Burgenland einerseits sehr konservativ, andererseits aber, besonders aufgrund <strong>des</strong><br />
- 11 -<br />
ReferentInnen<br />
Einflusses durch die Pendler, seit einigen Jahrzehnten stark von Wien bzw. Graz beeinflusst<br />
sein müssten. Außerdem muss auch die Wirkung der Medien berücksichtigt werden.<br />
In den Jahren 1952 bis 1959, 1963‐1964 und 1975 tätigten das heutige Institut <strong>für</strong><br />
Österreichische Dialekt‐ und Namenlexika und das Phonogrammarchiv der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften Aufnahmen der Sprachen und Ortsdialekte in etwa 300 Orten,<br />
was einer Aufnahme aller Ortsdialekte gleichkommt. Damit ist das Burgenland das am<br />
besten dokumentierte Bun<strong>des</strong>land Österreichs, jedoch wurden diese Aufnahmen bis heute<br />
nur unzureichend aufgearbeitet. Diese Tonaufnahmen bilden meine Vergleichsgrundlage<br />
zum heutigen Burgenländischen. Das Ziel meiner Arbeit ist die Untersuchung von<br />
Veränderungen und/oder Beständigkeit auf der lautlichen Ebene. Außerdem soll die<br />
Einstellung zur Sprache behandelt werden.<br />
Quellen:<br />
Tonaufnahmen aus dem Phonogrammarchiv der ÖAW:<br />
B 146‐B 231, B 242‐293, B 486‐589,B 845‐928, B 1301‐1375, B 1461‐1588, B 2384‐2424, B 2428‐2457, B 2461‐2474, B 3128‐<br />
3189, B 7544‐7545, B 8291‐8296, B 20001‐20034<br />
Literatur (in Auswahl):<br />
Holzer, Werner (Hrsg.) (1993): Trendwende? Sprache und Ethnizität im Burgenland. Wien: Passagen‐Verl.<br />
Muhr, Rudolf (2005): Dialekt als Teil der inneren Mehrsprachigkeit. In: Ders., Erwin Schranz und Dietmar Ulreich (Hrsg.):<br />
Sprachen und Sprachkontakte im pannonischen Raum. Das Burgenland und Westungarn als mehrsprachiges Gebiet.<br />
Frankfurt u. a.: Peter Lang (= Österreichisches Deutsch. Sprache der Gegenwart 5). S. 135 – 148.<br />
Resch, Gerhard (1974): Soziolinguistisches zur Sprache von Pendlern. Die Realisierung der hochsprachlichen Diphtonge „ei“,<br />
„au“ und „eu“ in der Umgangssprache von Gols (Burgenland) unter dem Einfluß <strong>des</strong> Wiener Dialektes. In: Wiener<br />
Linguistische Gazette 7. S. 38 – 47.<br />
Rauchbauer, Paul (1995): Die deutschen Mundarten im nördlichen Burgenlande. Wien: Dissertation 1932.<br />
Sauer, Dagmar: Bewertungen <strong>des</strong> Dialekts in der Schule. Am Beispiel der Pflichtschulen im südlichen Burgenland. Wien:<br />
Diplomarbeit..<br />
Seidelmann, Erich (1957): Lautlehre der Mundart von Mörbisch am Neusiedler See. Wien: Dissertation.<br />
SUSANNE OBERHOLZER (ZÜRICH)<br />
Kommunikative Funktionen von Code‐Switching im Deutschschweizer<br />
Gottesdienst<br />
In Gottesdiensten der Deutschschweiz wird sowohl Standarddeutsch wie auch Dialekt<br />
(Schweizerdeutsch) gesprochen; dies gilt <strong>für</strong> die römisch‐katholische und die evangelische<br />
Lan<strong>des</strong>kirche. Die Verwendung von Standarddeutsch in Gottesdiensten ist (meist) nicht<br />
adressateninduziert, sondern situationsinduziert (Einteilung nach Christen et al. 2010: 13‐<br />
14): Pfarrpersonen mit Dialekt als Erstsprache kommunizieren mit Sprechern (der<br />
Gemeinde), deren Erstsprache ebenfalls eine Deutschschweizer Mundart ist. Demzufolge<br />
gelänge die Kommunikation im Gottesdienst auch in Schweizerdeutsch. Nichts<strong>des</strong>totrotz<br />
finden sich beide Varietäten in den Kirchen, häufig werden sie innerhalb eines<br />
Gottesdienstes nebeneinander gebraucht.<br />
Dieser Beitrag zeigt auf, dass und wo Code‐Switching zwischen den beiden Sprachformen in<br />
Gottesdiensten auftritt. Er widmet sich zudem der Frage, ob sich die Verwendung der<br />
Varietäten Schweizerdeutsch und Standarddeutsch sowie die Wechsel zwischen den beiden<br />
in diesem Kommunikationsraum bestimmten Funktionen zuordnen lassen. Ein Vorschlag <strong>für</strong><br />
eine Typologisierung der kommunikativen Funktionen der Code‐Switchings (in beide<br />
Richtungen) soll diskutiert werden. Zudem soll die Frage untersucht werden, ob sich eine<br />
- 12 -
ReferentInnen<br />
funktionale Einteilung der Varietäten auch über den Einzelgottesdienst und den<br />
Einzelsprecher hinaus aufrechterhalten lässt und inwiefern sie sich auch auf andere Beispiele<br />
situationsinduzierten Standardgebrauchs ihre Gültigkeit übertragen lässt (vgl. beispielsweise<br />
Steiners (2008) funktionale Einteilung von Code‐Switching im gymnasialen<br />
Mathematikunterricht).<br />
Literatur:<br />
Christen, Helen/Guntern, Manuela/Hove, Ingrid/Petkova, Marina (2010): Hochdeutsch in aller Munde. Eine empirische<br />
Untersuchung zur gesprochenen Standardsprache in der Deutschschweiz (= Zeitschrift <strong>für</strong> Dialektologie und Linguistik.<br />
Beihefte; Heft 140). Stuttgart: Steiner.<br />
Steiner, Astrid (2008): Unterrichtskommunikation: eine linguistische Untersuchung der Gesprächsorganisation und <strong>des</strong><br />
Dialektgebrauchs in Gymnasien der Deutschschweiz. Tübingen: Narr.<br />
ALEXANDER SCHEUFENS (KÖLN)<br />
Gruppen und Gesellschaft im altsächsischen Heliand<br />
Eine systematische Darstellung und Interpretation <strong>des</strong> Verhältnisses von Person und<br />
Gemeinschaft fehlt in der bisherigen Forschung zur altsächsischen Evangelienharmonie<br />
Heliand. Fast die gesamte bisherige Forschung orientierte sich an der Vor‐Annahme <strong>des</strong><br />
Heliands als einer Missionsdichtung und stellte die Intention <strong>des</strong> unbekannten Autors in den<br />
Mittelpunkt <strong>des</strong> Forschungsinteresses, nicht die Überlieferung <strong>des</strong> Textes. Dagegen<br />
bestimmen zwei neue Leitfragen zur Textintention das Forschungsvorhaben: „Wie agieren<br />
Figuren und Gruppen mit‐und untereinander und welche Konsequenz hat dies <strong>für</strong> die<br />
Interpretation <strong>des</strong> Textes?“ und „Wie verschafft sich der Text durch seine narrative<br />
Organisation im Hinblick auf die Personen‐und Gruppendarstellungen Akzeptanz?“. Erstmals<br />
wird die Darstellung sämtlicher Gruppierungen im Text untersucht, nicht nur das Verhältnis<br />
Jesu zu seinen Jüngern. Dabei stützt sich das Dissertationsprojekt in einem zweiten Schritt<br />
auf die Ergebnisse der neueren mediävistischen Forschung zu Gruppenbindungen im<br />
Frühmittelalter. Die umfassende Analyse der textuellen Funktion personaler Beziehungen<br />
stellt die die bisherige Forschung dominierende These in Frage, die dem Verhältnis Jesu zu<br />
seinen Jüngern eine Sonderstellung zuschreibt und es als Darstellung „germanischer<br />
Gefolgschaft“ versteht, wie dies in der Heldendichtung überliefert ist. Statt<strong>des</strong>sen soll<br />
ausgelotet werden, inwiefern sich in der Beschreibung von Gruppenbindungen<br />
Sozialstrukturen einer frühfeudalen Gesellschaftsordnung widerspiegeln.<br />
ELMAR SCHILLING (MÜNSTER)<br />
„Ermenrîkes dôt“ und das <strong>niederdeutsche</strong> „Jüngere Hildebrandslied“:<br />
Frühneuzeitliche Nachklänge heldenepischer Tradition<br />
Durch die gesamte deutsche Literatur <strong>des</strong> Mittelalters zieht sich die epische<br />
Auseinandersetzung mit der Gestalt Dietrichs von Bern. Die Begegnung von Dietrichs<br />
Lehrmeister Hildebrand mit seinem Sohn und der darauf folgende Kampf stellen den Stoff<br />
<strong>für</strong> das älteste erhaltene Stück deutschsprachiger Heldendichtung. Der Konflikt zwischen<br />
- 13 -<br />
ReferentInnen<br />
Dietrich und Ermanarich bildet die Grundlage <strong>für</strong> die sogenannte Historische Dietrichepik.<br />
Bis in die altnordische Literatur reicht die Stofftradition. Zwei mittel<strong>niederdeutsche</strong> Balladen<br />
<strong>des</strong> 16. Jahrhunderts, Ermenrikes dot und das Jüngere Hildebrandslied, letztere wohl auf das<br />
hochdeutsche Gegenstück zurückgehend, greifen diese Geschichten auf und präsentieren sie<br />
in einer charakteristisch ‚zersungenen‘ Form. Dies hat allerhand Besserungsversuche auf den<br />
Plan gerufen, die aber den Blick auf die Charakteristik der Lieder zu verstellen drohen.<br />
Verwechslungen von Personennamen mit Ortsnamen oder Appellativa zeigen, wo mündlich<br />
tradierte Sage nicht mehr verstanden wurde und wie sich die Weitergebenden zu helfen<br />
wussten. Wo Forschern <strong>des</strong> 19. und 20. Jahrhunderts der Konjekturbedarf ins Auge sprang,<br />
liegen die eigentümlichen Faszinosa dieses literarischen Subgenres: Durch die<br />
eingeschränkte Länge der Balladen verschwimmen zeitliche und räumliche Dimensionen.<br />
Motive werden aufgegriffen und fallengelassen, Erwartungen an den Handlungsverlauf läuft<br />
der Text auf irritierende Weise zuwider. Das Ethos der Figuren erweist sich als wenig<br />
berechenbar: Wie viel vom Hildebrand <strong>des</strong> 9. und wie viel vom Dietrich <strong>des</strong> 13.<br />
Jahrhunderts, welche heroischen und ritterlichen Verhaltensmuster lassen sich in diesen<br />
wunderlichen Texten wiederfinden – und wie viel Neues bieten deren Figuren, die in<br />
Verbindung mit den glücklichen Ausgängen der Texte oft als ‚gemütlich‘ und ‚kleinbürgerlich‘<br />
abgetan worden sind? Es empfiehlt sich ein Blick auf die Texte, der die frühneuzeitlichen<br />
Charakteristika nicht einfach als Degeneration heldenepischen Erzählens ansieht.<br />
LUISE CZAJKOWSKI (LEIPZIG)<br />
Sprachbewegungen und Sprachausgleich im niederdeutsch‐<br />
ostmitteldeutschen Interferenzraum im Spätmittelalter und der Frühen<br />
Neuzeit<br />
Der überwiegend in der Dialektologie geprägte Begriff <strong>des</strong> niederdeutsch‐ostmittel‐<br />
deutschen Interferenzraums hat die Forschung bisher vor allem hinsichtlich <strong>des</strong> Ursprungs<br />
<strong>des</strong> neuhochdeutschen Standards interessiert. Wie dieses sich heute über weite Teile <strong>des</strong><br />
ostmitteldeutschen Raums erstreckende Übergangsgebiet zwischen den <strong>niederdeutsche</strong>n<br />
und den hochdeutschen Dialekten entstanden ist, soll nun untersucht werden. Erste<br />
Untersuchungen führen zu der Hypothese, dass der Grund <strong>für</strong> die Entstehung <strong>des</strong><br />
Interferenzraums ursprünglich in einer Verdrängung der <strong>niederdeutsche</strong>n Dialekte durch die<br />
hochdeutschen (und das schon lange vor der Reformation) liegt. Orte, in denen einstmals die<br />
<strong>niederdeutsche</strong> Schreibsprache herrschte, in denen sich aber schon während <strong>des</strong> Spätmittel‐<br />
alters die mitteldeutsche Sprache durchsetzte, liegen laut ersten Untersuchungen im<br />
besagten niederdeutsch‐ostmitteldeutschen Interferenzraum der Gegenwart.<br />
Ziel <strong>des</strong> (Dissertations‐)Projektes ist es, die Verdrängung <strong>des</strong> Niederdeutschen in diesem<br />
Gebiet nachzuzeichnen. Anhand graphematischer und flexionsmorphologischer Untersu‐<br />
chungen soll der Status quo der Schreibsprache (Zugriffe auf tatsächlich gesprochene<br />
Ortsdialekte sind nicht mehr möglich) im Untersuchungsgebiet bestimmt und die Ergebnisse<br />
der einzelnen Ortspunkte miteinander verglichen werden. Der Untersuchungszeitraum<br />
erstreckt sich dabei über zwei Jahrhunderte, von 1300 bis 1500. Das Untersuchungskorpus<br />
besteht überwiegend aus Originalquellen, sowie aus einzelnen zusätzlich herangezogenen<br />
- 14 -
ReferentInnen<br />
Editionen. Die Texte wurden (ausfindig gemacht,) ediert, kollationiert und in eine Datenbank<br />
eingespeist, sodass sie <strong>für</strong> die komplexe Auswertung zur Verfügung stehen. Erste Ergebnisse<br />
zeigen bereits die erwünschten neuen Erkenntnisse bzgl. <strong>des</strong> Schreibsprachenwechsels im<br />
mitteldeutschen Raum.<br />
SIMON KASPER (MARBURG)<br />
Dialektsyntaktische Phänomene, die <strong>niederdeutsche</strong> Sprachgrenze und das<br />
Projekt „Syntax hessischer Dialekte (SyHD)“<br />
Das DFG‐Projekt „Syntax hessischer Dialekte (SyHD)“ hat sich zum Ziel gesetzt, erstmals und<br />
flächendeckend die Dialektsyntax <strong>des</strong> Deutschen am Beispiel eines gesamten Bun<strong>des</strong>lands<br />
(Hessen) in ihren Grundzügen zu erheben, systematisch zu dokumentieren und zu<br />
analysieren. Die Regierungsgrenzen Hessens schließen dabei nicht nur westmitteldeutsche,<br />
sondern neben Übergangsgebieten zum Ostmitteldeutschen vor allem auch <strong>niederdeutsche</strong>,<br />
d.h. west‐ und ostfälische Dialektregionen mit ein (vgl. Wiesinger 1983). Zum aktuellen<br />
Zeitpunkt wurden bereits Daten aus 17 Belegorten (10% der Gesamtmenge an<br />
Erhebungsorten) mit jeweils 5‐8 Informanten erhoben. Da über Jahrzehnte hinweg eher<br />
andere linguistische Strukturebenen (Phonetik/Phonologie, Lexik) als die Syntax auf<br />
dialektale Variation hin untersucht worden sind (vgl. Glaser 2000: 258f.) und sich dieses Bild<br />
nur langsam ändert (vgl. <strong>für</strong> das deutsche Sprachgebiet etwa das syntaktische Sonderprojekt<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Sprachatlas von Niederbayern „SNiB“ (Eroms et al. 2006) und den<br />
Syntaktischen Atlas der Deutschen Schweiz „SADS“), sollen im Vortrag daher zunächst die<br />
Anlage und Methode <strong>des</strong> Projekts vorgestellt werden, um anschließend bereits erhobene<br />
syntaktische Daten aus <strong>niederdeutsche</strong>n und westmitteldeutschen Dialektregionen anhand<br />
ausgewählter syntaktischer Phänomene zu vergleichen (z.B. Pronominaladverbien,<br />
Präteritumschwund, tun‐Periphrase). Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf der Frage<br />
liegen, ob und wenn ja, welche dieser Phänomene raumbildend sind und wie sich diese<br />
Räume zur bekannten Niederdeutsch‐Mitteldeutsch‐Grenze verhalten.<br />
Literatur:<br />
Eroms, Hans Werner/Röder, Birgit/Spannbauer‐Pollmann, Rosemarie (2006): Bayerischer Sprachatlas. Regionalteil 5:<br />
Sprachatlas von Niederbayern. Bd. 1: Einführung mit Syntaxauswertung. Heidelberg: Univ.‐Verlag Winter.<br />
Glaser, Elvira (2000): Erhebungsmethoden dialektaler Syntax. In: Stellmacher; D. (Hrsg.): Dialektologie zwischen Tradition<br />
und Neuansätzen. Beiträge der internationalen Dialektologentagung, Göttingen, 19.‐2<strong>1.</strong> Oktober 1998. Stuttgart: Steiner<br />
(ZDL Beihefte 109). S. 259‐276.<br />
Wiesinger, Peter (1983): Die Einteilung der deutschen Dialekte. In: Besch, W./Knoop, U./Putschke, W./Wiegand. H. E.<br />
(Hrsg.): Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Teilband 2. Berlin/New York: de<br />
Gryuter (HSK 1, 2). S. 807‐900.<br />
- 15 -<br />
ReferentInnen<br />
TIMO AHLERS (WIEN)<br />
Erhebung bairischer Syntaxdaten: theoretische Herausforderungen &<br />
Aufgaben<strong>des</strong>ign<br />
Die weiträumige Erhebung dialektsyntaktischer Daten, wie sie jüngst in bisher noch wenigen<br />
Projekten (etwa SynAlm oder SyHD) vorgenommen wird, bedeutet die Schaffung einer sehr<br />
wichtigen empirischen Datenbasis <strong>für</strong> die gesamte linguistic scientific community. Nicht<br />
zuletzt <strong>für</strong> explanative Theorien, welche die Syntax in ihr Zentrum stellen, ist eine<br />
quantitative und qualitative breite Datenlage unverzichtbar zur theoretischen Modellierung.<br />
Vice versa kann die empirische Datenlage nicht ohne die Fortschritte und Fragestellungen<br />
moderner Syntaxtheorien erhoben werden. Dies scheint trivial, hat sich aber längst noch<br />
nicht in allen Forschungsbereichen durchgesetzt. Das im Vortrag behandelte Beispiel<br />
eingebetteter Verbzweitsätze im Bairischen soll <strong>für</strong> eine engere Kooperation zwischen<br />
theoretischer und empirischer Forschungspraxis werben.<br />
Literatur:<br />
Antomo, M./Steinbach, M. (2008): Desintegration und Interpretation: Weil‐V2‐Sätze an der Schnittstelle zwischen Syntax,<br />
Semantik und Pragmatik. Unpubliziertes Manuskript. Universität Frankfurt und Universität Mainz.<br />
Julien, Marit (2007): Embedded V2 in Norwegian and Swedish. Working Papers in Scandinavian Syntax 80:103‐161, Lund<br />
University.<br />
Leu, Tom (2009): From Greek to Germanic: The Structure of AdjectivalModification. In: Brucart, Gavarro, Sola (Eds):<br />
Merging Features: Computation, Interpretation, and Acquisition, Oxford University Press.<br />
Weiß, Helmut (1998): Syntax <strong>des</strong> Bairischen. Tübingen: Niemeyer.<br />
Rowley, Anthony R. (1977): Eine Beschreibung der Mundart von Florutz (Fierozzo) in der Sprachinsel <strong>des</strong> Fersentals bei<br />
Trient. Ma Thesis, University of Reading.<br />
ALFRED LAMELI (MARBURG)<br />
Die Gliederung der Dialekte und das „Problem“ der sprachlichen Komplexität<br />
Übergeordnetes Ziel der Dialektgliederung ist die systematische Kategorisierung <strong>des</strong><br />
Sprachraums. Indem dabei die Komplexität der sprachräumlichen Verflechtungen reduziert<br />
wird, werden allgemeine Strukturen im Sinne übergeordneter Raumeinheiten sichtbar, die<br />
zur Erklärung sprachlicher Phänomene und Prozesse genutzt werden können. Doch wirft der<br />
kategorisierende Ansatz Probleme auf, wenn man die evolutionäre Entfaltung <strong>des</strong><br />
Sprachraums berücksichtigt, die zu einer Landschaft kontinuierlicher Übergänge geführt hat.<br />
So kann auch nicht verwundern, dass ein Blick in die vorliegenden Einteilungen der<br />
deutschen Dialekte bisweilen erstaunliche Unterschiede zeigt. Grenzen und Einheiten<br />
werden nicht selten stark abweichend angesetzt. Einen Schritt weiter gehen<br />
dialektometrische Ansätze, die mitunter explizit auf der Kontinuität <strong>des</strong> Raumes aufbauen<br />
und den unterliegenden Strukturen <strong>des</strong> Sprachraums gewidmet sind. Aus diesem Kontext<br />
heraus soll im Vortrag vorgeführt werden, dass die in den traditionellen Einteilungen<br />
reduzierte sprachliche Komplexität einen besonders interessanten Gegenstand der<br />
raumstrukturellen Analyse bildet, der neue Einsichten in die Strukturierung, aber auch in die<br />
- 16 -
ReferentInnen<br />
Dynamik <strong>des</strong> Sprachraumes zu liefern im Stande ist. Hier<strong>für</strong> wurde eine quantitative<br />
Modellierung der dialektalen Raumstruktur in Deutschland erarbeitet, die im Vortrag<br />
präsentiert wird und hinsichtlich der damit abgebildeten Hierarchien und Relationen der<br />
Einzeldialekte diskutiert wird.<br />
SANDRA WEBER (LÜTTICH)<br />
Sprachliche Identität, Spracheinstellungen und Sprachwahrnehmung in der<br />
deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens<br />
Ob in dem vorweihnachtlichen Radioquiz „Der germanistische Adventskalender: Ostbelgien<br />
lernt Deutsch“ oder in Zeitungsartikeln mit Titeln wie „Mazouttanks und andere<br />
Verfehlungen“ ‐ ein Blick auf die Medien der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG)<br />
verrät es: Der deutschsprachige Belgier hat offensichtlich den Eindruck, dass sich das<br />
belgische Hochdeutsch von dem auf der anderen Seite der deutsch‐belgischen Grenze<br />
unterscheidet. Immer wieder werden Besonderheiten in der Sprache der deutschsprachigen<br />
Belgier in den regionalen Medien thematisiert, und erst kürzlich ist ein<br />
populärwissenschaftliches Wörterbuch zur ostbelgischen Alltagssprache erschienen. Dieses<br />
Projekt beschäftigt sich damit, wie die ostbelgischen Sprachmerkmale in der hochdeutschen<br />
Alltagssprache von den Bewohnern der DG wahrgenommen und bewertet werden, und<br />
inwieweit diese zu ihrer sprachlichen Identität gehören. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der<br />
Frage ob und in welchem Maße die sprachliche Identität, die Sprachwahrnehmung und<br />
–einstellungen der Ostbelgier durch die politische und kulturelle Situation der DG beeinflusst<br />
werden. Die DG ist eine der drei autonomen Gemeinschaften <strong>des</strong> belgischen Föderalstaats.<br />
Die bewegte Geschichte der Region (mehrfacher Nationalitätenwechsel zwischen 1920 und<br />
1945) und die Minderheitensituation machen es den Ostbelgiern allerdings schwer, zu einer<br />
Identität zu finden. Die Bewohner der DG sprechen eine Sprache, deren « Mutterland » das<br />
Nachbarland Deutschland ist, außerdem haben sie durch den Konsum deutscher Medien<br />
einen starken Bezug zur deutschen Kultur, möchten aber nicht als Deutsche betrachtet<br />
werden. Innerhalb Belgiens sind sie eine Minderheit, fühlen sich aber durch intensiven<br />
Kontakt auch der belgischen Kultur verbunden. Auf nationaler Ebene können sich die<br />
Ostbelgier zwar über ihre Sprache definieren (siehe die offizielle Bezeichnung <strong>des</strong> Gebietes:<br />
"DeutschSPRACHIGE Gemeinschaft"), auf internationaler Ebene birgt das aber das Problem,<br />
dass man sich so nicht von den deutschen Staatsbürgern abgrenzen kann. Bei diesem Projekt<br />
geht es u. a. darum, ob dies auf sprachlicher Ebene über regionale Varianten oder Varietäten<br />
geschehen kann. Da sowohl auf Ebene der Basisdialekte bzw. der regionalen<br />
Sprachmerkmale als auch im vertikalen Varietätengebrauchsgefüge grundsätzlich große<br />
Gemeinsamkeiten zwischen den sprachlichen Verhältnissen in der DG und denen im<br />
angrenzenden deutschen Gebiet bestehen, die kulturellen und politischen Situationen aber<br />
durchaus unterschiedlich sind, verspricht eine grenzüberschreitende vergleichende<br />
Betrachtung besonders aufschlussreiche Ergebnisse. Die wichtigsten Fragen hierbei sind:<br />
Wie stark herrscht bei den Sprechern das Gefühl, das sich das regionale Alltagshochdeutsch<br />
von dem auf der anderen Seite der Lan<strong>des</strong>grenze unterscheidet? Was ist in den Augen der<br />
lokalen Bevölkerung typisch <strong>für</strong> diese Varietät und inwieweit stimmen diese Vorstellungen<br />
mit der Realität überein? Wie sind ihre Einstellungen der regionalen hochdeutschen<br />
Alltagssprache gegenüber? Welche Funktionen haben vorkommende regionale Merkmale<br />
- 17 -<br />
ReferentInnen<br />
<strong>für</strong> die Identität der Menschen auf beiden Seiten der Grenze? Des Weiteren soll untersucht<br />
werden, wie Sprache in den regionalen Medien, also besonders standardnahe Varietäten, in<br />
die dennoch auch regionaler Sprachgebrauch einfließen kann, wahrgenommen werden:<br />
Betrachten die Menschen sie als ein sprachliches Vorbild, an dem sie sich orientieren<br />
können? Das Projekt, die Untersuchungsmethoden und eventuell erste<br />
Untersuchungsergebnisse sollen im Rahmen <strong>des</strong> Vortrags vorgestellt werden.<br />
REBEKKA STUDLER (BASEL)<br />
Zur Genese von Spracheinstellungen<br />
zum Standarddeutschen in der Deutschschweiz<br />
Die Sprachsituation in der Schweiz ist <strong>für</strong> die Untersuchung von Spracheinstellungen aus<br />
min<strong>des</strong>tens zwei Gründen interessant: Erstens besteht in der Deutschschweiz eine Diglossie<br />
mit schweizerdeutschen Dialekten und der Standardvarietät ‚Hochdeutsch’. Anders als in<br />
klassischen diglossischen Situationen hat das Schweizerdeutsche (die Low‐Varietät) ein<br />
hohes Prestige und einen grossen Einfluss auf die (Sprach‐)Identität seiner SprecherInnen.<br />
Zweitens ist das Deutsche eine plurizentrische Sprache mit Standardvarietäten <strong>für</strong><br />
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Obwohl diese Varietäten theoretisch<br />
gleichberechtigt sind, ist die Überzeugung weit verbreitet, dass das bun<strong>des</strong>deutsche<br />
Hochdeutsch das normgebende und korrekte Deutsch darstellt.<br />
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass die Spracheinstellungen zum<br />
Standarddeutschen geteilt sind: Einerseits sind sie positiv, da nicht nur das<br />
Schweizerdeutsche, sondern auch das Hochdeutsche ein hohes Prestige geniesst und als<br />
Instanz <strong>für</strong> ‚gutes Deutsch’ gilt. Andererseits sind sie negativ, da die Umgangssprache in allen<br />
informellen und halbformellen Situationen der Dialekt ist; Hochdeutsch wird vorwiegend in<br />
der Schule erlernt und in erster Linie in offiziellen Situationen verwendet. Während Kinder<br />
im Vorschulalter und in den ersten Schuljahren noch keine charakteristischen Einstellungen<br />
entwickelt haben, kommt es im Laufe der Schulzeit zu einer Distanzierung (die Mehrheit der<br />
Bevölkerung ist der Überzeugung, dass das Hochdeutsche <strong>für</strong> DeutschschweizerInnen eine<br />
Fremdsprache darstellt) und zu negativen Einstellungen zum Hochdeutschen und seinen<br />
SprecherInnen.<br />
Um zu klären, welche konkreten Gründe bei der Entstehung von Spracheinstellungen zum<br />
Standarddeutschen (und zum Schweizerdeutschen) ausschlaggebend sind, wende ich<br />
quantitative und qualitative Methoden an, i.e. Fragebogen und Leitfadeninterviews. In<br />
meinem Vortrag werde ich die Methode meiner Untersuchung vorstellen und erste<br />
Ergebnisse der quantitativen Erhebung präsentieren: Es wird diskutiert, ob unterschiedliche<br />
Sprachsozialisierungen, wie Erstkontakt mit der Varietät ‚Standarddeutsch’, Art <strong>des</strong> Erwerbs<br />
<strong>des</strong> Standarddeutschen (gesteuert/ungesteuert), vermitteltes Prestige von<br />
Schweizerdeutsch und Standarddeutsch etc. die Spracheinstellungen beeinflussen, ob die<br />
sprachpolitischen Änderungen der letzten Jahre signifikante Änderungen bringen können<br />
und inwiefern die Spracheinstellungen mit den Einstellungen zu seinen SprecherInnen<br />
zusammenhängen.<br />
- 18 -
ReferentInnen<br />
JANA BRUNNER (POTSDAM)<br />
Einführung in die Statistik <strong>für</strong> LinguistInnen<br />
Der Workshop gibt eine sehr knappe Einführung in statistische Arbeitsweisen<br />
(Grundbegriffe, Hypothesengenerierung, Kriterien <strong>für</strong> die Auswahl eines Tests), die darauf<br />
angelegt ist, die TeilnehmerInnen zu befähigen, sich selbstständig weiter in die Materie<br />
einzuarbeiten.<br />
Die TeilnehmerInnen werden lernen, mit der Statistiksoftware R umzugehen. Wir werden<br />
Daten in das Programm einlesen und einfache statistische Tests (z.B. Chi‐Quadrat‐Test, t‐<br />
Test) durchführen.<br />
- 19 -<br />
CAMPUSPLAN<br />
Mensa<br />
Hauptgebäude Räume<br />
HG 247, HG 248, HG 242<br />
Erweiterungsbau,<br />
Campus Suite 2<br />
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
Vom Bahnhof oder Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) mit der Linie 4 in Richtung "Campus<br />
Uni" oder der Linie 5 in Richtung "Sünderup (über Campus)" bis zur Haltestelle "Campus Uni"<br />
(roter Kreis auf dem Plan) fahren.<br />
Die Busfahrpläne liegen den Tagungsunterlagen bei und sind mit der Tagungshomepage<br />
(http://www.germsem.uni‐kiel.de/ndnl/Doppelkolloquium%20Flensburg.shtml) verlinkt.<br />
Die Lokale (siehe Plan in den Tagungsunterlagen) können vom zentralen Omnisbusbahnhof<br />
(ZOB) fußläufig erreicht werden.