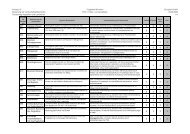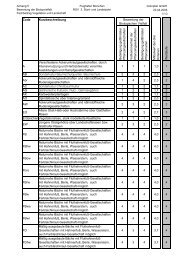2 Beschreibung des Vorhabens
2 Beschreibung des Vorhabens
2 Beschreibung des Vorhabens
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start- und Landebahn<br />
Umweltverträglichkeitsstudie<br />
UVS 2 <strong>Beschreibung</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Vorhabens</strong><br />
Dr. Blasy - Dr. Øverland<br />
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG<br />
Eching am Ammersee, den 14.08.2007
Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG<br />
Moosstraße 3<br />
82279 Eching am Ammersee<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
14.08.2007 Dr. H. Øverland<br />
......................................................................................................<br />
Datum Name Unterschrift (GF)<br />
14.08.2007 G.-M. Krüger<br />
......................................................................................................<br />
Datum Name Unterschrift (PL)<br />
Name Firma<br />
Ersteller Gerd-Michael Krüger Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start- und Landebahn<br />
Flughafen München GmbH<br />
Projektteam Kapazitäten<br />
Postfach 23 17 55<br />
85326 München-Flughafen<br />
Burkhard Lüst Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />
Heidi Stürzer Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />
2-2 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
Tabellenverzeichnis....................................................................................................... 2-5<br />
Verzeichnis der Karten im Anhang .............................................................................. 2-5<br />
Abkürzungen .................................................................................................................. 2-6<br />
Glossar............................................................................................................................ 2-6<br />
2 <strong>Beschreibung</strong> <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong>............................................................................ 2-8<br />
2.1 Einleitung........................................................................................................ 2-8<br />
2.1.1 Bestehender Flughafen München .......................................................... 2-8<br />
2.1.2 Änderungen der Planung gegenüber Planungsstand<br />
Raumordnungsverfahren ....................................................................... 2-8<br />
2.1.3 Übersicht der Maßnahmen im Ausbauvorhaben ................................... 2-9<br />
2.2 Flughafenausbau.......................................................................................... 2-10<br />
2.2.1 Flugbetriebsflächen.............................................................................. 2-10<br />
2.2.1.1 Start- und Landebahn................................................................... 2-10<br />
2.2.1.2 Rollwege....................................................................................... 2-10<br />
2.2.1.3 Vorfelder ....................................................................................... 2-10<br />
2.2.1.4 Hochbauflächen............................................................................ 2-11<br />
2.2.2 Grundwasserregelung.......................................................................... 2-11<br />
2.2.2.1 Grundwasserabsenkung und -versickerung................................. 2-11<br />
2.2.2.2 Bauwerke im Grundwasser .......................................................... 2-12<br />
2.2.3 Sparten und wasserwirtschaftliche Maßnahmen ................................. 2-12<br />
2.2.3.1 Entwässerung............................................................................... 2-12<br />
2.2.3.2 Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb <strong>des</strong><br />
Flughafengelän<strong>des</strong> ....................................................................... 2-13<br />
2.2.4 Geländeaufschüttungen ....................................................................... 2-13<br />
2.3 Folgemaßnahmen ........................................................................................ 2-14<br />
2.3.1 Gewässerneuordnung.......................................................................... 2-14<br />
2.3.2 Landseitige Straßen und Wege............................................................ 2-15<br />
2.4 Boden- und Rohstoffmanagement ............................................................... 2-15<br />
2.4.1 Übersicht .............................................................................................. 2-15<br />
2.4.2 Gesamtrohstoffbedarf........................................................................... 2-15<br />
2.4.3 Kiesgewinnung aus Seitenentnahmen................................................. 2-16<br />
2.4.4 Materialzulieferung............................................................................... 2-16<br />
2.5 Baubetrieb .................................................................................................... 2-17<br />
2.5.1 Baulogistikkonzept ............................................................................... 2-17<br />
2.5.2 Phasen der Baumaßnahmen ............................................................... 2-17<br />
2.5.2.1 Vorabmaßnahmen........................................................................ 2-17<br />
2.5.2.2 1. Investmaßnahme...................................................................... 2-18<br />
2.5.2.3 2. Investmaßnahme...................................................................... 2-18<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-3
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
2.5.2.4 3. Investmaßnahme...................................................................... 2-19<br />
2.5.3 Festlegungen zum Bauablauf .............................................................. 2-19<br />
2.5.3.1 Baustelleneinrichtungsflächen...................................................... 2-19<br />
2.5.3.2 Massen und Volumen der Baumaßnahmen................................. 2-21<br />
2.5.3.3 Transportfahrzeuge ...................................................................... 2-21<br />
2.5.3.4 Anlieferrouten für Transportfahrten .............................................. 2-22<br />
2.5.3.5 Transporte und Fahrten................................................................ 2-22<br />
2.5.3.6 Baumaschineneinsatz .................................................................. 2-23<br />
2.5.3.7 Zwischenlagerstätten.................................................................... 2-23<br />
2.5.3.8 Bodenklassen auf Zwischenlagern, Aufschüttungen sowie<br />
Abschirmwällen............................................................................. 2-24<br />
2.5.4 Minimierung von Luftschadstoffemissionen und der<br />
Staubentwicklung ................................................................................. 2-24<br />
2.5.4.1 Grundsätzliche Maßnahmen ........................................................ 2-24<br />
2.5.4.2 Vermeidung von Staubemissionen durch Befeuchtung<br />
beim technischen Erdbau und erforderliche<br />
Wasserentnahme ......................................................................... 2-26<br />
Quellenverzeichnis ...................................................................................................... 2-29<br />
Karten nach Kartenverzeichnis .................................................................................. 2-30<br />
2-4 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Seite<br />
Tabelle 2-1 Transportvolumina................................................................................ 2-21<br />
Verzeichnis der Karten im Anhang<br />
Karte Nr. Bezeichnung Maßstab<br />
UVS 2-1 Lageplan mit politischen Grenzen 1: 100.000<br />
UVS 2-2 Lageplan <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong> 1: 25.000<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-5
Abkürzungen<br />
ASG Abbausystem Gelände<br />
DFS Deutsche Flugsicherung<br />
FMG Flughafen München GmbH<br />
FTO St 2084 (Flughafentangente Ost)<br />
ICAO International Civil Aviation Organisation<br />
ROV Raumordnungsverfahren<br />
UVS Umweltverträglichkeitsstudie<br />
Glossar<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Flugbetriebsflächen Flächen auf einem Flugplatz außerhalb von Gebäuden, die<br />
dem Betrieb von Luftfahrzeugen dienen; sie unterteilen sich in<br />
das → Rollfeld und das → Vorfeld.<br />
Landseite Bereich <strong>des</strong> Flughafens, der vor der Sicherheitskontrolle liegt<br />
und für die Allgemeinheit zugänglich ist, sowie die nähere<br />
Umgebung <strong>des</strong> Flughafens.<br />
Luftseite Bereich <strong>des</strong> Flughafens, der hinter der Sicherheitskontrolle<br />
liegt und nur für abgefertigte Fluggäste zugänglich ist.<br />
Perimeter-Rollweg Rollweg, der um eine Start- und Landebahn herumführt.<br />
Durch den Perimeter-Rollweg wird ein Queren der Start- und<br />
Landebahn durch den Rollverkehr vermieden.<br />
Planungsfall Zustand im Jahr 2020 mit einer 3. Start- und Landebahn<br />
sowie den erforderlichen Anpassungen weiterer kapazitätserheblicher<br />
Flughafenbereiche, so dass das Gesamtsystem<br />
<strong>des</strong> Flughafens München das Planungsziel einer praktischen<br />
Kapazität von min<strong>des</strong>tens 120 Flugbewegungen/h erreicht.<br />
Prognosenullfall Zustand im Jahr 2020 ohne den Bau einer 3. Start- und<br />
Landebahn <strong>des</strong> Flughafens München.<br />
Referenzfall Zustand im Referenzjahr 2004 für die Untersuchung.<br />
Rollfeld Start- und Landebahnen sowie die weiteren für Start und<br />
Landung bestimmten Teile eines Flugplatzes einschließlich<br />
der sie umgebenden Schutzstreifen und die Rollwege sowie<br />
die weiteren zum Rollen bestimmten Teile eines Flugplatzes<br />
außerhalb <strong>des</strong> → Vorfel<strong>des</strong> (vgl. § 21a Abs. 2 Satz 2 LuftVO).<br />
Rollweg Festgelegter Weg auf einem Flugplatz für das Rollen von<br />
Luftfahrzeugen, der eine Verbindung zwischen einem Teil <strong>des</strong><br />
Flugplatzes und einem anderen herstellt (auch Rollbahn).<br />
Schnellabrollweg Rollweg, der spitzwinklig mit einer Start- und Landebahn<br />
verbunden und dazu bestimmt ist, den landenden Flugzeugen<br />
das Abrollen bei höheren Geschwindigkeiten als auf anderen<br />
2-6 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Abrollwegen zu ermöglichen.<br />
SLB Süd, Südbahn Bestehende Start- und Landebahn Süd mit der Bezeichnung<br />
08 R / 26 L.<br />
SLB Nord, Nordbahn Bestehende Start- und Landebahn Nord mit der Bezeichnung<br />
08 L / 26 R.<br />
SLB neue Nordbahn Neue Start- und Landebahn Nord mit der Bezeichnung 09/27.<br />
Vorfeld Festgelegte Fläche auf einem Flugplatz für die Abfertigung<br />
von Luftfahrzeugen (Ein- und Aussteigen von Fluggästen, Ein-<br />
und Ausladen von Gepäck, Post oder Fracht, Be- und Enttanken<br />
(sowie zum Abstellen und zur Wartung von Luftfahrzeugen).<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-7
2 <strong>Beschreibung</strong> <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong><br />
2.1 Einleitung<br />
2.1.1 Bestehender Flughafen München<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Der Verkehrsflughafen München verfügt heute über ein unabhängiges<br />
Zweibahnsystem mit der Start- und Landebahn 08L/26R (Nord) und in<br />
einem Achsabstand von 2.300 m hierzu die parallele Start- und Landebahn<br />
08R/26L (Süd) nebst Rollwegen, Abrollwegen, Vorfeldern und Abfertigungseinrichtungen.<br />
Die Start- und Landebahnen mit einer Länge von<br />
jeweils 4.000 m und einer Breite von 60 m sind für Starts und Landungen<br />
in jeweils beiden Betriebsrichtungen und für Allwetterflugbetrieb der Betriebsstufe<br />
III b zugelassen. Der Flughafen München ist für Luftfahrzeuge<br />
mit Code-Letter "F" geeignet. Alle heute betriebenen Luftfahrzeuge<br />
können damit in München starten und landen.<br />
2.1.2 Änderungen der Planung gegenüber Planungsstand<br />
Raumordnungsverfahren<br />
Flächenreduzierung<br />
Durch folgende Maßnahmen konnte der Flächenbedarf <strong>des</strong> gesamten<br />
<strong>Vorhabens</strong> gegenüber den für das Raumordnungsverfahren getroffenen<br />
Annahmen reduziert werden:<br />
> Der Abstand <strong>des</strong> Flughafenzauns westlich der Schwelle 09 bzw. östlich<br />
der Schwelle 27 der neuen Start- und Landebahn wurde von ca. 800 m<br />
(Planungsstand ROV) auf 575 m reduziert. Die Anflugbefeuerung der<br />
Start- und Landebahn befindet sich teilweise außerhalb <strong>des</strong> Flughafenzauns.<br />
> Der nördliche Abstand <strong>des</strong> Flughafenzauns zur Achse der S/L-Bahn<br />
wurde im Mittelteil der 09/27 von 310 m auf 265 m reduziert und an den<br />
Köpfen der Bahn auf 295 m.<br />
> Auf die im Raumordnungsverfahren vorgesehenen zwei Rollwege<br />
westlich der bestehenden Nordbahn (westlicher Perimeter-Rollweg und<br />
innerer westlicher Rollweg) konnte verzichtet werden. Die östlichen<br />
Perimeter-Rollwege wurden zur Flächenminimierung um ca. 250 m<br />
nach Westen verschoben.<br />
> Südlich der neuen Start- und Landebahn wurde die westlich der neuen<br />
Allgemeinen Luftfahrt gelegene Fläche in einer Größe von ca. 50 ha<br />
von dem Flughafengelände ausgenommen.<br />
2-8 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> Verlegung der St 2084 nach Süden zwischen die bestehende<br />
Nordbahn und die geplante 3. Start-/ Landebahn.<br />
Durch eine Simulation der luftseitigen Verkehrsflüsse hat die DFS den<br />
Nachweis erbracht, dass diese Minimierungsmaßnahmen die Funktionalität<br />
der Verkehrsflüsse nicht beeinträchtigen (s. Gutachten “Funktionsnachweis<br />
der luftseitigen Verkehrsflüsse am Flughafen München im Jahr<br />
2020“, DFS, Langen, 2007).<br />
Weitere Elemente der vertieften Planungen<br />
Im Zuge der weiteren Planung wurde die Lage folgender (zusätzlicher)<br />
Anlagen (s. Karte UVS 2-2) festgelegt:<br />
> Im Rahmen der Vorfelderweiterung wurde die Fläche der bestehenden<br />
Allgemeinen Luftfahrt und <strong>des</strong> bestehenden Hubschrauberlandeplatzes<br />
überplant. Als neuer Standort ist eine Fläche zwischen der bestehenden<br />
Nordbahn und der 3. Start- und Landebahn vorgesehen.<br />
> Die Feuerwache 3 wird in diesem Bereich westlich der neuen Allgemeinen<br />
Luftfahrt angeordnet und südlich <strong>des</strong> Parallelrollwegs L, etwa in<br />
Höhe der Bahnmitte errichtet.<br />
> Zur Reduzierung der Rollzeiten wurde ein weiterer Rollweg (Y2) mit<br />
einem Abstand von 620 m östlich der Schwelle 26R geplant.<br />
> Zur Anbindung <strong>des</strong> erweiterten Vorfelds an das Rollwegsystem der 3.<br />
Start- und Landebahn ist neben den für das Raumordnungsverfahren<br />
bereits vorgesehenen zwei Rollbrückenpaaren eine zusätzliche Anbindung<br />
nordöstlich <strong>des</strong> Erweiterungsbereichs vorgesehen, um Engpässe<br />
im Rollverkehr im Bereich der östlichen Enteisungsflächen der bestehenden<br />
Nordbahn (Schwelle 26R) zu vermeiden.<br />
> Die Linienführung der St 2084 verläuft zwischen der bestehenden<br />
Nordbahn und der geplanten 3. S/L-Bahn ("Variante Mitte").<br />
> Bypass zur Anbindung <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> Ost, Rollwegsystem 3. Bahn<br />
> Rollbrücke in Folge der Maßnahme Knoten Ost<br />
2.1.3 Übersicht der Maßnahmen im Ausbauvorhaben<br />
In der UVS wird für die Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen<br />
folgende Gliederung <strong>des</strong> Gesamtvorhabens (s. Karte UVS 2-2) in<br />
Verursacherbereiche vorgenommen. In der UVS werden Kürzel vergeben,<br />
damit eine separate und eindeutige Erfassung einzelner Wirkbereiche<br />
möglich ist.<br />
Flughafenausbau<br />
> Errichtung der 3. S/L-Bahn und Ausbau Vorfeld Ost (einschließlich<br />
sonstiger luftseitiger Baumaßnahmen wie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,<br />
Betriebsstraßen) - Kürzel: AB<br />
> Grundwasserregelung - Kürzel: GR<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-9
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> Sparten (Entwässerung, sonstige Ver- und Entsorgung) - Kürzel: SP<br />
> Geländeaufschüttungen – Kürzel: GA<br />
Folgemaßnahmen<br />
> Gewässerneuordnung Kürzel: - GN<br />
> Landseitige Straßen/Verkehrsanbindung Straße Kürzel: - VS<br />
2.2 Flughafenausbau<br />
2.2.1 Flugbetriebsflächen<br />
2.2.1.1 Start- und Landebahn<br />
2.2.1.2 Rollwege<br />
2.2.1.3 Vorfelder<br />
Die neue Start- und Landebahn (09/27) soll nordöstlich der bestehenden<br />
Nordbahn (08L/26R), zwischen der Ortschaft Attaching im Westen, der<br />
Staatsstraße 2580 im Osten und der Autobahn A 92 im Norden in einem<br />
Achsabstand von 1.180 m parallel zur bestehenden Nordbahn 08L/26R<br />
liegen. Der Schwellenversatz zwischen den beiden Start- und Landebahnen<br />
beträgt 2.100 m. Das Vorhaben umfasst Flächen in den Landkreisen<br />
Erding und Freising mit den Gemeinden Eitting, Oberding, Hallbergmoos,<br />
Marzling und Stadt Freising (s. Karte UVS 2-1). Der Schwerpunkt<br />
der Ausbaumaßnahmen 3. S/L-Bahn und Vorfeld Ost liegt in der<br />
Gemeinde Oberding.<br />
Die Start- und Landebahn wird tauglich für den Allwetterflugbetrieb nach<br />
Betriebsstufe III b und für Luftfahrzeuge ausgelegt, die dem Code-Letter<br />
"F" entsprechen. Die Bahnlänge beträgt 4000 m. Sie erhält eine Gesamtbreite<br />
von 60 m zuzüglich 2 x 7,5 m befestigte Schultern. An die Start- und<br />
Landebahn schließen in jede Richtung vier Schnellabrollwege an. Für den<br />
abfliegenden Verkehr sind Aufrollwege mit Holding Bays und Enteisungsflächen<br />
an jeder Schwelle vorgesehen.<br />
Die Anbindung der neuen S/L-Bahn 09/27 an das bestehende Start-/<br />
Landebahnsystem erfolgt über ein ICAO Code F-konformes Rollwegsystem.<br />
Die neuen Rollwege haben eine Breite von 30 m. Die neue Nordbahn<br />
wird über einen doppelten Parallelrollweg erschlossen. Die Verbindung<br />
zu den Vorfeldern erfolgt über vier Rollwege in Nord-Süd-Richtung.<br />
Zur Bewältigung <strong>des</strong> für den Planungsfall prognostizierten Luftverkehrsaufkommens<br />
sowie zur luftseitigen Erschließung der erforderlichen Anlagen<br />
ist eine Erweiterung der Vorfeldflächen östlich <strong>des</strong> bestehenden Vorfelds<br />
erforderlich. Der neu zu errichtende Vorfeldbereich wird begrenzt:<br />
> im Norden durch die St 2584 (Erdinger Allee),<br />
> im Süden durch den Südring,<br />
2-10 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> im Westen durch die heute schon planfestgestellte Ostgrenze der<br />
Ramp 3,<br />
> und im Osten durch den Abfanggraben Ost.<br />
Die Vorfelderweiterung ist so dimensioniert, dass in der Spitzenstunde<br />
unter Ansatz <strong>des</strong> prognostizierten Flugzeugmix für alle Flugzeuge ein<br />
Standplatz zur Verfügung steht.<br />
Im Zuge der Ausbaumaßnahmen wird die bestehende Allgemeine Luftfahrt<br />
(ALF) verlegt. Für die ALF wird am neuen Standort ein neues Vorfeld<br />
errichtet.<br />
2.2.1.4 Hochbauflächen<br />
Das zukünftige Satellitengebäude B1 wird auf 7 Ebenen Raum für Gebäudetechnik,<br />
Gepäckförderung- und -sortierung, verschiedene Passagierflüsse<br />
sowie deren verschiedenen Kontrollen, Gastronomie und Retailbereiche<br />
anbieten. Es wird eine Anbindung <strong>des</strong> Personentransportsystems<br />
vorgesehen.<br />
Im Bereich der heutigen Schneedeponie sind hochbauliche Entwicklungsflächen<br />
für zwei Rampengerätestationen sowie Frachtzwischenlagerung<br />
vorgesehen.<br />
Südlich <strong>des</strong> Parallelrollweges L wird in etwa der Bahnmitte eine neue<br />
Feuerwache errichtet.<br />
Die allgemeine Luftfahrt (ALF) wird an einen neuen Standort, zwischen<br />
der bestehenden Nordbahn und der 3. Start- und Landebahn auf Höhe der<br />
bestehenden Schwelle 26R verlegt.<br />
2.2.2 Grundwasserregelung<br />
2.2.2.1 Grundwasserabsenkung und -versickerung<br />
Die Grundwasserregelung umfasst die Maßnahmen zur erforderlichen<br />
Grundwasserabsenkung im Bereich der 3. Start- und Landebahn und die<br />
Wiederversickerung von Grundwasser nördlich der neuen Flughafengrenze.<br />
Das bestehende System der Grundwasserregelung wird für den Bereich<br />
der 3. Start- und Landebahn um ein Dränagesystem ergänzt. Ziel dieses<br />
Systems ist es, die im Planungsbereich vorhandenen hohen Grundwasserstände<br />
an bautechnisch wichtigen und sicherheitsrelevanten Punkten<br />
um rd. 0,5 m abzusenken. Durch die geplante Grundwasserregelung kann<br />
gleichzeitig der für die Aufschüttung der Flugbetriebsflächen erforderliche<br />
Rohstoffbedarf deutlich reduziert werden. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen<br />
werden damit vor allem auch die Eingriffe in den Gewinnungsgebieten<br />
reduziert.<br />
Mit geeigneten Maßnahmen zur Wiederversickerung werden die Auswirkungen<br />
der Grundwasserregelung minimiert und auf den Nahbereich um<br />
das künftige Flughafengelände begrenzt.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-11
2.2.2.2 Bauwerke im Grundwasser<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Das Baufeld in und um den Flughafen München ist durch geringe Grundwasserflurabstände<br />
gekennzeichnet. Bei höchsten Grundwasserständen,<br />
die bereichsweise, vor allem nördlich <strong>des</strong> Flughafens am Rand <strong>des</strong><br />
Wirkungsbereichs der Grundwasserregelung bis zur Geländeoberkante<br />
reichen, liegt der größte Teil der geplanten Bauwerke und Sparten im<br />
Grundwasser. Dadurch ergeben sich sowohl im Bauzustand als auch im<br />
Endzustand Auswirkungen auf den Grundwasserstrom, die von der Bauwerksgröße<br />
und der Einbindetiefe in das Grundwasser abhängen. Art und<br />
Umfang dieser Auswirkungen wurden mittels hydrogeologischer Berechnungen<br />
quantifiziert. Wenn bei den Auswirkungen absehbar ein vertretbares<br />
Maß überschritten würde, werden technische Ausgleichsmaßnahmen<br />
(z.B. Grundwasserüberleitung) vorgesehen. Wie im Bestand ist dies bei<br />
besonders großen Bauwerken im Grundwasser, wie z. B. bei Tunnelbauwerken<br />
und Rollbrücken etc. der Fall.<br />
2.2.3 Sparten und wasserwirtschaftliche Maßnahmen<br />
2.2.3.1 Entwässerung<br />
Die auf den geplanten Erweiterungsflächen <strong>des</strong> Flughafens München<br />
anfallenden Oberflächen- und Schmutzwässer werden über ein neu zu<br />
erstellen<strong>des</strong> Entwässerungssystem ordnungsgemäß gesammelt, abgeleitet<br />
und abhängig von ihrer Belastung umweltverträglich behandelt. Das<br />
Entwässerungssystem sieht für die Erweiterungsflächen ein Trennsystem<br />
vor. Das anfallende Schmutzwasser wird zusammen mit der Restentleerung<br />
der geplanten Regenklärbecken und dem Enteisungsabwasser in der<br />
Kläranlage Eitting, die über ausreichende Kapazitäten verfügt, mechanisch-biologisch<br />
gereinigt.<br />
Im Prinzip wird das bestehende System der Entwässerung auch für die<br />
Kapazitätserweiterung fortentwickelt. Hinsichtlich der Belastung <strong>des</strong> Oberflächenabflusses<br />
aus Niederschlägen muss im Bereich der Flugbetriebsflächen<br />
zwischen dem Sommerbetrieb mit weniger belastetem Abfluss<br />
(Belastungen aus Regenwasserinhaltsstoffen und Belastungsbeiträge von<br />
versiegelten Flächen) und dem Winterbetrieb mit infolge <strong>des</strong> Einsatzes<br />
von chemischen Flächen- und Flugzeugenteisungsmitteln belastetem<br />
Abfluss unterschieden werden.<br />
Unbelastetes Niederschlagswasser wird generell versickert. Das Niederschlagswasser<br />
von der 3. S/L-Bahn, den Schnellabrollwegen und Rollwegen<br />
wird im Sommerbetrieb über die Gelän<strong>des</strong>chulter und Mulden versickert.<br />
Die Versickerung über die belebte Bodenzone der Gelän<strong>des</strong>chulter<br />
und in den Mulden bewirkt eine Reinigung <strong>des</strong> Wassers. Die Versickerung<br />
<strong>des</strong> unbelasteten Niederschlagsabflusses von den Dachflächen der<br />
Feuerwache erfolgt in angrenzenden Geländemulden über die belebte<br />
Bodenzone.<br />
Im Winterbetrieb werden wegen <strong>des</strong> dann erfolgenden Einsatzes von Enteisungsmitteln<br />
die von den Rollwegen abfließenden Enteisungsabwässer<br />
über ein "Abbau-System-Gelände" (ASG) geleitet, dabei biologisch<br />
2-12 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
behandelt und dann im Anschluss an das ASG im anstehenden Boden<br />
versickert. Das Abbausystem im Gelände (ASG) ist ein für den Flughafen<br />
München entwickeltes Reinigungssystem für Enteisungsmittel entlang der<br />
Rollwege, das sich im bestehenden Flughafen bewährt hat und daher<br />
auch für die Flughafen-Erweiterung entlang der Rollwege zum Einsatz<br />
kommen soll.<br />
Im Winterbetrieb kann der Oberflächenabfluss von den Flugbetriebsflächen<br />
mit chemischen Flächen- und Flugzeugenteisungsmitteln belastet<br />
sein und bedarf daher in der Regel einer zusätzlichen Behandlung. Der<br />
über spezielle Sammelsysteme erfasste Abfluss der Start- und Landebahnen,<br />
Schnellabrollwege und Vorfelder wird in einem Enteisungsabwasserbecken<br />
zwischengespeichert und anschließend fracht- bzw. mengenabhängig<br />
der Kläranlage Eitting zugeführt.<br />
Der im Bereich der Vorfelderweiterung Ost und der Allgemeinen Luftfahrt<br />
anfallende Niederschlagsabfluss wird über die geplante Regenwasserkanalisation<br />
mit Regenwasserbehandlung im Regenklärbecken gereinigt<br />
und gedrosselt in den Vorflutgraben Nord ausgeleitet. Bei Starkregenereignissen<br />
kann ein zusätzlicher Rückhalt in den geplanten Regenrückhaltebecken<br />
erfolgen.<br />
2.2.3.2 Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong><br />
Beim Ausbau <strong>des</strong> Flughafens müssen zahlreiche Sparten wie Gasleitungen,<br />
Stromkabel als Freileitungen und erdverlegte Leitungen, Trinkwasser-<br />
und Schmutzwasserleitungen sowie Telekommunikationsleitungen<br />
verlegt bzw. neu verlegt werden.<br />
2.2.4 Geländeaufschüttungen<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> geplanten Ausbauvorhabens sind umfangreiche Baumaßnahmen<br />
mit teilweise erheblichen Eingriffen in den Untergrund erforderlich.<br />
Unter anderem wird der Abtrag großer Mengen an Oberboden,<br />
schluffigen Decklagen, Torf und ähnlichen Böden notwendig, die aufgrund<br />
ihrer bodenmechanischen Eigenschaften beim Ausbau <strong>des</strong> Flughafens<br />
nicht wieder verwendet werden können (s. Geotechnische Begutachtung,<br />
Zentrum für Geotechnik, TU München, 2007).<br />
Diese Böden weisen geogen bedingte Arsengehalte auf, die teilweise die<br />
Prüf- und Maßnahmewerte der Bun<strong>des</strong>bodenschutzverordnung überschreiten<br />
(Boden- und Rohstoffmanagement, R & H Umwelt GmbH,<br />
Nürnberg / emc, Erfurt, 2007).<br />
Ein Teil <strong>des</strong> beim Ausbau anfallenden Bodenmaterials wird in Randbereichen<br />
<strong>des</strong> Flughafens in Geländeaufschüttungen und Abschirmungswällen<br />
geeignet abgelagert, so dass sich keine Auswirkungen auf Schutzgüter<br />
wie Boden und Grundwasser ergeben. Entscheidend hierfür ist, dass das<br />
Bodenmaterial bei den Aufschüttungen nur geringmächtig auf anstehende<br />
Böden abgelagert wird (bis 0,5 m), dass im abgelagerten Bodenmaterial<br />
keine reduzierenden Verhältnisse entstehen können, die zur Freisetzung<br />
von Arsen führen.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-13
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Bei den höheren Aufschüttungen wird der anstehende Boden abgetragen<br />
und das aufzuschüttende Bodenmaterial lagenweise verdichtet eingebaut,<br />
so dass eine Infiltration von Niederschlagswasser und damit der Austrag<br />
von möglicherweise freigesetztem Arsen in das Grundwasser verhindert<br />
wird. Anschließend wird die Aufschüttung mit einer Rekultivierungsschicht<br />
von ca. 0,5 m Mächtigkeit abgedeckt. Um unerwünschte Effekte durch<br />
einen ungeregelten Ablauf von Niederschlagswasser zu vermeiden, sind<br />
Maßnahmen zur Entwässerung der Aufschüttungen vorgesehen.<br />
Die geplanten Entwässerungsmaßnahmen werden so konzipiert, dass<br />
eine Ableitung <strong>des</strong> Wassers über die Geländeoberfläche zum Rand der<br />
Aufschüttungen erfolgt. Dort wird es über ausreichend dimensionierte Versickerungsmulden<br />
in den Untergrund eingeleitet. Bei sehr hohen Niederschlägen<br />
kann, zusätzlich zur Versickerung über die Mulden, eine Einleitung<br />
von geringen Wassermengen in nahegelegene Vorfluter erfolgen.<br />
Weiterhin ist eine Verlegung einer Dränagematte zwischen dem verdichteten<br />
Bodenmaterial der Aufschüttung und der Rekultivierungsschicht vorgesehen,<br />
damit eine sichere Fassung <strong>des</strong> durch die Rekultivierungsschicht<br />
sickernden Wassers ermöglicht wird. Diese Dränagematten leiten das<br />
Wasser ebenfalls in die Versickerungsmulden am Rand der Aufschüttungen<br />
ab.<br />
Folgende Aufschüttungen mit Bodenmaterial im Gelände, für Wälle und<br />
Hügel sind geplant (mit Höhenangaben: minimale und maximale Höhe<br />
aller Teilflächen).<br />
> Abschirmungswälle bei Hallbergmoos (7,1 bis 12,6 m)<br />
> Erweiterung Aussichtshügel Attaching Süd (bis 19 m)<br />
> Geländeaufschüttungen Attaching Ost (0,4 bis 2,5 m)<br />
> Geländeaufschüttungen am Knoten Ost (1,5 bis 5,5 m)<br />
> Sichtschutzwall südlich der verlegten St 2084 (neu) (2 bis 3 m)<br />
> Geländeaufschüttungen in der Randzone Ost (0,4 bis 6,3 m)<br />
> Geländeaufschüttungen zwischen den Bahnen (bis 0,5 m)<br />
> Abschirmungswälle Attaching Süd und Ost (8,3 bis 12,6 m)<br />
2.3 Folgemaßnahmen<br />
2.3.1 Gewässerneuordnung<br />
Die Gewässerneuordnung umfasst folgende Maßnahmen zu Gewässerausbau<br />
und -verlegung.<br />
> Verlegung Abfanggraben Ost.<br />
> Neubau Ableitungsgraben Nord.<br />
> Verlängerung Verrohrung Nord.<br />
2-14 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> Verlegung Goldach.<br />
2.3.2 Landseitige Straßen und Wege<br />
> Verlegung St 2084 (inklusive eines Provisoriums zur Umgehung der<br />
Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen und inklusive<br />
der Rollbrücken Y1 bis Y4 und ihrer Grundwasserwannen).<br />
> Neubau Südring (inklusive eines Provisoriums zur Umgehung der<br />
Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen S9 und S10).<br />
> Verlegung und zweibahniger Ausbau St 2584 (Erdinger Allee) mit den<br />
Rollbrückenpaaren N5 und N6, N7 und N8, sowie N9 und N10<br />
(inklusive der Grundwasserwannen sowie eines Provisoriums zur<br />
Umgehung der Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen<br />
N5 bis N10).<br />
> Verlegung der Kreisstraße ED 5.<br />
> Sonstige Straßen und Wege (Gemeindeverbindungsstraße Attaching<br />
(Dorfstraße)), öffentliche Feld und Waldwege, Feuerwehrzufahrten und<br />
Zufahrten zu betrieblichen Einrichtungen außerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong>,<br />
Radwege.<br />
2.4 Boden- und Rohstoffmanagement<br />
2.4.1 Übersicht<br />
Die hohen Grundwasserstände, der spezifische Bodenaufbau und die<br />
geologischen Verhältnisse im Planungsbereich bestimmen die grundbautechnischen<br />
Anforderungen und erfordern ein umfangreiches Boden- und<br />
Rohstoffmanagement. Rund 4,3 Mio. m³ <strong>des</strong> gewachsenen Bodens müssen<br />
abgetragen bzw. umgelagert werden. Je nach Qualität soll der Boden<br />
zur Wiederandeckung, zur Wiederverfüllung der Seitenentnahmen, für<br />
Schutzmaßnahmen und zur Geländemodellierung verwendet werden. Ziel<br />
ist es, den abgetragenen Boden weitgehend auf dem Flughafengelände<br />
bzw. für die mit dem Vorhaben zusammenhängenden Maßnahmen zu<br />
verwenden. Der Rohstoffbedarf kann zu einem Teil durch Seitenentnahmen<br />
und Aushub von Baugruben gedeckt werden. Der verbleibende Anteil<br />
an Kiesen und Zuschlagsstoffen muss angeliefert werden. Für die Kieslieferungen<br />
kommen Nass- und Trockenabbaue in Frage.<br />
2.4.2 Gesamtrohstoffbedarf<br />
Bei Realisierung der Baumaßnahme besteht ein Gesamtbedarf an<br />
entsprechenden Rohstoffen von insgesamt 6,4 Mio. m³ (s. Boden- und<br />
Rohstoffmanagement – R & H Umwelt GmbH, Nürnberg / emc, Erfurt / TU<br />
München, Zentrum Geotechnik, 2007). Bei Einbeziehung <strong>des</strong> gesamten<br />
Oberbaus für befestigte Flächen (z.B. Beton, Asphalt, Tragschichten)<br />
erhöht sich das bilanzierte Rohstoffvolumen auf 8,2 Mio. m³.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-15
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Verwendung von Material aus dem großräumigen Erdbau<br />
Die anfallenden Bodenmaterialien aus dem großräumigen Erdbau werden<br />
beim Bau von Böschungen an Gewässern und Straßen, für Gewässerdeiche<br />
und -böschungen, für Abschirmungswälle sowie für Geländeaufschüttungen,<br />
Wiederverfüllung von Seitenentnahmen und Wiederandeckung<br />
innerhalb <strong>des</strong> Flughafenzauns eingesetzt. Dadurch kann das anfallende<br />
Bodenmaterial überwiegend vor Ort wiederverwendet werden. Lediglich<br />
ein kleiner Teil <strong>des</strong> geogen bedingt arsenhaltigen Bodenmaterials wird<br />
extern entsorgt.<br />
2.4.3 Kiesgewinnung aus Seitenentnahmen<br />
Aufgrund der topografischen und hydrogeologischen Gegebenheiten ist<br />
ein Massenausgleich unmittelbar innerhalb <strong>des</strong> Baufelds der geplanten<br />
Maßnahmen nicht möglich. Der Bedarf an Schüttmaterial für die Flugbetriebsflächen<br />
(vornehmlich Kies) liegt erheblich über der Menge der dafür<br />
geeigneten Erdstoffe, die im Zuge der Erdbaumaßnahmen anfallen.<br />
Ein wesentlicher Anteil der notwendigen Aufschüttvolumina kann vor Ort<br />
über Seitenentnahmen auf der <strong>Vorhabens</strong>fläche im Bereich der geplanten<br />
3. S/L-Bahn gewonnen werden. Dazu soll tragfähiger Kies aus künftig<br />
nicht überbauten Bereichen gewonnen werden. Gleichzeitig werden<br />
zusätzliche Materialtransporte vermieden und Rohstoffressourcen in der<br />
Region um den Flughafen geschont.<br />
Die Seitenentnahmen sind zwischen der 3. S/L-Bahn und dem Flughafenzaun<br />
vorgesehen. Sie liegen somit im Wirkungsbereich der Grundwasserregelung.<br />
Die Seitenentnahmen sind in Einzelabschnitte eingeteilt,<br />
zwischen denen der vorhandene geologische Untergrund erhalten bleibt.<br />
In diesen Lücken zwischen den verfüllten Seitenentnahmen ist ein ungehindertes<br />
Abströmen <strong>des</strong> Grundwassers möglich.<br />
Die Entnahmeorte werden, unter anderem wegen der Gefahr der Bildung<br />
von offenen Wasserflächen, die relevant für die biologische Flugsicherheit<br />
aufgrund von Vogelschlag sein können, wieder verfüllt. Begrenzender<br />
Faktor ist dabei das zur Verfügung stehende geeignete Verfüllmaterial.<br />
Für die Verfüllung steht geeignetes Bodenmaterial in einer Menge von<br />
rund 0,71 Mio. m 3 zur Verfügung. In dieser Größenordnung kann auch die<br />
Auskiesung erfolgen. Bei der Verfüllung der Seitenentnahmen wird<br />
besonders auf die Qualität <strong>des</strong> zu verfüllenden Materials geachtet. Die<br />
geltenden Anforderungen zum Schutz <strong>des</strong> Grundwassers werden eingehalten.<br />
2.4.4 Materialzulieferung<br />
Es besteht ein Gesamtbedarf an mineralischen Rohstoffen (Sande, Kies,<br />
Bindemittel, sonstige Zuschlagsstoffe) bei den geplanten Maßnahmen von<br />
rund 4,7 Mio. m³, die zugeliefert werden müssen (s. Boden- und Rohstoffmanagement<br />
– R & H, Nürnberg/ emc, Erfurt/ TU München, Zentrum<br />
Geotechnik, 2007). Davon sind rund 2,9 Mio. m³ mineralische Rohstoffe<br />
(überwiegend Kies), die von außen herantransportiert werden müssen.<br />
2-16 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
2.5 Baubetrieb<br />
2.5.1 Baulogistikkonzept<br />
Im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen wurde zur Bauablaufplanung<br />
der gesamten Bauzeit ein baulogistisches Konzept erstellt<br />
(Baulogistikkonzept, Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007).<br />
Im Baulogistikkonzept werden die inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben für<br />
den Bauablauf erstellt (im wesentlichen die Ermittlung der transportrelevanten<br />
Einbau- und Ausbaumassen, die Anzahl von Transporten und<br />
<strong>des</strong> eingesetzten Baugeräts, Darstellung <strong>des</strong> voraussichtlichen Bauablaufes<br />
sowie baubetrieblicher Aspekte). Weiter sind Angaben zur Vermeidung<br />
und Minimierung von nachteiligen Auswirkungen durch den<br />
Baubetrieb enthalten.<br />
2.5.2 Phasen der Baumaßnahmen<br />
Im Rahmen eines Grobterminplanes (s. Baulogistikkonzept) werden die<br />
Baumaßnahmen folgendermaßen unterteilt.<br />
> Vorabmaßnahmen<br />
> 1. Investmaßnahme<br />
> 2. Investmaßnahme<br />
> 3. Investmaßnahme<br />
Während sich die Vorabmaßnahmen und die 1. Investmaßnahme zeitlich<br />
überlagern, werden die folgenden Abschnitte der 2. Investmaßnahme und<br />
3. Investmaßnahme zeitlich voraussichtlich unabhängig voneinander angeordnet.<br />
2.5.2.1 Vorabmaßnahmen<br />
Hierunter fallen alle Maßnahmen, die vorbereitenden Charakter haben. Im<br />
Einzelnen sind zu nennen.<br />
Straßenverkehrsanlagen<br />
> Verlegung St 2084 (inklusive einem Provisorium zur Umgehung der<br />
Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen und inklusive<br />
der Rollbrücken Y1 bis Y4 und ihre Grundwasserwannen).<br />
> Neubau Südring (inklusive einem Provisorium zur Umgehung der<br />
Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen S9 und S10).<br />
> Verlegung St 2584 (Erdinger Allee) mit den Rollbrückenpaaren N5 und<br />
N6, N7 und N8, sowie N9 und N10 (inklusive der Grundwasserwannen<br />
sowie einem Provisorium zur Umgehung der Baumaßnahmen Rollbrücken<br />
und Grundwasserwannen N5 bis N10).<br />
> Verlegung ED 5.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-17
Neuordnung der Gewässer und Entwässerungssysteme<br />
> Verlegung Abfanggraben Ost.<br />
> Neubau Ableitungsgraben Nord.<br />
> Verlängerung Verrohrung Nord.<br />
> Verlegung Goldach.<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Grundwasserregelung im Bereich der 3. Start- und Landebahn.<br />
Grundwasserversickerung für die 3. Start- und Landebahn.<br />
Verlegung <strong>des</strong> Enteisungsabwasserbeckens (Schmelzwasserbecken).<br />
Umverlegung und Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen<br />
außerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong> (Sparten)<br />
Dies betrifft Erdgasleitungen, Stromkabel als Freileitungen und erdverlegte<br />
Leitungen, Telekommunikationsleitungen sowie Trinkwasser- und<br />
Schmutzwasserleitungen.<br />
2.5.2.2 1. Investmaßnahme<br />
Die 1. Investmaßnahme umfasst den Neubau <strong>des</strong> kompletten 3. Start- und<br />
Landebahnsystems und <strong>des</strong> Rollwegsystems mit den Anbindungen den<br />
Bestand. Darüber hinaus wird eine Rollwegverbindung zwischen den<br />
bestehenden Vorfeldern 2 und 3 sowie der Rollweganbindung 3. Start-<br />
und Landebahn über ein während der Vorabmaßnahmen gebautes<br />
Rollbrückenpaar erstellt (Rollkorridor OW). Dieser Bereich bindet auch<br />
über zwei weitere Rollbrückenpaare (ebenfalls während der Vorabmaßnahmen<br />
gebaut) an das bestehende parallele Rollwegsystem der heutigen<br />
Nordbahn an.<br />
Ferner wird ein zweites Enteisungsabwasserbecken gebaut.<br />
Das aus den Bauwerken 3. Start- und Landebahn, sowie dem Rollkorridor<br />
Nord anfallenden Bodenmaterial wird zu den geplanten Abschirmungswällen<br />
Attaching und Hallbergmoos, zum Sichtschutzwall St 2084<br />
neu, zu den verschiedenen Geländeaufschüttungen am Knoten Ost und in<br />
der Randzone Ost, der Geländeaufschüttung in der Randzone Ost, sowie<br />
zur Erweiterung <strong>des</strong> Aussichtshügels Attaching-Süd transportiert und<br />
eingebaut.<br />
2.5.2.3 2. Investmaßnahme<br />
Die Baumaßnahmen der 2. Investmaßnahme konzentrieren sich auf den<br />
Bereich <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> 4. Wesentliche Gewerke sind hier:<br />
> Tunnelbauwerke unter Vorfeld 4 (S-Bahntunnel, Gepäck- und Versorgungstunnel,<br />
sowie ein Tunnel für das Personentransportsystem)<br />
zwischen dem Fracht- und Gepäckzwischenlager und dem späteren<br />
Satellit B 1.<br />
2-18 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Regenwasser, Schmutzwasser,<br />
Löschwasser, Trinkwasser, Flugbetriebsstoffversorgung, Kabeltrassen).<br />
> Deckenbau Vorfeld 4, sowie Rollbrücke S9 inklusive Grundwasserwanne.<br />
2.5.2.4 3. Investmaßnahme<br />
Analog zu den Baumaßnahmen der 2. Investmaßnahme konzentrieren<br />
sich die Gewerke dieses Bauabschnitts auf den Bereich <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> 5.<br />
Die wesentlichen Gewerke sind hier:<br />
> Tunnelbauwerke unter Vorfeld 5 (S-Bahntunnel, Gepäck- und Versorgungstunnel,<br />
sowie ein Tunnel für das Personentransportsystem)<br />
zwischen dem Satellit B und der östlichsten Vorfeldpositionen.<br />
> Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Regenwasser, Schmutzwasser,<br />
Löschwasser, Trinkwasser, Flugbetriebsstoffversorgung, Kabeltrassen).<br />
> Deckenbau Vorfeld 5, sowie Rollbrücke S10 inklusive Grundwasserwanne.<br />
2.5.3 Festlegungen zum Bauablauf<br />
2.5.3.1 Baustelleneinrichtungsflächen<br />
Vorabmaßnahmen<br />
Da sich die einzelnen Baustellen verteilt um den Flughafen München<br />
befinden, zudem die meisten Maßnahmen Linienbaustellen (die S/L-Bahn,<br />
Straßen, Gewässer und Leitungstrassen sind linienförmig) darstellen, wird<br />
auf eine zentrale Baustelleneinrichtung (BE) verzichtet. Die jeweiligen<br />
bauzeitlich benötigten Flächen sind im Plan der Vorabmaßnahmen im<br />
Baulogistikkonzept dargestellt.<br />
Die einzelnen Baustelleneinrichtungsflächen werden an ein Fernmelde-<br />
und Baustromnetz angebunden. Die sonstige Ver- und Entsorgung (Trinkwasser,<br />
Abwasser sowie Gas für Beheizung) wird dezentral bei der jeweiligen<br />
Baustelleneinrichtungsfläche gemäß der Arbeitsstättenverordnung,<br />
<strong>des</strong> Wasserhaushaltsgesetzes, sowie <strong>des</strong> Abwasserbeseitigungsgesetzes<br />
angeordnet.<br />
Zusätzliche Betankungsanlagen für die Baustellengeräte sind ebenfalls<br />
dezentral auf den jeweiligen Baustelleneinrichtungsflächen angeordnet.<br />
Aufgrund <strong>des</strong> reduzierten Flächenbedarfs der einzelnen Baustelleneinrichtungsflächen<br />
versickert das in geringem Umfang anfallende Oberflächenwasser<br />
vor Ort und es kann auf Oberflächenversickerungsanlagen<br />
verzichtet werden.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-19
1. Investmaßnahme<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Alle Anlagen auf den Baustelleneinrichtungsflächen werden temporär an<br />
ein Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsnetz sowie an ein<br />
Baustromnetz angebunden. Die Gasversorgung sowie die Betankung für<br />
Baugeräte erfolgt auf diesen Flächen dezentral, dass heißt von den<br />
Unternehmern individuell. Um der erhöhten Flächenversiegelung in<br />
diesem Bereich Rechnung zu tragen, werden für die Ableitung <strong>des</strong><br />
Oberflächenwassers Rohrnetze sowie entsprechende Versickerungsanlagen<br />
vorgesehen.<br />
Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt über eine bewachte<br />
Toranlage, die an den geschlossenen Bauzaun um das Baufeld S/L Bahn<br />
anschließt. Die Bereiche hinter der Toranlage (dass heißt innerhalb <strong>des</strong><br />
Baufel<strong>des</strong>) bieten ausreichend Raum für Reifenwaschanlagen sowie<br />
Abstreifstrecken, die eine Verschmutzung der öffentlichen Straßen vermeiden.<br />
Insbesondere diese Flächen sind regelmäßig mit Hochdruckreinigungsgeräten<br />
sowie Kehrfahrzeugen sauber zu halten. Die Baustraßen<br />
im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche werden in einem<br />
bituminösen Aufbau erstellt oder gegebenenfalls mit Bitumenfräsgut<br />
befestigt.<br />
Mit der Fertigstellung der zu verlegenden St 2084 endet ein Großteil der<br />
Vorabmaßnahmen. Die Zufahrt zum Baustellengelände 3. S/L Bahn erfolgt<br />
nun über die verlegte St 2084 (neu). Die westliche Lage <strong>des</strong> Baustellentores<br />
und die zusätzlichen Abbiegespuren, sowie die angeordneten LKW<br />
Speicher vermeiden Rückstauungen in das öffentliche Straßennetz. Die<br />
Baustelleneinrichtungsfläche Baufeld S/L Bahn wird rund 120.000 m²<br />
Fläche benötigen. Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche <strong>des</strong> Baufel<strong>des</strong><br />
S/L Bahn wird im endgültigen Zustand das Vorfeld der Allgemeinen<br />
Luftfahrt, sowie eine Schneedeponie liegen. Mit dem Herrichten dieser<br />
Flächen als Baustelleneinrichtungsfläche kann vorab der Untergrund für<br />
die letztendliche Nutzung geschaffen und damit Mehraufwendungen vermieden<br />
werden.<br />
Die Baustelleneinrichtungsfläche für den Bauabschnitt 1 Rollkorridor Nord<br />
im Zentralbereich wird vom an- und abfahrenden Verkehr über die<br />
> Autobahn A 92 bis zur Anschlussstelle Erding (9),<br />
> St 2580 (FTO) und<br />
> Provisorium Südring bis Abzweig St 2584 (alte Erdinger Allee)<br />
erschlossen.<br />
Für die Baustelleneinrichtungsfläche werden rund 85.000 m² vorgesehen.<br />
Analog zu den BE der S/L Bahn liegen die BE der Baumaßnahmen im<br />
Vorfeldbereich über Flächen, die zu einem späteren Zeitpunkt als Bodenverkehrsflächen<br />
dienen. Somit kann auch hier vorab der Untergrund entsprechend<br />
der späteren Nutzung erstellt werden.<br />
2-20 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
2. Investmaßnahme<br />
Es werden in dieser Phase nur Baustelleneinrichtungsflächen im Vorfeldbereich<br />
vorgesehen. Die Baustelleneinrichtungsflächen werden wie schon<br />
während der 1. Investmaßnahme über den Knoten A der St 2584 (Erdinger<br />
Allee) angebunden.<br />
3. Investmaßnahme<br />
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden wie schon während der 1. und<br />
2 Investmaßnahme über den Knoten A der St 2584 (Erdinger Allee) angebunden.<br />
Die Standorte der Baustelleneinrichtungsflächen verschieben sich<br />
analog zum Baufortschritt der vorhergehenden Investmaßnahmen nach<br />
Osten.<br />
2.5.3.2 Massen und Volumen der Baumaßnahmen<br />
Aus den im Grobterminplan <strong>des</strong> Baulogistikkonzeptes enthaltenen Vorabmaßnahmen<br />
werden folgende Volumina ermittelt. Die großvolumigen<br />
Geländeaufschüttungen sowie Abschirmungswälle sind gesondert berücksichtigt.<br />
Tabelle 2-1 Transportvolumina<br />
Antransporte [Mio. m 3 ] Abtransporte [Mio. m 3 ] Direkte Verwendung [Mio. m 3 ]*<br />
Vorabmaßnahmen<br />
1,31<br />
1. Investmaßnahme<br />
1,21 0,62<br />
4,73<br />
2. Investmaßnahme<br />
3,02 2,84<br />
0,83<br />
3. Investmaßnahme<br />
0,28 0,22<br />
1,27 0,44 0,36<br />
Abschirmungswälle, Sichtschutzwälle, Geländeaufschüttungen<br />
2,70 - 2,70<br />
Sonstige Andeckungen, Aufschüttungen und Verfüllungen<br />
1,64 - 1,64<br />
*Direkte Verwendung von Abtransporten in Geländeaufschüttungen, Wällen, Deichbauwerken und<br />
Böschungen an Gewässern.<br />
Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ergeben sich Restmassen von<br />
ca. 4,3 Mio. m 3 Erdmaterial, das für die geplanten Aussichtshügel, Abschirmungswälle<br />
(insgesamt ca. 2,7 Mio. m 3 ) und für sonstige Andeckungen,<br />
Aufschüttungen und Verfüllungen (ca. 1,6 Mio. m 3 ) verwendet wird.<br />
2.5.3.3 Transportfahrzeuge<br />
Die einzelnen Transporte werden nach ihrem Transportgut und der Transportstrecke<br />
(öffentlicher Bereich oder Baustellenverkehr) unterschieden.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-21
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Hieraus ergeben sich unterschiedliche Transportvolumen und damit unterschiedliche<br />
Transportmengen (Beispiele für einzusetzende Fahrzeuge und<br />
Nutzlasten bzw. -volumina s. Abschnitt 2.4 Baulogistikkonzept).<br />
Neben dem Einsatz von besonders lärmgedämmter und abgasreduzierter<br />
Motorentechnologie sind zur Vermeidung beziehungsweise zur Verringerung<br />
der durch die Bautätigkeit und vor allem durch den Bauverkehr<br />
erzeugten Immissionen in den nachfolgenden Zulassungsverfahren geeignete<br />
Minimierungsmaßnahmen (z.B. durch zeitliche und örtliche Beschränkungen<br />
beziehungsweise geeignete Verfahrenstechnik) festzulegen.<br />
Umweltfreundlichere Alternativen zum Transport für den großräumigen<br />
Erdbau über Fahrzeuge z.B. Form von Förderbändern wurden geprüft.<br />
Lösungsansätze mit Transportförderbändern wurden allerdings als nicht<br />
zielführend eingeschätzt, da zahlreiche Zwischenlagerstätten an unterschiedlichen<br />
Orten und Zeitpunkten angedient bzw. wieder aufgelöst<br />
werden und die unterschiedlichen Aufschüttungen sowie Abschirmungswälle<br />
nicht kontinuierlich während einer definierten Zeitspanne aufgeschüttet<br />
werden. Durch ein Netz verschiedener Transportförderbänder<br />
würde zudem der Baustellenverkehr anderer Gewerke wesentlich behindert<br />
(Baulogistikkonzept, Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007).<br />
2.5.3.4 Anlieferrouten für Transportfahrten<br />
Um zusätzliche Belastungen in Wohngebieten zu vermeiden, sollen alle<br />
Anlieferungen so weit wie möglich über die Autobahn A 92, die Anschlussstelle<br />
Erding (9) und die St 2580 (FTO) erfolgen. Je nach Bauabschnitt<br />
unterscheiden sich dann die letzten Strecken zu den jeweiligen Baustellentoren<br />
bzw. Baustellen.<br />
Resultierend aus der günstigen Infrastrukturanbindung (A92) und auch<br />
gestützt auf die geographische Lage möglicher Kiesabbaugebiete im<br />
Bereich um den Flughafen München wird für die Transportwege von<br />
folgender Situation der Verteilung der Anlieferrouten ausgegangen.<br />
> FTO von Süden kommend: 30%.<br />
> FTO von Norden kommend: 60%.<br />
> Über Flughafen München von Westen kommend: 10%.<br />
2.5.3.5 Transporte und Fahrten<br />
Zur Berechnung der notwendigen Transporte auf und zu den Baustellen<br />
für die einzelnen Maßnahmen wurde im Baulogistikkonzept für jede<br />
Baumaßnahme von einem durchschnittlichen Arbeitstag von 10 Stunden<br />
ausgegangen, dass heißt in der Regel von 07.00 h bis 17.00 h. Es wird<br />
unterschieden in Transport und Fahrt, wobei ein Transport aus zwei<br />
Fahrten (hin und zurück) besteht. Jede massenrelevante Maßnahme<br />
wurde gesondert betrachtet. Die ermittelten Fahrten wurden in das im<br />
Grobterminplan definierte Zeitschema eingearbeitet und für die einzelnen<br />
Bauabschnitte zusammengefasst. Vor allem bei den Vorabmaßnahmen<br />
2-22 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
werden soweit möglich die noch nicht rückgebauten bestehenden Straßen<br />
(z.B. St 2084 alt) genutzt.<br />
Um einen großen Teil der Transporte innerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong><br />
abzuwickeln und damit die öffentlichen Straßen zu entlasten, ist vorgesehen,<br />
bedarfsweise Betriebsstraßen zur Aufnahme <strong>des</strong> Schwerverkehrs<br />
mit einer verstärkten und verbreiterten Schwarzdecke zu ertüchtigen.<br />
2.5.3.6 Baumaschineneinsatz<br />
Neben der Ermittlung der notwendigen Transporte wird für die geplanten<br />
Maßnahmen der jeweilige Baumaschineneinsatz und der entsprechende<br />
Einsatzzeitraum für die Ermittlung der Lärm- und Abgasemission abgeschätzt.<br />
2.5.3.7 Zwischenlagerstätten<br />
Die Lagen der Zwischenlagerstätten wurden aufgrund der Baustellenstandorte<br />
und der zu Verfügung stehenden Flächen gewählt, sowie hinsichtlich<br />
einer Transportminimierung und ihrer Aufnahmekapazität optimiert.<br />
So wurden alle Zwischenlagerstätten in der Nähe ihrer Quellen und<br />
Zielströme positioniert.<br />
Folgende Lagen und eingebrachte Materialien der Zwischenlager wurden<br />
ausgewählt.<br />
> ZL1 Im Bereich Satellit B1 (Baukiese, d.h. Kiese mit unterschiedlicher<br />
Körnung, die für die Herstellung <strong>des</strong> Grobplanums geeignet sind).<br />
> ZL2 Im Bereich Regenrückhaltebecken (RRB) westlich <strong>des</strong> Abfanggrabens<br />
Ost (Bodenmaterial für Dammbau Abfanggraben Ost).<br />
> ZL3 Im Bereich Südost-Kante Ramp 5 (Baukiese, d.h. Kiese mit<br />
unterschiedlicher Körnung, die z.B. für die Herstellung <strong>des</strong><br />
Grobplanums geeignet sind).<br />
> ZL4 Im Bereich östlich <strong>des</strong> Ableitungsgrabens Nord (Bodenmaterial,<br />
das für die Andeckung im Bereich S/L Bahn verwendet wird).<br />
> ZL5 Mittig im Bereich südlich <strong>des</strong> Abfanggrabens Nord (Bodenmaterial<br />
für Dammbau Abfanggraben Nord).<br />
> ZL6 Im Bereich der BE für S/L Bahn (einbaufähiger Boden, d.h. Kiese<br />
mit unterschiedlicher Körnung, die für die Herstellung <strong>des</strong> Grobplanums<br />
geeignet sind).<br />
> ZL7 Im Bereich westlich von ZL5 (Baukiese, d.h. Kiese mit<br />
unterschiedlicher Körnung, die für die Andeckung im Bereich S/L Bahn<br />
verwendet wird).<br />
Neben den oben genannten Zwischenlagerstätten werden insbesondere<br />
entlang der Straßenbaumaßnahmen und im Bereich der Seitenentnahmen<br />
kurzzeitig Lagerstätten für abgeräumtes Bodenmaterial vorgesehen.<br />
Dieses Bodenmaterial wird vor Ort wieder angedeckt.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-23
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Auf die ZL 4 und ZL 7 wird Bodenmaterial zwischengelagert, das geogen<br />
bedingt arsenhaltig ist. Diese Zwischenlager mit arsenhaltigem Bodenmaterial<br />
werden unmittelbar nach der Aufschüttung von Mieten mit Planen<br />
gegen eindringen<strong>des</strong> Niederschlagswasser geschützt.<br />
2.5.3.8 Bodenklassen auf Zwischenlagern, Aufschüttungen sowie<br />
Abschirmwällen<br />
Zur Klassifizierung der Eignung zur Aufschüttung, Ermittlung möglicher<br />
Staubemissionen und möglicher Vorbelastungen von Erdmaterialien werden<br />
im Baulogistikkonzept die in die Zwischenlager und Aufschüttungen<br />
sowie Abschirmungswälle eingebrachten Bodenvolumina nach unterschiedlichen<br />
Oberbodenklassen (gemäß Spezifizierung der Geotechnischen<br />
Begutachtung, Zentrum für Geotechnik, TU München, 2007) getrennt<br />
aufgeführt. Zusätzlich werden die Zeiträume der Zu- und Abgänge und die<br />
Einsatzzeiten entsprechender Baugeräte ermittelt.<br />
2.5.4 Minimierung von Luftschadstoffemissionen und der<br />
Staubentwicklung<br />
2.5.4.1 Grundsätzliche Maßnahmen<br />
Grundsätzliche Maßnahmen<br />
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind grundsätzlich vorzusehen.<br />
> Kein Abblasen von angefallenen Stäuben.<br />
> Staubbindung durch Feuchthalten <strong>des</strong> Materials.<br />
> Umschlagverfahren mit geringen Wurfhöhen.<br />
> Vollständige Einhausung von Förderbändern (z.B. Mischanlagen).<br />
Anforderungen Baugeräte<br />
Folgende Anforderungen an Geräte und Maschinen sind zu erfüllen.<br />
> Emissionsarme und gering Staub freisetzende Arbeitsgeräte vorsehen.<br />
> Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren sind - sofern möglich - mit<br />
Partikelfilter-Systemen auszustatten.<br />
> Auf Antriebe mit Zweitaktmotoren sollte vollständig verzichtet werden.<br />
> Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur mechanischen<br />
Bearbeitung von Baustoffen (z.B. Trennscheiben) sind staubmindernde<br />
Maßnahmen (z.B. Benetzen, Erfassen, Absaugen) zu<br />
treffen.<br />
> Optimierung der Maschinenlaufzeiten - Vermeidung von Leerlauf,<br />
Abschalten der Motoren der zum Be- und Entladen wartenden Fahrzeuge.<br />
2-24 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Anforderungen an thermische und chemische Arbeitsprozesse<br />
Bei thermischen Arbeitsprozessen auf Baustellen (Aufheizen (Belagsbau),<br />
Schneiden, heiß Beschichten, Schweißen, Sprengen) werden Gase und<br />
Rauche freigesetzt. Im Vordergrund stehen Maßnahmen bei der (heißen)<br />
Verarbeitung von Bitumen (Straßenbeläge, Abdichtungen, Heißverkleben)<br />
sowie bei Schweißarbeiten.<br />
> Keine thermische Aufarbeitung (z.B. hot-remix) von teerhaltigen Belägen/<br />
Materialien auf Baustellen.<br />
> Verwendung von Bitumen mit geringer Luftschadstoff-Emissionsrate<br />
(Rauchungsneigung).<br />
> Reduktion der Verarbeitungstemperatur durch geeignete Bindemittelwahl.<br />
> Verwenden von Gussasphalten und Heißbitumen mit geringer Rauchungsneigung.<br />
> Die Verarbeitungstemperaturen dürfen folgende Werte nicht überschreiten:<br />
> Gussasphalt maschineller Einbau: 220 °C<br />
> Gussasphalt Handeinbau: 240 °C<br />
> Heißbitumen: 190 °C<br />
> Einsatz von geschlossenen Heizkesseln mit Temperaturreglern.<br />
> Schweißarbeitsplätze sind so einzurichten, dass der Schweißrauch<br />
erfasst, abgesaugt und abgeschieden werden kann (z.B. mit Punktabsaugung).<br />
Allgemeine Anforderungen Baustellenbetrieb<br />
Weiterhin sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen.<br />
> Lagerung von Materialien im Baustellenbereich vermeiden.<br />
> Wenn dies nicht möglich ist, sollen Abwehungen von staubförmigen<br />
Material durch Abdeckung, Befeuchtung oder Abschirmung begrenzt<br />
und Liegezeiten im Freien so weit wie möglich verkürzt werden. Dies<br />
gilt auch für Erdaushub.<br />
> Einrichtung von Lkw-Radwaschanlagen an den Ausfahrten von Baustraßen<br />
bzw. Baustellenbereichen in den öffentlichen Verkehrsraum.<br />
> Auf unbefestigten Pisten sind Stäube z.B. mit Druckfass oder Wasserberieselungsanlage<br />
geeignet zu binden.<br />
> Regelmäßige Reinigung der Baustraßen mit wirksamen<br />
Kehrmaschinen (ohne Aufwirbelung) oder durch Nassreinigungsverfahren.<br />
> Umgehende Instandsetzung von beschädigten Straßenoberflächen.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-25
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> Beschränken der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Baupisten, d.<br />
h. auf Wegen, die nicht besonderen Maßnahmen zur Staubminderung<br />
unterliegen, auf 30 km /h.<br />
2.5.4.2 Vermeidung von Staubemissionen durch Befeuchtung beim<br />
technischen Erdbau und erforderliche Wasserentnahme<br />
Die Oberflächen aller Baustraßen sowie Zwischenlagerstätten von Oberboden,<br />
die nicht angesät werden (Zwischenlagerstätten die nur für kurze<br />
Zeit vorgesehen sind, wie zum Beispiel im Bereich der Seitenentnahmen),<br />
müssen in angemessener Weise mit mobilen Sprinklerfahrzeugen oder<br />
Sprinkleranlagen benetzt werden. Darüber hinaus sind alle Aufschüttungen<br />
sowie Abschirmungswälle während der Einbauphase angemessen<br />
feucht zu halten, um den gewünschten hohen Verdichtungsgrad zu erreichen,<br />
sowie Staubemissionen so gering wie möglich zu halten. Die eingebrachten<br />
Wassermengen wirken oberflächlich und verdunsten wieder, so<br />
dass kein Versickerungsvorgang stattfindet. Die eingesetzten Wasserbedarfsmengen<br />
richten sich im Wesentlichen nach den klimatischen<br />
Gegebenheiten.<br />
Die erforderlichen Wassermengen werden aus dezentralen Entnahmebrunnen<br />
entnommen und liegen im Bereich BE neue Nordbahn, nördlich<br />
Enteisungsabwasserbecken 1 (jeweils Vorabmaßnahmen und 1. Investmaßnahme),<br />
im Bereich Schwelle 09 (1. Investmaßnahme), sowie südöstliche<br />
Ecke <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> Ramp 5 (2. und 3. Investmaßnahme).<br />
Darüber hinaus sind Entnahmebrunnen und eine Entnahmestelle für die<br />
Abschirmungswälle und Aufschüttungen und deren angrenzende<br />
Baustraßen vorzusehen (Abschirmungswälle Hallbergmoos, Entnahme<br />
am Ludwigskanal (1. bis 3. Investmaßnahme) und Geländeaufschüttung<br />
am Knoten Ost, bzw. für Arbeiten im Bereich <strong>des</strong> Rollkorridors Nord,<br />
Ramp 4 und Ramp 5 (alle Investmaßnahmen). Die Entnahmestelle wird<br />
nahe dem Anschlussbauwerk zum Abfanggraben Ost angeordnet. Die<br />
vorgesehen Betriebsstraßen <strong>des</strong> Ableitungsgrabens Nord in diesem<br />
Bereich müssen nach den Erfordernissen für Anfahrt und Wasserentnahme<br />
ausgelegt werden.<br />
Die Oberflächengewässer dürfen hinsichtlich ihrer Abflussverhältnisse,<br />
Qualität und ihrer Ökologie nicht beeinträchtigt werden. Entsprechende<br />
Hinweise finden sich in UVS 11 Schutzgut Wasser (Abschnitt 11.2 Oberflächengewässer).<br />
Für die Berechnung <strong>des</strong> Wasserverbrauches werden im Wesentlichen die<br />
Verteilung der Baustellen im gesamten Maßnahmenbereich, sowie die<br />
Intensität der Erdbewegungen herangezogen. Analog zu den Bauflächen<br />
werden auch die Flächen für Zwischenlager und die Flächen für Baustraßen<br />
entsprechend reduziert. Damit wird auch keine Versickerung<br />
stattfinden, das Wasser wird weitgehend verdunsten.<br />
2-26 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Vorabmaßnahmen:<br />
> Entnahmebrunnen nördlich Enteisungsabwasserbecken 1: ein Fahrzeug<br />
mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich 16 m³<br />
Verbrauch pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen BE neue Nordbahn: ein Fahrzeug mit 10 m³ Wasser<br />
Fassungsvermögen und 16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen nahe Geländeaufschüttung am Knoten Ost: ein<br />
Fahrzeug mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />
16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
1. Investmaßnahme:<br />
> Entnahmebrunnen nördlich Enteisungsabwasserbecken 1: drei Fahrzeuge<br />
mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich je<br />
17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen Schwelle 27 neue Nordbahn: drei Fahrzeuge mit je<br />
10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich je 17 m³ Verbrauch<br />
pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen BE neue Nordbahn: zwei Fahrzeuge mit je 10 m³<br />
Wasser Fassungsvermögen und je rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Maximale durchschnittliche Entnahme am Entnahmebrunnen in der<br />
Nähe der Geländeaufschüttungen am Knoten Ost: drei Fahrzeuge mit<br />
10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich 15 m³ Verbrauch<br />
pro Stunde.<br />
> Maximale durchschnittliche Entnahme an der Entnahmestelle Hallbergmoos<br />
für Verdichtung der Abschirmungswälle: drei Fahrzeuge mit 10<br />
m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich 15 m³ Verbrauch<br />
pro Stunde.<br />
Zeitliche Überlappung von Vorab- und 1. Investmaßnahme<br />
> Entnahmebrunnen nördlich <strong>des</strong> Enteisungsabwasserbeckens 1: vier<br />
Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />
je rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen Schwelle 27 neue Nordbahn: vier Fahrzeuge mit je<br />
10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich rund 17 m³ pro<br />
Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen Baustelleneinrichtungsfläche neue Nordbahn: vier<br />
Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />
je rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Maximale durchschnittliche Entnahme am Entnahmebrunnen in der<br />
Nähe der Geländeaufschüttungen am Knoten Ost: vier Fahrzeuge mit<br />
je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich je rund 17 m³<br />
Verbrauch pro Stunde.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-27
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
> Maximale durchschnittliche Entnahme an der Entnahmestelle Hallbergmoos<br />
für die Verdichtung der Abschirmungswälle: drei Fahrzeuge mit<br />
10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich rund 15 m³<br />
Verbrauch pro Stunde.<br />
2. Investmaßnahme:<br />
> Entnahmebrunnen in der Nähe der Geländeaufschüttung am Knoten<br />
Ost: zwei Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und<br />
durchschnittlich rund 16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen an der südöstlichen Ecke Vorfeld Ramp 5: zwei<br />
Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />
rund 16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Maximale durchschnittlich Entnahme an der Entnahmestelle<br />
Hallbergmoos für die Verdichtung der Abschirmungswälle: zwei Fahrzeuge<br />
mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich rund<br />
15 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
3. Investmaßnahme<br />
> Entnahmebrunnen in der Nähe der Geländeaufschüttungen am Knoten<br />
Ost: zwei Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und<br />
durchschnittlich rund 15 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Entnahmebrunnen in der südöstlichen Ecke Vorfeld, Ramp 5: zwei<br />
Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und<br />
durchschnittlich rund 15 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
> Maximale durchschnittliche Entnahme an der Entnahmestelle<br />
Hallbergmoos für die Verdichtung der Abschirmungswälle: drei<br />
Fahrzeuge mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />
rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />
2-28 Umweltverträglichkeitsstudie
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Quellenverzeichnis<br />
Technische Planung Luftseite. - Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007.<br />
Straßenplanung. - Wagner + Partner, Beratende Ingenieure im Bauwesen, München,<br />
2007.<br />
Tunnelplanung. - Obermeyer Planen und Beraten GmbH, München.<br />
Wasserwirtschaftliche Maßnahmen. - (Dr. Blasy – Dr. Øverland, Beratende Ingenieure<br />
GmbH & Co. KG, Eching am Ammersee / Regierungsbaumeister Schlegel<br />
GmbH & Co. KG, München, 2007.<br />
Boden- und Rohstoffmanagement, - Rietzler & Heidrich Umwelt GmbH, Nürnberg<br />
/ emc GmbH Erfurt / TU München, Zentrum für Geotechnik, 2007.<br />
Baulogistikkonzept (Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007.<br />
Umweltverträglichkeitsstudie 2-29
Karten nach Kartenverzeichnis<br />
Planfeststellungsverfahren<br />
3. Start und Landebahn<br />
Karte Nr. Bezeichnung Maßstab<br />
UVS 2-1 Lageplan mit politischen Grenzen 1: 100.000<br />
UVS 2-2 Lageplan <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong> 1: 25.000<br />
2-30 Umweltverträglichkeitsstudie