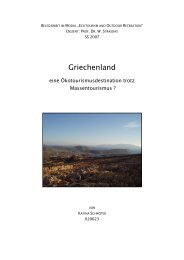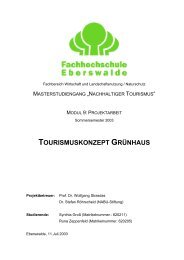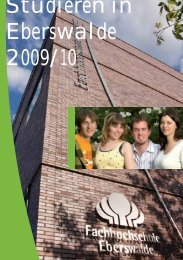Klettern und Ökotourismus - Hochschule für nachhaltige ...
Klettern und Ökotourismus - Hochschule für nachhaltige ...
Klettern und Ökotourismus - Hochschule für nachhaltige ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften<br />
-<br />
Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
Belegarbeit<br />
Modul Ecotourism<br />
Studiengang Nachhaltiger Tourismus<br />
Fachhochschule Eberswalde<br />
03.08.2007<br />
Betreuer: Prof. Stradas<br />
Vorgelegt von:<br />
Stephanie Herbener<br />
Matr.-Nr. 620606
Inhalt<br />
1. Fragestellung......................................................................................................................... 1<br />
2. Die Natursportart außeralpines <strong>Klettern</strong> .......................................................................... 1<br />
2.1 Die Entwicklung des Klettersports................................................................................... 1<br />
2.2 Varianten des Klettersports .............................................................................................. 3<br />
3. <strong>Ökotourismus</strong> – Definition <strong>und</strong> Erfolgsfaktoren............................................................... 4<br />
4. Umweltrelevanz des außeralpinen Felskletterns............................................................... 5<br />
4.1 Überblick.......................................................................................................................... 5<br />
4.2 Negative Umwelteinflüsse in verschiedenen Phasen ....................................................... 5<br />
5. Die Akteure des deutschen Klettersports........................................................................... 6<br />
5.1 Deutscher Alpenverein..................................................................................................... 6<br />
5.2 IG <strong>Klettern</strong>........................................................................................................................ 7<br />
5.3 Bergwacht......................................................................................................................... 8<br />
5.4 Arbeitskreise <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz ........................................................................... 8<br />
5.3 Kuratorium Sport <strong>und</strong> Natur e. V..................................................................................... 9<br />
6. Steuerungselemente <strong>für</strong> naturverträgliches <strong>Klettern</strong> ..................................................... 10<br />
6.1 Gesetzgebung ................................................................................................................. 10<br />
6.2 Kletterkonzeptionen ....................................................................................................... 10<br />
6.3 Freiwillige Vereinbarungen............................................................................................ 11<br />
7. Wie kann die Natursportart <strong>Klettern</strong> <strong>Ökotourismus</strong>-Standards erfüllen?.................. 11<br />
7.1 Ökologische <strong>und</strong> soziokulturelle Verträglichkeit........................................................... 12<br />
7.2 Sozioökonomischer Nutzen............................................................................................ 13<br />
7.3 Erhöhung der Naturschutzakzeptanz.............................................................................. 14<br />
8. Zusammenfassung.............................................................................................................. 15<br />
Quellen..................................................................................................................................... 16<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: Klettergebiete in deutschen Mittelgebirgen .................................................................. 1<br />
Abb. 2: Anzahl der Kletterer in Deutschland............................................................................. 2<br />
Abb. 3: Wo wird geklettert?....................................................................................................... 3<br />
Abb. 4: Deutscher Alpenverein.................................................................................................. 6<br />
Abb. 5: IG <strong>Klettern</strong>..................................................................................................................... 8<br />
Abb. 6: Bergwacht...................................................................................................................... 8<br />
Abb. 7, 8, 9: Einheitliche Beschilderung <strong>und</strong> Zonierung an Kletterfelsen .............................. 10<br />
Abb. 10: Die 10 Regeln zum umweltverträglichen <strong>Klettern</strong>.................................................... 11<br />
Abb. 11: Ziele des <strong>Ökotourismus</strong>............................................................................................. 12<br />
Abb. 12: Alterstruktur der Kletterer......................................................................................... 13<br />
Titelbild: http://www.velowelt-leipzig.de/velowelt/images/6/6e/<strong>Klettern</strong>_10.06.06_057.jpg
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
1. Fragestellung<br />
Die vorliegende Belegarbeit geht der Frage nach, ob sich die Natursportart außeralpines<br />
Sportklettern in Deutschland <strong>für</strong> die Entwicklung von ökotouristischen Angeboten eignet.<br />
Nach einer Einführung zur Entwicklung der Sportart <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> ihren Varianten werden die<br />
Kriterien <strong>und</strong> Erfolgsfaktoren des <strong>Ökotourismus</strong> vorgestellt. Schließlich werden die Umwelt-<br />
auswirkungen des <strong>Klettern</strong>s, wichtige deutsche Akteure sowie vorhandene Steuerungs-<br />
elemente aufgezeigt. Den Abschluss bildet die Analyse des deutschen Klettersports hin-<br />
sichtlich seiner ökotouristischen Potentiale.<br />
2. Die Natursportart außeralpines <strong>Klettern</strong><br />
2.1 Die Entwicklung des Klettersports<br />
Ab Mitte der 90er Jahre hat die Natursportart <strong>Klettern</strong> in Deutschland einen regelrechten<br />
Boom erlebt. Während alpines Felsklettern aufgr<strong>und</strong> der vielfältigen Möglichkeiten wenig<br />
Probleme verursacht (IITF 2000, S. 29), drängt sich eine Vielzahl von Kletterern an den<br />
wenigen Felsgebieten deutscher Mittelgebirgslandschaften (s. Abb. 1).<br />
Abb. 1: Klettergebiete in deutschen Mittelgebirgen 1<br />
Im Gegensatz zu den Alpen sind diese Felsgebiete zumeist näher an Ballungsgebieten,<br />
einfacher zugänglich <strong>und</strong> sicherer. Es sind keine plötzlichen Wetterumschwünge zu <strong>für</strong>chten,<br />
1 (http://www.dav-felsinfo.de/ajaxdav/)<br />
1
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
Steinschlag tritt selten auf <strong>und</strong> die Zivilisation ist nicht weit. Auch Ausflüge von wenigen<br />
St<strong>und</strong>en lohnen sich. Insgesamt wird die Zahl der deutschen Kletterer mittlerweile auf über<br />
250.000 geschätzt (s. Abb. 2).<br />
Die starke Konzentration zog lokale Umweltbelastungen nach sich <strong>und</strong> eine baldige Folge des<br />
Ansturms waren diverse Verbotsregelungen. Die Sanktionen reichten von der Sperrung<br />
einzelner Felsabschnitte bzw. kompletter Felsen nur <strong>für</strong> wenige Monate bis hin zum<br />
ganzjährigen Kletterverbot in ganzen Felslandschaften.<br />
Abb. 2: Anzahl der Kletterer in Deutschland 2<br />
Mit dem Kletterboom in Deutschland wurden verstärkt künstliche Kletteranlagen geschaffen,<br />
die ein Training auch bei schlechtem Wetter, im Winter <strong>und</strong> trotz Felssperrungen erlaubten.<br />
Der Wettkampf- <strong>und</strong> Leistungsgedanke nahm zu, während die Bedeutung von <strong>Klettern</strong> als<br />
Naturerlebnis abnahm. Mit der Vielzahl von künstlichen Kletteranlagen wurde der<br />
Nutzungsdruck, der auf den deutschen Mittelgebirgsfelsen lastete, jedoch nicht vermindert.<br />
Im Gegenteil: Aufgr<strong>und</strong> der einfachen Zugänglichkeit der Anlagen <strong>und</strong> einer Vielzahl von<br />
Kursangeboten stieg die Zahl der Kletterer, die irgendwann auch nach draußen drängten,<br />
weiter an (s. Abb. 3) Viele betrachteten die empfindlichen Felsgebiete nur noch als Trainings-<br />
objekte mit Frischluftzufuhr <strong>und</strong> verstärktem Nervenkitzel: <strong>Klettern</strong> wurde zum Modesport<br />
mit all seinen negativen Folgen.<br />
2 (http://www.verlagshaus-media.de/service/md2.asp?df=media2006_cl.pdf)<br />
2
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
Abb. 3: Wo wird geklettert? 3<br />
Engagierte Kletterer organisierten sich schließlich <strong>und</strong> versuchten zusammen mit<br />
Naturschutzakteuren an Lösungen mitzuarbeiten, die sowohl der Umwelt als auch den<br />
Kletterern gerecht wurden. Langwierige Entscheidungsprozesse führten zu diversen<br />
Kompromissen, teilweise mit schwer durchschaubaren Regelwerken.<br />
2.2 Varianten des Klettersports<br />
Wie in der Einführung kurz dargestellt, entstehen die meisten Probleme durch außeralpines<br />
<strong>Klettern</strong> an Mittelgebirgsfelsen. Im Folgenden werden die verschiedenen Varianten kurz<br />
vorgestellt. Freiklettern bedeutet, dass vertikale Distanzen am Fels nur vom eigenen Körper<br />
unter Zuhilfenahme von natürlichen Griffen <strong>und</strong> Tritten bewältigt werden. Im Gegensatz zur<br />
landläufigen Meinung, ist der Kletterer dabei durch fest oder temporär installierte<br />
Sicherungspunkte am Fels (z. B. Klemmkeile, Klebe-, Bohrhaken) <strong>und</strong> einem Seil gesichert.<br />
Die zunehmende Installation von festen Sicherungspunkten an den Felsen ermöglichte das<br />
<strong>Klettern</strong> in den höheren Schwierigkeitsbereichen <strong>und</strong> damit auch den Zugang in zuvor<br />
unberührte Areale.<br />
Eine Unterart des Freikletterns ist das Sportklettern bei dem der sportliche Aspekt stärker im<br />
Vordergr<strong>und</strong> steht. Wo diese Variante ausgeübt wird, finden sich meist zahlreiche feste<br />
Sicherungspunkte am Fels.<br />
Beim Bouldern geht es nicht um die Überwindung von vertikalen Distanzen sondern um die<br />
Lösung von kurzen aber schwierigen Kletterproblemen. Geklettert wird in Absprunghöhe<br />
über dem Boden, oftmals parallel zur Erdoberfläche <strong>und</strong> ohne jegliche Sicherung. Felsköpfe<br />
3 (http://www.verlagshaus-media.de/service/md2.asp?df=media2006_cl.pdf)<br />
3
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
werden dabei, wenn überhaupt, nur von sehr niedrigen Felsblöcken erreicht. Ausgelegte<br />
Matten auf dem Boden <strong>und</strong> das Auffangen durch Partner schützen vor Verletzungen.<br />
Teilweise finden sich an den deutschen Mittelgebirgsfelsen auch die, in den Alpen häufig<br />
vorkommenden, fest installierten Klettersteige. Diese zeichnen sich, zusätzlich zu den fest<br />
installierten Haken, durch Drahtseile <strong>und</strong> Leitern aus <strong>und</strong> ermöglichen auch ungeübteren <strong>und</strong><br />
weniger sportlichen Kletterern die Fortbewegung in der Vertikalen.<br />
3. <strong>Ökotourismus</strong> – Definition <strong>und</strong> Erfolgsfaktoren<br />
Zielgebiete des <strong>Ökotourismus</strong> sind natürliche oder naturnahe Gebiete, häufig auch Schutz-<br />
gebiete, welche touristisch interessante natürliche Attraktionen aufweisen. Das Erleben<br />
möglichst intakter Natur steht im Mittelpunkt der Reise. Dabei soll der Reisestil bezüglich der<br />
ökologischen, sozialen, kulturellen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Auswirkungen sowohl ver-<br />
antwortungsbewusst als auch verträglich sein <strong>und</strong> dabei zum Schutz der Umwelt sowie zum<br />
Wohlergehen der lokalen Bevölkerung beitragen (STRASDAS 2001, S. 4 f.). <strong>Ökotourismus</strong> ist<br />
also darauf angelegt, nicht nur negative Auswirkungen auf Natur <strong>und</strong> Umwelt zu vermeiden,<br />
sondern aktiv die Schutz- <strong>und</strong> Entwicklungsziele der bereisten Gebieten zu unterstützen<br />
(SCHROEDER 2007, S. 226). Ein wichtiger Punkt ist die Förderung der Naturschutzakzeptanz,<br />
die Erhöhung des Umweltbewusstseins <strong>und</strong> damit auch eine Änderung im Nutzungsverhalten<br />
aller Beteiligten (STRASDAS 2001, S. 10).<br />
<strong>Ökotourismus</strong> unterstützt somit auch die Forderungen des Nachhaltigen Tourismus. Während<br />
dieser aber verschiedene Tourismusarten umfasst, hat der <strong>Ökotourismus</strong> ausschließlich natur-<br />
bezogenen Tourismus zum Inhalt (STRASDAS 2001, S. 7).<br />
Der Erfolg von <strong>Ökotourismus</strong> beruht nach STRASDAS (2007) auf folgenden Faktoren:<br />
• Auswahl attraktiver Gebiete, <strong>für</strong> die eine (potentielle) Nachfrage besteht<br />
• vielfältige, qualitativ hochwertige Produkte<br />
• adäquate Kommunikationsstrategien<br />
• integrierte, partizipative Planung <strong>und</strong> Management<br />
• Kooperationen zwischen Schutzgebietsverwaltungen, Privatwirtschaft <strong>und</strong> lokalen<br />
Gemeinden<br />
• Professionalisierung <strong>und</strong> institutionelle Stärkung von Naturschutzorganisationen<br />
• Kompetenzförderung <strong>und</strong> Anleitung der lokalen Bevölkerung <strong>und</strong> des privaten<br />
Tourismussektors<br />
• Langzeitunterstützung <strong>und</strong> geeignete finanzielle Instrumente<br />
4
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
4. Umweltrelevanz des außeralpinen Felskletterns<br />
4.1 Überblick<br />
Die besondere Umweltrelevanz beim außeralpinen Sportklettern in Deutschland besteht durch<br />
die geringe Anzahl von Felsen denen ein hoher Nutzungsdruck gegenüber steht. Unter den<br />
durch <strong>Klettern</strong> verursachten Umweltproblemen zählt die Gefährdung von verschiedenen Tier-<br />
<strong>und</strong> Pflanzenarten zu den wichtigsten negativen Auswirkungen des Klettersports. Deutsche<br />
Mittelgebirgsfelsen wurden vom Menschen über Jahrh<strong>und</strong>erte kaum genutzt <strong>und</strong> stellen aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> naturnahe, ursprüngliche Lebensräume <strong>für</strong> Tiere <strong>und</strong> Pflanzen dar. Da die<br />
Standortbedingungen bezüglich Temperaturschwankungen, Windeinwirkung, Nährstoffarmut<br />
<strong>und</strong> starker Sonneneinstrahlung extrem sind, können nur gut angepasste, aber gleichzeitig<br />
hochsensible Organismen überleben. Vielfach sind sie Relikte aus den vergangenen Eiszeiten<br />
<strong>und</strong> bereits stark gefährdet (SCHEMEL/ERBGUTH 2000, S. 310).<br />
4.2 Negative Umwelteinflüsse in verschiedenen Phasen<br />
Die negativen Einflüsse des <strong>Klettern</strong>s auf die Umwelt lassen sich in drei Phasen gliedern:<br />
• An-/Abfahrt<br />
Die Anfahrt zu den Klettergebieten erfolgt zumeist als motorisierter Individualverkehr, da die<br />
Felsgebiete nur selten an den ÖPNV angeschlossen sind <strong>und</strong> die Wegstrecke häufig zu lang<br />
<strong>für</strong> eine Anreise per Rad ist. Die Folgen sind Ausstoß von Treibhausgasen,<br />
Feinstaubbelastungen <strong>und</strong> Lärmbelästigung von Menschen <strong>und</strong> Tieren. Da der Klettersport<br />
aber zumeist mindestens zu zweit ausgeübt wird, sind die Kraftfahrzeuge oft relativ gut<br />
ausgelastet.<br />
Die Parkmöglichkeiten sind in der Nähe von Kletterfelsen meist nur begrenzt. Häufig kommt<br />
es zur unkontrollierten Ausdehnung der Parkflächen mit entsprechenden mechanischen<br />
Schädigungen an Boden <strong>und</strong> Pflanzen.<br />
• Zu-/Abstieg<br />
Bereits beim Zustieg zu den Felsen wird die meist bewaldete Umgebung häufig durch<br />
Trampelpfade zerschnitten. Dabei kommt es zu Bodenverdichtungen, Erosion, Trittschäden<br />
an Pflanzen <strong>und</strong> Störung von Tieren. Ein weiteres Problem ist der Stoffeintrag in die<br />
Landschaft von organischen <strong>und</strong> anorganischen Abfällen. Eine Folge davon ist<br />
Eutrophierung, welche die Verdrängung seltener Pflanzenarten verursachen kann.<br />
Unter den Felsen wird meist <strong>für</strong> längere Zeit gelagert <strong>und</strong> das Klettermaterial ausgebreitet.<br />
Gerade in diesem Bereich sind völlig vegetationslose Flächen durch Trittschäden mittlerweile<br />
5
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
weit verbreitet. Da am Fuße der Felsen oft nur wenig Platz vorhanden ist, geht von<br />
Klettergruppen mit einer höheren Teilnehmerzahl eine besondere Gefahr aus.<br />
• <strong>Klettern</strong><br />
In der ungegliederten Steilwand siedeln nur wenige unempfindliche Arten wie z.B. Algen,<br />
Moose, Flechten <strong>und</strong> Spinnen. Glatte Felswände sind jedoch relativ selten. Häufig sind Felsen<br />
durch Risse, Spalten, Löcher, Felsbänder <strong>und</strong> Höhlungen gegliedert. Diese dienen den<br />
Kletterern als Griffe <strong>und</strong> Tritte zur Fortbewegung oder zum Anbringen von temporären<br />
Sicherungspunkten. Gleichzeitig sind sie aber auch bevorzugter Wuchsort, Lebensraum <strong>und</strong><br />
Nistplatz von Flora <strong>und</strong> Fauna. Gleiches gilt <strong>für</strong> die Felsköpfe die von Kletterern häufig als<br />
Routenausstieg, Sicherungspunkt oder auch Rastplatz genutzt werden. Neben der<br />
mechanischen Schädigung von Pflanzen durch das <strong>Klettern</strong> selbst, werden Kletterrouten<br />
oftmals auch absichtlich von „lästigem“ Bewuchs gesäubert. Dieser Stoffaustrag zieht eine<br />
Veränderung der Biotopstruktur nach sich. Durch Störung <strong>und</strong> Beunruhigung werden<br />
Fledermäuse, Wanderfalken, Uhus, Kolkraben, Reptilien <strong>und</strong> viele andere Tierarten gefährdet<br />
(SCHEMEL/ERBGUTH 2000, S. 310, 314 f.).<br />
5. Die Akteure des deutschen Klettersports<br />
5.1 Deutscher Alpenverein<br />
Bereits 1869 gegründet, zählt der Deutscher Alpenverein (DAV) heute 750.000 Mitglieder, ist<br />
damit der größte Bergsportverband der Welt <strong>und</strong> einer der großen Sport- <strong>und</strong><br />
Naturschutzverbände Deutschlands. Er setzt sich aus 355 regionalen Vereinen (Sektionen)<br />
<strong>und</strong> einer Stiftung zusammen (http://www.alpenverein.de/template_loader.php?tplpage_id=<br />
4). Ca. 10% aller DAV-Mitglieder klettern in den Deutschen Mittelgebirgen (SCHEMEL/<br />
ERBGUTH 2000, S. 300). Seit den 1980er <strong>und</strong> 1990er Jahren engagiert sich der Alpenverein<br />
verstärkt im Naturschutz <strong>und</strong> initiierte viele verschiedene Projekte.<br />
4 (http://www.alpenverein.de/)<br />
Abb. 4: Deutscher Alpenverein 4<br />
6
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
Zum Thema <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz hat der DAV verschiedene Publikationen veröffent-<br />
licht:<br />
• Zu Gast in den Felsen (Broschüre 2006, enthält 10 Regeln zum naturverträglichen <strong>Klettern</strong>)<br />
• Konzeption <strong>für</strong> das <strong>Klettern</strong> in den außeralpinen Felsgebieten in Deutschland (Buch 2000,<br />
Standardwerk zum Thema Klettersport <strong>und</strong> Naturschutz)<br />
• Leitbild <strong>Klettern</strong> <strong>für</strong> die außeralpinen Felsgebiete Deutschlands (1998,<br />
Ökologische Gr<strong>und</strong>lagen, Konzeptionen zum naturverträglichen <strong>Klettern</strong>,<br />
Pflegemaßnahmen)<br />
• <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz – Die Ausstellung (Broschüre zur Wanderausstellung)<br />
Außerdem unterhält der DAV mit Unterstützung der Deutschen B<strong>und</strong>esstiftung Umwelt die<br />
Homepage http://www.dav-felsinfo.de, welche alle Informationen zum Thema <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong><br />
Naturschutz (Felssperrungen, Ansprechpartner, Hintergründe etc.) enthält. Das DAV-Felsinfo<br />
hat die Förderung eines naturverträglichen Klettersports zum Ziel <strong>und</strong> möchte dies erreichen<br />
durch<br />
• die Verbreitung der bestehenden Kletterregelungen<br />
• die Information von Kletterern über das Thema <strong>Klettern</strong> & Naturschutz<br />
• die Besucherlenkung zur Entlastung von konfliktreichen Felsen <strong>und</strong> Gebieten<br />
• die Unterstützung der ehrenamtlichen Gebietsbetreuer<br />
• den Aufbau einer zentralen Datenbank zur klettersportlichen Raumplanung<br />
(http://www.dav-felsinfo.de/ajaxdav/)<br />
5.2 IG <strong>Klettern</strong><br />
Die Interessensgemeinschaften (IG) sind Vereinigungen von Kletterern <strong>für</strong> Kletterer, die sich<br />
<strong>für</strong> die Erhaltung ihrer Klettergebiete in Mittelgebirgen einsetzen. 1989 wurde die erste IG<br />
<strong>Klettern</strong> im Frankenjura gegründet <strong>und</strong> hatte das Ziel, naturschutzbedingte Sperrungen von<br />
Kletterfelsen abzuwenden.<br />
Heute gibt es b<strong>und</strong>esweit zwölf Interessensgemeinschaften <strong>und</strong> vier weitere eigenständige<br />
Klettervereinigungen, die sich im B<strong>und</strong>esverband IG <strong>Klettern</strong> e.V. zusammengeschlossen<br />
haben (http://www.ig-klettern.de/ueberuns.html). Im Jahre 2000 hatten sie ca. 2.500<br />
Mitglieder (SCHEMEL/ERBGUTH 2000, S. 300). Ihre Aufgaben sind:<br />
7
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
• politische Arbeit<br />
• Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden<br />
• Umsetzung von Kletterkonzeptionen<br />
• Routensanierung<br />
• Wegebau etc.<br />
5.3 Bergwacht<br />
Abb. 5: IG <strong>Klettern</strong> 5<br />
Die Bergwacht wurde bereits 1920, mit dem Ziel die bedrohte Natur in den Alpenregionen zu<br />
retten, gegründet. In der darauffolgenden Zeit wandelte sie sich jedoch von einer<br />
Naturschutzorganisation mehr <strong>und</strong> mehr zur ehrenamtlichen Rettungsorganisation mit<br />
folgenden Aufgaben:<br />
• Durchführung des Rettungsdienstes<br />
• Einsatz bei Unglücksfällen <strong>und</strong> Katastrophen<br />
• Mitwirkung im Natur-, Landschafts- <strong>und</strong> Umweltschutz<br />
In Deutschland gibt es 11 Landesverbände die rechtlich Gemeinschaften des Deutschen Roten<br />
Kreuzes sind. Der Wirkungskreis hat sich somit auf außeralpine Felsregionen ausgedehnt.<br />
Obwohl der Naturschutz mittlerweile in den Hintergr<strong>und</strong> getreten ist, werden hier dennoch<br />
verschiedene Aufgaben wahrgenommen:<br />
• Durchführung von Naturschutzstreifen <strong>und</strong> Naturschutzprojekten<br />
• Unterstützung der Naturschutzwacht<br />
• Unterstützung geförderter Naturschutzprojekte<br />
• Öffentlichkeits- <strong>und</strong> Jugendarbeit im Natur- <strong>und</strong> Umweltschutz<br />
(http://www.drk.de/bergwacht/index.html)<br />
5.4 Arbeitskreise <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz<br />
Abb. 6: Bergwacht 6<br />
Ehrenamtliche Arbeit auf lokaler <strong>und</strong> regionaler Ebene in den Klettergebieten leisten auch die<br />
zahlreichen „Arbeitskreise <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz“ (AKN) in Deutschland. Diese setzen<br />
sich zusammen aus aktiven Kletterern <strong>und</strong> Gebietskennern von Verbänden wie DAV, IG<br />
<strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Bergwacht <strong>und</strong> nehmen folgende Aufgaben wahr:<br />
• Ausarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung von Kletterkonzeptionen<br />
5 (http://www.ig-klettern.de/)<br />
6 (http://www.drk.de/bergwacht/index.html)<br />
8
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
• Besucherlenkung, Wegebau <strong>und</strong> Beschilderung an Kletterfelsen<br />
• Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong> Information der Kletterer<br />
• Sicherheitstechnische Sanierung von Kletterrouten<br />
• Übernahme von Felspatenschaften<br />
• Lokale Plattform <strong>für</strong> alle Fragen des <strong>Klettern</strong>s<br />
• Zusammenarbeit mit Behörden <strong>und</strong> Naturschutzverbänden<br />
(http://www.alpenverein-bw.de/klettern/akns.html)<br />
5.3 Kuratorium Sport <strong>und</strong> Natur e. V.<br />
Das Kuratorium Sport <strong>und</strong> Natur wurde 1992 als Interessensvertretung der<br />
Natursportverbände in Deutschland gegründet <strong>und</strong> ist die größte nationale<br />
Interessensvereinigung im Bereich des Natursports. Mitglieder sind neben 19 anderen<br />
Verbänden auch der B<strong>und</strong>esverband IG <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> der Deutsche Alpenverein. Das<br />
Kuratorium vertritt ca. drei Mio. Natursportler <strong>und</strong> ist somit die größte Vereinigung des<br />
Natursports in Deutschland.<br />
Folgende Vereinsziele sind festgeschrieben:<br />
• der Wert naturschonender Sportausübung in der freien Natur soll öffentlich dargestellt<br />
werden <strong>und</strong> zum besseren Verständnis von Sport in der Natur beizutragen<br />
• an der Lösung des Konflikts "Sport <strong>und</strong> Natur" soll durch sachorientierte Beiträge <strong>und</strong> durch<br />
Mitarbeit in den Fachgremien mitgewirkt werden<br />
• unter den Mitgliedern soll das Naturverständnis <strong>und</strong> die naturschonende Sportausübung<br />
gefördert werden<br />
• das Recht zur Ausübung von naturschonendem Sport in der freien Natur soll vertreten <strong>und</strong><br />
gesichert werden<br />
• der Jugend soll durch erlebnisreichen Sport in der Natur eine positive Lebenseinstellung <strong>und</strong><br />
ein unmittelbares Naturverständnis vermittelt werden.<br />
Das Kuratorium veranstaltete bereits zahlreiche Symposien. Durch die Zusammenarbeit mit<br />
Firmen aus dem Outdoor-Bereich (Fachgruppe Outdoor) möchte man auch Natursportler<br />
ansprechen, die nicht in den Mitgliedsverbänden des Kuratoriums organisiert sind. Außerdem<br />
wurden Positionspapiere zur Novellierung des B<strong>und</strong>esnaturgesetzes <strong>und</strong> zur Umsetzung der<br />
europäischen Richtlinien FFH- <strong>und</strong> Vogelschutzrichtlinie erarbeitet (http://www.kuratorium-<br />
sport-natur.de/a_infos.phtml).<br />
9
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
6. Steuerungselemente <strong>für</strong> naturverträgliches <strong>Klettern</strong><br />
6.1 Gesetzgebung<br />
Die Schutzwürdigkeit der Felsbiotope ist als Rahmengesetz in der Gesetzgebung verankert:<br />
§20c des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes zählt alle „offenen Felsbildungen“ zu den „besonders<br />
schützenswerten Biotopen“, womit dem Naturschutz absoluter Vorrang vor anderen<br />
Nutzungsansprüchen eingeräumt wird. Außerdem befinden sich die meisten Felsen innerhalb<br />
von Schutzgebieten (SCHEMEL/ERBGUTH 2000, S. 311). Auch in betroffenen B<strong>und</strong>esländern<br />
<strong>und</strong> Nationalparken finden sich entsprechende Verordnungen zum <strong>Klettern</strong>. Beispiele da<strong>für</strong><br />
sind das Nationalparkgesetz <strong>für</strong> den Harz (http://www.ig-klettern-niedersachsen.de/info<br />
0601.htm) <strong>und</strong> das Landesnaturschutzgesetz Sachsen (http://www.naturschutzrecht.net/<br />
Gesetze/Sachsen/lnatschgsach05.html).<br />
6.2 Kletterkonzeptionen<br />
Um den Interessen von Naturschutz <strong>und</strong> Kletterern gerecht zu werden verfasste der DAV<br />
richtungsweisende Kletterkonzeptionen <strong>für</strong> die einzelnen Gebiete. Diese wurden in<br />
Zusammenarbeit von Kletterern, Naturschutzverbänden, Behörden <strong>und</strong> anderen<br />
Interessensgruppen erarbeitet, werden stetig aktualisiert <strong>und</strong> haben zum Teil auch Eingang in<br />
Gesetzgebungen gef<strong>und</strong>en. Sie enthalten detaillierte Vereinbarungen zu Zonierungen <strong>und</strong> der<br />
Freigabe bzw. Sperrung von Kletterfelsen. Diese wurden auf der Gr<strong>und</strong>lage umfassender<br />
Erhebungen erstellt. Außerdem wurde eine einheitliche Beschilderung <strong>für</strong> die Felsen<br />
entwickelt (s. Abb.7-9).<br />
Abb. 7, 8, 9: Einheitliche Beschilderung <strong>und</strong> Zonierung an Kletterfelsen<br />
• Zone 1: Ruhezone –<br />
Kletterverzicht<br />
• Zone 2: Status Quo –<br />
<strong>Klettern</strong> auf vorhandenen<br />
Routen<br />
keine Neutouren<br />
• Zone 3: Einrichtung neuer Touren gemäß<br />
getroffener Vereinbarung<br />
Bei Zuwiderhandlungen drohen Bußgelder. Im Donautal werden von Naturpark-Rangern<br />
zwischen 50 <strong>und</strong> 2.500 Euro gefordert (http://www.alpenverein-bw.de/downloads/dav_info_<br />
10
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
2004_5.pdf). In manchen Landkreisen können, je nach Bußgeldkatalog, im Extremfall bis zu<br />
10.000 Euro verlangt werden (http://www.palatinum.info/ news0206.shtm).<br />
6.3 Freiwillige Vereinbarungen<br />
Zur freiwilligen Selbstbeschränkung rufen diverse DAV-Publikationen <strong>für</strong> sanftes <strong>Klettern</strong> (s.<br />
Kap.5.1) auf. Im Vordergr<strong>und</strong> steht die Vermittlung der 10 Regeln zum umweltverträglichen<br />
<strong>Klettern</strong> (s. Abb. 10).<br />
1. Aktuelle Kletterregelungen beachten<br />
(Information durch Internet, Beschilderung <strong>und</strong> Kletterführer)<br />
2. Umweltverträglich anreisen<br />
(ÖPNV, Fahrgemeinschaften)<br />
3. Nur zugelassene Parkplätze nutzen<br />
4. Nicht auf Abwege geraten<br />
(Zustiegspfade nicht verlassen)<br />
5. Pflanzenbewuchs erhalten<br />
6. Tabuzonen respektieren<br />
(z. B. Abseilhaken unterhalb von Felsköpfen)<br />
7. Brutzeiten sind Sperrzeiten!<br />
(Information durch Internet <strong>und</strong> Hinweistafeln)<br />
8. Keinen Müll zurücklassen<br />
(außerdem Fäkalien vergraben, nur zugelassene Feuerstellen nutzen)<br />
9. Nutzen bieten, Nutzen ernten<br />
(<strong>für</strong> Übernachtung <strong>und</strong> Verpflegung lokale Gasthöfe oder Zeltplätze nutzen damit<br />
auch die ansässige Bevölkerung profitiert, persönlicher Kontakt zu Einheimischen<br />
mindert Vorurteile)<br />
10. Sanierungen <strong>und</strong> Erschließungen abstimmen!<br />
(an lokale Ansprechpartner wie die Arbeitskreise <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz wenden)<br />
(DAV 2006)<br />
Abb. 10: Die 10 Regeln zum umweltverträglichen <strong>Klettern</strong><br />
Mittlerweile besitzen diese Verhaltensweisen unter den Kletterern einen hohen<br />
Bekanntheitsgrad <strong>und</strong> haben sich weitgehend durchgesetzt. Dies beruht allerdings nicht auf<br />
freiwilliger Basis, sondern häufig nur durch die drohende Sperrung von Kletterfelsen oder<br />
Bußgeldern.<br />
7. Wie kann die Natursportart <strong>Klettern</strong> <strong>Ökotourismus</strong>-Standards erfüllen?<br />
Im Folgenden soll das ökotouristische Potential der Natursportart <strong>Klettern</strong> anhand der Ziele<br />
des <strong>Ökotourismus</strong> nach STRASDAS (2001, s. Abb. 11) betrachtet werden. Wo es nötig ist,<br />
werden Verbesserungsvorschläge gemacht.<br />
11
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
1. Oberziel: Verträglichkeit<br />
• 1. Teilziel: Ökologische Verträglichkeit<br />
• 2. Teilziel: Sozio-kulturelle Verträglichkeit<br />
2. Oberziel: Sozio-ökonomischer Nutzen<br />
• 1. Teilziel: Rentabilität<br />
• 2. Teilziel: Finanzierung von Naturschutzvorhaben oder Schutzgebieten<br />
• 3. Teilziel: Schaffung von Einkommensmöglichkeiten <strong>für</strong> die lokale Bevölkerung<br />
(ethisch-soziale <strong>und</strong> strategische Motive)<br />
3. Oberziel: Erhöhung der Naturschutzakzeptanz<br />
(STRASDAS 2001, S. 9 f.)<br />
Abb. 11: Ziele des <strong>Ökotourismus</strong><br />
7.1 Ökologische <strong>und</strong> soziokulturelle Verträglichkeit<br />
Das Erreichen von ökologischer Verträglichkeit wurde in den letzten Jahren im Klettersport,<br />
wie oben gezeigt, von verschiedenen Akteuren stark gefördert. Felssperrungen <strong>und</strong> Bußgelder<br />
sorgten auch bei weniger verantwortungsbewussten Kletterern <strong>für</strong> einen Wandel des<br />
Verhaltens. Wenn bei der Ausübung die Regeln zur umweltfre<strong>und</strong>lichen Anreise <strong>und</strong> zum<br />
naturverträglichen <strong>Klettern</strong> (s. Abb. 11) beachtet werden, lässt sich diese Sportart also<br />
durchaus ökologisch verträglich durchführen. Ein gewisses Maß an Kontrolle ist dabei aber<br />
unabdingbar. Zur Not muss die Zahl der Kletterer, z. B. durch Ticketverkauf wie in der<br />
Nordeifel, limitiert werden<br />
Bei (Pauschal-) Kletterreisen mit Übernachtungen ist außerdem die ökologisch verträgliche<br />
Unterbringung <strong>und</strong> Versorgung in den Gebieten zu verbessern. Qualitativ hochwertige<br />
Zertifizierungen wie Viabono sind dabei allerdings untauglich. Ideal wären Gütesiegel, die<br />
dem eher einfachen Charakter von Unterkünften <strong>für</strong> Kletterer gerecht werden. Der DAV hat<br />
<strong>für</strong> seine Alpenvereinshütten im Gebirge bereits ein spezielles Umweltgütesiegel entwickelt.<br />
Vielleicht lassen sich manche Kriterien daraus auch <strong>für</strong> andere Kletterunterkünfte verwenden<br />
oder anpassen. Möglich wäre auch eine Ausweitung des Netzwerkes Eco-Camping Baden-<br />
Württemberg auf ganz Deutschland (http://www.dbu.de/projekt_18035/_db_799.html).<br />
Potential könnte auch die Versorgung mit regionalen <strong>und</strong>/oder ökologischen Produkten<br />
besitzen. Hier wäre es möglich, von Kletterern frequentierte Gastronomiebetriebe zu einer<br />
Angebotserweiterung oder -veränderung zu bewegen. Lokale Gütesiegel sollten benutzt<br />
werden oder neue geschaffen werden. Vorbild kann die DAV-Initiative „So schmecken die<br />
Berge“ zur Direktvermarktung auf Alpenvereinshütten sein (http://www.alpenverein.de/<br />
template_loader.php?tplpage_id=56).<br />
12
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
Die sozio-kulturelle Verträglichkeit des Klettersports hängt zum Teil eng mit der ökologisch<br />
verträglichen Ausübung zusammen. Die Einhaltung <strong>und</strong> Überwachung der oben aufgeführten<br />
Regeln helfen auch hier bei der Vermeidung von Problemen. Hauptkonfliktpunkte mit<br />
Einheimischen sind zum Beispiel die Inanspruchnahme von Parkflächen, behinderndes<br />
Parken, die Nichtbeachtung von Privatgr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Landschaftsverunreinigungen. Andere<br />
Besucher, vor allem Wanderer, konkurrieren ebenfalls mit Parkplätzen <strong>und</strong> empfinden<br />
Kletterer teilweise als optische <strong>und</strong> akustische Störung ihres Naturgenusses. Hier könnte<br />
versucht werden <strong>für</strong> mehr gegenseitiges Verständnis zu werben oder eine räumliche Trennung<br />
zu initiieren.<br />
7.2 Sozioökonomischer Nutzen<br />
Die Erhöhung des sozio-ökonomischen Nutzens ist ein schwierigeres Kapitel. Obwohl<br />
Kletterregel 9 (s. Abb. 10) empfiehlt, der einheimischen Bevölkerung einen Nutzen<br />
zukommen zu lassen, ist dies im Bewusstsein der Kletterer weitaus weniger präsent als die<br />
Notwendigkeit der ökologisch verträglichen Ausübung ihres Sportes. Wie Abb. 12 zeigt, sind<br />
Kletterer relativ jung. Viele von ihnen sind Studenten mit geringem Einkommen.<br />
Abb. 12: Alterstruktur der Kletterer 7<br />
Da so oft wie möglich geklettert wird, Ausrüstung teuer ist, die Anfahrt oftmals länger dauert<br />
<strong>und</strong> deshalb häufig übernachtet wird, werden die übrigen Kosten so gering wie möglich<br />
gehalten. Übernachtet wird meist bei Bekannten, auf einfachen Zeltplätzen, in preiswerten<br />
Pensionen mit Mehrbettzimmern oder in (Alpen-) Vereinsheimen. Die Verpflegung wird<br />
häufig von zu Hause mitgebracht <strong>und</strong> vor Ort selbst zubereitet. Die einheimische<br />
Bevölkerung sollte über diese Art des Reisens informiert sein, damit keine falschen<br />
Erwartungen entstehen. Wenn das Angebot vor Ort gezielt auf die Bedürfnisse von Kletterern<br />
7 (http://www.verlagshaus-media.de/service/md2.asp?df=media2006_cl.pdf)<br />
13
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
abgestimmt wird, lässt sich auch mit investitionsarmen Low-Budget-Angeboten, wie zum<br />
Beispiel naturnahen Zeltplätzen oder einem speziellen „Klettererfrühstück“, eine hohe<br />
Rentabilität erzielen.<br />
Kletterpauschalreisen von Veranstaltern können ebenfalls dazu beitragen. Die Einbindung<br />
von lokaler Bevölkerung <strong>und</strong> lokalen Produkten wären weitere Kriterien <strong>für</strong> ökotouristische<br />
Angebote. Außerdem sollte in den Reisen ein Anteil enthalten sein, der direkt in Maßnahmen<br />
zur Förderung von naturverträglichem <strong>Klettern</strong> einfließt.<br />
Einige Klettergebiete oder DAV-Sektionen, wie die Nordeifel oder die Sektion Essen,<br />
verkaufen Zugangstickets deren Besitz überprüft wird. Der Erlös fließt in die Gebiete <strong>und</strong><br />
fördert infrastrukturelle <strong>und</strong> naturschutztechnische Maßnahmen wie Wegebau, Routen-<br />
sanierung oder auch Beschilderungen. Zu prüfen wäre, ob diese Gebühren nicht in allen<br />
Klettergebieten eingeführt werden können. Auf diese Weise könnten auch nicht-organisierte<br />
Kletterer einen Beitrag zur Pflege <strong>und</strong> Erhaltung der Naturräume leisten.<br />
7.3 Erhöhung der Naturschutzakzeptanz<br />
Die Erhöhung der Naturschutzakzeptanz ist ein weiteres wichtiges Ziel im <strong>Ökotourismus</strong>.<br />
Gr<strong>und</strong>voraussetzung da<strong>für</strong> ist, dass die Kletterer informationstechnisch auch erreicht werden.<br />
Eine Möglichkeit wäre die Einrichtung von Lehrpfaden an den Felsen. Außerdem bietet es<br />
sich an, alle in den Klettergebieten aktiven touristischen Akteure zu schulen <strong>und</strong> mit<br />
einzubinden. So sollten Veranstalter, Übernachtungsbetriebe, Gasthäuser etc. aktuelle<br />
Informationen (Regeln <strong>für</strong> sanftes <strong>Klettern</strong>, Sperrungen, etc.) über die Regionen bereithalten<br />
<strong>und</strong> diese aktiv kommunizieren. Gerade bei organisierten (Anfänger-) Kletterkursen bietet<br />
sich die Möglichkeit neben Sicherungs- <strong>und</strong> Klettertechnik auch naturverträgliches Verhalten<br />
zu propagieren. Da bei mehrtägigen Kletteraufenthalten auch Ruhetage obligatorisch sind,<br />
wäre zu prüfen ob spezielle Umweltbildungsangebote eine positive Resonanz unter den<br />
Kletterern hervorrufen <strong>und</strong> <strong>für</strong> eine erhöhte Umweltsensibilisierung sorgen können.<br />
Schutzgebiete mit Besucherzentren, wie zum Beispiel Nationalparkhäuser oder Geopark-<br />
Infostellen könnten ebenfalls spezielle Angebote <strong>für</strong> Kletterer entwickeln. Der Bereich<br />
Umweltbildung <strong>und</strong> -sensibilisierung bei Kletterern ist trotz vielen vorangegangen<br />
Bemühungen immer noch zu verbessern.<br />
Überall wo Naturschutzmaßnahmen Kletterer in der Ausübung ihres Sportes einschränken<br />
sollte dieses zum Beispiel durch Schautafeln gut <strong>und</strong> nachvollziehbar kommuniziert werden.<br />
14
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
8. Zusammenfassung<br />
Die vorliegende Arbeit hat das außeralpine Felsklettern, seine Auswirkungen auf die Natur,<br />
seine wichtigsten Akteure <strong>und</strong> Steuerungselemente vorgestellt. Im Anschluss daran wurde<br />
untersucht wie sich <strong>Klettern</strong> mit den Zielen des <strong>Ökotourismus</strong> vereinbaren lässt.<br />
<strong>Klettern</strong> kann ökologisch verträglich durchgeführt werden, umfassende Regelwerke <strong>und</strong><br />
Leitfäden hierzu wurden in den letzten Jahren geschaffen. Aufgr<strong>und</strong> der kleinteiligen<br />
Biotopstruktur an Felsen <strong>und</strong> dem hohen Nutzungsdruck ist eine stetige <strong>und</strong> strenge Kontrolle<br />
allerdings von gr<strong>und</strong>legender Bedeutung. Die soziokulturelle Verträglichkeit hängt eng mit<br />
der ökologischen zusammen: Eine Vermeidung von Überfrequentierung verbessert auch<br />
diese.<br />
Um sozioökonomischen Nutzen durch Kletterreisen bzw. -ausflüge zu erzielen, ist eine<br />
konsequente Ausrichtung der touristischen Infrastruktur auf die eher einfachen Bedürfnisse<br />
von Kletterern zu empfehlen. Hier besteht aber durchaus das Potential ökologisch verträgliche<br />
<strong>und</strong> zertifizierte Angebote zu verkaufen.<br />
Der Naturschutz profitiert finanziell bereits durch die organisierten Kletterer. Teilweise geht<br />
ihr Engagement sogar weit darüber hinaus. Wichtig wäre, dass auch die unorganisierten<br />
Kletterer durch Abgaben <strong>für</strong> Tickets etc. einen Beitrag <strong>für</strong> ihr Klettergebiet leisten können.<br />
Ähnliches gilt <strong>für</strong> die Naturschutzakzeptanz <strong>und</strong> das Umweltbewusstsein: Auch hier müssen<br />
durch eine entsprechende Maßnahmenförderung vor allem noch unorganisierte Kletterer<br />
angesprochen werden. Da viele Kletterer zuerst einen Kurs besuchen, bietet sich die<br />
Möglichkeit wesentliche Gr<strong>und</strong>sätze zum Thema <strong>Klettern</strong> <strong>und</strong> Naturschutz bereits von<br />
Anfang an zu vermitteln. Hier sind besonders die Veranstalter von Kletterkursen <strong>und</strong><br />
Kletterreisen an ihre Pflicht zu erinnern.<br />
Die Untersuchungen <strong>und</strong> Konzeptionen der letzten Jahre bilden eine wichtige Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong><br />
die ökotouristisch-kompatible Ausübung dieses Sports. Wenn bereits existierende<br />
Empfehlungen <strong>und</strong> Reglements von Seiten der Regionen <strong>und</strong> Anbieter umgesetzt <strong>und</strong><br />
ausreichend kontrolliert werden, kann <strong>Klettern</strong> durchaus Inhalt von ökotouristischen<br />
Angeboten sein.<br />
15
Sportklettern in außeralpinen Felslandschaften - Potential <strong>für</strong> ökotouristische Angebote?<br />
Quellen<br />
Literatur<br />
• DEUTSCHER ALPENVEREIN (1998): Leitbild <strong>Klettern</strong> <strong>für</strong> die außeralpinen Felsgebiete in<br />
Deutschland. München.<br />
• DEUTSCHER ALPENVEREIN (2006): Zu Gast in den Felsen (Broschüre). München.<br />
• IITF – INSTITUT FÜR INTEGRATIVEN TOURISMUS UND FREIZEITFORSCHUNG (2000): Trend-<br />
<strong>und</strong> Extremsportarten in Österreich. Wien.<br />
• SCHEMEL, H.-J./ERBGUTH, W. (2000): Handbuch Sport <strong>und</strong> Umwelt. Aachen.<br />
• SCHROEDER, G. (2007): Das Tourismuslexikon. Hamburg.<br />
• STRASDAS, W. (2001): Ökotourimus in der Praxis. Zur Umsetzung der sozio-ökonomischen<br />
<strong>und</strong> naturschutzpolitischen Ziele eines anspruchsvollen Tourismuskonzeptes in<br />
Entwicklungsländern. Ammerland.<br />
• STRASDAS, W. (2007): Fachhochschule Eberswalde, Studiengang Nachhaltiger Tourismus.<br />
Vorlesungsskript zum Modul Ecotourism and Outdoor Recreation. Eberswalde.<br />
Internet<br />
• BERGWACHT: http://www.drk.de/bergwacht/ (26.07.2007)<br />
• DEUTSCHER ALPENVEREIN: http://www.alpenverein.de (26.07.2007)<br />
http://www.dav-felsinfo.de (26.07.2007)<br />
• DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT: http://www.dbu.de (01.08.2007)<br />
• GERANOVA BRUCKMANN Verlagshaus GmbH: http://www.verlagshaus-media.de<br />
(30.07.2007)<br />
• IG KLETTERN: http://www.ig-klettern.de (26.07.2007)<br />
• IG KLETTERN NIEDERSACHSEN: http://www.ig-klettern-niedersachsen.de (26.07.2007)<br />
• INSTITUT FÜR NATURSCHUTZ UND NATURSCHUTZRECHT: http://www.naturschutzrecht.net<br />
(26.07.2007)<br />
• KURATORIUM SPORT UND NATUR E. V.: http://www.kuratorium-sport-natur.de (26.07.2007)<br />
• LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG DES DAV: http://www.alpenverein-bw.de<br />
(26.07.2007)<br />
• PALATINUM.INFO: http://www.palatinum.info (30.07.2007)<br />
• VELOWELT-LEIPZIG: http://www.velowelt-leipzig.de (26.07.2007)<br />
16