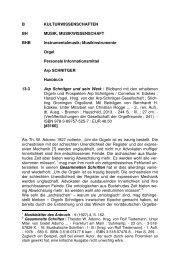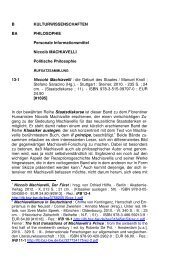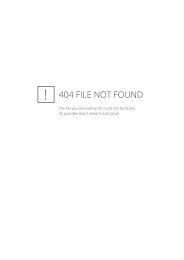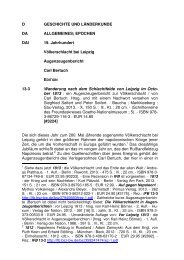Der Jurist in der industriellen Gesellschaft : Ernst Forsthoff
Der Jurist in der industriellen Gesellschaft : Ernst Forsthoff
Der Jurist in der industriellen Gesellschaft : Ernst Forsthoff
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
C GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN<br />
CK RECHT; VERWALTUNG<br />
CKA Recht, Rechtswissenschaft<br />
Personale Informationsmittel<br />
<strong>Ernst</strong> FORSTHOFF<br />
BIOGRAPHIE<br />
12-3 <strong>Der</strong> <strong>Jurist</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriellen <strong>Gesellschaft</strong> : <strong>Ernst</strong> <strong>Forsthoff</strong><br />
und se<strong>in</strong>e Zeit / Florian Me<strong>in</strong>el. - Berl<strong>in</strong> : Akademie-Verlag,<br />
2011. - XI, 557 S. ; 25 cm. - Zugl.: Berl<strong>in</strong>, Humboldt-Univ.,<br />
Diss., 2010. - ISBN 978-3-05-005101-7 : EUR 79.80<br />
[#2505]<br />
I. E<strong>in</strong>führung<br />
Die hier anzuzeigende Studie von Me<strong>in</strong>el ist aus e<strong>in</strong>er von Prof. Dr. Folke<br />
Schuppert betreuten, von <strong>der</strong> <strong>Jurist</strong>ischen Fakultät <strong>der</strong> HUB angenommenen,<br />
mit summa cum laude bewerteten Dissertation (Korreferent: Prof. Dr.<br />
Jens Kersten) hervorgegangen. Sie rückt das wissenschaftliche Werk des<br />
1974 verstorbenen Öffentlichrechtlers Professor Dr. <strong>Ernst</strong> <strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> den<br />
Fokus ihrer Untersuchungen. Ziel <strong>der</strong> Arbeit ist es, zu „e<strong>in</strong>er entwicklungsgeschichtlichen<br />
Deutung <strong>der</strong> Ideenwelt <strong>Ernst</strong> <strong>Forsthoff</strong>s“ beizutragen (S. 5).<br />
<strong>Forsthoff</strong> hatte zwischen 1943 und 1967 (mit e<strong>in</strong>er Unterbrechung von 1946<br />
bis 1952) rd. 18 Jahre lang e<strong>in</strong>en Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht<br />
an <strong>der</strong> Universität Heidelberg <strong>in</strong>ne. Er war <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik auch<br />
über die Fachgrenzen h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>er breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden,<br />
und zwar e<strong>in</strong>erseits als spiritus rector und agent provocateur <strong>der</strong><br />
„Schmittisten“ (Smend), an<strong>der</strong>erseits als hartnäckiger Verfechter und eigentlicher<br />
„Kopf“ <strong>der</strong>jenigen „Fraktion“ <strong>der</strong> Staatsrechtslehrer, die <strong>der</strong> Idee e<strong>in</strong>es<br />
„starken“ Staates anh<strong>in</strong>g.<br />
Als eigentliche Ursache für den Verlust an substantieller Staatlichkeit, den<br />
<strong>Forsthoff</strong> damals gerade auch <strong>der</strong> Bundesrepublik attestierte, hatte er die<br />
Auslieferung des Staates an die Ökonomie ausgemacht, e<strong>in</strong>e Abhängigkeit,<br />
die seitdem ja nicht nur nicht abgenommen, son<strong>der</strong>n im Gegenteil stetig<br />
weiter zugenommen und die sich mittlerweile auch <strong>in</strong>stitutionell verfestigt<br />
hat. So gesehen, darf es nicht verwun<strong>der</strong>n, daß die heutige, von sog. „Märkten“<br />
(früher sprach man von Spekulanten) getriebene europäische Staatenwelt<br />
nur noch e<strong>in</strong> Bild des Jammers bietet. Was waren die von <strong>Forsthoff</strong><br />
e<strong>in</strong>st geschmähten (National-)Staaten demgegenüber doch noch für selbstbewußte,<br />
kraftvolle, <strong>in</strong> sich ruhende Organisationen, verglichen mit jenen<br />
ausgemergelten (ausgemerkelten?) „Papiertigern“ unserer Tage, die sich<br />
wi<strong>der</strong>standslos zum Büttel je<strong>der</strong> beliebigen ökonomischen Halbwahrheit
machen lassen und sich anstandslos je<strong>der</strong> von e<strong>in</strong>er ökonomischen Halbwelt<br />
erhobenen For<strong>der</strong>ung unterwerfen, sofern diese nur als „Marktgesetz“<br />
ausgegeben wird. Und <strong>in</strong> welch desaströse Lage haben sich diese staatlichen<br />
„Schrumpfgebilde“ <strong>in</strong>zwischen durch ihr jammervolles Lavieren manövriert,<br />
<strong>in</strong> dem die „Herrschaft <strong>der</strong> Nullen“ e<strong>in</strong> bislang nicht für möglich gehaltenes<br />
Ausmaß angenommen hat. Demgegenüber müssen die 50ger und<br />
60ger Jahren, <strong>in</strong> denen <strong>Forsthoff</strong> se<strong>in</strong>e Thesen über den „Abschied vom<br />
Staat“ formulierte, nachgerade als e<strong>in</strong>e Idylle, als e<strong>in</strong> „goldenes Zeitalter“<br />
„echter“/„kraftvoller“ Staatlichkeit ersche<strong>in</strong>en, dessen Verlust man nur nachtrauern<br />
kann.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund könnten sich mit dem Ersche<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>es <strong>Forsthoff</strong>-<br />
Buchs über bloße historische Rem<strong>in</strong>iszenzen h<strong>in</strong>aus gewissermaßen auch<br />
programmatische Erwartungen verb<strong>in</strong>den. Sich unter den <strong>der</strong>zeitigen Gegebenheiten<br />
also noch e<strong>in</strong>mal ernsthaft auf die Analysen des se<strong>in</strong>erzeit<br />
quasi „berufsmäßigen Opponenten“ <strong>Forsthoff</strong> e<strong>in</strong>zulassen, den von ihm<br />
entwickelten Gedanken noch e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong>tensiv nachzuspüren, sie e<strong>in</strong>gehend<br />
zu analysieren und sich im Rahmen e<strong>in</strong>er weitgreifenden Werkgeschichte<br />
noch e<strong>in</strong>mal ihres - vor allem - politischen Gehalts zu vergewissern, das<br />
könnte e<strong>in</strong> ambitioniertes, aber durchaus lohnendes Vorhaben werden.<br />
II. Arbeitsplan Me<strong>in</strong>els<br />
Indessen, e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne verstandene Rekonstruktion des wissenschaftlichen<br />
Werks von <strong>Forsthoff</strong> liegt nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Absicht von Me<strong>in</strong>el. Se<strong>in</strong>e<br />
Intentionen zielen darauf ab, <strong>Forsthoff</strong> zu neuer wissenschaftlicher Reputation<br />
zu verhelfen, um die ambivalente Wertschätzung, die er heute <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
„scientific community“ genieße, zu überw<strong>in</strong>den.<br />
<strong>Forsthoff</strong>, sagt Me<strong>in</strong>el, sei nämlich nicht nur „<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Generation <strong>der</strong> bedeutendste<br />
Vertreter des Öffentlichen Rechts <strong>in</strong> Deutschland“ (ebd.) gewesen,<br />
son<strong>der</strong>n auch se<strong>in</strong>e „zentrale Stellung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wissenschaftsgeschichte<br />
des öffentlichen Rechts und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verfassungsgeschichte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
(sei) ganz unbestritten“ (ebd.). An<strong>der</strong>erseits aber sei se<strong>in</strong> Werk nur<br />
noch bed<strong>in</strong>gt präsent, sei „<strong>der</strong> Wissenschaft <strong>der</strong> Gegenwart zugleich nah<br />
und fern“ (S. 4). Nah vor allem <strong>in</strong> Gestalt se<strong>in</strong>er „epochemachende(n) Untersuchungen<br />
über das Recht <strong>der</strong> wohlfahrtsstaatlichen Verwaltung“, fern,<br />
weil die Debatten, die <strong>Forsthoff</strong> angestoßen und geprägt habe, <strong>in</strong>zwischen<br />
„historisch, um nicht zu sagen antiquarisch geworden“ seien (ebd.).<br />
Im Zentrum von <strong>Forsthoff</strong>s wissenschaftlichem Interesse habe e<strong>in</strong>e Fragestellung<br />
gestanden, „die sich trotz aller Brüche se<strong>in</strong>es Lebens im Grunde<br />
nie verän<strong>der</strong>t“ habe (S. 5). Me<strong>in</strong>el bezeichnet sie als die „durch alle Staatsformen<br />
h<strong>in</strong>durch virulent gebliebene Verfassungsfrage des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts“<br />
(ebd.) und me<strong>in</strong>t damit “die Auflösung <strong>der</strong> bürgerlichen Distanz zwischen<br />
Individuum und Staat“ (ebd.). Die daraus resultierende Problematik,<br />
„die mit dem Ende <strong>der</strong> Monarchie und <strong>der</strong> bürgerlichen <strong>Gesellschaft</strong>, mit<br />
dem Übergang zur Massendemokratie und zum bürokratischen Staat <strong>der</strong><br />
Dase<strong>in</strong>svorsorge entstanden“ sei (ebd.), sei für <strong>Forsthoff</strong> alles an<strong>der</strong>e als<br />
e<strong>in</strong>e Randfrage o<strong>der</strong> gar „als e<strong>in</strong>e bloß politische“ (ebd.) Angelegenheit gewesen.<br />
Vielmehr habe sie für ihn geradezu existentielle Bedeutung erlangt:
auf sie habe er se<strong>in</strong> gesamtes wissenschaftliches Räsonieren konzentriert,<br />
sie habe nicht alle<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e „Arbeitsweise“, son<strong>der</strong>n überhaupt „das geistige<br />
Selbstverständnis des <strong>Jurist</strong>en unmittelbar“ geprägt (ebd.). Denn hätten „die<br />
juristischen Formen des bürgerlichen Jahrhun<strong>der</strong>ts“ nach dessen „Liquidierung“<br />
auch „ihre <strong>in</strong>nere Rechtfertigung, ihr ‚Pr<strong>in</strong>zip’“ e<strong>in</strong>gebüßt, so hätten sie<br />
„doch (fort)bestanden“, ja hätten „fortbestehen (müssen), solange e<strong>in</strong> neues<br />
Ordnungsgefüge nicht gewonnen war“ (ebd.).<br />
Angesichts dieses Dilemmas macht Me<strong>in</strong>el <strong>in</strong> <strong>Forsthoff</strong>s Werk e<strong>in</strong> „geistesgeschichtliche(s)<br />
Problem“ aus, das es zu erforschen gelte. Und dieses Problem<br />
umschreibt er mit folgenden drei Fragen: „Auf welche Weise und mit<br />
welchen Vorverständnissen spiegelt sich <strong>in</strong> <strong>Forsthoff</strong>s Werk die deutsche<br />
Rechts- und Verfassungsgeschichte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts? Wie reagierte<br />
se<strong>in</strong> staats- und verwaltungsrechtliches Denken auf die Umbrüche und Zäsuren<br />
dieses Jahrhun<strong>der</strong>ts? Wie […] verän<strong>der</strong>ten sich <strong>in</strong> diesen Umbrüchen<br />
se<strong>in</strong>e Auffassungen vom Recht und se<strong>in</strong> Selbstverständnis als <strong>Jurist</strong>?“<br />
(ebd.) Damit hat Me<strong>in</strong>el zugleich se<strong>in</strong>en Arbeitsplan formuliert, dessen Implementierung<br />
die folgenden rd. 470 Druckseiten ausfüllen.<br />
III. Form <strong>der</strong> „Werkbiographie“<br />
Die äußere Form, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Me<strong>in</strong>el se<strong>in</strong>en Plan „abarbeiten“ will, bezeichnet er<br />
als „Werkbiographie“ (S. 9). Er bedient sich damit e<strong>in</strong>es Term<strong>in</strong>us, <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit<br />
für biographische Literatur (vornehmlich allerd<strong>in</strong>gs im Rahmen ihrer Rezension<br />
/ Rezeption) durchaus „en mode“ ist. Indessen, bislang läßt sich<br />
nicht feststellen, daß die Vokabel „Werkbiographie“ bereits <strong>in</strong>haltlich konsolidiert<br />
o<strong>der</strong> gar zu e<strong>in</strong>em fixen Bestandteil biographischer Fachterm<strong>in</strong>ologie<br />
geworden wäre. Und schon gar nicht läßt sich bisher ausmachen, daß sich<br />
<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Biographik <strong>in</strong> Gestalt von „Werkbiographie“ e<strong>in</strong> neues, gegenüber<br />
<strong>der</strong> „normalen“ Biographie eigenständiges Genre ausgebildet hätte. So<br />
erweist sich „Werkbiographie“ im Regelfall als e<strong>in</strong>e bloße Metonymie. Und<br />
<strong>der</strong>en e<strong>in</strong>zig erkennbare Funktion sche<strong>in</strong>t dar<strong>in</strong> zu bestehen, <strong>der</strong> alten, bie<strong>der</strong>en,<br />
e<strong>in</strong>e gleichrangige Berücksichtigung <strong>der</strong> beiden zentralen biographischen<br />
Elemente postulierenden Formel von „Leben und Werk“ e<strong>in</strong> mo<strong>der</strong>nistisches<br />
„facelift<strong>in</strong>g“ zu verpassen. Dies letztlich wohl auch deshalb, um<br />
dem verbreiteten Verdikt zu entgehen, dem sich e<strong>in</strong>e unter dem Banner von<br />
„Leben und Werk“ angetretene Biographik häufig ausgesetzt sieht, und das<br />
besagt, Biographie sei „Tratsch als Kunst“ (Walter Klier).<br />
Angesichts dieser Sachlage und <strong>in</strong> Anbetracht vor allem <strong>der</strong> Tatsache, daß<br />
<strong>Forsthoff</strong>s wissenschaftliches Werk nicht <strong>in</strong> konkreten „Lebensumständen“<br />
wurzelt, son<strong>der</strong>n sich im Grunde über Lebensabschnitte h<strong>in</strong>weg entwickelt<br />
hat, 1 so daß sich e<strong>in</strong>e strikte, unmittelbare Korrelation zwischen „Werk“ und<br />
“Leben“ regelmäßig we<strong>der</strong> aufdrängt, noch herstellen läßt, wäre es hilfreich<br />
gewesen, wenn Me<strong>in</strong>el se<strong>in</strong> persönliches Verständnis von „Werkbiographie“<br />
1 E<strong>in</strong>e Ausnahme macht se<strong>in</strong>e Schrift <strong>Der</strong> totale Staat, die er bekanntlich nicht<br />
se<strong>in</strong>em wissenschaftlichen Werk zugerechnet, son<strong>der</strong>n als „e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> politischer Absicht<br />
geschriebene Schrift“ ausgegeben hat, Schreiben vom 3.7. 1965 an den<br />
Wiener Dekan, Jur.Fak. HD, Personalvorgang <strong>Forsthoff</strong>; s. auch se<strong>in</strong>e Bemerkung<br />
gegenüber Stadelmann, Me<strong>in</strong>el, S. 74 FN 144.
erläutert hätte. Dabei hätte er dann <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch Gelegenheit gehabt,<br />
darzulegen, ob - und ggf. wie - sich denn <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Augen „Werk“ und „Biographie“<br />
im E<strong>in</strong>zelfall mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verb<strong>in</strong>den bzw. sich zu „Werkbiographie“<br />
verknüpfen. Etwa wenn o<strong>der</strong> weil Lebensgeschichte <strong>in</strong> diesem E<strong>in</strong>zelfall zur<br />
conditio e<strong>in</strong>es Werkes (o<strong>der</strong> auch umgekehrt: e<strong>in</strong> Werk zur conditio von Lebensgeschichte)<br />
geworden ist und sich damit als e<strong>in</strong> für die wissenschaftsgeschichtliche<br />
/ ideengeschichtliche Deutung dieses Werkes notwendiger<br />
(unverzichtbarer?) Faktor erweist. Dieser Aufgabe hat sich Me<strong>in</strong>el lei<strong>der</strong><br />
nicht gestellt. 2 Und dieses Defizit zeitigt Folgen.<br />
E<strong>in</strong>e von ihnen besteht dar<strong>in</strong>, daß Me<strong>in</strong>el ke<strong>in</strong>e Kriterien und demzufolge<br />
auch ke<strong>in</strong>e Begründung dafür anzubieten vermag, weshalb er an verschiedenen<br />
Stellen se<strong>in</strong>er Werkgeschichte überhaupt auf Ereignisse / Erlebnisse<br />
/ Vorgänge aus <strong>Forsthoff</strong>s Leben (Me<strong>in</strong>el verwendet wie<strong>der</strong>holt den vagen<br />
Begriff „Lebensumstände“) zurückgreift und warum er dann gerade diejenigen<br />
für präsentationswürdig ansieht, die er ausgewählt hat. Das wie<strong>der</strong>um<br />
erweckt den E<strong>in</strong>druck, die E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> „Lebensumstände“ erfolge ohneh<strong>in</strong><br />
nur colorandi causa.<br />
IV. Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Arbeit<br />
1. Darstellung<br />
Se<strong>in</strong>er Werkgeschichte hat Me<strong>in</strong>el quasi zwei Glie<strong>der</strong>ungsebenen e<strong>in</strong>gezogen.<br />
Auf <strong>der</strong> ersten, zeitlich determ<strong>in</strong>ierten, wird das <strong>Forsthoff</strong>sche Œuvre <strong>in</strong><br />
vier große Abschnitte, von Me<strong>in</strong>el „Teile“ genannt, geglie<strong>der</strong>t. Auf <strong>der</strong> zweiten,<br />
an <strong>der</strong> Sachthematik orientierten und die Arbeit eigentlich strukturierenden<br />
Ebene, wird <strong>der</strong> Stoff auf <strong>in</strong>sgesamt neun Kapitel aufgeteilt. Diese Kapitel<br />
s<strong>in</strong>d die zentrale Glie<strong>der</strong>ungse<strong>in</strong>heit <strong>der</strong> Arbeit.<br />
Im Ersten Teil (S. 13 - 98), E<strong>in</strong>flüsse und Bed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> geistigen Entwicklung<br />
<strong>Ernst</strong> <strong>Forsthoff</strong>s genannt, präsentiert Me<strong>in</strong>el - gewissermaßen als<br />
E<strong>in</strong>stieg - e<strong>in</strong>e Melange aus biographischem und werkgeschichtlichem Material.<br />
Den Anfang machen Überlegungen zu den „E<strong>in</strong>flußfaktoren“, denen<br />
Me<strong>in</strong>el e<strong>in</strong>e bestimmende Wirkung auf <strong>Forsthoff</strong>s Entwicklung zuspricht.<br />
Ihnen spürt er unter <strong>der</strong> Überschrift des ersten Kapitels Drei Väter nach.<br />
Wer allerd<strong>in</strong>gs erwartet, daß er nun mit drei Persönlichkeiten konfrontiert<br />
wird, die - vielleicht <strong>in</strong> verschiedenen Lebensphasen - bei ihm die „Rolle“<br />
des Vaters e<strong>in</strong>genommen haben, wird sich enttäuscht sehen. Es geht nur<br />
mittelbar um Personen, und auch dann ist nur von zwei leibhaftigen Menschen<br />
die Rede. Denn unter <strong>der</strong> Parole: „Drei Väter“, behandelt Me<strong>in</strong>el <strong>in</strong><br />
Wahrheit e<strong>in</strong>e Institution (das „väterliche Pfarrhaus“), e<strong>in</strong>e „Kohortenfrage“<br />
(<strong>Forsthoff</strong>s „Zugehörigkeit zur Kriegsjugendgeneration“) sowie den Vorgang<br />
e<strong>in</strong>er „Assimilation“ („die Begegnung mit Person und Werk se<strong>in</strong>es akademischen<br />
Lehrers“). Daran anschließend steht <strong>Forsthoff</strong>s Entscheidung für den<br />
totalen Staat (Zweites Kapitel) zur Debatte. Er<strong>in</strong>nert man sich daran, daß<br />
die die beiden Kapitel zusammenhaltende Generalüberschrift des ersten<br />
2 Das ersche<strong>in</strong>t um so erstaunlicher, als Me<strong>in</strong>el im H<strong>in</strong>blick auf das Werk Gehlens<br />
e<strong>in</strong>e „Werkbiographie“ offenkundig nicht vermißt, er sich hier vielmehr mit e<strong>in</strong>er<br />
schlichten, also ohne die E<strong>in</strong>beziehung biographischer Aspekte argumentierenden<br />
„werkgeschichtlichen Gesamt<strong>in</strong>terpretation“ (S. 9) zufrieden gibt.
Teils: E<strong>in</strong>flüsse und Bed<strong>in</strong>gungen <strong>der</strong> geistigen Entwicklung gelautet hatte,<br />
dann hat Me<strong>in</strong>el hier e<strong>in</strong>en beachtlichen dialektischen „Salto“ vollführt.<br />
Im Zweiten Teil (S. 99 - 222), Verstehende Verwaltungsrechtswissenschaft<br />
betitelt, befaßt sich Me<strong>in</strong>el mit dem unter dem Nationalsozialismus vollzogenen<br />
Verwaltungsumbau und <strong>der</strong> <strong>in</strong> dessen Folge erhobenen For<strong>der</strong>ung<br />
„nach e<strong>in</strong>er Erneuerung des Verwaltungsrechts und <strong>der</strong> verwaltungsrechtlichen<br />
Methode“ (S. 101). Er erörtert die Problematik an Hand e<strong>in</strong>es bipolaren<br />
Modells, <strong>in</strong> dem sich Bestandsaufnahmen, von Me<strong>in</strong>el Grundfragen genannt<br />
(Drittes Kapitel), und Gestaltungsoptionen gegenüberstehen: Die Dase<strong>in</strong>sverantwortung<br />
als Ordnungsidee des mo<strong>der</strong>nen Verwaltungsrechts<br />
(Viertes Kapitel).<br />
Im Dritten Teil (S. 223 - 352) mit <strong>der</strong> programmatischen Überschrift: Nach<br />
<strong>der</strong> Utopie, wendet sich Me<strong>in</strong>el den Werken <strong>Forsthoff</strong>s zu, von denen er<br />
sagt, daß sie nach se<strong>in</strong>er „Ernüchterung“ über den Nationalsozialismus entstanden<br />
s<strong>in</strong>d. Me<strong>in</strong>el tut sich mit dieser Qualifizierung um so leichter, als er<br />
ja nicht nur das gesamte (staats-)kirchenrechtliche Schrifttum e<strong>in</strong>schließlich<br />
<strong>der</strong> <strong>in</strong> diese Zeit fallenden kirchenpolitischen Aktivitäten <strong>Forsthoff</strong>s, son<strong>der</strong>n<br />
auch die Resonanzen ausklammert, die die Amtsführung des Königsberger<br />
Dekans auslösten. 3 Me<strong>in</strong>el erläutert die stattgehabte Zäsur zunächst an<br />
zwei disparaten rechtsphilosophischen Themenfel<strong>der</strong>n, mit denen sich<br />
<strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> den 30ger Jahren <strong>in</strong>tensiv befaßt Sprache und Institutionen<br />
(Fünftes Kapitel). Wenn Me<strong>in</strong>el dann aber auch noch die Arbeiten, die<br />
<strong>Forsthoff</strong> Zur Kritik <strong>der</strong> deutschen Nachkriegsverfassungen (Sechstes Kapitel)<br />
geschrieben hat, als e<strong>in</strong>e Frucht des Bruchs mit <strong>der</strong> „Utopie“ (des NS)<br />
ausgibt, dann kann diese Zuordnung nur akzeptiert werden, wenn die Präposition<br />
„nach“ strikt temporal <strong>in</strong>terpretiert wird.<br />
Damit ist die Arbeit an ihr eigentliches Ziel gelangt: Sie ist Im Staat <strong>der</strong> Industriegesellschaft<br />
(Vierter Teil, S. 353 - 482) angekommen, e<strong>in</strong>em Phänomen,<br />
von dem gesagt wird, es halte zwar vielfach an <strong>der</strong> überlieferten Nomenklatur<br />
fest, sei <strong>in</strong> Wahrheit aber doch nichts an<strong>der</strong>es als <strong>Der</strong> Rechtsstaat<br />
nach se<strong>in</strong>em Ende (Siebtes Kapitel). Die Kontroverse, die durch diese<br />
These ausgelöst wurde, zeichnet Me<strong>in</strong>el unter <strong>der</strong> Überschrift: Die skeptische<br />
Verfassungstheorie <strong>Ernst</strong> <strong>Forsthoff</strong>s und die Staatsrechtslehre <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik (Achtes Kapitel) detailliert nach. Den Abschluß bildet e<strong>in</strong><br />
Traktat über Status und Funktion des <strong>Jurist</strong>(en) <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriellen <strong>Gesellschaft</strong><br />
(Neuntes Kapitel).<br />
2. Würdigung<br />
Läßt man die Ausführungen von Me<strong>in</strong>els Revue passieren, dann ist zu konstatieren,<br />
daß er sich <strong>in</strong> den von ihm berücksichtigten Werken <strong>Forsthoff</strong>s<br />
und <strong>der</strong> sie tragenden Ideenwelt bestens auskennt. Er zeichnet die Entste-<br />
3 So heißt es etwa <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gutachten, das <strong>der</strong> Rektor <strong>der</strong> Universität Königsberg,<br />
von Grünberg, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Eigenschaft als ostpreußischer Gaudozentenführer erstattet:<br />
“Trotz <strong>der</strong> bisweilen etwas schillernden Art dieses Mannes lege ich großen<br />
Wert darauf, daß er <strong>der</strong> Universität Königsberg erhalten bleibt.“ (Gutachten für den<br />
Gaudozentenführer Thür<strong>in</strong>gen vom 04.09.1938, UA J, Best. U Abt IV, Nr. 14 Bl<br />
278r; s. auch das Gutachten des SD RFSS Ostpreußen vom 04.04.1940.)
hung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Werke sorgsam nach, beschreibt ihre ideengeschichtlichen<br />
Wurzeln, deckt die zwischen ihnen verlaufenden Verb<strong>in</strong>dungsl<strong>in</strong>ien<br />
auf, und berichtet ausführlich über die Kontroversen, die <strong>Forsthoff</strong> angezettelt<br />
und ausgefochten hat. Dem wissenschaftlichen Apparat nach zu urteilen,<br />
hat er die e<strong>in</strong>schlägige - auch fremdsprachige - Literatur mit viel Fleiß<br />
souverän zusammengetragen. Es versteht sich, daß manches an<strong>der</strong>s akzentuiert<br />
werden kann, als Me<strong>in</strong>el es tut, und daß zumal <strong>Forsthoff</strong>s determ<strong>in</strong>ierende<br />
Begriffsbildung 4 kritisch betrachtet werden kann. Und so verlokkend<br />
es wäre, dem nachzugehen, <strong>in</strong> dieser Anzeige kann darauf nicht näher<br />
e<strong>in</strong>gegangen werden. Mit zwei kurzen Schlaglichtern soll es hier se<strong>in</strong> Bewenden<br />
haben.<br />
Das e<strong>in</strong>e gilt dem „Überraschungscoup“, mit dem Me<strong>in</strong>el se<strong>in</strong>en Protagonisten<br />
zum Urvater <strong>der</strong> „Idee des verantwortungsteilenden Gewährleistungsstaates“<br />
(S. 195) ausruft. Das verwun<strong>der</strong>t schon deshalb, weil sich Me<strong>in</strong>el<br />
mit H<strong>in</strong>weisen auf e<strong>in</strong>e etwaige „Fortwirkung“ <strong>Forsthoff</strong>scher Gedanken ansonsten<br />
mehr als zurückhält. Auch weiß natürlich niemand, wie sich <strong>Forsthoff</strong><br />
zu dieser E<strong>in</strong>vernahme, resp. nachgetragenen Ehre, wirklich gestellt<br />
und ob er ihr vielleicht sogar zugestimmt hätte. Schließlich gehören Wi<strong>der</strong>sprüche<br />
ja zum Leben. Aber vielleicht ist die Berufung auf <strong>Forsthoff</strong> und<br />
se<strong>in</strong>e Ausrufung zum Urahn ja letztlich gar nichts an<strong>der</strong>es als e<strong>in</strong>e verkappte<br />
captatio benevolentiae?<br />
Das zweite gilt <strong>der</strong> „Endlosschleife“, mit <strong>der</strong> Me<strong>in</strong>el se<strong>in</strong>e Untersuchung abschließt.<br />
Er übernimmt dafür von <strong>Forsthoff</strong> „jene(.) oft zitierten Sätze(.)“, mit<br />
denen dieser e<strong>in</strong>st e<strong>in</strong>en Vortrag beendete, den er zu Ehren se<strong>in</strong>es Heidelberger<br />
Amtsvorvorgängers Gerhard Anschütz aus Anlaß von dessen hun<strong>der</strong>tstem<br />
Geburtstag gehalten hatte. Jene Sätze, die nach dem Willen von<br />
Me<strong>in</strong>el „auch am Ende dieser Untersuchung stehen“ sollen, lauten: „Wir leben<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeit, <strong>der</strong> es beschieden ist, nicht <strong>der</strong> Sieger, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Besiegten<br />
ehrend zu gedenken. Sie s<strong>in</strong>d es, die Beispiele gegeben und Maße<br />
gesetzt haben, denen wir uns verpflichtet wissen“ (alle Zitate S. 482).<br />
Mit dieser Rückkoppelung stellt sich <strong>der</strong> Autor demonstrativ an die Seite<br />
se<strong>in</strong>es Protagonisten. Er schließt damit e<strong>in</strong>en Annäherungsprozeß ab, von<br />
dessen Verlauf und e<strong>in</strong>zelnen Stadien <strong>der</strong> Leser auf den vorangehenden<br />
480 Seiten Zeuge geworden war und <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Identifikation des Autors mit<br />
se<strong>in</strong>em Protagonisten nun se<strong>in</strong>en krönenden Abschluß f<strong>in</strong>det. Da es offenkundig<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Absicht <strong>Forsthoff</strong>s lag, e<strong>in</strong> Stück des Ruhms, den er Gerhard<br />
Anschütz zusprach, auch für sich selbst zu reklamieren, werden wir nun<br />
auch Me<strong>in</strong>el zu den „Beispiele (gebenden) und Maße (setzenden)“ heimlichen<br />
„Siegern <strong>der</strong> Geschichte“ rechnen dürfen.<br />
E<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Frage ist es, ob e<strong>in</strong> so hoher Grad an Identifikation des Autors<br />
mit se<strong>in</strong>em Protagonisten, wie ihn die besagte Schlußsentenz ausweist,<br />
dem Buch gut tut. Jedenfalls verb<strong>in</strong>det sich mit Biographien wegen <strong>der</strong> ihnen<br />
geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong> zugeschriebenen Aufgabe e<strong>in</strong>er S<strong>in</strong>nkonstruktion <strong>in</strong> <strong>der</strong> Re-<br />
4 Schon <strong>der</strong> Zweitgutachter <strong>der</strong> Freiburger Habilitationsschrift, Wilhelm van Calker,<br />
hatte sich mit großer Noblesse von ihr distanziert; Me<strong>in</strong>el zitiert diese Passage<br />
se<strong>in</strong>es Votums auf S. 65 wörtlich, schreibt sie aber irrtümlich se<strong>in</strong>em Bru<strong>der</strong> Fritz,<br />
dem (ehemals) Straßburger Strafrechtler zu, bei dem C.S. promoviert hatte.
gel die Erwartung, daß <strong>der</strong> Autor e<strong>in</strong>e gewisse M<strong>in</strong>destdistanz zu se<strong>in</strong>em<br />
Objekt e<strong>in</strong>halte. Aber möglicherweise gilt auch diese Regel nicht ohne Ausnahme.<br />
Außerdem hatte Me<strong>in</strong>el sich ja gar nicht auf e<strong>in</strong>e „normale“ Biographie<br />
e<strong>in</strong>lassen, son<strong>der</strong>n eben e<strong>in</strong>e „Werkbiographie“ schreiben wollen.<br />
V. Im Speziellen: Zu den biografische Partien<br />
1. Behandlung <strong>der</strong> Quellen<br />
Jede auf überliefertem, schriftlich fixierten Quellenmaterial basierende Arbeit,<br />
mag sie sich nun als „Werkbiographie“, Werkgeschichte o<strong>der</strong> wie auch<br />
sonst immer verstehen, muß im Umgang mit und <strong>der</strong> Bearbeitung von diesem<br />
Quellenmaterial gewissen Standards gerecht werden. Dazu gehört<br />
u.a., daß Berichte über Ereignisse, Vorgänge, Erklärungen etc. quellenmäßig<br />
belegt werden, daß das vorhandene Quellenmaterial so vollständig wie<br />
möglich erhoben und se<strong>in</strong> Inhalt nicht nach Gusto herangezogen o<strong>der</strong> übergangen<br />
wird.<br />
Diesen - im Grunde re<strong>in</strong> handwerklichen - Anfor<strong>der</strong>ungen wird die Arbeit<br />
von Me<strong>in</strong>el <strong>in</strong> ihren über das Buch verteilten biographischen Parts vielfach<br />
nicht gerecht: Denn das vorhandene und zugängliche Quellenmaterial wird<br />
von Me<strong>in</strong>el nur unvollständig ausgeschöpft 5 und die herangezogenen Quellen<br />
werden ihrerseits z.T wie<strong>der</strong>um nur punktuell ausgewertet. 6 Das wie<strong>der</strong>-<br />
5 Beispielsweise: Me<strong>in</strong>el hätte sich se<strong>in</strong>e Spekulationen darüber, wie <strong>Forsthoff</strong><br />
se<strong>in</strong> Studium <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Anfangssemestern gestaltet hatte, ersparen können, wenn<br />
er die Quästurbücher <strong>der</strong> ALU (UA FR B 0017, Signatur 71) herangezogen und<br />
ausgewertet hätte. Nicht erhoben und ausgewertet hat er weiterh<strong>in</strong> etwa <strong>Forsthoff</strong>s<br />
Bonner Habilitationsakte (A. d. RuStw Fak. Bonn), <strong>Forsthoff</strong>s (undatierten,<br />
auf Anfor<strong>der</strong>ung v. 26.08. 1938 verfaßten) Lebenslauf, <strong>in</strong> dem er auch se<strong>in</strong>en Konflikt<br />
mit Richard Thoma ausführlich thematisiert (UA Jena Abt. IV, Nr. 14, Bl 282);<br />
ferner die Auskünfte, des Gaudozentenbundsführers Königsberg an den Gaudozentenbundsführer<br />
Thür<strong>in</strong>gen vom 4.9. 1938 (UA Jena Abt IV, Nr.14, Bl 278r und<br />
v) und des SD RFSS, Leitabschnitt Königsberg, an die Gauleitung Thür<strong>in</strong>gen v.<br />
4.7. 1940 (UA Jena Abt. IV, Nr.14, Bl. 288 / 289). Auch die Korrespondenz zwischen<br />
<strong>Forsthoff</strong> und G. A. Re<strong>in</strong>, die <strong>der</strong> Berufung <strong>Forsthoff</strong>s nach Hamburg vorang<strong>in</strong>g<br />
und die Auskünfte über die Beweggründe gibt, die <strong>Forsthoff</strong> zu se<strong>in</strong>em<br />
Wechsel nach Hamburg veranlaßten, hat Me<strong>in</strong>el nicht zur Kenntnis genommen.<br />
6 Beispielsweise konstruiert Me<strong>in</strong>el se<strong>in</strong>e These, <strong>Forsthoff</strong> habe sich „um <strong>in</strong> Wien<br />
dem Zugriff <strong>der</strong> Partei zu entgehen, (…) zum Militär e<strong>in</strong>ziehen“ lassen (S. 237),<br />
ohne dessen zahlreiche, völlig konträre Bekundungen (wie sie sich etwa, aber<br />
nicht nur, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Schriftsatz an den öffentl. Kläger v. 9.9.1946 o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anlage<br />
3 zum Fragebogen <strong>in</strong> <strong>der</strong> schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Entnazifizierungsakte f<strong>in</strong>den)<br />
auch nur ansatzweise zu erwähnen (von e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>haltlichen Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>zusetzen<br />
mit ihnen ganz zu schweigen), obwohl Me<strong>in</strong>el beide Dokumente kennt und<br />
mehrfach zitiert. <strong>Forsthoff</strong>s mit Variationen vielfach wie<strong>der</strong>holte Klage über se<strong>in</strong>e<br />
„vom Reichsstatthalter von Schirach veranlasst(e)“ E<strong>in</strong>ziehung zur Wehrmacht, die<br />
er übrigens auch <strong>in</strong> E<strong>in</strong>gaben an Wiener Behörden zur Sprache gebracht hat, wird<br />
von Me<strong>in</strong>el mit dem geradezu umwerfenden „Argument“ vom Tisch gefegt „<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Aufhebung <strong>der</strong> UK-Stellung (lag) mit Sicherheit ke<strong>in</strong> Akt <strong>der</strong> Repression“ (S. 237<br />
FN 68, Hervorhebung hier). Im übrigen darf vielleicht nachgefragt werden, weshalb<br />
<strong>Forsthoff</strong> es darauf angelegt haben sollte, sich „dem Zugriff (resp. Machtbereich)<br />
<strong>der</strong> Partei“ (S. 237 + FN 68) zu entziehen wo er doch, soweit ersichtlich, <strong>in</strong>
um nährt den Verdacht, daß <strong>der</strong> Dokumenten- und Informationsauswahl,<br />
resp. <strong>der</strong>en Präsentation, e<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressengeleitetes Vorverständnis zugrunde<br />
liegen könnte. 7 Weiterh<strong>in</strong> fällt auf, daß Me<strong>in</strong>el als Fundstellen für von ihm<br />
benutzte Quellen selbst dann vielfach nur private Sammlungen angibt, wenn<br />
<strong>der</strong> fragliche Beleg - z.T. sogar als Orig<strong>in</strong>al - <strong>in</strong> öffentlichen Archiven verwahrt<br />
wird. 8 Da private Sammlungen regelmäßig nicht frei und allgeme<strong>in</strong><br />
Wien gar nicht mit „<strong>der</strong> Partei“ über Kreuz lag, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> <strong>der</strong> Person des Reichsstatthalters<br />
se<strong>in</strong>en eigentlicher Gegenspieler hatte.<br />
7 Beispielweise entsteht dieser Verdacht, wenn <strong>Forsthoff</strong>s Schreiben vom<br />
3.7.1965 an den Wiener Dekan, das sich nicht nur se<strong>in</strong>er Intention, son<strong>der</strong>n sogar<br />
se<strong>in</strong>er ausdrücklich genannten Zweckbestimmung nach als e<strong>in</strong>e von Günther<br />
W<strong>in</strong>kler angeregte „Argumentationshilfe“ für den Adressaten zu erkennen gibt, als<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Forsthoff</strong> abgenötigte Pflichtleistung mit Rechtfertigungscharakter („<strong>Forsthoff</strong><br />
mußte sich schriftlich über den Totalen Staat erklären“, S 409, Hervorhebung hier)<br />
ausgegeben wird. Und dieser Verdacht wird weiter dadurch verstärkt, daß <strong>der</strong><br />
fragliche Brief, auf S. 409 FN 61 lediglich nachgewiesen wird, ohne den Leser<br />
darauf h<strong>in</strong>zuweisen, daß er längere wörtliche Passagen aus diesem Brief an zwei<br />
an<strong>der</strong>en Stellen f<strong>in</strong>den kann (S. 71 FN 130, S. 314 FN 67), jeweils allerd<strong>in</strong>gs mit<br />
signifikanten Auslassungen. So fehlt nicht nur die über die Motivation Auskunft<br />
gebende E<strong>in</strong>gangspassage (<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Forsthoff</strong> schreibt, von „Herrn Kollegen W<strong>in</strong>kler<br />
erfuhr ich, daß Ihnen … e<strong>in</strong>e Information zu me<strong>in</strong>er Schrift […] von Nutzen se<strong>in</strong><br />
würde.“ Hiermit schreibe ich Ihnen auf „se<strong>in</strong>en mir durchaus verständlichen<br />
Wunsch [….] e<strong>in</strong>ige Worte <strong>der</strong> Unterrichtung“), son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Halbsatz, mit<br />
dem <strong>Forsthoff</strong> se<strong>in</strong>e Beziehungen zu Benno Ziegler erläutert („mit dem ich über<br />
die Volkskonservative Partei politisch verbunden war“); schließlich fällt auch die<br />
durchaus bemerkenswerte Passage dem Rotstift von Me<strong>in</strong>el zum Opfer, <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Forsthoff</strong> erläutert, wie er denn se<strong>in</strong>e For<strong>der</strong>ung, die Juden seien „unschädlich“ zu<br />
machen, verstanden wissen wollte.<br />
8 Beispielsweise verweist Me<strong>in</strong>el für den Schriftsatz <strong>Forsthoff</strong>s vom 9.9.1946 an<br />
den öff. Kläger bei <strong>der</strong> Spruchkammer Heidelberg sowie für dessen Schreiben<br />
vom 10.05.1947 an den Dekan <strong>der</strong> Jur. Fak. Heidelberg als Fundstelle auf e<strong>in</strong>e<br />
private Sammlung. Tatsächlich ist <strong>der</strong> fragliche Schriftsatz aber Bestandteil <strong>der</strong><br />
Personalakte <strong>Forsthoff</strong>s - UA HD PA 3789 -, die Me<strong>in</strong>el übrigens <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Zusammenhängen<br />
selbst mehrfach zitiert hat (z.B. S. 305 FN 12); das Schreiben an<br />
den Dekan ist Bestandteil des von <strong>der</strong> Jur. Fak. Heidelberg verwahrten Personalvorgangs<br />
<strong>Forsthoff</strong>. - Weiterh<strong>in</strong> zitiert Me<strong>in</strong>el aus Briefen <strong>Forsthoff</strong>s an den Kölner<br />
Dekan Kraw<strong>in</strong>kel (v. 19.02.1948), an den Heidelberger Dekan Engisch (v. 22<br />
10.1949), an Rudolf Smend (v. 28.09.1950) sowie aus dem bereits erwähnten<br />
(s.o. FN 6) Brief an den Dekan <strong>der</strong> Wiener Fakultät (v. 3.7.1965), für die er jeweils<br />
den NL <strong>Forsthoff</strong> als Fundstelle angibt. Alle diese Briefe s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>dessen Bestandteil<br />
öffentlicher Archive, und zwar <strong>der</strong>jenige an Kraw<strong>in</strong>kel des UA Köln, <strong>der</strong>jenige an<br />
Smend <strong>der</strong> SUB Gött<strong>in</strong>gen, diejenigen an Engisch und Dekan Wien jeweils im<br />
Personalvorgang <strong>Forsthoff</strong> <strong>der</strong> Jur. Fak. Heidelberg; die auf S. 238 FN 78 erwähnten<br />
„Feldpostbriefe“ gehören zum Bestand <strong>der</strong> UB Heidelberg. Übrigens, wer sich<br />
für <strong>Forsthoff</strong>s Ergänzungsschriftsatz i.S Investitionshilfe <strong>in</strong>teressiert, ist - entgegen<br />
<strong>der</strong> Darstellung von Me<strong>in</strong>el (S. 389 FN 141) - nicht auf den NL C.S. angewiesen.<br />
Die mit „Ergänzende Bemerkungen zur Rechtswidrigkeit d. Investitionshilfegesetzes“<br />
betitelte Stellungnahme <strong>Forsthoff</strong>s vom 18.02.1954 (im Umfang von 10 S.) ist<br />
- bibliographierbar o<strong>der</strong> nicht - sowohl Bestandteil <strong>der</strong> Verfahrensakte <strong>der</strong> BReg.<br />
(die heute im BA zu f<strong>in</strong>den se<strong>in</strong> dürfte), und sie ist - selbstverständlich - auch Be-
zugänglich s<strong>in</strong>d, kommt diese Form <strong>der</strong> Nachweisführung dem Verweis <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>en Arkanbereich und damit <strong>der</strong> Verweigerung e<strong>in</strong>es Diskurses gleich.<br />
2. Umgang mit Fakten<br />
Dem legeren Umgang mit dem Quellenmaterial korrespondiert e<strong>in</strong>e gleichermaßen<br />
“lockere“ E<strong>in</strong>stellung zu den Fakten. So werden dem Leser von<br />
Me<strong>in</strong>el vielfach Ereignisse, Vorgänge etc. als „harte Tatsachen“ präsentiert,<br />
die sich dann allerd<strong>in</strong>gs bei näherem H<strong>in</strong>sehen als „taube Nüsse“ erweisen,<br />
sei es, daß es die behaupteten Ereignisse, Vorgänge etc. gar nicht gegeben<br />
hat, sei es, daß sie nicht so stattgefunden haben, wie sie von Me<strong>in</strong>el dargestellt<br />
werden. „Falsche Tatsachenbehauptungen“ dieser Art f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong><br />
allen biografischen Partien des Buches. „Randfragen“ bzw. „Nebensächlichkeiten“<br />
s<strong>in</strong>d von ihnen <strong>in</strong> gleicher Weise „angekränkelt“, wie auch die Darstellung<br />
<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Stationen von <strong>Forsthoff</strong>s akademischem Berufsweg<br />
mit ihnen durchsetzt ist. Wegen ihrer großen Zahl kann hier daher nicht auf<br />
jede e<strong>in</strong>zelne dieser Fehlbehauptungen näher e<strong>in</strong>gegangen, und es kann<br />
auch nicht <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall e<strong>in</strong> alle E<strong>in</strong>zelheiten berücksichtigen<strong>der</strong><br />
Nachweis geführt werden. Die nachfolgenden Auflistungen s<strong>in</strong>d daher auch<br />
eher nur beispielhaft gedacht, ihre Kommentierung erfolgt im Telegrammstil.<br />
a) Fehlbehauptungen allgeme<strong>in</strong>er Art.<br />
(1) S 16: <strong>Forsthoff</strong> ist nach se<strong>in</strong>em Assessorexamen zwar <strong>in</strong> den preußischen<br />
Justizdienst e<strong>in</strong>getreten, aber er war nicht <strong>in</strong> Bonn, son<strong>der</strong>n als<br />
„Hilfsrichter am AG Oberhausen“ tätig; 9<br />
(2) S. 19: die Bekanntschaft <strong>Forsthoff</strong>s mit Friedrich Gogarten, Hans<br />
Schomerus und Wilhelm Stapel wurde ganz gewiß nicht durch<br />
<strong>Forsthoff</strong>s Vater vermittelt; 10<br />
(3) S 43: <strong>Forsthoff</strong> hat se<strong>in</strong>e Wohnung nicht während se<strong>in</strong>er ganzen Freiburger<br />
PD-Zeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Thurnseestr. 67 gehabt; er hat ab Frühjahr 1932<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Thurnseestr. 56/58, ab WS 1932/33 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wer<strong>der</strong>str.11 gewohnt;<br />
11<br />
standteil <strong>der</strong> im BVerfG überlieferten Gerichtsakte 1BvR 484/54 geworden, die,<br />
jedenfalls heute, allgeme<strong>in</strong> zugänglich ist.<br />
9 Undatierter, vermutlich Anfang Dezember 1929 abgefaßter LL, den <strong>Forsthoff</strong> mit<br />
se<strong>in</strong>em Habilitationsantrag <strong>der</strong> Bonner Fakultät vorlegte, A. d. Rechts- u. Staatsw.<br />
Fakultät Bonn, Habilitationsakt Forsthof, n.p.<br />
10 Was Gogarten anbelangt, so hat <strong>Forsthoff</strong> ihn <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Glückwunschadresse zu<br />
Gogartens achtzigstem Geburtstag an ihre geme<strong>in</strong>sam verbrachte Zeit im R<strong>in</strong>g<br />
er<strong>in</strong>nert „über die wir mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> bekannt wurden“. Me<strong>in</strong>el hat diesen Brief übrigens<br />
selbst zitiert (S. 50 FN 9). - Hans Schomerus war, vermittelt durch se<strong>in</strong>e Zugehörigkeit<br />
zur Gött<strong>in</strong>ger Burschenschaft Germania, ebenso wie <strong>Forsthoff</strong> Mitglied<br />
im Deutschen Hochschulr<strong>in</strong>g (DHR). - Wilhelm Stapel gehörte neben se<strong>in</strong>er Funktion<br />
als Herausgeber des Deutschen Volkstums zu den Dozenten <strong>der</strong> - ebenfalls<br />
von dem DNHV getragenen - Fichte-Hochschule und trat <strong>in</strong> dieser Eigenschaft<br />
ziemlich regelmäßig als Redner vor Mitglie<strong>der</strong>n auch des DHR auf.<br />
11 An diese Anschrift war etwa auch <strong>der</strong> Erlaß des REM vom 27.10.1933 gerichtet,<br />
mit dem <strong>Forsthoff</strong> die Vertretung des Heller-Lehrstuhls übertragen wurde, s. UA F,<br />
Rektoratsakte Abt.4 Nr. 1194.
(4) S. 50: <strong>Forsthoff</strong>s Bekanntschaft mit Wilhelm Grewe gründete nicht im<br />
„R<strong>in</strong>g-Kreis“, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> Grewes Freiburger Studienzeit; 12<br />
(5) S 54: G. A. Re<strong>in</strong>, <strong>der</strong> Rektor <strong>der</strong> Hamburger Universität war ke<strong>in</strong>eswegs<br />
nur e<strong>in</strong> „parte<strong>in</strong>ahe(r) Historiker“, für den ihn Me<strong>in</strong>el ausgibt, son<strong>der</strong>n<br />
„natürlich“ PG; 13<br />
(6) S 237: Herbert Krüger wurde von Heidelberg nicht nach Hamburg,<br />
son<strong>der</strong>n nach Straßburg berufen; 14<br />
(7) S. 237: von Schirach hat nicht verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t, daß <strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> Wien e<strong>in</strong>e<br />
Wohnung bekam. Obwohl nicht im Besitz e<strong>in</strong>es „Son<strong>der</strong>mietsche<strong>in</strong>s“,<br />
<strong>der</strong> ihm auf Betreiben von Schirachs verweigert worden war, konnte<br />
<strong>Forsthoff</strong> 1943 <strong>in</strong> Wien sehr wohl e<strong>in</strong>e „ganz ausgezeichnete Wohnung“<br />
anmieten; 15<br />
(8) S 232: <strong>Forsthoff</strong> hat „e<strong>in</strong>en Ruf nach Jena“, den er <strong>in</strong> 1940 abgelehnt<br />
haben soll, tatsächlich nie erhalten; 16<br />
(9) S. 307: Theodor Steltzer war ke<strong>in</strong> „Königsberge(r) Bekannter“<br />
<strong>Forsthoff</strong>s; ihre Bekanntschaft entsprang vielmehr dem Milieu des<br />
„Schutzbundhauses“ (was man zuvor, auf S. 51, auch noch <strong>in</strong> etwa so<br />
hatte lesen können); 17<br />
12<br />
Grewe hörte als Freiburger Student bei <strong>Forsthoff</strong> und war Mitglied <strong>in</strong> dessen<br />
Sem<strong>in</strong>ar. 1933 wechselte er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Gefolge nach Frankfurt, 1935 nach Hamburg<br />
und 1936 nach Königsberg, s. Archiv des MPI für Europ. RG <strong>in</strong> Frankfurt, hs<br />
LL im NL Grewe.<br />
13<br />
Das muß man nicht erst bei Helmut Heiber: Universität unterm Hakenkreuz. -<br />
Teil 2. Die Kapitulation <strong>der</strong> Hohen Schulen. - Bd. 1. 1992, S. 511 nachschlagen,<br />
wenn man - wie Me<strong>in</strong>el - die Hamburger Dissertation von Arndt Goede (Adolf<br />
Re<strong>in</strong> und „die Idee <strong>der</strong> politischen Universität“, 2008) zitiert (s. S. 54 mit FN 36<br />
und 39). Goede nennt sogar Re<strong>in</strong>s E<strong>in</strong>trittsdatum (S. 76: „1. Mai 1933“).<br />
14<br />
S.<br />
http://www.munz<strong>in</strong>ger.de/search/portrait/Herbert+Kr%C3%BCger/0/10914.html<br />
[2012-07-28].<br />
15<br />
Schreiben <strong>Forsthoff</strong>s vom 22.3.1943 an den Heidelberger Dekan, Jur.Fak HD,<br />
Personalvorgang Forsthof.<br />
16<br />
Für die Wie<strong>der</strong>besetzung <strong>der</strong> <strong>in</strong> 1940 nach dem Wechsel von Ulrich Scheuner<br />
nach Gött<strong>in</strong>gen vakant gewordenen Professur benennt die Fakultät auf ihrer Vorschlagsliste<br />
die Professoren von Mangoldt (Tüb<strong>in</strong>gen), von Unruh (Frankfurt) und<br />
Ipsen (Hamburg). Den Ruf erhielt von Mangoldt, dem die Professur zum<br />
01.01.1941 übertragen wurde, s. UA J, Bestand BA, Nr. 2151, 2152. In den Fakultätsberatungen<br />
hatte sich Max Hildebert Boehm für <strong>Forsthoff</strong> engagiert, über die<br />
durchgehend negative Resonanz, auf die se<strong>in</strong> Vorschlag bei se<strong>in</strong>en Fakultätskollegen<br />
stieß, berichtet er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Brief vom 13.05.1948 an He<strong>in</strong>rich von Gleichen-<br />
Rußwurm, BA Koblenz, N 1077, Nr. 3.<br />
17<br />
In <strong>der</strong> Berl<strong>in</strong>er Motzstr.22 residierte nicht nur <strong>der</strong> Juniklub, dessen stimmberechtigtes<br />
Mitglied Steltzer war (Volker Mauersberger: Rudolf Pechel und die Deutsche<br />
Rundschau 1919 - 1933, 1971, S. 330), auch an<strong>der</strong>e Aktivitäten, die Steltzer<br />
pflegte, waren dort „verortet“ (s. Klaus Albers: Theodor Steltzer : Szenarien<br />
se<strong>in</strong>es Lebens, 2009, S. 199 - 200). Überdies waren Steltzer und <strong>Forsthoff</strong> zu Ende<br />
<strong>der</strong> 1920ger Jahre gleichermaßen Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Volkskonservativen Vere<strong>in</strong>igung<br />
gewesen.
(10) S. 308: Lt. Aktenlage bekleidete <strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kieler StK zu<br />
ke<strong>in</strong>em Zeitpunkt „das Amt e<strong>in</strong>es Referenten für Verfassungs- und Kirchenrecht“;<br />
18<br />
(11) S 414: Horst Ehmke war Gött<strong>in</strong>ger Studien- und später Freiburger<br />
Fakultätskollege von Konrad Hesse. Die Behauptung, er sei e<strong>in</strong><br />
„Schüler“ Hesses, entbehrt nicht e<strong>in</strong>er gewissen Komik; 19<br />
(12) S. 423 Alexan<strong>der</strong> Hollerbach war nie Assistent von Konrad<br />
Hesse, er war bis zu se<strong>in</strong>er Habilitation Assistent von Erik Wolf.<br />
b) Fehlerhafte Datierungen.<br />
(1) S. 230, 245: <strong>Der</strong> Beg<strong>in</strong>n von <strong>Forsthoff</strong>s Amtsdekanat <strong>in</strong> Königsberg<br />
wird zunächst auf 1939, später auf 1938 datiert, tatsächlich ist<br />
ke<strong>in</strong>e dieser beiden Angaben zutreffend; <strong>Forsthoff</strong> hatte das Dekanat seit<br />
Herbst 1936 <strong>in</strong>ne; 20<br />
(2) S 238 FN 78: Heft 1 - 9 <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Jur. Fak. <strong>der</strong> Universität<br />
Heidelberg herausgegebenen. Feldpostbriefe s<strong>in</strong>d nicht 1941 erschienen,<br />
son<strong>der</strong>n 1944, Heft 10 noch 1945;<br />
(3) S 239 FN 84: <strong>Forsthoff</strong>s Schreiben an den öffentlichen Kläger<br />
bei <strong>der</strong> Spruchkammer Heidelberg datiert nicht aus 1945, son<strong>der</strong>n aus<br />
1946 ;<br />
(4) S 410 FN 66: <strong>Forsthoff</strong>s Brief an Herbert Krüger datiert nicht<br />
aus 1965, son<strong>der</strong>n aus 1966.<br />
c) Fehlbehauptungen über <strong>Forsthoff</strong>s akademischen Berufsweg.<br />
(1) S.42: Richtig ist, „daß <strong>Forsthoff</strong> Smend (…) se<strong>in</strong>e akademische Karriere<br />
verdankte“, denn die Möglichkeit zur Habilitation <strong>in</strong> Freiburg bei<br />
Smends altem Bekannten Friedrich Marschall von Bieberste<strong>in</strong> war<br />
<strong>Forsthoff</strong> tatsächlich durch Rudolf Smend und niemand an<strong>der</strong>s eröffnet<br />
worden. Aber: die „Rahmengeschichte“, <strong>in</strong> die Me<strong>in</strong>el die „Vermittlung“<br />
Smends verpackt, und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e se<strong>in</strong>e Behauptung, Smend habe<br />
<strong>Forsthoff</strong> (erst) auf Grund e<strong>in</strong>es (dr<strong>in</strong>glichen) Telefonats, das C.S. am<br />
18.01.1930 mit ihm geführt haben soll, „umgehend“ an Marschall „vermit-<br />
18 <strong>Forsthoff</strong> wurde von MP Steltzer gegen Ende 1946 <strong>in</strong> die StK Kiel berufen und<br />
dort zunächst mit e<strong>in</strong>em „Son<strong>der</strong>auftrag“ beschäftigt. Obwohl absehbar war, daß<br />
für ihn <strong>in</strong> <strong>der</strong> Präsidialkanzlei auf Dauer ke<strong>in</strong>e Verwendungsmöglichkeit bestand<br />
und er daher „auf Anordnung des MP (…) im Bereich <strong>der</strong> Landesregierung e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden (sollte), etwa im MJ o<strong>der</strong> im MI“ (LBA S-H, PA <strong>Forsthoff</strong>), wurde er<br />
vom MP noch mit Urkunde von Samstag, dem 19.4.1947, also nur e<strong>in</strong>en Tag vor<br />
<strong>der</strong> Landtagswahl vom 20.4.1947, als „Referent für Kirchenrecht“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> StK e<strong>in</strong>gestellt<br />
und zum Oberregierungsrat ernannt. Nur für e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>stellung <strong>Forsthoff</strong>s als<br />
„Referent für Kirchenrecht“ war auch bei dem zuständigen Überprüfungsausschuß<br />
die Erteilung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen „Unbedenklichkeitsbesche<strong>in</strong>igung“ beantragt worden,<br />
nur für e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>stellung <strong>in</strong> dieser Funktion hatte auch die Britische Militärregierung<br />
nach mehrmaligem Anlauf letztlich ihre Zustimmung erteilt.<br />
19 Man schwankt, ob dem Mut, resp. <strong>der</strong> Sorglosigkeit des Autors o<strong>der</strong> <strong>der</strong> stillen<br />
Nachsicht <strong>der</strong> Referenten größere Bewun<strong>der</strong>ung gezollt werden muß.<br />
20 Gutachten NSDAP, Gaudozentenführer Ostpreußen, vom 4.9.1938, UA Jena, B.<br />
U Abt. IV, Bl. 278r.
telt“ (ebd.) ist blanke Mär. Zu dem von Me<strong>in</strong>el genannten Zeitpunkt (18.1.)<br />
hielt Marschall nämlich nicht nur bereits seit rd. drei Wochen Smends<br />
Empfehlung <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Händen, son<strong>der</strong>n er „brütete“ seitdem auch schon<br />
über <strong>Forsthoff</strong>s Unterlagen.<br />
(2) S 53: Me<strong>in</strong>el behauptet, <strong>Forsthoff</strong> habe Frankfurt den Rücken gekehrt,<br />
weil se<strong>in</strong> „Ord<strong>in</strong>ariat 1935 zum Extraord<strong>in</strong>ariat herabgestuft zu werden<br />
drohte“. Da sei es für ihn „Zeit (gewesen) zu gehen“, zumal es für ihn<br />
genug an<strong>der</strong>weitige „Möglichkeiten gab“. - Beides ist falsch.<br />
Daß Me<strong>in</strong>el für die von ihm behauptete, angeblich irgendwie „drohende“<br />
Umwandlung des Ord<strong>in</strong>ariats (wann?, durch wen?, warum?) ke<strong>in</strong>e Belege<br />
anzuführen vermag, ist ke<strong>in</strong> Zufall. Denn es gibt solche Belege nicht, 21<br />
und es kann sie „<strong>der</strong> Natur <strong>der</strong> Sache“ nach auch gar nicht geben, wenn<br />
man sich e<strong>in</strong>mal die Verknüpfung von materiellem Beamtenrecht mit dem<br />
Haushaltsrecht vor Augen hält.<br />
Was sodann die vielen „Möglichkeiten“ anbelangt, die <strong>Forsthoff</strong> angeblich<br />
außerhalb Frankfurts hatte, so verkennt Me<strong>in</strong>el ganz offensichtlich, daß<br />
dem Hochschullehrer nach <strong>der</strong> ns. „Revolution“ nur diejenigen Betätigungsmöglichkeiten<br />
offen standen, die ihm das REM eröffnete o<strong>der</strong> zubilligte.<br />
Das „Interesse“ e<strong>in</strong>er Fakultät an e<strong>in</strong>em Hochschullehrer o<strong>der</strong> auch<br />
ihr Beschluß, ihn kooptieren zu wollen, hatte für den Betroffenen ke<strong>in</strong>erlei<br />
praktische Relevanz, eröffnete ihm <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e noch lange ke<strong>in</strong>e reale<br />
„Betätigungsmöglichkeit“. Genau diese Restriktionen hatte <strong>Forsthoff</strong> übrigens<br />
zu dem Zeitpunkt, für den ihm Me<strong>in</strong>el alle Möglichkeiten <strong>der</strong> Welt attestiert,<br />
bereits selbst zu spüren bekommen, und zwar lustigerweise gerade<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> - fehlgeschlagenen - Leipziger Berufungsangelegenheit, die Me<strong>in</strong>el<br />
als e<strong>in</strong>en Beleg für se<strong>in</strong>e angeblich doch so vielen (Betätigungs-)„Möglichkeiten“<br />
anführt. 22<br />
(3) S. 54: <strong>Forsthoff</strong>s „Blitzberufung“ nach Hamburg kommentiert Me<strong>in</strong>el<br />
mit e<strong>in</strong>er aus <strong>der</strong> Korrespondenz mit Franz Beyerle entlehnten Bemerkung<br />
<strong>Forsthoff</strong>s, <strong>der</strong> zufolge er „gegen den geschlossenen Wi<strong>der</strong>stand <strong>der</strong><br />
Fakultät“ berufen worden sei. Das freilich ist e<strong>in</strong> Ammenmärchen, und<br />
Me<strong>in</strong>el muß die Unrichtigkeit <strong>der</strong> von ihm kommentarlos angeführten Behauptung<br />
auch kennen. Denn er zitiert <strong>in</strong> diesem Zusammenhang (S. 54<br />
FN 40) e<strong>in</strong>e Arbeit des Hamburger Historikers Hermann Weber, <strong>in</strong> <strong>der</strong> dieser<br />
sich mit den Vorgängen um <strong>Forsthoff</strong>s Berufung kritisch ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzt<br />
und den <strong>der</strong> Berufung zugrundeliegende Fakultätsbeschluß vom<br />
28.02.1935 wortwörtlich abdruckt. Dieser lautet: „Rechtsfakultät soweit <strong>in</strong>folge<br />
Ferien erreichbar erbittet überwiegend <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Berufung<br />
<strong>Forsthoff</strong>, lehnt (<strong>Ernst</strong>) von Hippel unbed<strong>in</strong>gt ab“. 23 Man wird sich nicht erst<br />
21 Jedenfalls ist den Akten <strong>der</strong> Frankfurter Universität we<strong>der</strong> über e<strong>in</strong>e stattgefundene,<br />
noch über e<strong>in</strong>e anstehende Umwandlung des fraglichen Ord<strong>in</strong>ariats irgend<br />
etwas bekannt.<br />
22 S. se<strong>in</strong> Schreiben vom 3.7.1934 an den Hamburger Rektor Re<strong>in</strong>, <strong>in</strong> dem er darüber<br />
beredte Klage führt, StA HH 361-5 II<br />
23 Schreiben des Rektors <strong>der</strong> Hamburger Universität (Re<strong>in</strong>) vom 28.02.1935 zur<br />
Unterrichtung an die Landesunterrichtsbehörde, StA HH B 361 – 5 II (Hochschulwesen),<br />
Hervorhebung hier.
auf Adam Riese berufen müssen, daß bei e<strong>in</strong>em „überwiegenden“ Votum<br />
e<strong>in</strong>er noch so schwach besetzten Fakultät von e<strong>in</strong>em „geschlossenen Wi<strong>der</strong>stand“<br />
ke<strong>in</strong>e Rede se<strong>in</strong> kann.<br />
(4) S. 226 - 227: Die Geschichte, die Me<strong>in</strong>el über <strong>Forsthoff</strong>s Abschied<br />
von Hamburg und speziell über die Begleitumstände dieses Abschieds erzählt,<br />
ist <strong>in</strong> toto unzutreffend. 24 We<strong>der</strong> hatte <strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> Hamburg „kaum<br />
e<strong>in</strong> Jahr gelehrt“, noch mußte er „se<strong>in</strong>en Lehrstuhl räumen“ (ebd.), schon<br />
gar nicht mußte er ihn „Ende 1935“ aufgeben; er wurde auch nicht „versetzt“,<br />
schon gar nicht „erzwang“ (S. 227) <strong>der</strong> „Gauführer und Präsident<br />
(...) des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Curt Rothenberger,“ (S. 226)<br />
<strong>Forsthoff</strong>s „Versetzung nach Königsberg“(S. 227). Nichts von alledem trifft<br />
zu. Die Fakten sehen an<strong>der</strong>s aus.<br />
Die Bemühungen <strong>der</strong> Universität Königsberg um <strong>Forsthoff</strong> setzen bereits<br />
e<strong>in</strong>, kaum daß <strong>Forsthoff</strong> se<strong>in</strong>e Hamburger Professur übernommen hatte.<br />
Schon mit Schreiben vom 9.7.1935 bittet <strong>der</strong> Rektor <strong>der</strong> Albertus-<br />
Universität se<strong>in</strong>en Hamburger Kollegen um se<strong>in</strong> „Urteil über die Persönlichkeit“<br />
<strong>Forsthoff</strong>s. Mit Schreiben vom 24.9.1935 unterrichtet sodann<br />
<strong>Forsthoff</strong> se<strong>in</strong>en Rektor darüber, daß <strong>der</strong> REM bei ihm angefragt habe,<br />
„ob ich bereit sei, <strong>in</strong> me<strong>in</strong>e Berufung an die Universität Königsberg e<strong>in</strong>zuwilligen“.<br />
Und knapp acht Wochen später, die mit dem REM geführten<br />
Verhandlungen s<strong>in</strong>d abgeschlossen, kann <strong>Forsthoff</strong> dem Rektorat unter<br />
dem 5.12.1935 mitteilen, daß er den Ruf nach Königsberg angenommen<br />
habe. Er setzt h<strong>in</strong>zu: „Nach den Eröffnungen, die man mir im M<strong>in</strong>isterium<br />
machte, war es mir nicht möglich, mich <strong>der</strong> mir <strong>in</strong> Königsberg zugedachten<br />
Aufgaben zu entziehen“. 25 Man spürt hier förmlich körperlich den Druck,<br />
vor dem <strong>Forsthoff</strong> nach Königsberg ausgewichen ist!<br />
(5) S. 237: Zu <strong>der</strong> These, <strong>Forsthoff</strong> habe sich, „um <strong>in</strong> Wien dem<br />
Zugriff <strong>der</strong> Partei zu entgehen, (…) zum Militär e<strong>in</strong>ziehen“ lassen, ist bereits<br />
das Nötige gesagt worden. Darauf kann hier verwiesen werden (s.o.<br />
FN 5).<br />
(6) S 409: Mit e<strong>in</strong>er bösen Verunglimpfung des Schweizer Staatsrechtlers<br />
Max Imboden verläßt die Arbeit den Boden jeglicher Objektivität.<br />
Es geht um die Jahrestagung <strong>der</strong> VDStRL 1965, die auf Grund e<strong>in</strong>er, i.w.<br />
auf Betreiben Max Imbodens ausgesprochenen E<strong>in</strong>ladung <strong>der</strong> Basler Fakultät<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> dortigen Universität stattf<strong>in</strong>den sollte und für die <strong>der</strong> Vorstand<br />
24 Als unzutreffend erweisen sich überdies e<strong>in</strong> weiteres Mal (s. bereits o. [2]) die<br />
hochschulpolitischen Annahmen, von denen Me<strong>in</strong>el ausgeht, so etwa die Behauptung<br />
„Königsberg war ke<strong>in</strong> ehrenvoller Ruf“ (S. 227). Me<strong>in</strong>el übersieht, daß Königsberg<br />
<strong>in</strong>zwischen zur „Grenzlanduniversität“ aufgestiegen und speziell se<strong>in</strong>e<br />
<strong>Jurist</strong>ische Fakultät zusammen mit denjenigen <strong>in</strong> Kiel und Breslau zur „Stoßtruppfakultät“<br />
erhoben worden war. Übrigens durch K. A. Eckhardt, e<strong>in</strong>en alten Bekannten<br />
<strong>Forsthoff</strong>s, <strong>der</strong> <strong>in</strong>zwischen (seit 1.10.1934) die Nachfolge von Achelis im REM<br />
angetreten hatte und nun auch die Berufungsverhandlungen mit <strong>Forsthoff</strong> führte.<br />
Glaubt Me<strong>in</strong>el wirklich, daß Eckhardt e<strong>in</strong>en von Hamburger Parteikreisen „stigmatisierten“<br />
<strong>Forsthoff</strong> auf e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Konzept so exponierte Stelle berufen haben<br />
würde?<br />
25 Alle Schreiben StA HH B 361-6, Sign. IV 257.
<strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>igung (Werner Weber) <strong>Forsthoff</strong> (auf dessen Bitten) das Hauptreferat<br />
übertragen hatte. Als im Mai 1965 die öffentlichen Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungen,<br />
die <strong>in</strong> Wien um Person und Werk <strong>Forsthoff</strong>s aus Anlaß se<strong>in</strong>er dort<br />
geplanten Ehrenpromotion geführt werden, auch <strong>in</strong> die Schweiz „überschwappen“,<br />
legt <strong>Forsthoff</strong> das übernommene Referat spontan nie<strong>der</strong>. 26<br />
Kurz darauf (und ohne Kenntnis von <strong>Forsthoff</strong>s Reaktion) wenden sich die<br />
Basler Professoren Kurt Eichenberger und Max Imboden sowie <strong>der</strong> Berner<br />
Hans Huber, allesamt Schweizer Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> VDStRL, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen<br />
Schreiben an <strong>der</strong>en Vorstand, um ihn über die Angriffe zu unterrichten,<br />
die nun auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweizer Presse gegen <strong>Forsthoff</strong> geführt<br />
werden. Sie schreiben: „Die für den Oktober 1965 geplante Tagung <strong>in</strong> Basel<br />
hat uns vor e<strong>in</strong> ernsthaftes Problem gestellt. Es liegt uns daran, Ihnen<br />
offen unsere Me<strong>in</strong>ung zu sagen (…) Die beiliegende Zeitungsnotiz (…)<br />
mag Ihnen zeigen, welche Frage die Öffentlichkeit beschäftigt. Professor<br />
<strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> Heidelberg, dem mit Blick auf die Dreissigerjahre <strong>der</strong> Vorwurf<br />
e<strong>in</strong>es militanten Antisemitismus gemacht wird, ist als e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> vier Referenten<br />
<strong>der</strong> Basler Tagung vorgesehen (…). Die Pressenotiz spricht e<strong>in</strong>e<br />
harte Sprache. Wir hatten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zwischenzeit Gelegenheit, den Text <strong>der</strong><br />
offenbar <strong>in</strong> Frage stehenden Schrift e<strong>in</strong>zusehen; <strong>der</strong> Inhalt ist <strong>der</strong>art, dass<br />
e<strong>in</strong>e nähere Erörterung die Situation nicht verbessern kann (…)“. 27<br />
Aus dieser Briefpassage „zaubert“ Me<strong>in</strong>el die Behauptung: “E<strong>in</strong>ige<br />
Schweizer Mitglie<strong>der</strong> (…), unter <strong>der</strong> Führung von Max Imboden, erhoben<br />
E<strong>in</strong>spruch gegen e<strong>in</strong>en Auftritt des - wie sie me<strong>in</strong>ten - „militanten Antisemiten“<br />
<strong>Forsthoff</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz.“ Diese Behauptung ist vor allem <strong>in</strong> Bezug<br />
auf den - noch en passant zum Rädelsführer ernannten - Max Imboden e<strong>in</strong>e<br />
glatte üble Nachrede. Sie legt ihm e<strong>in</strong> Urteil über <strong>Forsthoff</strong> als persönliche<br />
Äußerung <strong>in</strong> die Fe<strong>der</strong>, das gar nicht von ihm stammt und das er sich<br />
auch nicht zu eigen gemacht hat. Das ist e<strong>in</strong>e böse Verdrehung <strong>der</strong> Fakten.<br />
VI. Resümee<br />
Me<strong>in</strong>el hat e<strong>in</strong>e umfangreiche Arbeit vorgelegt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> er auf sehr unterschiedlichem<br />
Niveau zwei disparate Themenfel<strong>der</strong> behandelt. Lei<strong>der</strong> bleiben<br />
diese unverbunden nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> stehen. Sie mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
zu setzen, vielleicht sogar mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> „<strong>in</strong>s Gespräch“ zu br<strong>in</strong>gen, gel<strong>in</strong>gt<br />
Me<strong>in</strong>el nicht, denn er zeigt sich nur e<strong>in</strong>em <strong>der</strong> beiden Themen wirklich<br />
gewachsen. Für die an<strong>der</strong>e Thematik, die Biographik, hat er „ke<strong>in</strong> Händchen“<br />
und läßt für <strong>der</strong>en Problematik auch sonst wenig Gespür erkennen.<br />
Wenn Me<strong>in</strong>el sich trotzdem auf dieses Terra<strong>in</strong> e<strong>in</strong>läßt, so mag dies durchaus<br />
von Mut zeugen, aber e<strong>in</strong>en Gefallen hat er sich damit doch nicht getan.<br />
Weniger wäre mehr gewesen.<br />
Gerd Sälzer<br />
26 Mit Schreiben vom 7.5.1965, s. auch se<strong>in</strong>en Brief an C.S vom 9.5.1965, <strong>in</strong>:<br />
Briefwechsel <strong>Ernst</strong> <strong>Forsthoff</strong> - Carl Schmitt : (1926 - 1974) / hrsg. von Dorothee<br />
Mußgnug …, 2007, S. 210 (Hervorhebung hier).<br />
27 Schreiben vom 10.5.1965 an Werner Weber, Abschrift FES Dep. Horst Ehmke<br />
1/ HEA 502.
QUELLE<br />
Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und<br />
Wissenschaft<br />
http://ifb.bsz-bw.de/<br />
http://ifb.bsz-bw.de/bsz338028323rez-1.pdf