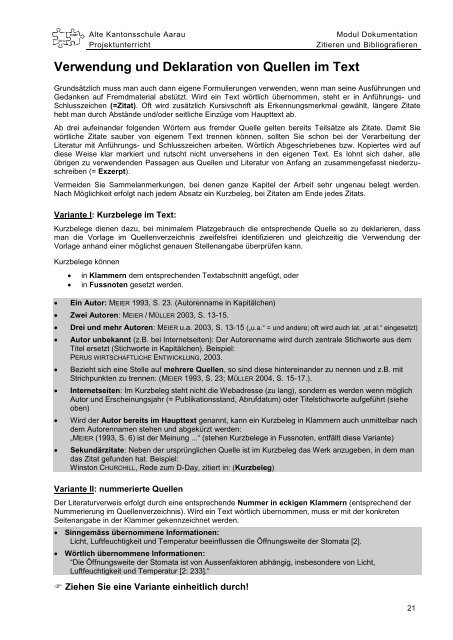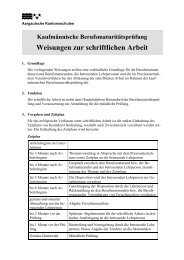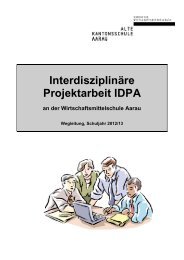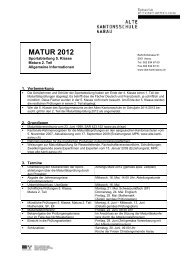Quellenverzeichnis (Bibliografie / Filmografie / Mediografie)
Quellenverzeichnis (Bibliografie / Filmografie / Mediografie)
Quellenverzeichnis (Bibliografie / Filmografie / Mediografie)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Alte Kantonsschule Aarau<br />
Projektunterricht<br />
Verwendung und Deklaration von Quellen im Text<br />
Modul Dokumentation<br />
Zitieren und <strong>Bibliografie</strong>ren<br />
Grundsätzlich muss man auch dann eigene Formulierungen verwenden, wenn man seine Ausführungen und<br />
Gedanken auf Fremdmaterial abstützt. Wird ein Text wörtlich übernommen, steht er in Anführungs- und<br />
Schlusszeichen (=Zitat). Oft wird zusätzlich Kursivschrift als Erkennungsmerkmal gewählt, längere Zitate<br />
hebt man durch Abstände und/oder seitliche Einzüge vom Haupttext ab.<br />
Ab drei aufeinander folgenden Wörtern aus fremder Quelle gelten bereits Teilsätze als Zitate. Damit Sie<br />
wörtliche Zitate sauber von eigenem Text trennen können, sollten Sie schon bei der Verarbeitung der<br />
Literatur mit Anführungs- und Schlusszeichen arbeiten. Wörtlich Abgeschriebenes bzw. Kopiertes wird auf<br />
diese Weise klar markiert und rutscht nicht unversehens in den eigenen Text. Es lohnt sich daher, alle<br />
übrigen zu verwendenden Passagen aus Quellen und Literatur von Anfang an zusammengefasst niederzuschreiben<br />
(= Exzerpt).<br />
Vermeiden Sie Sammelanmerkungen, bei denen ganze Kapitel der Arbeit sehr ungenau belegt werden.<br />
Nach Möglichkeit erfolgt nach jedem Absatz ein Kurzbeleg, bei Zitaten am Ende jedes Zitats.<br />
Variante I: Kurzbelege im Text:<br />
Kurzbelege dienen dazu, bei minimalem Platzgebrauch die entsprechende Quelle so zu deklarieren, dass<br />
man die Vorlage im <strong>Quellenverzeichnis</strong> zweifelsfrei identifizieren und gleichzeitig die Verwendung der<br />
Vorlage anhand einer möglichst genauen Stellenangabe überprüfen kann.<br />
Kurzbelege können<br />
� in Klammern dem entsprechenden Textabschnitt angefügt, oder<br />
� in Fussnoten gesetzt werden.<br />
� Ein Autor: MEIER 1993, S. 23. (Autorenname in Kapitälchen)<br />
� Zwei Autoren: MEIER / MÜLLER 2003, S. 13-15.<br />
� Drei und mehr Autoren: MEIER u.a. 2003, S. 13-15 („u.a.“ = und andere; oft wird auch lat. „et al.“ eingesetzt)<br />
� Autor unbekannt (z.B. bei Internetseiten): Der Autorenname wird durch zentrale Stichworte aus dem<br />
Titel ersetzt (Stichworte in Kapitälchen). Beispiel:<br />
PERUS WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG, 2003.<br />
� Bezieht sich eine Stelle auf mehrere Quellen, so sind diese hintereinander zu nennen und z.B. mit<br />
Strichpunkten zu trennen: (MEIER 1993, S. 23; MÜLLER 2004, S. 15-17.).<br />
� Internetseiten: Im Kurzbeleg steht nicht die Webadresse (zu lang), sondern es werden wenn möglich<br />
Autor und Erscheinungsjahr (= Publikationsstand, Abrufdatum) oder Titelstichworte aufgeführt (siehe<br />
oben)<br />
� Wird der Autor bereits im Haupttext genannt, kann ein Kurzbeleg in Klammern auch unmittelbar nach<br />
dem Autorennamen stehen und abgekürzt werden:<br />
„MEIER (1993, S. 6) ist der Meinung ...“ (stehen Kurzbelege in Fussnoten, entfällt diese Variante)<br />
� Sekundärzitate: Neben der ursprünglichen Quelle ist im Kurzbeleg das Werk anzugeben, in dem man<br />
das Zitat gefunden hat. Beispiel:<br />
Winston CHURCHILL, Rede zum D-Day, zitiert in: (Kurzbeleg)<br />
Variante II: nummerierte Quellen<br />
Der Literaturverweis erfolgt durch eine entsprechende Nummer in eckigen Klammern (entsprechend der<br />
Nummerierung im <strong>Quellenverzeichnis</strong>). Wird ein Text wörtlich übernommen, muss er mit der konkreten<br />
Seitenangabe in der Klammer gekennzeichnet werden.<br />
� Sinngemäss übernommene Informationen:<br />
Licht, Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflussen die Öffnungsweite der Stomata [2].<br />
� Wörtlich übernommene Informationen:<br />
“Die Öffnungsweite der Stomata ist von Aussenfaktoren abhängig, insbesondere von Licht,<br />
Luftfeuchtigkeit und Temperatur [2: 233].“<br />
� Ziehen Sie eine Variante einheitlich durch!<br />
21