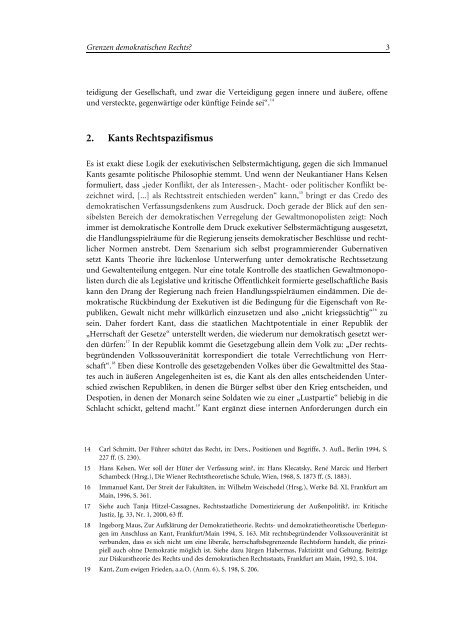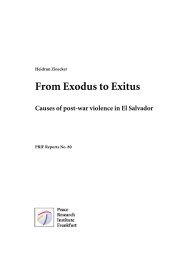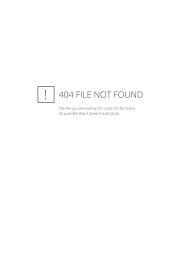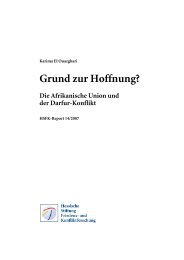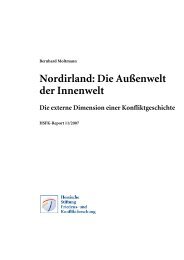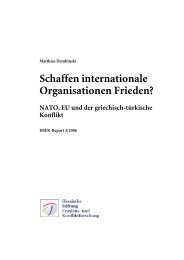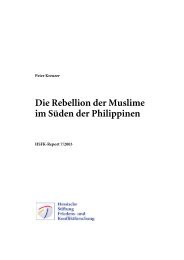Grenzen demokratischen Rechts? Die ... - eDoc
Grenzen demokratischen Rechts? Die ... - eDoc
Grenzen demokratischen Rechts? Die ... - eDoc
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grenzen</strong> <strong>demokratischen</strong> <strong>Rechts</strong>? 3<br />
teidigung der Gesellschaft, und zwar die Verteidigung gegen innere und äußere, offene<br />
und versteckte, gegenwärtige oder künftige Feinde sei“. 14<br />
2. Kants <strong>Rechts</strong>pazifismus<br />
Es ist exakt diese Logik der exekutivischen Selbstermächtigung, gegen die sich Immanuel<br />
Kants gesamte politische Philosophie stemmt. Und wenn der Neukantianer Hans Kelsen<br />
formuliert, dass „jeder Konflikt, der als Interessen-, Macht- oder politischer Konflikt bezeichnet<br />
wird, [...] als <strong>Rechts</strong>streit entschieden werden“ kann, 15 bringt er das Credo des<br />
<strong>demokratischen</strong> Verfassungsdenkens zum Ausdruck. Doch gerade der Blick auf den sensibelsten<br />
Bereich der <strong>demokratischen</strong> Verregelung der Gewaltmonopolisten zeigt: Noch<br />
immer ist demokratische Kontrolle dem Druck exekutiver Selbstermächtigung ausgesetzt,<br />
die Handlungsspielräume für die Regierung jenseits demokratischer Beschlüsse und rechtlicher<br />
Normen anstrebt. Dem Szenarium sich selbst programmierender Gubernativen<br />
setzt Kants Theorie ihre lückenlose Unterwerfung unter demokratische <strong>Rechts</strong>setzung<br />
und Gewaltenteilung entgegen. Nur eine totale Kontrolle des staatlichen Gewaltmonopolisten<br />
durch die als Legislative und kritische Öffentlichkeit formierte gesellschaftliche Basis<br />
kann den Drang der Regierung nach freien Handlungsspielräumen eindämmen. <strong>Die</strong> demokratische<br />
Rückbindung der Exekutiven ist die Bedingung für die Eigenschaft von Republiken,<br />
Gewalt nicht mehr willkürlich einzusetzen und also „nicht kriegssüchtig“ 16 zu<br />
sein. Daher fordert Kant, dass die staatlichen Machtpotentiale in einer Republik der<br />
„Herrschaft der Gesetze“ unterstellt werden, die wiederum nur demokratisch gesetzt werden<br />
dürfen: 17 In der Republik kommt die Gesetzgebung allein dem Volk zu: „Der rechtsbegründenden<br />
Volkssouveränität korrespondiert die totale Verrechtlichung von Herrschaft“.<br />
18 Eben diese Kontrolle des gesetzgebenden Volkes über die Gewaltmittel des Staates<br />
auch in äußeren Angelegenheiten ist es, die Kant als den alles entscheidenden Unterschied<br />
zwischen Republiken, in denen die Bürger selbst über den Krieg entscheiden, und<br />
Despotien, in denen der Monarch seine Soldaten wie zu einer „Lustpartie“ beliebig in die<br />
Schlacht schickt, geltend macht. 19 Kant ergänzt diese internen Anforderungen durch ein<br />
14 Carl Schmitt, Der Führer schützt das Recht, in: Ders., Positionen und Begriffe, 3. Aufl., Berlin 1994, S.<br />
227 ff. (S. 230).<br />
15 Hans Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, in: Hans Klecatsky, René Marcic und Herbert<br />
Schambeck (Hrsg.), <strong>Die</strong> Wiener <strong>Rechts</strong>theoretische Schule, Wien, 1968, S. 1873 ff. (S. 1883).<br />
16 Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, in: Wilhelm Weischedel (Hrsg.), Werke Bd. XI, Frankfurt am<br />
Main, 1996, S. 361.<br />
17 Siehe auch Tanja Hitzel-Cassagnes, <strong>Rechts</strong>staatliche Domestizierung der Außenpolitik?, in: Kritische<br />
Justiz, Jg. 33, Nr. 1, 2000, 63 ff.<br />
18 Ingeborg Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie. <strong>Rechts</strong>- und demokratietheoretische Überlegungen<br />
im Anschluss an Kant, Frankfurt/Main 1994, S. 163. Mit rechtsbegründender Volkssouveränität ist<br />
verbunden, dass es sich nicht um eine liberale, herrschaftsbegrenzende <strong>Rechts</strong>form handelt, die prinzipiell<br />
auch ohne Demokratie möglich ist. Siehe dazu Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge<br />
zur Diskurstheorie des <strong>Rechts</strong> und des <strong>demokratischen</strong> <strong>Rechts</strong>staats, Frankfurt am Main, 1992, S. 104.<br />
19 Kant, Zum ewigen Frieden, a.a.O. (Anm. 6), S. 198, S. 206.