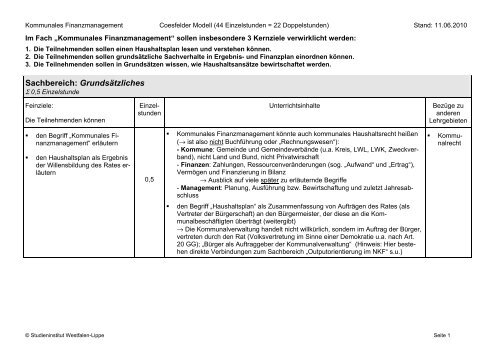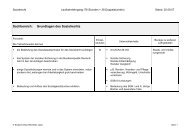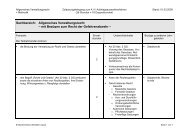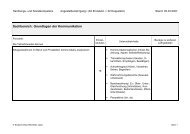Sachbereich: Grundsätzliches - Studieninstitut Westfalen Lippe
Sachbereich: Grundsätzliches - Studieninstitut Westfalen Lippe
Sachbereich: Grundsätzliches - Studieninstitut Westfalen Lippe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
Im Fach „Kommunales Finanzmanagement“ sollen insbesondere 3 Kernziele verwirklicht werden:<br />
1. Die Teilnehmenden sollen einen Haushaltsplan lesen und verstehen können.<br />
2. Die Teilnehmenden sollen grundsätzliche Sachverhalte in Ergebnis- und Finanzplan einordnen können.<br />
3. Die Teilnehmenden sollen in Grundsätzen wissen, wie Haushaltsansätze bewirtschaftet werden.<br />
<strong>Sachbereich</strong>: <strong>Grundsätzliches</strong><br />
Σ 0,5 Einzelstunde<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� den Begriff „Kommunales Finanzmanagement“<br />
erläutern<br />
� den Haushaltsplan als Ergebnis<br />
der Willensbildung des Rates erläutern <br />
Einzelstunden<br />
0,5<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� Kommunales Finanzmanagement könnte auch kommunales Haushaltsrecht heißen<br />
(→ ist also nicht Buchführung oder „Rechnungswesen“):<br />
- Kommune: Gemeinde und Gemeindeverbände (u.a. Kreis, LWL, LWK, Zweckverband),<br />
nicht Land und Bund, nicht Privatwirschaft<br />
- Finanzen: Zahlungen, Ressourcenveränderungen (sog. „Aufwand“ und „Ertrag“),<br />
Vermögen und Finanzierung in Bilanz<br />
→ Ausblick auf viele später zu erläuternde Begriffe<br />
- Management: Planung, Ausführung bzw. Bewirtschaftung und zuletzt Jahresabschluss<br />
� den Begriff „Haushaltsplan“ als Zusammenfassung von Aufträgen des Rates (als<br />
Vertreter der Bürgerschaft) an den Bürgermeister, der diese an die Kommunalbeschäftigten<br />
überträgt (weitergibt)<br />
→ Die Kommunalverwaltung handelt nicht willkürlich, sondern im Auftrag der Bürger,<br />
vertreten durch den Rat (Volksvertretung im Sinne einer Demokratie u.a. nach Art.<br />
20 GG); „Bürger als Auftraggeber der Kommunalverwaltung“ (Hinweis: Hier bestehen<br />
direkte Verbindungen zum <strong>Sachbereich</strong> „Outputorientierung im NKF“ s.u.)<br />
� Kommunalrecht<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 1
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Übersicht Haushaltskreislauf: Planung – Ausführung – Jahresabschluss, -prüfung<br />
Σ 0,5 Einzelstunde<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� die Haushaltswirtschaft in Zeitphasen<br />
(Planung, Bewirtschaftung,<br />
Jahresabschluss) einteilen<br />
und die an der Haushaltswirtschaft<br />
beteiligten Stellen nennen<br />
Einzelstunden<br />
0,5<br />
Unterrichtsinhalte<br />
Beteiligte Stellen im Überblick und ohne gesetzliche Fundstellen:<br />
Fachämter, Kämmerei, Bürgermeister/-in, Fachausschüsse und Rat<br />
Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 2
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Outputorientierung im NKF<br />
Σ 2 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� den Begriff „Outputorientierung“ erläutern<br />
� die Begriffe „Produkt“- „Produktbereich“-<br />
„Produktgruppe“-„Leistung“ im Zusammenhang<br />
mit der Outputorientierung erläutern<br />
� die Begriffe „Ziele“ im Zusammenhang<br />
mit der Outputorientierung erläutern<br />
� die Notwendigkeit von Kennzahlen für<br />
die Outputorientierung erläutern<br />
Einzelstunden<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Rechtsgrundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft<br />
Σ 0,5 Einzelstunde<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� anhand von Beispielen die öffentliche<br />
Finanzwirtschaft von der Privatwirtschaft<br />
abgrenzen und dabei auf wesentliche<br />
Unterschiede eingehen<br />
2<br />
Einzelstunden<br />
0,5<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� Ein Teilplan wird bzgl. nebenstehender Begrifflichkeiten analysiert<br />
� Die Kette „Outputorientierung“ - Ziele – Kennzahlen – Ressourcenplanung<br />
(abgebildet im Teilergebnis- und Teilfinanzplan) wird dargestellt.<br />
Die Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen wird nicht verlangt!<br />
� § 12 GemHVO: Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung und als Teil des<br />
Haushaltsgrundsatzes der Verständlichkeit (Haushaltsklarheit)<br />
� § 41 (1) Buchstabe t GO: Unterstützung der Produktorientierung mit strategischer<br />
Zieldefinitionen, die in die Zuständigkeit des Rates nach §41 (1)<br />
Buchstabe t GO fällt<br />
� § 4 GemHVO: konkrete Ausgestaltung der strategischen Ziele durch operative<br />
Ziele in jedem Teilplan<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 3<br />
� Verwaltungsorganisation<br />
� Buchführung<br />
im<br />
NKF<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� Bindung an Plan (→ Notwendigkeit des Haushaltsplans) gegenüber Anpassung<br />
an die Marktlage
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Grundlagen der Abgrenzung von Einzahlung und Erträgen sowie Auszahlung und Aufwand<br />
Σ 6 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden<br />
können<br />
� anhand von<br />
Beispielen Einzahlungen<br />
von<br />
Erträgen und<br />
Auszahlungen<br />
von Aufwendungenabgrenzen <br />
Einzelstunden<br />
6<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� Definition von Aufwand und Ertrag als Veränderung des Eigenkapitals in einer Periode. Didaktischer<br />
Hinweis: Die Teilnehmen verstehen nur durch Anwendung dieser Definition den Begriff Aufwand.<br />
� Einfache Bilanz mit Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital<br />
� Exemplarische/ beispielhafte Sachverhalte (pflichtig für die (Zwischen)Prüfung):<br />
- Kauf von Anlagevermögen (=Investition): Zusammenhang zwischen einer Investitionsauszahlung und den<br />
darauf folgenden Abschreibungen bei abnutzbaren Anlagevermögen (die lineare Abschreibung ist hier<br />
ausreichend; die geom.-degr. Abschreibung wird im Fach „Buchführung“ behandelt).<br />
- Lfd. Verwaltungstätigkeit (=Konsum): normalerweise Aufwand = Auszahlungen, in Sonderfällen sind Periodenabgrenzungen<br />
notwendig, (z.B. Stromrechnung wird bezahlt: aus aktuellem Jahr, aus Vorjahr)<br />
- Definition von Investition im Sinne des KFM (Veränderung von Anlagevermögen) in Abgrenzung zur Umgangssprache<br />
(z.B. Fortbildung von Personal ist keine Investition im Sinne des KFM) und in Abgrenzung<br />
zur Lebenswirklichkeit (z.B. Sanierung eines Daches ist keine Investition im Sinne des KFM)<br />
- Kreditaufnahme: Zuerst Einzahlung (aber kein Ertrag), dann Folgewirkungen: Zinsen (Auszahlung und<br />
Aufwand), sowie Tilgung (Auszahlung, aber kein Aufwand); mit einfacher Berechnung von Zinsen und Tilgung<br />
bei Ratenzahlungskrediten (= Tilgung in gleich hohen Raten), aber nicht beim Annuitätenkredit (=<br />
Summe aus Zinsen und Tilgung ist konstant)<br />
- Periodenabgrenzungen: Unterschied von Personalauszahlungen und Personalaufwand bei aktiven Beamten<br />
durch Pensionsrückstellungsbildung (keine Pensionrückstellungsauflösung in Prüfung); Zahlung der<br />
Januar-Beamtenbesoldung Ende Dezember des Vorjahrs; Vorauszahlungen von erheblichen Mieten<br />
- Einzahlungen und/ oder Erträge: Steuern, Gebühren, Schlüsselzuweisungen u.a.;<br />
Beiträge (Kanalanschluss- und Straßenanliegerbeiträge) erst im 2. Teil dieses Lernziels<br />
- Kreisumlage: Aus Sicht der Gemeinde, aus Sicht des Kreises<br />
- Geringes Vorratsvermögen wg. Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ gemäß §75(1) S.2 GO:<br />
Büromaterial, Papiervorrat etc. wird gekauft und sofort als Aufwand verbucht (Sofortverbrauchsfiktion),<br />
der reale Verbrauch, egal in welchem Haushaltsjahr, wird nicht abgebildet (verbucht).<br />
- SoPo, GWGs und pRAP im 2.Teil dieses Feinlernziels (für VFA nach der Zwischenprüfung)<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 4<br />
� Buchführung
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Allgemeine Haushaltsgrundsätze<br />
Σ 1 Einzelstunde<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden<br />
können<br />
� die allgemeinenHaushaltsgrundsätze<br />
nennen und<br />
deren Inhalte<br />
und<br />
Grundbedeutungbeschreiben <br />
Einzelstunden<br />
1<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� § 75 GO (Nachfolgend pflichtige Inhalte für die (Zwischen)Prüfung)<br />
- (1) S.1 Stetige Aufgabenerfüllung<br />
- (1) S.2 Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Sparsamkeit<br />
- (2) (Genereller) Haushaltsausgleich (Satz 1 u.2) und<br />
(fiktiver) mit Ausgleichsrücklage (Satz 3):<br />
Höhe: nur ganz grob als max. 1/3 des EK darstellen<br />
Funktion: (1.) Puffer und (2.) für fiktiven Haushaltsausgleich falls Aufwand größer Ertrag<br />
� Zu „Stetige Aufgabenerfüllung“:<br />
Es wird nicht nur das einzelne Haushaltsjahr betrachtet, sondern auch zukünftige,<br />
so wird die mittelfristige Planung z.B. im (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzplänen integriert (gemäß §84<br />
GO).<br />
In Verbindung mit §75(2) GO (dem Haushaltsausgleich „Aufwand ≤ Ertrag“) wird die<br />
„intergenerative Gerechtigkeit“ verwirklicht; diese wird auch in §1(1) S.3 GO gefordert.<br />
� Zur „Wirtschaftlichkeit“ gilt grundsätzlich:<br />
Geringwertige Vorratsbestände wie Büromaterial, Kopiererpapier und Tonerkassetten sollten nicht als Vorrat<br />
verbucht werden, da dies unwirtschaftlich ist, sondern sofort als verbraucht.<br />
Gründe: Der Aufwand der dann notwendigen Abgangsverbuchung und/ oder Inventur benötigt 1€ / Minute<br />
Arbeitszeit (Durchschnittswert für einen Verwaltungsmitarbeiter lt. KGSt-Bericht Arbeitsplatzkosten).<br />
Dieser zusätzliche Aufwand würde aber nur vernachlässigbar die Genauigkeit der Haushaltswirtschaft erhöhen,<br />
da der Wert des Lagervorratsverbrauchs von Jahr zu Jahr nur gering schwankt und zudem nur<br />
sehr gering im Vergleich zu anderen Haushaltspositionen (z.B. Personalaufwand) ist. Zudem würde dieser<br />
zusätzliche Aufwand wahrscheinlich höher sein, als der mögliche Einsparungseffekt, weil eventuell der eine<br />
oder andere Verbrauch (z.B. von Bleistiften) geringer wäre.. → Beim Kauf sollten diese Vorratsbestände<br />
sofort als verbraucht verbucht werden („Sofortverbrauchsfiktion“), unabhängig vom realen Verbrauchszeitpunkt.<br />
Der Daumenwert von 1€ pro Minute Arbeitszeit, abgeleitet aus dem Durchschnittswert für einen Verwaltungsmitarbeiter<br />
lt. KGSt-Bericht Arbeitsplatzkosten, wird vermittelt. Dabei sind folgende Aspekte wichtig:<br />
1. Er ist einfach zu handhaben. 2. Es ist ein Durchschnittswert. 3. Der Wert wurde von einer annerkannten<br />
kommunalen Institution ermittelt. 4. Er gilt für Verwaltungsmitarbeiter, nicht z.B. für Bauhofmitarbeiter. 5. Er<br />
gilt inkl. Sozialversicherungsbeiträge bzw. Pensionrückstell., Raum, Computer, internen Leist.B.<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 5<br />
� Buchführung<br />
im<br />
NKF<br />
� Staatsrecht<br />
� Volkswirtschaftslehre
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Planung des Haushalts: Teil 1<br />
Σ 4,5 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� strategische und operative Ziele unterscheiden<br />
� die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan<br />
als<br />
Ergebnis der Willensbildung des Rates<br />
erläutern<br />
� in groben Zügen das Zustandekommen<br />
und ausführlicher die Inhalte der Haushaltssatzung<br />
erläutern und die darin<br />
vorkommenden Begriffe erklären<br />
� den Wirkungsbereich des Haushaltsplans<br />
erläutern<br />
� die Bedeutung der Teilpläne erläutern<br />
Einzelstunden<br />
0,5<br />
1,5<br />
0,5<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu anderenLehrgebieten<br />
� Strategischen Ziele werden vom Rat festgelegt (§ 41 (1) t GO),<br />
die Umsetzung erfolgt durch den Bürgermeister mit Hilfe der Verwaltung<br />
(operative Ziele)<br />
� Rat erteilt Ermächtigung für die Obergrenze von Aufwendungen und Auszahlungen,<br />
Einzahlungen und Erträge können höher als veranschlagt ausfallen<br />
� § 78 (2) GO: Inhalte Nr. 1 -3<br />
� § 78 (3) GO: Zeitliche Begrenzung<br />
� § 79 (3) GO: Wirkungsbereich des Haushaltsplans<br />
� Gliederung des Gesamthaushaltes in kleinere Einheiten<br />
� Der Rat steuert durch Teilpläne<br />
� Grundlage von evtl. Budgetierung<br />
� Zusammenhang zwischen Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzplan,<br />
sowie Teilplänen<br />
� KommunalesVerfassungsrecht<br />
� KommunalesVerfassungsrecht<br />
� Buchführung<br />
im<br />
NKF<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 6
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Planung des Haushalts: Teil 1<br />
Σ 4 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden<br />
können<br />
� grundlegende Geschäftsvorfälle<br />
im<br />
(Teil)Ergebnis- und<br />
(Teil)Finanzplan<br />
veranschlagen<br />
Zwischensumme: 15 Einzelstunden<br />
Einzelstunden Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
2<br />
� § 4(1) GemHVO und § 1 - 3 GemHVO<br />
� Um Sachverhalte den Zeilen der Anlagen 3 (bzw.8), 4 (bzw. 9a,9b) VV Muster zur GO und<br />
GemHVO zuordnen zu können, ist die Anlage 17 VV Muster zur GO und GemHVO notwendig<br />
� Die Sachverhalte des obigen <strong>Sachbereich</strong>s „Grundlagen der Abgrenzung von Einzahlung<br />
und Erträgen sowie Auszahlung und Aufwand“ werden wieder aufgenommen und um die<br />
Zuordnung zu den Zeilen des (Teil-)Ergebnisplans und (Teil)Finanzplanz vorzunehmen<br />
� Unterschiede zwischen Gesamt- und Teilplänen werden erst im nächsten Feinlernziel thematisiert<br />
Anmerkung: - Es könnte jetzt ein kleiner Test zur Selbsteinschätzung der Teilnehmenden hilfreich sein.<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 7<br />
� Vielfalt der<br />
Kontenrahmen<br />
der Privatwirtschaft<br />
� Buchführung<br />
im<br />
NKF
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Planung des Haushalts: Teil 2<br />
Σ 9 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� grundlegende Geschäftsvorfälle<br />
im (Teil)Ergebnis-<br />
und (Teil)Finanzplan veranschlagen<br />
(Teil 2)<br />
� die Unterschiede bei der<br />
Veranschlagung im Ergebnis-<br />
und Teilergebnisplan<br />
nennen und erläutern und<br />
dabei auch die Bedeutung<br />
der internen Leistungsbeziehungen<br />
erläutern<br />
� die Unterschiede bei der<br />
Veranschlagung im Finanz-<br />
und Teilfinanzplan (Teil A<br />
und B) nennen und erläutern <br />
Einzelstunden<br />
3<br />
1<br />
3<br />
Unterrichtsinhalte<br />
� SoPo und deren ertragswirksame Auflösung;<br />
- Beiträge (Kanalanschluss- und Straßenanliegerbeiträge)<br />
- Zuwendung des Landes für Anlagevermögen, dies insbesondere auch in Abgrenzung<br />
zu „Zuwendungen für laufende Zwecke“ („Betriebskostenzuwendung“)<br />
� GWGs im Zusammenhang zum „allgemeinen Haushaltsgrundsatz“ „Wirtschaftlichkeit“ gemäß<br />
§75(1) S.2 GO:<br />
d.h. ein GWG wird gekauft, z.B. Drucker, und im Kaufjahr zu 100% abgeschrieben,<br />
wg. §33(4) GemHVO i.V.m. §75(1) S.2 GO. Dieses ergibt sich aus wirtschaftlichen Gründen.<br />
Andere Verfahrensweisen in der Praxis, sowie Festwerte und Gruppenwerte, sollten zur<br />
Vereinfachung und zeitlichen Straffung der Materie nicht thematisiert werden oder nur darauf<br />
hingewiesen werden.<br />
� pRAP: Abbildung von Friedhofsgebühren: Bei Zahlung und in den Folgejahren<br />
� § 4 GemHVO<br />
� pflichtige und freiwillige (Interne Leistungsverrechnung) Angaben im Teilergebnisplan<br />
� Interne Leistungsbeziehungen nur im Teilergebnisplan gemäß §4 (3), §17 GemHVO<br />
� Veranschlagung von internen Leistungsbeziehungen als Voraussetzung zur verursachungsgerechten<br />
Dokumentation und Bewirtschaftung von Aufwendungen und Erträgen, auch in<br />
Hinblick auf wirtschaftlichere Verfahrensweisen (→ Unterstützung des Controllings)<br />
� § 4 GemHVO<br />
� pflichtige (Investitionstätigkeit)- und<br />
freiwillige Angaben (lfd. Verwaltungstätigkeit) im Teilfinanzplan<br />
� Begriffserläuterung Verpflichtungsermächtigungen: §85(1) GO<br />
� Unterschied von Teilfinanzplan A und Teilfinanzplan B<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 8<br />
Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� Kosten-<br />
und Leistungsrechnung
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Planung des Haushalts: Teil 2<br />
Σ 9 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� einzelne Veranschlagungsgrundsätze<br />
nennen und in ihrem<br />
Inhalt und ihrer Bedeutung<br />
für die Planung beschreiben<br />
und auf einfache<br />
Geschäftsvorfälle anwenden<br />
Einzelstunden<br />
1<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen Lehrgebieten<br />
� Veranschlagungsgrundsätze:<br />
- Einzelveranschlagung gemäß §§ 2 – 4 GemHVO<br />
- Bruttoprinzip (Saldierungsverbot) gemäß §11(1) GemHVO und Vollständigkeit i.V.m.<br />
§79(1) GO<br />
- Richtigkeit/ Willkürfreiheit (Haushaltswahrheit) gemäß §11(2) S. 2, 3 GemHVO<br />
- Verständlichkeit (Haushaltsklarheit) i.V.m. §§7, 12, 27 GemHVO<br />
- einfache Periodenabgrenzungen z.B. durch<br />
- erhebliche Mietvorauszahlungen<br />
- Beamtenbesoldung Ende Dezember für Januar des nächsten Jahres<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 9
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Planung des Haushalts: Teil 2<br />
Σ 9 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� die Ziele und Möglichkeiten<br />
von Budgets nennen<br />
Einzelstunden<br />
1<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen<br />
Lehrgebieten<br />
� § 21 GemHVO<br />
� Ziele:<br />
a) Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung durch vereinfachte Finanzmitteldeckung<br />
innerhalb des Budgets.<br />
b) Gestärkte Eigenverantwortung des Budgetverantwortlichen<br />
� Möglichkeiten:<br />
Ganz oder teilweise Budgetierung von Produkt- und Organisationsbereichen<br />
� Grenzen:<br />
§ 21 (3) GemHVO: Zahlungswirksame Mehraufwendungen können nur durch zahlungswirksame<br />
Minderaufwendungen gedeckt werden.<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 10
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Bewirtschaftung des Haushalts<br />
Σ 3,5 Einzelstunden<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
� einzelne Bewirtschaftungsgrundsätze nennen<br />
und in ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung für<br />
die Planung beschreiben und auf einfache<br />
Geschäftsvorfälle anwenden<br />
� die Begriffe über- und außerplanmäßige Aufwendungen<br />
und Auszahlungen in Grundzügen<br />
erklären<br />
� die Notwendigkeit der Überwachung der<br />
Haushaltsansätze begründen<br />
Einzelstunden<br />
2<br />
1<br />
0,5<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen Lehrgebieten<br />
� Bewirtschaftungsgrundsätze:<br />
- Gesamtdeckungsprinzip gemäß §20 GemHVO<br />
- Bildung von (Zuschuss-)Budgets nach §21 (1) GemHVO (Echte<br />
Deckungsfähigkeit) und gemäß §21(2) GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)<br />
� §§ 81, 83 GO<br />
� § 23 GemHVO<br />
� Keine Auftragsvergabe ohne vorherige Kontrolle, ob Mittel vorhanden<br />
sind, u.a. bei der Beachtung von schon vergebenen Aufträgen<br />
oder dringenden noch zu vergebenen Aufträgen, sowie Deckungsfähigkeiten<br />
nach §21 GemHVO<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 11
Kommunales Finanzmanagement Coesfelder Modell (44 Einzelstunden = 22 Doppelstunden) Stand: 11.06.2010<br />
<strong>Sachbereich</strong>: Jahresabschluss<br />
Σ 0,5 Einzelstunde<br />
Feinziele:<br />
Die Teilnehmenden können<br />
Einzelstunden<br />
� die Bilanz als zusätzliches Element des Jahresabschlusses<br />
nennen 0,5<br />
Zwischensumme: 28 Einzelstunden<br />
4 Einzelstunden sind für individuelle Zielsetzungen frei verfügbar.<br />
Zusätzlich zu obigen Einzelstunden:<br />
1 Klausur à 2 Einzelstunden + 1 Einzelstunde Besprechnung<br />
1 Unterrichtsstunde für die Besprechung der sonstigen Leistungen<br />
8 Einzelstunden zur Prüfungsvorbereitung im Teil III<br />
Unterrichtsinhalte Bezüge zu<br />
anderen Lehrgebieten<br />
� § 95 (1) GO, § 37 GemHVO;<br />
die Struktur der Bilanz und grundsätzlichen Inhalte wurde schon zur<br />
der Abgrenzung von Zahlungen zu Ertrag und Aufwand benötigt<br />
© <strong>Studieninstitut</strong> <strong>Westfalen</strong>-<strong>Lippe</strong> Seite 12