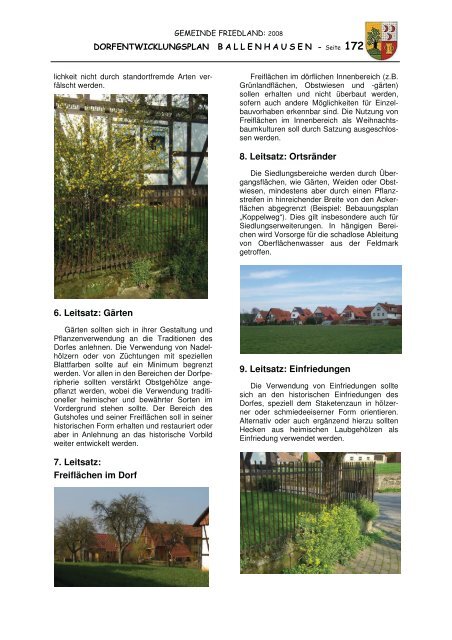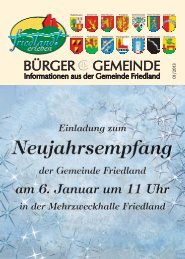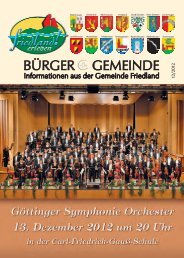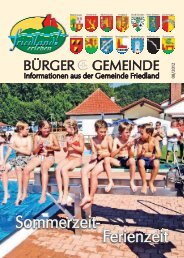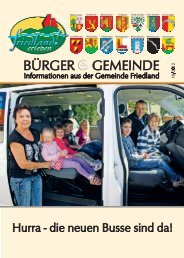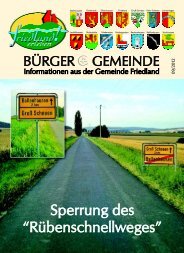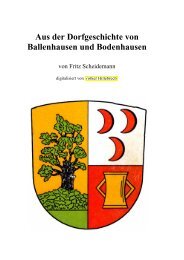Download starten - Ballenhausen
Download starten - Ballenhausen
Download starten - Ballenhausen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
lichkeit nicht durch standortfremde Arten verfälscht<br />
werden.<br />
6. Leitsatz: Gärten<br />
Gärten sollten sich in ihrer Gestaltung und<br />
Pflanzenverwendung an die Traditionen des<br />
Dorfes anlehnen. Die Verwendung von Nadelhölzern<br />
oder von Züchtungen mit speziellen<br />
Blattfarben sollte auf ein Minimum begrenzt<br />
werden. Vor allen in den Bereichen der Dorfperipherie<br />
sollten verstärkt Obstgehölze angepflanzt<br />
werden, wobei die Verwendung traditioneller<br />
heimischer und bewährter Sorten im<br />
Vordergrund stehen sollte. Der Bereich des<br />
Gutshofes und seiner Freiflächen soll in seiner<br />
historischen Form erhalten und restauriert oder<br />
aber in Anlehnung an das historische Vorbild<br />
weiter entwickelt werden.<br />
7. Leitsatz:<br />
Freiflächen im Dorf<br />
�<br />
Freiflächen im dörflichen Innenbereich (z.B.<br />
Grünlandflächen, Obstwiesen und -gärten)<br />
sollen erhalten und nicht überbaut werden,<br />
sofern auch andere Möglichkeiten für Einzelbauvorhaben<br />
erkennbar sind. Die Nutzung von<br />
Freiflächen im Innenbereich als Weihnachtsbaumkulturen<br />
soll durch Satzung ausgeschlossen<br />
werden.<br />
8. Leitsatz: Ortsränder<br />
Die Siedlungsbereiche werden durch Übergangsflächen,<br />
wie Gärten, Weiden oder Obstwiesen,<br />
mindestens aber durch einen Pflanzstreifen<br />
in hinreichender Breite von den Ackerflächen<br />
abgegrenzt (Beispiel: Bebauungsplan<br />
„Koppelweg“). Dies gilt insbesondere auch für<br />
Siedlungserweiterungen. In hängigen Bereichen<br />
wird Vorsorge für die schadlose Ableitung<br />
von Oberflächenwasser aus der Feldmark<br />
getroffen.<br />
9. Leitsatz: Einfriedungen<br />
Die Verwendung von Einfriedungen sollte<br />
sich an den historischen Einfriedungen des<br />
Dorfes, speziell dem Staketenzaun in hölzerner<br />
oder schmiedeeiserner Form orientieren.<br />
Alternativ oder auch ergänzend hierzu sollten<br />
Hecken aus heimischen Laubgehölzen als<br />
Einfriedung verwendet werden.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
10. Leitsatz: Mauern<br />
Natursteinmauern, insbesondere Trockenmauern,<br />
sind als wertvolle Biotope und typische<br />
Gestaltmerkmale von <strong>Ballenhausen</strong> zu<br />
erhalten und ggf. zu erneuern. Auch in Neubaugebieten<br />
sollten nach Möglichkeit Mauern<br />
aus Natursteinen angelegt werden. Im Bereich<br />
des Wasserbaus sollte die Möglichkeit des<br />
Einsatzes von Gabionen (Drahtschotterkörben)<br />
genutzt werden. Beton-Winkelstützen sollen<br />
wann immer möglich, vermieden werden.<br />
11. Leitsatz: Feldflur<br />
Die Feldflur der Gemarkung <strong>Ballenhausen</strong><br />
soll langfristig durch Hecken, Raine und Feldgehölze<br />
ökologisch und ästhetisch belebt,<br />
bestehende Strukturen erhalten werden. Insbesondere<br />
Feldwege, Gewässer und Straßen<br />
sollen verstärkt bepflanzt werden. Die Pyrami-<br />
�<br />
denpappel soll als ein typisches Identifikationselement<br />
der Ballenhäuser Umgebung verstanden<br />
und gepflanzt werden, obwohl dieser<br />
Baum im strengen Sinn nicht als standortheimisch<br />
bezeichnet werden kann.<br />
12. Leitsatz:<br />
Gebäude als Biotope<br />
Alte Gebäude stellen wichtige Lebensräume<br />
für verschiedene Tierarten dar, welche<br />
hieran angepasst sind. Bei der Restaurierung<br />
bzw. Renovierung sollen Unterschlupf- und<br />
Einflugmöglichkeiten nicht verbaut bzw. neu<br />
geschaffen werden. Fassaden sollten nach<br />
Möglichkeit eine Berankung erhalten.<br />
13. Leitsatz: Verkehr<br />
Das Dorfgebiet von <strong>Ballenhausen</strong> soll komplett<br />
als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden.<br />
Die für Kraftfahrzeuge reservierten Flächen<br />
sind so gering wie möglich zu halten. Bestehende<br />
fußläufige Verkehrsverbindungen sollen<br />
erhalten, neue entwickelt und in das Verkehrskonzept<br />
des Ortes integriert werden. Alte Wegerechte<br />
sollten wiederbelebt werden. Über<br />
den Erhalt der Gemeindeverbindungsstraße<br />
nach Groß Schneen soll eine Entscheidung<br />
getroffen werden, welche die Bedürfnisse der<br />
Einwohner von <strong>Ballenhausen</strong> besonders berücksichtigt.<br />
Die Ortseingänge der Heerstaße<br />
sollen verkehrsberuhigt werden.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
MASSNAHMEN-<br />
SCHWERPUNKTE DER<br />
DORFERNEUERUNG<br />
FREIRAUM<br />
Wenngleich die Gestaltung privater Freiräume<br />
für das Erscheinungsbild von <strong>Ballenhausen</strong><br />
von großer Bedeutung ist, muss sich<br />
die Dorferneuerungsplanung hier darauf beschränken,<br />
das Gestaltprinzip und den Wert<br />
dörflicher Gärten zu verdeutlichen. Sie dient<br />
damit als Leitfaden des privaten Grundbesitzers<br />
zur dorfgerechten Gestaltung seiner Freiräume.<br />
Da eine solche Gestaltung eher kostensparend<br />
als kostenaufwendig ist, werden<br />
Maßnahmen im privaten Freiraum nur gefördert,<br />
wenn hierdurch eine überdurchschnittliche<br />
Wirkung für die Freiraumentwicklung von<br />
<strong>Ballenhausen</strong> zu erwarten ist.<br />
Für alle Einwohner von <strong>Ballenhausen</strong> hingegen<br />
ist eine kostenlose Beratung in Sachen<br />
Freiraum wie auch Gebäude vorgesehen. Dies<br />
gilt unabhängig davon, ob das Anwesen ein<br />
Neubau oder historischer Altbau ist, ob es im<br />
Zentrum <strong>Ballenhausen</strong>s liegt oder an der Peripherie.<br />
Diese Beratung sollte in Anspruch genommen<br />
werden, wenn Veränderungen im<br />
Freiraum oder an den Gebäuden beabsichtigt<br />
werden, denn durch eine fachkundige Beratung<br />
lassen sich immer Kosten sparen bzw.<br />
Kosteneffizienz der Maßnahmen erreichen.<br />
Maßnahmen im öffentlichen Freiraum hingegen<br />
sind wesentlich aufwendiger und werden<br />
daher gefördert, wenn ihre Erfordernis im<br />
Dorfentwicklungsplan genannt wurde. In <strong>Ballenhausen</strong><br />
lassen sich die öffentlichen Freiräume,<br />
die einer Neugestaltung im Rahmen<br />
der Dorferneuerung bedürfen, überwiegend<br />
den Straßenräumen, Fußwegen, sowie spe-<br />
�<br />
ziellen Orten wie dem Ehrenmal, dem Sportplatz<br />
oder dem Friedhof zuordnen.<br />
In mehreren Arbeitskreissitzungen und<br />
nicht zuletzt während der gemeinsamen Begehung<br />
von <strong>Ballenhausen</strong> kristallisierten sich<br />
Schwerpunkte für öffentliche Maßnahmen<br />
heraus, die im Folgenden eingehend dargestellt<br />
werden sollen. Die Reihenfolge der Maßnahmen<br />
entspricht ihrer Priorität, welche auf<br />
der Arbeitskreissitzung am 29. Oktober 2008<br />
festgelegt wurde.<br />
Selbst wenn jetzt bereits Details dargestellt<br />
werden, darf dies nicht über die Tatsache hinwegtäuschen,<br />
dass es sich bei den Entwürfen<br />
um erste Ideen handelt, die auf der Basis einer<br />
sehr groben Kartengrundlage (ALK - Automatisiertes<br />
Liegenschaftskataster) erstellt wurden.<br />
Dies bedeutet, dass die Darstellung als Vorentwurf<br />
mit exemplarischem Charakter zu werten<br />
ist, dessen weitere Detaillierung in jedem<br />
Falle der Abstimmung mit dem Arbeitskreis<br />
Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong> sowie gegebenenfalls<br />
auch den Anliegern bedarf.<br />
Allerdings wurden für die Planung einzelner<br />
Maßnahmen auch erste Aufmaße erforderlich,<br />
um die Machbarkeit der Vorschläge zu prüfen.<br />
Hierzu wurden traditionelle (Bandmaß), aber<br />
auch moderne Messverfahren (Einsatz eines<br />
Digitaltachymeters) angewendet.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
�
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Angesichts der Lage <strong>Ballenhausen</strong>s, etwas<br />
abseits von der verkehrsbelasteten Bundesstraße<br />
27, mag es verwundern, dass der Arbeitskreis<br />
Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong> die<br />
höchste Priorität bei Maßnahmen setzt, die<br />
einer Verbesserung von verkehrsbedingten<br />
Problemen dienen. Dies zeigt jedoch andererseits,<br />
dass diese Probleme trotz der gegenüber<br />
der B 27 deutlich geringeren Verkehrsbelastung<br />
der Ortsdurchfahrt von den Einwohnerinnen<br />
und Einwohnern <strong>Ballenhausen</strong>s als<br />
deutliche Verringerung ihrer Lebensqualität<br />
gesehen werden.<br />
Maßnahmenschwerpunkt 1a: Verkehrsberuhigung<br />
der Ortseingänge<br />
Der erste Fokus des Arbeitskreises richtet<br />
sich auf eine Verringerung der Einfahrgeschwindigkeiten<br />
in das Dorf. Aus westlicher<br />
Richtung, von der B 27 kommend, führt die<br />
Kreisstraße 21 gewissermaßen in einer Zielgerade<br />
in die Siedlung hinein. Die Übersichtlichkeit<br />
dieser Straßenführung in Verbindung mit<br />
dem durch separate seitliche Bushaltebuchten<br />
und Gehwege deutlich aufgeweiteten Straßenraum<br />
hat ganz offensichtlich zu hohe Fahrgeschwindigkeiten<br />
zur Folge.<br />
Es macht daher Sinn, in diesem Bereich alle<br />
Möglichkeiten auszuschöpfen, die eine Reduzierung<br />
der Fahrgeschwindigkeiten zur Folge<br />
haben können. Hier wäre zunächst die Bepflanzung<br />
der K 21 zwischen der Bundesstraße<br />
und dem Ortseingang als Allee vorzuschlagen,<br />
verbunden mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung.<br />
Die auf das Dorf zuführende Allee<br />
hätte blickführende Wirkung, würde das Landschaftsbild<br />
beleben und die subjektive Wahrnehmung<br />
der Fahrgeschwindigkeiten erhöhen.<br />
�<br />
Am Dorfeingang sollte mit einer Fahrbahnverschwenkung<br />
der einfahrende Verkehr weiter<br />
abgebremst werden. Ein Materialwechsel am<br />
Ortseingang in Form von Pflasterbändern aus<br />
Naturstein würde auch sensorisch den Übergang<br />
in die geschlossene Siedlung signalisieren.<br />
Die letztgenannten Maßnahmen sollten<br />
auch die Gestaltung des östlichen Ortseinganges<br />
bestimmen. Anstelle einer Alleepflanzung<br />
hätte hier jedoch ein Baumtor eine bessere<br />
Wirkung, da der Raum hier durch die relativ<br />
enge Talmulde des Mainebaches deutlich eingeschränkt<br />
ist.<br />
Maßnahmenschwerpunkt 1b: Verbesserung<br />
für Fußgänger im Freiraum<br />
von <strong>Ballenhausen</strong><br />
Als weiteres Defizit wurde bereits im Zuge<br />
der Dorfbegehung mit dem Arbeitskreis das<br />
Fehlen von Gehwegen und definierten Querungsmöglichkeiten<br />
angesprochen. Dies betrifft<br />
im Wesentlichen die Heerstraße als Ortsdurchfahrt<br />
im Zuge der Kreisstraße 21, aber auch<br />
den westlichen Abschnitt der Rhienstraße in<br />
der Verlängerung des so genannten „Rübenschnellweges“.<br />
Eine Vermessung der genannten Straßenräume<br />
in den neuralgischen Abschnitten ergab,<br />
dass die Anlage separater Gehwege bei<br />
einer geringfügigen Veränderung der Querschnittsgestaltung<br />
durchaus möglich ist. Im<br />
Folgenden sollen die betreffenden Abschnitte<br />
detailliert angesprochen und die Planung durch<br />
Querschnittszeichnungen verdeutlicht werden.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
�
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Rhienstraße, westlicher Teil: Einrichtung<br />
eines Gehweges<br />
Die Rhienstraße als Verlängerung des „Rübenschnellweges“<br />
weist innerorts eine erheblich<br />
breitere Fahrbahn auf als in der Feldmark.<br />
Hat der „Rübenschnellweg“ nur 3,80 Breite,<br />
sind es in der Rhienstraße nicht weniger als<br />
6,80 m zwischen den Hochborden! Bei insgesamt<br />
7,40 m Breite des Straßenraumes bleiben<br />
neben den Borden nur schmale Streifen,<br />
die als Schutz der Gebäude fungieren. Fußgänger<br />
bleiben schutzlos in der Fahrbahn und<br />
fungieren als „Verkehrshindernisse“.<br />
�<br />
Dass diese Auslegung der Rhienstraße von<br />
den Ballenhäusern nicht begrüßt wird, liegt auf<br />
der Hand. Sie haben mehrfach auf die negativen<br />
Auswirkungen des „Rübenschnellweges“<br />
innerorts hingewiesen.<br />
Abhilfe schafft eine Neudefinition des Querschnitts.<br />
Auf der Ostseite der Rhienstraße wird<br />
ab der Kreuzung Eickhofsweg ein 1,5 m breiter<br />
Gehweg angelegt, der von der Fahrbahn durch<br />
einen Hochbord getrennt ist. Die Fahrbahn<br />
wird auf eine Breite von 5,5 m beschränkt, dies<br />
ist immer noch so viel wie die Ortsdurchfahrt<br />
einer Kreisstraße. Die restliche Fläche bleibt<br />
wie bisher als schmaler Randstreifen erhalten.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Heerstraße – Zwischen Rhienstraße<br />
und Johannisstraße<br />
Der Katasterplan von <strong>Ballenhausen</strong> ergibt,<br />
dass die Heerstraße an der Engstelle zwischen<br />
den Gebäuden Nr. 6 und 7 noch eine Breite<br />
von 8,25 m besitzt – zumindest theoretisch.<br />
Praktisch ist sie heute durch eine freiwachsende<br />
Hecke eingeengt.<br />
Hier ergibt sich die Möglichkeit, auf der<br />
Südseite der Straße einen 1,5 m breiten Gehweg<br />
anzulegen und durch eine Hochbordanlage<br />
von der Fahrbahn abzugrenzen. Die<br />
verbleibende Fahrbahnbreite würde demzufolge<br />
mit 6,5 m noch deutlich oberhalb des Standards<br />
von 5,5 m liegen, der für Kreisstraßen<br />
gefordert ist. Zu berücksichtigen ist allerdings,<br />
dass die Fahrbahn in einer leichten Kurve verläuft<br />
und die genannte Breite auch noch die<br />
Entwässerungseinrichtung aufnehmen muss.<br />
Gleichwohl zeigt die Darstellung, dass der<br />
Gehweg keine Utopie ist, sondern ohne weiteres<br />
realisiert werden kann.<br />
�<br />
Um den Gehweg in sinnvoller Form an das<br />
weitere Fußwegenetz <strong>Ballenhausen</strong>s anzuschließen,<br />
ist eine Querung der Heerstraße<br />
erforderlich. Diese ist sinnvollerweise dort anzulegen,<br />
wo der Gehweg auf der Nordseite der<br />
Fahrbahn endet und ein Einblick in die Heerstraße<br />
wie auch in die Rhienstraße möglich ist.<br />
Hier tut sich ein Detailproblem insofern auf,<br />
als die das Grundstück Nr. 7 einfassende Natursteinmauer<br />
mit einem Eckpunkt etwas in<br />
den Sichtraum ragt und die Sicht in die Heerstraße<br />
nach Nordosten verstellt. Es sollte daher<br />
versucht werden, durch Begradigung der<br />
Mauer bei gleichzeitiger Instandsetzung die<br />
Sichtverhältnisse zu verbessern, was das Einverständnis<br />
der Anlieger sowie einen geringfügigen<br />
Grunderwerb voraussetzt.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Heerstraße – Zwischen Mainestraße<br />
und Stichstraße zur Kirche<br />
Ein weiterer Schwerpunkt von Fußgängerbewegungen<br />
befindet sich zwischen der Einmündung<br />
der Mainestraße in die Heerstraße<br />
und der einige Meter weiter südlich abzweigenden<br />
Stichstraße, die zur Kirche und vor<br />
allem zum Kindergarten führt. Hier beträgt die<br />
Breite der Straßenparzelle sogar etwas über 9<br />
Meter.<br />
Allerdings kommen zwei Faktoren erschwerend<br />
hinzu: die Heerstraße vollführt in diesem<br />
Bereich eine Richtungsänderung um nahezu<br />
neunzig Grad, die nicht eingesehen werden<br />
kann, so dass die Aufmerksamkeit bereits sehr<br />
stark auf den eventuell entgegenkommenden<br />
Verkehr ausgerichtet ist.<br />
�<br />
Zum anderen ist die Heerstraße in diesem<br />
Bereich gegenüber dem südlichen Grundstück<br />
(Nr. 10) eingetieft, so dass ein Teil der Straßenparzelle<br />
als Böschung ausgebildet ist. Die<br />
Geländeverhältnisse begrenzen daher die<br />
Übersichtlichkeit zusätzlich zu den Gebäuden.<br />
Eine Lösung kann daher in diesem Abschnitt<br />
nur in der Anlage eines separaten<br />
Fußweges auf der Nordseite der Heerstraße in<br />
Verbindung mit einer Überquerung zur Stichstraße<br />
gesehen werden.<br />
Um hinreichende Breite für die Fahrbahn zu<br />
erhalten, muss die südliche Böschung zum Teil<br />
einbezogen werden. Der Höhenunterschied ist<br />
hier mit einer kleinen Natursteinmauer abzufangen,<br />
welche sich in Form und Gestaltung an<br />
die Mauern der Umgebung anlehnen sollte.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 2: Umgestaltung<br />
von Johannisstraße und<br />
Kirchumfeld<br />
Während die bislang genannten Maßnahmenschwerpunkte<br />
vor allem die Sicherheit der<br />
Verkehrsteilnehmer (vor allen der Fußgänger)<br />
im Fokus haben, wird mit der Umgestaltung<br />
von Johannisstraße und Kirchumfeld auch eine<br />
massive Verbesserung des dörflichen Erscheinungsbildes<br />
angestrebt. Gleichwohl ist weiteres<br />
nicht minder wichtiges Ziel der Umgestaltung,<br />
die fußläufige Verbindung der beiden<br />
genannten Gehwegeabschnitte herzustellen.<br />
Die Maßnahme beinhaltet im Einzelnen:<br />
• Umgestaltung der Johannisstraße<br />
• Umgestaltung des Kirchumfeldes mit<br />
dem Ehrenmal<br />
• Schaffung eines neuen „Thieplatzes“<br />
westlich der Kirche<br />
• Schaffung einer behindertengerechten,<br />
barrierefreien Zuwegung von der Johannisstraße<br />
zur Mainestraße<br />
�
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Umgestaltung der Johannisstraße<br />
Die Johannisstraße ist von der Heerstraße<br />
bis zur Kirche sehr steil. Es wurde im Arbeitskreis<br />
intensiv darüber diskutiert, die Straße für<br />
den Fahrverkehr gänzlich zu schließen und<br />
lediglich als fußläufige Verbindung zu erhalten.<br />
Gegen diese Option spricht die Tatsache, dass<br />
der neben der Kirche befindliche Kindergarten<br />
zu Stoßzeiten intensiv mit dem Fahrzeug frequentiert<br />
wird und sich eine Schließung der<br />
Johannisstraße sehr negativ auf das Verkehrsgeschehen<br />
auswirken würde.<br />
Um gleichwohl für Fußgänger eine akzeptable<br />
Lösung zu erzielen, wird die Straße in<br />
einen Fußgängerbereich von ca. 1,6 m Breite<br />
und einen befahrbaren Bereich von 3 m Breite<br />
aufgeteilt, die durch Hochbord voneinander<br />
getrennt sind. Der Fußgängerbereich wird<br />
zudem flacher ausgeführt und der Höhenunterschied<br />
durch eingeschaltete Stufen überwunden,<br />
was vor allem bei Glättebildung von<br />
Vorteil ist. Das Geländer im Süden des Straßenraumes<br />
wird erneuert. Der gesamte Bereich<br />
wird gepflastert, wobei die Pflasterart die<br />
Unterscheidung von Fahrbahn und Gehweg<br />
verdeutlicht. Die privaten Einfahrten und<br />
Grundstücksbereiche werden als solche kenntlich<br />
gemacht und nach Möglichkeit entsiegelt –<br />
das Einverständnis der Eigentümer vorausgesetzt.<br />
�<br />
Umgestaltung des Kirchumfeldes<br />
mit dem Ehrenmal<br />
Das Kirchumfeld ist gegenwärtig stark zugewachsen.<br />
Dies liegt zum einen an den vielen<br />
Hecken, die den westlich und nördlich der<br />
Kirche verlaufenden Weg wie auch das Ehrenmal<br />
einfassen. Auf dem Kirchengrundstück,<br />
vor allem aber auf den Nachbargrundstücken<br />
sind die Bäume im Verhältnis zu der Größe,<br />
die sie mittlerweile erreicht haben, zu dicht<br />
gepflanzt. Der Weg, der das Kirchumfeld erschließt,<br />
ist daher eingeengt, seine Oberfläche<br />
durch Wurzelaufbrüche und Anhebungen der<br />
Oberfläche durch unterirdische Wurzeln sehr<br />
uneben.<br />
Die Umgestaltung soll diese Defizite und<br />
Funktionsschwächen beseitigen. Hierzu ist<br />
zum einen erforderlich, durch Beseitigen der<br />
Hecken und der im Erscheinungsbild „untergeordneten“<br />
Bäume die Grundstruktur der Örtlichkeit<br />
wieder deutlich zu machen. Wünschenswert<br />
wäre vor allem, wenn die Bäume<br />
des Nachbargrundstückes in die Maßnahme<br />
einbezogen würden, da deren Wurzeln vor<br />
allem die Schäden im Gehweg verursachen.<br />
Die übrigen Maßnahmen sind schnell aufgezählt:<br />
Erneuerung des Gehweges einschließlich<br />
seines Unterbaus, Anlage einer<br />
wassergebunden befestigten Fläche um das<br />
Ehrenmal, damit dieses einen würdigen Rahmen<br />
erhält, raumbildende Bepflanzung um
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
diese Fläche, am besten durch Buchsbaum,<br />
der durch Schnitt in Form gehalten wird, ergänzen<br />
der Bepflanzung durch einzelne Exemplare,<br />
die deutliche Akzente setzen. Schön<br />
wäre, wenn in diesem Zusammenhang auch<br />
die Kirchenfassade instand gesetzt würde, die<br />
unter den feuchten Bedingungen des zugewachsenen<br />
Umfeldes deutlich erkennbar gelitten<br />
hat.<br />
Ein zweiter, barrierefrei erschlossener Weg<br />
östlich der Kirche wäre eine weitere Option, die<br />
bei der Umgestaltung des Kirchumfeldes in die<br />
Überlegungen einbezogen werden sollte.<br />
Schaffung eines neuen „Thieplatzes“<br />
westlich der Kirche<br />
Der Thieplatz <strong>Ballenhausen</strong>s ist heute eine<br />
Zufahrt zu privaten Grundstücken. Allein die<br />
Bezeichnung „Thie“, die noch im Katasterplan<br />
vermerkt ist, legt den Bezug zur Geschichte<br />
des Ortes: Aus der Örtlichkeit ist dieser nicht<br />
mehr zu entnehmen, und es gibt auch keinerlei<br />
Möglichkeiten zu einer Wiederbelebung.<br />
Westlich des Kirchenbaus hingegen liegt<br />
eine kleine Fläche, in welcher einer der<br />
schönsten Bäume <strong>Ballenhausen</strong>s steht: Eine<br />
Linde. Diese Fläche bietet einen wunderschönen<br />
Ausblick über die Heerstraße auf das Unterdorf,<br />
den man im Schatten der Linde genießen<br />
könnte – wäre die Fläche nicht privat.<br />
Im Rahmen des Arbeitskreises wurden die<br />
Möglichkeiten zum Erwerb dieser Fläche angelotet<br />
– siehe da, nichts ist unmöglich! Der Eigentümer<br />
zeigte sich nicht abgeneigt, so dass<br />
die Möglichkeit, an dieser Stelle so etwas wie<br />
einen „Thieplatz“ einzurichten, in den Dorfentwicklungsplan<br />
aufgenommen wird.<br />
Der Bereich um die Linde wird etwas eingeebnet<br />
und mit einer wassergebundenen<br />
Decke befestigt. Seine Einfassung wird durch<br />
eine niedrige Natursteinmauer von maximal 70<br />
cm Höhe sichergestellt, die auch einen Absturz<br />
über die steile Böschung auf die Heerstraße<br />
verhindern soll. Wünschenswert wäre ein weiterer<br />
Zugang zur Johannisstraße. Natürlich soll<br />
eine Bank aufgestellt werden, damit der Aus-<br />
�<br />
blick angemessen erlebt und genossen werden<br />
kann.<br />
Die genannten Maßnahmen lassen im<br />
Zentrum <strong>Ballenhausen</strong>s einen Schwerpunkt<br />
dörflichen Lebens entstehen und schöpfen das<br />
Potenzial, welches die Örtlichkeit in Verbindung<br />
mit dem Gebäude der Kirche bietet, angemessen<br />
aus.<br />
Schaffung einer behindertengerechten,<br />
barrierefreien Verbindung von<br />
der Johannisstraße zur Mainestraße<br />
Um die in den Maßnahmenschwerpunkten<br />
1 beschriebene fußläufige Verbindung auch<br />
über das Kirchumfeld in barrierefreier Form zu<br />
führen, ist ein weiterer Zugang von der Johannisstraße<br />
zum nördlichen Kirchumfeld nötig, da<br />
die kürzeste Verbindung leider mehrere Stufen<br />
aufweist. Eine solche sollte im Bereich östlich<br />
der Kirche oder des Kindergartens geschaffen<br />
werden, um Behinderten, aber auch Kinderwagen<br />
und den so genannten „Rollatoren“ für<br />
gehbehinderte oder ältere Menschen eine<br />
barrierefreie Möglichkeit einzuräumen.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 3: Ausbau<br />
eines Wirtschaftsweges als kombinierter<br />
Rad-Gehweg vom Sportplatz<br />
zur B 27<br />
Auch der dritte Maßnahmenschwerpunkt<br />
zeigt die Bedeutung, die eine Verbesserung<br />
der Verkehrsfunktionen für die Einwohner <strong>Ballenhausen</strong>s<br />
einnimmt. Einhellig sprachen sie<br />
sich für den Ausbau eines Wirtschaftsweges<br />
als Rad- und Gehweg aus, der vom Sportplatz<br />
auf die B 27 führt.<br />
Die Bedeutung dieser Maßnahme ist nachvollziehbar,<br />
führt doch entlang der B 27 ein gut<br />
befestigter und weitgehend ebener Weg nach<br />
Göttingen, so dass man die Stadt bequem mit<br />
dem Fahrrad erreichen kann – wäre da nicht<br />
die Strecke entlang der Kreisstraße 21. Diese<br />
wird als gefährlich empfunden, so dass viele<br />
von der Benutzung des Fahrrades absehen.<br />
Zur Beseitigung dieses Defizits muss der<br />
vorhandene Wirtschaftsweg lediglich eine verbesserte<br />
Befestigung erhalten. Hier ist zu überlegen,<br />
ob eine wassergebundene Befestigung<br />
ausreichend ist, oder ob weitergehende Befestigungsformen<br />
gewählt werden sollen. Wünschenswert<br />
wäre ferner, den kahlen Weg mit<br />
einer Bepflanzung zu verschönern. So könnten<br />
beispielsweise einige Obstbäume gepflanzt<br />
werden, die man durch Schnitt gut in Form<br />
halten kann und die damit nicht in Konflikt mit<br />
der den Weg begleitenden Hochspannungsleitung<br />
geraten. Letztere wird ohnehin, wie schon<br />
viele dieser Leitungen, eines Tages unter der<br />
Erde verschwinden.<br />
�<br />
Maßnahmenschwerpunkt 4: Neugestaltung<br />
des Dorfplatzes Heerstraße<br />
/ Zum Ahrenbach<br />
Als weiterer großer Maßnahmenschwerpunkt<br />
bietet sich in der Gestaltung eines Dorfplatzes<br />
am westlichen Ortseingang <strong>Ballenhausen</strong>s<br />
an. Hier wurde durch Verlegung der<br />
Heerstraße vor einigen Jahrzehnten eine große<br />
Fläche geschaffen, die bislang kaum genutzt<br />
wird.<br />
An der Einmündung der Straße „Zum Ahrenbach“<br />
in die alte Heerstraße befand sich<br />
früher das Feuerwehrgerätehaus. Dieses ist<br />
noch vorhanden, hat aber seine Zweckbestimmung<br />
nach dem Neubau des Gerätehauses<br />
in der Rhienstraße verloren. Die alte Linde<br />
neben dem Gebäude schuf früher einen schönen<br />
Rahmen für Freiluftaktivitäten vom Grillen<br />
bis hin zum geselligen Zusammensitzen im<br />
Schatten. Auch dies gehört nach Verlagerung<br />
des Feuerwehrgerätehauses der Vergangenheit<br />
an.<br />
Eine Neubesinnung auf das Feuerwehrhaus<br />
ist wichtig, um diesen zentralen Punkt der<br />
Dorfgemeinschaft wieder zu beleben. Hierzu<br />
gibt es bereits einige Ansätze, denen im Rahmen<br />
der Dorferneuerung ein angemessenes<br />
Umfeld gestaltet werden sollte. Diese Umgestaltung<br />
hat folgende Schwerpunkte:<br />
• Flächenentsiegelung und Neuorientierung<br />
der Flächendisposition<br />
• Wiederöffnung des Rhienbaches<br />
• Erneuerung und Ergänzung der Bepflanzung,<br />
Beleuchtung und Ausstattung
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Flächenentsiegelung und Neuorientierung<br />
der Flächendisposition<br />
Um einen Dorfplatz zu schaffen, ist es wichtig,<br />
der Örtlichkeit den Charakter einer „Kreuzung“<br />
oder „Straßenverkehrsfläche“ zu nehmen.<br />
Ins Auge fällt der hohe Versiegelungsgrad<br />
des Bereiches. Sie ist zum einen<br />
Ergebnis der früheren Straßenführung, da die<br />
alte Fahrbahn teilweise noch belassen wurde.<br />
Zum anderen ist die neue Heerstraße durch<br />
gegenüberliegend angeordnete seitliche<br />
Busbuchten sehr weit, was sich sehr ungünstig<br />
auf das Vorhaben einer Verkehrsberuhigung<br />
auswirkt.<br />
�<br />
Die heutige Planungsphilosophie des öffentlichen<br />
Nahverkehrs wirkt auf einen Rückbau<br />
dieser Buchten hin: Busse sollen im öffentlichen<br />
Straßenraum halten, diesen für den<br />
Zeitraum des Aus- und Einsteigens zum Stillstand<br />
bringen und so eine Gefährdung der<br />
Fahrgäste durch vorbeifahrenden Verkehr<br />
vermeiden.<br />
Die breit gezogenen Einmündungstrichter<br />
sind ebenfalls nicht mehr zeitgemäß, da sie ein<br />
zu schnelles Einbiegen in Seitenstraßen begünstigen.<br />
Entsiegelung von Flächen entspricht<br />
daher auch der heutigen Verkehrsphilosphie.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Die Neuorientierung der befestigten Flächen<br />
soll stärker als heute auf den Bereich um<br />
das ehemalige Feuerwehrgerätehaus ausgerichtet<br />
sein. Hier soll ein kleiner, halbkreisförmiger<br />
Platz entstehen, dem sich die Fahrbahn<br />
der Straße „Zum Ahrenbach“ gestalterisch<br />
unterordnet. Sie könnte zum Beispiel höhengleich<br />
erfolgen und nur in einem Wechsel der<br />
Pflasterrichtung oder des Pflasterverbandes<br />
zum Ausdruck kommen.<br />
Wiederöffnung des Rhienbaches<br />
Die Möglichkeit einer Öffnung des unterirdisch<br />
durch den Bereich verlaufenden Rhienbaches<br />
wurde von Arbeitskreismitgliedern<br />
während des Dorfrundganges angesprochen.<br />
Das Vorhandensein von fließendem Wasser ist<br />
regelmäßig eine Attraktion in öffentlichen Freiräumen,<br />
und die Dorferneuerung hat seit langem<br />
die Wiederöffnung von Gewässern in den<br />
Ortslagen zum Ziel. Auf der Ebene des Gewässers<br />
könnte ein kleines Plateau angelegt<br />
werden, welches den Zugang zum Wasser und<br />
das Erleben des Baches ermöglicht und<br />
gleichzeitig auch als Saugstelle zu Löschzwecken<br />
genutzt werden könnte.<br />
�<br />
Bepflanzung, Ausstattung, Beleuchtung<br />
Bepflanzung, Ausstattung und Beleuchtung<br />
des Platzes sollten von Grund auf erneuert<br />
werden. Das Grundgerüst der bestehenden<br />
Baumbepflanzung sollte bestehen bleiben,<br />
soweit es sich in die künftige Gestaltung einfügt.<br />
Der Gehölzbestand des Platzes ist nicht<br />
so wertvoll und prägend, dass sich die gesamte<br />
Planung an ihm ausrichten sollte; eine zukunftsfähige,<br />
funktionierende Gestaltung kann<br />
durchaus die Fällung und Neuanpflanzung von<br />
Bäumen sinnvoll machen, wenn diese nicht<br />
prägenden Charakter besitzen.<br />
Die Bepflanzung sollte um Alleebäume entlang<br />
der Heerstraße erweitert werden, welche<br />
vor allem den Dorfeingang betonen und die<br />
Straßenführung sichtbar machen. Schmale<br />
Zierbeete könnten die Begrenzung des Platzes<br />
an seiner Nordostseite dekorieren und einen<br />
lebendigen Aspekt vor der gut erhaltenen historischen<br />
Bausubstand einbringen. Eine angemessene<br />
Beleuchtung wäre geeignet, den<br />
Platz auch in der dunklen Jahreszeit erlebbar<br />
zu machen. Zur Ausstattung gehören auch die<br />
Glascontainer, die hinter das Feuerwehrgerätehaus<br />
verlegt werden könnten.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 5: Umgestaltung<br />
des Kreuzungsbereiches<br />
„Rhienstraße / Eickhofsweg“<br />
Auch die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches<br />
Rhienstraße / Eickhofsweg hat das<br />
Bestreben um Verbesserung der Verkehrsverhältnisse<br />
zum Ziel. Beklagt wurde der schnell<br />
einfahrende Verkehr aus dem so genannten<br />
„Rübenschnellweg“, der Gemeindeverbindungsstraße<br />
zwischen <strong>Ballenhausen</strong> und Groß<br />
Schneen. Mit der Umgestaltung der Kreuzung<br />
als Platz sollte der Charakter eines Straßenraumes,<br />
der vorrangig dem Kraftfahrzeug<br />
dient, unterbrochen und in eine Platzsituation<br />
überführt werden, in der Fußgänger und spielende<br />
Kinder zu erwarten sind.<br />
Die einfachste Möglichkeit wäre eine Pflasterung<br />
der Kreuzung in Form eines Rondells.<br />
Bei der geringen Fläche sollte hier Natursteinpflaster<br />
verwendet werden. Die Kreismitte<br />
könnte angehoben werden, dies würde zum<br />
einen die Entwässerung erleichtern und zum<br />
anderen gemeinsam mit der raueren Oberfläche<br />
das Fahrgefühl deutlich verändern. Wünschenswert<br />
und sinnvoll wäre, die Rhienstraße<br />
als abknickende Vorfahrt auszuweisen und<br />
damit den einfahrenden Verkehr zum Anhalten<br />
zu zwingen. Über genauere Details der Ausgestaltung<br />
wird zu gegebener Zeit zu entscheiden<br />
sein.<br />
�<br />
Maßnahmenschwerpunkt 6: Umgestaltung<br />
der Grünfläche „Am Klimpe“<br />
Am südlichen Ortsrand, kurz hinter dem<br />
Beginn der Verrohrung des Rhienbaches befindet<br />
sich auf dem verrohrten Bachlauf eine<br />
öffentliche kleine Fläche, die als Grünfläche<br />
gestaltet ist. Die Gestaltung beschränkt sich<br />
allerdings auf die Einsaat mit Rasen, die dort<br />
aufgestellten kleinen Bolztore sind eher privater<br />
Natur. Leider wird dieser Bereich auch häufig<br />
zum Parken genutzt.<br />
Im Zuge der Dorferneuerung sollte diese<br />
kleine Fläche eine verbesserte Gestaltung und<br />
Funktionszuweisung erhalten. Das Parken<br />
sollte durch geeignete Maßnahmen unterbunden,<br />
die kleine Stichstraße nach Osten durch<br />
eine Muldengosse eindeutiger von der Fläche<br />
abgegrenzt werden. Wie die Fläche letztlich<br />
ausgestaltet werden soll, ist zu gegebener Zeit<br />
mit dem Arbeitskreis und den Anwohnern zu<br />
klären. Denkbar wäre sowohl die Anlage eines<br />
Sitzplatzes, eines kleinen Spielbereiches oder<br />
auch eines Spielbereiches für die Großen, z.B.<br />
in Form eines Boulodromes.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 7: Umgestaltung<br />
und Verkehrsberuhigung<br />
des Bauerweges<br />
Der Bauerweg ist ein typischer Straßenraum<br />
der 60er Jahre. Seine Breite beträgt insgesamt<br />
ca. 12 Meter, die Fahrbahnbreite mit<br />
5,50 m Breite ist ausgelegt wie die Ortsdurchfahrt<br />
einer Kreisstraße. Leider führt dies nach<br />
Aussagen der Anwohner dazu, dass selbst der<br />
Linienbus hier deutlich zu schnell fährt und<br />
immer wieder gefährliche Situationen auftreten.<br />
Die Anwohner schlagen daher eine Veränderung<br />
des Querschnittes an einigen Stellen<br />
vor, die man sich so vorstellen kann:<br />
Erneuerungsbedürftig sind vor allem die<br />
Bordanlagen und Gehwege. Bei einer Totalerneuerung<br />
der Straße sollte die Querschnittsgestaltung<br />
komplett verändert werden. Ein<br />
gutes Beispiel hierfür liefert die Unterdorfstraße<br />
in Klein Schneen, die im Rahmen der Dorferneuerung<br />
neu gestaltet wurde (rechts unten).<br />
�<br />
Maßnahmenschwerpunkt 8: Umgestaltung<br />
der Straße „Kohlstedthof“<br />
Sehr erneuerungsbedürftig ist die Parallelstraße,<br />
der „Kohlstedthof“. Auch diese Straße<br />
stammt aus den sechziger Jahren, besitzt jedoch<br />
eine gegenüber dem Bauerweg erheblich<br />
geringere Verkehrsbedeutung bei deutlich<br />
größeren Abnutzungserscheinungen. Die Oberfläche<br />
ist verschiedentlich geflickt, vor allem<br />
in den Gehwegen sind erhebliche Sackungen<br />
zu verzeichnen, die zur Pfützenbildung und<br />
zum Stolpern führen.<br />
Der Kohlstedthof weist einen deutlich zu<br />
hohen Versiegelungsgrad auf. Die Fahrbahnbreite<br />
beträgt ebenfalls knapp 5,50 m einschließlich<br />
der Muldengosse, die Breite des<br />
Gehweges ist mit 2,35 sehr üppig bemessen.<br />
Zu überlegen wäre, den Kohlstedthof als<br />
Spielstraße umzugestalten und eine Mischnutzung<br />
von Fahrverkehr und fußläufigem Verkehr<br />
zu erzielen. Auch hierüber ist zu gegebener<br />
Zeit unter Beteiligung der Anwohner zu<br />
entscheiden.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 9: Umgestaltung<br />
der Straße „Zum Ahrenbach“<br />
Die Straße „Zum Ahrenbach“ beginnt am<br />
ehemaligen Feuerwehrhaus in dem Bereich,<br />
der im Rahmen der Dorferneuerung als Dorfplatz<br />
umgestaltet werden soll. Es macht daher<br />
Sinn, sie als eine der typischen Straßen <strong>Ballenhausen</strong>s,<br />
die zudem zum Sportgelände und<br />
Dorfgemeinschaftshaus führt, in angemessener<br />
Weise umzugestalten.<br />
Ins Auge fällt hier vor allem der ca. einen<br />
Meter breite Pflasterstreifen, der sich entlang<br />
der Grundstücksgrenzen zieht. Anregungen,<br />
diesen zu entsiegeln und einzusäen, wurden<br />
von den Anwohnern mit dem Argument der<br />
Parkplatznot zurückgewiesen. Um diesem<br />
Argument zu begegnen, könnten in dem Straßenraum<br />
einzelne Parkplätze eingerichtet werden.<br />
Die Fahrbahn würde hierdurch eine abschnittsweise<br />
Verengung erfahren. Der nicht<br />
nutzbare Raum zwischen den Parkplätzen und<br />
Einfahrten könnte dennoch entsiegelt und begrünt<br />
werden, um den Straßenraum insgesamt<br />
aufzulockern. Ein anderes Beispiel liefert auch<br />
die Unterdorfstraße in Klein Schneen...<br />
�<br />
Maßnahmenschwerpunkt 10: Maßnahmen<br />
am Dorfgemeinschaftshaus<br />
Dorfgemeinschaftshaus und Sportplatz stellen<br />
einen der sozialen Mittelpunkte <strong>Ballenhausen</strong>s<br />
dar. Hier kann durch gezielte Investitionen<br />
die Lebensqualität noch verbessert werden.<br />
Im Arbeitskreis wurde vor allem das Fehlen<br />
von Spielgeräten für Kinder beklagt. Es<br />
sind genügend Flächen vorhanden, um Kinder<br />
allen Alters konfliktfrei Möglichkeiten der Bewegung<br />
und des Spiels zu bieten.<br />
Die asphaltierte Fläche vor dem Gebäude<br />
wird nur zum Abstellen von Fahrzeugen bei<br />
Veranstaltungen genutzt. Ansonsten liegt sie<br />
brach und könnte zum Spielen dienen. Die<br />
Aufstellung von einigen Geräten für Skater<br />
sowie eines Streetball-Korbes könnten Ansatzpunkte<br />
einer verbesserten Nutzung dieser<br />
Fläche liefern.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 11: Renaturierung<br />
des Mainebaches und Anlage<br />
eines bachbegleitenden Gehweges<br />
Etwas stiefmütterlich behandelt sind die<br />
Gewässer in <strong>Ballenhausen</strong>. Neben der Verrohrung<br />
des Rhienbaches leidet vor allem der<br />
Mainebach an einer einseitigen Nutzung für<br />
Feuerlöschzwecke, die zu einem rigiden Ausbau<br />
oberhalb der Mainestraße geführt hat.<br />
Dieser sollte rückgebaut und eine Alternative<br />
zur Löschwassergewinnung gefunden werden,<br />
zum Beispiel eine schnell installierbare Stauanlage<br />
im Bereich der Brücke.<br />
Unterhalb der Mainestraße ist der Bach<br />
stellenweise stark eingeengt und völlig frei von<br />
begleitenden Gehölzen. Hier führt die gute<br />
Belichtung der Ufer in Verbindung mit der ausgezeichneten<br />
Nährstoffversorgung zu einem<br />
starken Krautwuchs, welcher den Abfluss des<br />
Baches behindert. Erst im Bereich des Sportplatzes<br />
wird der Querschnitt wieder weiter,<br />
dies ist nicht zuletzt auf die beschattenden<br />
Gehölze zurückzuführen, die den Krautwuchs<br />
in Grenzen halten.<br />
Es macht daher Sinn, einen Uferrandstreifen<br />
entlang des Mainebaches zwischen Mainestraße<br />
und Sportplatz anzulegen und mit<br />
Gehölzen zu bepflanzen. Dies erfolgt zweckmäßigerweise<br />
auf der Südseite des Gewässers.<br />
Auf der Nordseite des Mainebaches sollte<br />
ein Streifen erworben werden, um hier den<br />
gewünschten Verbindungsweg zwischen Mainestraße<br />
und Sportplatz entstehen zu lassen.<br />
Dieser Weg würde vielen Einwohnern den<br />
gefährlichen Umweg über die Heerstraße ersparen<br />
und zudem eine Verbesserung des<br />
Rundwandernetzes um das Dorf bedeuten.<br />
�<br />
Maßnahmenschwerpunkt 12: Verbesserung<br />
des Wanderweges zum<br />
Weinberg<br />
In diesem Zusammenhang steht auch die<br />
Maßnahme einer Verbesserung des Wanderweges<br />
zum Weinberg. Diese beliebte Verbindung<br />
ist verfallen und verlangt von ihren Benutzern<br />
Kondition und gutes Schuhwerk. Eine<br />
Befestigung der Oberfläche, vielleicht auch die<br />
Kontrolle der Grenzmarken würde die Benutzbarkeit<br />
dieses Weges bedeutend steigern und<br />
ihm seine Funktion innerhalb des außerörtlichen<br />
Wegenetzes für die Naherholung wiedergeben.<br />
Maßnahmenschwerpunkt 13: Verbesserung<br />
des Gehweges entlang<br />
des Rhienbaches<br />
Verbesserungsbedarf besteht nach Aussagen<br />
des Arbeitskreises auch am Gehweg entlang<br />
des Rhienbaches. Zwar endet dieser Weg<br />
in der Feldmark, man muss ihn somit wieder<br />
zurücklaufen, aber er ist beliebt – vor allem<br />
von den Kindern, die hier am Wasser ideale<br />
Spiel- und Erlebnismöglichkeiten in der Natur<br />
finden. Im Rahmen der Dorferneuerung und in<br />
Zusammenwirken mit der Maßnahme 6 (Am<br />
Klimpe) sollten die Gehölze zurückgeschnitten<br />
und die Begehbarkeit des Weges durch geeignete<br />
Maßnahmen sichergestellt werden.
���������������������������<br />
���������������������������<br />
������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
Legende<br />
Renaturierung und Biotopvernetzung<br />
der Bachläufe und Auenbereiche<br />
Anlage eines bepflanzten Uferrandstreifens<br />
entlang des Mainebaches<br />
Anlage und Verdichtung von Gehölzstrukturen<br />
entlang der Wege und Straßen<br />
Pflanzung eines Baumtores<br />
zur Betonung des Ortseinganges<br />
Ausbau zu einem kombiniertem Rad-/<br />
Fußweges vom Sportplatz bis zur B 27<br />
Anlage eines Fußweges entlang<br />
des Mainebaches<br />
SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG<br />
Büro für Landschaftarchitektur und Landespflege Dr. Schwahn<br />
Schildweg 21 * 37085 Göttingen<br />
Tel: (0551) 59 349 * Fax: (0551) 59 357<br />
Ausbau / Instandsetzung der<br />
vorhandenen Wege<br />
Erhalt des dörflichen Ortsrandes<br />
DORFERNEUERUNG <strong>Ballenhausen</strong><br />
Im Auftrag der Gemeinde Friedland<br />
- Landschaftliches Entwicklungskonzept -<br />
Stärkere Eingrünung des Ortsrandes<br />
Anlage eines Osterfeuerplatzes<br />
Blatt Maßstab Bearbeiter(in) Datum<br />
1<br />
Dr. Schwahn Dez. 2008<br />
M. Fleddermann<br />
Potentielle Fläche für eine<br />
Siedlungserweiterung
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
WEITERE MASSNAHMEN<br />
DER<br />
DORFERNEUERUNG<br />
Als Maßnahmeschwerpunkte für die Dorferneuerung<br />
können nur Flächen gelten, die<br />
sich im öffentlichen Bereich und im Besitz der<br />
Gemeinde befinden. Dies jedoch darf nicht<br />
darüber hinwegtäuschen, dass im privaten<br />
Freiraum eine Vielzahl von Möglichkeiten existiert,<br />
durch Veränderungen der Oberflächengestaltung,<br />
durch Bäume, Pflanzbeete und<br />
Fassadenberankung, durch Erneuerung von<br />
Mauern und Zäunen zu einer Verbesserung<br />
des Dorfbildes und der Freiraumqualität in<br />
<strong>Ballenhausen</strong> beizutragen. Auch diese Maßnahmen<br />
werden von der Dorferneuerung gefördert.<br />
Voraussetzung für eine solche Förderung<br />
ist eine Beratung durch die Dorferneuerungs-<br />
Planer. Diese erstellen gern ein individuelles<br />
Konzept, das als Grundlage für einen Kostenvoranschlag<br />
durch ein regional ansässiges<br />
Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus<br />
dienen kann. Beide sind für die Beantragung<br />
beim Amt für Landentwicklung erforderlich.<br />
Bei der Ausfüllung des Antragsformulars<br />
gibt die Gemeinde gern Hilfestellung.<br />
Wichtig ist, dass vor der Bewilligung des<br />
Antrages durch das Amt für Landentwicklung<br />
keinesfalls mit der Durchführung der<br />
Maßnahme begonnen werden darf, da ansonsten<br />
die komplette Förderung verfällt!<br />
�<br />
Maßnahmen im öffentlichen<br />
Freiraum<br />
Neben den genannten Maßnahmenschwerpunkten<br />
existieren noch zahlreiche<br />
weitere Möglichkeiten zur Umgestaltung öffentlicher<br />
Freiräume im Rahmen der Dorferneuerung.<br />
Es ist durchaus denkbar und entspricht<br />
auch der Erfahrung des Planerteams, wenn im<br />
Zuge der Dorferneuerung die Prioritäten verändert<br />
werden und sich neue Maßnahmenschwerpunkte<br />
herauskristallisieren. Die<br />
Schwerpunktsetzung ist jedoch stets notwendig,<br />
um im Rahmen der Dorferneuerungs-<br />
Förderrichtlinie die erforderliche Mindestgrenze<br />
der Kosten zu erreichen.<br />
Gestaltung der Straßenräume<br />
Neben den in den Maßnahmenschwerpunkten<br />
explizit angesprochenen Straßenräumen<br />
sollten auch alle Möglichkeiten zur Umgestaltung<br />
der nicht genannten Straßen ausgeschöpft<br />
werden. Die folgenden Punkte stellen<br />
Ansatzpunkte für kleine Veränderungen dar,<br />
die regelmäßig in den Dörfern vorgefunden<br />
werden:<br />
Breite Einmündungen („Trompeten“) wurden<br />
vor allem bei der Auslegung der Straßen<br />
in den sechziger bis Ende der siebziger Jahre<br />
angelegt. Diese Mündungsbereiche können<br />
ohne Einschränkung der Fahrfunktion deutlich<br />
enger gefasst werden – für <strong>Ballenhausen</strong> wurde<br />
eine Möglichkeit in der Umgestaltung der<br />
Einmündung „Zum Ahrenbach“ aufgezeigt.<br />
Hier kann entweder durch Einbau einer Natursteinpflasterung<br />
im Seitenbereich oder aber<br />
durch ein Pflanzbeet eine deutliche funktionale<br />
und gestalterische Aufwertung erzielt werden.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Oberflächenbefestigungen sind nicht überall<br />
erforderlich. Entlang von Zäunen und Mauern<br />
der Grundstücksgrenzen sowie entlang von<br />
Gebäuden ist meist eine Entsiegelung möglich.<br />
Bereits ein Pflanzstreifen von 30 cm kann einen<br />
vollständig anderen Aspekt in einem Straßenraum<br />
auslösen. Gerade in Neubausiedlungen<br />
eröffnet sich hier eine Fülle gestalterischer<br />
Möglichkeiten!<br />
Ein Irrglaube ist übrigens, dass ein Keller<br />
dann feuchter wird, wenn man eine Versiegelung<br />
aufnimmt und ein Pflanzbeet einrichtet.<br />
Eine Woche hat 168 Stunden. Wenn es in<br />
dieser Woche insgesamt zwanzig Stunden<br />
lang regnet, kann Feuchtigkeit immer noch 148<br />
Stunden lang aus dieser Fläche verdunsten.<br />
Das Ergebnis: Häufig sind Keller trockener, vor<br />
denen sich ein Pflanzstreifen befindet. Nebenbei<br />
sei erläutert, dass die Pflanzen die verdunstende<br />
Oberfläche deutlich vergrößern, da<br />
sie Wasser über die Blätter verdunsten.<br />
�<br />
Stellplätze für Kfz lassen sich immer dort<br />
einrichten, wo die Gesamtbreite der Fahrbahn<br />
sieben Meter überschreitet. Aber auch in<br />
engeren Straßenräumen, z.B. „Zum<br />
Ahrenbach“, wurde erläutert, wie die Anlage<br />
von Parkplätzen zu einer Verkehrsberuhigung<br />
führen kann. Solche Stellplätze können in<br />
Rasenfugenpflaster angelegt werden und so<br />
zur Verdunstung beitragen. Neben der<br />
Ordnung im Straßenraum wird hierdurch auch<br />
die gestalterische Abwechslung gesteigert, vor<br />
allem, wenn gelegentlich eine Pflanzinsel<br />
eingeschaltet wird.<br />
Baumpflanzungen sind eine gute Möglichkeit,<br />
Räume zu gliedern, da Bäume deutliche<br />
Wirkung in der dritten Dimension entfalten.<br />
Nebenbei sind Bäume Schattenspender, ökologische<br />
Nischen und bereichern mit markantem<br />
Wuchs das Bild von Siedlungen, aber das<br />
wurde ja bereits erläutert...Übrigens: Es muss<br />
nicht in jedem Fall eine Linde sein (obwohl<br />
gerade die Linde sehr schnittverträglich ist und<br />
in kleiner Form gehalten werden kann). In vielen<br />
Fällen ist die Verwendung kleinkroniger<br />
Bäume wie Rotdorn, Apfeldorn oder Eberesche<br />
sinnvoller. Auf die Gehölzliste im Anhang<br />
sei hingewiesen!
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Der Altbaumbestand bedarf kontinuierlicher<br />
Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, dennoch<br />
sind bei alten Bäumen hin und wieder<br />
Abgänge und notwendige Fällung (aus welchem<br />
Grund auch immer) zu verzeichnen. Das<br />
Pflanzen neuer großkroniger Laubbäume hat<br />
daher in <strong>Ballenhausen</strong> auch den Sinn, das<br />
Ortsbild mit seinen charakteristischen Linden,<br />
Obstbäumen etc. zu erhalten.<br />
Dorfgerechte Beleuchtung<br />
Vor allem in der dunklen Jahreszeit von Oktober<br />
bis April wird deutlich, welchen Anteil die<br />
Beleuchtung an der Erlebnisqualität von Freiräumen<br />
hat. Früher waren<br />
Dörfer nur sehr spärlich<br />
beleuchtet. Die Verbreitung<br />
der Straßenbeleuchtung<br />
brachte leider auch eine Vereinheitlichung<br />
der<br />
Beleuchtungskörper mit sich:<br />
Pilzleuchten und genormte<br />
Straßenlampen machten<br />
keinen Unterschied zwischen<br />
Stadt und Dorf. Dies ist<br />
bedauerlich und sollte im<br />
Rahmen der Dorferneuerung<br />
korrigiert werden, zumal<br />
auch aus energetischen<br />
Gründen ein Überdenken der<br />
bisherigen Beleuchtungspraxis<br />
angezeigt ist.<br />
Dörfliche Freiräume<br />
benötigen<br />
Beleuchtungskörper, welche dem Charakter<br />
des Dorfes gerecht werden. Ferner ist hier<br />
besonders wichtig, dass die seit längerem<br />
bekannten Aspekte des Tierschutzes berücksichtigt<br />
werden. UV-Licht lockt Insekten und<br />
Fledermäuse an und hat schon viele dieser<br />
Tiere zu Tode gebracht, so dass UVemittierende<br />
Leuchtmittel der Vergangenheit<br />
angehören sollten. Auch sollte eine Lichtverstrahlung<br />
des Nachthimmels vermieden werden:<br />
Licht gehört auf den Boden und nicht in<br />
die Luft, sollte gezielt gestreut und optimal<br />
genutzt werden. Dies ist auch in energetischer<br />
Hinsicht von Bedeutung. Und zu guter Letzt<br />
sollten die im Dorf verwendeten Beleuchtungskörper<br />
sich auch gestalterisch in den Kontext<br />
einfügen.<br />
Leider existieren Beleuchtungskörper, die<br />
all diese Anforderungen erfüllen, erst seit verhältnismäßig<br />
kurzer Zeit. Im Rahmen der Dorferneuerung<br />
ist somit der Zeitpunkt gekommen,<br />
eine Erneuerung der Beleuchtung nach den<br />
oben genannten Erkenntnissen in Angriff zu<br />
nehmen.<br />
�<br />
Sanierung der Natursteinmauern<br />
In <strong>Ballenhausen</strong> sind viele sehr ortsbildprägende<br />
Natursteinmauern vorhanden. Ihre Sanierung<br />
kann auch einen Schwerpunkt der<br />
Dorferneuerung darstellen. Ob in öffentlichem<br />
oder privatem Besitz - an ihrer Erhaltung besteht<br />
angesichts ihrer besonderen Bedeutung<br />
für Dorfbild und Dorfökologie generell ein besonderes<br />
Interesse. Aus diesem Grund ist<br />
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch<br />
allein die Erneuerung bzw. Sanierung einer<br />
solchen Mauer im Rahmen der Dorferneuerung<br />
förderungswürdig ist.<br />
Häufig sind die Natursteinmauern ursprünglich<br />
in Trockenbauweise, d.h. ohne die Verwendung<br />
von Mörtel aufgesetzt und wandern<br />
aufgrund des Erddruckes in den Straßenraum.<br />
Um den Bestand an Pflanzen wie Farnen und<br />
Mauerpolstern zu erhalten, sollte zunächst<br />
versucht werden, sie hinterwärts abzugraben<br />
und die Steine wieder zurückzudrücken. Wenn<br />
dies nicht möglich oder sinnvoll erscheint,<br />
muss die Mauer abgebaut und neu aufgesetzt<br />
werden. Ganz wichtig ist, dass kein drückendes<br />
Wasser entstehen kann, sondern die<br />
Mauerrückseite eine gute Entwässerung besitzt.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Verbesserung des Wanderwegesystems<br />
um <strong>Ballenhausen</strong><br />
Der Plan „Fußwegeverbindungen“ zeigt bereits<br />
die Möglichkeit eines Rundwanderweges<br />
um <strong>Ballenhausen</strong> auf. Damit muss sich die<br />
Verbesserung des Wegesystems in der Gemarkung<br />
jedoch keineswegs beschränken.<br />
Vielmehr sollte in Verbindung mit den Nachbardörfern<br />
die Herrichtung und Ausschilderung<br />
eines gemeindeübergreifenden Wegesystems<br />
für Wanderer und Radler betrieben werden.<br />
Hierfür gibt es möglicherweise auch über die<br />
Dorferneuerung hinausgehende Fördermöglichkeiten.<br />
Anlage von Hecken und Baumreihen<br />
entlang von Wegen und Straßen<br />
Neben den bereits im Rahmen von Maßnahmenschwerpunkt<br />
angeregten Bepflanzungen<br />
sollen auch entlang der übrigen Wege,<br />
Straßen und Gewässer der Gemarkung <strong>Ballenhausen</strong><br />
alle Möglichkeiten ausgeschöpft<br />
werden, bestehende Gehölzstrukturen zu verdichten<br />
und neue anzulegen. Diese linearen<br />
Verbindungselemente zwischen Dorf und umgebender<br />
Landschaft haben vielfältige Biotopfunktionen<br />
und wirken auch für die Bewohner<br />
von <strong>Ballenhausen</strong> in vielerlei Hinsicht positiv:<br />
Blühende Obstbaumreihen im Frühling und die<br />
Ernte von gesundem Obst im Herbst schaffen<br />
einen besonderen Aspekt von Heimatgefühl,<br />
�<br />
auch die Bank am Wegesrand wird erst durch<br />
daneben stehende Bäume heimelig. Die ökologischen<br />
Aspekte sind nicht weniger relevant:<br />
Hecken bremsen die Windgeschwindigkeit und<br />
somit die Erosion, bei einer hangparallelen<br />
Anlage versickert hier außerdem abfließendes<br />
Oberflächenwasser, mitgeführte Sedimente<br />
verbleiben in der Hecke. So kann in den Hanglagen<br />
oberhalb der Siedlungen durch das<br />
Pflanzen von Hecken an den richtigen Stellen<br />
auch Einfluss auf das Problem des Hangwasserabflusses<br />
gelegt werden.<br />
Eingrünung der Ortsränder<br />
Die Ortsränder von <strong>Ballenhausen</strong> sind, wie<br />
bereits verschiedentlich ausgeführt, in weiten<br />
Teilen gut in die umgebende Landschaft integriert.<br />
Der Erhalt dieses Saums von Obstwiesen,<br />
Gärten und Weiden sollte allen Bewohnern<br />
<strong>Ballenhausen</strong>s am Herzen liegen. Darüber<br />
hinaus gibt es erhebliches Potenzial für<br />
eine bessere Ortsrandgestaltung, vor allem an<br />
den neueren Baugebieten, aber auch den ergänzenden<br />
Einzelbauten der zentralen Ortslage.<br />
Hier besteht ein Nachholbedarf, der nicht<br />
allein in der Verantwortung der privaten Bauherren<br />
liegt. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete<br />
sollte im Rahmen der Bauleitplanung<br />
besonderer Wert auf die Eingrünung derselben<br />
gelegt werden. So trägt die Anlage von Streuobstwiesen,<br />
Baumreihen oder Pflanzstreifen<br />
mit heimischen Gehölzen am Rand der Baugebiete<br />
zur Entwicklung eines ortstypischen<br />
Dorfrandes bei und kann als Ausgleich im Sinne<br />
der Eingriffsregelung gewertet werden.<br />
Gemeinschaftliche Pflanzaktion<br />
Eine gemeinsame Pflanzaktion ist ein guter<br />
Einstieg in die Umsetzung der Dorferneuerungsplanung.<br />
An einem Samstag trifft sich die<br />
Dorfgemeinschaft, um möglichst viele Pflanzen<br />
im Dorf und in seiner Umgebung in die Erde zu<br />
bringen. Das Pflanzmaterial hierzu könnte z.B.<br />
von der Gemeinde gekauft werden. In diesem<br />
Rahmen erhalten auch Haus- und Grundeigentümer<br />
die Gelegenheit, mit der Begrünung ihrer<br />
Anwesen etwas für das Dorfbild beizusteuern.<br />
Nach getaner Arbeit ist ein gemeinsames Essen<br />
ein guter Abschluss.
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
PRIVATE INITIATIVEN<br />
Selbst bei der relativ umfangreichen Liste<br />
von Maßnahmen in öffentlichen Freiräumen ist<br />
das Ziel der Dorferneuerungsplanung nur zu<br />
erreichen, wenn auch im privaten Bereich Bestrebungen<br />
zur Erhaltung traditioneller, dörflicher<br />
Freiräume und ihrer Elemente unternommen<br />
werden. Die privaten Freiräume sind zu<br />
vielfältig, als dass im Rahmen dieser Broschüre<br />
konkrete Planungen vorgestellt werden<br />
könnten. In den meisten Fällen sind auch gar<br />
keine umfassenden Planungen erforderlich.<br />
Wichtig ist vielmehr, dass die Bedeutung der<br />
einzelnen Freiraumelemente und ihr Wert für<br />
das traditionelle, dörfliche Erscheinungsbild<br />
wie auch für die Ökologie des Dorfes als Lebensraum<br />
für Pflanzen und Tiere erkannt werden.<br />
Schwerpunkt der Bestandsaufnahme war<br />
daher die Vermittlung dieser Bedeutung.<br />
Bei allen Maßnahmen, welche die privaten<br />
Freiräume bzw. ihre Elemente verändern, sollten<br />
die allgemeinen Ausführungen über die<br />
Bedeutung von Freiräumen und ihren Elementen<br />
in Erinnerung gerufen werden. Traditionelle,<br />
dörfliche Freiraumelemente sollen nach<br />
Möglichkeit erhalten oder aber in der traditionellen<br />
Weise erneuert werden: Holzlattenzäu-<br />
�<br />
ne, Trockenmauern, Hausbäume, Bauerngärten,<br />
Berankungen, ruderale Vegetationsstreifen,<br />
Obstwiesen, Dachböden sollen als Lebensräume<br />
in der Form erhalten werden, die<br />
über Jahrhunderte das Erscheinungsbild von<br />
<strong>Ballenhausen</strong> wie auch die Identität seiner<br />
Einwohner geprägt hat. Diese Identität verpflichtet:<br />
wenn die unverwechselbare Gestalt<br />
von <strong>Ballenhausen</strong> erhalten bleiben soll, müssen<br />
sich seine Bewohner für die Erhaltung<br />
ihrer Heimat engagieren. Der Arbeitskreis<br />
Dorferneuerung mag ein Anfang sein, warum<br />
sollte er nicht als Verein über die Zeit der<br />
staatlichen Förderung hinaus weiter existieren?<br />
Längst nicht alle Maßnahmen im Bereich<br />
der öffentlichen Freiräume können aus Mitteln<br />
der Dorferneuerung bezuschusst werden. Dies<br />
ist aber auch nicht erforderlich. Ein wesentliches<br />
Merkmal traditioneller, dörflicher Freiraumelemente<br />
ist ihre Einfachheit: Das Erreichen<br />
der gewünschten Funktion mit einfachsten<br />
Mitteln. Bei der Erhaltung und Erneuerung<br />
privater, dörflicher Freiraumstrukturen kommen<br />
daher keine großen finanziellen Belastungen<br />
auf die Eigentümer zu. Die Vergangenheit<br />
zeigt vielmehr, dass übermäßiger Mitteleinsatz<br />
eine wesentliche Ursache für die Überprägung<br />
dörflicher Freiräume mit städtischen Elementen<br />
war. In <strong>Ballenhausen</strong> sollte die Dorferneuerung<br />
als Möglichkeit genutzt werden, die Konsequenzen<br />
aus diesen Erkenntnissen zu ziehen!<br />
Die folgenden Empfehlungen sollen als<br />
Orientierungshilfe für die Gestaltung der privaten<br />
Freiräume und zum Umgang mit Natur und
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Landschaft dienen. Darüber hinaus kann<br />
eine individuelle Beratung durch die Dorferneuerungs-Planer,<br />
die jetzt als Umsetzungsbeauftragte<br />
fungieren, im Rahmen<br />
der Dorferneuerung kostenlos in Anspruch<br />
genommen werden.<br />
Gestaltung der Vorgärten<br />
Der repräsentative Charakter von Vorgärten<br />
kann ganz entscheidend durch einen oder<br />
mehrere „Hausbäume“ gesteigert werden.<br />
Wenn möglich, sollten diese in der Nähe des<br />
Einganges gepflanzt werden. Vor allem bei<br />
symmetrisch angelegten Häusern empfiehlt<br />
sich die Pflanzung von zwei Winterlinden<br />
beidseitig der Haustür, deren Krone<br />
regelmäßig beschnitten wird. Auf diese Weise<br />
wird sowohl eine übermäßige Beschattung<br />
verhindert sowie auch ein Eindringen der<br />
Wurzeln in Keller oder Kanalisation, da der<br />
Wurzelkörper etwa die gleiche Größe wie die<br />
Krone annimmt.<br />
Der Eingangsbereich sollte möglichst<br />
durchlässig befestigt werden. Hier empfiehlt<br />
sich Pflaster, welches mit großen Fugen verlegt<br />
wird. Vor allem bei historischen Gebäuden<br />
sollte bevorzugt Natursteinpflaster verwendet<br />
werden. Die Einfriedung des Vorgartens<br />
sollte mit einem Holzlattenzaun erfolgen, der<br />
�<br />
sich gut beranken lässt, z.B. mit Wicken oder<br />
Kapuzinerkresse.<br />
Ausgesprochen schöne Aspekte bieten<br />
Blumenzwiebeln und sonstige Frühjahrsblüher.<br />
Schneeglöckchen, Märzenbecher,<br />
Christrosen, Perlhyazinthen, Vergißmeinnicht,<br />
Krokusse, Scylla, Tulpen und Narzissen bringen<br />
im Frühjahr Farbe in den Garten und veranlassen<br />
Vorübergehende zum Stehenbleiben.<br />
Rasenflächen in Vorgärten können ebenfalls<br />
mit Blumenzwiebeln "nachgerüstet" werden;<br />
hier empfiehlt sich die gruppenweise Pflanzung.<br />
Vor allem bei südexponierten Vorgärten<br />
sollten bevorzugt Stauden statt Gehölze verwendet<br />
werden. Zwar machen sie etwas mehr<br />
Arbeit; ihre Blütenpracht belohnt jedoch die<br />
Mühe und bringt bei gut durchdachter Anlage<br />
Freude über das ganze Sommerhalbjahr.<br />
Zweckmäßigerweise baut man die Staudenpflanzung<br />
so auf, dass an Zaun und Eingangsweg<br />
zunächst niedere Stauden angepflanzt<br />
werden, deren Hintergrund höherwachsende<br />
Arten wie Rittersporn, Brennende Liebe,<br />
Trändendes Herz, Pfingstrosen und Taglilien<br />
bilden. Auch für schattigere Lagen gibt es genug<br />
Arten, so z.B. Immergrün, Schaumblüte,<br />
Frauenmantel und viele Waldgräser.<br />
Berankung von Fassaden<br />
Fassadenberankungen erfüllen weitaus<br />
mehr Funktionen als allein die Verdeckung<br />
„nackter“ Wände. Ihre ökologische Aufgabe<br />
liegt in der Bereitstellung von Lebensräumen<br />
für Vögel und Insekten sowie in der Verbesserung<br />
des Kleinklimas durch Staubfilterung und<br />
Verdunstung. Darüber hinaus schützt eine<br />
Fassadenberankung das Bauwerk vor extremen<br />
Witterungseinflüssen. Fassadenberankungen<br />
können in engen Straßenräumen wesentlich<br />
zur Begrünung beitragen, da der Wurzelbereich<br />
vergleichsweise wenig Platz benötigt<br />
(ca. 40 cm von der Hauswand).
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
Nicht alle Pflanzen klettern von selbst; dies<br />
tun im Wesentlichen nur Wilder Wein, Kletterhortensie<br />
und Efeu. Die meisten Rankpflanzen<br />
benötigen vielmehr Rank- bzw. Kletterhilfen,<br />
die in Form von Latten, Spanndrähten oder<br />
ähnlichen sinnvollen Vorrichtungen geboten<br />
werden kann. Wichtig ist ein Wandabstand von<br />
ca. 5 - 20 cm, um eine gute Hinterlüftung des<br />
Mauerwerks zu gewährleisten.<br />
Dörfliche Gärten<br />
<strong>Ballenhausen</strong> zeigt besondere Stärken bei<br />
der Gestaltung der privaten Gärten, die eine<br />
besondere Individualität erkennen lassen,<br />
wenn auch nicht immer dörfliche Gestaltungsprinzipien<br />
vorherrschend sind.<br />
Wenngleich es der Dorferneuerung fern<br />
liegt, dörfliche „Einheitsgärten“ zu produzieren,<br />
sollte sich die Gestaltung der Dorfgärten doch<br />
stärker an den Traditionen des ländlichen<br />
Raumes orientieren. Die nach dem Krieg vermehrt<br />
eingesetzten Immergrünen und Koniferen<br />
sollten daher in Zukunft wieder den laubabwerfenden<br />
Arten Platz machen, die diesen<br />
bereits vor dieser Zeiterscheinung innehatten.<br />
Dies ist durchaus im Sinne der Pflegeleichtigkeit:<br />
Fichten, Kiefern und Lebensbäume sind<br />
Großgehölze, die viel Raum zur Entwicklung<br />
�<br />
benötigen und ihn in aller Regel nicht erhalten.<br />
Sie nehmen ihn sich dann – auf Kosten der<br />
Frei-Räume. Im Kirchumfeld von <strong>Ballenhausen</strong><br />
ist dieses Phänomen sehr deutlich zu erkennen.<br />
Wer immer die Möglichkeit und die Zeit dazu<br />
hat, sollte einen Teil seines Gartens zur<br />
Erzeugung von Gemüse, Obst und Kräutern<br />
nutzen. Dies hat im Wesentlichen nur Vorteile,<br />
denn neben dem Menschen profitieren viele<br />
dorftypische Arten von vielfältig gestalteten<br />
Gärten. Auch das Ortsbild lebt von Nutzgärten,<br />
die früher noch viel verbreiteter waren als heute.<br />
Gerade <strong>Ballenhausen</strong> weist noch viele<br />
Dorfgärten auf, so dass es ungerecht wäre, nur<br />
einige an dieser Stelle hervorzuheben.<br />
Die Einfriedung des Gartens sollte mit einem<br />
Staketenzaun erfolgen. Zur Überwindung<br />
von Höhenunterschieden sind Terrassierungen<br />
sinnvoll; durch Natursteinmauern lassen sich<br />
darüber hinaus reizvolle Aspekte verwirklichen<br />
und Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt<br />
schaffen. Betonstützmauern sollten nach<br />
Möglichkeit mit Natursteinen verblendet werden.<br />
Nutzgärten benötigen keinen Sichtschutz,<br />
so dass sich Gehölzabpflanzungen erübrigen.<br />
Aber auch Ziergärten verlieren einen erheblichen<br />
Teil ihrer Wirkung, wenn sie von einer<br />
dichten Hecke umgeben sind. Schutzpflanzun-
�������������������������<br />
������������������������ � � � � � � � � � � � �������������<br />
gen mit Sträuchern sollten nur dort vorgenommen<br />
werden, wo sich ein wirkliches Schutzbedürfnis<br />
ergibt, so z.B. an vielbefahrenen Straßen<br />
oder gegen Witterungseinflüsse.<br />
Auch bei der Anlage von Terrassenflächen<br />
sollten die Überlegungen zur Versiegelung<br />
angestellt werden. Rasenflächen sollten nicht<br />
im englischen Stil angelegt, sondern vielfältig<br />
gestaltet werden. Hierzu trägt übrigens eine<br />
intensive Düngung nicht bei, da diese nur<br />
starkwüchsige Gräser begünstigt und darüber<br />
hinaus häufige Schnitte erfordert. Geringere<br />
Düngergaben und weniger Schnitte dagegen<br />
ziehen eine höhere Artenvielfalt nach sich.<br />
Umweltfreundliche Gartengestaltung<br />
Anlage und Pflege des Gartens können Aspekte<br />
des Umweltschutzes in sehr unterschiedlicher<br />
Weise berücksichtigen. Hierbei ist<br />
die Verwendung von chemischen Behandlungsmitteln<br />
nur ein Aspekt, wenn auch der<br />
einleuchtendste. In Privatgärten werden am<br />
ehesten natürliche Pflanzenbehandlungsmittel<br />
wie Brennesseljauche, Klebfallen u. dgl. angewendet,<br />
da der Gärtner bzw. die Gärtnerin hier<br />
mit den Folgen der Pflanzenbehandlung zu<br />
leben hat. Sinnvoll ist auch die Rückbesinnnung<br />
auf alte Kulturfolgen und Mischkulturen,<br />
die allein mit den Schädlingen fertig werden.<br />
Man denke daran: Unsere Vorfahren lebten<br />
von diesen Gärten, und dies ohne Gloriaspritze,<br />
Metasystox oder Unkraut-Ex!<br />
�<br />
Über die Pflanzenbehandlung hinaus können<br />
Ziele von Natur- und Umweltschutz jedoch<br />
auf vielfältige Art weiter berücksichtigt werden.<br />
Die Verwendung von Regenwasser spart<br />
Trinkwasser. Die Kompostierung von Garten-<br />
und Küchenabfällen trägt zur Müllvermeidung<br />
und zur Reduzierung von Dünger bei, da sie<br />
eine hervorragende Bodenverbesserung ergibt.<br />
Hierzu gehört auch die Kompostierung<br />
von Laub, welches deshalb nicht von den Rabatten<br />
geharkt werden soll. Organische Düngung<br />
statt Mineraldüngung ist im Dorf leichter<br />
als in der Stadt, da hier noch Tiere gehalten<br />
werden. Auf diese Weise könnte dörfliche Gartenkultur<br />
zu einem Vorbild umweltverträglicher<br />
Lebensraumgestaltung werden.
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
ARTENLISTEN FÜR<br />
DÖRFLICHE GEHÖLZE UND<br />
STAUDEN<br />
Großbäume für Dorf und Feldmark<br />
Spitzahorn Acer platanoides<br />
Bergahorn Acer pseudoplatanus<br />
Rosskastanie Aesculus hippocastanum<br />
Rotbuche Fagus sylvatica<br />
Esche Fraxinus excelsior<br />
Walnussbaum Juglans regia<br />
Traubeneiche Quercus petraea<br />
Steileiche Quercus robur<br />
Winterlinde Tilia cordata<br />
Sommerlinde Tilia platyphyllos<br />
Kleinkronige Bäume für Dorf und<br />
Feldmark<br />
Feldhahorn Acer campestre<br />
Hainbuche Carpinus betulus<br />
Rotdorn Crataegus laevigata<br />
nur im Ort: Paul's<br />
Scartet'<br />
Holzapfel Malus sylvestris<br />
Eberesche Sorbus aucuparia<br />
Mehlbeere<br />
Sorbus aria<br />
Traubenkirsche Prunus padus<br />
Salweide Salix caprea<br />
Bäume für Auenbereiche<br />
Schwarzerle Alnus glutinosa<br />
Esche Fraxinus excelsior<br />
Aspe Populus tremula<br />
Baum-Weide Salix alba, S.<br />
fragilis<br />
�<br />
Obstbäume<br />
Äpfel in bewährten Sorten, z.B.:<br />
Alkmene<br />
Bohnapfel<br />
Celler Dickstiel<br />
Gelber Richard<br />
Gravensteiner<br />
Jakob Fischer<br />
Jakob Lebel<br />
Kaiser Wilhelm<br />
Klarapfel<br />
Landsberger Renette<br />
Maunzenapfel<br />
Ontario<br />
Roter Berlepsch<br />
Roter Boskoop<br />
Schafsnase<br />
Schöner von Nordhausen<br />
Uelzener Calvill<br />
Uelzener Rambour
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Birnen in regional bewährten Sorten, z.B.:<br />
Gellerts Butterbirne<br />
Gute Luise<br />
Gute Graue<br />
Clapps Liebling<br />
Köstliche von Charneu<br />
Pastorenbirne<br />
Speckbirne<br />
Hauszwetschge, Pflaumen in bewährten<br />
Sorten, Mirabellen, Reneklauden<br />
Süßkirschen in bewährten Sorten, z.B.:<br />
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche<br />
Große Prinzessinnenkirsche<br />
Große schwarze Knorpelkirsche<br />
Königskirsche<br />
Sauerkirschen in bewährten Sorten, z.B.:<br />
Rote Maikirsche<br />
Schattenmorelle<br />
Heimische Sträucher<br />
�<br />
Roter Hartriegel Cornus sanguinea<br />
Kornelkirsche Cornus mas<br />
Haselnuß Corylus avellana<br />
Eingr. Weißdorn Crataegus monogyna<br />
Zweigr. Weißdorn Crataegus laevigata<br />
Pfaffenhütchen Euonymus eurpäus<br />
Faulbaum Rhamnus frangula<br />
Heckenkirsche Lonicera xylosteum<br />
Schlehe Prunus spinosa<br />
Feld-Rose Rosa arvensis<br />
Hundsrose Rosa canina<br />
Brombeere Rubus fruticosa<br />
Strauchweiden Salix caprea,<br />
cinerea,<br />
purpurea<br />
Schwarzer Holunder Sambucus nigra<br />
Roter Holunder Sambucus<br />
racemosa<br />
Wolliger Schneeball Viburnum lantana<br />
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus<br />
Ziersträucher für die Ortslage<br />
Kahle Felsenbirne Amelanchier laevis<br />
Kupferfelsenbirne Amel. lamarckii<br />
Sommerflieder Buddleia alternifolia<br />
Buchsbaum Buxus sempervirens<br />
Gartenhortensie Hydrangea paniculata<br />
'Grandiflora'<br />
Bauernjasmin Philadelphus coronarius<br />
Blut-Johannisbeere Ribes sanguineum<br />
ssp.<br />
Rosen in diversen, ungefüllten Sorten<br />
Flieder Syringa vulgaris<br />
Kleinsträucher<br />
Berberitze Berberis buxifolia,<br />
hookeri, verruclosa<br />
Scheinhasel Corylopsis pauciflora<br />
Deutzie Deutzia gracilis<br />
Johanniskraut Hypericum calicynum<br />
Mahonie Mahonia aquifolium<br />
Glanzrose Rosa nitida<br />
Purpurweide Salix rosmarinifolia<br />
Brautspiere Spiraea arguta<br />
Rote Sommerspiere Spiraea bumalda<br />
Froebelii<br />
Rosmarinweide Salix rosmarinifo<br />
lia
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Schling- und Kletterpflanzen<br />
Efeu Hedera helix<br />
Clematis in Sorten Clematis montana<br />
ssp.<br />
Waldrebe Clematis vitalba<br />
Kletterrosen in Sorten<br />
Kletterhortensie Hydrangea petiolaris<br />
Wilder Wein Parthenocissus<br />
quinquefolia, tricuspidata<br />
Knöterich Polygonum aubertii<br />
Jelängerjelieber Lonicera caprifolium<br />
Blumenzwiebeln und Knollen<br />
Dahlie Dahlia-Hybriden<br />
Winterling Erianthis hiemalis<br />
Kaiserkrone Frittilaria imperialis<br />
Schachbrettblume Frittilaria meleagris<br />
Gelbstern Gagea lutea<br />
Schneeglöckchen Galanthus nivalis<br />
Schwertlilie Iris germanica u.a.<br />
Märzenbecher Leucojum vernum<br />
Feuerlilie Lilium bulbiferum<br />
Türkenbund Lilium martagon<br />
Madonnenlilie Lilium candidum<br />
Traubenhyazinthe Muscari comosum<br />
Hasenglöckchen Scylla non scripta<br />
Blaustern Scylla bifolia,<br />
S. sibirica<br />
Tulpe in Sorten Tulipa ssp.<br />
Stauden, Sommerblumen<br />
Akelei Aquilegia vulgaris/hybrida<br />
Alant Inula helenium<br />
Aster Aster novi-belgii,<br />
Callistephus<br />
chinensis<br />
Aurikel Primula auricula<br />
Bartnelke Dianthus barbatus<br />
�<br />
Bechermalve Althea ficifolia,<br />
Lavatera trimestris<br />
Beinwell Symphitum officinalis<br />
Bergflockenblume Centaurea montana<br />
Blaukissen Aubrieta-Hybriden<br />
Brennende Liebe Lychnis chalcedonia<br />
Christrose Helleborus niger<br />
Dachwurz Sempervivum tectorum<br />
Eberraute Artemisia abrotanum<br />
Eibisch Althea officinalis<br />
Eisenhut Aconitum napellus<br />
Eisenkraut Verbena officinalis<br />
Federnelke Dianthus plumarius<br />
Feldrittersporn Delphinium consolida<br />
Fetthenne Sedum telephium<br />
Feuerbohne Phaseolus coccineus<br />
Fleißiges Lieschen Impatiens walleriana<br />
Frauenmantel Alchemilla mollis<br />
Fuchsschwanz Amaranthus candatus<br />
Funkie Hosta sieboldiana<br />
u. andere<br />
Gauklerblume Mumulus guttatus<br />
Gartenbalsamine Impatiens balsamina<br />
Gelbfärberich Lysimachia punctata<br />
Gemswurz Doronicum grandiflorum<br />
Glockenblume Campanula persifolia<br />
Goldlack Cheiranthus cheiri<br />
Goldrute Solidago hybrida<br />
Grasnelke Armeria maritima<br />
Haselwurz Asarum europaeum<br />
Himmelsschlüssel Primula vulgaris<br />
Immergrün Vinca minor<br />
Johanniskraut Hypericum perforatum<br />
Jungfer im Grünen Nigella damascena<br />
Kapuzinerkresse Tropaeolum majus<br />
Klatschmohn Papaver rhoeas<br />
Knäuelglockenblume Campanula<br />
glomerata<br />
Kornblume Centaurea cyanus<br />
Kaukasusvergißmeinnicht Brunnera macrophylla<br />
Leberblümchen Hepatica nobilis<br />
Levkoje Matthiola incana<br />
Lichtnelke Lychnis coronaria<br />
Löwenmaul Antirrhinum majus
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Lungenkraut Pulmonaria<br />
officinalis<br />
Maiglöckchen Convallaria majalis<br />
Männertreu Lobelia erinus<br />
Margerite Chrysanthemum<br />
leucanthemum<br />
Mauerpfeffer Sedum acre<br />
Mondviole Lunaria annua<br />
Mutterkraut Chrysanthemum<br />
parthenium<br />
Orientalischer Mohn Papaver orientale<br />
Pfingstrose Paeonia officinalis<br />
Primel Primula officinalis<br />
Purpurglöckchen Heuchera<br />
sanguinea<br />
Resede Reseda odorata<br />
Ringelblume Calendula officinalis<br />
Rittersporn Delphinium elatum<br />
Ruprechtskraut Geranium<br />
robertianum<br />
Salomonssiegel Polygonatum<br />
odoratum<br />
Schafgarbe Achillea<br />
filipendulina<br />
Schleierkraut Gypsophila<br />
paniculata<br />
Schleifenblume Iberis<br />
Schmuckkörbchen Cosmos bipinatus<br />
Seifenkraut Saponaria officinalis<br />
Sonnenblume Helianthus annuus<br />
Sonnenbraut Helenium hybridum<br />
Sonnenhut Rudbeckia laciniata<br />
Steinbrech Saxifraga umbrosa<br />
Steinkraut Alyssum saxatile<br />
Stockrose Althaea rosea<br />
Strohblume Helichrysum bracteatum<br />
Studentenblume Tagetes patula<br />
Taglilie Hemerocallis in<br />
Sorten<br />
Tränendes Herz Dicentra spectabilis<br />
Trollblume Trollius europaeus<br />
Veilchen Viola odorata<br />
Verbene Verbena rigida<br />
Vergißmeinnicht Myosotis in Sorten<br />
Wasserdost Eupatorium purpureum<br />
Wegwarte Chichorium intybus<br />
Weidenröschen Epilobium angustifolium<br />
Wicke Lathyrus odoratus<br />
Wilde Malve Malva sylvestris<br />
Wucherblume Chrysanthemum<br />
Zinnie Zinnia elegans<br />
�
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
KOSTENSCHÄTZUNG<br />
Maßnahmenschwerpunkt 1a: Ortseinfahrten:Verkehrsberuhigung<br />
Pauschal für 2 Verkehrsberuhigungen am Ortseingang 100.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 100.000,00<br />
Zuzüglich Planungskosten, 15 % 15.000,00<br />
Zwischensumme 115.000,00<br />
Zuzüglich Mehrwertsteuer, 19 % 21.850,00<br />
Gesamtkosten 136.850,00<br />
Maßnahmenschwerpunkt 1b: Ausbau innerörtlicher Fusswege an ‚Heerstraße’<br />
und ‚Rhienstraße’ ,Querungshilfen<br />
Abschnittslänge: 175 lfm, Flächenbefestigung neu: 370 qm<br />
Vorarbeiten 7.400,00<br />
Unterbau, Entwässerung 5.550,00<br />
Gossen, Borde, Einfassungen 4.725,00<br />
Wegebau (Pflasterung Betonstein) 14.850,00<br />
Wegebau (Pflasterung Naturstein) 4.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 36.525,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 5.478,75<br />
Zwischensumme 42.003,75<br />
19 % Mehrwertsteuer 7.980,71<br />
Gesamtkosten (gerundet) 49.984,46<br />
Maßnahmenschwerpunkt 2:<br />
Neugestaltung von Johannisstraße und Kirchumfeld<br />
Gesamtfläche (neu zu befestigen): 1000 m², davon Betonpflaster 770 m²,<br />
Natursteinpflaster 100 m², wassergebundene Decke 130 m².<br />
Bau Natursteinmauer 20 lfm, Bau Treppe Naturstein 7 Stck., Treppe Betonstein 9 Stck.<br />
Vorarbeiten 17.000,00<br />
Unterbau, Entwässerung 15.000,00<br />
Gossen, Borde, Einfassungen 11.000,00<br />
Wegebau (Pflasterung Betonstein) 34.650,00<br />
Wegebau (Pflasterung Naturstein) 10.000,00<br />
Wegebau (WGD, „Thieplatz“) 2.600,00<br />
Naturstein-Mauerbau, 20 lfm 3.000,00<br />
Treppen Naturstein 2.100,00<br />
Treppen Beton (Johannisstraße) 1.350,00<br />
Baumschnitt, Baumpflege 2.500,00<br />
Pflanzarbeiten, Rasenansaat 5.000,00<br />
Pflegearbeiten 1.000,00<br />
Ausstattung, Beleuchtung<br />
(6 Mastleuchten, 6 Bodenstrahler, 2 Bänke, 2 Papierkörbe) 12.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 117.200,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 17.580,00<br />
Zwischensumme 134.780,00<br />
Übertrag Zwischensumme 134.780,00<br />
�
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
19 % Mehrwertsteuer 25.608,20<br />
Gesamtkosten 160.388,20<br />
Davon Anteile (gerundet)<br />
Anteil Johannisstraße (Anteil Fläche: 44 %) 71.000<br />
Anteil Wegeparzelle zur Heerstraße (Anteil Fläche: 24 %) 39.000<br />
Anteil „Neuer Thieplatz“ (Anteil Fläche: 13 %) 21.000<br />
Anteil Kirchgrundstück (Anteil Fläche: 19 %) 30.000<br />
Maßnahmenschwerpunkt 3:<br />
Ausbau eines Radweges zur B 27<br />
Gesamtfläche 2880 m², Abschnittslänge 960 lfm;<br />
Oberflächenbefestigung auf vorhandenem Unterbau:<br />
Vorarbeiten auf vorh. Unterbau 2.880,00<br />
Wegebau (Splittdecke 3 cm) 14.400,00<br />
Pflanzarbeiten (50 Obstbäume) 1.750,00<br />
Pflegearbeiten 250,00<br />
Ausstattung (2 Bänke, 2 Schilder) 3.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 22.280,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 3.342,00<br />
Zwischensumme 25.622,00<br />
19 % Mehrwertsteuer 4.868,18<br />
Gesamtkosten 30.490,18<br />
Maßnahmenschwerpunkt 4:<br />
Neugestaltung des Dorfplatz<br />
Gesamtfläche (neu zu befestigen): 940 m², Öffnung des ‚Rhienbaches’,<br />
Uferbefestigung, Natursteinmauern: 70 lfm, Grünflächen: ca. 1500 qm<br />
Vorarbeiten 24.650,00<br />
Unterbau, Entwässerung 14.100,00<br />
Gossen, Borde, Einfassungen 7.500,00<br />
Wegebau (Pflasterung Betonstein) 41.175,00<br />
Wegebau (Pflasterung Naturstein) 2.500,00<br />
Öffnen des ‚Rhienbaches’, Uferbefestigung, Natursteinmauern 20.000,00<br />
Vegetationstechnische Arbeiten (Rasen, Pflanzbeete) 11.250,00<br />
Alleebaumpflanzung 3.000,00<br />
Pflegearbeiten 7.500,00<br />
Ausstattung, Beleuchtung<br />
(5 Mastleuchten, 3 Pollerleuchten, 2 Bänke, 1 Papierkorb) 10.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 141.675,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 21.251,25<br />
Zwischensumme 162.926,25<br />
19 % Mehrwertsteuer 30.955,99<br />
Gesamtkosten 193.882,24<br />
�
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 5:<br />
Erneuerung des Kreuzungsbereiches Rhienstraße - Eickhofsweg,<br />
Verkehrsberuhigung<br />
Gesamtfläche: 300 m² Pflasterkreis Naturstein 70 qm,<br />
Pflasterung Betonstein 200 qm, Grünflächen: 30 qm<br />
Vorarbeiten 5.100,00<br />
Unterbau, Entwässerung 4.050,00<br />
Gossen, Borde, Einfassungen 1.250,00<br />
Wegebau (Pflasterung Betonstein) 9.000,00<br />
Wegebau (Pflasterung Naturstein) 7.000,00<br />
Pflanzarbeiten incl. Pflegearbeiten 750,00<br />
Summe Herstellungskosten 27.150,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 4.072,50<br />
Zwischensumme 31.222,50<br />
19 % Mehrwertsteuer 5.932,28<br />
Gesamtkosten 37.154,78<br />
Maßnahmenschwerpunkt 6: Neugestaltung der Grünfläche ‚Am Klimpe’<br />
Pauschal 5.000,00<br />
Summe Herstellungskosten incl. Planungskosten und<br />
Mehrwertsteuer 19 %<br />
5.000,00<br />
Maßnahmenschwerpunkt 7:<br />
Erneuerung des Bauerweges, Verkehrsberuhigung<br />
Neu zu befestigende Fläche: 2400 m², Befestigung der Fahrbahn: Schwarzdecke,<br />
Pflasterbänder Naturstein/ Betonstein, Befestigung Fußweg/ Zufahrten: Betonstein;<br />
Grünflächen: 1240 qm<br />
Vorarbeiten 40.800,00<br />
Unterbau, Entwässerung 36.000,00<br />
Gossen, Borde, Einfassungen 15.000,00<br />
Wegebau, Oberflächenbefestigung (Asphalt, Pflasterung Betonstein/ 108.000,00<br />
Naturstein)<br />
Vegetationstechnische Arbeiten 9.300,00<br />
Pflegearbeiten 6.200,00<br />
Ausstattung, Beleuchtung (11 Mastleuchten) 13.200,00<br />
Summe Herstellungskosten 228.500,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 34.275,00<br />
Zwischensumme 262.775,00<br />
19 % Mehrwertsteuer 49.927,25<br />
Gesamtkosten 312.702,25<br />
�
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 8:<br />
Erneuerung der Straße Kohlstedthof, Verkehrsberuhigung<br />
Neu zu befestigende Fläche: 2600 m² (Pflaster); Grünflächen: 650 qm<br />
Vorarbeiten 54.995,00<br />
Unterbau, Entwässerung 38.992,50<br />
Gossen, Borde, Einfassungen 18.250,00<br />
Wegebau, Oberflächenbefestigung (Asphalt, Pflasterung Betonstein/<br />
Naturstein) 116.977,50<br />
Vegetationstechnische Arbeiten 6.345,00<br />
Pflegearbeiten 3.172,50<br />
Ausstattung, Beleuchtung (12 Mastleuchten) 14.400,00<br />
Summe Herstellungskosten 253.132,50<br />
Planungskosten, psch. 15 % 37.969,88<br />
Zwischensumme 291.102,38<br />
19 % Mehrwertsteuer 55.309,45<br />
Gesamtkosten 346.411,83<br />
Maßnahmenschwerpunkt 9:<br />
Erneuerung der Straße Zum Ahrenbach, Anlage von PKW-Stellflächen<br />
(abschnittsweise)<br />
Neu zu befestigende Fläche: 1240 m² (Pflaster); Grünflächen (Pflanzinseln): 50 qm<br />
Vorarbeiten 21.080,00<br />
Unterbau, Entwässerung 18.600,00<br />
Gossen, Borde 11.000,00<br />
Wegebau, Oberflächenbefestigung<br />
(Asphalt mit Bänderung Betonstein/ Naturstein) 55.800,00<br />
Vegetationstechnische Arbeiten 1.000,00<br />
Pflegearbeiten 250,00<br />
Ausstattung, Beleuchtung (8 Mastleuchten) 9.600,00<br />
Summe Herstellungskosten 117.330,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 17.599,50<br />
Zwischensumme 134.929,50<br />
19 % Mehrwertsteuer 25.636,61<br />
Gesamtkosten 160.566,11<br />
Maßnahmenschwerpunkt 10: Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus<br />
Pauschal 50.000,00<br />
Summe Herstellungskosten incl. Planungskosten und<br />
Mehrwertsteuer 19 %<br />
50.000,00<br />
�
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Maßnahmenschwerpunkt 11:<br />
Anlage eines Fußweges und Renaturierungsmaßnahmen am Mainebach,<br />
Abschnittslänge 205 lfm; Flächenankauf 1025 m²; Anlage Fußweg 410 m²<br />
Flächenankauf 5.125,00<br />
Ausbau von Sohl- und Uferbefestigung 15.000,00<br />
Vorarbeiten, Unterbau 8.200,00<br />
Wegebau (Splittdecke 3 cm) 2.050,00<br />
Pflanzarbeiten (Psch.) 750,00<br />
Pflegearbeiten 500,00<br />
Ausstattung (2 Bänke) 2.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 33.625,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 5.043,75<br />
Zwischensumme 38.668,75<br />
19 % Mehrwertsteuer 7.347,06<br />
Gesamtkosten 46.015,81<br />
Maßnahmenschwerpunkt 12:<br />
Ausbau eines Fußweges zum „Weinberg“<br />
Gesamtfläche 570 m², Abschnittslänge 190 lfm;<br />
Oberflächenbefestigung auf vorhandenem Unterbau<br />
Vorarbeiten auf vorh. Unterbau 570,00<br />
Wegebau (Splittdecke 3 cm) 2.850,00<br />
Pflanzarbeiten 1.500,00<br />
Pflegearbeiten 300,00<br />
Ausstattung (1 Bank, 2 Schilder) 2.000,00<br />
Summe Herstellungskosten 7.220,00<br />
Planungskosten, psch. 15 % 1.083,00<br />
Zwischensumme 8.303,00<br />
19 % Mehrwertsteuer 1.577,57<br />
Gesamtkosten 9.880,57<br />
Maßnahmenschwerpunkt 13: Maßnahmen am Gehweg am Rhienbach<br />
Pauschal 3.000,00<br />
Summe Herstellungskosten incl. Planungskosten und<br />
Mehrwertsteuer 19 %<br />
3.000,00<br />
�
�������������������������<br />
����������������������� � � � � � � � � � � � �������������<br />
Zusammenstellung der Gesamtkosten – Freiraum<br />
�<br />
Abschließend erfolgt die Zusammenstellung der vorgeschlagenen Maßnahmen nach ihrer im<br />
Arbeitskreis Dorferneuerung eingestuften Priorität. Sinnvoll ist nun, die Realisierbarkeit im Rahmen<br />
der Haushaltsmöglichkeiten der Gemeinde Friedland zu prüfen und entsprechende Mittel zur<br />
Gegenfinanzierung des Eigenanteils in die Haushalte der kommenden Jahre einzustellen.<br />
Maßnahme<br />
Nr. Bezeichnung Bruttokosten<br />
1a Ortseingänge 136.850,00<br />
1b Innerörtliche Fußwege 49.984,46<br />
2 Johannisstraße/ Kirchumfeld 160.388,20<br />
3 Radweg zur B 27 30.490,18<br />
4 Neugestaltung Dorfplatz 193.882,24<br />
5 Kreuzungsbereich Rhienstraße 37.154,78<br />
6 Grünfläche 'Am Klimpe' 5.000,00<br />
7 Erneuerung Bauerweg 312.702,25<br />
8 Erneuerung Kohlstedthof 346.411,83<br />
9 Erneuerung Ahrenbach 160.566,11<br />
10 Aussenanlagen Dorfgemeinschaftshaus 50.000,00<br />
11 Gehweg/ Renaturierung Mainebach 46.015,81<br />
12 Weg zum 'Weinberg' 9.880,57<br />
13 Gehweg am 'Rhienbach' 3.000,00<br />
Summe 1.542.326,42<br />
Nach einer Einschätzung des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und<br />
Landentwicklung zieht jeder Euro an Fördermittel weitere sieben Euro an Umsätzen der Wirtschaft,<br />
vor allem des Mittelstandes, nach sich. Bewahrheitet sich diese Einschätzung, kann die Dorferneuerung<br />
<strong>Ballenhausen</strong> einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region leisten. Für<br />
die Lebensqualität der Dorfbewohner sowie die ökologische Qualität <strong>Ballenhausen</strong>s steht in jedem<br />
Fall ein Aufschwung bevor!
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
E. Anhang<br />
� Kosten für öffentliche und private Maßnahmen<br />
� Richtlinien<br />
� TÖB-Beteiligung<br />
� Ablauf Dorferneuerung – private Maßnahmenförderung<br />
� Protokolle
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Anhang: Kosten für öffentliche und private Maßnahmen<br />
I. ÖFFENTLICHE MASSNAHMENSCHWERPUNKTE– S. KAP. VORHER<br />
Kostenschätzung<br />
Da noch keine genauen Projektierungen vorliegen, handelt es sich bei den Kosten um<br />
grobe Kostenschätzungen.<br />
Maßnahme<br />
Nr. Bezeichnung Bruttokosten<br />
1a Ortseingänge 136.850,00<br />
1b Innerörtliche Fußwege 49.984,46<br />
2 Johannisstraße/ Kirchumfeld 160.388,20<br />
3 Radweg zur B 27 30.490,18<br />
4 Neugestaltung Dorfplatz 193.882,24<br />
5 Kreuzungsbereich Rhienstraße 37.154,78<br />
6 Grünfläche 'Am Klimpe' 5.000,00<br />
7 Erneuerung Bauerweg 312.702,25<br />
8 Erneuerung Kohlstedthof 346.411,83<br />
9 Erneuerung Ahrenbach 160.566,11<br />
10 Aussenanlagen Dorfgemeinschaftshaus 50.000,00<br />
11 Gehweg/ Renaturierung Mainebach 46.015,81<br />
12 Weg zum 'Weinberg' 9.880,57<br />
13 Gehweg am 'Rhienbach' 3.000,00<br />
Summe 1.542.326,42<br />
Gesamtsumme 1.542.326 €<br />
Gerundet: netto 1.300.000 €<br />
I.: Zuschussbedarf öffentliche Freiraum-Maßnahmen 50 % auf Nettosumme 650.000 €<br />
II. Öffentliche Gebäudemaßnahme<br />
Projekt Zuschussbedarf<br />
1. Sport- und Gemeinschaftshaus, Außen-Sanierung 35.000 €<br />
2. Sport- und Gemeinschaftshalle, Außen-Sanierung 75.000 €<br />
3. Friedhofskapelle, Toilettenanbau 30.000 €<br />
4. Schützenhaus 25.000 €<br />
Außensanierung, energetische Verbesserung<br />
5. Kleinbaulichkeiten, Infotafeln; Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €<br />
---------------------------------------------------------------------<br />
II. Zuschußbedarf öffentliche Gebäudemaßnahmen 180.000 €
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
III. Private Gebäudemaßnahmen Förderbedarf<br />
Siehe S. 110<br />
Bei voraussichtlich nach heutigen Kenntnissen geschätzten (im Durchschnitt) 5 Anträgen für<br />
Gebäudemaßnahmen pro Jahr ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Jahr von 53.000 €.<br />
Auf 6 Jahre:<br />
III. Zuschussbedarf von 318.000 € gerundet 300.000 €<br />
auf dem Gebäudemaßnahmensektor zur Sanierung ortsbildprägender Gebäudeaußenhüllen.<br />
Gesamter Zuschussbedarf aus I. bis III:<br />
I. Öffentliche Freiraummaßnahmen = 650.000 €<br />
II. Öffentliche Gebäudemaßnahmen = 180.000 €<br />
III. Private Gebäudemaßnahmen = 300.000 €<br />
Summe I. bis III: = 1.130.000 €
Anhang:<br />
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
TÖB-Beteiligung �<br />
Träger öffentlicher Belange (TÖB)<br />
Nunmehr wird der vorliegende Entwurf zum Dorferneuerungsplan den TÖB zwecks<br />
Abstimmung und Stellungnahme zugeleitet. Diese Stellungnahmen werden ausgewertet,<br />
im Arbeitskreis und in den örtlichen Gremien behandelt und abgewogen.<br />
Danach wird der endgültige Dorferneuerungsplan fertig gestellt.<br />
Die bisher vorliegenden Stellungnahmen der TÖB sind nachfolgend<br />
beigeheftet.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Anhang:<br />
Richtlinien �<br />
Es folgt die<br />
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten<br />
ländlichen Entwicklung (ZILE) - RdErl. d. ML v. 29. 10. 2007<br />
und Anlage zu ZILE<br />
Weitere Informationen finden sie im<br />
Internet:<br />
www.ml.niedersachsen.de<br />
www.gll.niedersachsen.de
H. Ministerium für den ländlichen Raum,<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen<br />
zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE)<br />
RdErl. d. ML v. 29. 10. 2007 — 306-60119/3 —<br />
— VORIS 78350 —<br />
Bezug: RdErl. v. 2. 5. 2005 (Nds. MBl. S. 417)<br />
— VORIS 78350 —<br />
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage<br />
1.1 Die Länder Niedersachsen und Bremen gewähren unter<br />
Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlage<br />
— der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. 9.<br />
2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen<br />
Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für<br />
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) — ABl. EU<br />
Nr. L 277 S. 1) —, zuletzt geändert durch Verordnung (EG)<br />
Nr. 2012/2006 des Rates vom 19. 12. 2006 (ABl. EU Nr. L 384<br />
S. 8), — im Folgenden: ELER-VO — und<br />
— der vom Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz<br />
beschlossenen Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe<br />
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)<br />
nach Maßgabe dieser Richtlinie und der VV/VV-Gk zu § 44<br />
LHO Zuwendungen für die integrierte ländliche Entwicklung.<br />
Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur<br />
im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsansätze<br />
unter Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse der<br />
Raumordnung und Landesplanung, der Belange des Naturund<br />
Umweltschutzes sowie der Grundsätze der AGENDA 21<br />
die ländlichen Räume i. S. der Artikel 20 und 52 ELER-VO<br />
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums<br />
als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern<br />
und weiterzuentwickeln. Die Maßnahmen sollen zu einer positiven<br />
Entwicklung der Agrarstruktur und einer nachhaltigen<br />
Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen.<br />
1.2 Die Länder gewähren ergänzend zu Nummer 1.1 unter<br />
Beteiligung der EU auf der Grundlage der ELER-VO nach<br />
Maßgabe dieser Richtlinie und der VV/VV-Gk zu § 44 LHO<br />
Zuwendungen für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung,<br />
die zur Erreichung der Ziele nach den Artikeln 20 und 52<br />
ELER-VO erforderlich sind, aber im Rahmen der GAK nicht<br />
gefördert werden dürfen.<br />
Zweck dieser ergänzenden Förderung ist<br />
— die nachhaltige Entwicklung von ländlichen Gebieten,<br />
— die Bewahrung und Entwicklung der Dörfer als Wohn-,<br />
Sozial- und Kulturraum und Stärkung des innerörtlichen<br />
Gemeinschaftslebens sowie die Bewahrung und Entwicklung<br />
des typischen Landschaftsbildes,<br />
— die Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und<br />
Bevölkerung mit Dienstleistungseinrichtungen,<br />
— die Förderung des Fremdenverkehrs,<br />
— die Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes.<br />
1.3 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die in dieser<br />
Richtlinie enthaltenen Regelungen für das Zielgebiet „Konvergenz“,<br />
bestehend aus den Landkreisen Celle, Cuxhaven, Harburg,<br />
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg<br />
(Wümme), Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen und Verden.<br />
Zum „Nichtkonvergenzgebiet“ zählen das übrige Landesgebiet<br />
Niedersachsens und das Land Bremen.<br />
1.4 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung<br />
einer Zuwendung besteht nicht. Über Anträge entscheidet die<br />
Bewilligungsbehörde aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im<br />
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.<br />
2. Gegenstand der Förderung<br />
2.1 Gefördert werden nach Nummer 1.1 und den Förderungsgrundsätzen<br />
GAK folgende Maßnahmen:<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
2.1.1 Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte<br />
als Vorplanung i. S. des § 1 Abs. 2 des GAK-<br />
Gesetzes (GAKG) zur Einbindung einer nachhaltigen<br />
Land- und Forstwirtschaft in den Prozess zur Stärkung<br />
der regionalen Wirtschaft, die auf der Basis einer Analyse<br />
der regionalen Stärken und Schwächen<br />
— die Entwicklungsziele der Region definieren,<br />
— Handlungsfelder festlegen,<br />
— die Strategie zur Realisierung der Entwicklungsziele<br />
darstellen und<br />
— prioritäre Entwicklungsprojekte beschreiben.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der Anlage<br />
Abschnitt 341.1 aufgeführt.<br />
2.1.2 Ein Regionalmanagement zur Initiierung, Organisation<br />
und Umsetzungsbegleitung der ländlichen Entwicklungsprozesse<br />
durch<br />
— Information, Beratung und Aktivierung der Bevölkerung,<br />
— Identifizierung und Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale,<br />
— Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Projekte.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der Anlage<br />
Abschnitt 341.2 aufgeführt.<br />
2.1.3 Investive Maßnahmen (Anlage) sowie deren Vorbereitung<br />
und Begleitung im Zusammenhang mit land- und<br />
forstwirtschaftlichen Tätigkeiten und deren Umstellung<br />
sowie mit Tätigkeiten im ländlichen Raum in den folgenden<br />
Bereichen:<br />
2.1.3.1 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und die<br />
Gestaltung des ländlichen Raums zur Verbesserung<br />
der Agrarstruktur in Verfahren nach<br />
dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) einschließlich<br />
Projekten zur Sicherung eines nachhaltig<br />
leistungsfähigen Naturhaushalts sowie<br />
Projekten des freiwilligen Nutzungstauschs.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der<br />
Anlage Abschnitte 125.1.1 bis 125.1.4 aufgeführt.<br />
2.1.3.2 Dorferneuerung und -entwicklung ländlich geprägter<br />
Orte i. S. des § 1 Abs.1 Nr. 1 Buchst. d<br />
GAKG zur Erhaltung und Gestaltung des dörflichen<br />
Charakters einschließlich der Sicherung<br />
und Weiterentwicklung dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen<br />
zur Verbesserung der<br />
Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölkerung<br />
sowie der dazu erforderlichen Dorfentwicklungsplanungen/-konzepte<br />
und der Umsetzungsbegleitung.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der<br />
Anlage Abschnitte 322.1 und 322.2 aufgeführt.<br />
2.1.3.3 Kooperation von Land- und Forstwirten mit<br />
anderen Partnern im ländlichen Raum zur Einkommensdiversifizierung<br />
oder Schaffung zusätzlicher<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten und<br />
Projekte land- und forstwirtschaftlicher Betriebe<br />
zur Umnutzung ihrer Bausubstanz.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der<br />
Anlage Abschnitt 311 aufgeführt.<br />
2.1.3.4 Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,<br />
insbesondere zur Erschließung<br />
der landwirtschaftlichen oder touristischen<br />
Entwicklungspotenziale im Rahmen<br />
der Einkommensdiversifizierung land- -oder<br />
forstwirtschaftlicher Betriebe.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der<br />
Anlage Abschnitt 125.2 aufgeführt.<br />
2.1.4 Maßnahmen mit der Folge der Umwandlung oder einer<br />
sonstigen wesentlichen Beeinträchtigung seltener oder ökologisch<br />
wertvoller Biotope gemäß den §§ 24 bis 28 b, 32 bis 33 a<br />
und 34 b NNatG dürfen nicht gefördert werden.<br />
1217
2.1.5 Bei einer Förderung aus Mitteln der GAK sind die nachfolgenden<br />
Regelungen der Förderungsgrundsätze zu beachten:<br />
2.1.5.1 Es besteht Einigkeit zwischen Bund und Ländern<br />
darüber, dass Aufgaben, die nicht überwiegend der Agrarstrukturverbesserung,<br />
sondern der Erhaltung der Kulturlandschaft,<br />
der Landschaftspflege und Erholungsfunktion der<br />
Landschaft oder dem Tierschutz dienen, nicht als Gemeinschaftsaufgabe<br />
anzusehen sind und daher allein aus Landesmitteln<br />
finanziert werden können.<br />
Unabhängig von der unterschiedlichen Zuordnung müssen<br />
bei der Durchführung agrarstruktureller Maßnahmen im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe die Erfordernisse der Raumordnung,<br />
Landesplanung sowie des Umweltschutzes und des<br />
Tierschutzes beachtet werden, um die strukturellen sowie<br />
ökologischen Rahmenbedingungen des ländlichen Raums zu<br />
verbessern.<br />
Im Rahmen der Förderung soll verstärkt dazu beigetragen<br />
werden, eine mit ökologisch wertvollen Landschaftselementen<br />
vielfältig ausgestattete Landschaft zu erhalten und zu<br />
schaffen, den Erosionsschutz zu sichern und den Tierschutz<br />
zu verbessern.<br />
Bund und Länder weisen auf den notwendigen Schutz der<br />
im Interesse des Naturschutzes und der Landschaftspflege erhaltenswerten<br />
Landschaftsbestandteile hin. Die Erhaltung der<br />
Landschaftsbestandteile ist mit anderen Interessen und Belangen<br />
abzuwägen.<br />
2.1.5.2 Nicht zuwendungsfähig sind:<br />
— Bau- und Erschließungsmaßnahmen in Neubau-, Gewerbeund<br />
Industriegebieten,<br />
— Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs in<br />
Verfahren nach dem FlurbG und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz<br />
und von bebauten Grundstücken durch<br />
Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Kauf von Lebendinventar,<br />
— Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, wie<br />
z. B. Flächennutzungs- oder Bebauungspläne,<br />
— Beratungs- und Betreuungsleistungen der öffentlichen Verwaltung,<br />
— Betriebskosten bei Projekten nach Nummer 2.1.3,<br />
— Projekte gemäß Nummer 2.1.3.4 für natürliche und juristische<br />
Personen des privaten Rechts mit Ausnahme von<br />
Infrastruktureinrichtungen, die uneingeschränkt der Öffentlichkeit<br />
zur Verfügung stehen und — im Fall von Wegebau<br />
— die dem Schluss von Lücken in Wegenetzen dienen,<br />
— Projekte nach Nummer 2.1.3.3 (Anlage Abschnitt 311),<br />
wenn eine Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
oder anderer Förderprogramme möglich ist,<br />
— Investitionen in Gemeinschaftseinrichtungen bei Projekten<br />
nach Nummer 2.1.3.2 für natürliche Personen und Personengesellschaften<br />
sowie juristische Personen des privaten<br />
Rechts<br />
2.1.5.3 Bei den Ausgaben nach Nummer 2.1.3.1 (Anlage Abschnitte<br />
125.1.1 bis 125.1.4) sind von der Förderung ausgeschlossen<br />
— Entwässerung von Ackerland, Grünland oder Ödland,<br />
— Umwandlung von Grünland und Ödland in Ackerland,<br />
— Beschleunigung des Wasserabflusses,<br />
— Bodenmelioration und<br />
— Beseitigung von Landschaftselementen wie Tümpel, Hecken,<br />
Gehölzgruppen oder Wegraine.<br />
Die Wirkungen des Flurbereinigungsverfahrens auf Natur<br />
und Landschaft sind zu dokumentieren.<br />
Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn die o. g.<br />
Projekte im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde<br />
durchgeführt werden.<br />
2.1.5.4 Bei den Ausgaben nach den Nummern 2.1.3.2 und<br />
2.1.3.3 (Anlage Abschnitt 311, 322.1, 322.2) werden Projekte,<br />
die der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von in<br />
Anhang I des EG-Vertrages genannten Produkten dienen, nach<br />
1218<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm und nicht nach<br />
dieser Richtlinie gefördert.<br />
2.1.6 Bei einer Förderung aus Mitteln der GAK gelten nach<br />
den Angaben, die das Bundesministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen der Notifizierung<br />
gegenüber der EU-Kommission gemacht hat, zusätzlich<br />
folgende Einschränkungen:<br />
Regionalmanagement und regionale Entwicklungskonzepte,<br />
die aus anderen Programmen, beispielsweise LEADER oder<br />
REGION AKTIV gefördert werden, können nicht zusätzlich<br />
nach den Nummern 2.1.1 bzw. 2.1.2 dieser Richtlinie gefördert<br />
werden (Kumulationsverbot). Je genau abgegrenzter<br />
Region sind bezogen auf die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung<br />
jeweils nur ein integriertes Entwicklungskonzept<br />
und ein Regionalmanagement förderfähig. In einer Übergangszeit<br />
bis zum 31. 12. 2008 können ggf. geringfügige Überschneidungen<br />
geduldet werden.<br />
2.2 Gefördert werden nach Nummer 1.2 und dem Programm<br />
der Länder Niedersachsen und Bremen zur Entwicklung des<br />
ländlichen Raums gemäß der ELER-VO folgende ergänzende<br />
Maßnahmen zur GAK:<br />
2.2.1 in den Bereichen<br />
— Kultur- und Erholungslandschaft,<br />
— Fremdenverkehr,<br />
— Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die<br />
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung,<br />
— Dorfentwicklung,<br />
— Erhalt und Verbesserung des ländlichen Erbes.<br />
Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind in der Anlage Abschnitte<br />
125.1.5, 313, 321, 322.3 und 323 aufgeführt und mit<br />
dem Hinweis „außerhalb der Fördermöglichkeiten der GAK“<br />
überschrieben.<br />
2.2.2 Die Einschränkungen der Förderung aus Mitteln der<br />
GAK nach Nummer 2.1.5 werden für die ergänzenden Maßnahmen<br />
nach Nummer 2.2.1 für verbindlich erklärt.<br />
Ausgenommen davon sind:<br />
2.2.2.1 Die zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung des für<br />
die Projektumsetzung erforderlichen Personaleinsatzes<br />
ist im Zusammenhang mit investiven Projekten<br />
nach der Anlage Abschnitte 313 und 321 abweichend<br />
von Nummer 2.1.5.2 sechster Spiegelstrich<br />
als Betriebskosten förderbar.<br />
2.2.2.2 Investitionen in Gemeinschaftseinrichtungen nach<br />
der Anlage Abschnitt 322.3.7 sind auch für natürliche<br />
Personen und Personengesellschaften sowie<br />
juristische Personen des privaten Rechts möglich.<br />
2.2.2.3 Der Erwerb auch unbebauter Grundstücke nach der<br />
Anlage Abschnitt 322.3.8 im Zusammenhang mit<br />
Projekten im Rahmen dieses Abschnitts.<br />
2.2.3 Die in der Anlage Abschnitt 313 aufgeführten Projekte,<br />
mit denen die besondere Bedeutung des Naturschutzes herausgestellt<br />
wird, werden nach der Förderrichtlinie „Natur erleben<br />
und Nachhaltige Entwicklung“ des MU und nicht nach dieser<br />
Richtlinie gefördert.<br />
3. Zuwendungsempfänger<br />
Für die einzelnen Maßnahmen sind die Zuwendungsempfänger<br />
in der Anlage bei den jeweiligen Fördertatbeständen<br />
aufgeführt.<br />
4. Zuwendungsvoraussetzungen<br />
4.1 Die in den Nummern 2.1.3 und 2.2.1 aufgeführten Maßnahmen<br />
dürfen nur in Orten bis maximal 10 000 Einwohnerinnen<br />
und Einwohnern durchgeführt werden.<br />
Bei den in der Anlage Abschnitt 125.1 genannten Projekten<br />
ist eine Förderung in den unbebauten überwiegend landwirtschaftlich<br />
geprägten Außenbereichen zulässig.<br />
4.2 Die Förderung von Baudenkmalen setzt eine denkmalschutzrechtliche<br />
Genehmigung voraus; bei den in der Anlage<br />
Abschnitte 323.1 und 323.2 aufgeführten Projekten wird die<br />
Auswahlentscheidung über eine Förderung regelmäßig durch
die Denkmalpflege unter Beteiligung der Bewilligungsbehörde<br />
getroffen.<br />
Die Einstufung eines zu fördernden Gebäudes als „landschaftstypische<br />
Bausubstanz“ wird in Abstimmung mit der<br />
Denkmalschutzbehörde vorgenommen.<br />
4.3 Bei den in der Anlage Abschnitte 311, 321, 322.3.5<br />
und 323.2 aufgeführten Projekten ist,<br />
— sofern es sich um Dorf- oder Nachbarschaftsläden handelt,<br />
ein Konzept zur Markt- und Standortanalyse vorzulegen,<br />
— in allen anderen Fällen ein Investitions- und Wirtschaftskonzept<br />
vorzulegen, das Aussagen zur erwarteten Wirtschaftlichkeit<br />
und zur Anzahl der zu sichernden/neu zu<br />
schaffenden Qualifizierungs- und Arbeitsplätze enthält bzw.<br />
den Bedarf für die geplante Nutzung belegt.<br />
Die Erstellung der zuvor genannten Konzepte stellt keinen<br />
unzulässigen Vorhabenbeginn gemäß der VV Nr. 1.3 zu § 44<br />
LHO dar.<br />
4.4 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist nur zulässig,<br />
wenn eine Konzeption für die Ver- und Entsorgung (Wasser,<br />
Abwasser, Energie usw.) in den betreffenden Bereichen vorliegt<br />
und die Maßnahmen dieser Konzeption nicht widersprechen<br />
oder wenn die koordinierte Lösung der Probleme im<br />
Rahmen der Ausführung des Einzelprojekts bzw. der Dorferneuerungsplanung<br />
gewährleistet ist.<br />
Dies gilt nicht für Projekte, die in der Anlage Abschnitt 125.1<br />
aufgeführt sind oder sofern bei anderen Maßnahmen die Konzeption<br />
für die Ver- und Entsorgung ohne Bedeutung für das<br />
Projekt ist.<br />
4.5 Projekte zur Förderung der Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten, des Fremdenverkehrs, von<br />
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die<br />
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung, der Dorfentwicklung<br />
und des Erhalts und Verbesserung des ländlichen Erbes erfolgen<br />
unter Beachtung der Grenzen und Bestimmungen der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. 12. 2006<br />
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf<br />
De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 379 S. 5), geändert durch<br />
Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 27/2007<br />
vom 27. 4. 2007 (ABl. EU Nr. L 209 S. 48), und der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. 12. 2006<br />
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf<br />
staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung<br />
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen<br />
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (ABl. EU<br />
Nr. L 358 S. 3).<br />
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung<br />
5.1 Die Zuwendung wird grundsätzlich als nicht rückzahlbare<br />
Zuwendung zur Projektförderung in Form der Anteilfinanzierung<br />
gewährt.<br />
Für Flurbereinigungsverfahren, die bis zum 31. 12. 2006<br />
angeordnet wurden, gilt weiterhin die Fehlbedarfsfinanzierung<br />
unter Beibehaltung der zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung<br />
geltenden Fördersätze.<br />
5.2 Bemessungsgrundlagen für die Zuwendung<br />
5.2.1 Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden und<br />
Gemeindeverbände im Konvergenzgebiet bestimmt deren Höhe<br />
der Zuwendung, die gestaffelt anhand der Abweichung vom<br />
Landesdurchschnitt in der jeweiligen Vergleichsgruppe von<br />
der über drei Jahre gemittelten Steuereinnahmekraft festgelegt<br />
wird. Grundlage bilden die Daten des NLS aus der Veröffentlichung<br />
„Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik“.<br />
Die Differenzierung trägt der Regelung gemäß § 22 NFAG<br />
Rechnung.<br />
5.2.1.1 Gemeinden und Gemeindeverbände im Konvergenzgebiet<br />
können für die in der Anlage Abschnitte 125.1.5, 313,<br />
321, 322.3 und 323 aufgeführten Maßnahmen eine höhere<br />
Zuwendung zu den zuwendungsfähigen Ausgaben als im<br />
Nichtkonvergenzgebiet erhalten. Dies gilt entsprechend für<br />
Landkreise.<br />
Für die in der Anlage Abschnitte 125.1.1, 125.1.2, 125.2,<br />
322.1 und 322.2 aufgeführten GAK-Maßnahmen gilt die Regelung<br />
übergangsweise in den Jahren 2007 bis 2009.<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
Die Zuwendungshöhen entsprechend der Abweichungen von<br />
der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft ergeben sich aus<br />
der folgenden Übersicht:<br />
Abweichung von der<br />
Steuereinnahmekraft<br />
Zuschusshöhe im<br />
Konvergenzgebiet<br />
15 v. H. über Durchschnitt bis zu 40 v. H.<br />
Durchschnitt bis zu 55 v. H.<br />
15 v. H. unter Durchschnitt bis zu 65 v. H.<br />
Die Zuordnung der Gemeinden zu den Zuschusshöhen entsprechend<br />
ihrer Abweichung von der Steuereinnahmekraft<br />
wird jährlich anhand der vom NLS aktualisierten Daten fortgeschrieben.<br />
Für Landkreise erfolgt die Einstufung anhand der<br />
Umlagekraftmesszahl.<br />
Für das konkrete Einzelprojekt ist die Zuschusshöhe in<br />
dessen Bewilligungsjahr maßgebend.<br />
5.2.1.2 Bei Gemeinden und Gemeindeverbänden im Nichtkonvergenzgebiet<br />
können bis zu 40 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben gefördert werden. Dies entspricht dem Eingangssatz<br />
im Konvergenzgebiet.<br />
5.2.1.3 Ausgenommen von der Staffelung der Zuschusshöhen<br />
sind die Maßnahmen der Aufstellung von Dorferneuerungsplänen,<br />
deren Umsetzungsbegleitung, die Erstellung integrierter<br />
ländlicher Entwicklungskonzepte und das Regionalmanagement,<br />
siehe Nummern 5.3.1, 5.3.2, 5.3.9 und 5.3.10.<br />
5.2.2 Unbeschadet der Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
können weitere Maßnahmen, soweit nachstehend nichts Abweichendes<br />
geregelt ist,<br />
— bei anderen öffentlichen Zuwendungsempfängern (z. B.<br />
Realverbände, Kirchen) bis zu 40 v. H.,<br />
— bei anderen Zuwendungsempfängern bis zu 25 v. H.<br />
der zuwendungsfähigen Ausgaben im Konvergenz- und Nichtkonvergenzgebiet<br />
gefördert werden.<br />
In diesen Fällen richtet sich die Höhe der Zuwendung nicht<br />
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers;<br />
sie soll ihm vielmehr einen Anreiz bieten, Projekte<br />
im Interesse der Ziele dieser Richtlinie und entsprechend<br />
dem Zuwendungszweck (Nummer 1) durchzuführen. Auf die<br />
Feststellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kann deshalb<br />
bei der Bemessung der Zuwendung regelmäßig verzichtet<br />
werden.<br />
5.2.3 Die Fördersätze für Maßnahmen nach den Nummern<br />
2.1.3 und 2.2.1, die der Umsetzung eines integrierten<br />
ländlichen Entwicklungskonzepts nach Nummer 2.1.1 oder<br />
eines Regionalentwicklungskonzepts einer Leader-Gruppe<br />
dienen, können um bis zu 10 v. H. erhöht werden, ausgenommen<br />
die in der Anlage Abschnitte 125.1.1 bis 125.1.4 aufgeführten<br />
Maßnahmen.<br />
Für Projekte der in Nummer 5.2.2 zweiter Spiegelstrich genannten<br />
anderen Zuwendungsempfänger kann der Zuschuss<br />
um bis zu 5 v. H. erhöht werden.<br />
Vor dem 1. 1. 2007 abgeschlossene vergleichbare Planungen<br />
und Konzepte werden den integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten<br />
gleichgestellt.<br />
Befürwortet die Denkmalpflege ein Projekt nach Anlage Abschnitt<br />
323.1 oder 323.2 und wird es durch deren landesweite<br />
Prioritätenbildung als förderungswürdig ausgewählt, so wird<br />
dieser Umstand einer vergleichbaren Planung gleichgesetzt.<br />
5.2.4 Bei anderen Zuwendungsempfängern nach Nummer<br />
5.2.2 zweiter Spiegelstrich kann für Projekte nach den in<br />
der Anlage Abschnitte 323.1 und 323.2 aufgeführten Maßnahmen<br />
ein Zuschuss von bis zu 60 v. H. gewährt werden,<br />
sofern die Denkmalpflege ein besonderes öffentliches Landesinteresse<br />
befürwortet, das das Interesse des Antragstellers an<br />
der Umsetzung des Projekts übersteigt.<br />
Eine weitere Erhöhung nach Nummer 5.2.3 scheidet aus.<br />
5.2.5 Entsprechend den Zielen eines integrierten Förderungsansatzes<br />
ist eine Bündelung mit anderen Förderungsprogrammen<br />
der Gemeinden, der Landkreise, des Landes, des Bundes<br />
und der EG sowie mit privaten Projekten anzustreben.<br />
Bei den einzelnen Projekten sind finanzielle Beteiligungen<br />
Dritter nach der VV Nr. 2.5 zu § 44 LHO/Nr. 2.4 VV-Gk und<br />
1219
anderweitige öffentliche Förderungen in vollem Umfang in<br />
die Finanzierung einzubringen.<br />
Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob angesichts der Drittmittel<br />
eine Förderung nach in dieser Richtlinie in Höhe ausgewiesenen<br />
Regelzuschusssätzen notwendig und angemessen ist.<br />
5.2.6 Projekte mit einem Zuwendungsbedarf von weniger<br />
als 2 500 EUR, bei Gebietskörperschaften von weniger als<br />
5 000 EUR werden nicht gefördert.<br />
5.3 Sonderregelungen für einzelne Förderbereiche<br />
5.3.1 Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte<br />
nach Nummer 2.1.1 kann mit bis zu 75 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben gefördert werden. Die Zuwendung<br />
nach dieser Richtlinie je Konzept beträgt einmalig bis zu<br />
50 000 EUR. Die betragsmäßige Höchstgrenze darf insgesamt<br />
für alle der in der Anlage Abschnitt 341.1 aufgeführten Projekte<br />
nur einmal ausgeschöpft werden.<br />
5.3.2 Ein Regionalmanagement nach Nummer 2.1.2 kann für<br />
einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren in Regionen mit<br />
mindestens 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit bis<br />
zu 70 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch<br />
75 000 EUR jährlich gefördert werden. Die betragsmäßige<br />
Höchstgrenze darf insgesamt für alle der in der Anlage Abschnitt<br />
341.2 aufgeführten Projekte jährlich nur einmal ausgeschöpft<br />
werden.<br />
In dünn besiedelten Räumen kann ein Regionalmanagement<br />
auch in Regionen mit mindestens 30 000 Einwohnerinnen<br />
und Einwohnern gefördert werden.<br />
5.3.3 Die in der Anlage Abschnitte 125.1.1, 125.1.3 und<br />
125.1.4 aufgeführten Maßnahmen können mit bis zu 75 v. H.<br />
der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden.<br />
5.3.4 Für die in der Anlage Abschnitt 125.1.2 aufgeführten<br />
Maßnahmen richtet sich die von der Teilnehmergemeinschaft<br />
zu erbringende Eigenleistung nach deren wirtschaftlicher<br />
Leistungsfähigkeit und den Vorteilen aus der Durchführung<br />
des Verfahrens.<br />
Die Förderung beträgt bis zu 75 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben.<br />
Die Bewilligungsbehörde kann bei Verfahren mit besonderer<br />
ökologischer Zielsetzung und bei Verfahren mit hoher Bedeutung<br />
für die Erhaltung der Kulturlandschaft mit bis zu 80 v. H.<br />
fördern.<br />
5.3.5 Bei den in der Anlage Abschnitte 125.1.1 bis 125.1.4<br />
aufgeführten Projekten sind, entsprechend den Fördergrundsätzen<br />
GAK, finanzielle Beteiligungen Dritter nach der VV<br />
Nr. 2.5 zu § 44 LHO/Nr. 2.4 VV-Gk und anderweitige öffentliche<br />
Förderungen von den zuwendungsfähigen Ausgaben<br />
abzusetzen.<br />
Als Dritte sind alle außer den Teilnehmern der Flurbereinigungsverfahren<br />
gem. § 10 Nr. 1 FlurbG zu behandeln.<br />
Außerdem sind abzusetzen:<br />
— Erlöse nach § 46 Satz 3 FlurbG,<br />
— Gewinne aus Landzwischenerwerb,<br />
— Verkaufserlöse aus Materialabgabe, sofern die Anschaffungsoder<br />
Herstellungskosten gefördert worden sind.<br />
Nicht abzusetzen sind Kapitalbeträge nach § 40 FlurbG und<br />
Erlöse aus der Verwertung von Restflächen, die aus der mäßigen<br />
Erhöhung des Flächenabzuges nach § 47 FlurbG stammen.<br />
5.3.6 Bei den in der Anlage Abschnitte 311.2 und 321 aufgeführten<br />
Projekten werden Investitionen, die die Stromproduktion<br />
für Dritte zum Gegenstand haben und bei denen eine<br />
Vergütung für die Stromabgabe gemäß Erneuerbare-Energien-<br />
Gesetz erfolgt, nur mit einem Zuschuss von bis zu 10 v. H.<br />
und bis zu 100 000 EUR der zuwendungsfähigen Ausgaben<br />
gefördert.<br />
Gefördert werden nur<br />
— landesweit einmalige Pilotprojekte für Bioenergieanlagen<br />
und<br />
— die Prozesswärmeverwertung von Bioenergieanlagen.<br />
Ausgeschlossen ist die Förderung von Investitionen für die<br />
Hersteller von Anlagen und deren Komponenten sowie mit<br />
Vertrieb und Einbau befassten Unternehmen. Dabei kann unter<br />
1220<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
den Beschränkungen des Satzes 1 die Errichtung eines Nahwärmenetzes<br />
mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 100 EUR/<br />
Trassenmeter und in Höhe von bis zu 250 EUR pro Hausanschluss<br />
gefördert werden. Gleiches gilt, sofern für andere<br />
Projekte zur Prozesswärmeverwertung die Verlegung neuer<br />
Leitungen notwendig ist.<br />
Bei den in der Anlage Abschnitt 311.1 aufgeführten Projekten<br />
wird die Höhe der Zuwendung auf 75 000 EUR begrenzt.<br />
5.3.7 Bei den in der Anlage Abschnitt 313 aufgeführten<br />
Projekten wird die Höhe der Zuwendung auf 100 000 EUR<br />
begrenzt.<br />
5.3.8 Bei den in der Anlage Abschnitt 322.1 aufgeführten Projekten<br />
kann bei besonders innovativen Projekten in besonderem<br />
Interesse des Landes die Höhe der Zuwendung auf bis zu<br />
100 v. H. angehoben werden. In diesen Fällen ist vorab die<br />
Zustimmung des ML einzuholen.<br />
5.3.9 Die Aufstellung des Dorferneuerungsplans nach der<br />
Anlage Abschnitt 322.2.1.1 kann mit bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben gefördert werden, unabhängig vom<br />
jeweiligen Zuschusssatz der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes,<br />
siehe Nummer 5.2.<br />
Die Vorinformationsphase vor Aufnahme eines Ortes in das<br />
Förderprogramm stellt keinen unzulässigen Vorhabenbeginn<br />
gemäß der VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO dar. Sie ist nur i. V. m. der<br />
späteren Aufstellung des Dorferneuerungsplans förderbar.<br />
5.3.10 Die Umsetzungsbegleitung nach Anlage Abschnitt<br />
322.2.1.2 kann mit bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben gefördert werden. Die Höhe der Zuwendung je Dorf<br />
ist für die Dauer im Dorferneuerungsprogramm auf 30 000 EUR<br />
begrenzt.<br />
Bei umfangreichen Gruppen- oder Verbunddorferneuerungen<br />
kann die Zuwendung je Dorfentwicklungsplanung auf<br />
40 000 EUR erhöht werden.<br />
5.3.11 Bei den in der Anlage Abschnitte 322.1 bis 322.3 aufgeführten<br />
Projekten wird die Höhe der Zuwendungen an private<br />
Zuwendungsempfänger auf 25 000 EUR, bei den Projekten<br />
in der Anlage Abschnitt 322.3.4 auf 100 000 EUR sowie Abschnitte<br />
322.3.5 und 322.3.7 auf 75 000 EUR begrenzt.<br />
Die betragsmäßige Höchstgrenze darf für denselben Zuwendungszweck<br />
für jedes Objekt nur einmal ausgeschöpft werden.<br />
Objekte in diesem Sinne sind Gebäude und Gebäudeteile<br />
mit eigenständiger wirtschaftlicher Funktion sowie andere<br />
bauliche oder sonstige nach dieser Richtlinie förderungsfähige<br />
Anlagen.<br />
Erfüllt ein Objekt die Zuwendungsvoraussetzungen nach<br />
mehreren Abschnitten der Anlage, so können hierfür die jeweils<br />
zulässigen Höchstbeträge nacheinander gewährt werden.<br />
5.3.12 Bei den in der Anlage Abschnitt 322.2 aufgeführten<br />
Projekten können gegenüber Zuwendungsempfängern, die den<br />
Status der Gemeinnützigkeit erfüllen, bei der Bemessung der<br />
Zuwendung neben den Ausgaben auch eigene Arbeitsleistungen,<br />
mit 50 v. H. des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen<br />
an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer)<br />
ergeben würde, berücksichtigt werden. Die Zuwendung<br />
wird gleichwohl nur zu den Ausgaben gewährt und darf<br />
die Summe der Ausgaben nicht überschreiten.<br />
5.3.13 Die Kosten des Grundstückserwerbs bei den in der<br />
Anlage Abschnitte 322.2.2.6 und 322.3.8 aufgeführten Projekten<br />
dürfen nur bis zu maximal 10 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Gesamtausgaben des Projekts berücksichtigt werden.<br />
6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen<br />
6.1 Die Zuwendung ist, wenn mit ihrer Hilfe Gegenstände<br />
erworben oder hergestellt werden, nach der VV Nr. 4.2.4 zu<br />
§ 44 LHO/Nr. 4.2.3 VV-Gk mit einer Zweckbindungsfrist zu<br />
versehen. Die Frist beträgt bei geförderten<br />
— Grundstücken, Bauten und baulichen Anlagen zwölf Jahre<br />
ab Fertigstellung,<br />
— technischen Einrichtungen, Geräten und sonstigen Gegenständen<br />
fünf Jahre ab Lieferung.<br />
Eine dingliche Sicherung der zweckentsprechenden Verwendung<br />
ist mit Rücksicht auf den damit verbundenen Verwaltungsaufwand<br />
nur in Ausnahmefällen zu fordern.
Bei gemeinschaftlichen Anlagen in Verfahren nach dem<br />
FlurbG, deren Zweckbestimmung im Flurbereinigungs- oder<br />
Zusammenlegungsplan bestimmt und nach § 58 Abs. 4 FlurbG<br />
mit der Wirkung von Gemeindesatzungen geregelt wird, kann<br />
regelmäßig auf die Festsetzung einer Zweckbindungsfrist verzichtet<br />
werden.<br />
6.2 Die Bewilligungsbehörde darf bei Zuwendungen, die Teilnehmergemeinschaften<br />
oder Verbänden der Teilnehmergemeinschaften<br />
in Vorjahren aus Verpflichtungsermächtigung bewilligt<br />
worden sind, auf deren Antrag den Zuwendungszweck veränderten<br />
Planungen anpassen und die Verwendung der Zuwendung<br />
für ein anderes Projekt des Zuwendungsempfängers<br />
zulassen, sofern die Zuwendung noch nicht ausgezahlt wurde.<br />
6.3 Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P/Nr. 5.4 ANBest-Gk ist<br />
die Verwendung der Zuwendung innerhalb von sechs Monaten<br />
nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch<br />
einen Monat nach Ablauf des Haushaltsjahres der Bewilligungsbehörde<br />
nachzuweisen. Ist der Zuwendungszweck nicht<br />
bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, so ist spätestens<br />
einen Monat nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem<br />
Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis vorzulegen.<br />
7. Anweisungen zum Verfahren<br />
7.1 Zuwendungsanträge, Bewilligungsbehörde<br />
7.1.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der<br />
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung,<br />
die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides<br />
und die Rückforderung der gewährten Zuwendung<br />
gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser<br />
Richtlinie Abweichungen zugelassen worden oder in dem unmittelbar<br />
im Inland geltenden Gemeinschaftsrecht der EU<br />
abweichende Regelungen getroffen sind.<br />
7.1.2 Bewilligungsbehörde ist in Niedersachsen die jeweils<br />
örtlich zuständige GLL. Für das Land Bremen ist die GLL Verden<br />
die zuständige Bewilligungsbehörde.<br />
7.1.3 Der Zuwendungsantrag ist bei der örtlich zuständigen<br />
Bewilligungsbehörde einzureichen. Antragsvordrucke<br />
können bei der örtlich zuständigen Bewilligungsbehörde<br />
oder der Gemeinde angefordert oder im Internet unter<br />
www.ml.niedersachsen.de heruntergeladen werden.<br />
Bei den in der Anlage Abschnitte 125.2, 311, 313, 321, 322<br />
und 323 aufgeführten Projekten werden die Zuwendungsanträge<br />
privater Antragsteller über die Gemeinde vorgelegt. Die<br />
Gemeinde und die oder der Umsetzungsbeauftragte nehmen<br />
u. a. zu der Frage Stellung, ob das Projekt zur integrierten<br />
ländlichen Entwicklung beiträgt; ihnen obliegt auch die Koordinierung<br />
der öffentlichen und privaten Projekte.<br />
Die Gemeinde und die oder der Umsetzungsbeauftragte erhalten<br />
in diesen Fällen eine Abschrift des Zuwendungsbescheides.<br />
An der Förderung sonst beteiligte Behörden sind<br />
von der Bewilligung zu unterrichten.<br />
7.1.4 Die Bewilligungsbehörde stellt nach Prüfung der Einzelnachweise<br />
eine Gesamtabrechnung auf und legt sie dem<br />
ML bis zum 1. Februar jeden Jahres vor.<br />
7.2 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept und Regionalmanagement<br />
7.2.1 Gefördert werden können Regionen, die eine auf ihre<br />
spezielle Situation zugeschnittene Entwicklungsstrategie erarbeiten.<br />
Unter Region ist ein Gebiet mit räumlichem und funktionalem<br />
Zusammenhang zu verstehen.<br />
Die Konzepte können sich bei begründetem Bedarf problemorientiert<br />
auf räumliche und thematische Schwerpunkte<br />
beschränken.<br />
7.2.2 Die integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte müssen<br />
mindestens folgende Elemente beinhalten:<br />
— Kurzbeschreibung der Region,<br />
— Analyse der regionalen Stärken und Schwächen,<br />
— Auflistung der Entwicklungsziele und geeigneter Prüfindikatoren,<br />
— Darlegung der Entwicklungsstrategie, der Handlungsfelder<br />
und Leitprojekte,<br />
— Festlegung von Kriterien zur Auswahl der Förderprojekte,<br />
— Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung.<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
Der Prozess der Erarbeitung des Konzepts ist zu dokumentieren.<br />
7.2.3 In die Erarbeitung des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts<br />
sollen die Bevölkerung und die relevanten<br />
Akteure der Region in geeigneter Weise einbezogen werden.<br />
Dazu gehören in der Regel<br />
— der landwirtschaftliche Berufstand,<br />
— die Gebietskörperschaften,<br />
— die Einrichtungen der Wirtschaft wie Industrie- und Handelskammer<br />
oder Handwerkskammer,<br />
— die Verbraucherverbände,<br />
— die Umweltverbände,<br />
— die Träger öffentlicher Belange.<br />
7.2.4 Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte<br />
kann auch im Rahmen des Regionalmanagements<br />
vorgenommen werden.<br />
7.2.5 Die Zuwendungsempfänger beauftragen Stellen außerhalb<br />
der öffentlichen Verwaltung mit der Durchführung des<br />
Regionalmanagements. Diese Stellen müssen eine hinreichende<br />
Qualifikation nachweisen.<br />
7.2.6 Die Akteure gemäß Nummer 7.2.3 sind in geeigneter<br />
Weise in die Arbeit des Regionalmanagements einzubeziehen.<br />
Die Arbeit des Regionalmanagements und die Einbeziehung<br />
der Akteure nach Nummer 7.2.3 sind in jährlichen Tätigkeitsberichten<br />
zu dokumentieren.<br />
7.2.7 Das integrierte ländliche Entwicklungskonzept ist im<br />
Rahmen seiner Zielsetzung mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten<br />
Planungen, Konzepten oder Strategien abzustimmen.<br />
Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren. Die<br />
Dokumentation ist Bestandteil des integrierten ländlichen<br />
Entwicklungskonzepts.<br />
7.2.8 Das Regionalmanagement stimmt sich mit den Stellen<br />
in der Region ab, die ähnliche Ziele verfolgen; insbesondere<br />
mit der oder dem Umsetzungsbeauftragten in der Dorferneuerung.<br />
Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren.<br />
7.3 Flurbereinigung<br />
7.3.1 Der Zuwendungsbedarf der Teilnehmergemeinschaft<br />
und ggf. anderer Zuwendungsempfänger ist für das einzelne<br />
Verfahren unter Berücksichtigung der<br />
— von den Teilnehmern zu entrichtenden Beiträge nach § 19<br />
FlurbG,<br />
— sonstigen Eigenleistungen,<br />
— Leistungen Dritter<br />
zu ermitteln. Dabei sind die agrarstrukturellen, landwirtschaftlich-betriebswirtschaftlichen<br />
und außerlandwirtschaftlichen<br />
Ziele und der daraus zu erwartende Erfolg zugrunde zu<br />
legen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.<br />
7.3.2 Der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist im Rahmen<br />
der Anhörung nach § 5 Abs. 2 FlurbG Gelegenheit zu<br />
geben, sich zur Höhe der von den Teilnehmern zu entrichtenden<br />
Beiträge zu äußern.<br />
7.3.3 Bei Teilnehmergemeinschaften findet die VV Nr. 1.3<br />
zu § 44 LHO keine Anwendung, weil Verpflichtungen und<br />
Ausgaben nach § 17 FlurbG und den §§ 105 ff. LHO der Kontrolle<br />
der Bewilligungsbehörde, in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde<br />
unterliegen und die Ausgaben über das Jahresausbauprogramm<br />
von der Bewilligungsbehörde gesteuert werden.<br />
7.4 Dorferneuerung<br />
7.4.1 In Niedersachsen stellt die Bewilligungsbehörde unter<br />
Berücksichtigung des vom ML zugewiesenen Kontingents an<br />
Förderungsmitteln für ihren Amtsbezirk ein Förderungsprogramm<br />
für die Dorferneuerung auf. Das Förderungsprogramm<br />
wird jährlich zum 1. Juli fortgeschrieben; das ML erhält jeweils<br />
Abschriften.<br />
Für Bremen bestehen für die ländlichen Gebiete Dorferneuerungspläne,<br />
die als Fördergrundlage anerkannt sind.<br />
7.4.2 Anträge auf Aufnahme eines Dorfes in das Förderungsprogramm<br />
sind von der Gemeinde an die Bewilligungsbehörde<br />
zu richten. Eine bereits vorhandene Dorferneuerungsplanung<br />
ist mit dem Antrag vorzulegen.<br />
1221
7.4.3 Die Bewilligungsbehörde entscheidet über die Aufnahme<br />
in das Förderungsprogramm. Sie bekundet damit ihre Absicht,<br />
ein Dorf nach Maßgabe dieser Richtlinie zu fördern. Die<br />
Aufnahme begründet keinen Anspruch bezüglich Art, Höhe<br />
und Zeitpunkt der Förderung. Maßgebend dafür sind neben<br />
den sachlichen Voraussetzungen die jeweils verfügbaren Haushaltsmittel<br />
und der Inhalt der Zuwendungsbescheide. Über<br />
die Aufnahme in das Förderungsprogramm ist auch der Landkreis<br />
zu unterrichten.<br />
7.4.4 Bei den in der Anlage Abschnitt 322.2 aufgeführten<br />
Projekten muss der Förderung von investiven Maßnahmen<br />
eine Dorferneuerungsplanung zugrunde liegen, die in Text<br />
und Karte auf Basis einer Bestandsaufnahme die örtlichen<br />
Stärken und Schwächen, die Entwicklungsziele für den<br />
Planungsraum und die zur Verwirklichung erforderlichen<br />
Projekte sowie die Abstimmung mit anderen für die Ortsentwicklung<br />
bedeutsamen Planungen und Projekten auch für<br />
die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar darstellt. Sie soll<br />
darüber hinaus auf die räumlich funktionalen und umweltbezogenen<br />
Entwicklungsperspektiven der land- und forstwirtschaftlichen<br />
Betriebe eingehen.<br />
Ist es für die Verwirklichung strukturverbessernder Ziele<br />
sinnvoll, sollen mehrere Dörfer oder Ortsteile zu einem Planungsraum<br />
verbunden werden.<br />
Die Dorferneuerungsplanung hat neben den Zielen der<br />
Raumordnung, der Landesplanung, des Umweltschutzes sowie<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege insbesondere<br />
den Erfordernissen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung,<br />
der Landwirtschaft, der Denkmalpflege, der Erholung,<br />
der Wasserwirtschaft, des öffentlichen Verkehrs und der<br />
Gestaltung des Orts und Landschaftsbildes sowie den sozioökonomischen<br />
örtlichen Gegebenheiten und der kulturellen<br />
Eigenart im Rahmen eines ganzheitlichen und interdisziplinären<br />
Betrachtungsansatzes Rechnung zu tragen.<br />
Die Dorferneuerungsplanung muss mit den Ergebnissen der<br />
Bauleitplanung in Einklang stehen, soweit sie nicht deren<br />
Änderung vorbereiten soll. Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte<br />
— soweit vorhanden — und Konzepte der<br />
Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Sicherung der<br />
Bewirtschaftungs- und Entwicklungsfähigkeit der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe sind zugrunde zu legen.<br />
Die Dorferneuerungsplanung ist von der Gemeinde aufzustellen.<br />
Die Träger öffentlicher Belange, die Dorfbewohnerinnen<br />
und Dorfbewohner sowie andere Antragsberechtigte sind<br />
in geeigneter Weise umfassend und frühzeitig an der Dorferneuerungsplanung<br />
zu beteiligen.<br />
7.4.5 Die oder der Umsetzungsbeauftragte initiiert, organisiert<br />
und begleitet den Umsetzungsprozess des Dorfentwicklungsplans<br />
durch<br />
— Information, Beratung und Aktivierung der örtlichen Wirtschaft<br />
und Bevölkerung,<br />
— Identifizierung und Erschließung örtlicher Entwicklungspotenziale,<br />
— Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Projekte,<br />
die eine den Grundsätzen der Dorferneuerungsplanung<br />
entsprechende Maßnahmedurchführung gewährleistet,<br />
— Verfolgung des gemeinsam mit der Gemeinde und den an<br />
der Dorferneuerungsplanaufstellung Beteiligten nach Nummer<br />
7.4.4 festgelegten Prioritätenkatalogs für die öffentlichen<br />
Projekte,<br />
— enge Abstimmung mit den Bewilligungsbehörden als erster<br />
Ansprechpartner,<br />
— Abstimmung mit dem Regionalmanager — soweit in der<br />
Region vorhanden — über ortsübergreifend oder regional<br />
bedeutsame Projekte im Ort.<br />
7.4.6 Die Bewilligungsbehörde kann ausnahmsweise die<br />
Förderung von Projekten bereits vor der Fertigstellung des<br />
Dorferneuerungsplans zulassen, wenn sie von beispielgebender<br />
Bedeutung sind, wenn andere Planungen es erfordern<br />
oder wenn die Projekte zur Substanzerhaltung unaufschiebbar<br />
sind und gewährleistet ist, dass sie den späteren Festsetzungen<br />
des Dorferneuerungsplans nicht zuwiderlaufen. Die<br />
Ausnahmen sind zu dokumentieren.<br />
1222<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
7.4.7 Die Bewilligungsbehörde leitet aus der Dorferneuerungsplanung<br />
den zeitlichen und finanziellen Rahmen ab.<br />
Gemeinsam mit der Gemeinde, den an der Dorferneuerungsplanaufstellung<br />
Beteiligten nach Nummer 7.4.4 und der oder<br />
dem Umsetzungsbeauftragten stimmt sie die Prioritäten insbesondere<br />
für die Umsetzung der öffentlichen Projekte nach<br />
dieser Richtlinie ab. Sie informiert hierüber die möglichen<br />
Zuwendungsempfänger in geeigneter Weise, z. B. im Rahmen<br />
einer Bürgerversammlung. Aus dieser Mitteilung ergibt sich<br />
kein Anspruch auf Förderung (vgl. Nummer 1.4).<br />
Sie koordiniert den Einsatz sonstiger den Zielen der Dorferneuerung<br />
dienlicher öffentlicher Mittel und setzt ggf. Prioritäten,<br />
insbesondere im Hinblick auf eine angemessene Beteiligung<br />
privater Projektträger an der Förderung.<br />
8. Schlussbestimmungen<br />
8.1 Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2007 in Kraft.<br />
8.2 Gleichzeitig wird der Bezugserlass aufgehoben.<br />
8.3 Dieser RdErl. tritt mit Ablauf des 31. 12. 2015 außer Kraft.<br />
An die<br />
Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften<br />
Region Hannover, Landkreise und Gemeinden<br />
Landwirtschaftskammer Niedersachsen<br />
Teilnehmergemeinschaften und deren Verbände<br />
— Nds. MBl. Nr. 44/2007 S. 1217<br />
Anlage<br />
In den Förderungsgrundsätzen der GAK sind, dem Grundsatz<br />
der Subsidiarität folgend, bundeseinheitlich nur die<br />
wesentlichen Eckpunkte der Förderung festgelegt worden.<br />
Um den Anforderungen an eine landeseinheitliche Anwendung<br />
und dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu entsprechen,<br />
werden die Fördertatbestände hiermit konkretisiert.<br />
Die nach Nummer 2.1 förderungsfähigen Maßnahmen der<br />
GAK und die nach Nummer 2.2 förderungsfähigen Maßnahmen<br />
außerhalb der GAK sind nachfolgend nach ihrer inhaltlichen<br />
Ausrichtung und nach der Gliederung der Artikel 20<br />
und 52 ELER-VO zusammengefasst dargestellt:<br />
Übersicht:<br />
125 Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang<br />
mit der Entwicklung und Anpassung der Landund<br />
Forstwirtschaft<br />
125.1 Flurbereinigung<br />
125.1.1 Vorarbeiten, Flurbereinigung — GAK<br />
125.1.2 Ausführungskosten, Flurbereinigung — GAK<br />
125.1.3 Freiwilliger Landtausch — GAK<br />
125.1.4 Freiwilliger Nutzungstausch — GAK<br />
125.1.5 Kultur und Erholungslandschaft<br />
125.2 Vorhaben zur Erschließung landwirtschaftlicher Flächen<br />
— ländlicher Wegebau — GAK<br />
311 Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten<br />
311.1 Umnutzung von Bausubstanz — GAK<br />
311.2 Kooperationen — GAK<br />
313 Förderung des Fremdenverkehrs<br />
313 Ländlicher Tourismus<br />
321 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die<br />
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung<br />
321 Dienstleistungseinrichtungen<br />
322 Dorferneuerung und -entwicklung<br />
322.1 Vorarbeiten, Dorferneuerung — GAK<br />
322.2 Dorferneuerung — GAK<br />
322.3 Dorfentwicklung<br />
323 Erhalt und Verbesserung des ländlichen Erbes<br />
323 Kulturerbe<br />
341 Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung im Hinblick<br />
auf die Ausarbeitung und Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrategie<br />
341.1 Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte — GAK<br />
341.2 Regionalmanagement — GAK
125 Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang<br />
mit der Entwicklung und Anpassung der Landund<br />
Forstwirtschaft<br />
125.1.1 Vorarbeiten nach § 26 c FlurbG im Rahmen der GAK nach<br />
Nummer 2.1.3/2.1.3.1<br />
(Vorarbeiten, Flurbereinigung — GAK)<br />
Dazu gehören insbesondere Ausgaben für<br />
125.1.1.1 Spezielle Untersuchungen oder Erhebungen, die<br />
wegen örtlicher Besonderheiten des vorgesehenen<br />
Verfahrensgebietes notwendig sind und soweit es<br />
sich dabei nicht um Verfahrenskosten nach § 104<br />
FlurbG handelt,<br />
125.1.1.2 Zweckforschungen und Untersuchungen an Verfahren<br />
mit modellhaftem Charakter.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
Zusammenschlüsse von Teilnehmergemeinschaften.<br />
125.1.2 Ausführungskosten nach § 105 FlurbG in Verfahren nach<br />
den §§ 1, 86, 87 und 91 FlurbG im Rahmen der GAK nach<br />
Nummer 2.1.3.1<br />
(Flurbereinigung — GAK)<br />
Dazu gehören insbesondere Ausgaben für<br />
125.1.2.1 die zur wertgleichen Abfindung notwendigen Maßnahmen,<br />
125.1.2.2 die wegen einer völligen Änderung der bisherigen<br />
Struktur eines land- und forstwirtschaftlichen<br />
Betriebes erforderlichen Maßnahmen (§ 44 Abs. 5<br />
FlurbG),<br />
125.1.2.3 die Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen<br />
und die Instandsetzung der neuen Grundstücke,<br />
125.1.2.4 die nach § 37 Abs. 1 und 2 FlurbG mit Rücksicht<br />
auf den Umweltschutz, den Naturschutz und die<br />
Landschaftspflege, den Boden- und den Gewässerschutz,<br />
einschließlich wichtiger Landschaftselemente<br />
zur Sicherung eines Biotopverbundsystems<br />
sowie für den Denkmalschutz erforderlichen<br />
Maßnahmen,<br />
125.1.2.5 den Ausgleich für Wirtschaftserschwernisse und<br />
vorübergehende Nachteile (§ 51 FlurbG), Geldabfindungen<br />
(§ 44 Abs. 3, § 50 Abs. 2 FlurbG) sowie<br />
Geldentschädigungen, soweit diese Verpflichtungen<br />
nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt<br />
sind,<br />
125.1.2.6 die beim Landzwischenerwerb entstehenden Verluste,<br />
soweit sie der Teilnehmergemeinschaft bei<br />
der Verwendung der Flächen entstehen,<br />
125.1.2.7 die Zinsen für die von der Teilnehmergemeinschaft<br />
für den Landzwischenerwerb zu einem angemessenen<br />
Satz aufgenommenen Kapitalmarktdarlehn,<br />
nicht jedoch Verzugszinsen,<br />
125.1.2.8 die der Teilnehmergemeinschaft bei Vermessung,<br />
Vermarkung und Wertermittlung der Grundstücke<br />
entstehenden Aufwendungen sowie den ihr entstehenden<br />
Verwaltungsaufwand,<br />
125.1.2.9 die Vergabe von Arbeiten zur Wahrnehmung von<br />
gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Teilnehmer<br />
(§ 18 Abs. 1 FlurbG).<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse,<br />
— Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtspersonen,<br />
— einzelne Beteiligte.<br />
125.1.3 Freiwilliger Landtausch nach § 103 a FlurbG im Rahmen<br />
der GAK nach Nummer 2.1.3.1<br />
(Freiwilliger Landtausch — GAK)<br />
Zuwendungsfähig sind<br />
125.1.3.1 nicht investive Ausgaben der Tauschpartner durch<br />
Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Vorbereitung<br />
und Durchführung des freiwilligen Landtauschs<br />
sowie Ausgaben für<br />
125.1.3.2 Ausführungskosten nach § 103 g FlurbG insbesondere<br />
für<br />
125.1.3.2.1 Vermessung,<br />
125.1.3.2.2 die Instandsetzung der neuen Grundstücke,<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
125.1.3.2.3 Herstellung der gleichen Bewirtschaftungsmöglichkeiten<br />
wie bei den abgegebenen Grundstücken,<br />
125.1.3.2.4 Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen<br />
Naturhaushalts<br />
soweit die Aufwendungen den Tauschpartnern entsprechend<br />
den im Flurbereinigungsverfahren üblichen Maß nicht selbst<br />
zugemutet werden können.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
Einzelne Beteiligte (Tauschpartner) sowie andere am Tausch<br />
beteiligte Personen.<br />
125.1.4 Freiwilliger Nutzungstausch im Rahmen der der GAK nach<br />
Nummer 2.1.3.1<br />
(Freiwilliger Nutzungstausch — GAK)<br />
Zuwendungsfähig sind nicht investive Ausgaben der Tauschpartner<br />
durch Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur<br />
Vorbereitung und Durchführung des freiwilligen Nutzungstauschs.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
Einzelne Beteiligte (Tauschpartner) sowie andere am Tausch<br />
beteiligte Personen.<br />
125.1.5 Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung der Kultur- und<br />
Erholungslandschaft, die im Rahmen des Ordnungsauftrags<br />
des FlurbG zur Förderung des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege sowie zur Verbesserung der Erholungseignung<br />
der Landschaft in Verfahren nach dem FlurbG<br />
durchgeführt werden außerhalb der Fördermöglichkeiten<br />
der GAK<br />
(Kultur- und Erholungslandschaft)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und<br />
der landschaftsgebundenen Erholung im Rahmen des Zuwendungszwecks<br />
nach Nummer 1.2 sind insbesondere<br />
125.1.5.1 die Schaffung, Wiederherstellung und Sicherung<br />
von für den Naturschutz wertvollen Bereichen<br />
(z. B. Anlage und Renaturierung von Feuchtflächen;<br />
Erhaltung von Bäumen, Gehölzen, Heide<br />
und Grasland; Herrichtung von Bodenabbaustellen,<br />
soweit nicht Dritte hierzu verpflichtet sind),<br />
125.1.5.2 Bepflanzungen mit standortheimischen Arten (z. B.<br />
Schutzpflanzungen, Feldgehölze, Baumgruppen,<br />
Uferbepflanzungen, Maßnahmen der Grünordnung<br />
im und am Dorf),<br />
125.1.5.3 die Anlage von offenen Gewässern einschließlich<br />
der Gestaltung der Uferzone,<br />
125.1.5.4 die Anlage und Gestaltung von Wander- und<br />
Reitwegen, Aussichtspunkten, Lehrpfaden, Rastplätzen,<br />
125.1.5.5 die Schaffung von Zuwegungen und Parkplätzen<br />
zu und an nach dieser Richtlinie geförderten Einrichtungen,<br />
125.1.5.6 die Bereitstellung von Land für Zwecke des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege im<br />
Zusammenhang mit Maßnahmen nach den Abschnitten<br />
125.1.5.1 bis 125.1.5.5. Zuwendungsfähig<br />
sind Ausgaben des Zuwendungsempfängers<br />
nach § 40 FlurbG (Kapitalbetrag) oder nach § 52<br />
FlurbG (Geldabfindung) bis zu maximal 10 v. H.<br />
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben des Vorhabens.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse,<br />
— Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtspersonen,<br />
— einzelne Beteiligte,<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände.<br />
125.2 Vorhaben zur Erschließung landwirtschaftlicher Flächen im<br />
Rahmen der GAK nach Nummer 2.1.3.4<br />
(Ländlicher Wegebau — GAK)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
den Neubau befestigter oder die Befestigung vorhandener, bisher<br />
nicht oder nicht ausreichend befestigter Verbindungswege<br />
und landwirtschaftlicher Wege einschließlich erforderlicher<br />
Brücken außerhalb bebauter Ortslagen (siehe § 34 BauGB) sowie<br />
einschließlich ggf. erforderlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen<br />
des Naturschutzes.<br />
1223
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Wasser und Bodenverbände sowie vergleichbare Körperschaften,<br />
— natürliche Personen und Personengesellschaften,<br />
— juristische Personen des privaten Rechts.<br />
311 Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten<br />
311.1 Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur<br />
Umnutzung ihrer Bausubstanz im Rahmen der GAK nach<br />
Nummer 2.1.3.3<br />
(Umnutzung — GAK)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
311.1.1 — Markt- und Standortanalysen,<br />
— Investitions- und Wirtschaftskonzepte,<br />
nur i. V. m. einer investiven Maßnahmen nach Abschnitt<br />
311.1.2,<br />
311.1.2 investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher<br />
Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz,<br />
insbesondere für<br />
— Wohn-,<br />
— Handels-,<br />
— Gewerbe-,<br />
— Dienstleistungs-,<br />
— kulturelle,<br />
— öffentliche oder<br />
— gemeinschaftliche Zwecke,<br />
die dazu dienen, Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze<br />
zu schaffen oder Zusatzeinkommen zu<br />
erschließen.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe.<br />
311.2 Maßnahmen der Kooperation von Land- und Forstwirten mit<br />
anderen Partnern im ländlichen Raum zur Einkommensdiversifizierung<br />
oder Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
im Rahmen der GAK nach Nummer 2.1.3.3<br />
(Kooperation — GAK)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
311.2.1 Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen),<br />
311.2.2 — Markt- und Standortanalysen,<br />
— Investitions- und Wirtschaftskonzepte,<br />
nur i. V. m. einer investiven Maßnahmen nach Abschnitt<br />
311.2.4,<br />
311.2.3 Betreuung der Zuwendungsempfänger,<br />
311.2.4 Investive Maßnahmen.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— natürliche Personen und Personengesellschaften,<br />
— juristische Personen des privaten Rechts.<br />
313 Förderung des Fremdenverkehrs<br />
Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Tourismus außerhalb<br />
der Fördermöglichkeiten der GAK<br />
(Ländlicher Tourismus)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
313.1 Vorarbeiten (Zweckforschungen, Untersuchungen, Erhebungen,<br />
Realisierungskonzepte, Folgeabschätzungen),<br />
die für die zukünftige Umsetzung investiver<br />
Vorhaben benötigt werden,<br />
313.2 die Schaffung von Informations- und Vermittlungseinrichtungen<br />
lokaler und regionaler Tourismusorganisationen<br />
im ländlichen Raum einschließlich deren<br />
Teilnahme an Messen,<br />
313.3 die Entwicklung insbesondere themenbezogener Rad-,<br />
Reit- und Wanderrouten mit ergänzenden Einrichtungen,<br />
z. B. Rastplätze, Aussichtsstellen, Beschilderung,<br />
Karten,<br />
313.4 kleinere Infrastrukturmaßnahmen mit regionalem oder<br />
lokalem Bezug zur Attraktivitätssteigerung des Tourismus<br />
z. B. Museen, Bootsanleger, Spielscheunen,<br />
Freilichtbühnen,<br />
1224<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
313.5 die zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung für den<br />
für die Projektumsetzung erforderlichen Personaleinsatz<br />
in der Regel 1 Jahr in Ausnahmefällen 2 Jahre.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Teilnehmergemeinschaften,<br />
— Real- bzw. Wasser- und Bodenverbände,<br />
— Fremdenverkehrsvereine,<br />
— natürliche und andere juristische Personen.<br />
321 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für<br />
die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung<br />
Maßnahmen zur Schaffung von Dienstleistungseinrichtungen zur<br />
Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung<br />
außerhalb der Fördermöglichkeiten der GAK<br />
(Dienstleistungseinrichtungen)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
321.1 Vorarbeiten (Zweckforschungen, Untersuchungen, Erhebungen,<br />
Realisierungskonzepte, Folgeabschätzungen),<br />
die für die zukünftige Umsetzung investiver<br />
Vorhaben benötigt werden,<br />
321.2 Maßnahmen zur Schaffung, Erweiterung und Modernisierung<br />
von Dienstleistungseinrichtungen zur<br />
Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und<br />
Bevölkerung z. B.<br />
— Einrichtung von Dorf- oder Nachbarschaftsläden,<br />
— Einrichtungen für die Anwendung von Informations-<br />
und Kommunikationstechnik,<br />
— Einrichtung von ländlichen Dienstleistungsagenturen,<br />
— landesweit einmalige Pilotvorhaben zur Versorgung<br />
des ländlichen Raums mit Breitbandtechnologie,<br />
— landesweit einmalige Pilotvorhaben zur Errichtung<br />
von Bioenergieanlagen zur Erprobung neuer Verfahrenstechniken,<br />
— Prozesswärmeverwertung von Bioenergieanlagen<br />
z. B. durch<br />
— Ausbau von Nahwärmenetzen in Orten zur<br />
Begrenzung der Verwendung fossiler Brennstoffe,<br />
— Beheizen kommunaler Dienstleistungseinrichtungen<br />
wie Schulen, Schwimmbäder, Turnhallen,<br />
Museen,<br />
— Versorgung der örtlichen oder regionalen Märkte<br />
mit Dienstleistungen, ausgenommen die Bereiche<br />
Landwirtschaft, Ernährung, Tourismus und Einzelhandelsketten,<br />
— zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung für den<br />
für die Projektumsetzung erforderlichen Personaleinsatz<br />
in der Regel 1 Jahr in Ausnahmefällen 2<br />
Jahre.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— juristische Personen des öffentlichen Rechts,<br />
— natürliche Personen,<br />
— Personengesellschaften und juristische Personen des Privatrechts.<br />
322 Dorferneuerung und -entwicklung<br />
322.1 Vorarbeiten im Rahmen der GAK nach Nummer 2.1.3/2.1.3.2<br />
(Vorarbeiten, Dorferneuerung — GAK)<br />
Dazu gehören insbesondere Ausgaben für<br />
322.1.1 Spezielle Untersuchungen oder Erhebungen, die<br />
wegen örtlicher Besonderheiten des vorgesehenen<br />
Verfahrensgebietes notwendig sind,<br />
322.1.2 Zweckforschungen und Untersuchungen an konkreten<br />
Verfahren mit modellhaftem Charakter.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse,<br />
Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtspersonen<br />
sowie einzelne Beteiligte,<br />
— natürliche Personen und Personengesellschaften sowie<br />
juristische Personen des privaten Rechts.
322.2 Maßnahmen der Dorferneuerung und -entwicklung im<br />
Rahmen der GAK nach Nummer 2.1.3.2<br />
(Dorferneuerung — GAK)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für in das Programm aufgenommene<br />
Dörfer für<br />
322.2.1.1 die Dorferneuerungsplanung einschließlich<br />
— einer Vorinformationsphase bereits vor Aufnahme<br />
des Ortes in das Förderprogramm,<br />
— Bürgerbeteiligungsverfahren und<br />
— notwendiger Ergänzungsplanungen,<br />
soweit die Gemeinde eine entsprechend qualifizierte<br />
Planerin oder einen entsprechend qualifizierten<br />
Planer außerhalb der öffentlichen Verwaltung<br />
mit ihrer Erarbeitung beauftragt. Gesetzlich<br />
vorgeschriebene Pläne werden nicht gefördert.<br />
322.2.1.2 die gestalterische, städtebauliche und landschaftspflegerische<br />
Umsetzungsbegleitung, wenn die Gemeinde<br />
eine entsprechend qualifizierte Planerin<br />
oder einen entsprechend qualifizierten Planer außerhalb<br />
der öffentlichen Verwaltung damit beauftragt<br />
(Umsetzungsbeauftragte/Umsetzungsbeauftragter).<br />
Die Umsetzungsbegleitung soll eine den Grundsätzen<br />
der Dorferneuerungsplanung entsprechende<br />
Durchführung von Maßnahmen gewährleisten.<br />
Objektplanungen werden im Rahmen der Umsetzungsbegleitung<br />
nicht gefördert.<br />
Maßnahmen zur Dorferneuerung<br />
322.2.2.1 Maßnahmen zur Verbesserung der innerörtlichen<br />
Verkehrsverhältnisse, nicht jedoch in Neubauund<br />
Gewerbegebieten,<br />
322.2.2.2 Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefahren<br />
für den Ortsbereich und zur Sanierung innerörtlicher<br />
Gewässer,<br />
322.2.2.3 kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur<br />
Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters,<br />
322.2.2.4 Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung landund<br />
forstwirtschaftlich oder ehemals land- und<br />
forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägendem<br />
Charakter einschließlich der dazugehörigen<br />
Hof-, Garten- und Grünflächen, nach<br />
näherer Maßgabe des Dorferneuerungsplans,<br />
322.2.2.5 Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche<br />
Bausubstanz einschließlich Hofräume<br />
und Nebengebäude an die Erfordernisse<br />
zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens anzupassen,<br />
vor Einwirkungen von außen zu schützen oder in<br />
das Ortsbild oder in die Landschaft einzubinden,<br />
soweit sie nicht im Rahmen des einzelbetrieblichen<br />
Agrarinvestitionsförderungsprogramms gefördert<br />
werden,<br />
322.2.2.6 der Erwerb von bebauten Grundstücken durch<br />
Gemeinden und Gemeindeverbände einschließlich<br />
in der Dorferneuerungsplanung besonders<br />
begründeter Abbruchmaßnahmen, im Zusammenhang<br />
mit Maßnahmen nach den Abschnitten<br />
322.2.2.1 bis 322.2.2.3 nach Abzug eines Verwertungswertes.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse,<br />
Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtspersonen<br />
sowie einzelne Beteiligte,<br />
— natürliche Personen und Personengesellschaften sowie<br />
juristische Personen des privaten Rechts.<br />
322.3 Maßnahmen zur Bewahrung und Entwicklung der Dörfer als<br />
Wohn-, Sozial- und Kulturraum und Stärkung des innerörtlichen<br />
Gemeinschaftslebens sowie zur Erhaltung des Orts- und<br />
Landschaftsbildes außerhalb der Fördermöglichkeiten der GAK<br />
(Dorfentwicklung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
322.3.1 die Verbesserung der Aufenthaltsqualität von Straßen<br />
und Plätzen durch Gestaltung, Rückbau, Verkehrsberuhigung,<br />
Anlegen von Fußgängerbereichen<br />
und Wegeverbindungen, Wiederherstellung von<br />
Klinkerstraßen usw., jedoch keine Maßnahmen zur<br />
erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen<br />
i. S. von § 127 BauGB,<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
322.3.2 naturnahen Rückbau sowie Wiederherstellung, Umgestaltung<br />
und Sanierung innerörtlicher oder landschaftstypischer<br />
Gewässer einschließlich der Anlage<br />
und Gestaltung der Wasserflächen und deren Randbereiche<br />
unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen<br />
Vorschriften,<br />
322.3.3 die Anlage, Gestaltung, Sanierung, Vernetzung und<br />
Sicherung dorf- und landschaftstypischer Anlagen<br />
zum Abbau ökologischer Defizite, z. B. durch Anlage<br />
von Obstwiesen, Bauerngärten, Teichen, Mauern,<br />
Trockenstandorten, Hecken und Wegrainen<br />
und deren Vernetzung mit der Feldflur sowie die<br />
Umwandlung versiegelter Flächen in naturnahe unbebaute<br />
Bereiche, die Renaturierung von eintönigen<br />
Grünanlagen sowie die Anlage, naturnahe und<br />
standortgerechte Gestaltung, Vernetzung und Sicherung<br />
sonstiger Grünflächen und Grünzüge,<br />
322.3.4 die Erhaltung und Gestaltung ortsbildprägender<br />
landschaftstypischer ländlicher, nicht nach dem<br />
GAKG förderungsfähiger Bausubstanz, höchstens<br />
25 000 EUR je Maßnahme. Bei Kulturdenkmalen<br />
kann der Höchstbetrag auf bis zu 100 000 EUR für<br />
private Zuwendungsempfänger und auf bis zu<br />
150 000 EUR für öffentlichrechtliche Zuwendungsempfänger<br />
je Maßnahme heraufgesetzt werden,<br />
322.3.5 die Umnutzung ganz oder teilweise leer stehender<br />
orts- oder landschaftsbildprägender Gebäude für<br />
Wohn-, Arbeits-, Fremdenverkehrs-, Freizeit-, öffentliche<br />
oder gemeinschaftliche Zwecke und nach<br />
Maßgabe besonderer siedlungsstruktureller oder entwicklungsplanerischer<br />
Gründe auch deren Umsetzung,<br />
höchstens 75 000 EUR je Maßnahme; in<br />
besonders begründeten Ausnahmefällen bei öffentlich-rechtlichen<br />
Zuwendungsempfängern höchstens<br />
150 000 EUR,<br />
322.3.6 den Ersatz nichtsanierungsfähiger orts- oder landschaftsbildprägender<br />
Bausubstanz durch sich maßstäblich<br />
in das Umfeld einfügende Neubauten,<br />
höchstens 25 000 EUR je Maßnahme,<br />
322.3.7 den Neu-, Aus und Umbau sowie die orts-/landschaftsgerechte<br />
Gestaltung ländlicher Dienstleistungseinrichtungen<br />
und Gemeinschaftsanlagen, die<br />
geeignet sind, das dörfliche Gemeinwesen, die<br />
Kultur, die Kunst oder die Wirtschaftsstruktur zu<br />
stärken, höchstens 75 000 EUR für private Zuwendungsempfänger<br />
und höchstens 100 000 EUR für<br />
öffentlich-rechtliche Zuwendungsempfänger je Maßnahme,<br />
322.3.8 den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken<br />
einschließlich besonders begründeter Abbruchmaßnahmen<br />
im Zusammenhang mit Maßnahmen<br />
nach diesem Abschnitt, nach Abzug eines<br />
Verwertungswertes, höchstens 25 000 EUR je Maßnahme.<br />
Bei kommunalen Maßnahmen kann der<br />
Höchstbetrag in begründeten Ausnahmefällen auf<br />
bis zu 50 000 EUR je Maßnahme heraufgesetzt werden.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Teilnehmergemeinschaften,<br />
— Real- bzw. Wasser- und Bodenverbände,<br />
— Fremdenverkehrsvereine,<br />
— natürliche und andere juristische Personen.<br />
323 Erhalt und Verbesserung des ländlichen Erbes<br />
Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung des kulturellen Erbes<br />
außerhalb der Fördermöglichkeiten der GAK<br />
(Kulturerbe)<br />
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für<br />
323.1 die Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung von denkmalgeschützter,<br />
denkmalwürdiger oder landschaftstypischer<br />
Anlagen, z. B. Mühlen, Schleusen, besondere<br />
landwirtschaftliche Gebäude, z. B. Gulfhäuser,<br />
Drei- und Vierseithöfe, Gärten und historische Kulturlandschaften<br />
oder Landschaftsteile,<br />
323.2 die Umnutzung von denkmalgeschützter, denkmalwürdiger<br />
oder landschaftstypischer Bausubstanz zu<br />
deren dauerhafter Sicherung,<br />
323.3 Einrichtungen zur Information über Tradition und<br />
Belange ländlichen Arbeitens und Lebens,<br />
1225
1226<br />
Nds. MBl. Nr. 44/2007<br />
323.4 die Erhaltung und Ausgestaltung von Heimathäusern<br />
und typischen Dorftreffpunkten,<br />
323.5 die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung<br />
historischer Gärten, regionaltypischer Anlagen und<br />
funktionsfähiger historischer Kulturlandschaften oder<br />
Landschaftsteile,<br />
323.6 die Erfassung und Dokumentation historischer Kulturlandschaften<br />
und Siedlungsentwicklung.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Teilnehmergemeinschaften,<br />
— Real- bzw. Wasser- und Bodenverbände,<br />
— Fremdenverkehrsvereine,<br />
— natürliche und andere juristische Personen.<br />
341 Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen und<br />
Durchführung einer lokalen Entwicklungsstrategie<br />
341.1 Studien über das betreffende Gebiet im Rahmen der GAK<br />
nach Nummer 2.1.1<br />
(Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte — GAK)<br />
Dazu gehören Ausgaben für<br />
341.1.1 die Erstellung und Dokumentation des integrierten<br />
ländlichen Entwicklungskonzepts,<br />
341.1.2 Schulungen/Fortbildungsveranstaltungen der Personen,<br />
die an der Ausarbeitung und Erstellung eines<br />
integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts beteiligt<br />
sind,<br />
341.1.3 Fortbildungsmaßnahmen für leitende Akteure,<br />
341.1.4 die Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen,<br />
Kongressen und Seminaren, Betreuung, Beratung<br />
und Weiterbildung hinsichtlich Projektentwicklung<br />
und -management.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Zusammenschlüsse von verschiedenen Akteuren mit eigener<br />
Rechtspersönlichkeit nach Nummer 7.2.3 unter Einschluss<br />
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden.<br />
341.2 Durchführung der lokalen Entwicklungsstrategie im Rahmen<br />
der GAK nach Nummer 2.1.2<br />
(Regionalmanagement — GAK)<br />
Dazu gehören Ausgaben für<br />
341.2.1 die Unterstützung und Umsetzung des integrierten<br />
ländlichen Entwicklungskonzepts oder einer vergleichbaren<br />
Planung,<br />
341.2.2 die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,<br />
Seminaren und Tagungen in Deutschland/Europa<br />
für die Akteure,<br />
341.2.3 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Zuwendungsempfänger:<br />
— Gemeinden und Gemeindeverbände,<br />
— Zusammenschlüsse von verschiedenen Akteuren mit eigener<br />
Rechtspersönlichkeit nach Nummer 7.2.3 unter Einschluss<br />
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Ablauf Dorferneuerung �<br />
Zur privaten Maßnahmenförderung:<br />
1. Beratungstermin vor Ort mit Planungsbüro vereinbaren<br />
Terminvereinbarung über Gemeinde Friedland - Bauamt Frau Bruder –<br />
Bönneker Str. 2 in 37133 Groß Schneen, Tel.: 05504-80238<br />
oder Planungsbüro Hajo Brudniok, Tel. 0551-6345600<br />
2. Einholen von Kostenangeboten entsprechend dem Beratungsergebnis.<br />
3. Einreichen der vollständigen Antragsunterlagen - Antrag + Kostenangebote - über<br />
Gemeinde Friedland an das Amt für Landentwicklung Göttingen.<br />
4. Nach Überprüfung der Kostenangebote und Anfertigung einer Stellungnahme durch<br />
das Planungsbüro erfolgt ein ablehnender Bescheid oder Zuwendungsbescheid durch<br />
das Amt für Landentwicklung Göttingen > vor Erhalt eines Zuwendungsbescheides<br />
darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden, da sonst aus haushaltsrechtlichen<br />
Gründen keine Förderung erfolgen darf. Auch ein Vertragsabschluss oder eine<br />
Auftragserteilung gelten als Maßnahmebeginn.<br />
5. Durchführung der Maßnahme - Abrechnungszeitraum ist im Zuwendungsbescheid<br />
vermerkt und zu beachten.<br />
6. Einreichung des Auszahlungsantrages und Verwendungsnachweises. Es sind Originalrechnungen<br />
beizufügen (werden zurückgegeben).<br />
BEI ÄNDERUNGEN UND UNVORHERGESEHENEN ZUSATZMASSNAHMEN WÄH-<br />
REND DER DURCHFÜHRUNG INFORMIEREN SIE BITTE SOFORT DAS AMT FUR<br />
LANDENTWICKLUNG GÖTTINGEN ODER DAS PLANUNGSBÜRO.<br />
7. Vorortabnahme durch Planungsbüro bzw. durch das Amt für Landentwicklung<br />
8. Auszahlung des Zuschusses.<br />
Zuständiges Amt:<br />
Amt für Landentwicklung Göttingen – Andreas Ochmann<br />
Danziger Straße 40 - 37083 Göttingen Tel.: 0551-5074 207<br />
E-Mail: Andreas.Ochmann@gll-nom.niedersachsen.de
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Protokolle:<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 13.05.2008<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 20.45 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die Einwohnerversammlung<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Donnerstag, dem 24.04.2008<br />
im Sporthaus <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Bürgermeister Friedrichs begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong> sowie den Ortsbürgermeister<br />
Herrn Utermöhlen und stellt den Vertreter des GLL, Herrn Ochmann, die Planer, Herrn Brudniok und Herrn<br />
Greber, sowie den Landschaftsplaner, Herrn Dr. Schwahn, und die Mitarbeiter der Verwaltung, Herrn Schäfer und Frau<br />
Bruder vor.<br />
Herr Friedrichs weist auf die Chancen für <strong>Ballenhausen</strong> hin, die sich aus der Förderung ergeben können. Im Rahmen der<br />
heutigen Veranstaltung sollen die Erstellung des Dorferneuerungsplanes sowie die Förderung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms<br />
vorgestellt und erläutert werden.<br />
Herr Ochmann (GLL Göttingen) stellt die Struktur und die Aufgabenbereiche der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung<br />
und Liegenschaften Northeim vor und erläutert die Förderperiode 2007 – 2013. Auf der Grundlage der "Richtlinien über<br />
die Gewährung von Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung – ZILE –" werden Zuwendungen aus Landesmitteln,<br />
GA-Mittel und EU-Mittel für die Dorferneuerung zur Verfügung gestellt. Ziel ist nicht mehr die „Verschönerung“ der Dörfer,<br />
sondern ihre Entwicklung, d.h. Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume, zu sichern und zu entwickeln. Voraussetzung<br />
für eine Förderung ist die Vorlage eines Dorferneuerungsplanes.<br />
Das Aufstellungsverfahren des Dorferneuerungsplanes wird erläutert. Für die Erstellung des Planes ist insbesondere von<br />
Bedeutung, dass im Rahmen von Arbeitskreisen die Interessen der Ortschaft in den Plan mit einfließen. Im Vorfeld einer<br />
geplanten Maßnahme haben Interessierte die Möglichkeit, ein für sie kostenfreies Beratungsgespräch vom betreuenden Büro<br />
in Anspruch zu nehmen. Nach Genehmigung des Dorferneuerungsplanes können Anträge zur Förderung der Maßnahmen<br />
gestellt werden.<br />
Die Schwerpunkte der ZILE-Richtlinie sind u.a. die Förderung des ländlichen Tourismus und die Förderung von Dienstleistungen.<br />
Antragsberechtigt sind Gemeinden und Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse, Wasser-<br />
und Bodenverbände und ähnliche Rechtspersonen<br />
sowie einzelne Beteiligte, natürliche Personen und Personengesellschaften sowie<br />
juristische Personen des privaten Rechts.<br />
Umfang und Höhe der Zuwendung richten sich u.a. nach der wirtschaftlichen Leistungskraft der Gemeinde. Die Höhe der<br />
Förderung in der Gemeinde Friedland beträgt 50 % bei öffentlichen Maßnahmen und 30 % (max. 25.000 €) bei privaten<br />
Maßnahmen. Die Förderungshöchstgrenze bei Baudenkmälern liegt bei 100.000 €. Es besteht keine Fördergrenze bei öffentlichen<br />
Maßnahmen, wie Plätze und Straße usw..<br />
Bei Vereine können bei der Bemessung der Zuwendung neben den Ausgaben auch eigene Arbeitsleistungen mit 50 v. H. des<br />
Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen<br />
an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt werden.<br />
Herr Ochmann weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Maßnahmen vor Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen<br />
werden dürfen. Nur in Ausnahmefällen kann auf Antrag ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt werden.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Herr Brudniok (Planungsbüro) gibt einen Überblick über die Geschichte der Dorferneuerung von 1970 bis heute und erläutert<br />
die Ziele der Förderung. Nach einem kurzen Ausflug in die Ortsgeschichte und die Besonderheiten geht Herr Brudniok auf<br />
das Verfahren zur Dorferneuerung ein.<br />
Die Dorferneuerung basiert auf drei Säulen: dem Dorferneuerungsplan, der Betreuung und der Bürgerbeteiligung. Letztere<br />
erfolgt über Arbeitskreise, deren Themen anhand der Dorferneuerung Elkershausen beispielhaft vorgestellt werden. Mit den<br />
landwirtschaftlichen Betrieben wird ein separater Termin mit Einzelgesprächen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Arbeitssitzungen<br />
werden in den Plan mit eingestellt.<br />
Herr Brudniok weist darauf hin, dass der Dorferneuerungsplan eine Fachplanung ist und keine unmittelbare Rechtswirkung<br />
für den Einzelnen entwickelt. Der Dorferneuerungsplan sowie die Gebäudekartei bilden jedoch die Grundlage für die Einzelförderung.<br />
Im Rahmen des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ werden fünf Themenbereiche zur Lösung der Probleme im ländlichen<br />
Raum vorgestellt, die auch im Rahmen der Dorferneuerung in <strong>Ballenhausen</strong> abgearbeitet werden sollen.<br />
Zur Ermittlung der Chancen und Probleme des Ortes sowie des Interesses an privaten Maßnahmen wird im Rahmen des<br />
Verfahrens ein Fragenbogen an alle Haushalte verteilt.<br />
Anhand von Lichtbildern aus Esebeck werden ortsbildprägende Gebäude vorgestellt und beispielhaft erläutert, welche Fördermaßnahmen<br />
- insbesondere an Fachwerkgebäuden - im Rahmen der Dorferneuerung förderungsfähig sind. Anhand der<br />
gezeigten Beispiele werden Hinweise gegeben, die im Rahmen der Dorferneuerung zu beachten sind. Hierzu gehören z. B.<br />
Freilegung von verblendeten Fachwerkgebäuden, Dachsanierungen mit naturroten Ziegeln, Behängung, Vorbauten, Fenstersanierung,<br />
Hausumfeld und der gleichen mehr. Dabei sind die gestalterischen Vorgaben der Dorferneuerung zu beachten. Die<br />
dadurch entstehenden Mehrkosten sollen durch den Einsatz öffentlicher Mittel in Form der Zuschüsse abgefedert werden.<br />
Ein Gebäudekataster wird erstellt, welches auch eine IST – SOLL Umsetzung beinhaltet. Dieses wird für die künftige Förderung<br />
mit herangezogen. Insbesondere Gebäude, die vor 1940 erbaut worden sind, gelten als förderungswürdig, da diese das<br />
Ortsbild im besonderen Maß prägen.<br />
Herr Bürgermeister Friedrichs verweist noch einmal darauf, dass der Geldgeber, also das Land Niedersachsen, das Verfahren<br />
und die Gestaltung bestimmt. Vor Beginn ist die Maßnahme entsprechend abzuklären.<br />
Herr Dr. Schwahn geht auf die Bedeutung des Freiraumes als Wohnraum ein und verweist auf dessen Funktion auch für<br />
andere Lebewesen. Die Bepflanzung im Ort und an den Ortsrändern hatte in früheren Zeiten neben ihrer optischen Bedeutung<br />
auch eine wirtschaftliche, da die Anpflanzung von Obstbäumen der Versorgung der Bevölkerung diente.<br />
Anhand von Luftbildern ist festzustellen, dass <strong>Ballenhausen</strong> über intakte dörfliche Strukturen verfügt, die allerdings der<br />
Stärkung bedürfen. Die Schaffung neuer Strukturen aufgrund von Defiziten ist nicht erforderlich. Die Bepflanzung ist mit<br />
heimischen Pflanzenarten auszuführen; Koniferen, Fichten etc. sind nicht gewünscht. Herr Schwahn verweist auf erfreuliche<br />
Entwicklungen in diesem Bereich.<br />
Das Thema „Freiraumplanung“ in der Dorferneuerung in <strong>Ballenhausen</strong> wird im Rahmen eines ersten Dorfrundganges aufgegriffen<br />
sowie im Arbeitskreis bearbeitet. Im Anschluss werden Entwürfe entwickelt, die zusammen mit einer Prioritätenliste<br />
und einer Kostenschätzung in den Dorferneuerungsplan einfließen.<br />
Herr Bürgermeister Friedrichs erklärt, dass private Maßnahmen sich an den Richtlinien zu orientieren haben, aber stets privat<br />
bleiben. Alle im Dorferneuerungsplan dargestellten öffentlichen Maßnahmen können umgesetzt werden. Der Gemeinderat<br />
wird nach Haushaltslage und in Absprache mit dem Ortsrat die Umsetzung der Maßnahmen beschließen. Es wird niemals<br />
gegen das Votum der Anlieger eine Maßnahme umgesetzt. Ausgenommen hiervon sind dringend notwendige Reparaturarbeiten,<br />
wie die Sanierung defekter Leitungen etc., die Arbeiten werden dann auf ein Minimum beschränkt werden. Die Dorferneuerungsplanung<br />
ist eine reine „Angebotsplanung“.<br />
Herr Friedrichs führt aus, dass die Dorferneuerung sich positiv auf die Ortschaft auswirken kann. Jeder sollte daher nach<br />
seinem Ermessen von der Fördermöglichkeit Gebrauch machen. Die Dorferneuerung lebt von der Mitwirkung der Bürger und<br />
Bürgerinnen, und er bittet deshalb, dass sich aus deren Reihen ein Arbeitskreis herausbildet.<br />
Am Arbeitskreis kann sich jeder, der Interesse an der Dorferneuerung hat, beteiligen.<br />
Eine Liste wird ausgelegt, in die sich verschiedene Anwesende zur Mitwirkung am Arbeitskreis eintragen.<br />
Die Einladung zu den Arbeitskreissitzungen erfolgt direkt und über Aushang. Im Rahmen der ersten Sitzung wird ein Rundgang<br />
durch den Ort stattfinden. Es wird vorgeschlagen, diesen Rundgang an einem Freitagnachmittag durchzuführen. Eine<br />
gesonderte Einladung folgt.<br />
Weitere Fragen werden aus dem Publikum nicht gestellt.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Herr Bürgermeister Friedrichs und Herr Ortsbürgermeister Utermöhlen bedanken sich bei den Anwesenden sowie den offiziellen<br />
Vertretern für ihre Teilnahme an der heutigen Veranstaltung und appellieren an die Bürgerinnen und Bürger sich an<br />
den Prozess zu beteiligen.<br />
Die Veranstaltung endet um 20.45 Uhr.<br />
Im Auftrage:<br />
( Bruder )<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 13.05.2008<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 19.07 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 20.50 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 2. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Mittwoch, dem 02.07.2008<br />
im Sporthaus <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Ochmann fehlt entschuldigt<br />
Herr Schäfer begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong>, den Ortsbürgermeister Herrn<br />
Utermöhlen sowie Herrn Brudniok und Herrn Greber vom Planungsbüro Brudniok.<br />
Herr Brudniok stellt kurz den weiteren Ablaufplan für die Dorferneuerung vor. Thema dieses Abends ist die Ortsgeschichte /<br />
Infrastruktur. Auf einer historischen Karte sind die alte Ortslage und die Hauptachsen des Ortes zu erkennen. Vom Büro<br />
Brudniok ist eine Gebäudekartei erstellt worden, die ca. 120 Objekte umfasst. Die ehemaligen und heutigen Nutzungen sowie<br />
die Bewohnerstruktur sollen den Gebäuden in der Altdorflage zugeordnet werden.<br />
Herr Utermöhlen wird dem Büro Brudniok die Dorfchronik von <strong>Ballenhausen</strong> auf CD zur Verfügung stellen. Die historischen<br />
Bilder und weitere Informationen können bei Bedarf in den Dorferneuerungsplan aufgenommen werden.<br />
Eine Liste der Baudenkmäler fordert das Büro Brudniok von der Denkmalpflege an.<br />
Nach Abschluss der Gebäudeerfassung weist Herr Brudniok daraufhin, dass die Anzahl der Leerstände erfreulich gering ist.<br />
Es wohnen zudem überdurchschnittlich viele Familien mit mind. 3 Kindern im Ort.<br />
Herr Schäfer erläutert die Förderungsgrundsätze und die Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere der<br />
früheren landwirtschaftlichen Nutzung der Gebäude. Diese Aussagen sind für eine Dorferneuerungsförderung mit maßgeblich.<br />
Bezüglich der weiteren Vorgehensweise erläutert Herr Schäfer, dass ein Plan an die Mitglieder des Arbeitskreises verteilt<br />
wird, in dem die Nutzung der Gebäude eingetragen ist. Er bittet, diese Planvorlage genau zu kontrollieren und ggf. Korrekturen<br />
einzubringen. Es wäre unglücklich, wenn eine fehlende Aussage zu einer landwirtschaftlichen bzw. ehemaligen<br />
landwirtschaftlichen Nutzung die Förderung einer Maßnahme erschweren würde.<br />
Herr Greber ergänzt, dass jede Nutztierhaltung in dem Plan vermerkt werden muss. Er führt aus, dass die Einstufung „landwirtschaftliche<br />
Nutzung“ nicht mit heutigen Maßstäben gemessen werden darf. Beispielsweise besaßen Deputathäuser aufgrund<br />
ihrer Funktion immer eine einhergehende landwirtschaftliche Nutzung.<br />
Herr Utermöhlen schildert, dass demnach alle Gebäude im Bauerweg landwirtschaftlich genutzt worden sind.<br />
Herr Schäfer verweist auf die Förderrichtlinie, nach der Gebäude, die nach 1940 gebaut wurden, in der Regel nicht gefördert<br />
werden.<br />
Herr Greber ergänzt, dass hier auch der Charakter und die Veränderungen am Gebäude in der Beurteilung der Förderungsfähigkeit<br />
eine Rolle spielen.<br />
Herr Greber betont die hohe Bedeutung auch von Kleinbauern und ehemaliger landwirtschaftlicher Nutzung im Rahmen des<br />
Antragsverfahrens für Maßnahmen in der Dorferneuerung.<br />
Herr Sebode berichtet von einem Zeitungsartikel über den Straßenbau in <strong>Ballenhausen</strong>, der mit einer historischen Ortsansicht<br />
versehen ist und für den Dorferneuerungsplan von Bedeutung sein könnte. Ein Bild des früheren Ortsheimatpflegers Voigt<br />
sollte in den Dorferneuerungsplan aufgenommen werden.<br />
Herr Schäfer erklärt zum weiteren Vorgehen, dass alle Arbeitskreisteilnehmer eine schriftliche Einladung sowie ein Protokoll<br />
erhalten. Kritik und Anregungen sind jederzeit willkommen und werden als wichtige Hilfe zur Erstellung des Dorferneuerungsplanes<br />
gewertet.<br />
Ein vorläufiger Sitzungsplan wird verteilt.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Herr Schäfer erläutert, dass sich die Arbeitskreisthemen an den vorgegebenen Kapiteln des Dorferneuerungsplanes orientieren.<br />
Der Plan wird gemeinsam mit dem Arbeitskreis erarbeitet. Im Anschluss werden die Träger öffentlicher Belange beteiligt.<br />
Abschließend wird der Plan den politischen Gremien zur Billigung und dem GLL zur Genehmigung vorgelegt. Auf der<br />
Grundlage des Planes entscheidet das GLL über die Anträge zur Förderung von Maßnahmen. Alle Arbeitskreismitglieder<br />
erhalten zum Abschluss eine Ausfertigung des Dorferneuerungsplanes. Die Erstellung des Plans wird voraussichtlich ein Jahr<br />
in Anspruch nehmen. Vor Abschluss des Verfahrens können keine Einzelanträge gestellt werden. Eine Förderung von Maßnahmen<br />
ist nur in absoluten Ausnahmefällen und mit besonderer Begründung möglich. Er dankt allen für ihre Sitzungsteilnahme.<br />
Herr Franke schlägt vor, in Zusammenarbeit mit dem Ortsheimatpfleger einen Verein zu gründen, der sich der Umsetzung<br />
der Planung und langfristigen Pflege der umgesetzten Maßnahmen (Grünanlagen etc.) widmet.<br />
Herr Schäfer begrüßt den Willen zum langfristigen Engagement.<br />
Herr Greber sieht die „Verlängerung“ des Arbeitskreises positiv, warnt aber vor übertriebenen Hoffnungen.<br />
Es wird vorgeschlagen, die Fotos aus dem Archiv des ehemaligen Ortheimatpflegers Voigt durchzusehen und ggf. für eine<br />
Veröffentlichung in dem Dorferneuerungsplan einzuscannen. Die Fotos sollten mit Personennamen versehen werden, um<br />
deren langfristige Aussagekraft zu gewährleisten.<br />
Herr Utermöhlen dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitzung um 20.50 Uhr.<br />
In der Nachbesprechung des Sitzungsplanes wurde darauf hingewiesen, dass Dienstags aufgrund von Terminüberschneidungen<br />
keine Sitzungen stattfinden sollen. Herr Brudniok und Herr Greber bitten zudem um Tausch der beiden Termine zum<br />
Thema „Architektur“ mit dem Termin zum Thema „Freiraum“. Mit dem Büro Schwahn soll diesbezüglich Kontakt aufgenommen<br />
werden.<br />
(Bruder)<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 15.09.2008<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 18.40 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 21.20 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 3. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Donnerstag, dem 11.09.2008<br />
im Sporthaus <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Schäfer begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong>, Herrn Ochmann vom GLL und<br />
Herrn Dr. Schwahn vom Büro für Landschaftsarchitektur und Landespflege Dr. Christoph Schwahn.<br />
Thema der Arbeitskreissitzung ist der „Freiraum“ in <strong>Ballenhausen</strong>.<br />
Herr Dr. Schwahn stellt den Bestandsplan vor, in dem u.a. Bäume, Sträucher, versiegelte Flächen, Grünflächen und Spielplätze<br />
dargestellt sind, und hebt die Funktion des Ortes für die Landwirtschaft und die Erholung hervor. Ziel ist es, eine<br />
Steigerung der Attraktivität der Ortschaft einschließlich der Freiräume zu erreichen.<br />
Die Schwerpunkte der Planung bilden<br />
1. die Gestaltung der Übergänge vom Dorf in die Landschaft<br />
2. die Bäume und Sträucher (u.a. Artenwahl, Versiegelung im Wurzelbereich)<br />
3. die Gärten (Bepflanzung, Vorgärten, Grundstückseinfahrtbereiche ...)<br />
4. die Fauna (Fledermäuse, Insekten ...)<br />
5. die Einfriedungen wie Mauern, Zäune, Hecken<br />
6. die Bäche und Wasserflächen sowie<br />
7. die versiegelten Bereiche.<br />
Herr Dr. Schwahn stellt zu den o.g. Bereiche negative und positive Beispiele vor und erläutert deren Einfluss auf den Freiraum,<br />
das Klima und den Menschen.<br />
Er fordert die Anwesenden auf, zu den Themen „Wertigkeiten“, „Defizite“, „Dorfleben“ und „Engagement“ ihre Ideen und<br />
Anregungen beizutragen.<br />
„Wertigkeiten“<br />
� Kirchenumfeld<br />
� Baumbestand<br />
� Schöne Lage<br />
� Ruhe<br />
� Waldnähe<br />
� Ist immer noch ein Dorf<br />
� Wie im Urlaub
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
� Pappeln sind typisch für <strong>Ballenhausen</strong><br />
� Alte Trockenmauern<br />
� Alte Fachwerkhäuser<br />
� Es wird viel gefeiert und schön<br />
� Vereinsleben funktioniert<br />
„Defizite“<br />
� Verfallende Gebäude<br />
� Verantwortlichkeiten für den Freiraum nicht immer klar<br />
� Kein Platz für Jugendliche<br />
� Keiner kümmert sich um Abfall, Flaschen etc. im Bereich der Birken am Klimp<br />
� Gewässer verrohrt, teilweise verbaut<br />
� Durchgangsstraße, Rübenschnellweg, fehlender Fahrradanschluss zur B27<br />
� Ausgleichsfläche wird teilweise beackert<br />
� Feldmark stellenweise „ausgeräumt“<br />
„Potenziale – was könnte man entwickeln“<br />
� Rundweg um das Dorf entwickeln<br />
� Bereich der Ortseingänge, alte Schmiede<br />
� Bereitschaft, gemeinsam Aktionen zur Verbesserung des Lebensumfeldes durchzuführen<br />
� <strong>Ballenhausen</strong> ist oft Treffpunk für Jugendliche aus umliegenden Dörfern<br />
� Es gibt Freiflächen, die gestaltet werden können z.B. Kirchberg, Zusammenschluss von Rhienbach und Mainebach<br />
� Spielplatz am Kindergarten öffentlich machen<br />
„Dorfleben im Freien“<br />
� Kirmes am Sportplatz<br />
� Sportwoche am Sportplatz<br />
� Ernst-August-Bergmann Gedächtnispokal an der Feuerwehr<br />
� Waldfest am Schützenhaus<br />
� Osterfeuer auf dem Maineberg<br />
„Engagement für Umwelt, für einen schönen Lebensraum“<br />
� AK Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong><br />
� Kirche und Ortsrat Aufräum-Aktion<br />
� Baumpflanz-Aktion des Ortsrates<br />
� Kopfweidenschnitt durch ...?<br />
Herr Dr. Schwahn stellt einen auf der Grundlage des Bestandsplanes und des Ortsrundganges erarbeiteten ersten Entwurf des<br />
Maßnahmenplans vor. Der Arbeitskreis ist eingeladen, Änderungen und Ergänzungen vorzuschlagen.<br />
Der Maßnahmenplan sieht u.a. vor:<br />
� einen Radweg zur B 27<br />
� einen Gehweg zwischen dem Neubaugebiet am Friedhof und dem Sporthaus<br />
� einen Osterfeuerplatz<br />
� einen autofreien Bereich am Klimp („Ruhender Verkehr“)<br />
� die Umgestaltung der Bushaltestelle im Eingangsbereiches des Ortes zwecks Verkehrsberuhigung, z.B. durch eine<br />
einengende Bepflanzung<br />
� Fahrbahnverschwenkungen an den Ortseingängen Richtung Stockhausen und Reinhausen<br />
� die Sperrung des Gemeindeverbindungsweges<br />
� eine Neugestaltung des Querschnittes der Rhienstraße und des Kreuzungsbereiches<br />
� einen Gehweg entlang der Heerstraße unter der Voraussetzung, dass ausreichend Platz vorhanden ist,<br />
� Veränderungen des Kirchenumfeldes durch Auslichten der (Nadel-) Gehölze etc. und Einrichtung einer Sitzecke.<br />
Herr von Campe erklärt sich bereit, einem noch zu gründenden Verein zur Umsetzung der Dorferneuerung das in<br />
seinem Besitz befindliche Grundstück neben der Kirche zu übertragen.<br />
� eine Erneuerung der Straßenoberfläche in der Johannisstraße sowie den Einbau einer Treppe zur Überwindung der<br />
Steigung. Eine Ausschilderung als Einbahnstraße wird ebenfalls vorgeschlagen. Ferner sollte die fußläufige Verbindung<br />
zwischen Heerstraße und Johannisstraße neu gestaltet werden.<br />
� eine Neugliederung des Straßenraumes des Bauerweges unter Einbeziehung des Kreuzungsbereiches sowie<br />
� eine Neugliederung des Straßenraumes des Kohlstedthofes.<br />
Eine Verkehrsberuhigung der Rhienstraße wird angeregt, da dort sehr viele Kinder wohnen und Fahrzeuge mit überhöhter<br />
Geschwindigkeit die Straße passieren. Die Verrohrung des Rhienbaches hat zu Wasseraufstauungen auf dem Asphalt geführt.<br />
Ggf. ist eine Pflasterung auch des Stichweges angezeigt.<br />
Herr von Campe weist auf künftige Veränderungen in der Verkehrsentwicklung hin, die eine Abnahme des Autoverkehrs<br />
prognostizieren. Investitionen sollten dies berücksichtigen<br />
(Bruder)<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 09.10.2008<br />
Der Bürgermeister
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Beginn der Sitzung: 18.40 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 20.12 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 4. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Mittwoch, dem 08.10.2008<br />
im Sporthaus <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Schäfer begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong>, Herrn Ortsbürgermeister Utermöhlen<br />
und Herrn Brudniok vom Büro Hajo Brudniok.<br />
Dorferneuerungspläne verschiedener gemeindlicher Ortschaften werden zur Einsicht- und Kenntnisnahme verteilt. Herr<br />
Schäfer erinnert an die Abgabe des Fragenbogens zur Fauna in <strong>Ballenhausen</strong>.<br />
Thema der Arbeitskreissitzung ist „Bestandsaufnahme Architektur“.<br />
Herr Brudniok führt aus, dass nach der Bestandsaufnahme der Gebäude im Vorgriff auf das Thema „Strukturentwicklung“<br />
eine kurze Einführung in das Themengebiet erfolgt.<br />
Herr Brudniok stellt den ältesten bekannten Lageplan von 1785 vor und geht auf die Ortschronik ein. Die erste urkundliche<br />
Erwähnung wird korrigiert und auf 1135 datiert. Das Urheberrecht der Chronik liegt lt. Herrn Utermöhlen beim Ortsrat <strong>Ballenhausen</strong>.<br />
Zitate im Dorferneuerungsplan werden erlaubt. Herr Brudniok bittet, weitere historische Aufnahmen zur Verfügung<br />
zu stellen.<br />
Es folgt eine Vorstellung der ehemaligen und aktuell landwirtschaftlich genutzten Gebäude anhand eines Planes. Demnach<br />
existieren zur Zeit fünf Haupterwerbsbetriebe.<br />
Herr Schäfer weist daraufhin, das Schützenhaus und den Hasenwinkel in den Plan zu integrieren. Die Verwaltung wird den<br />
entsprechenden Ausschnitt (ALK) zur Verfügung stellen.<br />
Der landwirtschaftliche Betrieb von Herrn Exposito Verdejo ist in dem Plan mit aufzunehmen.<br />
Herr Brudniok stellt die Gebäudetypologie, wonach die Häuser in fünf Gruppen eingeteilt werden, und deren prozentuale<br />
Verteilung vor.<br />
� Gruppe A: historische Fachwerkhäuser mit sichtbaren Fronten (26,7 %)<br />
� Gruppe B: ältere Gebäude mit Massivfronten (13,8 %).<br />
� Gruppe C: jüngere Massivbauten bis Mitte 20. Jahrhundert (8,6 %).<br />
� Gruppe D: moderne Häuser der letzten 30 Jahre (25,8 %)<br />
� Gruppe E: stark umformte Altbauten (25,1 %).<br />
Im Rahmen eines Bilderbogens werden Sonderbauten und eine Chronologie der Fachwerkhäuser vorgestellt. Baujahre werden,<br />
soweit bekannt, ergänzt und gelungene Sanierungen vorgestellt. Zu dem Thema „Fachwerkbauten als Wirtschaftsgebäude“<br />
sollen Gespräche mit den Landwirten geführt werden. Mögliche Nutzungsänderungen /- ergänzungen werden angerissen.<br />
Herr Brudniok weist auf den erhöhten Fördersatz von 50 % bei der Sanierung der Kirche hin.<br />
Herr Utermöhlen schlägt vor, den Kirchenvorstand darüber zu informieren.<br />
Herr Hillebrecht erklärt, dass der Kirchenvorstand über die Dorferneuerung bereits informiert ist.<br />
Herr Brudniok bietet u.a. die Beratung bei der Umgestaltung behängter Gebäude an.<br />
Es wird darum gebeten, die Fragebogenaktion von August 2008 zu wiederholen und die Eigentümer gezielter auf die Möglichkeiten<br />
der Dorferneuerung hinzuweisen.<br />
Herr Brudniok erläutert anhand zweier Pläne die Verteilung der Gebäudetypen und die Bedeutung der einzelnen Häuser für<br />
das Ortsbild.<br />
Herr Renziehausen erkundigt sich nach der Berücksichtigung von Förderanträgen, wenn mehrere Anträge vorliegen.<br />
Herr Brudniok erklärt, das jeder Anträge stellen kann. Ausgenommen sind Neubauten. Landwirtschaftlich genutzte Gebäude<br />
(auch ehemals) und ortsbildprägende Gebäude werden vorrangig berücksichtigt. Energieeinsparungsmaßnahmen an Neubauten<br />
werden über das Energieeinsparungsprogramm außerhalb der Dorferneuerung gefördert, entsprechende Maßnahmen bei<br />
Altbauten über die Dorferneuerung.<br />
Auf die Frage von Herrn Renziehausen nach der Fördermöglichkeit einer Sanierung eines Daches aus den 50er Jahren, verweist<br />
Herr Brudniok auf einen Ortstermin und eine entsprechende Einzelbeurteilung.<br />
Bei Eigenleistung erläutert Herr Brudniok wird lediglich das Material mit 30 % gefördert. Es ist darauf zu achten ist, dass die<br />
Förderungsuntergrenze von ca. 8500 € Investitionsvolumen (= 2500 € Fördermittel) nicht unterschritten wird. Bei gemeinnützigen<br />
Vereinen ist Eigenleistung anrechenbar.<br />
Herr Brudniok schließt mit einem Überblick über die Themen der nächsten Arbeitskreise. Zum Thema Strukturentwicklung<br />
wird ein Fragebogen mit sechs Themenkomplexen eingesetzt, der in zwei Arbeitsgruppen bearbeitet werden soll. Die Themen<br />
sind in Anlehnung an das Programm „Unser Dorf hat Zukunft“ zusammengestellt worden.<br />
� Gruppe A<br />
1. Infrastruktur, Gemeinbedarf, Daseinsvorsorge<br />
2. Soziales Engagement und Miteinander, Sozialkultur<br />
3. Wirtschaft und Beschäftigung<br />
� Gruppe B<br />
4. Klimawandel und Energie
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
5. Innenentwicklung und Dorfumbau<br />
6. Strategien und Steuerung<br />
Herr Brudniok erläutert anhand von Stichwörtern die Fragestellungen.<br />
Auf Nachfrage von Herrn Renziehausen, ob z.B. zu Fragen zum Jugendraum der Ortsrat Stellung beziehen soll, erklärt Herr<br />
Brudniok, dass der Arbeitskreis sich selbst ein Meinungsbild bilden soll.<br />
Es wird vorgeschlagen, eine Gruppe zu bilden, die an zwei Terminen den Fragebogen bearbeitet. Die Gruppensitzungen<br />
sollten vor dem Arbeitskreis „Strukturentwicklung und örtliche Bauentwicklung“ am 4. Dezember 08 stattfinden.<br />
Die vorgestellten Pläne und der Fragebogen werden dem Protokoll beigefügt. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, die Pläne<br />
per email zu erhalten.<br />
Herr Schäfer bedankt sich bei den Anwesenden und bittet um Weitergabe der Informationen in den Ort und um Überprüfung<br />
der Pläne, damit diese ggf. korrigiert werden können.<br />
(Bruder)<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 05.11.2008<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 18.35 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 21.17 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 5. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Mittwoch, dem 29.10.2008<br />
im Sporthaus <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Schäfer begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong> und Herrn Dr. Schwahn vom Büro<br />
für Landschaftsarchitektur und Landespflege Dr. Christoph Schwahn.<br />
Thema der Arbeitskreissitzung sind „Maßnahmen im Freiraum“.<br />
Herr Dr. Schwahn erläutert, dass während des Dorfrundganges (1. Arbeitskreissitzung) und in der 3. Arbeitskreissitzung zum<br />
Thema „Freiraum / Bestandsaufnahme“ Defizite benannt und erste Maßnahmenvorschläge erörtert worden sind. Auf dieser<br />
Grundlage ist ein erster Maßnahmenplan erarbeitet worden. Ziel des Abends ist die Vorstellung / Diskussion der Maßnahmen<br />
sowie die Festsetzung von Prioritäten zur Umsetzung. Die Einteilung der Maßnahmen in „dringend“, „mittelfristig“ und<br />
„langfristig“ fließt in einen Zeitplan, der zur Anmeldung von Fördermitteln benötigt wird.<br />
Der Dorferneuerungsplan beinhaltet eine Selbstbindung der Gemeinde und bildet die Grundlage auch für andere Förderprogramme<br />
(z.B. GA-Mittel). Zu beachten ist, dass die dargestellten Maßnahmen mit anderen Baumaßnahmen ggf. kombiniert<br />
werden, um den Einsatz der Mittel zu konzentrieren bzw. effizient zu gestalten.<br />
Im Folgenden werden die Maßnahmen im Detail vorgestellt.<br />
1. Ortseingang / Dorfplatz<br />
Der Versiegelungsgrad ist sehr hoch. Der Rhienbach verläuft unterirdisch. Bushaltebuchten, Glascontainer und das ehemalige<br />
Feuerwehrhaus prägen den Platz.<br />
Der Plan (siehe Anlage) schlägt eine Entsiegelung und eine Freilegung des Baches vor. Die Bushaltebuchten entlang der<br />
Straße werden entfernt und Grünbereiche angelegt. Das alte Feuerwehrhaus könnte als Begegnungsstätte genutzt werden.<br />
Bänke standen bereits früher unter der dortigen Linde. Ein Belagwechsel und ein „Baumtor“ am Ortseingang signalisieren<br />
dem ortseinwärtsfließenden Verkehr die Geschwindigkeit zu reduzieren. Der Verbleib der Glascontainer wird im Rahmen<br />
einer Detailplanung geregelt.<br />
Es entspannt sich eine Diskussion zu den Auswirkungen der Maßnahmen auf den fließenden Verkehr und den Sichtbeziehungen.<br />
Alternative Maßnahmen, wie eine Fahrbahnabsenkung (Mulde) und Geschwindigkeitsbeschränkungen, werden<br />
vorgeschlagen, sind aber an einer Kreisstraße nicht umsetzbar.<br />
Der Arbeitskreis favorisiert eine Fahrbahnverschwenkung, wie sie bereits in Klein Schneen umgesetzt worden ist, und bittet<br />
um Kontaktaufnahme mit dem Amt für Kreisentwicklung und Bauen / SG Kreisstraßen. Dort soll das Problem geschildert<br />
und um Maßnahmenvorschläge gebeten werden.<br />
Herr Schäfer schlägt vor, sowohl eine Bepflanzung als auch eine Fahrbahnverschwenkung in den Maßnahmenplan aufzunehmen.<br />
Er weist daraufhin, dass der Plan die Grundlage für eine Förderung in der Dorferneuerung bildet. Es sollten daher<br />
alle möglichen Maßnahmen eingebracht werden, auch wenn nicht alles umgesetzt werden kann. Maßnahmen, die nicht im<br />
Plan enthalten sind, werden nicht gefördert, eine Nachbesserung des Planes ist i. d. Regel nicht möglich.<br />
Herr Dr. Schwahn bietet an, beispielhaft Fotos der Fahrbahnverschwenkung in Klein Schneen in dem Maßnahmenplan einzufügen.<br />
2. Fußwegeverbindungen<br />
Eine Übersicht (siehe Anlage) stellt die Fußwegeverbindungen zur den Infrastruktureinrichtungen des Ortes sowie Rundwege<br />
in der Landschaft vor. Ziel ist eine Erhöhung der Sicherheit für die Fußgänger und die Schließung von Lücken im Wegenetz.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Querungshilfen, wie Zebrastreifen etc., können nicht eingebaut werden, da hierfür die rechtlichen Voraussetzungen (Verkehrsdichte<br />
etc.) fehlen. Vorgeschlagen werden Pflasterungen zur Markierung der Wegeverbindungen. Der Landkreis Göttingen<br />
als Eigentümer der Kreisstraße ist anzufragen und eine Genehmigung einzuholen.<br />
Fuß-/Radwege in der Landschaft sowie der Mainebach sollten mit Gehölzbepflanzungen versehen werden. Eine Renaturierung<br />
des Feuerlöschwasserentnahmestelle am Rhienbach ist zu prüfen.<br />
Anhand von zwei Skizzen (siehe Anlage) werden Möglichkeiten zur Schaffung eines Gehweges entlang der Heerstraße und<br />
zur Fahrbahnquerung vorgestellt. Zur Kostenbeteiligung der anliegenden Eigentümer kann z. Zt. keine abschließende Aussage<br />
getroffen werden.<br />
Auf die Nachfrage, ob für alle Eigentümer von Grundstücken, die von Maßnahmen betroffen sind, im Vorfeld kontaktiert<br />
werden sollten, erläutert Herr Dr. Schwahn, dass die Dorferneuerungsplanung, ähnlich wie ein Bebauungsplan, eine Absichtserklärung<br />
darstellt. Eigentumsverhältnisse können sich während des Programms ändern. Die Gemeinde kann ggf. ihr<br />
Vorkaufsrecht ausüben.<br />
Herr Hillebrecht weist daraufhin, dass er keine Flächen zur Umsetzung eines Fußweges entlang des Mainebaches zur Verfügung<br />
stellen wird.<br />
Da die Wegeverbindung Sportplatz – Neubaugebiet auch zur Schaffung eines Rundweges als wichtig eingestuft wird, werden<br />
Alternativen zur Wegeführung, z.B. über den Friedhof, diskutiert. Der Bach steht im Eigentum des Feldwegeverbandes.<br />
Vorgeschlagen wird, die Abstandsflächen zu pachten und den Weg darüber zu führen. Die Fläche reicht zur Anlage eine<br />
Weges lt. Herrn Dr. Schwahn jedoch nicht aus.<br />
3. Kirchumfeld - Johannisstraße<br />
Zur Überwindung der Steigung wird der Einbau einer Treppe vorgeschlagen. Der verbleibende Straßenraum ist nur noch in<br />
eine Richtung („Einbahnstraße“) zu nutzen. Der Winterdienst ist zu berücksichtigen.<br />
Die Grünfläche im Bereich der Kirche ist neu zu gliedern und zu beleuchten. Hecken und Sträucher sollen entfernt und nur<br />
das Ortsbild prägende Bäume belassen werden. Stolperstellen und Schäden durch Wurzeln werden reduziert.<br />
Herr Schäfer fragt an, ob auf eine der beiden Treppen in der Wegeführung zwischen Kirche und Heerstraße verzichtet werden<br />
könnte.<br />
Herr Dr. Schwahn erläutert, dass dafür die Kirchenmauer verändert werden müsste. Eine Detailplanung mit Nivellierung wird<br />
im Rahmen einer Ausführungsplanung erstellt und ist nicht Bestandteil der Dorferneuerungsplanung.<br />
Der Arbeitskreis plädiert für einen behindertengerechten Zugang zur Kirche, der evtl. auch über die Grünfläche gelegt werden<br />
könnte.<br />
Herr Dr. Schwahn weist auf die Bedeutung des Weges im übergeordneten Wegenetz hin. Die Einbeziehung des Bereiches um<br />
den Kindergarten zur Herstellung der Verbindung ist zu klären.<br />
Herr Schäfer wird gebeten, mit dem Kirchenvorstand zwecks Besprechung der Situation Kontakt aufzunehmen. Da bis<br />
Weihnachten 2008 die Maßnahmen im Freiraum zusammengestellt werden sollen, bittet Herr Dr. Schwahn um kurzfristige<br />
Übermittlung der Informationen.<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden in eine Prioritätenliste eingeordnet. Sie gibt Auskunft über die Wertigkeit und<br />
Dringlichkeit bezüglich der Umsetzung. Änderungen im Verlauf des Programms sind möglich.<br />
1. Fußwege / Verkehrsberuhigung<br />
2. Kirchumfeld / Johannisstraße<br />
3. Radweg zur B 27<br />
4. Dorfeingang / - platz und Heerstraße<br />
5. Kreuzung Rhienstraße / Gemeindeverbindungsweg nach Groß Schneen<br />
6. Kurve in der Rhienstraße<br />
7. Bauerweg<br />
8. Kohlstedthof<br />
9. Zum Ahrenbach<br />
10. Sportplatz / DGH<br />
11. Fußweg entlang des Mainebaches<br />
12. Instandsetzung des Stichweges zum Maineberg<br />
13. Schützenhaus / Grillplatz / Konzertmuschel<br />
14. Fußweg Rhienbach<br />
In Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Gemeinde Friedland werden eine Kostenschätzung sowie die Finanzierung zu den<br />
aufgeführten Maßnahmen ausgearbeitet.<br />
Der Anschluss des Schützenhauses an das Wasser- und Stromnetz ist im Rahmen der Dorferneuerung nicht möglich.<br />
Eine Verkehrsberuhigung des Gemeindeverbindungsweges nach Groß Schneen durch Rückbau etc. ist aufgrund der Nutzung<br />
durch die Landwirtschaft problematisch. Ziel der Dorferneuerung ist die Stützung der Landwirtschaft, so dass Einschränkungen<br />
nicht gefördert werden. Eine Freigabe nur für Anlieger wird als wenig wirksam beurteilt.<br />
Hinsichtlich des Radweges zur B 27 werden Sicherheitsbedenken geäußert. Ein Verlauf parallel zur Kreisstraße ist aufgrund<br />
der hohen Kosten und des schwierigen Flächenerwerbs nicht umsetzbar. Der dargestellte Verlauf weist zudem einen geringeren<br />
Höhenunterschied auf.<br />
Die Problematik des Osterfeuerplatzes soll intern über den Ortsrat mit den betroffenen Landwirten geklärt werden. Ein angedachter<br />
Grunderwerb kann nicht über die Dorferneuerung gefördert werden.<br />
Herr von Campe erkundigt sich, ob es Vorgaben zur Entsiegelung im Rahmen der Dorferneuerung gibt. Er sorgt sich, dass<br />
Gestaltung oftmals feste Strukturen beinhaltet und wünscht sich eine Festschreibung der Entsiegelung.<br />
Herr Dr. Schwahn erläutert, dass keine Bilanz erstellt wird, aber nach Möglichkeit z.B. Pflasterungen eingesetzt und Grünflächen<br />
ausgedehnt werden (siehe Anlage Dorfplatz – Heerstraße). In der Dorferneuerung hat sich diesbezüglich ein Wandel<br />
seit den 1960er Jahren durchgesetzt. So werden beispielsweise Pflanzbeete an Häusern propagiert.<br />
Teilnehmer des Arbeitskreises weisen auf die Pflege und die damit verbundenen Kosten hin.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Herr Dr. Schwahn weist abschließend daraufhin, dass im 1. Quartal 2009 der Entwurf des Dorferneuerungsplanes vorgestellt<br />
wird.<br />
Herr Schäfer bedankt sich bei den Anwesenden.<br />
Die vorgestellten Pläne und Skizzen werden dem Protokoll beigefügt.<br />
(Bruder)<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 25.11.2008<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 18.35 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 20.00 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 6. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Mittwoch, dem 06.11.2008<br />
im Gasthaus Meyer in <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Ortsbürgermeister Utermöhlen begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong>, Herrn<br />
Brudniok vom Büro Hajo Brudniok und Frau Bruder von der Verwaltung. Er bedankt sich bei Herrn Meyer für die Möglichkeit,<br />
die Gasträume für die Veranstaltung zu nutzen.<br />
Herr Brudniok verweist auf das Thema „Architektur / Maßnahmen“ und stellt verschiedene Materialien und Umgestaltungsvorschläge<br />
vor (siehe Anlage).<br />
Ziel ist die Erhaltung typischer Dachlandschaften und die stilgerechte Fachwerkgestaltung. Entsprechend werden beispielsweise<br />
nur naturrote Dachziegeln gefördert – lasierte, glasierte und engobierte Dachziegeln sind von einer Förderung ausgenommen.<br />
Gefördert werden zudem die Unterkonstruktion, einschließlich Dachrinne, sowie Schornsteinköpfe und Dachgauben.<br />
Die Traufholzverschalung sollte in einem hellem Farbton gehalten werden. Es wird angeraten, den Dachstuhl vor der<br />
Zuschussbeantragung prüfen zu lassen.<br />
Bei Behängen bieten sich Krempziegel, evtl. mit einer Abkantung, an, da sie an dieser Stelle nicht vermörtelt werden müssen<br />
und diffusionsoffen sind. Biberschwänze sollten das norddeutsche Profil aufweisen.<br />
Förderfähig sind zudem Klappläden, die Aufarbeitung von Türen / Toren / Fenstern sowie Vorbauten – letztere auch bei<br />
Neubauten. Die Türgestaltung sollte gliedernde Element aufweisen und die Farbe „Weiß“ sollte vermieden werden. Innenliegende<br />
Sprossen und Kunststofffenster sind nicht zu verwenden.<br />
Herr Brudniok erläutert den Ablauf einer Beratung und stellt anhand verschiedener Haustypen Maßnahmenvorschläge vor<br />
(siehe Anlage).<br />
Der Arbeitskreis diskutiert diese und bringt eigene Vorschläge ein.<br />
Herr Brudniok erklärt auf Nachfrage, dass die Gestaltung der Fassade unterschiedlich erfolgen kann. So bietet sich auf der<br />
Wetterseite des Hauses ein Schutz, z.B. mit Ziegeln an, während auf den geschützten Seiten das Fachwerk sichtbar bleiben<br />
kann. Aufgesetztes Fachwerk wird nicht gefördert, jedoch der Abriss und die Entsorgung des alten Behangs.<br />
Die Eigenleistung wird nur bei Vereinen mit einem festgesetzten Stundensatz gefördert. Privatpersonen können jedoch Zuschüsse<br />
für das Material beantragen. Die Förderungsuntergrenze ist dabei zu beachten.<br />
Herr Brudniok weist daraufhin, dass keine planerischen Festsetzungen in der Altdorflage greifen, d.h. dass dort beispielsweise<br />
alle Dachfarben und -neigungen z.Zt. erlaubt sind. Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken ist der Erlass einer Satzung,<br />
in der u.a. Dachfarbe, Neigung und das Material für die Fassadengestaltung historischer Häuser vorgeschrieben werden.<br />
Der Arbeitskreis diskutiert diese Möglichkeit sehr konträr. Der Schutz des Eigentums steht dem Schutz des Ortsbildes gegenüber.<br />
Die mangelnde Pflege bzw. sog. „Schmuddelflecken“ werden stark kritisiert.<br />
Frau Bruder weist daraufhin, dass es zur Zeit keine Gestaltungssatzung in der Gemeinde Friedland gibt. Die Verwaltung<br />
nutzt ihre Einflussnahme über die Stellungnahme zu den Bauanträgen.<br />
Herr Brudniok bittet den Arbeitskreis, in der nächsten Sitzung ein Votum zu einer örtlichen Bauvorschrift abzugeben. Sie soll<br />
zu einer harmonischen und einheitlichen Gestaltung des historischen Ortskerns beitragen.<br />
Der Arbeitskreis trifft sich am 3. Dezember um 18.30 Uhr im Gasthaus Meyer zur Bearbeitung der Fragebögen, die mit dem<br />
Protokoll vom 08.10.2008 verteilt worden sind. Sollte ein Folgetermin erforderlich sein, wird dieser in der Arbeitsgruppe<br />
intern vereinbart. Die Sitzung am 4. Dezember 2008 entfällt.<br />
Der Arbeitskreis trifft sich am 15. Januar 2009 zum Thema „Strukturentwicklung und örtliche Bauentwicklung“. Im Rahmen<br />
der Sitzung werden u.a. die Fragebögen ausgewertet.<br />
Herr Ortsbürgermeister Utermöhlen dankt den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Sitzung um 20 Uhr.<br />
(Bruder)
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 25.11.2008<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 19.05 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 20.54 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 7. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Donnerstag, dem 18.12.2008<br />
im Gasthaus Meyer in <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Sebode und Herr Dr. Bartels fehlen entschuldigt<br />
Herr Schäfer begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong>, Herrn Brudniok vom Büro Hajo<br />
Brudniok und Herrn Ochmann vom GLL. Er bedankt sich bei Herrn Meyer für die Möglichkeit, die Gasträume für die Veranstaltung<br />
zu nutzen.<br />
Herr Brudniok erklärt, dass die Förderung der Landwirtschaft einen Schwerpunkt in der Richtlinie ZILE bildet und weist auf<br />
die Bedeutung dieser auch in der Dorferneuerung hin. Zielsetzung des Abends ist, mit Vertretern der Landwirtschaft die<br />
bisher vorgeschlagenen Maßnahmen, z.B. zur Verkehrsberuhigung oder zur Platzgestaltung, zu besprechen und evtl. auftretende<br />
Probleme zu benennen. Herr Greber wird Anfang Januar 2009 die Landwirte aufsuchen, um ihre Wünsche und Anregungen<br />
anhand eines Fragebogens aufzunehmen.<br />
Auf die Frage, ob bereits Überlegungen zur Nutzung von Biogas angestellt worden sind, erläutert Herr Teichmann, dass<br />
dieses vor einigen Jahren diskutiert worden ist, aber das Interesse des Ortes u.a. aufgrund der Preisentwicklung gering war.<br />
Zudem ist der Zuschnitt des Ortes für eine Erschließung ungünstig. Die Neubaugebiete haben diese Frage zum Teil für sich<br />
geklärt und viele Einwohner haben sich Ofenheizungen zugelegt.<br />
Herr Sebode ergänzt, dass die Säure in der Gülle seinerzeit ein Problem darstellte.<br />
Das Interesse an Gemeinschaftsanlagen wertet Herr Teichmann als gering.<br />
Zu den Standortnachteilen wird auf die üblichen Beschwerden hingewiesen, wenn Gülle auf die Ländereien ausgefahren<br />
wird. Der Schweinestall in Groß Schneen wird als eine Beeinträchtigung für <strong>Ballenhausen</strong> gewertet.<br />
Herr Schäfer führt aus, dass es Überlegungen gibt, den Stall zu verlegen. Hierzu wird im Rahmen der planungsrechtlich<br />
erforderlichen Schritte auch ein Gutachten in Auftrag gegeben.<br />
Es wird bemängelt, dass einige Straßen, die aus dem Ort in die Fläche führen, während der Erntezeiten aufgrund parkender<br />
Fahrzeuge kaum zu befahren sind. Im Solkweg behindern Parkfelder und Bäume, die in der ursprünglichen Planung nicht<br />
vorgesehen waren, die Passage von großen landwirtschaftlichen Maschinen wie Rübenroder oder Mähdrescher.<br />
Herr Teichmann erläutert, dass durch die Konzentration in der Landwirtschaft die Probleme zunehmen. Es ergeben sich<br />
beispielsweise trotz besserer Technik größere Belastungen beim Austragen der Gülle aufgrund der gestiegenen Menge.<br />
Er verweist darauf, dass die Bevölkerung sehr sensibel reagiert. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führt regelmäßig zu<br />
Klagen.<br />
Herr Meyer kritisiert, dass landwirtschaftliche Flächen zur Abfallentsorgung (Heckenschnitt etc.) genutzt werden. An landschaftlichen<br />
reizvollen Punkten werden Unrat und Zeltheringe hinterlassen.<br />
Herr Greber äußert, dass Angebote, wie Mülltonnen, eher kontraproduktiv wirken.<br />
Herr Meyer berichtet von Informationstafeln, die im touristischen Gebieten in Bayern zur Aufklärung eingesetzt werden.<br />
Herr Teichmann erkundigt sich nach Fördermöglichkeiten bei der Nutzung von Feldwegen auch für den Radverkehr.<br />
Herr Ochmann erläutert, dass eine Tonnageaufweitung auf 8 to (3m + Bankette) mit 50 % der Nettokosten gefördert wird.<br />
Reparaturen der Oberflächen werden nicht gefördert. Der touristische Ausbau beinhaltet eine Längenbegrenzung auf 1000 m<br />
und hat als Lückenschluss im Rahmen eines Konzeptes zu erfolgen. Für touristische Projekte stehen ferner Fördermittel aus<br />
anderen Programmbereichen zur Verfügung. Der Wechsel von einem Grasweg auf einen Schotterweg ist prinzipiell förderfähig.<br />
Er verweist auf den in der ZILE-Richtlinie verankerten ländlichen Wegebau.<br />
Die finanzielle Mittelausstattung bewertet Herr Ochmann als ausreichend.<br />
Herr Greber erkundigt sich nach den Fördermöglichkeiten für den Radweg zur B 27 und einem Lückenschluss von ca. 50 m<br />
im Bereich des Maineberges.<br />
Herr Ochmann rät, den Weg nicht als Radweg zu kennzeichnen. Er verweist darauf, dass die Kosten für eine Erhöhung der<br />
Tonnage höher ausfallen als bei einer Oberflächensanierung. Die Kofinanzierung obliegt den Landwirten, jedoch besteht die<br />
Möglichkeit, dass die Gemeinde Friedland sich engagiert. Sowohl die Landwirte als auch die Gemeinde Friedland können als<br />
Antragsteller auftreten.<br />
Verkehrsberuhigende Maßnahmen werden von Herrn Sebode als sinnvoll angesehen, wenn beispielsweise Fahrbahnteilungen<br />
eingebaut wurden.<br />
Auf Herrn Schäfers Nachfrage nach Fahrbahnverschwenkungen wird einhellig darauf verwiesen, dass diese in der Regel zu<br />
klein und zu eng gebaut sind, um sie mit längeren Fahrzeugen durchfahren zu können. Sie werden von der Landwirtschaft<br />
daher abgelehnt.
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Herr Greber berichtet, dass sich Geschwindigkeitsmessungen in der Vergangenheit als effizienter erwiesen haben.<br />
Auf eine Flurbereinigung angesprochen wurde erklärt, dass zwischen 1953 und 1957 in <strong>Ballenhausen</strong> die erste niedersächsische<br />
Flurbereinigung durchgeführt worden ist. Die anwesenden Landwirte sehen in diesem Bereich keinen Handlungsdruck.<br />
Auf Nachfrage berichtet Herr Schäfer, dass derzeit kein weiteres Neubaugebiet in <strong>Ballenhausen</strong> geplant ist.<br />
Zur weiteren Vorgehensweise erläutert Herr Brudniok, dass auf der Grundlage der Fragebogen ein Text ausgearbeitet wird,<br />
der sich mit Perspektiven für die Landwirtschaft auseinandersetzt. Dieser wird den Landwirten vor der Aufnahme in den<br />
Dorferneuerungsplan zur Korrektur zur Verfügung gestellt.<br />
Im zweiten Teil des Abends geht Herr Ochmann auf die Fördermöglichkeiten bis 2013 und die Arbeit der Landwirtschaftskammer<br />
und des GLL ein.<br />
Er verweist auf steuerliche Fragen und die De-Minimus-Regelung sowie die im Anhang 1 genannten Kriterien („Ersterzeugnisse“<br />
...). Es werden in jedem Fall Einzelfalllösungen zu erarbeiten sein.<br />
Herr Teichmann berichtet, dass der Druck, größere Flächen zu bewirtschaften, steigt.<br />
Herr Ochmann erklärt, dass nicht immer die Flurbereinigung gewählt werden muss. So besteht die Möglichkeit des freiwilligen<br />
Landtausches.<br />
Neben den Fördermöglichkeiten im Rahmen der Dorferneuerung stehen der Landwirtschaft weitere Fördermittel zur Verfügung,<br />
z.B. zur Diversifizierung und Umnutzung (-> ZILE-Richtlinie, LEADER). Die Umnutzung beinhaltet jedoch nicht die<br />
Schaffung von Wohnraum.<br />
Weitere Themen sind die Kooperation mit Nicht-Landwirten, ländlicher Tourismus, Dienstleistungseinrichtungen (Gutachten,<br />
Konzepte, Dorfladen ...), Prozesswärmeverwertung (nur das Leitungssystem), Investitionskonzepte etc.<br />
Die Sanierung von Forstwegen ist über die Landwirtschaftskammer zu klären.<br />
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten mit sehr guten Konditionen werden von der KFW angeboten.<br />
Hinsichtlich der Sanierung von Immobilien erläutert Herr Ochmann, dass Zielsetzung der Dorferneuerung die Bewahrung<br />
und nicht die Verschönerung von regionstypischen Häusern ist. In der Regel sind Häuser, die vor 1945 erbaut worden sind,<br />
förderungsfähig. Keine Altersbegrenzung existiert bei Zweckbauten. Hier besteht aufgrund der oftmals großen Flächen Kompromissbereitschaft<br />
bei der Auswahl der Materialien (z.B. rote Alubleche), vorausgesetzt der Denkmalschutz stimmt der<br />
Maßnahme zu.<br />
Es besteht die Möglichkeit, die Förderung durch einen Zuschuss aus der Denkmalpflege zu erhöhen, so dass die Förderquote<br />
über 30 % steigt. Zudem besteht die Möglichkeit, die Aufwendungen steuerlich abzusetzen.<br />
Die Auswahl der Dachziegel hat sich in Format/Form und Farbe an den Vorgaben der Dorferneuerung zu orientieren. Die<br />
Förderung deckt die aufgrund der Vorgaben evtl. anfallende Mehrkosten. Das Fabrikat oder Modell wird nicht vorgeschrieben.<br />
Weitere Auflagen durch die Denkmalpflege sind jedoch möglich. Die Auswahl sollte sich an der Nutzung und dem Alter<br />
des Objektes bzw. dem Umfeld anpassen. In einem Beratungsgespräch mit dem Dorferneuerungsbetreuer werden entsprechende<br />
Empfehlungen ausgesprochen. Ziel ist die Bewahrung des Landschaftsbildes mit den typischen roten Dachlandschaften.<br />
Herr Ochmann weist stichwortartig auf die weiteren Fördermöglichkeiten für die Landwirtschaft im Rahmen des Programms<br />
PROFIL hin (Streuobstwiesen, Gewässergestaltung etc.). Auf Nachfrage erläutert er, dass die Beseitigung von Streuobstwiesen<br />
nicht förderfähig ist, die Rodung von Hecken als Biotopschutz/-pflege jedoch positiv bewertet werden kann.<br />
Die Förderperiode wird individuell festgelegt. Das Programm läuft bis 2013. Im Durchschnitt beträgt die Laufzeit der Dorferneuerung<br />
fünf Jahre. Sie kann entsprechend der Nachfrage verkürzt oder verlängert werden.<br />
Sobald der Dorferneuerungsplanes durch das GLL genehmigt wurde, können Anträge gestellt werden. Sollte dringender<br />
Handlungsbedarf bestehen, z.B. aufgrund von Feuer, Sturm etc., ist eine kurzfristige Lösung möglich.<br />
Die Förderquote beträgt bei privaten Maßnahmen 30 %, bei Maßnahmen der Gemeinde und Verbände 50 % (netto). Pro<br />
Objekt werden bei privaten Maßnahmen max. 25.000 € bewilligt. Das Investitionsvolumen darf 8.340 € nicht unterschreiten<br />
(Mindestgrenze).<br />
Herr von Bodenhausen erkundigt sich, ob Straßenbaumaßnahmen geplant sind.<br />
Herr Schäfer berichtet, dass alle potenziellen Maßnahmen aufgenommen werden, um eine Förderung nicht zu gefährden.<br />
Herr Ochmann ergänzt, dass alle Maßnahmen, die der Arbeitskreis wünscht, aufgenommen werden, unabhängig davon, ob<br />
Arbeiten an Versorgungsleitungen vorgenommen werden müssen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist abhängig von der<br />
Finanzlage der Kommune. Die Kosten der Baumaßnahme werden im Vorfeld vorgestellt, da die umlagefähigen Kosten auf<br />
die Anlieger verteilt müssen.<br />
Herr Schäfer erläutert, dass eine Berechnung aufgrund von Einheitswerten, unabhängig von einer Ausschreibung, vorgestellt<br />
wird. Es wird eine ganzheitliche Lösung gesucht, die auch die Sanierung des Leitungsnetzes beinhaltet, um die Kosten niedrig<br />
zu halten. Vor Maßnahmenbeginn erfolgt eine Information der Anlieger.<br />
Herr Ochmann weist daraufhin, dass bei den Planungen die unterschiedliche Trägerschaft der Straßen berücksichtigt und das<br />
Einverständnis bei den Träger der jeweiligen Straße eingeholt werden muss.<br />
Zum Ablauf der Dorferneuerungsplanung erklärt Herr Ochmann, dass der Prozess aus einer Planungs- und einer Umsetzungsphase<br />
besteht. Nach der Aufnahme des Ortes in das Programm auf Antrag der Gemeinde Friedland wird ein Entwurf<br />
des Dorferneuerungsplans durch den Arbeitskreis und das betreuende Büro erstellt. Darin enthalten ist eine Schätzung des Investitionsvolumens.<br />
Nach der Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange wird der Dorferneuerungsplan zur Beratung in den<br />
Rat gegeben und beschlossen. Der Plan wird anschließend dem GLL zur Genehmigung vorgelegt. Im Rahmen einer Bürgerversammlung<br />
wird der Dorferneuerungsplans in der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong> vorgestellt.<br />
Die Verwaltung wird über eine Hauswurfsendung die Einwohner/innen der Ortschaft darüber informieren, ab wann Förderanträge<br />
eingereicht werden können. Bestehen Überlegungen eine Maßnahme umzusetzen, kann der Antragsteller ein für ihn<br />
kostenfreies Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Der Kontakt zu dem betreuenden Büro wird über die Gemeindeverwaltung<br />
hergestellt. Der Förderantrag ist über die Gemeinde Friedland einzureichen.<br />
Die Kontaktdaten von Herrn Ochmann werden an die Landwirte weitergeleitet.<br />
Herr Schäfer dankt den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Sitzung um 20.54 Uhr.
(Bruder)<br />
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 26.01.2009<br />
Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 18.35 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 21.00 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 8. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Donnerstag, dem 15.01.2009<br />
im Gasthaus Meyer in <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Ortsbürgermeister Utermöhlen fehlt entschuldigt<br />
Herr Schäfer begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong> sowie Herrn Brudniok vom Büro<br />
Hajo Brudniok und stellt das Thema des Abends vor: „Strukturentwicklung und örtliche Bauentwicklung". Grundlage der<br />
heutigen Sitzung ist der am 8.10.2008 ausgegebene Fragebogen.<br />
Herr Brudniok erläutert, dass die Dorferneuerung mit diesem Thema darauf abzielt, dass die Mitglieder des Arbeitskreises<br />
sich auch nach Abschluss der Planungsphase mit der Entwicklung ihrer Ortschaft auseinandersetzen. Er begrüßt in diesem<br />
Zusammenhang Herrn Brinkmann, der in seiner Funktion als Architekt gemeinsam mit Herrn von Campe an einem Konzept<br />
zur Zukunft des Scheidemann´schen Hofes arbeitet.<br />
Aus Sicht des Arbeitskreises bestehen folgende Stärken und Schwächen:<br />
� Stärken<br />
- Sporthaus<br />
- Gasthaus<br />
- Landschaft<br />
- ruhig und dennoch stadtnah gelegen<br />
- Lage / Anbindung an das Grundzentrum<br />
- wenig Verkehr<br />
- Burgruine Bodenhausen<br />
- Grabungsstelle in der Nähe des alten Wasserbassins<br />
- mehrere Räume zum Anmieten für Feiern, u.a. ein großer Festsaal (Feuerwehrhaus, Sporthaus, Schützenhaus,<br />
Gasthaus<br />
- gutes Vereinsleben, 4 bis 5 aktive Vereine<br />
- Sommerbuche<br />
- Kirche mit dem Thie<br />
- Forsthaus Hasenwinkel<br />
- Feuerwehr mit modernem Feuerwehrhaus<br />
- Nah zur B 27<br />
- Dichte Lage zu Groß Schneen<br />
� Schwächen<br />
- Jugendarbeit (Probleme mit dem Jugendraum etc.)<br />
- Gestaltung des Thieplatzes<br />
- mangelnde Integration der Neubürger in die Dorfgemeinschaft<br />
- kein Kaufladen<br />
- Nachwuchsprobleme in den Vereinen<br />
- Jugendarbeit gezielt verbesserbar, Jugendraum verbesserbar<br />
Herr Brudniok erläutert anhand einer Folie das Ziel, die Vitalität der Dörfer zu sichern. Die aufgezeigten Themenfelder spiegeln<br />
sich in dem Fragebogen wider.<br />
1. 1 „Öffentliche Infrastruktur – Gemeinbedarf“<br />
Eine Schule ist seit 1972 nicht mehr vorhanden. Die Ortschaft verfügt über einen Kindergarten, der langfristig gesichert<br />
werden soll. Eine Renovierung hat vor kurzem stattgefunden. Als Dorftreffs werden das Sporthaus, die Feuerwehr , die Gast-
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
stätte Meyer sowie das Schützenhaus genannt. Handlungsbedarf besteht beim Sporthaus und beim Schützenhaus. Letzteres<br />
besitz keinen Stromanschluss. Die Kosten für einen Stromanschluss sollten seinerzeit ca. 30.000 DM betragen. Eine Nutzung<br />
als Rast- / Wanderhütte ist vorstellbar, da das Haus in der Nähe eines Radwanderweges liegt. Das Schützenhaus kann für bis<br />
zu 30 Personen als Treffpunkt vermietet werden. Eine Verlängerung des Daches bzw. ein Überdach sind wünschenswert.<br />
Eine Festscheune war früher vorhanden, wird aber als nicht mehr notwendig erachtet, weil die Fläche am Sportplatz für<br />
festliche Aktivitäten zur Verfügung steht.<br />
Eine Sporthalle ist vorhanden, wird aber nur selten genutzt, z.B. vom Kindergarten. Die Halle wird vor allem für Festlichkeiten<br />
vermietet und vom Gesangverein genutzt. Früher wurde sie auch zu Tischtenniszwecken genutzt. Sport- und Spielplatz<br />
sind vorhanden, gewünscht werden ein Bolzplatz (wie in Diemarden), eine Skaterbahn, ein Basketballfeld sowie eine Boulebahn.<br />
Herr Brudniok erklärt, dass eine Konzentration sportlicher Aktivitäten im Bereich des Sportplatzes sinnvoll ist, um einen<br />
Treffpunkt zu kristallisieren.<br />
Bezüglich des Jugendraumes, der im Feuerwehrgerätehaus integriert ist, wird eine bessere Betreuung gefordert, bauliche<br />
Mängel werden nicht genannt.<br />
Die Ortschaft verfügt über eine Bibliothek in der Scheidemann´schen Stiftung.<br />
Es ist ein Pfarrhaus mit einem Gemeinderaum vorhanden, welches vor kurzem renoviert worden ist. Handlungsbedarf besteht<br />
bei der Kirche (z.B. Außenfassadensanierung) und dem Vorplatz mit dem Kriegerdenkmal. Mit dem Kirchenvorstand sollte<br />
diesbezüglich ein Gespräch geführt werden. Es sind bei den alle 14 Tage stattfinden Kirchenveranstaltungen wenig Kirchenbesucher<br />
zu verzeichnen. Die Zukunft der Kirchennutzung in <strong>Ballenhausen</strong> erscheint fraglich.<br />
Unter den sozialen Einrichtungen wird der DRK – Verein genannt.<br />
Als Vereinhäuser fungieren das Gasthaus, das Sporthaus sowie das Schützenhaus. Zudem gibt es ein altes und ein neues<br />
Feuerwehrgerätehaus.<br />
Als Wahrzeichen von <strong>Ballenhausen</strong> sind die Sommerbuche, die Pappeln in der Feldmark, die Burgruine sowie das Forsthaus<br />
Hasenwinkel genannt.<br />
Der Ort verfügt über drei Bushaltestellen – die Anzahl wird als ausreichend bezeichnet. Baulich besteht kein Handlungsbedarf,<br />
Es gab Brunnen bei der Burg und im Hasenwinkel sowie eine Quelleneinfassung mit Sandsteinen auf der Gipswiese in der<br />
Nähe des Sportplatzes. Letztere könnte im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Rundwanderweges wieder aufgebaut<br />
werden.<br />
Als Infostellen und Werbeanlagen werden der Wappenstein, mehrere Aushangkästen sowie eine Plakatwand genannt. Der<br />
Standort der Werbeanlage am Dorfeingang wird als ungünstig bewertet. Die Plakatwand am Kirchberg sollte aufgrund ihres<br />
Zustands erneuert oder entfernt werden.<br />
Der Grillplatz am Schützenhaus sollte hergerichtet werden.<br />
In der Friedhofskapelle fehlen eine Stromanschluss sowie Toiletten. Ein Toilettenanbau ist wünschenswert. Die Trägerschaft<br />
liegt bei der Kirche.<br />
Ein Backhaus ist nicht vorhanden, ein Bedarf wird nicht gesehen.<br />
1. 2 „Private und sonstige Infrastruktur, Versorgung, Daseinsvorsorge, Verkehr, Mobilität, ÖPNV“<br />
Dorf-/ Nachbarschaftsläden sind nicht mehr vorhanden, ein Bedarf wird verneint. Ein Hofladen ist erwünscht, diesbezügliche<br />
Signale der Landwirte sind abzuwarten. Der Ort wird über mobile Bäckereien versorgt. Gewünscht wird die Einrichtung<br />
eines Cafes (evtl. im Hasenwinkel) sowie eines Kiosks. Dieser könnte beispielweise in einen Hofladen integriert werden.<br />
<strong>Ballenhausen</strong> verfügt über folgende Gewerbebetriebe: einen Reifenhandel, eine Zimmerei, einen Erlebnishof, zwei Steuerfachbüros,<br />
eine Biogärtnerei, einen Malerbetrieb, einen Elektriker, eine Försterei sowie eine Galerie. Zudem befindet sich<br />
eine Praxis für Akupunktur im Ort.<br />
Der Zugang zum Breitband (DSL ...) sollte ausgebaut werden. Es fehlen Leitungen, so dass zum Teil Telefonanschlüsse nicht<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Die verkehrliche Anbindung wird als gut bewertet. Es besteht jedoch Optimierungsbedarf, u.a an den Wochenenden. Die<br />
Linien sollten sich passgenauer an den Bedürfnissen der Schüler und Berufstätigen orientieren.<br />
2. „Soziales Engagement und Miteinander, Sozialkultur“<br />
Das Vereinsleben wird als rege beschrieben. Die Integration sollte vorangetrieben, mehr Anlaufpunkte geschaffen und das<br />
Management des Vereinslebens neu strukturiert werden. Im Bereich Kultur sind mehr Angebote zu entwickeln. Bislang<br />
erfolgen kulturelle Aktivitäten von den Vereinen. Geselliges Treffen findet einmal im Monat im Feuerwehrgerätehaus statt<br />
zum Handarbeiten und „Klönen“. Die Heimatpflege ist zu intensivieren. Ein Cafe sollte in bereits vorhandenen Räumlichkeiten<br />
eingerichtet werden.<br />
Im Dorf wird eine zentrale Stelle, ein sozialer und kultureller Mittelpunkt zum Teil vermisst.<br />
Der Kindergarten sollte attraktiver gestaltet werden. Der Standort ist langfristig zu sichern und die Öffnungszeiten an die<br />
Bedürfnisse der Eltern anzupassen.<br />
Die Vereine (mit Gründungsjahr) sind:<br />
- SV von 1909 <strong>Ballenhausen</strong> (1909)<br />
- Frw. Feuerwehr (1935) mit 170 Mitgliedern<br />
- Gesangverein (1884) mit 66 Mitgliedern<br />
- Sportverein Rot-Weiß (1949)<br />
- Handarbeiten und Klönen (1982)<br />
- BKC (2008) mit 56 Mitgliedern<br />
- SoVD<br />
- DRK
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Alle Vereine leiden unter Nachwuchsproblemen.<br />
Die Nutzung der Hofstelle von Herrn von Campe als Kulturtreffpunkt wird kritisch diskutiert, da zum Erhalt der Hofanlage<br />
eine wirtschaftliche Nutzung erforderlich ist. Da der Ort über keinen zentralen Platz bzw. einen Mittelpunkt verfügt, wird in<br />
dem Areal Entwicklungspotenzial gesehen. Die Erstellung eines Konzeptes wird als Grundvoraussetzung eingestuft. Von<br />
Herrn von Campe ist lt. Architekt Brinkmann daran gedacht, eine Ziegenkäseproduktion und ein Dorfcafé aufzubauen, ferner<br />
sollen eventuell vom Aussterben bedrohte Tiere nachgezüchtet werden.<br />
<strong>Ballenhausen</strong> hat zwei Chroniken, die, wie auch historische Karten und Bilder, über den Heimatpfleger zu erhalten sind.<br />
Zur Vermittlung von Dorfgeschichte und zur Förderung / Erhaltung von Traditionen, Sitten und Gebräuchen werden Veranstaltungen<br />
wie die Kirmes, Karneval, die Sportwoche, das Frühlingssingen, das Osterfeuer, das Weinfest, das Waldfest, ein<br />
Wintervergnügen, das Feuerwehrfest sowie eine Grenzbegehung durchgeführt. Des weiteren werden ein monatlicher Seniorennachmittag<br />
des DRK und Ausflüge sowie ein Schnitzelessen und das Bosseln veranstaltet. Für Kinder wird ein Kindergottesdienst<br />
jeden zweiten Samstag angeboten. Zudem gibt es ein gemeinsames Schlittenfahren und die Jugendfeuerwehr. 2006<br />
wurde eine Baumpflanzaktion initiiert. Das Ehrenmal wird gemeinsam gepflegt und gesäubert. Auf Gemeindeebene wird die<br />
Nachbarschaftshilfe NENA angeboten. 2009 stehen vier Vereinsjubiläen an. Es wird angemerkt, dass die Schwierigkeit bei<br />
der Vielzahl an Veranstaltungen darin besteht, dass jede finanziert und ausreichend besucht werden muss.<br />
Es gibt eine Mädchenband und einen Fotografen, Herrn Holzigel, der seine Werke u.a. in der Gemeindeverwaltung in Groß<br />
Schneen ausgestellt hat.<br />
Zur Einbindung der Neubürger werden diese zur Kirmes eingeladen und deren Neubauten während des Umzuges eingeweiht.<br />
Auch erhalten sie Einladungen der Vereine.<br />
3. „Wirtschaft und Beschäftigung“<br />
Im Ort werden elf Arbeitsplätze bereitgestellt (Zimmerei 1, Malerbetrieb 3, KFZ-Werkstatt 1, Steuerberater 3, Bio-<br />
Landwirtschaft 3). Gästezimmer für Touristen gibt es nicht. Früher wurden auf dem Anwesen Hasenwinkel für Urlauber<br />
Zimmer vermietet. Die Wirtschaftsförderung wird seitens die Gemeinde Friedland übernommen. Zu verschiedenen Veranstaltungen<br />
werden die Betriebe eingeladen.<br />
Der Sitzung wird unterbrochen und ein weiterer Termin verabredet.<br />
Der zweite Teil der Arbeitskreissitzung zum Thema „Strukturentwicklung und örtliche Bauentwicklung" findet am 4. Februar<br />
09, 19 Uhr, statt.<br />
Herr Schäfer dankt den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Sitzung um 21.00 Uhr.<br />
(Bruder)<br />
Gemeinde Friedland 37133 Friedland, den 02.03.2009 Der Bürgermeister<br />
Beginn der Sitzung: 19.07 Uhr<br />
Ende der Sitzung: 20.50 Uhr<br />
Niederschrift<br />
über die 9. Sitzung des Arbeitskreises<br />
(Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>)<br />
am Donnerstag, dem 04.02.2009<br />
im Gasthaus Meyer in <strong>Ballenhausen</strong><br />
Teilnehmer: Siehe anliegende Anwesenheitsliste<br />
Herr Ortbürgermeister Utermöhlen begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft <strong>Ballenhausen</strong> sowie Herrn<br />
Brudniok vom Büro Hajo Brudniok sowie Herrn Schäfer und Frau Bruder von der Verwaltung. Er verweist auf den nahenden<br />
Abschluss des Planungsprozesses und dankt allen Arbeitskreismitgliedern für ihr Engagement.<br />
Herr Brudniok erläutert das weitere Vorgehen. Herr Dr. Schwahn hat das Thema „Freiraum“ aufbereitet und einen Maßnahmenkatalog<br />
zusammengestellt. Anfang März wird der Entwurf des Dorferneuerungsplanes vorliegen und den Mitgliedern des<br />
Arbeitskreises sowie den Trägern Öffentlicher Belange zwecks Stellungnahme zur Verfügung gestellt.<br />
Der Arbeitskreis setzt die Sitzung vom 15.01.2009 mit der Beantwortung des Fragenbogens fort. Anmerkungen zum Protokoll<br />
der letzten Sitzung liegen nicht vor.<br />
4. Klimawandel und Energie<br />
Der Arbeitskreis schlägt folgende Maßnahmen vor:<br />
1. Einsparungen bei der Beleuchtung der Straßen (Beleuchtungszeiten, Beleuchtung von ausgewählten Bereichen z.B.<br />
Kreuzungen ...)<br />
2. Anschluss der Ortschaft an das Erdgasnetz<br />
3. Information über energieeinsparende Maßnahmen (Wärmedämmung ...)<br />
Herr Brudniok fragt nach, ob der Gedanke, sich als „Energiedorf“ zu positionieren, von dem Arbeitskreis getragen wird. Im<br />
Mittelpunkt der Idee steht nicht die Nutzung der Bioenergie (siehe Jühnde, Reiffenhausen ...), sondern die Energieeinsparung.<br />
Es bestehen häufig Defizite in der Information der Hauseigentümer über Möglichkeiten, entsprechende Maßnahmen im
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
Bestand umzusetzen. Er weist auf die überörtliche Bedeutung dieses Themas hin. Beispielsweise könnte eine „Energiefibel“<br />
in Zusammenarbeit mit Experten erstellt werden.<br />
Herr Piper berichtet von früheren Überlegungen, sich an dem Wettbewerb der Universität Göttingen „Bioenergiedorf“ zu<br />
beteiligen. Damals scheiterte eine erfolgreiche Teilnahme u.a. an dem Widerstand der Landwirtschaft. Er hält den Gedanken<br />
für wichtig und weiterverfolgbar.<br />
Herr Utermöhlen ergänzt, dass die Ortschaft erst in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Reiffenhausen hatte sich ebenfalls<br />
an dem Wettbewerb beteiligt und konnte durch eine schon bestehende Biogasanlage sowie eine größere Entfernung zur Stadt<br />
Göttingen punkten. Es liegt eine Expertise der Verwaltung vor, dass in <strong>Ballenhausen</strong> landwirtschaftliche Flächen nicht in<br />
ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Die Ortschaft bietet aufgrund der engen baulichen Struktur jedoch gute Voraussetzungen<br />
für Nahwärmesysteme (z.B. Erdwärme).<br />
Mit dem GLL Göttingen soll abgeklärt werden, welche Möglichkeiten bestehen, das Thema „Energieeinsparung“ in <strong>Ballenhausen</strong><br />
umzusetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Programme zur Energieeinsparung bei Fachwerkhäusern<br />
aufgrund unrealistischer Zielwerte nicht greifen.<br />
Herr Renziehausen gibt zu bedenken, dass ein Blockheizkraftwerk relativ groß ist und viele kleine Teilnehmer den Rahmen<br />
sprengen könnten. Reiffenhausen wird zudem die Ressourcen in der Region binden. Das Thema „Dämmung“ und die Nutzung<br />
der Dachflächen zur Energieerzeugung sind bei vielen Bürger/innen bereits präsent.<br />
Herr Piper bietet an, einen Informationsabend mit entsprechenden Referenten zu organisieren<br />
Herr Schäfer schlägt vor, das Thema beispielsweise unter dem Oberbegriff „Alternative Energieversorgung“ in den Dorferneuerungsplan<br />
einzubinden, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Damit würde sich die Ortschaft nicht zu stark binden und<br />
Perspektiven offen halten.<br />
Den Handlungsbedarf an öffentlichen Gebäuden sieht der Arbeitskreises wie folgt:<br />
� Sporthaus: Wärmedämmung, Solarkollektoren<br />
� Feuerwehrhaus: Solarkollektoren<br />
� Schützenhaus: Stromanschluss, Solarkollektoren<br />
� Friedhofskapelle: Solarkollektoren<br />
� Sportplatz: Flutlichtbeleuchtung<br />
5. Innenentwicklung und Dorfumbau<br />
Die weitere Entwicklung der Ortschaft steht in engem Zusammenhang mit dem demographischen Wandel und der Entwicklung<br />
von Baugebieten. Die Einwohnerentwicklung zwischen 1998 und 2007 war in <strong>Ballenhausen</strong> relativ stabil. Eine Studie<br />
der Universität Göttingen prognostiziert eine Verringerung der Bevölkerung bis 2020 um 8,3 %, während eine Studie der<br />
Bertelsmann Stiftung von einem Wachstum um 11,9 % ausgeht.<br />
Auf die Unterschiede in den Prognosen angesprochen erläutert Herr Brudniok, dass der Landkreis Göttingen im Durchschnitt<br />
mit einem Rückgang in der Bevölkerungsentwicklung rechnen muss, von dem aber der „Speckgürtel“ um Göttingen weniger<br />
betroffen sein wird.<br />
Die Baulücken in <strong>Ballenhausen</strong> werden anhand einer Karte zusammengetragen. Demnach stehen im Baugebiet am Friedhof<br />
acht Bauplätze, in der Wiesenstraße ein Bauplatz, im Wolfsgraben und im Koppelweg sechs Bauplätze, im Bauerweg ein<br />
Bauplatz sowie in der Rhienstraße drei Bauplätze zur Verfügung. Es ist zu prüfen, ob neben dem Feuerwehrhaus ein Bauplatz<br />
ausgewiesen werden kann, da die Erschließung z. Zt. nur über das Grundstück der Feuerwehr möglich ist.<br />
In der Summe ergeben sich 16 – 17 Bauplätze in der Ortslage. Im Flächennutzungsplan sind weitere Entwicklungsflächen in<br />
den Bereiches des Bauerweges und der Rhienstraße ausgewiesen. Defizite sind nicht erkennbar.<br />
Eine Nachverdichtung im Innenbereich sollte in Erwägung gezogen werden. Im Bauerweg weisen die Grundstücke eine<br />
Größe von 1300 – 1400 m² auf. Dort kann die Bebauung in zweiter Reihe durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes<br />
gesteuert werden.<br />
Auf die Frage nach dem Bedarf wird vorgeschlagen, eine Anliegerbefragung durchzuführen. Es schließt sich eine Diskussion<br />
über die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer an.<br />
Herr Brudniok erklärt, dass es sich um potentielle Nachverdichtungsflächen handelt, d.h. eine Umsetzung kann, muss aber<br />
nicht zwingend erfolgen.<br />
Nicht der Verkauf an Dritte sollte Gegenstand der Überlegung sein, sondern der Wunsch von Kindern, auf dem elterlichen<br />
Grundstück zu bauen. Die Auseinandersetzung mit Grundstücksgeschäften ist nicht Gegenstand der Dorferneuerungsplanung.<br />
Die Nutzung verschiedener Brachflächen als Bauplätze ist zu prüfen. Am Ortsrand ist laut Flächennutzungsplan keine<br />
Bebauung vorgesehen. Südlich des Bauerweges ist keine Erschließung möglich. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft<br />
von landwirtschaftlichen Betrieben ist aufgrund von zu erwartenden Immissionen eine Bebauung ausgeschlossen.<br />
Die Zukunft des landwirtschaftlichen Betriebes am Sportplatz ist aufgrund der ungeklärten Nachfolge ungewiss. Im Falle<br />
einer Aufgabe des Betriebes ist eine Nachnutzung mit Wohnbebauung denkbar.<br />
Herr Schäfer erläutert, dass der Flächennutzungsplan die mittelfristige Entwicklung (10 – 15 Jahre) wiedergibt. Der Plan ist<br />
Grundlage für die Erstellung von Bebauungsplänen.<br />
Angesichts der Prognosen wird ein weiterer Bedarf an Wohnbauflächen nicht gesehen. Eigentümer großer Grundstücke<br />
sollen auf die Möglichkeit der Teilung hingewiesen werden. Sollte eine weitere Entwicklung erforderlich sein, könnte diese<br />
zwecks Abrundung des Dorfbildes im Bereich des Sportplatzes zu erfolgen.<br />
Herr Brudniok prognostiziert, dass der Bedarf für die nächsten zehn Jahre gedeckt ist. Hinzu kommen Leerstände im Bestand<br />
(z.B. ehemalige landwirtschaftliche Hofstellen).<br />
Herr Dr. Schwahn wird in seinem Beitrag auf die Eingrünung des Ortsrandes eingehen. Die Gestaltung im Innenbereich<br />
basiert auf § 34 BauGB. Die Bebauungspläne enthalten u.a. Gestaltungsvorschriften.<br />
6. Strategien und Steuerung<br />
Zu den Besonderheiten in <strong>Ballenhausen</strong> zählen der liegende Dachstuhl und die Bibliothek auf dem Scheidemann´schen Hof<br />
sowie die Pappeln. Zur Steigerung der Attraktivität des Ortes könnten Info-Tafeln zur Burgruine mit Wegweisung aufgestellt
GEMEINDE FRIEDLAND: 2008 / 2009<br />
DORFENTWICKLUNGSPLAN B A L L E N H A U S E N<br />
und Entdeckungsreisen angeboten werden. Der Bachlauf entlang des gewünschten Radweges könnte ausgekoffert und mit<br />
einem Tretbecken versehen werden.<br />
Als Schwächen des Dorfes werden die fehlende Integration der Neubürger in die Dorfgemeinschaft, die Gestaltung des<br />
Thieplatzes und die mangelnde Attraktivität des Jugendraumes genannt. Die Jugendarbeit ist gezielt zu verbessern.<br />
Zur Aktivierung von lokalen Akteuren verweist der Arbeitskreis auf die Gründung eines Vereins für Heimatpflege, welcher<br />
die Dorferneuerung zukünftig begleiten soll. Eine detaillierte Zielrichtung der Vereinsarbeit hinsichtlich der Pflege von<br />
Brauchtum oder der praktischen Arbeit ist noch nicht festgelegt. Geplant sind u.a. die Organisation von Festlichkeiten, die<br />
dauerhafte Pflege öffentlicher Flächen (Kirchberg/Ehrenmal) unter Einbeziehung des Ortsheimatpflegers sowie die Kooperation<br />
mit anderen Vereinen. Zudem soll ein Gesprächskreis zur Verbesserung der Jugendarbeit einberufen werden.<br />
Die Gründung eines eigenständigen, gemeinnützigen Vereins wird angestrebt, um eine finanzielle Unterstützung für Arbeitsmittel,<br />
Geräte, Benzin etc. einwerben zu können. Zudem besteht die Möglichkeit, für Maßnahmen einen Förderantrag zu<br />
stellen.<br />
Bezüglich der Frage nach Kooperationen wird auf die Zusammenarbeit der Vereine und Verbände verwiesen.<br />
Es wird gewünscht, dass der Arbeitskreis sich regelmäßig trifft und dauerhaft den Kontakt zwischen der Verwaltung und dem<br />
Ort pflegt.<br />
Bei Interesse, eine Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung umzusetzen, ist eine Beratung durch das betreuende Büro<br />
vorgesehen. Der Kontakt wird über die Gemeindeverwaltung hergestellt.<br />
Der weitere Verlauf des Prozesses gestaltet sich wie folgt:<br />
Es wird eine Kostenschätzung zu den geplanten Maßnahmen erstellt und dem Entwurf beigefügt. Der finanzielle Rahmen ist<br />
damit festgesteckt. Der Entwurf wird dem GLL und den Trägern Öffentlicher Belange zur Stellungnahme vorgelegt. Der<br />
Arbeitskreis wird mit eingebunden. Der Dorferneuerungsplan wird anschließend dem Rat zum Beschluss vorgelegt. Der genehmigte<br />
Plan bildet die Grundlage für die Förderung.<br />
Zum Abschluss wird ein Motto zur Dorferneuerung gesucht. Vorgeschlagen wurden:<br />
� „Lebensqualität soll erhalten bleiben“<br />
� „Klein, gemütlich und doch zentral“<br />
� „Eigenleistung und Nachbarschaftshilfe als Faustpfand“<br />
� „Geben und Nehmen – eine Hand wäscht die andere“<br />
� „<strong>Ballenhausen</strong> lebt“<br />
Es wird auf die Arbeit der NENA hingewiesen. Die Nachbarschaftshilfe wird sich in <strong>Ballenhausen</strong> weiter entwickeln und die<br />
gemeinsamen Projekte werden zur einer Stärkung des „Wir-Gefühls“ beitragen<br />
Herr Brudniok ergänzt, dass die Dorfgemeinschaft den Schwerpunkt in der Planung bildet. Es wird im Dorferneuerungsplan<br />
der Ist-Zustand des Dorflebens beschrieben, welcher mit den vorgeschlagenen Maßnahmen erhalten und aktiviert werden<br />
soll. Die Chancen stehen aufgrund der überschaubaren Größe des Ortes sehr gut.<br />
Herr Schäfer dankt den Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit in den vergangenen Sitzungen des Arbeitskreises. Der<br />
Entwurf wird in Absprache mit dem GLL in <strong>Ballenhausen</strong> vorgestellt. Zu der Veranstaltung werden alle Mitglieder des Arbeitskreises<br />
eingeladen. Die Träger Öffentlicher Belange sind anzuhören. Der Plan wird öffentlich ausgelegt. Dauer und Ort<br />
der Auslegung werden über Aushänge bekannt gemacht. Sobald eine Förderung von privaten Maßnahmen möglich ist, wird<br />
die Verwaltung durch eine Hauswurfsendung informieren. Er dankt für die gute Beteiligung und Zusammenarbeit und<br />
schließt die Sitzung um 20.50 Uhr.<br />
(Bruder)
Europäische Gemeinschaft<br />
Strukturfonds<br />
,<br />
Niedersachsen<br />
Amt für Landentwicklung Göttingen<br />
Unter der Rubrik Landentwicklung und Bodenordnung und dem<br />
dazugehörigen Unterpunkt Fördermöglichkeiten findet man den<br />
Vordruck mit Ausfüllhinweisen dazu.<br />
Was ist sonst zu beachten?<br />
Förderung der Dorferneuerung in Niedersachsen und<br />
Dorferneuerung in <strong>Ballenhausen</strong><br />
Planung für das Dorf<br />
Ziele der Dorferneuerung<br />
Die Dorferneuerungsplanung hat sich als flexibles Instrument erwiesen,<br />
Entwicklungsziele und Problemlösungen anschaulich und<br />
allgemeinverständlich darzustellen, ohne sie gleich rechtsverbindlich<br />
festzuschreiben. Ein Dorferneuerungsplan ist Voraussetzung<br />
für die Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Inhalt und<br />
Umfang richten sich nach den örtlichen Erfordernissen.<br />
Die Aufstellung des Dorferneuerungsplans kann mit bis zu 50 v.<br />
H. der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden, unabhängig<br />
vom jeweiligen Zuschusssatz der Gemeinde oder des<br />
Gemeindeverbandes.<br />
Mit der Durchführung von Maßnahmen darf grundsätzlich nicht vor<br />
Erlass des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Ausnahmen<br />
hiervon bedürfen unbedingt der Genehmigung des Amtes für<br />
Landentwicklung Göttingen. Maßnahmen mit einem<br />
Zuwendungsbedarf von weniger als 500 €, bei<br />
Gebietskörperschaften von weniger als 5.000 €, werden nicht<br />
gefördert.<br />
Soweit die Richtlinie für Maßnahmen eine betragsmäßige Höchstgrenze<br />
vorsieht, darf diese für denselben Zuwendungszweck für<br />
jedes Objekt nur einmal ausgeschöpft werden.<br />
Bei der Bemessung der Zuwendung können berücksichtigt werden<br />
- Ausgaben, die durch Belege nachgewiesen werden, in voller<br />
Höhe,<br />
- bei gemeinnützigen Vereinen eigene Arbeitsleistungen mit der<br />
Hälfte des Betrages, der sich bei einer Vergabe an einen Unternehmer,<br />
ohne Berechnung der Umsatzsteuer, ergeben<br />
würde.<br />
Erfahrene Dorfplaner sind nötig<br />
Förderungsvoraussetzungen Verfahrensgang<br />
Die wenigsten ländlichen Gemeinden verfügen selbst über hinreichende<br />
Kapazität für eine umfassende Dorferneuerungsplanung.<br />
Die Neigung, bei den Aufwendungen für die Planung zu sparen, ist<br />
häufig der Beginn von Fehlentwicklungen. Das Land will dazu<br />
beitragen, dass die Gemeinden erfahrene Dorfplaner für die Lösung<br />
dieser komplexen Aufgaben verpflichten können.<br />
Grundlage für die Förderung:<br />
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur<br />
integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) –<br />
RdErl. d. ML v. 29. 10. 2007 — 306-60119/3<br />
Das niedersächsische Dorferneuerungsprogramm ist ein umfassendes<br />
Instrument zur Entwicklung der Dörfer mit einem ganzheitlichen<br />
und interdisziplinären Planungs- und Förderansatz. Mit der<br />
Dorferneuerung werden mehrere Ziele angestrebt:<br />
- Planung für Dörfer als allgemein verständliche Entscheidungshilfe<br />
- Erarbeitung eines örtlichen Leitbildes bzw. einer „lokalen<br />
Agenda 21“<br />
- Erhaltung des dörflichen Charakters<br />
- Verbesserung des dörflichen Umfeldes<br />
- Stärkung des innerörtlichen Gemeinschaftslebens<br />
- Sicherung von Arbeitsplätzen<br />
- Maßnahmen für die landwirtschaftlichen Betriebe<br />
- Verbesserung der Erschließung<br />
- Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefahren und zur<br />
Sanierung innerörtlicher Gewässer<br />
- Hersteller grünordnerischer Anlagen und dorfökologischer<br />
Maßnahmen<br />
- Förderung außerlandwirtschaftlicher Einkommensalternativen<br />
- Anstoß für Entwicklungs- und Investitionsvorhaben<br />
- Fachkundige Betreuung<br />
Beteiligung der Dorfbewohner<br />
Wo wird gefördert?<br />
Die Dorfbewohner müssen mit den Ergebnissen der Planung leben.<br />
Es ist daher notwendig, sie von Anfang an daran zu beteiligen.<br />
Dorfbewohner sind für die Gemeinde und den Planer eine unentbehrliche<br />
Informationsquelle, sie sind auch die Partner der Gemeinde,<br />
wenn es um die Verwirklichung der Dorferneuerung geht.<br />
Erfahrungsgemäß steigt die Investitionsbereitschaft der Dorfbewohner<br />
in dem Maße, wie sie an der Planung teilhaben. Neben<br />
Bürgerversammlungen hat sich die Bildung planungsbegleitender<br />
örtlicher Arbeitskreise bewährt, in denen sowohl Vertreter der<br />
Gemeinde- oder Ortsräte als auch interessierte Dorfbewohner<br />
mitarbeiten.<br />
Die Dorferneuerungsplanung, die fachkundige Betreuung von<br />
Projekten öffentlicher und privater Zuwendungsempfänger werden<br />
in Gemeinden und Ortsteilen mit herkömmlich landwirtschaftlicher<br />
Siedlungsstruktur, in Weilern, landschaftsbestimmenden Gehöftgruppen<br />
und Einzelgehöften gefördert. Voraussetzung einer Förderung<br />
ist die Aufnahme des Ortes in das Dorferneuerungsprogramm.<br />
Wer wird gefördert?<br />
Fachkundige Betreuung/Umsetzungsbegleitung<br />
Zuwendungen können Gemeinden, Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaften<br />
nach dem Flurbereinigungsgesetz, Wasserund<br />
Bodenverbände sowie natürliche und juristische Personen<br />
erhalten. Ein Anspruch auf die Gewährung von Zuwendungen<br />
besteht nicht.<br />
Was können die Bürger für ihr Dorf tun?<br />
Mit der Beschlussfassung der Gemeinde über die Dorferneuerungsplanung<br />
beginnt die Phase ihrer Verwirklichung. Diese Umsetzung,<br />
etwa die Durchführung von Modernisierungs-, Renovierungs-<br />
oder Umbaumaßnahmen, erfordert ihrerseits eine sorgfältige<br />
Beratung und Abstimmung mit den in der Planung niedergelegten<br />
Zielen der Dorferneuerung. Soweit den Gemeinden die entsprechenden<br />
Fachkenntnisse hierfür fehlen, sollen sie und auch die<br />
betreffenden Bauherren sich fachkundiger Betreuung eines außerhalb<br />
der öffentlichen Verwaltung tätigen Fachmanns bedienen<br />
können.<br />
Bewilligungsbehörde<br />
Die Mitwirkung der Dorfbewohner ist von entscheidender Bedeutung<br />
für das Gelingen der Dorferneuerung. Alle Bürger sind deshalb<br />
zur Mitwirkung aufgerufen. Das erfordert keine speziellen Fachkenntnisse,<br />
sondern gesunden Menschenverstand. Vor allem<br />
kommt es darauf an, dass sie<br />
Bewilligungsbehörde ist das Amt für Landentwicklung Göttingen, es<br />
hält auch die erforderlichen Antragsvordrucke bereit. Da Amt für<br />
Landentwicklung Göttingen setzt den zeitlichen und finanziellen<br />
Rahmen für die Förderung des einzelnen Dorfes fest, sobald die<br />
Dorferneuerungsplanung vorliegt und koordiniert ggf. den Einsatz<br />
anderer staatlicher Förderungsmittel. Anträge von Privatpersonen –<br />
nimmt die Stadt / Gemeinde entgegen; sie muss prüfen, ob die<br />
Anträge mit den Zielen der Dorferneuerungsplanung übereinstimmen.<br />
Antragsvordrucke können im Internet unter folgender Adresse<br />
heruntergeladen werden: www.gll.niedersachsen.de .<br />
- sich ihr Dorf genau ansehen;<br />
- darüber nachdenken, was zu erhalten ist und was neugestaltet<br />
werden könnte;<br />
- mit Nachbarn, Freunden und Ratsmitgliedern über die Probleme<br />
sprechen;<br />
- bei der Dorferneuerungsplanung durch Beteiligung an Bürgerversammlungen<br />
und Arbeitskreisen mitwirken;<br />
- eigene Maßnahmen planen und die Förderung beantragen.
Zuschusshöhe<br />
Das Land gewährt Zuschüsse bis zu 30 % der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben, höchstens 25.000 € je Maßnahme, bei öffentlichrechtlichen<br />
Zuwendungsempfängern auf die Nettokosten bis zu 50<br />
% der zuwendungsfähigen Ausgaben; für allgemeine Umnutzungsvorhaben<br />
können max. 75.000 € bzw. 150.000 für öffentlich Antragsteller<br />
je nach Fördertatbestand je Objekt gewährt werden.<br />
men des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) gefördert<br />
werden.<br />
- Den Neu-, Aus- und Umbau von land- und forstwirtschaftlichen<br />
Gemeinschaftsanlagen, z. B. Maschinenschuppen, Lagerhäuser,<br />
Gemeinschaftsställe.<br />
- Die Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz, die geeignet<br />
ist, außerlandwirtschaftliche Einkommen für landwirtschaftliche<br />
Betriebe zu erschließen.<br />
Das Land fördert<br />
- Die gestalterische, städtebauliche und landschaftspflegerische<br />
Betreuung, z. B bei der Vorbereitung von Beschlüssen zur<br />
Dorferneuerung, bei Bauanträgen, Bauvoranfragen pp., bei<br />
gestalterischen Details, bei Anträgen auf Förderung. Die Objektplanung<br />
selbst wird nicht im Rahmen der Betreuung, sondern<br />
bei den Kosten der Maßnahmen gefördert.<br />
Verbesserung des Wohnumfeldes und der Erschließung<br />
Zuschusshöhe auf die Nettokosten<br />
Zuschusshöhe<br />
Straßen, Wege und Gewässer sind die Grundlagen der innerörtlichen<br />
Strukturen. Sie haben sich unter Voraussetzungen entwickelt,<br />
die mit den heutigen nicht mehr übereinstimmen, insbesondere die<br />
Verkehrserschließung hat sich bis in die Nebenstraßen hinein<br />
einseitig an den Bedürfnissen des Autoverkehrs orientiert. Damit<br />
sind für das Zusammenleben im Dorf bedeutsame Räume verloren<br />
gegangen. Auch innerörtliche Gewässer standen der Verkehrserschließung<br />
häufig genug im Wege und wurden kurzerhand verrohrt.<br />
Eine Besinnung auf die überlieferten dorfgerechten Erschließungsformen<br />
ist dringend geboten. Besondere Aufmerksamkeit gebührt<br />
auch der Gestaltung des Dorfrandes als Verbindung des Siedlungsraumes<br />
mit der offenen Landschaft.<br />
Das Land gewährt Zuschüsse bis zu 30 % der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben, höchstens 25.000 € je Maßnahme; landwirtschaftliche<br />
Umnutzungsvorhaben können bis zu 30 % der zuwendungsfähigen<br />
Ausgabe, höchstens 75.000 € je Objekt, bezuschusst werden.<br />
Erhaltung des dörflichen Charakters<br />
Die Umsetzungsbegleitung kann mit bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben gefördert werden. Die Höhe der Zuwendung<br />
je Dorf ist für die Dauer im Dorferneuerungsprogramm auf<br />
30 000 EUR begrenzt.<br />
Bei umfangreichen Gruppen- oder Verbunddorferneuerungen<br />
kann die Zuwendung je Dorfentwicklungsplanung auf<br />
40 000 EUR erhöht werden.<br />
Grunderwerb, abgängige Bausubstanz<br />
Das Land fördert<br />
Die Erhaltung der Eigenart unserer ländlichen Siedlungen und ihre<br />
behutsame Fortentwicklung ist eine Hauptaufgabe der Dorferneuerung.<br />
Die überlieferte Bausubstanz, die Zuordnung der Gebäude<br />
zueinander sowie zu Straßen, Wegen und Plätzen sowie Bäume<br />
und typische ländliche Grünanlagen prägen das unverwechselbare<br />
Gesicht des Dorfes. Auch funktionsentleerte ehemals landwirtschaftliche<br />
Bausubstanz ist daher möglichst zu erhalten und sinnvoll<br />
zu nutzen. Die Modernisierung der Altbausubstanz begünstigt<br />
die Wiederbelegung der Ortskerne und sichert Arbeitsplätze im Ort.<br />
- Die Verbesserung des dörflichen Wohnumfeldes, z. B. durch<br />
dorfgerechten Ausbau oder Gestaltung von Straßenräumen,<br />
Plätzen, Fußgängerbereichen sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung,<br />
die Schaffung von Geh- und Radwegen sowie<br />
von Hofanschlüssen.<br />
- Die naturnahe Gestaltung, die Freilegung und Sanierung<br />
innerörtlicher Gewässer.<br />
- Die Anlage, Gestaltung und Vernetzung innerörtlicher Grünflächen<br />
und Grünzüge.<br />
- Die landschaftsgerechte Eingrünung des Dorfes und seiner<br />
Umgebung.<br />
- Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefahren, z. B.<br />
Regenwasserrückhaltebecken zum Schutz der Ortslage und<br />
Anlagen zur schadlosen Abführung des Oberflächenwassers.<br />
Zuschusshöhe<br />
Das Land fördert<br />
Der ungezügelte Abbruch überlieferter reparaturbedürftiger oder<br />
funktionsloser Bausubstanz hat maßgeblich zum Gesichtsverlust<br />
vieler Dörfer beigetragen. Nicht immer konnten die entstandenen<br />
Lücken ohne nachhaltige Schäden für das Ortsbild geschlossen<br />
werden. Hofflächen und Gebäude wurden durch überdimensionierte<br />
Parkplätze oder städtisch anmutende unmaßstäbliche Baukörper<br />
ersetzt. Erhaltenswert ist ein Gebäude allerdings nicht schon deshalb,<br />
weil es alt ist. Das Dorf muss sich fortentwickeln können,<br />
wenn es heutigen Funktionsansprüchen genügen soll. In manchen<br />
Fällen wird daher der Abbruch unumgänglich sein. Aber es sollte<br />
der letzte Schritt sein, eine Entscheidung, die reiflich überlegt ist.<br />
- Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung dörflicher Bausubstanz,<br />
wenn sie nach den Feststellungen der Dorferneuerungsplanung<br />
ortsbildprägender Charakter hat, z. B. Maßnahmen an<br />
Grundmauern, Fassaden, Türen, Fenstern und Dächern. Der Innenausbau<br />
wird in dem Umfang gefördert, der zur Erhaltung des<br />
Gebäudes konstruktiv erforderlich ist.<br />
- Kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und<br />
Gestaltung des dörflichen Charakters, z. B. die Herstellung und<br />
Verbesserung von Brunnen, Stützmauern, Zäunen und anderen<br />
ortstypischen Bauwerken sowie von Beleuchtungskörpern.<br />
Die Umnutzung ortsbildprägender Gebäude für Wohn-, Arbeitssowie<br />
Fremdenverkehrszwecke oder Funktionen, die das dörfliche<br />
Gemeinwesen stärken. Die Umnutzung ortsbildprägender Gebäude<br />
bedarf bei privaten Antragstellern immer einer nationalen Kofinanzierung,<br />
weil diese Förderziffer außerhalb der GAK liegt.<br />
Eine Ausnahme bilden Anträge landwirtschaftlicher Betriebe. Diese<br />
können Umnutzungsmaßnahmen über die RL-Ziffer Diversifizierung<br />
auch im Rahmen der GAK gefördert bekommen ( außerhalb der<br />
Dorferneuerung).<br />
Das Land fördert<br />
- Den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken<br />
einschließlich in der Dorferneuerungsplanung besonders begründeter<br />
Abbruchmaßnahmen im Zusammenhang mit infrastruktureller<br />
Maßnahmen der Dorferneuerung sowie Maßnahmen<br />
für land- und forstwirtschaftliche Gemeinschaftsanlagen.<br />
Maßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe<br />
Das Land gewährt Zuschüsse bei öffentlich-rechtlichen Zuwendungsempfängern<br />
auf die Nettokosten bis zu 50 % der zuwendungsfähigen<br />
Ausgaben.<br />
Internet: www.gll.niedersachsen.de und www.ml.niedersachsen.de<br />
Ansprechpartner zur Dorferneuerung <strong>Ballenhausen</strong>:<br />
Gemeinde Friedland - Frau Bruder<br />
Bönneker Str. 2 - 37133 Groß Schneen<br />
Tel.: 05504-80238 / E-Mail: bruder@friedland.de<br />
Dorferneuerung soll die ländlichen Siedlungen als Standort landund<br />
forstwirtschaftlicher Betriebe erhalten und deren Entwicklungsmöglichkeiten<br />
im Dorf sichern. Neben den Arbeits- und Produktionsbedingungen<br />
sind dabei auch die allgemeinen Lebensverhältnisse<br />
der bäuerlichen Familien zu verbessern. Für das konfliktfreie<br />
Miteinander der vielfältigen Funktionen des heutigen Dorfes ist<br />
auch bedeutsam, die Umweltwirkungen der Landwirtschaft mit den<br />
Bedürfnissen zeitgemäßen Wohnens in Einklang zu bringen. Wichtig<br />
ist ferner, landwirtschaftlichen Betrieben aufgrund des Strukturwandels<br />
die Möglichkeit alternativer Einkommen zu erschließen.<br />
Amt für Landentwicklung Göttingen – Andreas Ochmann<br />
Danziger Straße 40 - 37083 Göttingen Tel.: 0551/5074-207<br />
E-Mail: Andreas.Ochmann@gll-nom.niedersachsen.de<br />
Das Land fördert<br />
Planungsbüro Hajo Brudniok Gotteslager 3 c –<br />
37081 Göttingen / Tel. 0551-6345600 / Fax: 6345606<br />
E-Mail: info@hajobrudniok.de<br />
- Maßnahmen, die geeignet sind, land- und fortwirtschaftliche<br />
Bausubstanz einschließlich Nebengebäuden und Hofräumen an<br />
die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens anzupassen,<br />
vor Einwirkungen von außen zu schützen oder in das Ortsbild<br />
oder in die Landschaft einzubinden, wenn sie nicht im Rah