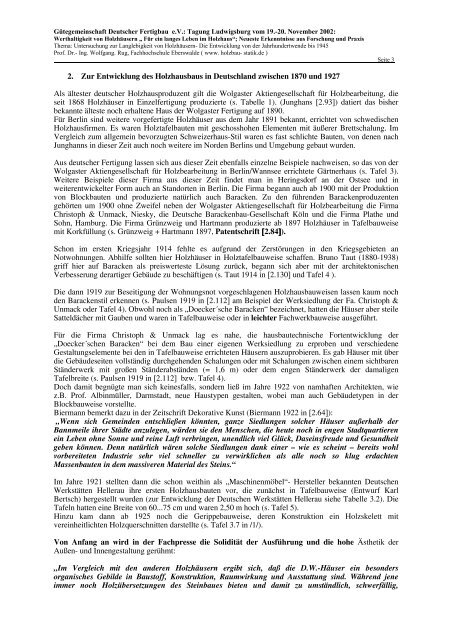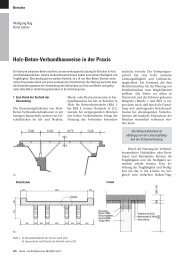Download - Dr. Rug & Partner
Download - Dr. Rug & Partner
Download - Dr. Rug & Partner
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau e.V.: Tagung Ludwigsburg vom 19.-20. November 2002:<br />
Werthaltigkeit von Holzhäusern „ Für ein langes Leben im Holzhaus“; Neueste Erkenntnisse aus Forschung und Praxis<br />
Thema: Untersuchung zur Langlebigkeit von Holzhäusern- Die Entwicklung von der Jahrhundertwende bis 1945<br />
Prof. <strong>Dr</strong>.- Ing. Wolfgang. <strong>Rug</strong>, Fachhochschule Eberswalde ( www. holzbau- statik.de )<br />
2. Zur Entwicklung des Holzhausbaus in Deutschland zwischen 1870 und 1927<br />
Als ältester deutscher Holzhausproduzent gilt die Wolgaster Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung, die<br />
seit 1868 Holzhäuser in Einzelfertigung produzierte (s. Tabelle 1). (Junghans [2.93]) datiert das bisher<br />
bekannte älteste noch erhaltene Haus der Wolgaster Fertigung auf 1890.<br />
Für Berlin sind weitere vorgefertigte Holzhäuser aus dem Jahr 1891 bekannt, errichtet von schwedischen<br />
Holzhausfirmen. Es waren Holztafelbauten mit geschosshohen Elementen mit äußerer Brettschalung. Im<br />
Vergleich zum allgemein bevorzugten Schweizerhaus-Stil waren es fast schlichte Bauten, von denen nach<br />
Junghanns in dieser Zeit auch noch weitere im Norden Berlins und Umgebung gebaut wurden.<br />
Aus deutscher Fertigung lassen sich aus dieser Zeit ebenfalls einzelne Beispiele nachweisen, so das von der<br />
Wolgaster Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung in Berlin/Wannsee errichtete Gärtnerhaus (s. Tafel 3).<br />
Weitere Beispiele dieser Firma aus dieser Zeit findet man in Heringsdorf an der Ostsee und in<br />
weiterentwickelter Form auch an Standorten in Berlin. Die Firma begann auch ab 1900 mit der Produktion<br />
von Blockbauten und produzierte natürlich auch Baracken. Zu den führenden Barackenproduzenten<br />
gehörten um 1900 ohne Zweifel neben der Wolgaster Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung die Firma<br />
Christoph & Unmack, Niesky, die Deutsche Barackenbau-Gesellschaft Köln und die Firma Plathe und<br />
Sohn, Hamburg. Die Firma Grünzweig und Hartmann produzierte ab 1897 Holzhäuser in Tafelbauweise<br />
mit Korkfüllung (s. Grünzweig + Hartmann 1897, Patentschrift [2.84]).<br />
Schon im ersten Kriegsjahr 1914 fehlte es aufgrund der Zerstörungen in den Kriegsgebieten an<br />
Notwohnungen. Abhilfe sollten hier Holzhäuser in Holztafelbauweise schaffen. Bruno Taut (1880-1938)<br />
griff hier auf Baracken als preiswerteste Lösung zurück, begann sich aber mit der architektonischen<br />
Verbesserung derartiger Gebäude zu beschäftigen (s. Taut 1914 in [2.130] und Tafel 4 ).<br />
Die dann 1919 zur Beseitigung der Wohnungsnot vorgeschlagenen Holzhausbauweisen lassen kaum noch<br />
den Barackenstil erkennen (s. Paulsen 1919 in [2.112] am Beispiel der Werksiedlung der Fa. Christoph &<br />
Unmack oder Tafel 4). Obwohl noch als „Doecker´sche Baracken“ bezeichnet, hatten die Häuser aber steile<br />
Satteldächer mit Gauben und waren in Tafelbauweise oder in leichter Fachwerkbauweise ausgeführt.<br />
Für die Firma Christoph & Unmack lag es nahe, die hausbautechnische Fortentwicklung der<br />
„Doecker´schen Baracken“ bei dem Bau einer eigenen Werksiedlung zu erproben und verschiedene<br />
Gestaltungselemente bei den in Tafelbauweise errichteten Häusern auszuprobieren. Es gab Häuser mit über<br />
die Gebäudeseiten vollständig durchgehenden Schalungen oder mit Schalungen zwischen einem sichtbaren<br />
Ständerwerk mit großen Ständerabständen (= 1,6 m) oder dem engen Ständerwerk der damaligen<br />
Tafelbreite (s. Paulsen 1919 in [2.112] bzw. Tafel 4).<br />
Doch damit begnügte man sich keinesfalls, sondern ließ im Jahre 1922 von namhaften Architekten, wie<br />
z.B. Prof. Albinmüller, Darmstadt, neue Haustypen gestalten, wobei man auch Gebäudetypen in der<br />
Blockbauweise vorstellte.<br />
Biermann bemerkt dazu in der Zeitschrift Dekorative Kunst (Biermann 1922 in [2.64]):<br />
„Wenn sich Gemeinden entschließen könnten, ganze Siedlungen solcher Häuser außerhalb der<br />
Bannmeile ihrer Städte anzulegen, würden sie den Menschen, die heute noch in engen Stadtquartieren<br />
ein Leben ohne Sonne und reine Luft verbringen, unendlich viel Glück, Daseinsfreude und Gesundheit<br />
geben können. Denn natürlich wären solche Siedlungen dank einer – wie es scheint – bereits wohl<br />
vorbereiteten Industrie sehr viel schneller zu verwirklichen als alle noch so klug erdachten<br />
Massenbauten in dem massiveren Material des Steins.“<br />
Im Jahre 1921 stellten dann die schon weithin als „Maschinenmöbel“- Hersteller bekannten Deutschen<br />
Werkstätten Hellerau ihre ersten Holzhausbauten vor, die zunächst in Tafelbauweise (Entwurf Karl<br />
Bertsch) hergestellt wurden (zur Entwicklung der Deutschen Werkstätten Hellerau siehe Tabelle 3.2). Die<br />
Tafeln hatten eine Breite von 60...75 cm und waren 2,50 m hoch (s. Tafel 5).<br />
Hinzu kam dann ab 1925 noch die Gerippebauweise, deren Konstruktion ein Holzskelett mit<br />
vereinheitlichten Holzquerschnitten darstellte (s. Tafel 3.7 in /1/).<br />
Von Anfang an wird in der Fachpresse die Solidität der Ausführung und die hohe Ästhetik der<br />
Außen- und Innengestaltung gerühmt:<br />
„Im Vergleich mit den anderen Holzhäusern ergibt sich, daß die D.W.-Häuser ein besonders<br />
organisches Gebilde in Baustoff, Konstruktion, Raumwirkung und Ausstattung sind. Während jene<br />
immer noch Holzübersetzungen des Steinbaues bieten und damit zu umständlich, schwerfällig,<br />
Seite 3