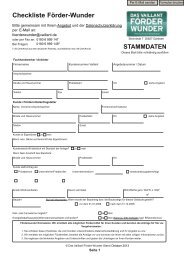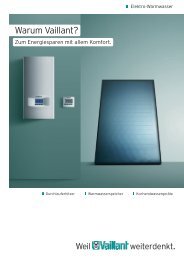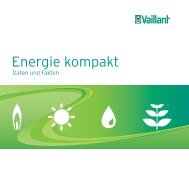EigenHeim - Vaillant
EigenHeim - Vaillant
EigenHeim - Vaillant
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Welche Heizung ist die richtige?<br />
Eine Übersicht über moderne<br />
Heizungslösungen, Trends und<br />
Zukunftstechnologien<br />
Medienpartner:<br />
<strong>EigenHeim</strong> genHe<br />
BAUEN WOHNEN LEBEN<br />
Leitfaden für Bauherren und Modernisierer<br />
Mit<br />
10-Punkte-<br />
Check<br />
Schutzgebühr: 5 Euro
Heiztechnik im Überblick<br />
E<br />
Solarkollektoren (A)<br />
G<br />
Flachkollektor ..................................................30<br />
Röhrenkollektor ............................................32<br />
A<br />
Ein- und Zweifamilienhaus<br />
Wärmepumpen (B)<br />
Sole-Wasser-WP ...........................................20<br />
Wasser-Wasser-WP ...................................22<br />
Luft-Wasser-WP .............................................24<br />
Split-WP ....................................................................26<br />
C<br />
B<br />
Wohnungslüftung (C)<br />
Wohnungslüftung ......................................48<br />
Klimageräte ........................................................50
Mehrfamilienhaus<br />
Zukunftstechnologien (D)<br />
E<br />
Zeolith-Gas-Wärmepumpe...........42<br />
Mini-Blockheizkraftwerk .................44<br />
Brennwertgeräte (E)<br />
Gas-Brennwert ...................................................8<br />
Öl-Brennwert ......................................................10<br />
A<br />
D F G<br />
Heizkessel (F)<br />
Pelletheizung ...................................................28<br />
Hackschnitzelheizung .........................34<br />
Holzvergaserkessel .................................36<br />
Warmwasserspeicher (G)
Vorwort ............................................................................................................................................................................................................................................... 1<br />
Welche Heizung ist die richtige für mich? ............................................................................................................................... 2<br />
Der 10-Punkte-Check ... .......................................................................................................................................................................................... 4<br />
... für Ihre Heizung im Neubau ............................................................................................................................................................ 4<br />
... für Ihre Heizungsmodernisierung .......................................................................................................................................... 5<br />
Überblick über moderne Heiztechnik<br />
Technologien auf Basis fossiler Energien ..................................................................................................................... 6<br />
Gas-Brennwertgeräte ........................................................................................................................................................................... 8<br />
Öl-Brennwertgeräte ............................................................................................................................................................................. 10<br />
Öl- und Gas-Heizwertgeräte ..................................................................................................................................................... 12<br />
Fernwärme .......................................................................................................................................................................................................... 14<br />
Technologien auf Basis erneuerbarer Energien .............................................................................................. 16<br />
Wärmepumpen ............................................................................................................................................................................................. 18<br />
Sole-Wasser-Wärmepumpe .......................................................................................................................................... 20<br />
Wasser-Wasser-Wärmepumpe ................................................................................................................................ 22<br />
Luft-Wasser-Wärmepumpe .......................................................................................................................................... 24<br />
Split-Wärmepumpe ................................................................................................................................................................... 26<br />
Pelletheizung ................................................................................................................................................................................................. 28<br />
Solarkollektoren ........................................................................................................................................................................................ 30<br />
Flachkollektor ......................................................................................................................................................................................30<br />
Röhrenkollektor ............................................................................................................................................................................. 32<br />
Hackschnitzelkessel ............................................................................................................................................................................ 34<br />
Holzvergaserkessel .............................................................................................................................................................................. 36<br />
Kaminöfen .......................................................................................................................................................................................................... 38<br />
Trends und Zukunftstechnologien ........................................................................................................................................ 40<br />
Zeolith-Gas-Wärmepumpe ........................................................................................................................................................ 42<br />
Mini-Blockheizkraftwerke/KWK ........................................................................................................................................ 44<br />
Begleitende Systeme ...................................................................................................................................................................... 46<br />
Wohnungslüftung .................................................................................................................................................................................. 48<br />
Klimageräte .................................................................................................................................................................................................... 50<br />
Warmwasserspeicher ........................................................................................................................................................................ 52<br />
Regelungstechnik .................................................................................................................................................................................. 54<br />
Gesetze/Verordnungen/Fördergelder ....................................................................................................................................... 56<br />
Gesetze .............................................................................................................................................................................................................................. 58<br />
Verordnungen/Fördermittel .............................................................................................................................................................. 59<br />
Kleine Geschichte der Heiztechnik ......................................................................................................................................... 62<br />
Aktuelle Förderstufen in Alt- und Neubau .............................................................................................................................. 64
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
Sie befi nden sich auf der Suche nach einer neuen Heizanlage? Um welt bewusste Bau-<br />
herren und Modernisierer können ihre Heizkosten deutlich reduzieren und gleichzeitig<br />
einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Einsparung von CO2-Emissionen leisten. Energieeffi ziente Heiz systeme senken die Heizkosten und die CO2-Emis sionen<br />
um durchschnittlich 30 Prozent. Beim Einsatz von Technologien auf Basis erneuerbarer<br />
Energien erhöht sich dieser Wert noch einmal.<br />
Der Heiztechnikmarkt ist gegenüber früheren Zeiten deutlich komplexer geworden.<br />
Neben konventionellen Heiztechniken auf Basis fossiler Brennstoffe rücken immer<br />
stärker Produkte in den Fokus, die regenerative Energien wie Sonnenenergie, Erdwärme<br />
und Holz nutzen. Dazu zählen Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung,<br />
Wärmepumpen und Holzpelletkessel. Eine moderne Heizung ist heute<br />
ein komplexes System, das effi ziente Heiztechnik intelligent mit Technologien auf Basis<br />
erneuerbarer Energien verknüpft. Die Auswahlmöglichkeiten sind vielfältig und scheinen<br />
häufi g nur wahren Heiztechnikexperten verständlich. Das muss nicht so sein.<br />
Der vorliegende Ratgeber soll Ihnen als Leitfaden und Entscheidungshilfe bei Ihrer Wahl<br />
einer modernen, umweltfreundlichen und sparsamen Heizungsanlage dienen. Einfach<br />
und übersichtlich zeigen wir Ihnen die wichtigsten Technologien und Entwicklungen.<br />
Gleichermaßen präsentieren wir Ihnen aktuelle Fördermöglichkeiten, Weblinks sowie<br />
eine übersichtliche Liste der Kernaspekte eines Heizungskaufs. Schon heute leistet<br />
moderne und energieeffi ziente Heiztechnik einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der<br />
weltweiten Klimaprobleme. Nutzen Sie diese Möglichkeiten, erhöhen Sie Ihre Unabhängigkeit,<br />
und sparen Sie damit auch noch Heizkosten ein.<br />
Eine aufschlussreiche Lektüre wünschen Ihnen<br />
Ralf-Otto Limbach Stefan Kriz<br />
Geschäftsführer <strong>Vaillant</strong> Group Chefredakteur Mein <strong>EigenHeim</strong><br />
und Wohnen&Leben<br />
1
2<br />
Welche Heizung ist die richtige für mich?<br />
Der Einbau einer energieeffi zienten Heizung entlastet den Geldbeutel<br />
vom ersten Tag an. Gas- und Ölkessel, Wärmepumpe, Pelletheizung oder<br />
Blockheizkraftwerk – Sie haben die Wahl. Jedoch ist es mit der Heizung<br />
wie bei der Partnerwahl: Längst nicht jede passt zu einem selbst.<br />
Damit die Wahl nicht zur Qual wird, sollten Sie gemeinsam mit Ihrem<br />
Heizungsfachmann die folgenden Fragen beantworten.<br />
1. Neubau oder Bestandsbau?<br />
Die einfachste Frage, die jedoch entscheidend ist für die Auslegung Ihrer Heizung. Der<br />
Wärmebedarf bei einem 25 Jahre alten Einfamilienhaus ist etwa um die Hälfte höher als<br />
bei einem zehn Jahre alten Haus – ganz zu schweigen von einem Neubau.<br />
2. Wie wohnen Sie?<br />
Etagenwohnung, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus? Die Frage nach der Größe ist<br />
entscheidend für die richtige Dimensionierung der neuen Heizungsanlage. Bringen Sie<br />
zum Beratungsgespräch einen Grundriss Ihres Hauses/Ihrer Wohnung mit. Wenn Sie<br />
keinen Energieausweis für Ihr Haus besitzen, bringen Sie zumindest eine Übersicht mit<br />
den Heizkosten bzw. dem Brennstoffverbrauch der letzten drei Jahre mit.<br />
3. Heizen oder Warmwassererzeugung oder beides?<br />
Defi nieren Sie im Voraus die Aufgaben Ihrer Heizung und klären Sie dabei die folgenden<br />
Punkte: Besitzt Ihr Haus/Ihre Wohnung lediglich ein Badezimmer mit Badewanne oder<br />
Dusche, sind zwei oder gar mehrere Bäder gleichzeitig in Betrieb oder ist sogar eine<br />
Wellnesseinrichtung (Sauna, Schwimmbad) vorhanden? Anhand dieser Angaben ermittelt<br />
Ihr Fachhandwerker den Warmwasserbedarf und die Größe Ihres Warmwasserspeichers.<br />
4. Wie groß ist der Wärmebedarf?<br />
Die Anzahl der Personen im Haushalt und die zu beheizende Fläche sind wichtige Werte<br />
für die Auslegung Ihrer Heizung. Bei einem Bestandsbau empfi ehlt sich die ganzheit liche<br />
Betrachtung des Gebäudes. Unter Umständen kann durch neue Fenster, ein neues Dach<br />
oder durch die Dämmung der Außenwand der Wärmebedarf insgesamt reduziert<br />
werden. Dazu kann Sie Ihr Fachhandwerker oder ein zertifi zierter Energieberater beraten.<br />
5. Welche baulichen Voraussetzungen sind vorhanden?<br />
Für eine Gasheizung benötigen Sie natürlich einen Gasanschluss. Bei den Brennstoffen<br />
Heizöl und Holz ist ein separater Lagerraum erforderlich. Nicht jedes Gebäude verfügt über
einen Schornstein – Heizen ohne Schornstein ist mit Hilfe einer Wärmepumpe problemlos<br />
möglich. Ihr Fachhandwerker kann Ihnen überdies eine Lösung aufzeigen, wie man<br />
energie effi ziente Brennwerttechnik in Gebäude ohne gemauerten Schornstein integriert.<br />
6. Welche Energiequelle darf es sein?<br />
Auch bei den Energiequellen hat der Heizungskäufer die Qual der Wahl: Sonne, Erdwärme,<br />
Biomasse oder doch bewährte und hocheffi ziente Technologien auf Basis von Öl und<br />
Gas. Sie können auch die unterschiedlichen Möglichkeiten geschickt miteinander kom bi nieren<br />
und moderne Technologien auf Basis erneuer barer Energien in ein bereits bestehendes<br />
System integrieren. Bedingung ist dabei ausreichender Stellplatz im Heizraum.<br />
7. Wo soll der neue Kessel stehen?<br />
Oft bietet der Keller nur wenig Platz. In manchen Fällen gibt es gar keinen Keller. Kein<br />
Problem – Heizungen können auch auf dem Dachboden, im Hauswirtschaftsraum oder<br />
unauffällig in den Wohnraum integriert werden.<br />
8. Welche Wärmeverteiler bevorzugen Sie?<br />
Soll es die Fußbodenheizung sein, oder bleibt es beim klassischen Heizkörper? Heizleisten<br />
oder eine Wandheizung sind ebenfalls möglich. Generell gilt: Je größer die Fläche für<br />
die Wärme übertragung ist, desto geringere Temperaturen muss die Heizung produzieren<br />
und desto effi zienter arbeitet sie. Auch hier hilft der Rat des Fachhandwerkers, der weiß,<br />
wie in Bestandsbauten größere Wärmeübertragungsfl ächen integriert werden können.<br />
9. Was darf es sonst noch sein?<br />
Moderne Heizanlagen sind komplexe Systeme mit vielfältigen Ergänzungsmöglichkeiten:<br />
Solar, Klima, Lüftung, Kühlung, Warmwasserspeicher. Ein Fachhandwerker zeigt Ihnen<br />
auf, ob die Warmwasserbereitung über einen Solarkollektor, der Einbau einer Klimaanlage<br />
oder die Ergänzung um kontrollierte Wohnungslüftung in Ihrem Haus Sinn macht.<br />
10. Was sagt der Geldbeutel?<br />
Eine neue Heizungsanlage kostet Geld, senkt aber auch die laufenden Kosten. Mit<br />
richtiger Planung und Beratung lassen sich die Investitionen aber deutlich reduzieren.<br />
Nicht alle Investitionen müssen auf einmal getätigt werden. Denken Sie schon heute an<br />
Ihre Bedürfnisse von morgen, und legen Sie zumindest die Anschlüsse für eine spätere<br />
Nachrüstung.<br />
Die Details Ihrer neuen Heizungsanlage sollten mit dem Heizungsfachmann Ihrer Wahl<br />
abgestimmt werden, damit eine passgenaue Heizungsanlage entsteht. Kompetente<br />
Ansprechpartner fi nden Sie auch unter<br />
http://www.vaillant.de/Privatkunden/Ihr-Partner-vor-Ort<br />
3
4<br />
Der 10-Punkte-Check ...<br />
Hier fi nden Sie die wichtigsten Schritte aufgelistet, die Sie schnell,<br />
sicher und sauber zu Ihrem neuen Heizungssystem führen.<br />
Neubau<br />
... für Ihre Heizung im Neubau<br />
1. Legen Sie mit Ihrem Architekten bzw. Energieberater den Energiestandard Ihres<br />
Neubaus und die Energieart(en) fest: Gas, Öl und/oder regenerative Energien.<br />
2. Überlegen Sie, wie und in welchem Umfang Sie ökologische Alternativen ein -<br />
setzen wollen: Solarthermie, Pelletheiztechnik oder Wärmepumpentechnik?<br />
3. Bestimmen Sie Art und Ort Ihrer neuen Heizung: Brennwert- oder Heizwert -<br />
technik mit Gas oder Öl; Keller, Parterre oder Dach?<br />
4. Falls Sie sich für Verbrennungstechnik entscheiden, sprechen Sie mit Ihrem<br />
Schornsteinfeger oder Fachhandwerker, um den Verlauf Ihrer Abgasleitung<br />
zu bestimmen.<br />
5. Lassen Sie heute schon Leitungen für eine spätere Solarnutzung legen, und planen<br />
Sie mögliche Ergänzungen wie Klimageräte oder Lüftungssysteme ebenfalls mit ein.<br />
6. Entscheiden Sie zusammen mit Ihrem Heizungsfachmann, welche Wärmeverteilung<br />
eingesetzt werden soll: Radiatoren und/oder Fußbodenheizung?<br />
7. Legen Sie die Warmwasserversorgung fest: zentral über z.B. einen Warmwasserspeicher<br />
im Keller und/oder dezentral mit einem Durchlauferhitzer?<br />
8. Informieren Sie sich über Finanzierungen und Fördermittel und stellen Sie<br />
frühzeitig Ihre Anträge.<br />
9. Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachbetrieb den Installationstermin nach Genehmigung<br />
der Fördermittel und/oder Kredite.<br />
10. Lassen Sie Ihre neue Anlage von Ihrem Schornsteinfeger abnehmen (gilt nur<br />
bei Verbrennungstechnik) und vom Fachhandwerker erklären.
... für Ihre Heizungsmodernisierung<br />
Bestandsbau<br />
1. Informieren Sie Ihren Fachhandwerker oder Energieexperten über Ihr<br />
Sanierungsvorhaben.<br />
2. Auf dieser Basis berät Sie Ihr Fachhandwerker über Ihre Möglichkeiten zur<br />
Heizungsmodernisierung.<br />
3. Fragen Sie nach wirtschaftlichen Alternativen wie Brennwerttechnik,<br />
Pelletheizsystemen oder Wärmepumpen.<br />
4. Überprüfen Sie mit Ihrem Installateur, wie und wo Sie heute schon Leitungen<br />
für eine spätere Solarnutzung integrieren können.<br />
5. Bestimmen Sie Energieträger, Standort und Art Ihres neuen Systems.<br />
6. Denken Sie auch über Möglichkeiten zur Kühlung und zur kontrollierten<br />
Wohnungslüftung nach.<br />
7. Informieren Sie sich über Finanzierungen und Fördermittel, und stellen Sie<br />
frühzeitig Ihre Anträge.<br />
8. Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachbetrieb den Installationstermin nach Genehmigung<br />
der Fördermittel und/oder Kredite.<br />
9. Lassen Sie Ihre neue Heizungsanlage von Ihrem Fachhandwerker installieren.<br />
10. Lassen Sie Ihre neue Anlage von Ihrem Schornsteinfeger abnehmen (gilt nur<br />
bei Verbrennungstechnik) und vom Fachhandwerker erklären.<br />
5
Technologien auf Basis<br />
6<br />
fossiler Energien
Erdöl und Erdgas sind zwei Hauptstützen des deutschen Primärenergieverbrauchs.<br />
Öl und Gas haben als Energieträger noch lange<br />
nicht ausgedient, wenn sie mit einem modernen Brennwertgerät<br />
optimal genutzt werden.<br />
Eine Ölheizung ist schnell montiert und arbeitet zuverlässig, eine Gasheizung<br />
beansprucht nur wenig Platz und lässt sich überall im Haus aufstellen. Moderne<br />
Brennwerttechnik erzielt dabei höchste Effi zienzgrade und nutzt die Möglichkeiten<br />
zur Wärmeerzeugung bis an die Grenzen des physikalisch Machbaren aus. So<br />
erzielen Sie den maximalen Ertrag und sparen gleichermaßen Heizkosten und<br />
CO2-Emissionen. Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über energieeffi -<br />
ziente Möglichkeiten auf Basis fossiler Energieträger.<br />
Technologien auf Basis<br />
fossiler Energien
Technologien auf Basis<br />
fossiler Energien<br />
8<br />
Gas-Brennwertgeräte<br />
Brennwertgeräte nutzen im Vergleich zu herkömmlichen Heizgeräten die im Abgas<br />
enthaltene Wärmeenergie, die ansonsten durch den Schornstein verloren geht. Der im<br />
Abgas enthaltene Wasserdampf wird verfl üssigt, und ihm wird durch die Kondensation<br />
die noch enthaltene Wärmeenergie entzogen. Diese wird dem Heizkreislauf zugeführt.<br />
Der Wärmeverlust wird dadurch geringer, und somit verbraucht die Heizung weniger<br />
Energie. Gas-Brennwertgeräte erreichen Wirkungsgrade, die kurz vor der physikalischen<br />
Grenze liegen. Beim Einbau von Brennwerttechnik muss unter Umständen ein bestehender<br />
Schornstein um ein Kunststoffrohr ergänzt werden.<br />
Anwendungen<br />
Gas-Brennwerttechnik eignet sich sowohl zur Modernisierung von Bestandsbauten als<br />
auch für Neubauten.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Zur effektiven Nutzung des Brennwerts sollte die gesamte Heizungsanlage für<br />
niedrige Systemtemperaturen (Vorlauf-/Rücklauftemperatur) ausgelegt sein<br />
- Selbst in Anlagen, die auf Temperaturen von 80/60 °C ausgelegt sind, wird ebenfalls<br />
ein deutlich höherer Nutzungsgrad gegenüber konventionellen Heizgeräten erreicht<br />
- Gasanschluss notwendig<br />
- Unter Umständen Schornsteinergänzung notwendig<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Kann nahezu überall im Haus eingesetzt werden<br />
- Keine separate Lagervorrichtung für Gas notwendig<br />
- Geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand, da Gas sauber verbrennt<br />
- Fossiler Energieträger<br />
- Optimale Energieausnutzung<br />
- Emissionen liegen weit unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte<br />
- Geringe Einmalinvestition<br />
- Leichte Montage<br />
- Brennwertgeräte benötigen rund 30 Prozent weniger Energie als alte Heizkessel<br />
- CO2-Emissionen sinken um bis zu 30 Prozent
Brennwertgeräte sind<br />
platzsparend und überall<br />
im Haus integrierbar.<br />
Brennwertgeräte sind<br />
fl exibel kombinierbar – z.B.<br />
mit Solarkollektoren, Lüftungsanlagen,<br />
Warmwasserspeichern und<br />
mit intelligenter Regelungstechnik.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Gute Versorgungssicherheit – Erdgas ist länger verfügbar als Erdöl<br />
- Langfristige Versorgungssicherheit beim Einsatz von Bio-Erdgas<br />
- Die Gasinfrastruktur ist sehr gut ausgebaut<br />
Unabhängigkeit<br />
- Langfristige Vorkommen<br />
- Alternative Gaserzeugung durch Biogas<br />
- Zukünftig geringere Abhängigkeit aufgrund des Baus neuer Versorgungswege<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasserspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
9
10<br />
Öl-Brennwertgeräte<br />
Brennwertgeräte nutzen zusätzlich die im Abgas enthaltene Energie und führen sie<br />
dem Wärme- und Warmwasserkreislauf nahezu komplett wieder zu. Dabei funktionieren<br />
Öl-Brennwertgeräte nach demselben Prinzip wie gasbetriebene Brennwertgeräte:<br />
Der im Abgas enthaltene Wasserdampf wird verfl üssigt, ihm wird durch die Kondensation<br />
die noch enthaltene Wärmeenergie entzogen, und diese wird dem Heizkreislauf<br />
zugeführt. Der Wärmeverlust wird dadurch geringer, und somit verbraucht die Heizung<br />
weniger Energie. Eine weitere Effi zienzsteigerung bei der Ausnutzung von Öl ist kaum<br />
noch möglich. Beim Einbau von Brennwerttechnik muss unter Umständen ein bestehender<br />
Schornstein um ein Kunststoffrohr ergänzt werden.<br />
Anwendungen<br />
Für Modernisierung und Neubau geeignet.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Lagerraum für Heizöl notwendig<br />
- Zur effektiven Nutzung des Brennwerts sollte die gesamte Heizungsanlage für<br />
niedrige Systemtemperaturen (Vorlauf-/Rücklauftemperatur) ausgelegt sein<br />
- Selbst in Anlagen, die auf Temperaturen von 80/60 °C ausgelegt sind, wird ebenfalls<br />
ein deutlich höherer Nutzungsgrad gegenüber konventionellen Heizgeräten erreicht<br />
- Unter Umständen Schornsteinergänzung notwendig<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Sehr effi zienter Energieeinsatz<br />
- Brennwertgeräte benötigen rund 30 Prozent weniger Energie als alte Heizkessel<br />
- CO2-Emissionen sinken um bis zu 30 Prozent<br />
- Leichte Montage<br />
- Geringe Einmalinvestitionskosten<br />
- Einfache hydraulische Einbindung auch in komplexe Anlagen<br />
- Basiert auf fossilen Energieträgern<br />
- Platz für Öltank nötig
Energieeffi ziente Brennwertgeräte sparen gegenüber<br />
alten Heizgeräten rund 30 Prozent der Energie ein.<br />
Brennwertgeräte nutzen<br />
zusätzlich die in den Abgasen<br />
enthaltende Energie zur Wärmeerzeugung<br />
und erzielen so<br />
hohe Nutzungsgrade.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Mittlere Versorgungssicherheit aufgrund der Endlichkeit der weltweiten Ölvorräte<br />
Unabhängigkeit<br />
- Eingeschränkt wegen weltweit steigender Ölnachfrage<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung und zur Trinkwassererwärmung<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasserspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
11
12<br />
Öl- und Gas-Heizwertgeräte<br />
Die Heizwerttechnik stellt eine konventionelle Lösung dar, um den Wärmebedarf eines<br />
Gebäudes abzudecken. Bei der Heizwerttechnik wird die im Abgas enthaltene Wärme<br />
nur so weit genutzt, dass es zu keiner Kondensation des Wasserdampfanteils im Schornstein<br />
kommen kann. Auf diese Weise können bestehende Schornsteine unverändert<br />
weitergenutzt werden. Zudem können die heißen Abgase aufgrund ihres natürlichen<br />
Auftriebs ohne den Einbau eines zusätzlichen Gebläses über den Schornstein abgeführt<br />
werden. Die Energieeffi zienz ist deutlich geringer als bei der Brennwerttechnik.<br />
Anwendungen<br />
Für Modernisierung geeignet.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Bei Gas: keine separate Lagervorrichtung notwendig<br />
- Bei Öl: Lagerraum für Heizöl notwendig<br />
- Geringer Platzbedarf<br />
- Bei Gas: geeignet für Keller, Wohnraum oder Montage im Dachgeschoss<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Leichte Montage<br />
- Geringe Einmalinvestition<br />
- Heizwerttechnik mit geringer Effi zienz: höhere CO2-Emission als bei<br />
Brennwerttechnik oder beim Einsatz von erneuerbaren Energien<br />
- Fossiler Energieträger<br />
- Technik entspricht nicht dem aktuellen Standard
Zukunftssicherheit<br />
- Eingeschränkte Zukunftssicherheit, da Heizwerttechnik nicht mehr den aktuellen<br />
Energieeffi zienz-Standards entspricht<br />
Unabhängigkeit<br />
- Öl: eingeschränkt wegen weltweit steigender Ölnachfrage<br />
- Gas: höhere Versorgungssicherheit, da länger verfügbar als Öl<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung und zur Trinkwassererwärmung<br />
- Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasserspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
υ<br />
Heizwertgeräte arbeiten verlässlich<br />
und unkompliziert.<br />
υ<br />
13
14<br />
Fernwärme<br />
Fernwärme wird in der Regel in großen Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerken, kleineren<br />
Blockheizkraftwerken, in Müllverbrennungsanlagen oder Fernheizwerken erzeugt. Rohrleitungssysteme,<br />
die sich überwiegend im Erdreich befi nden, sorgen für den Transport<br />
von thermischer Energie über große Distanzen. Bei Nahwärmekonzepten versorgt ein<br />
Blockheizkraftwerk zum Beispiel eine benachbarte Wohnsiedlung. Wasser eignet sich<br />
dabei besonders gut als Transportmedium, da thermische Energie entweder fl üssig<br />
oder gasförmig weitergeleitet wird. In den letzten Jahren wurden die deutschen Nahund<br />
Fernwärmenetze ausgebaut und die Zahl der Übergabestationen erhöht. Unter<br />
Fernheizung wird die Erschließung ganzer Städte oder Stadtteile verstanden. Fernwärme<br />
spielt in Deutschland mit 14 Prozent aller beheizten Wohnungen auf dem Energiemarkt<br />
nur eine Nebenrolle.<br />
Anwendungen<br />
Objekte im Bestandsbau, die bereits über einen Anschluss an ein Fernwärmenetz<br />
verfügen. In mit Fernwärme erschlossenen Neubaugebieten.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Geeignet für Häuser mit wenig Platz, weil lediglich Anschlüsse ans Fernwärmenetz<br />
benötigt werden<br />
- Kein Lagerraum für Energieträger nötig<br />
- Nachträglicher Anschluss privater Wohnungen und Häuser an das Fernwärmenetz<br />
ist nur schwer möglich und mit hohen Investitionskosten verbunden<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Hoher Energieverlust auch bei sehr guter Wärmedämmung wegen langer Transportwege<br />
- Nur bei dichter Bebauung geeignet<br />
- Nachträgliche Einbindung in ein Fernwärmenetz mit hohen Investitionskosten verbunden<br />
- Wenig Kombinationsmöglichkeiten mit Technologien auf Basis erneuerbarer Energien<br />
- Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung verbessert die CO2-Bilanz
Zukunftssicherheit<br />
- Mittlere Zukunftssicherheit, da moderne Heiztechnologien, die auf der Basis von<br />
erneuerbaren Energieträgern arbeiten, die Fernwärme hierzulande in den Hintergrund<br />
drängen<br />
Verfügbarkeit<br />
- Mittlere Verfügbarkeit, da Fernwärme im deutschen Energiemarkt nur eine untergeordnete<br />
Rolle spielt<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Keine<br />
15
Technologien auf Basis<br />
16<br />
erneuerbarer Energien
Luft, Wasser, Holz – die Natur offeriert uns zahlreiche Möglichkeiten<br />
zur umweltschonenden und kostensparenden Wärmegewinnung.<br />
Wärmepumpe, Pelletheizung, Hackschnitzelkessel oder Solarkollektoren<br />
beheizen Haus und Wohnung auf Basis regenerativer Energien<br />
und können überdies zur Warmwassererzeugung eingesetzt werden.<br />
Allein die Sonne sendet täglich 960 Billionen Kilowattstunden Energie auf die<br />
Erdoberfl äche. Solarthermie nutzt diese kostenlose Energie, um so in einem durchschnittlichen<br />
Einfamilienhaus die Heizkosten sowie die CO2-Emissionen pro Jahr<br />
deutlich zu senken. Wärmepumpen nutzen kostenlos Wärme aus der Erde, dem<br />
Grundwasser und der Umgebungsluft. Pelletkessel arbeiten CO2-neutral auf Basis<br />
von Holzabfällen. Auf den kommenden Seiten fi nden Sie die wichtigsten Informationen<br />
rund um das Thema „Heizen mit erneuerbaren Energieträgern“.<br />
Technologien auf Basis<br />
erneuerbarer Energien
Technologien auf Basis<br />
erneuerbarer Energien<br />
18<br />
Wärmepumpen<br />
Wärmepumpen gewinnen natürliche Energie aus dem Erdreich,<br />
dem Grundwasser oder der Luft und sparen dadurch kräftig Heizkosten.<br />
Wärmepumpen arbeiten emissionsfrei und zeichnen sich<br />
durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch aus. Staatliche<br />
Fördermittel senken die Amortisationszeit.<br />
�����������<br />
Wärmepumpen<br />
eignen sich im Winter<br />
zum Heizen und im<br />
Sommer zum Kühlen.<br />
Wärmepumpen nutzen die natürliche Umweltwärme aus dem Erdreich, dem Grundwasser<br />
oder der Umgebungsluft zur Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung.<br />
Diese Technologie funktioniert nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks:<br />
Die Wärme des Grundwassers, des Erdreichs oder der Umgebungsluft wird von<br />
einem thermischen Arbeitsmittel aufgenommen und durch Verdichtung zur Wärmeversorgung<br />
von Innenräumen nutzbar gemacht. Mit umgekehrtem Funktionsprinzip<br />
können einige Wärmepumpen auch kühlen.<br />
Wärmepumpen arbeiten äußerst effi zient: Bis zu 75 Prozent der Heizenergie werden<br />
direkt und kostenlos aus der Umwelt bezogen, nur noch 25 Prozent müssen in Form<br />
von elektrischem Strom als Antriebsenergie für Förderpumpe und Kompressor<br />
hinzugefügt werden. So können Haus- und Wohnungsbesitzer unabhängig von steigenden<br />
Preisen für Gas, Öl und Festbrennstoffe ihre Aufwendungen für Heizenergie<br />
nachhaltig senken.
Wärmepumpen können auf drei verschiedene Arten ihre Energie gewinnen:<br />
Sole-Wasser-Wärmepumpen beziehen ihre Energie aus dem Erdreich – wahlweise<br />
über eine bis zu 100 Meter tief reichende Erdsonde oder einen Flächenkollektor, der<br />
rund anderthalb Meter unter der Rasenfl äche frostsicher im Garten verlegt wird.<br />
Wasser-Wasser-Wärmepumpen nutzen über sogenannte Saug- und Schluckbrunnen<br />
die Wärme des Grundwassers.<br />
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht die Wärme für den Heizkreislauf ausschließ-<br />
lich der Umgebungsluft.<br />
Split-Wärmepumpen funktionieren nach dem Prinzip einer Luft-Wasser-Wärmepumpe,<br />
deren Funktionsweise durch eine Teilung in eine Innen- und eine Außeneinheit<br />
noch einmal optimiert wird.<br />
Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten ausführlich über umweltfreundliche<br />
Wärmepumpentechnologie.<br />
19
20<br />
Sole-Wasser-Wärmepumpe<br />
Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bezieht<br />
ihre Energie aus dem Erdreich. Als<br />
Wärmeträgermedium wird frostschutzsichere<br />
Sole eingesetzt. Im Wärmepumpenprozess<br />
wird das niedrige Temperaturniveau<br />
der Umweltwärme mit Hilfe<br />
Erdsonden<br />
zusätzlicher Energie so angehoben, dass<br />
reichen bis zu 100<br />
es für die Heizung nutzbar ist. Grund-<br />
Meter tief in die<br />
Erde hinein.<br />
sätzlich können entsprechend ausgerüstete<br />
Wärmepumpen bedingt auch für die<br />
Raumkühlung eingesetzt werden. Für den Betrieb einer Sole-Wasser-Pumpe wird<br />
entweder eine Erdsonde oder ein Flächenkollektor benötigt. Für den Einbau einer<br />
Erdsonde ist eine Tiefenbohrung notwendig.<br />
Anwendungen<br />
Für Neubau und wärmetechnisch optimierten Bestandsbau geeignet.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Sole-Wasser-Wärmepumpen beziehen ihre Energie aus dem Erdreich. Je nach Platzverhältnissen<br />
und Bodenbeschaffenheit werden Erdkollektoren oder eine/mehrere<br />
Erdsonden eingesetzt. Voraussetzung für den effi zienten Einsatz ist eine niedrige<br />
Vorlauftemperatur von rund 45 °C.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Keine fossilen Brennstoffe für die Wärmeerzeugung am Einsatzort<br />
- Kein direkter CO2-Ausstoß - Niedrige Betriebskosten<br />
- Hohe Energieeffi zienz<br />
- Erdbohrung für die Erstinstallation notwendig oder<br />
Verlegen eines Flächenkollektors<br />
- Abhängig von geologischen Gegebenheiten<br />
- Wärmepumpe wird mit Strom betrieben<br />
- Hoher Erstinstallationsaufwand
Beim Einbau der Erdsonde<br />
werden spezielle Tiefbohrgeräte<br />
eingesetzt.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da auf erneuerbare Energieformen zurückgegriffen wird<br />
Unabhängigkeit<br />
- Sehr hoch wegen Unabhängigkeit von externen Energielieferanten<br />
- Zum Betrieb wird Strom benötigt<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung<br />
- Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasser-/Pufferspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
Wärmepumpen beziehen<br />
75 Prozent ihrer<br />
Energie kostenfrei aus<br />
der Umwelt.<br />
21
22<br />
Wasser-Wasser-Wärmepumpe<br />
Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe bezieht<br />
ihre Energie aus dem Grundwasser.<br />
Im Wärmepumpenprozess wird das niedrige<br />
Temperaturniveau der Umweltwärme<br />
mit Hilfe zusätzlicher Energie so angehoben,<br />
dass es für die Heizung nutzbar<br />
Saug- und Schluck-<br />
ist. Grundsätzlich können entsprechend<br />
brunnen einer<br />
ausgerüstete Wärmepumpen auch bedingt<br />
Wasser-Wasser-<br />
Wärmepumpe.<br />
für die Raumkühlung eingesetzt werden.<br />
Für den Einbau eines Saug- und Schluckbrunnens<br />
ist keine Erdbohrung notwendig. Eine Sauganlage pumpt Grundwasser zu<br />
einer Wärmepumpe, die die Wärme des Grundwassers zur Beheizung des Gebäudes und<br />
der Warmwasserbereitung nutzbar macht. Das abgekühlte Grundwasser gelangt über<br />
den Schluckbrunnen zurück in den natürlichen Kreislauf. Durch die ganzjährig relativ<br />
konstante Durchschnittstemperatur des Grundwassers (etwa 10 °C) sind Wasser-Wasser-<br />
Systeme sehr effi zient.<br />
Anwendungen<br />
Für Neubau und wärmetechnisch optimierten Bestandsbau geeignet.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Idealvoraussetzung ist ein mineral- und kalkarmes Grundwasser. Voraussetzung für den<br />
effi zienten Einsatz ist eine niedrige Vorlauftemperatur von rund 45 °C.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Keine fossilen Brennstoffe für die Wärmeerzeugung am Einsatzort<br />
- Sehr effi zient<br />
- Kein direkter CO2-Ausstoß - Niedrige Betriebskosten<br />
- Erdarbeiten für Installation von Saug- und Schluckbrunnen nötig<br />
- Wärmepumpe wird mit Strom betrieben<br />
- Grundwasserförderung benötigt Strom für Pumpe<br />
- Abhängig von der Grundwasserqualität
Wärmepumpen<br />
funktionieren nach<br />
dem Prinzip eines<br />
Kühlschranks – nur<br />
umgekehrt.<br />
����������<br />
In einem Kreislauf wird<br />
die der Umwelt entzogene<br />
Wärme auf ein höheres<br />
Temperaturniveau<br />
gebracht und so für Heizzwecke<br />
nutzbar gemacht.<br />
�����������<br />
������<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da auf erneuerbare Energieformen zurückgegriffen wird<br />
Unabhängigkeit<br />
- Sehr hoch wegen Unabhängigkeit von externen Energielieferanten<br />
- Zum Betrieb wird Strom benötigt<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung<br />
- Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasser-/Pufferspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
������������<br />
23
24<br />
Luft-Wasser-Wärmepumpe<br />
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bezieht<br />
ihre Energie aus der Umgebungsluft. Im<br />
Wärmepumpenprozess wird das niedrige<br />
Temperaturniveau der Umweltwärme mit<br />
Hilfe zusätzlicher Energie so angehoben,<br />
dass es für die Heizung nutzbar ist.<br />
Grundsätzlich können entsprechend<br />
ausgerüstete Wärmepumpen bedingt<br />
auch für die Raumkühlung eingesetzt<br />
werden.<br />
Die Umgebungsluft<br />
sorgt für mollige<br />
Wohnraumwärme.<br />
Anwendungen<br />
Luft-Wasser-Wärmepumpen sind ideal für die Modernisierung von bestehenden Heizanlagen<br />
geeignet und bieten sich zudem für Immobilien mit schwer zugänglichen Grundstücken<br />
an. Voraussetzung für den effi zienten Betrieb ist ein reduzierter Heizwärmebedarf.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Luft-Wasser-Wärmepumpen erfordern im Vergleich zu Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-<br />
Wärmepumpen keine zusätzlichen Installationen zur Gewinnung von Wärme. Daher sind<br />
sie in der Anschaffung kostengünstiger als diese Systeme. Allerdings ist die Leistungsausbeute<br />
vergleichsweise geringer. Voraussetzung für den effi zienten Einsatz ist eine<br />
niedrige Vorlauftemperatur von rund 45 °C.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Keine Bohrungen oder Erdarbeiten nötig<br />
- Auch für Nachrüstung/Sanierung geeignet, wenn die Heizanlage auf eine Vorlauftemperatur<br />
von rund 45 °C eingestellt werden kann<br />
- Kein direkter CO2-Ausstoß - Am Einsatzort keine fossilen Brennstoffe notwendig<br />
- Geringere Leistungsausbeute als Wasser-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-<br />
Wärmepumpen<br />
- Benötigt bei sehr niedrigen Temperaturen meist zusätzlichen Wärmeerzeuger oder Strom
Ideal für Modernisierer: die<br />
Luft-Wasser-Wärmepumpe.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da auf erneuerbare Energieformen zurückgegriffen wird<br />
Unabhängigkeit<br />
- Sehr hoch wegen Unabhängigkeit von externen Energielieferanten<br />
- Zum Betrieb wird Strom benötigt<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung<br />
- Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasser-/Pufferspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
25
26<br />
Split-Wärmepumpe<br />
Eine Split-Wärmepumpe liefert nach dem bekannten Wärmepumpenprinzip 75 Prozent<br />
der Heizenergie durch die Umgebungsluft. Lediglich 25 Prozent müssen durch<br />
elektrischen Strom bereitgestellt werden. Die Technologie wird durch die Trennung in<br />
eine Innen- und eine Außeneinheit optimiert. Hierbei bietet der Markt verschiedene<br />
technologische Konzepte. Allen gemeinsam ist das Aufteilen (Splitten) der Wärmepumpe<br />
in einen Teil, der innerhalb, und einen Teil, der außerhalb des Gebäudes aufgestellt<br />
wird. Beide Komponenten werden durch Rohre miteinander verbunden, in denen das<br />
Wärmeträgermedium zirkuliert.<br />
Anwendungen<br />
Die Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe eignet sich sowohl für Bestandsbau als auch für<br />
Neubauten. Entscheidend für die Effi zienz ist genau wie bei anderen Wärmepumpentechnologien<br />
eine geringe Vorlauftemperatur von rund 45 °C. Luftansaug- und -ausblaskanäle<br />
wie bei Luft-Wasser-Wärmpumpen sind ebenso wenig erforderlich wie Bohrungen zur<br />
Erschließung der Wärmequelle. Insofern bietet die Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe<br />
Vorteile insbesondere im Bestandsbau.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Bedingt durch die Trennung der Wärmepumpe in eine Innen- und eine Außeneinheit<br />
besteht im Gebäude nur geringer Platzbedarf. Auch die Einbringung in enge Kellerräume<br />
ist dementsprechend deutlich vereinfacht.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Mit und ohne integrierten Warmwasserspeicher<br />
- Systemlösung für Heizung und Warmwasser<br />
- Bessere Gesamteffi zienz als bei herkömmlichen Luft-Wasser-Wärmepumpen<br />
- Ideale Lösung für den Bestandsbau, wenn Vorlauftemperatur von 45 °C möglich ist<br />
- Geringe Investitionen durch Erschließung der Wärmequelle Luft<br />
- Keine Bohrungen oder Erdarbeiten notwendig
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da auf erneuerbare Energieformen zurückgegriffen wird<br />
Unabhängigkeit<br />
- Sehr hoch wegen Unabhängigkeit von externen Energielieferanten<br />
- Zum Betrieb wird Strom benötigt<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasser-/Pufferspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
- Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung<br />
Split-Wärmepumpen sind in<br />
eine Innen- und eine Außeneinheit<br />
unterteilt.<br />
27
28<br />
Pelletheizung<br />
Ein Pelletheizkessel nutzt als Brennstoff Holzpellets. Dabei handelt es sich um<br />
Presslinge, die aus naturbelassenem Holz ohne chemische Bindemittel hergestellt<br />
werden. Das Rohmaterial bilden Sägespäne und Sägemehl. Sie fallen als Reststoffe bei<br />
der Holzverarbeitung an. Ein Pellet ist ca. 5 cm lang und hat einen Durchmesser von<br />
ca. 6 mm. Ein Kilogramm hat etwa denselben Heizwert wie ein halber Liter Heizöl.<br />
Anwendungen<br />
Ein Pelletheizkessel ist ein Heizsystem, das<br />
den kompletten Warmwasser- und Wohnwärmebedarf<br />
eines Gebäudes decken kann. Er<br />
eignet sich sowohl zur Modernisierung von<br />
Bestandsbauten als auch als Heizsystem für<br />
Neubauten.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Der Platzbedarf eines Pelletheizkessels ist<br />
relativ gering, jedoch wird ein Zusatzraum Die Verbrennung von Holzpellets verläuft CO2-neutral. zur Lagerung von Pellets benötigt. Die bei<br />
der Verbrennung der Pellets entstehende Bio-Asche kann entweder über den Hausmüll<br />
entsorgt oder als Dünger im Garten verwendet werden.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Auch für Nachrüstung/Sanierung geeignet<br />
- Neutrale CO2-Bilanz - Keine fossilen Brennstoffe notwendig<br />
- Platz zur Lagerung der Brennstoffe notwendig<br />
- Attraktive Fördergelder<br />
- Nachwachsender Rohstoff
Ein Pelletheizkessel deckt den kompletten<br />
Warmwasser- und Wohnwärmebedarf eines<br />
Gebäudes über umweltschonende Holzpellets.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da allein auf erneuerbare Energien zurückgegriffen wird<br />
Unabhängigkeit<br />
- Sehr hoch, weil Holz überall regional verfügbar ist<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung<br />
- Warmwasserspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
29
30<br />
Flachkollektoren<br />
Flachkollektoren funktionieren prinzipiell wie ein dunkler Gartenschlauch, der in der<br />
Sonne liegt. Seine Oberfl äche absorbiert das Sonnenlicht und vor allem die Wärmestrahlung,<br />
sodass sich das Wasser darin erwärmt. Im Flachkollektor wird über einen<br />
Absorber durch die Sonneneinstrahlung eine spezielle Trägerfl üssigkeit erwärmt und<br />
durch eine Umwälzpumpe zum Warmwasserspeicher transportiert. Dort wird die Wärme<br />
über einen Wärmetauscher auf das Trink- oder Heizungswasser übertragen und kann im<br />
Speicher „zwischengelagert“ werden, bis die Wärme zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung<br />
benötigt wird.<br />
Anwendungen<br />
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Neubau oder in der Modernisierung.<br />
Solarkollektoren können leicht in dafür vorbereitete bestehende Systeme<br />
integriert werden.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Solarkollektoren lassen sich mit nahezu jedem beliebigen Heizgerät zu einem Hybridsystem<br />
kombinieren. Reicht die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung des Trinkwassers<br />
nicht aus, heizt z.B. ein konventionelles Heizsystem den Speicher auf die gewünschte<br />
Solltemperatur nach.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Basiert auf erneuerbaren Energieträgern<br />
- CO2-freie Technologie<br />
- Kann in ein bestehendes Heizsystem integriert werden<br />
- Kollektor nutzt sich nicht ab<br />
- Solare Warmwasserbereitung: 1,2 – 1,5 Quadratmeter Kollektorfl äche pro Person genügen<br />
- Faustformel für die solare Heizungsunterstützung: Pro 10 Quadratmeter zu beheizende<br />
Wohnfl äche wird 1 Quadratmeter Kollektorfl äche benötigt<br />
- Erhöht Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern<br />
- Mit einem Speicher kann Wärme bevorratet werden<br />
- Reduziert Heizkosten
Pro Person genügen zur Warmwasserbereitung<br />
1,2 Quadratmeter<br />
Kollektorfl äche.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, weil allein auf erneuerbare Energieträger zurückgegriffen wird<br />
Flachkollektoren<br />
können sowohl die<br />
Heizung als auch die<br />
Warmwasserbereitung<br />
unterstützen.<br />
Verfügbarkeit<br />
- Abhängig von den Sonnenscheinstunden der betreffenden Region<br />
- Speicher ermö glichen Vorratshaltung und gleichen Jahresschwankungen bei der<br />
Sonneneinstrah lung aus<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren lassen sich mit nahezu jedem beliebigen Heizgerät zu einem<br />
Hybridsystem kombinieren<br />
31
32<br />
Röhrenkollektoren<br />
Vakuum-Röhrenkollektoren ähneln Flachkollektoren. Auch sie funktionieren prinzipiell<br />
wie ein dunkler Gartenschlauch, der in der Sonne liegt. Ihre Oberfl äche absorbiert das<br />
Sonnenlicht und vor allem die Wärmestrahlung, sodass sich das Wasser darin erwärmt. Im<br />
Röhrenkollektor wird über einen Absorber durch die Sonneneinstrahlung eine spezielle Trägerfl<br />
üssigkeit erwärmt und durch eine Umwälzpumpe zum Warmwasserspeicher transportiert.<br />
Dort wird die Wärme über einen Wärmetauscher auf das Trink- oder Heizungswasser<br />
übertragen und kann im Speicher „zwischengelagert“ werden, bis sie zum Heizen oder zur<br />
Warmwasserbereitung benötigt wird. Röhrenkollektoren sind ertragreicher als Flachkollektoren,<br />
weil die in ein Wärmeblech eingewickelten Absorberrohre in einer luftleeren Glasröhre<br />
stecken. Durch das Vakuum in der Glasröhre werden Wärmeverluste so gut wie vermieden.<br />
Außerdem befi ndet sich unter den einzelnen Röhren ein Spiegel, der das Sonnenlicht<br />
auf das Absorberrohr konzentriert.<br />
Anwendungen<br />
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Neubau oder in der Modernisierung.<br />
Solarkollektoren lassen sich leicht in dafür vorbereitete, bestehende Systeme<br />
integrieren.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Solarkollektoren lassen sich mit nahezu jedem beliebigen Heizgerät zu einem Hybridsystem<br />
kombinieren. Reicht die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung des Trinkwassers<br />
nicht aus, heizt z.B. ein konventionelles Heizsystem auf die gewünschte Solltemperatur<br />
nach.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Basiert auf erneuerbaren Energieträgern<br />
- CO2-freie Technologie<br />
- Kann in ein bestehendes Heizsystem integriert werden<br />
- Kollektor nutzt sich nicht ab<br />
- Solare Warmwasserbereitung: 0,8 – 1,0 Quadratmeter Kollektorfl äche pro Person genügen<br />
- Faustformel für die solare Heizungsunterstützung: Pro 10 Quadratmeter zu beheizender<br />
Wohnfl äche wird 1 Quadratmeter Kollektorfl äche benötigt<br />
- Erhöht Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern<br />
- Speicher notwendig, um Wärme zu bevorraten<br />
- Reduziert Heizkosten
CPC-Spiegel<br />
Lorem ipsum<br />
dolor sit amet,<br />
consectetuer<br />
Wärmeleitblech<br />
Vakuumröhre mit Absorber<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, weil allein auf erneuerbare Energieträger zurückgegriffen wird<br />
Verfügbarkeit<br />
- Abhängig von den Sonnenscheinstunden der betreffenden Region<br />
- Speicher ermöglichen Vorratshaltung und gleichen Jahresschwankungen bei der<br />
Sonneneinstrahlung aus<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren lassen sich mit nahezu jedem beliebigen Heizgerät zu einem<br />
Hybridsystem kombinieren<br />
Glas<br />
Hinter den Röhren<br />
liegende Spiegel<br />
fangen auch diffuses<br />
Licht auf und<br />
erhöhen damit die<br />
Ertragskraft eines<br />
Röhrenkollektors.<br />
33
34<br />
Hackschnitzelkessel<br />
Ein Hackschnitzelkessel funktioniert wie eine Pelletheizung. Die Wärmeerzeugung<br />
erfolgt jedoch nicht über Holzpresslinge, sondern mit Hackschnitzeln. Sie bestehen<br />
ebenfalls aus Rest- und Schwachholz, zum Beispiel aus den Teilen eines Baums, die<br />
sich nicht für die Nutzholzproduktion eignen. Sie sind etwa streichholz- bis zigarettenschachtelgroß.<br />
Eine möglichst einheitliche Größe der Hackschnitzel und ein geringer<br />
Wassergehalt sind Voraussetzungen für den problemlosen Einsatz in den Heizanlagen.<br />
Die Hackschnitzel werden aus einem Lagerraum zugeführt. Wichtig ist bei einem Hackschnitzelkessel<br />
insbesondere eine automatische Brennerrost- und Wärmetauscherreinigung.<br />
Anwendungen<br />
Neu- und Bestandsbau<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Der Platzbedarf eines Hackschnitzelkessels ist relativ gering, daher eignet er sich auch<br />
für den Einbau in engere Heizungskeller. Jedoch wird ein Zusatzraum zur Lagerung der<br />
Hackschnitzel benötigt. Die bei der Verbrennung entstehende Bio-Asche kann entweder<br />
über den Hausmüll entsorgt oder als Dünger im Garten verwendet werden.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Neutrale CO2-Bilanz - Keine fossilen Brennstoffe notwendig<br />
- Höherer Platzbedarf zur Lagerung der Brennstoffe als bei Öl<br />
- Technologie deutlich weniger verbreitet als Pelletheizkessel<br />
- Nach mehreren Wochen ist die Aschelade zu leeren<br />
- Wartungsintensiv
Hackschnitzelkessel<br />
funktionieren nach<br />
dem gleichen Prinzip<br />
wie eine Pelletheizung.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da allein auf erneuerbare Energieformen zurückgegriffen wird<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, weil Holz überall regional verfügbar ist<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung<br />
- Warmwasserspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
Quelle: BDH<br />
35
Technologien auf Basis<br />
erneuerbarer Energien<br />
36<br />
Holzvergaserkessel<br />
Ein Holzvergaserkessel nutzt die sogenannte Pyrolyse (Vergasung) zur Wärmeerzeugung.<br />
Als Brennstoff werden grobe Hackschnitzel und Scheitholz verwendet. Der<br />
Holzvergaserkessel wird durch eine Brennerplatte aus feuerfester Keramik in zwei<br />
Kammern unterteilt. Bei den meisten Heizkesseln fi ndet die Verbrennung in der Oberkammer<br />
statt. Beim Holzvergaserkessel dagegen erfolgt die Verbrennung im unteren<br />
Teil des Kessels. Zunächst wird bei einem Holzvergaserkessel im oberen Abschnitt eine<br />
Trocknung des Holzes durchgeführt. Dafür wird über ein Gebläse Luft von oben durch<br />
das Holz gedrückt. Im mittleren Teil des Kessels fi ndet die eigentliche Holzvergasung<br />
statt, und im unteren Abschnitt läuft eine Vorverbrennung ab. Die dabei entstehenden<br />
Verbrennungsgase werden über eine Düsenkombination mit Luft angereichert, und es<br />
kommt zur Hauptverbrennung. Durch eine räumliche und zeitliche Trennung der einzelnen<br />
Stufen der Holzverbrennung werden im Vergleich zu anderen Festbrennstoffkesseln<br />
niedrige Schadstoffemissionen und ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht.<br />
Anwendungen<br />
Im Neubau und bei der Modernisierung von Altbauten.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Holzvergaserkessel sind für Häuser mit geringem Energiebedarf nur in Verbindung mit<br />
großen Pufferspeichern geeignet. Wichtig ist, dass die Schornsteinmündung möglichst<br />
hoch und weit von Fenstern entfernt liegt, hinter denen Wohnräume sind. Dafür sollte<br />
bei der Planung auch die vorherrschende Windrichtung berücksichtigt werden. Selbst<br />
bei optimalem Betrieb kann es besonders beim Anheizen zeitweise zu Rauch- und<br />
Geruchsbelästigungen kommen.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Aufwendige Versorgung wegen nicht automatisierter Bestückung<br />
- Neutrale CO2-Bilanz - Keine fossilen Brennstoffe notwendig<br />
- Erheblicher Platzbedarf zur Lagerung der Brennstoffe<br />
- Deutlich weniger verbreitet als Pellettechnologie<br />
- Für Holzvergaserkessel mit mehr als 15 kW Leistung ist in Deutschland ein Pufferspeicher<br />
vorgeschrieben<br />
- Holzvergaserkessel vertragen keine Kohle, Koks, ungeordnete Holzreste oder Sägespäne
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, weil auf Basis regenerativer Energien geheizt wird<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, weil Holz überall regional verfügbar ist<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung<br />
- Warmwasserspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
Holzvergaser nutzen<br />
Scheitholz zur Wärmeerzeugung.<br />
Quelle: BDH<br />
37
38<br />
Kaminöfen<br />
Ein Kaminofen kann sowohl mit fossilen als auch mit nachwachsenden Brennstoffen<br />
beheizt werden. Er wird in direkter Anbindung an den Schornstein gestellt und über ein<br />
Ofenrohr mit diesem verbunden. Moderne Kaminöfen arbeiten auf Basis von erneuerbaren<br />
Energien wie Brennholz, Holzbriketts, Holzpellets, Papier oder Bioethanol. Ein<br />
Kamin ofen ist aus Gusseisen oder Stahlblech gefertigt und bietet in der Regel über eine<br />
Glasscheibe freie Sicht in den Feuerraum. Ein Kaminofen gibt die Wärmeenergie in Form<br />
von Strahlung, überwiegend aber über Konvektion (Transport von heißen oder kalten<br />
Teilchen) unmittelbar an den Raum ab. Im Idealfall erreichen Kaminöfen Wirkungsgrade<br />
von bis zu 80 Prozent.<br />
Wasserführende Kaminöfen geben zusätzlich Wärmeenergie an das Zentralheizungssystem<br />
ab. Von dort aus wird die Wärme auf weitere Zimmer verteilt. Zu diesem Zweck<br />
wird eine Wasserleitung an den Ofen angeschlossen, die sowohl die Zentralheizungsanlage<br />
als auch die Warmwasseraufbereitung unterstützen kann.<br />
Anwendungen<br />
Neubau und Modernisierung<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Kaminöfen bieten in ihren kleineren Varianten als Ergänzung des Basis-Heizsystems<br />
Einsatzmöglichkeiten im Neu- und im Altbau. Vor Kauf und Einbau muss jedoch auf<br />
jeden Fall mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister Rücksprache gehalten werden.<br />
Die Beschaffenheit und Nutzung des eigenen Schornsteins ist das entscheidende<br />
Kriterium beim Einbau eines Kaminofens.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Abzugsrohre und Schornstein notwendig<br />
- Im Vergleich zu Brennwerttechnik und Wärmepumpen hoher Pfl egeaufwand<br />
- Bevorratungsmöglichkeit für Brennstoffe notwendig<br />
- Temperaturregelung kaum möglich<br />
- Nicht ausreichend als alleinige Beheizung von Ein- bis Zweifamilienhäusern<br />
- Nicht so gute Wärmeausbeute wie effi ziente Pellet- oder Hackschnitzeltechnik<br />
- Höhere Schadstoffemissionen als bei kontrollierter Verbrennungstechnik<br />
- Künftig ggf. Rußpartikelfi lter notwendig ähnlich wie für Diesel-Motoren in Autos
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, wenn der Kaminofen auf Basis erneuerbarer Energien arbeitet<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, weil Holz überall regional verfügbar ist<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Einspeisung in bestehendes Heizsystems teilweise möglich<br />
Wegen ihrer<br />
Behaglichkeit<br />
erfreuen sich<br />
Kaminöfen<br />
großer Beliebtheit.<br />
39
Trends und Zukunftstechnologien<br />
40
Die Zukunft gehört hocheffi zienten Heizsystemen. Diese arbeiten<br />
zum Teil mit intelligent verknüpften Technologien auf Basis erneuerbarer<br />
und fossiler Brennstoffe. Sämtliche Lösungen zeichnen<br />
sich durch den hocheffi zienten Einsatz von Ressourcen und einen<br />
hohen Wirkungsgrad aus.<br />
Dazu zählen zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), die besonders<br />
effi zient gleichzeitig Heizwärme und elektrischen Strom erzeugen. Im Einfamilienhaus<br />
sorgt ein solches Mini-Blockheizkraftwerk auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung<br />
für höchste Unabhängigkeit. <strong>Vaillant</strong> bringt im Jahr 2010 die erste Zeolith-Gas-<br />
Wärmepumpe auf den Markt, die bewährte Gas-Brennwerttechnik mit kostenloser<br />
Umweltwärme verbindet. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie das Wichtigste über<br />
den aktuellen Stand der Forschung zu Heiztechnologien von morgen.<br />
41<br />
Trends und<br />
Zukunftstechnologien
Trends und<br />
Zukunftstechnologien<br />
42<br />
Zeolith-Gas-Wärmepumpe<br />
Eine Zeolith-Gas-Wärmepumpe verbindet die Vorzüge moderner Gas-Brennwertheizungen<br />
mit Solartechnik. Das Heizgerät erzeugt Wärmeenergie aus Erdgas und Umweltwärme.<br />
Zur weiteren Steigerung der Effi zienz ist das Gerät mit einer Zeolith-Einheit<br />
ausgerüstet. Zeolithe, von griechisch „zeo“ (sieden) und „lithos“ (Stein), geben bei der<br />
Aufnahme von Wasser erhebliche Wärmemengen ab. Diese Eigenschaft macht sich eine<br />
Zeolith-Gas-Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung zunutze. Zeolith hat eine Struktur wie<br />
ein Schwamm mit vielen kleinen Hohlräumen. Darin schließt das Mineral Wasser ein und<br />
gibt während der Wasseraufnahme eine große Menge Wärme ab. Heizt man den mit<br />
Wasser gesättigten Steinen dann mit hoher Temperatur ein, geben sie das Wasser als<br />
Dampf wieder frei. Die jeweils entstehende Wärme wird zusätzlich im Heizprozess<br />
genutzt. Dieser Prozess lässt sich beliebig oft wiederholen. Zeolith ist ungiftig, nicht<br />
brennbar und ökologisch unbedenklich.<br />
Anwendungen<br />
Mit einer Heizleistung von bis zu 10 kW ist das Hybridsystem für den Einsatz mit<br />
Fußbodenheizung in Niedrigenergiehäusern oder energetisch vorbildlich sanierten<br />
Altbauten ausgelegt.<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Der Platzbedarf einer Zeolith-Gas-Wärmepumpe ist gering, daher eignet sie sich auch<br />
für den Einbau in relativ enge Heizungskeller. Jedoch wird ein Gasanschluss benötigt.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Hocheffi ziente Technologie: Nutzungsgrad 20 Prozent oberhalb aktueller<br />
Gas-Brennwerttechnik<br />
- Wärmeerzeugung aus Gas, Umweltwärme und Sorptionsprozess mit Zeolith<br />
- CO2-Emissionen und der Energieverbrauch reduzieren sich im Vergleich zu<br />
Gas-Brennwertgeräten um rund 20 Prozent<br />
- Zeolith ist ungiftig, unbrennbar und ökologisch unbedenklich<br />
- Zeolith-Modul auf Lebensdauer wartungsfrei
Eine Zeolith-Gas-Wärmepumpe kombiniert<br />
bewährte Brennwerttechnik mit kostenloser<br />
Umweltwärme.<br />
Zeolith-Gas-<br />
Wärmepumpen<br />
sind fl exibel<br />
kombinierbar.<br />
Zeolithe sind Minerale, die bei der Aufnahme<br />
von Wasser Wärme freisetzen.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da erneuerbare Energien mit höchsten Wirkungsgraden arbeiten<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, da eine Zeolith-Gas-Wärmepumpe auf erneuerbare<br />
Energien zurückgreift<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Die Zeolith-Gas-Wärmepumpe wird als Systemlösung inklusive Solarkollektoren<br />
und Warmwasserspeicher ausgelegt<br />
43
44<br />
Mini-Blockheizkraftwerke/KWK*<br />
Blockheizkraftwerke arbeiten auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung. Ein spezieller<br />
Verbrennungsmotor, ähnlich dem eines Autos, treibt einen Generator zur Stromerzeugung<br />
an. Dieser wandelt die mechanische Energie des Motors in elektrische Energie<br />
um. Die dabei ebenfalls entstehende Wärme wird über einen Plattenwärmetauscher<br />
nutzbar gemacht und zum Heizen sowie zur Warmwasserbereitung verwendet. Etwa 65<br />
Prozent des eingesetzten Brennstoffs wird in Wärme umgewandelt, etwa 25 Prozent in<br />
Strom, und nur maximal zehn Prozent gehen als Abwärme verloren. Der zusätzlich zur<br />
Heizenergie produzierte Strom kann selbst verbraucht oder gegen eine staatlich festgelegte<br />
Vergütung ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. So lassen sich etwa<br />
70 Prozent des Strombedarfs eines Mehrfamilienhauses aus eigener Hand decken.<br />
Anwendungen<br />
Neubau und Modernisierung jeweils bei erhöhtem bzw. ganzjährig anfallendem<br />
Wärmebedarf<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
Der Platzbedarf eines Blockheizkraftwerks ist sehr gering, daher eignet es sich auch<br />
für den Einbau in relativ enge Hei z ungskeller. Zum Betrieb ist ein Gasanschluss, ein<br />
Flüssiggas- oder ein Öltank notwendig. Das kleine Kraftwerk kann problemlos nachträglich<br />
ins Heizsystem eingebunden und der bestehende Heizkessel so weiter als Spitzenlast-Wärmeerzeuger<br />
genutzt werden. Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb ist<br />
in der Regel eine Wärmeabnahmequelle im Sommer.<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Strom und Wärme werden direkt vor Ort und gemeinsam erzeugt<br />
- Kostensparende und umweltschonende Technologie<br />
- Verbrauchter Brennstoff von der Energiesteuer befreit: Hauseigentümer bekommen<br />
hier z.B. bei Erdgas etwa 10 – 15 Prozent des Gaspreises zurückerstattet<br />
- Deckt im Mehrfamilienhaus etwa 70 Prozent des Strombedarfs<br />
- Anpassung der Leistung (Leistungsmodulation) an den jeweiligen Bedarf für höheren<br />
Stromeigenverbrauch<br />
*Kraft-Wärme-Kopplung
Öffentliches Stromnetz<br />
Zähler<br />
Haushaltsstrom<br />
Gas<br />
Das Kleinkraftwerk<br />
für den heimischen<br />
Keller: ein Mini-Blockheizkraftwerk.<br />
Abgasführung<br />
Strom Mini-Blockheizkraftwerk Wärme<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, da Kraft-Wärme-Kopplung eine kostensparende und umweltschonende<br />
Form der Strom- und Wärmeerzeugung ist<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, da Kraft-Wärme-Kopplung im eigenen Keller genutzt werden kann<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung<br />
- Warmwasser-/Pufferspeicher<br />
- Regelungstechnik<br />
Kaltwasser<br />
Heizung<br />
Warmwasser<br />
45
Begleitende Systeme<br />
46
Eine moderne Heizungsanlage kann um zusätzliche Systembausteine<br />
ergänzt werden, die den Komfort erhöhen und überdies die<br />
Wärme- und Warmwasserversorgung weiter absichern. Klimaanlagen<br />
können eine Heizungsanlage intelligent ergänzen.<br />
Die Wohnungslüftung sorgt im ganzen Haus für rundum gutes Klima – mit kontrollierter,<br />
wohltemperierter Frischluftzufuhr. Mit Regelungssystemen lässt sich die<br />
Heizungsanlage auch aus der Ferne steuern, damit Sie z.B. nach dem Urlaub in ein<br />
wohltemperiertes Haus zurückkehren können. Ein Warmwasserspeicher ergänzt<br />
ein System auf Basis erneuerbarer Energien, damit auch in sonnenarmen Zeiten<br />
die warme Dusche nicht kalt wird. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie<br />
ausführlich über verschiedene Möglichkeiten zur intelligenten Ergänzung Ihres<br />
Heizungssystems.<br />
47<br />
Begleitende<br />
Systeme
Begleitende<br />
Systeme<br />
48<br />
Wohnungslüftung<br />
Systeme zur Wohnungslüftung sorgen für einen kontrollierten Luftwechsel in Gebäuden.<br />
Dieser ist insbesondere in immer luftdichteren Häusern notwendig, um die Lufthygiene<br />
zu gewährleisten und beispielsweise der Bildung von Schimmelpilz vorzubeugen.<br />
Der Markt hält sowohl Produkte zur automatischen Fensteröffnung als auch zur zentral<br />
oder dezentral kontrollierten Wohnungslüftung bereit. In der Praxis werden für kleinere<br />
Wohngebäude fast ausschließlich zentrale Anlagen eingesetzt. Auf diese Geräte beziehen<br />
sich auch die weiteren Angaben.<br />
Zentrale Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung bieten gleichzeitig eine integrierte,<br />
hocheffi ziente Wärmerückgewinnung von bis zu 96 Prozent. Das heißt: Der<br />
verbrauchten Abluft wird nahezu die gesamte enthaltene Wärme entzogen und auf die<br />
angesaugte Frischluft (Zuluft) übertragen. Dadurch senken Anlagen zur kontrollierten<br />
Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Gegensatz zur konventionellen Fensterlüftung<br />
den Heizbedarf eines Gebäudes um rund 20 Prozent.<br />
Anwendungen<br />
Sowohl im Neubau als auch im energetisch sanierten Bestandsbau<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Installation eines Luftkanalsystems zu den Zu- und Abluftstellen im Gebäude<br />
- Dichte Gebäudehülle ist entscheidend für Effi zienz der kontrollierten Wohnungslüftung<br />
- Regelmäßige Wartung der Anlage und insbesondere kontinuierlicher Filterwechsel<br />
- Aufwendige Nachrüstung im Bestandsbau<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Verbrauchte Luft wird dort abgesaugt, wo sie am meisten belastet ist (Küche, Bad)<br />
- Der abgesaugten Luft wird die Wärme über einen Wärmetauscher entzogen und die<br />
zugeführte Frischluft (Zuluft) damit erwärmt<br />
- Die erwärmte Frischluft (Zuluft) wird vorrangig den Aufenthaltsbereichen<br />
wie Wohnraum und Schlafzimmer zugeführt<br />
- Dauerhaft hygienischer Luftwechsel<br />
- Vorbeugung von Feuchtschäden und Schimmelbefall<br />
- Pollenfi lter<br />
- Reduzierung des Heizbedarfs um rund 20%
Mit kontrollierter<br />
Wohnraumlüftung<br />
haben Schimmelpilze<br />
keine Chance.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, weil nachhaltiger Effi zienzgewinn bei Beheizung<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, weil Anlage zum Betrieb ausschließlich Strom benötigt<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Kombinierbar mit allen gängigen Heizsystemen<br />
- Photovoltaik zur Stromerzeugung<br />
1 Außenluft<br />
2 Fortluft<br />
3 Abluft<br />
4 Zuluft<br />
5 Zentrales Lüftungsgerät<br />
49
Begleitende<br />
Systeme<br />
50<br />
Klimageräte<br />
Mit einer Klimaanlage wird Luft in Räumen ausgetauscht oder gefi ltert. Dabei wird der<br />
Raumluft entweder Wärme entzogen oder diese erwärmt und bei Bedarf auch entfeuchtet.<br />
Um Räume im Wohnbereich, in Ladenlokalen oder Büros zu klimatisieren, stehen<br />
je nach räumlichen Bedingungen unterschiedliche Geräte-Bauarten zur Verfügung. Am<br />
Markt durchgesetzt haben sich Split-Klimageräte. Diese bestehen aus einer Außen- und<br />
einer Inneneinheit. Während das Innengerät die Raumluft konditioniert, führt das Außengerät<br />
die Wärme sowie die Luftfeuchtigkeit in Form von Kondensat nach außen ab.<br />
Mono-Split-Klimageräte bestehen aus einer Außen- und einer Inneneinheit. Bei Multi-<br />
Split-Klimageräten können an ein Außengerät mehrere Inneneinheiten in einer Vielzahl<br />
von Räumen angeschlossen werden. Für die individuelle Anpassung der Inneneinheiten<br />
bietet der Markt zum Beispiel Decken-, Stand- oder Wandgeräte.<br />
Anwendungen<br />
Sowohl im Neu- als auch im Bestandsbau<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Individuelle Planung durch Fachhandwerksunternehmen erforderlich, um gewünschte<br />
Funktionen zu gewährleisten<br />
- Einsatz eines zertifi zierten Fachbetriebs zum Umgang mit Kältemitteln erforderlich<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Möglichkeit zur Abscheidung von Pollen, Staubpartikeln und Mikroorganismen<br />
- Invertertechnologie sorgt dafür, dass Klimagerät bedarfsabhängig den Betrieb hochoder<br />
runterschaltet<br />
- Energie-Effi zienzklassen wie bei Kühlschränken zur Messbarkeit des Gesamtenergiebedarfs<br />
des Klimageräts<br />
- Bei entsprechender Ausstattung sind Klimageräte eine energiesparende Ergänzung zur<br />
Zentralheizung<br />
- Einstellung aller Funktionen durch kabellose Fernbedienungen
Entlastung für Allergiker:<br />
Klimageräte fi ltern Pollen<br />
aus der Luft.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Mittel, da der Strombedarf von Klimageräten vergleichsweise hoch ist<br />
Verfügbarkeit<br />
- Anlage benötigt zum Betrieb lediglich Strom<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Mit allen Heizsystemen kombinierbar<br />
- Photovoltaik zur Stromerzeugung<br />
Klimageräte lassen sich an<br />
Decken und Wänden montieren<br />
sowie auf dem Boden<br />
aufstellen.<br />
51
Begleitende<br />
Systeme<br />
52<br />
Warmwasserspeicher<br />
Warmwasserspeicher nehmen Wärmeenergie in Form von Wasser auf und speichern sie<br />
bis zu einer Verbrauchsanforderung. Sie werden entweder direkt und unabhängig vom<br />
zentralen Heizsystem oder gekoppelt an die zentrale Heizanlage eingesetzt. Darüber<br />
hinaus bilden sie entweder eine separat aufgestellte Einheit oder einen integrierten<br />
Bestandteil eines Wärmeerzeugers. Als Pufferspeicher gewährleisten sie z.B. den möglichst<br />
langen und damit energieeffi zienten Betrieb einer Wärmepumpe. Hier kommen<br />
sie insbesondere bei Heizsystemen zum Einsatz, die ihren höchsten Nutzungsgrad nur<br />
unter Volllast erreichen, wie etwa Scheitholzkessel. Als Solarspeicher nehmen sie die<br />
Wärmeenergie dann auf, wenn sie durch die Solarkollektoren zur Verfügung gestellt,<br />
aber noch nicht abgerufen wird. Moderne Multispeicher können Wärmeenergie von<br />
verschiedensten Wärmequellen aufnehmen und machen die wirtschaftliche Nutzung<br />
vieler erneuerbarer Energieträger erst möglich. Warmwasserspeicher haben sich von<br />
einem früher passiv ausgelegten Element der Heizanlage zu einem bedeutenden Faktor<br />
moderner Heizsysteme mit vielen Steuerungsfunktionen entwickelt.<br />
Anwendungen<br />
Sowohl im Neubau als auch im Bestandsbau<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Individuelle Planung erforderlich, um idealen Warmwasserspeicher auszuwählen<br />
- Hochwertige Wärmedämmung sowohl des Warmwasserspeichers als auch der Warmwasser<br />
führenden Rohrleitungen erforderlich, um Wärmeverluste zu minimieren<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Schichtladetechnik aktuell bevorzugte Lösung für Warmwasserspeicher<br />
- Schichtladetechnik: höherer Wärmekomfort bei hoher Wirtschaftlichkeit<br />
- Zahlreiche Bauformen, Einsatzmöglichkeiten und Lösungswege für individuellen<br />
Warmwasserspeicher-Bedarf<br />
- Moderne Multispeicher bieten auch nachträglich die Möglichkeit zur Aufnahme von<br />
Wärmeenergie unterschiedlichster Wärmequellen
Speichergrößen von 300 bis<br />
500 Litern sichern auch in<br />
sonnenarmen Zeiten den Warmwasserbedarf.<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, weil u.a. zentraler Bestandteil moderner Heizanlagen mit erneuerbaren<br />
Energieträgern<br />
Verfügbarkeit<br />
- Sehr hoch, jedoch abhängig von der Größe des Warmwasserspeichers<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Kombinierbar mit allen gängigen Heizsystemen<br />
Warmwasserspeicher lassen sich<br />
mit effi zienter Brennwerttechnik<br />
und Solarkollektoren besonders<br />
gut zu einem intelligenten Heizsystem<br />
kombinieren.<br />
53
Begleitende<br />
Systeme<br />
54<br />
Regelungstechnik<br />
Regelungstechnik bildet den „klugen Kopf“ jeder modernen Heizanlage. Die Regelung<br />
garantiert den bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Betrieb des Wärmeerzeugers und –<br />
im Idealfall – auch seiner angeschlossenen Komponenten. Bei einer witterungsgeführten<br />
Regelung wird die Heizleistung über einen Außenfühler automatisch den Außentemperaturen<br />
angepasst. Bei einer raumtemperaturgeführten Regelung ist die Temperatursteuerung<br />
abhängig von der Differenz zwischen gewünschter und tatsächlicher Raumtemperatur.<br />
Die Verbindung zwischen der eigentlichen Regelung am Wärmeerzeuger und der oftmals<br />
im Wohnraum angebrachten Bedieneinheit kann sowohl per Kabel als auch per Funk<br />
umgesetzt werden. Als Ergänzung zur Regelung dienen Internet-Kommunikationssysteme.<br />
Sie empfangen Meldungen der Regelung, werten sie aus und senden sie per E-Mail<br />
oder SMS an den Betreiber oder betreuenden Fachhandwerker. Damit werden diese auf<br />
eventuell anstehende Wartungen oder präventiv auf mögliche Störfälle hingewiesen.<br />
Anwendungen<br />
Sowohl im Neubau als auch im Bestandsbau<br />
Einsatzbedingungen und Voraussetzungen<br />
- Genaue Defi nition der Zusammensetzung und Anforderungen einer Heizanlage<br />
erforderlich<br />
- Systemregelungen setzen in der Regel einen Systemanbieter für alle Komponenten<br />
einer Heizanlage voraus, damit deren Temperaturen optimal aufeinander<br />
abgestimmt und zu einem effi zienten System kombiniert werden können<br />
Die Technologie in Stichpunkten<br />
- Witterungs- oder raumtemperaturgeführte Regelungen<br />
- Innovative Regelungstechnik ist in der Lage, intelligente Entscheidungen im Hinblick auf<br />
maximalen Komfort und Wirtschaftlichkeit einer Heizanlage zu treffen<br />
- Systemregler steuern auch komplexe Heizanlagen aus mehreren Komponenten<br />
- Systemregler vereinfachen die Bedienung von Heizanlagen mit mehreren Komponenten<br />
- Internet-Kommunikationssysteme bilden eine gute Ergänzung moderner Regelungstechnik
vrnetDIALOG<br />
Zukunftssicherheit<br />
- Sehr hoch, weil nachhaltiger Effi zienzgewinn bei Steuerung auch komplexer<br />
Heizanlagen<br />
Verfügbarkeit<br />
- Integraler Bestandteil jeder modernen Heizanlage<br />
Mit witterungs- und raumtemperaturgeführten<br />
Regelungen lässt sich die optimale<br />
Temperatur erzeugen.<br />
www<br />
Internetbasiertes<br />
Hochsicherheitsportal<br />
Intelligente Regelungen<br />
lassen sich über<br />
das Internet auch aus<br />
der Ferne bedienen.<br />
Kombinationsmöglichkeiten<br />
- Je nach Zusammensetzung der Heizanlage sowie abhängig von den Effi zienz- und<br />
Komfortwünschen des Betreibers<br />
55
Gesetze/Verordnungen/Fördergelder<br />
56
Wer seine Heizungsanlage erneuert oder erneuerbare Energien<br />
einbindet, kann mit staatlichen Fördermöglichkeiten kalkulieren.<br />
Die Höhe der Fördermittel hängt davon ab, wo Sie wohnen, wie Sie<br />
modernisieren und ob Sie frühzeitig die Anträge stellen.<br />
Grundsätzlich gilt natürlich: Je umweltfreundlicher Ihre neue Heizung ist, auf desto<br />
mehr fi nanzielle Zuwendungen dürfen Sie hoffen. Die Fülle der Fördermöglichkeiten<br />
und der dazugehörigen gesetzlichen Regelungen ist vielfältig und unübersichtlich.<br />
Auf den kommenden Seiten haben wir knapp und strukturiert die wesentlichen<br />
Gesetze, Verordnungen und Fördermöglichkeiten dargestellt. Um Sie auf den<br />
allerneuesten Stand zu setzen, haben wir zudem die dazugehörigen Verlinkungen<br />
ins Internet angegeben.<br />
57<br />
Gesetze/Verordnungen/<br />
Fördergelder
Gesetze/Verordnungen/<br />
Fördergelder<br />
58<br />
§<br />
Die wichtigsten Gesetze in Kürze<br />
Wer sich jetzt für umweltschonende Heizungstechnik entscheidet, den<br />
belohnt der Staat: Bauherren oder Hausbesitzer, die mit erneuerbaren<br />
Energien heizen, erhalten Fördergelder von bis zu mehreren Tausend<br />
Euro. Wer mit Hilfe von Solarkollektoren, Wärmepumpen, Biomassekesseln<br />
oder Brennwertheizungen mit Solarunterstützung auf umweltschonende<br />
Heiztechnik setzt, spart nicht nur kräftig bei den Heizkosten,<br />
sondern sichert sich gleichzeitig Klimaprämien vom Staat. Die<br />
Vergabe der Fördergelder ist vielseitig und hängt unter anderem vom<br />
eingesetzten Heizungstyp, seiner Leistung und der Größe der Immobilie<br />
ab.<br />
EnEV<br />
Die Anfang 2002 in Kraft getretene Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine Zusammenführung<br />
der Wärmeschutzverordnung und der Heizungsanlagenverordnung. Sie<br />
begrenzt den maximal zulässigen Primärenergiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung<br />
eines Gebäudes. Die von der Energieeinsparverordnung vorgegebene<br />
Begrenzung des maximal zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs (Qpmax, EnEV) darf<br />
nicht überschritten werden. Derzeit gilt die EnEV 2009; eine weitere Verschärfung der<br />
energetischen Anforderungen ist für 2012 angekündigt.<br />
www.enev-online.de<br />
EEWärmeG<br />
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) schreibt Eigentümern von<br />
Gebäuden, die ab dem 1. Januar 2009 neu errichtet werden, eine Pfl icht zur anteiligen<br />
Nutzung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung vor. Diese Pfl icht gilt sowohl<br />
für private und öffentliche als auch gewerbliche Immobilien. Zu den erneuerbaren<br />
Energien zählen Sonnenenergie, Geothermie, Umweltwärme und Biomasse. Eine Kombination<br />
unterschiedlicher Energiequellen ist dabei ebenso möglich wie Maßnahmen,<br />
die ähnlich klimaschonend wirken. Dazu zählt beispielsweise die Kraft-Wärme-Kopplung,<br />
also die Erzeugung von Strom bei gleichzeitiger Wärmenutzung.<br />
www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/40512.php
Fördermöglichkeiten in Kürze<br />
Bund, Länder, Kommunen und Energieversorger bieten Ihnen für Ihre neue Heizan-<br />
lage vielfältige Fördermöglichkeiten. Grundsätzlich gibt es zwei Förderarten: Neben<br />
Investitionszuschüssen bietet die Kreditanstalt für Eiederaufbau (KfW) zinsgünstige<br />
Darlehen an. Seit Jahresbeginn 2009 fördert die KfW auch Einzelmaßnahmen wie die<br />
Erneuerung der Fenster oder den Einbau eines Brennwertkessels mit zinsgünstigen<br />
Krediten.<br />
www.kfw-foerderbank.de<br />
Umfangreiche Fördermaßnahmen vom Bund<br />
Seit März 2009 ist die neue Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt<br />
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
gültig. Die Maßnahmen bestehen aus Investitionszuschüssen, die über das Bundesamt<br />
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgewickelt werden, und den Programmen<br />
der KfW. Eine neue Bonusförderung soll weitere Investitionsanreize schaffen, indem sie<br />
besonders innovative und hocheffi ziente Lösungen zusätzlich unterstützt.<br />
www.kfw-foerderbank.de<br />
www.bafa.de<br />
Marktanreizprogramm des BAFA<br />
Das Marktanreizprogramm (MAP) 2009 des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
(BAFA) bietet vielfältige Möglichkeiten zur Förderung von Heizungsanlagen,<br />
die ganz oder teilweise auf erneuerbaren Energieträgern aufbauen. Dank dieser Förderungen<br />
reduzieren sich die Kosten für eine Solaranlage, eine Wärmepumpe oder einen<br />
Pelletheizkessel effektiv um die Förderung, die vom Staat erstattet wird.<br />
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_uebersicht_basis_und_bonusfoerderung.pdf<br />
Förderung von Mini-KWK-Anlagen<br />
Seit dem Inkrafttreten der Richtlinie zur Förderung von Mini-KWK-Anlagen am 1. Juli<br />
2008 und deren Weitergeltung ab dem 1. Januar 2009 kann die Neuerrichtung von<br />
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 50 kW<br />
(„Mini-KWK-Anlagen“) bezuschusst werden.<br />
www.bafa.de/bafa/de/energie/kraft_waerme_kopplung/index.html<br />
www.bmu.de/klimaschutzinitiative/nationale_klimaschutzinitiative/impulsprogramm_<br />
mini_kwk_anlagen/doc/41793.php<br />
59
Gesetze/Verordnungen/<br />
Fördergelder<br />
60<br />
Förderung von Solarthermie<br />
Wer mit Hilfe von Sonnenkraft das Trinkwasser erwärmt und zusätzlich Solarwärme in<br />
den Heizkreislauf einspeist, erhält als Basisförderung vom Staat 105 Euro je angefangenen<br />
Quadratmeter Bruttokollektorfl äche. Übertrifft das Gebäude heutige Dämmstandards,<br />
so erhöht sich die Prämie mit einem zusätzlichen Effi zienzbonus auf bis zu 210<br />
Euro je Quadratmeter.<br />
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_uebersicht_basis_und_bonusfoerderung.pdf<br />
Förderprogramm Wärmepumpen<br />
Der Einbau moderner Wärmepumpen wird ebenfalls vom Staat gefördert. Die Zuschüsse<br />
hängen vor allem vom Gebäude, von der beheizten Wohnfl äche und der verwendeten<br />
Wärmequelle (Luft, Wasser oder Erdwärme) ab. Als Nachweis der beheizten Flächen<br />
dienen bei einem Fördermittelantrag Grundrisspläne oder der Kaufvertrag der Immobilie.<br />
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_uebersicht_basis_und_bonusfoerderung.pdf<br />
Holzpelletkessel: umfangreiche Programme mit hohen Fördersummen<br />
Bei Pelletkesseln richtet sich die Förderung nach dem jeweiligen Typ der Anlage und<br />
nach der Ausstattung – beispielsweise mit einem Pufferspeicher, der die erzeugte<br />
Wärme aufnimmt, speichert und bei Bedarf in den Heizkreislauf einspeist. Neben der<br />
Mindestförderung gewährt der Staat einen Bonus pro Kilowatt Heizleistung.<br />
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_uebersicht_basis_und_bonusfoerderung.pdf<br />
Lokale Bonussysteme<br />
Viele lokale Energieversorger oder auch Bundesländer wie das Land Sachsen locken<br />
mit weiteren Bonussystemen. So erhalten beispielsweise Kunden der GEW Rheinenergie<br />
in Köln pauschal 510 Euro für die Installation von thermischen Solarkollektoren. Die<br />
Stadtwerke Sondershausen bezuschussen den Einbau von Erdgas-Brennwerttechnik<br />
mit 250 Euro. E.ON Bayern bietet seinen Kunden für die Umstellung auf eine effi ziente<br />
Brennwertheizung mit Solarkollektoren einen Bonus von 600 Euro. Partner der Aktion,<br />
beispielsweise der Heizungssystemlieferant <strong>Vaillant</strong>, gewähren zusätzlich 150 Euro<br />
Rabatt auf eine neu installierte Anlage. Für Mehrparteienhäuser sind sogar bis zu 1.875<br />
Euro möglich.<br />
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web<br />
Eine Gesamtübersicht über alle staatlichen Fördermittel sowie einen Förderrechner gibt<br />
es im Internet unter:<br />
www.vaillant.de/Privatkunden/Foerdermittel
Mit minimalem Aufwand zur maximalen Förderung<br />
Das <strong>Vaillant</strong> Förder-Wunder hilft Ihnen, sich mühelos die maximale Fördersumme beim<br />
Staat zu sichern, da sich die <strong>Vaillant</strong> Experten für Sie durch den „Förder-Dschungel“<br />
kämpfen.<br />
So funktioniert’s:<br />
1. Ihren Fachpartner mit dem Förder-Wunder beauftragen<br />
Dieser sendet das Angebot der geplanten Heizanlage mit erneuerbaren Energien<br />
zusammen mit einer Checkliste an <strong>Vaillant</strong>. Für <strong>Vaillant</strong> Kunden ist das Angebot<br />
kostenfrei.<br />
2. Experten ermitteln Ihre optimale Fördersumme<br />
Die Spezialisten bei <strong>Vaillant</strong> prüfen alle verfügbaren Fördermöglichkeiten auf<br />
Bundes- und Landesebene sowie alle regionalen Sonderprogramme für Ihren<br />
Standort und Ihr Vorhaben. Ihr Heizungsfachmann erhält danach alle relevanten<br />
und bereits ausgefüllten Anträge und reicht diese an Sie weiter.<br />
3. Anträge abschicken<br />
Erst jetzt kommen Sie ins Spiel: Sie tragen nur noch Ihre Kontonummer ein,<br />
unterschreiben die Anträge und senden sie in dem von <strong>Vaillant</strong> voradressierten<br />
Briefumschlag fristgerecht ab.<br />
61
62<br />
Kleine Geschichte der Heiztechnik<br />
Eine wohlig warme Wohnung ist ein Luxus der Neuzeit. Aber auch die<br />
alten Römer wollten nicht vor Kälte schlottern und haben ihren Erfi ndungsgeist<br />
spielen lassen. Ein kleiner Überblick über vergangene und<br />
aktuelle Formen der Wärmeerzeugung.<br />
Bereits die Neandertaler froren nicht gern. Sie machten sich vor 130.000 Jahren in<br />
kalten Zeiten das Feuer als Wärmeerzeuger zunutze. Die Römer haben in der Folge<br />
bereits eine wesentlich komfortablere Heizlösung angeboten: die Fußbodenheizung.<br />
Ca. 80 v. Chr. hat der römische Architekt Gaius Sergius Orata warme Luft in Hohlräume<br />
unter dem Fußboden und später auch in die Wände geleitet. Diese Technik war kostspielig<br />
und letztlich nur der wohlhabenden Bevölkerung zugänglich. Die breite Mehr heit<br />
griff weiterhin auf das offene Feuer zur Raumbeheizung zurück.<br />
Bis ins Mittelalter diente das Lagerfeuer in der Lehmhütte als Wärmequelle und als<br />
wichtiger Versammlungsort zugleich. Die Feuerstätte war eine fl ache Steingrube in der<br />
Raum mitte. Ab dem 8. Jahrhundert verdrängte ein gemauerter Herd zusehends die<br />
offene Feuerstelle. Er war in den Boden eingelassen und stand ebenfalls in der Mitte des<br />
Rau ms. So verringerte sich zum einen das Brandrisiko, zum anderen dachten die Leute<br />
schon damals äußerst energieeffi zient: Während beim offenen Feuer nur 20 bis 30<br />
Prozent der Energie genutzt werden konnten, besaß der Herd durch seine Fähigkeit zur<br />
Wärmespeicherung eine wesentlich höhere Effi zienz.<br />
Im 14. Jahrhundert tauchte erstmalig – vor allem im Alpenraum – der Kachelofen als<br />
Wärmequelle auf. Wieder einmal war das Thema Energieeffi zienz die treibende Innovationskraft.<br />
Die Ofenkacheln besaßen aufgrund einer speziellen Tonmischung eine<br />
besonders hohe Wärmespeicherfähigkeit. Noch lange nach Erlöschen des Feuers gaben<br />
die aufgeheizten Kacheln ihre Wärme an die Umwelt ab. Beheizt wurde zunächst mit<br />
Holz, später mit Kohle, Koks und Anthrazit.<br />
Der Schwede Marten Trifvald entwickelte im Jahr 1716 die Frühform einer Zentralheizung,<br />
die Warmwasserheizung. Sie diente zur Beheizung eines Treibhauses im englischen<br />
Newcastle. Ab 1850 ließen sich einige Fürsten und wohlhabende Bürger Warmwasserheizungen<br />
in ihre Schlösser und Villen einbauen. Für die breite Mehrheit der<br />
Bevölkerung blieb diese Form der Wärmeerzeugung unerschwinglich.
1868 wurde von Benjamin Maughan in England der erste gasbeheizte Warmwasserbereiter<br />
gebaut. Dieser englische Warmwasserbereiter war zweifellos den bereits bekannten<br />
Kohlebadeöfen nachgebaut, indem ein einfacher Brenner mit einer einzigen Gasaustrittsöffnung<br />
anstelle des Kohlerosts eingesetzt wurde.<br />
Der gelernte Kupferschmied und Pumpenmacher Johann <strong>Vaillant</strong> meldete 1894 den<br />
Gasbadeofen „geschlossenes System“ zum Patent an. Das Novum: Badewasser wurde<br />
durch ein Rohr geleitet und kam nicht mehr direkt mit den Abgasen in Berührung, wie<br />
es bei den frühen Formen des Durchlauferhitzers der Fall war. 1905 kam der erste<br />
wandhängende Durchlauferhitzer auf den Markt: der „Geyser“. Der Begriff wurde den<br />
isländischen „Geysiren“, Quellen auf Island, die heißes Wasser speien, entlehnt. Den<br />
Warmwassergeräten folgte 1924 der erste Zentralheizungskessel, ebenfalls entwickelt<br />
von Johann <strong>Vaillant</strong>.<br />
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 60er-Jahre war die Dreier-Kombination<br />
von Gasherd, Gaseinzelofen und Gaswasserheizer eine weitverbreitete Lösung<br />
im Ein- und Mehrfamilienhaus. Bis in die 70er-Jahre hinein konnten sich lediglich<br />
12 Prozent der deutschen Haushalte eine Zentralheizung leisten. Kohleöfen, die mit<br />
Kohlebriketts betrieben wurden, waren die häufi gste Heizlösung. Die Zentralheizung<br />
trat in den 70er-Jahren ihren Siegeszug an: Sukzessive wurden viele Wohnungen<br />
umgerüstet, bei Neubauten gehörte sie dann zum bautechnischen Standard.<br />
In den 80er-Jahren entstanden Niedertemperatur- und Brennwerttechnik. Gas-Heizgeräte<br />
mit Niedertemperaturtechnik zeichnen sich durch eine an die aktuellen Erfordernisse<br />
angepasste Wärmeerzeugung aus. Das Wasser im Heizungskreislauf wird nur so<br />
weit aufgeheizt, wie es die Außentemperatur und die Vorgaben des Gebäudeeigentümers<br />
erforderlich machen.<br />
Heute gelten Brennwertgeräte als Stand der Technik. Sie nutzen zusätzlich zur messbaren<br />
Wärme des Abgases die im Wasserdampf enthaltene Wärme, die ansonsten durch<br />
den Schornstein verloren gehen würde. Aktuelle Brennwertgeräte arbeiten an der<br />
Grenze des physikalisch Machbaren. Darüber hinaus spielen Produkte auf Basis<br />
erneuerbarer Energien, wie Wärmepumpen, Pelletheizungen, Solarsysteme und<br />
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, in der modernen Heiztechnik eine immer größere<br />
Rolle. Die klassische Heizung ist mittlerweile zum umfassenden System herangereift,<br />
das Abgasführung, Regelung, Warmwasserspeicher und vor allen Dingen auch Ergänzungen<br />
um erneuer bare Energieträger intelligent miteinander kombiniert.<br />
63
64<br />
Aktuelle Förderstufen in Alt- und Neubau<br />
Was ist eigentlich ein…<br />
…KfW-Effi zienzhaus 130<br />
Der Primärenergiebedarf sanierter Gebäude darf maximal 30 Prozent höher sein<br />
als der Energiebedarf, der nach der EnEV 2009 für das Referenzgebäude zulässig<br />
ist. Der Transmissionswärmeverlust darf 45 Prozent über dem Wert des Referenzgebäudes<br />
liegen. Die Altbau-Förderstufe KfW-Effi zienzhaus 130 wird zeitlich befristet<br />
voraussichtlich bis zum 30. Juni 2010 angeboten.<br />
…KfW-Effi zienzhaus 115<br />
Der Energiebedarf sanierter Gebäude darf maximal 15 Prozent und der Transmissionswärmeverlust<br />
30 Prozent höher sein als die Werte des Referenzgebäudes nach<br />
EnEV 2009.<br />
…KfW-Effi zienzhaus 100<br />
Der Energiebedarf sanierter Gebäude entspricht genau dem Niveau, das die Energieeinsparverordnung<br />
für Neubauten vorschreibt. Der Transmissionswärmeverlust darf<br />
15 Prozent höher als der Wert des vergleichbaren Referenzgebäudes sein.<br />
…KfW-Effi zienzhaus 85<br />
Das sanierte oder neu errichtete Gebäude benötigt nur 85 Prozent des Energiebedarfs<br />
des Referenzgebäudes. Der Transmissionswärmeverlust entspricht genau dem<br />
Wert des Referenzgebäudes nach EnEV 2009. Diese Förderstufe gibt es für Sanierungen<br />
und für Neubauten – für Neubauten allerdings befristet bis zum 30. Juni 2010.<br />
…KfW-Effi zienzhaus 70<br />
Gilt für Neubauten, die mit 70 Prozent des Energiebedarfs eines vergleichbaren Referenzgebäudes<br />
auskommen. Der Transmissionswärmeverlust muss 15 Prozent unter<br />
dem Wert des Referenzgebäudes liegen.<br />
…KfW-Effi zienzhaus 55<br />
Benötigt nur 55 Prozent der Energie, die ein Neubau in Deutschland maximal verbrauchen<br />
darf. Der Transmissionswärmeverlust liegt bei 70 Prozent im Vergleich zum<br />
Referenzgebäude. Es ist derzeit der höchste von der KfW gesetzte Förderstandard<br />
und gilt ab Anfang 2010.
Zwei Zeitschriften – ein Inhalt<br />
Die Zeitschriften „Mein <strong>EigenHeim</strong>“ und „Wohnen&Leben“ sind die meistgelesene Aufl age aller Bausparkassen-Zeitschriften<br />
in Deutschland. Viermal jährlich informieren sie zu allen Themen rund ums Bauen,<br />
Wohnen und Leben. Der Inhalt beider Titel ist dabei weitgehend identisch.<br />
Dem Bereich „Heizung“ wird in den Zeitschriften besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So fi nden Sie das<br />
eine oder andere Thema aus diesem Buch in Form von redaktionellen Beiträgen auch in „Mein <strong>EigenHeim</strong>“<br />
bzw. „Wohnen&Leben“ wieder.<br />
Zusätzlich bieten die Zeitschriften jede Menge Tipps zum Energiesparen, fürs Renovieren und zum Selbermachen.<br />
Darüber hinaus aber auch Neuheiten und Trends für Bad, Küche, Kinder- und Schlafzimmer sowie<br />
den Garten.<br />
Sie kennen „Mein <strong>EigenHeim</strong>“ und „Wohnen&Leben“ noch nicht? Dann fordern Sie doch einfach gleich ein<br />
Gratis-Exemplar an. Hier erhalten Sie es kostenlos und ohne jede Verpfl ichtung:<br />
Mein <strong>EigenHeim</strong>/Wohnen&Leben<br />
Leserservice<br />
Postfach 3261<br />
D-73752 Ostfi ldern<br />
Tel. 07 11-280 40 60-10<br />
Fax 07 11-280 40 60-70<br />
Wohnen Leben<br />
KINDER-KÜCHE<br />
Mit Sarah Wiener SEITE 30<br />
NEUE HEIZTECHNIK<br />
Rechtzeitig zum Saisonbeginn SEITE 70<br />
& 3/2009<br />
AUUUUUUUSSSSS UUUUUSSSSS SSSSSSZZZZZZZEEEE SSSSZZZ<br />
SEITEN 16, 26, 76<br />
LEICHTER ER DURCH DURCH DEN ALLTAG<br />
Platz Platz sc schaffen<br />
Terminplan Termin entschlacken<br />
Entspannt Entspa gärtnern<br />
Sie können sich Ihr Probeheft auch online bestellen. Schauen Sie unter<br />
www.mein-eigenheim.de oder www.wul-online.de<br />
Mehr als zwei Millionen Leser sind von den Zeitschriften begeistert. Sie auch?<br />
<strong>EigenHeim</strong> genHe<br />
BAUEN WOHNEN LEBEN<br />
<strong>EigenHeim</strong><br />
TOP THEMA<br />
ENERGIE<br />
CLEVER KOCHEN<br />
Stromfresser raus! SEITE 24<br />
BAUEN 2009<br />
Ihr Weg zum Energiesparhaus SEITE 8<br />
Mein <strong>EigenHeim</strong> und Wohnen&Leben sind die Medienpartner dieser <strong>Vaillant</strong> Publikation.<br />
!<br />
NNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN<br />
&ENERGIE SONNETANKEN<br />
SEITE 8, 44<br />
BAUEN WOHNEN LEBEN<br />
SPAREN<br />
2/2009
Wichtige Links:<br />
BINE Informationsdienst (Bürgerinformation Neue Energien) –<br />
Service des Fachinformationszentrums (FIZ) Karlsruhe<br />
www.bine.info<br />
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
www.bafa.de<br />
Informationsseite baufoerderer.de – ein Gemeinschaftsprojekt von<br />
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und KfW-Förderbank<br />
www.baufoerderer.de<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)<br />
www.kfw-foerderbank.de<br />
NRW.BANK – Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
www.nrwbank.de/de/wohnraumportal<br />
<strong>Vaillant</strong> Förderwunder<br />
www.vaillant.de/Privatkunden/Foerdermittel/Foerder-Wunder<br />
Herausgeber<br />
<strong>Vaillant</strong> GmbH<br />
Berghauser Straße 40<br />
D-42859 Remscheid<br />
Tel. 0 21 91-18 0<br />
Fax 0 21 91-18 28 10<br />
E-Mail: info@vaillant.de<br />
Medienpartner<br />
Mein <strong>EigenHeim</strong>/Wohnen&Leben<br />
Postfach 3261<br />
D-73752 Ostfi ldern<br />
Vertrieb<br />
<strong>Vaillant</strong> GmbH<br />
www.vaillant.de<br />
Mein <strong>EigenHeim</strong>/Wohnen&Leben<br />
www.mein-eigenheim.de<br />
www.wul-online.de<br />
Redaktion<br />
Dr. Jens Wichtermann (verantwortlich)<br />
Corinna Wnuck<br />
Gestaltung<br />
Gerlach&Partner, Köln<br />
Fotos<br />
Bernd Gabriel, iStockphoto,<br />
Joachim Stretz, Shutterstock, <strong>Vaillant</strong><br />
Druck<br />
Kunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen