Der Körper in seiner Umwelt - Myoreflextherapie
Der Körper in seiner Umwelt - Myoreflextherapie
Der Körper in seiner Umwelt - Myoreflextherapie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Weitere Pr<strong>in</strong>zipien und Aspekte lassen sich dieser Dynamik zuordnen:<br />
<strong>Der</strong> Zeichenklasse der Ikons entsprechen Wahrnehmungen, die<br />
zunächst nicht auf etwas anderes verweisen, sondern e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terne<br />
Bedeutung haben (vgl. Peirce 1998). <strong>Körper</strong>lich entspricht die<br />
Zeichenklasse der Ikone dem, was von Uexküll im Anschluss an<br />
Plessner als <strong>Körper</strong>-Se<strong>in</strong> benennt. (Vgl. Uexküll u.a. 1997, S. 79;<br />
Uexküll u.a. 2002, S. 127, 144f; Plessner 1961, S. 190).<br />
Demgegenüber entsprechen <strong>in</strong>dexikalische Zeichen Korrespondenzen<br />
und Zusammenhängen wie dem von Anstrengung und Widerstand.<br />
„E<strong>in</strong> Index ist e<strong>in</strong> Zeichen, dessen zeichenkonstitutive Beschaffenheit<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zweiheit [...] liegt.“ (Peirce 1998, S. 65) Diese Zeichenklasse<br />
entspricht dem, was Uexküll <strong>in</strong> Anlehnung an Plessner als <strong>Körper</strong>-<br />
Haben beschreibt. Die Erstheit der ikonischen Zeichenprozesse<br />
entspricht autonomen Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, bei<br />
denen die „passenden Gegenleitungen“ der <strong>Umwelt</strong> und die<br />
„passenden Gegenrollen“ der Mitwelt sich im S<strong>in</strong>ne des<br />
kommunikativen Realitätspr<strong>in</strong>zips e<strong>in</strong>spielen und sich quasi<br />
selbstverständlich e<strong>in</strong>stellen. Demgegenüber bedarf es bei der<br />
Zweiheit der <strong>in</strong>dexikalischen Zeichenprozesse autarker<br />
Wahrnehmungs- und Handlungsmuster im S<strong>in</strong>ne des pragmatischen<br />
Realitätspr<strong>in</strong>zips.<br />
Bei der Erläuterung des Begriffs der Autonomie hebt von Uexküll die<br />
dialektische Grundstruktur des Verhaltens deutlich hervor:<br />
"<strong>Der</strong> Begriff 'Autonomie' bezeichnet als umweltoffenes und umweltabhängiges<br />
Verhalten im Grunde e<strong>in</strong>e Paradoxie. Denn Autonomie oder<br />
'Selbstgesetzlichkeit' muss ständig das Verhalten der Umgebung <strong>in</strong> das<br />
eigene Verhalten e<strong>in</strong>beziehen. Das geschieht [...] so konsequent, dass<br />
Autonomie geradezu e<strong>in</strong> Beweis für Integration <strong>in</strong> die physische <strong>Umwelt</strong><br />
und die soziale Mitwelt ist. Dies [...] wird erst e<strong>in</strong>sichtig, wenn wir uns<br />
Rechenschaft geben, dass jede Leistung unseres <strong>Körper</strong>s e<strong>in</strong>er<br />
passenden Gegenleistung se<strong>in</strong>er physischen <strong>Umwelt</strong> und dass im sozialen<br />
Bereich jede unserer Rollen der passenden Gegenrolle der Mitwelt<br />
bedarf." (Uexküll u.a. 1997, S. 77; Hervorhebungen von K.M. & R.M.)<br />
Im Gegensatz zu diesem passenden Verhältnis von Subjekt und<br />
<strong>Umwelt</strong> treten bei e<strong>in</strong>em Verhalten der Autarkie die eigene<br />
Willkürmotorik und Kraftanstrengung e<strong>in</strong>erseits und der Widerstand der<br />
Umgebung (ihr Gegen-Stand) andererseits <strong>in</strong> den Vordergrund.<br />
E<strong>in</strong> Zuviel an Integration und Passung bzw. e<strong>in</strong> Zuwenig an Widerstand<br />
käme e<strong>in</strong>er ozeanischen Auflösung und e<strong>in</strong>em Sich-Verlieren des<br />
Eigen-<strong>Körper</strong>s gleich (s.o.). Kommt es umgekehrt zu e<strong>in</strong>em<br />
pathogenetischen bzw. traumatischen Zuwenig an Passung bzw. zu<br />
e<strong>in</strong>em Zuviel an Widerstand, so führt dies ebenfalls zu e<strong>in</strong>er<br />
Schädigung und e<strong>in</strong>em Selbstverlust des Eigenkörpers. In diesem Fall<br />
– so unsere These – zerbricht und missl<strong>in</strong>gt die Dialektik der<br />
<strong>Körper</strong>lichkeit: Die Erfahrung se<strong>in</strong>er selbst als Gegenstand, deren der<br />
Eigenkörper bedarf, verselbständigt sich und spaltet sich ab. Das<br />
Eigene, der eigene <strong>Körper</strong> ersche<strong>in</strong>t als Äußeres und Fremdes. Die<br />
Selbstregulation des <strong>Körper</strong>s gestaltet sich dann nicht-dialektisch.<br />
6


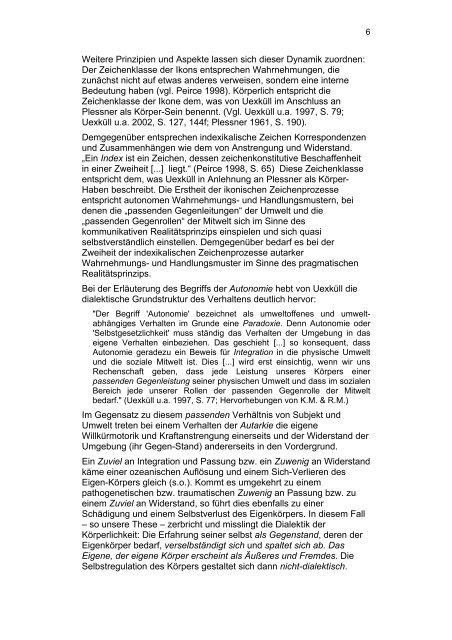
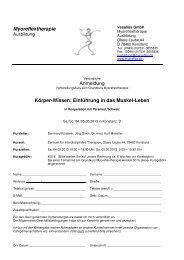
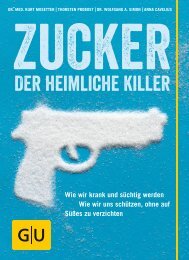





![Glykoplan [Kurzform]](https://img.yumpu.com/21621254/1/184x260/glykoplan-kurzform.jpg?quality=85)


![Glykoplan [ausführlich]](https://img.yumpu.com/21143639/1/184x260/glykoplan-ausfuhrlich.jpg?quality=85)

