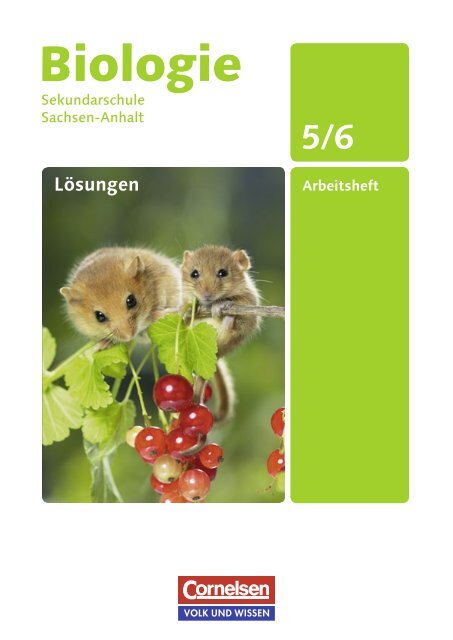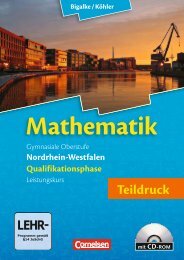Download (PDF: 6 MB) - Cornelsen Verlag
Download (PDF: 6 MB) - Cornelsen Verlag
Download (PDF: 6 MB) - Cornelsen Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Biologie<br />
Sekundarschule<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Lösungen<br />
5/6<br />
Arbeitsheft
1<br />
2<br />
Kennzeichen der Lebewesen<br />
Kennzeichen des Lebendigen<br />
Pflanzen, Pilze und Tiere sowie Menschen sind Lebewesen und zeigen bestimmte Kennzeichen, durch die wir<br />
sie eindeutig von unbelebten Gegenständen unterscheiden können. Erinnerst du dich an die Kennzeichen<br />
der Lebewesen? → SB/S. 21<br />
Auf den Abbildungen sind Kennzeichen der Lebewesen dargestellt. Finde heraus, welche Abbildungen<br />
zusammengehören, weil sie das gleiche Kennzeichen veranschaulichen. Verbinde sie mit Linien.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Jeweils ein mit einer Zahl bezeichnetes Bild gehört mit einem der mit einem Buchstaben bezeichneten<br />
Bilder zusammen. Ordne zu und begründe deine Lösung.<br />
Abbildung 1 und c gehören zusammen, weil die Küken und die Früchte das Kennzeichen<br />
„Fortpflanzung“ darstellen. Bild 2 und a gehören zusammen, weil sowohl beim Elefanten als auch bei der<br />
Eiche Wachstum und Entwicklung ablaufen. Bild 3 und b gehören zusammen, weil sie Reizbarkeit und<br />
Bewegung beim Fuchs und bei der Mimose veranschaulichen.<br />
Merk dir!<br />
Lebewesen haben Kennzeichen, die sie von unbelebten Gegenständen unterscheiden.<br />
a<br />
b<br />
c<br />
1
2 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
Leben unter Wasser – Fische<br />
Fische sind mit ihrem Körperbau (z. B. Stromlinienform, Kiemen als Atmungsorgane) an das Leben im Wasser<br />
angepasst und können sich daher in diesem Lebensraum scheinbar mühelos bewegen.<br />
Beschrifte den äußeren Körperbau mit den richtigen Begriffen.<br />
Maul<br />
Kiemendeckel<br />
Auge Schuppen Seitenlinienorgan<br />
Brustflossen<br />
Kopf<br />
Rumpf<br />
Bauchflossen<br />
Schwanz<br />
Rückenflosse<br />
Schwanzflosse<br />
Afterflosse<br />
Fische steuern das Schweben im Wasser mit der Schwimmblase (grau).<br />
Welcher der beiden abgebildeten Fische schwebt an der Wasseroberfläche und welcher tief unten?<br />
Begründe deine Antwort. → SB/S. 31<br />
Dieser Fisch befindet sich an der Wasserober-<br />
fläche. Seine Schwimmblase ist prall mit Luft<br />
gefüllt. Dadurch kann er oben schweben.<br />
Dieser Fisch befindet sich am Gewässergrund.<br />
Seine Schwimmblase enthält kaum Luft.<br />
Dadurch sinkt er ab.
1<br />
Fischnachwuchs im Aquarium<br />
Zebrabärblinge sind anspruchslose Aquarienfische, die ursprünglich aus den<br />
Bächen und Flüssen Vorderindiens stammen. Die Abbildung zeigt die Fortpflanzung<br />
und Entwicklung dieser bis zu 5 cm langen Fische: Das deutlich<br />
schlankere Männchen 1 gibt den Samen („Milch“) 8 ins freie Wasser<br />
ab. Das Zebrabärblingsweibchen 5 entlässt seine Eier („Rogen“) 2<br />
ebenfalls ins Wasser. Hier erfolgt auch die Befruchtung der Eier<br />
durch den Samen. Im befruchteten Ei 4 entwickelt sich eine<br />
Zebra bärblingslarve 3, die bald im Wasser schwimmen kann.<br />
Diese Dottersacklarve 7 ernährt sich zuerst von den<br />
Nährstoffen, die sich im Dottersack befinden. Der Jungfisch<br />
6 besitzt keinen Dottersack mehr, er muss sich<br />
selbstständig ernähren. → SB/S. 32 – 33<br />
Suche in der Abbildung die beschriebenen<br />
Entwicklungsstadien. Trage die Ziffern<br />
jeweils in die richtigen Kreise ein.<br />
8<br />
1<br />
5<br />
2<br />
4<br />
3<br />
7<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
6<br />
3
4 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
Lurche führen ein Doppelleben<br />
Im Frühjahr kannst du in vielen Gewässern kleine kugelige Gebilde sehen. Dies sind meist Eier bzw. der<br />
Laich von Lurchen. Aus befruchteten Eiern entwickeln sich ihre Nachkommen. → SB/S. 35<br />
Oft kannst du schon am Ablageplatz erkennen, um welche Lurchart es sich handelt.<br />
a Übertrage folgende Überschrift auf eine neue Seite in deinem Biologieheft: Der Laich der Lurche.<br />
b Fertige eine Kopie dieser Seite an. Schneide die Abbildungen und Textpäckchen von der kopierten<br />
Seite aus.<br />
c Lies die Texte sorgfältig durch und ordne sie den Abbildungen zu.<br />
d Klebe sie dann richtig geordnet in dein Biologieheft und ordne jedem Bild-Text-Paar den Namen<br />
des passenden Lurches zu.<br />
e Markiere im Text die Lurchart, die Laichzeit und die Art des Laiches (z. B. Ballen, einzeln).<br />
f Gestalte die Abbildungen nach den Angaben im zugehörigen Text farbig.<br />
Erdkröte Wasserfrosch<br />
Die Erdkröte laicht etwa um dieselbe Zeit wie der<br />
Grasfrosch. Die Erdkröte Sie laicht bildet etwa zweireihige um dieselbe Laichschnüre Zeit wie der<br />
(bis Grasfrosch. 5 m lang), Sie die bildet zwischen zweireihige den Wasserpflanzen<br />
Laichschnüre (bis<br />
aufgehängt 5 m lang), die werden. zwischen Erdkröten den Wasserpflanzen brauchen daher aufge-<br />
Gewässer hängt werden. mit Röhricht Erdkröten oder brauchen andere daher WasserpflanGewäszenser mit zum Röhricht Anheften oder ihrer andere Laichschnüre. Wasserpflanzen Die Eier zum<br />
sind Anheften nicht ihrer auffällig Laichschnüre. gefärbt. Die Eier sind nicht<br />
auffällig gefärbt.<br />
Der Laich des Wasserfroschs fällt kaum auf, da<br />
er Der erst Laich im Mai/Juni des Wasserfroschs abgegeben fällt wird kaum und auf auf, dem da<br />
Grund er erst im des Mai/Juni Gewässers abgegeben liegt. Die wird Eier und sind auf klein, dem<br />
oben Grund braun, des Gewässers unten gelblich. liegt. Die Entsprechend Eier sind klein, klein oben<br />
sind braun, die unten Kaulquappen. gelblich. Entsprechend Der Wasserfrosch klein sind braucht die<br />
Gewässer Kaulquappen. mit reichem Der Wasserfrosch Pflanzenbewuchs. braucht Der Gewäs-<br />
Laich ser mit des reichem Teichfroschs Pflanzenbewuchs. sieht ähnlich Der aus. Laich des<br />
Teichfroschs sieht ähnlich aus.<br />
Teichmolch<br />
Im April kommt es zur auffallenden Balz der<br />
Grasfrosch<br />
Der Grasfrosch legt von Ende Februar bis Anfang<br />
Teichmolche. Nach der Befruchtung legt das<br />
April große Laichballen ab, die an der Wasser-<br />
Weibchen Im April kommt 100 bis es 400 zur durchsichtige, auffallenden Balz nicht der auf fällig oberfläche Der Grasfrosch schwimmen. legt von Ende Die Eier Februar sind sehr bis Anfang dunkel.<br />
gefärbte Teichmolche. Eier einzeln Nach der ab Befruchtung und heftet sie legt an das Wasser- Grasfroschlaich April große Laichballen findet man ab, die meist an in der seichten Wasserpflanzen.<br />
Weibchen Dabei 100 bis werden 400 durchsichtige, oft einzelne nicht Blättchen auf fällig um- Wasseransammlungen oberfläche schwimmen. oder Die Eier in flachen sind sehr Buchten dunkel.<br />
gebogen. gefärbte Eier Teichmolche einzeln ab benötigen und heftet stehende sie an Wasserpflan- größerer Grasfroschlaich Gewässer. findet Dort man kommt meist es in durch seichten Sonnenzenreichepflanzen.<br />
Dabei Gewässer werden zum oft Laichen. einzelne Blättchen<br />
einstrahlung Wasseransammlungen zu einer kurzen oder in Entwicklungszeit.<br />
flachen Buchten<br />
umgebogen. Teichmolche benötigen stehende<br />
größerer Gewässer. Dort kommt es durch Sonnen-<br />
pflanzenreiche Gewässer zum Laichen.<br />
einstrahlung zu einer kurzen Entwicklungszeit.
1<br />
2<br />
Wie sich Erdkröten fortpflanzen und entwickeln<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Erdkröten leben in Wäldern und Parks. Hier ernähren sie sich von Regenwürmern, Schnecken, Asseln<br />
und Käfern. Nach der Winterruhe (März/April) wandern die Kröten zu ihrem Laichgewässer (Teich,<br />
Tümpel, Graben). Es ist immer diejenige Wasserstelle, in der sich die Kröte selbst entwickelt hat. Der<br />
Wanderweg kann oft mehrere Kilometer betragen.<br />
Am Laichgewässer paaren sich Weibchen und Männchen. Dabei geben sie Eier beziehungsweise Samenfäden<br />
in das Wasser ab. Hier, also außerhalb des weiblichen Körpers, erfolgt auch die Befruchtung.<br />
Warum paaren sich die Kröten eigentlich? Notiere eine Erklärung dafür.<br />
Die Weibchen werden zur Eiablage angeregt.<br />
Samenfäden und Eier gelangen gleichzeitig ins Wasser.<br />
Erst dadurch wird die Befruchtung ermöglicht.<br />
5<br />
4 3<br />
7<br />
Die Entwicklung vom Ei über Larvenstadien zum erwachsenen Tier wird als Verwandlung (biologisch:<br />
Metamorphose) bezeichnet. Sie kommt bei allen Lurchen vor. Die Larven atmen mit Kiemen, die erwachsenen<br />
Tiere mit einfachen Lungen und durch die feuchte Haut.<br />
In der Abbildung (oben) sind alle Entwicklungsstadien dargestellt. Ihre Bezeichnungen sind allerdings<br />
noch ungeordnet. Stelle die richtige Reihenfolge her, indem du die richtigen Ziffern in die entsprechenden<br />
Kreise einträgst:<br />
Larve mit Hinterbeinen 1, junge Kröte 2, Eier in der Laichschnur 3, Samenfäden 4, Paarung 5,<br />
Larve mit Außenkiemen 6, Befruchtung 7.<br />
6<br />
1<br />
2<br />
5
6 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
Aus der spannenden Welt der Lurche<br />
Lurche sind besonders auf ihren Wanderungen wegen der Zerstörung ihrer Lebensräume durch den Menschen<br />
stark gefährdet.<br />
Setze folgende Begriffe in den Lückentext ein:<br />
Kleingewässer, schnell, Feuchtgebiete, Autobahn, Flüssen, geringen Pflanzenbewuchs.<br />
In allen Gebieten unserer Heimat wurden und werden Feuchtgebiete und Kleingewässer be-<br />
sonders wegen Baumaßnahmen beseitigt. Jeder Radweg, jedes Bau- und Gewerbegebiet und erst recht<br />
jede Autobahn führen zur Beeinträchtigung oder sogar Vernichtung verschiedener Lebensräume.<br />
Großräumige Veränderungen in der Natur, z. B. die Begradigung von Bächen oder Flüssen ,<br />
bedrohen unsere Lurche. Denn die neuen Gewässer sind an den Ufern steil, haben oft ein befestigtes<br />
Bett, fließen viel zu schnell und weisen nur einen geringen Pflanzenbewuchs auf.<br />
In Deutschland sind alle Lurche geschützt. In dem folgenden Rätsel haben sich zwölf von ihnen<br />
versteckt. Finde sie heraus und kennzeichne sie.<br />
A L K N O B L A UU C H K R Ö T E K<br />
M O O R F R O S C H A E H K W L N<br />
F H RR A E F W B D C L F G F E M O<br />
K G O D G R A S F R O S C H C P F<br />
M L T A G H S T H U M V G U H R E<br />
P R B C B K S W K X N Z E M S S U<br />
S O AA M B L E A C L D F L N E R E<br />
V U U R C S R E F M O B B T L O R<br />
Y T C N O E F G G N A C B H K P S<br />
W X H P D E R R P O P B A V R S A<br />
L A U B F R O S C H D F U K Ö A L<br />
Z K N S X D S H Z E R G C W T T A<br />
A H K T Z K C K W X L P H L E G M<br />
L G E W U RR H V T S S X U Z E U AA<br />
M V O P V Ö M U V T U W N D Y F N<br />
F W R S T T N O U R Y Z K C V X DD<br />
C E U KK R E U Z K R Ö T E B A W E<br />
B D A L PP E N S AA L A M A N D E R
1<br />
2<br />
3<br />
Kriechtiere mögen es trocken und warm<br />
Nenne die typischen Merkmale der Kriechtiere. → SB/S. 38 – 41<br />
Kriechtiere sind wechselwarm, haben eine trockene Haut<br />
mit Hornschuppen und bewegen sich schlängelnd (kriechend) fort.<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Beschrifte die Abbildung mit den folgenden Begriffen: Lunge, Kloake, Leber, Magen, Niere, Mundöffnung,<br />
Herz, Darm, Fortpflanzungsorgan, Gehirn, Rückenmark. Hole dir Hilfe aus einem Lexikon.<br />
Mundöffnung (grün)<br />
Gehirn (gelb)<br />
Lunge (blau)<br />
Herz (rot)<br />
Rückenmark (gelb)<br />
Magen (grün)<br />
Kennzeichne die Organe mit folgenden Farben:<br />
Verdauungssystem: grün Ausscheidungsorgane: lila<br />
Nervensystem: gelb Leber: braun<br />
Blutkreislauf: rot Fortpflanzungsorgane: orange<br />
Atmungsorgan: blau<br />
Fortpflanzungsorgan (orange)<br />
Leber (braun)<br />
Darm (grün)<br />
Niere (lila)<br />
Kloake (grün)<br />
7
8 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
Fortpflanzung und Entwicklung der Zauneidechsen<br />
Im Frühjahr kommen die Zauneidechsen aus ihren Winterquartieren (z. B. frostgeschützten Erdhöhlen).<br />
Setze in den Lückentext ein: Häutung, Austrocknung, Paarung, Beschädigung, Befruchtung.<br />
Zauneidechsen pflanzen sich geschlechtlich fort. Im Frühjahr werben die Männchen um die Weibchen.<br />
Die Balz leitet die Paarung ein, dabei wird Samen in den Körper des Weibchens übertragen. Hier<br />
verschmelzen Samenfäden und Eier. Diesen Vorgang bezeichnet man als innere Befruchtung . Die<br />
befruchteten Eier reifen im Bauch des Weibchens. Es bildet sich eine derbe, pergamentartige Eihülle.<br />
Im Juni gräbt das Weibchen ein Loch in die Erde, legt ihre Eier hinein und scharrt das Gelege zu. Jetzt<br />
bewährt sich die feste Eihülle, sie schützt die Eier vor Austrocknung und Beschädigung . Nach etwa<br />
sechs Wochen schlüpfen fertig entwickelte, etwa 5 cm große Eidechsen, die sofort selbstständig leben<br />
können. Während ihres Wachstums streifen die Zauneidechsen mehrfach ihre äußere Hautschicht in<br />
Fetzen ab. Diese trockene, schuppige Hornschicht schützt die Tiere sehr gut vor Austrocknung .<br />
Da sie aber nicht mitwachsen kann, kommt es zur Häutung . Schon vorher hat sich allerdings unter<br />
der alten Haut eine neue Hornschicht gebildet.<br />
Benenne und notiere jeweils die zu erkennende Verhaltensweise der Zauneidechsen. → SB/S. 39<br />
Züngeln (riechen) Häutung<br />
Schlüpfen<br />
Paarung<br />
Eiablage
1<br />
2<br />
Vögel beobachten<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Vögel zu beobachten ist gar nicht so einfach. Sie fühlen sich sehr schnell gestört und fliegen weg.<br />
Man muss sehr leise sein und gut hinschauen. → SB/S. 42; 147 Hier kannst du schon einmal üben.<br />
Ordne den Umrissen den richtigen Artnamen zu: Haussperling – Ringeltaube – Amsel.<br />
a Jetzt wird’s bunt: Male die leeren Umrisse naturgetreu aus. Tipp: Hole dir Hilfe aus einem Bestimmungsbuch.<br />
b Vervollständige die Steckbriefe. Tipp: Auch hier kann dir ein Bestimmungsbuch helfen.<br />
Name Amsel Haussperling Ringeltaube<br />
Gestalt schlank rundlich großer Körper,<br />
Größe 25 cm 14 cm 40 cm<br />
Gefiederfarbe schwarz oder graubraun grau, braun, schwarz grau, braun<br />
Schnabelform lang, spitz kurz, spitz schmal, spitz<br />
Finde heraus, um welche Arten es sich hier handelt. Erstelle Steckbriefe zu den abgebildeten Vögeln.<br />
Name<br />
Gestalt<br />
Größe<br />
Gefiederfarbe<br />
Schnabelform<br />
kleiner Kopf<br />
Elster Buchfink Turmfalke<br />
krähenähnlich,<br />
Schwanz lang<br />
sperlingsähnlich, schlank schlank, spitze Flügel<br />
46 cm 15 cm 50 cm<br />
schwarzglänzend, weiß braun, blau, rötlich braun, dunkel gefleckt<br />
lang, spitz kurz, spitz hakenförmig<br />
9
10 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Wie Vögel fliegen<br />
Fliegen wie die Vögel – das ist ein uralter Traum des Menschen. Doch der Körper des Menschen ist nicht<br />
zum Fliegen gebaut. Erläutere, wie Vögel an das Fliegen angepasst sind.<br />
Benenne die Knochen des Vogelskeletts mit<br />
den aufgeführten Begriffen: Finger, Becken,<br />
Unterarm, Brustbein, Mittelhand, Oberarm,<br />
Handwurzel.<br />
1 Brustbein<br />
2 Handwurzel<br />
3 Finger<br />
4 Mittelhand<br />
5 Unterarm<br />
6 Oberarm<br />
7 Becken<br />
Vergleiche das Vogelskelett mit dem<br />
Hundeskelett. Notiere Unterschiede.<br />
Die Vorderbeine des Vogels sind zu<br />
Flügeln umgebildet.<br />
Besonders die Knochen von Mittelhand<br />
und Finger des Vogels sind sehr lang.<br />
Oberarm<br />
Die beiden Knochen auf der Waage stammen von einem Säugetier und einem Vogel. Male die schraffierten<br />
Flächen rot aus; sie stehen für das Knochenmark. Die punktierten Flächen malst du blau; sie<br />
kennzeichnen einen Luftraum. Welcher Knochen gehört zum Vogel, welcher zum Hund? Begründe.<br />
(rot)<br />
Das ist ein Säugetierknochen . Das ist ein Vogelknochen<br />
.<br />
2<br />
1<br />
Unterarm<br />
Handwurzel<br />
Mittelhand<br />
Finger<br />
3<br />
Rumpf<br />
Brustkorb Wirbelsäule<br />
Gliedmaßen<br />
(blau)<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Schwanz<br />
Becken<br />
7<br />
Oberschenkel<br />
Unterschenkel<br />
Fußwurzel<br />
Mittelfuß<br />
Zehen
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Fasse zusammen, warum Vögel fliegen können.<br />
Vögel besitzen ein sehr geringes Körpergewicht.<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Sie haben mit Luft gefüllte Knochen, die leichter sind als ein gleich großer Säugetierknochen.<br />
Vögel können sich auf verschiedene Arten durch die Luft bewegen: gleiten, segeln, rudern, rütteln<br />
und schwirren. Untersuche das Gleiten. Bastle dafür einen Papierflieger. Achte darauf, dass dein<br />
Flieger gleichförmig gebaut ist. Finde durch Ausprobieren die beste Wurftechnik heraus.<br />
Vergleiche unterschiedlich schwere und verschieden große Papierflieger. Baue dazu vier Flugmodelle<br />
aus den Materialien, die in der Tabelle stehen. Bestimme das Gewicht deiner Modelle und vergleiche<br />
ihre Flugzeit mithilfe einer Stoppuhr.<br />
Flugmodell Nr. Gewicht des Modells<br />
(in Gramm)<br />
1: 1 DIN-A4-Bogen<br />
2: zwei übereinandergeklebte<br />
DIN-A4-Bögen<br />
3: 1 DIN-A5-Bogen<br />
4: zwei übereinandergeklebte<br />
DIN-A5-Bögen<br />
Lösung individuell<br />
Flugzeit<br />
(in Sekunden)<br />
Führt in der Klasse einen Wettbewerb zum Gleitflug durch.<br />
Wessen Papierflieger fliegt am weitesten? Wessen Modell kann besonders langsam fliegen? Wessen<br />
Modell fliegt die schönsten Kurven?<br />
11
12 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
Die Schleiereule<br />
Eulen sind Vögel, die nachts aktiv sind.<br />
Lautlos folgen sie ihrer Beute und<br />
sind trotz der Dunkelheit bei<br />
der Jagd erfolgreich.<br />
Lies und bearbeite den folgenden Text sorgfältig mithilfe der Methode „Wie lese ich einen Text?“.<br />
→ SB/S. 13<br />
Die Schleiereule ist etwa 34 cm groß, hat schwarze Augen und lange Beine. Sie ist unauffällig gefärbt.<br />
Ihren Namen hat sie von dem auffallenden Federkranz, der um das Gesicht herumliegt und wie ein<br />
Schleier aussieht. Sie lebt in offenen Landschaften. Der Vogel ruht tagsüber in abgelegenen Ruinen<br />
oder auf Dachböden.<br />
Auf der Suche nach Beute fliegt die Schleiereule durch die Dunkelheit. Diese besteht fast nur aus<br />
Mäusen. Dabei fliegt sie dicht über den Boden. Die Flügel schwingen lautlos auf und ab.<br />
Die Schleiereule hat ein gutes Gehör und scharfe Augen. Hat sie eine Maus ausgemacht, so packt<br />
sie diese mit ihren spitzen Krallen. Mithilfe ihres Hakenschnabels hält die Schleiereule ihre Beute<br />
fest und verschlingt sie ganz. Nach der Mahlzeit würgt sie die unverdaulichen Reste (Haare, Federn<br />
und Knochen) hervor. Dieser Speiballen wird auch Gewölle genannt.<br />
Die Schleiereule legt von April bis Juni 4–7 weiße Eier direkt auf den Boden ihres Schlafverstecks.<br />
Die schlüpfenden Jungen haben ihre Augen noch geschlossen. Sie sind von weißem Flaum bedeckt<br />
und zeigen schon das typische Gesicht.<br />
Erstelle einen Steckbrief zur Schleiereule. Nutze die Informationen aus dem Text.<br />
Name<br />
Größe<br />
Aussehen<br />
Federn<br />
Lebensraum<br />
Jagdweise<br />
Ernährungsweise<br />
Fortpflanzung<br />
Jungtiere<br />
Schleiereule<br />
34 cm<br />
schwarze Augen, lange Beine<br />
unauffällig gefärbt, heller Federkranz um das Gesicht<br />
offene Landschaften, tagsüber in Ruinen und auf Dachböden<br />
in der Dunkelheit, packt Mäuse mit scharfen Krallen<br />
Beute wird ganz verschlungen, Reste werden als Gewölle ausgespuckt<br />
von April bis Mai legt sie 4 bis 7 Eier<br />
Augen geschlossen (Nesthocker), mit weißem Flaum
1<br />
Erst das Ei und dann das Huhn?<br />
Oder erst das Huhn und dann das Ei? Je länger<br />
man über die Antwort nachdenkt, desto<br />
schwieriger scheint sie zu sein. Eigentlich<br />
sind die genannten Fragen biologisch unsinnig,<br />
denn ohne Eier können sich keine Hühner<br />
entwickeln und ohne Hühner gibt es keine<br />
Eier. Welche Beziehung zwischen Huhn<br />
und Ei besteht, sollst du jetzt darstellen.<br />
Beschrifte die Zeichnungen und vervollständige<br />
den Text dieser Seite. → SB/S. 44<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Die geschlechtliche Vereinigung bei Hühnern nennt man Treten. Dabei werden Spermienzellen des<br />
Hahns durch die Kloake in den Eileiter des Huhns übertragen. Um das befruchtete Ei bildet<br />
sich eine Kalkschale . Damit sich in den Eiern Küken entwickeln können, müssen die Eier<br />
bebrütet<br />
Eierstock Keimscheibe Eidotter<br />
werden. Die Brutzeit dauert bei Haushühnern 21 Tage. Dann sind die Küken voll ent-<br />
wickelt und schlüpfen .<br />
Eileiter Darm<br />
Luftkammer<br />
Hagelschnur<br />
Eiklar Schalenhaut Kalkschale<br />
Entwicklung des Eies im Eileiter<br />
Eizahn<br />
Küken im Ei am Ende der Brutzeit Schlüpfendes Küken<br />
Treten<br />
Hoden<br />
Kloaken<br />
Eierstock<br />
Kloake<br />
13
14 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Vom Wildtier zum Haustier<br />
Einige Tierarten werden bereits seit Jahrtausenden vom Menschen gezähmt und gehalten.<br />
Aus vielen Wildtieren wurden durch Zähmung und Züchtung Haustiere. → SB/S. 56 – 57<br />
In diesem Gitterrätsel haben sich Wildtiere und Haustiere versteckt.<br />
Finde diese Tiere. Male die Kästchen farbig aus.<br />
H A W I L D S C H W E I N<br />
A L K S A G B U C H T A L<br />
U F AA LL B K AA T ZZ E A P I<br />
S T E P P E N T A R P AA N<br />
S C H U F L K A R II F U S<br />
C H R D E F I U H N A EE C<br />
H U U K R I V E U D L R H<br />
W O L F D M A S N L T O<br />
N<br />
E L T R A K H G D U R C E<br />
I K A T Z E U N I C A H I<br />
N U HH A U S H U H N U S<br />
S<br />
N B E L R A N N R F B EE E<br />
Schreibe die gefundenen Tiere in die Tabelle ein. Ordne dem Haustier die richtige Wildform zu.<br />
Wildtier Haustier<br />
Wildschwein Hausschwein<br />
Falbkatze Katze<br />
Steppentarpan Pferd<br />
Wolf Hund<br />
Bankivahuhn Haushuhn<br />
Auerochse Rind<br />
Vergleiche Wildschwein und Hausschwein. Notiere die Unterschiede.<br />
Züchtung<br />
Wildschwein Merkmal Hausschwein<br />
borstiges Fell Haut<br />
wenige Borsten<br />
klein, stehen aufrecht Ohren<br />
groß, stehen nach vorn<br />
klein und gedrungen Körper<br />
lang gestreckt<br />
glatt nach unten hängend Schwanz<br />
klein, geringelt
1<br />
2<br />
So kam der Mensch auf den Hund<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Der Hund ist eines unserer ältesten Haustiere. Alle Hunderassen stammen vom Wolf ab. → SB/S. 60 – 65<br />
Benenne die abgebildeten Hunderassen.<br />
Hunde helfen dem Menschen.<br />
a Trage in die Kästchen ein, welche Aufgabe die Hunde hier übernehmen.<br />
b Nenne die Sinnesleistungen der Hunde, die sich der Mensch zunutze macht.<br />
„Hundeberufe“<br />
Beispiele Sinnesleistung dient häufig als<br />
Schäferhund<br />
Bernhardiner<br />
Dackel<br />
Husky<br />
Spürhund<br />
Polizeihund<br />
Schäferhund<br />
Haushund<br />
Dalmatiner<br />
Bernhardiner<br />
Hütehund<br />
Geruchssinn, Hörsinn Polizei-, Blinden- und Spürhund<br />
Geruchssinn, Hörsinn Lawinenhund<br />
Geruchssinn, Hörsinn Jagdhund<br />
Blindenführhund<br />
15
16 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Die Katze – ein Schleichjäger<br />
Der Körper der Katze ermöglicht uns Schlussfolgerungen auf ihr Verhalten. Betrachte die Abbildungen<br />
und unterstreiche die richtige Beschreibung des Verhaltens. → SB/S. 66 – 69<br />
aufgeregt drohend wachsam wachsam angriffslustig<br />
wachsam müde aufgeregt aufgeregt wachsam<br />
verspielt verspielt aufmerksam schläfrig müde müde<br />
Wie fängt die Katze ihre Beute?<br />
Betrachte die Abbildung und beschreibe in kurzen Sätzen das Beutefangverhalten.<br />
Sie schleicht sich lautlos an und wartet ab.<br />
Sie springt auf die Beute.<br />
Sie packt das Beutetier mit den Krallen.<br />
Sie tötet das Beutetier mit einem Biss.<br />
Wie zieht die Katzenmutter ihre Jungen auf? Lies den Text und ergänze die Lücken.<br />
Eine Katze kann zweimal im Jahr vier<br />
bis acht Junge bekommen. In den ersten Wochen<br />
nach der Geburt sind die Jungen noch blind und<br />
taub und werden von der Mutter gesäugt .<br />
Bei Gefahr beschützt sie ihre Jungen und bringt<br />
sie in Sicherheit . Mit zunehmendem Alter versorgt<br />
die Mutter ihre Jungen mit Nahrung und lehrt<br />
sie, sich selbst Nahrung zu beschaffen.
1<br />
2<br />
3<br />
Das Rind liefert uns Milch und Fleisch<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Rinder wurden durch Züchtung zu Nutztieren. Weltweit gibt es etwa 460 Rinderrassen. Man unterscheidet<br />
dabei zwischen Rinderrassen, die vor allem als Fleischlieferanten gehalten werden, und solchen, die als<br />
Milchrinder dienen.<br />
Ergänze in der Tabelle die Namen der fehlenden Rinderrassen.<br />
Notiere darunter, welchen Nutzen diese Rasse jeweils für den Menschen hat.<br />
Galloway-Rind Deutsche Schwarzbunte Schottisches Hochlandrind<br />
Fleischlieferant Milchlieferant Fleischlieferant<br />
Rinder sind reine Pflanzenfresser und Wiederkäuer. Die Verdauungsorgane sind deshalb anders gebaut<br />
als die eines Menschen oder eines Schweins. → SB/S. 71 – 73<br />
a Beschrifte die Abschnitte des Wiederkäuermagens. Zeichne den Weg der Nahrung vor und nach dem<br />
Wiederkäuen farbig ein.<br />
Darm<br />
vor dem Wiederkäuen<br />
nach dem Wiederkäuen<br />
b Erläutere die Funktion der verschiedenen Abschnitte des Wiederkäuermagens.<br />
Abschnitte des Wiederkäuermagens Funktion<br />
1 = Blättermagen entzieht dem Grasbrei das Wasser.<br />
2 = Pansen weicht die schwer verdaubaren Grasfasern ein.<br />
1<br />
4<br />
2<br />
3<br />
Speiseröhre<br />
3 = Netzmagen befördert das angedaute Futter portionsweise zurück ins Maul.<br />
4 = Labmagen schließt die Verdauung der Nahrung ab.<br />
17
18 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
Haltung von Nutztieren<br />
Kennst du dich aus?<br />
Auf dieser Seite ist einiges durcheinandergeraten. Die Felder mit den Begriffen stehen nicht an der<br />
richtigen Stelle. Setze die zutreffenden Begriffe unter die entsprechenden Abbildungen.<br />
liefert Fleisch<br />
legt Eier<br />
liefert Milch, liefert Fleisch<br />
liefert Leder<br />
liefert Milch<br />
früher meist<br />
als Arbeitstier<br />
genutzt<br />
liefert Leder<br />
liefert Wolle<br />
geeignet für<br />
Sport- und Freizeit<br />
liefert Leder<br />
liefert Fleisch<br />
liefert Fleisch<br />
liefert Fleisch<br />
geeignet für Sport- und Freizeit<br />
früher meist als Arbeitstier genutzt<br />
liefert Fleisch<br />
liefert Wolle<br />
liefert Fleisch<br />
liefert Leder<br />
liefert Fleisch<br />
legt Eier
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Das Pferd – ein Tier aus der Steppe<br />
Die Vorfahren unseres Hauspferdes waren Wildpferde. Sie lebten<br />
als Herdentiere in den weiten Steppenlandschaften<br />
Europas und Asiens. → SB/S. 76 – 77<br />
Pferde sind ausdauernde Lauftiere.<br />
Gib zu den Ziffern des Beinskeletts die entsprechenden<br />
Bezeichnungen an.<br />
1 Beckenknochen<br />
2 Oberschenkelknochen<br />
3 Unterschenkelknochen<br />
4 Fußwurzelknochen<br />
5 Mittelfußknochen<br />
6 Zehenknochen<br />
Begründe anhand des Baus der Beine, dass Pferde Lauftiere sind.<br />
Ordne den Abbildungen die Gangarten des Pferdes zu.<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Pferde berühren nur mit den Zehenspitzen den Boden. Der Fuß des Pferdes ist durch Streckung des Mit-<br />
telfußes stark verlängert. Dadurch haben Pferde lange und starke Laufbeine, mit denen sie stundenlang<br />
laufen können, ohne zu ermüden.<br />
Schritt Trab Galopp<br />
Fülle die Lücken des folgenden Textes mit diesen Begriffen: Transport, Streitross, Trag- und Reittier,<br />
Freizeitgestaltung, Hauspferd, Landwirtschaft, Wildpferd, Reitsport, Bedeutung.<br />
Vor mehr als 5000 Jahren begannen die Menschen das Wildpferd zu zähmen und daraus<br />
das Hauspferd zu züchten. Zunächst diente es als Trag- und Reittier . Bald spielte es als<br />
Streitross<br />
bei kriegerischen Auseinandersetzungen eine Rolle. Bis vor etwa 60 Jahren lag die<br />
wirtschaftliche Bedeutung des Pferdes bei uns in seinem Einsatz in der Landwirtschaft ,<br />
zum Transport und beim Militär. Heute hat das Pferd im Reitsport und in der<br />
Freizeitgestaltung<br />
seine größte Bedeutung.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
19
20 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
2<br />
Wir vergleichen und ordnen Säugetiere<br />
Säugetiere besiedeln viele verschiedene Lebensräume. Sie ernähren sich sehr unterschiedlich und bewegen<br />
sich auch auf verschiedene Art und Weise.<br />
Gib an, um welche Tiere es sich handelt.<br />
1<br />
6<br />
2<br />
7<br />
3<br />
13<br />
1 = Schwalbe, 2 = Wespe, 3 = Forelle, 4 = Kobra, 5 = Fledermaus, 6 = Blauwal,<br />
7 = Fuchs, 8 = Dinosaurier, 9 = Kreuzspinne, 10 = Laubfrosch, 11 = Rentier, 12 = Strauß,<br />
13 = Ameise, 14 = Pinguin<br />
a Benenne die Tiere, die zu den Säugetieren gehören.<br />
Zu den Säugetieren gehören Fledermaus, Blauwal, Fuchs und Rentier.<br />
b Nenne die typischen Merkmale der Säugetiere.<br />
Fell (behaarte Haut), nach der Geburt werden die Jungen mit Milch gesäugt,<br />
gleichwarme Körpertemperatur.<br />
4<br />
Vergleiche die beiden Gebisstypen miteinander und benenne sie. Schreibe zu jedem Gebisstyp zwei<br />
Beispieltiere darunter.<br />
Fangzähne Reißzähne Nagezähne<br />
Fleischfressergebiss<br />
Beispiele: Hund, Tiger<br />
8<br />
5<br />
Nagetiergebiss<br />
9<br />
10<br />
12<br />
11<br />
Beispiele: Eichhörnchen, Kaninchen<br />
14
1<br />
2<br />
Überleben in allen Jahreszeiten<br />
Mit seinem Stachelkleid ist der Igel eine auffällige Erscheinung in unserer Tierwelt.<br />
Er ist er an die unterschiedlichen Jahreszeiten angepasst.<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Die Abbildung zeigt die Lebensweise eines Igels im Verlauf eines Jahres.<br />
Schreibe an die Striche der „Igeluhr“ statt der Stunden die entsprechenden Monate. Beginne um 12 Uhr<br />
mit dem Monat Dezember.<br />
Fülle mithilfe der „Igeluhr“ die folgende Tabelle aus.<br />
Jahreszeit Außentemperatur<br />
Winter<br />
Frühling<br />
Sommer<br />
Herbst<br />
Oktober<br />
September<br />
August<br />
November<br />
Juli<br />
Körpertemperatur<br />
Dezember<br />
Juni<br />
Verhalten des Igels<br />
2 °C 6 °C Der Igel hält Winterschlaf.<br />
15 °C 35 °C Der Igel wacht auf und beginnt Nahrung aufzunehmen.<br />
25 °C 35 °C Der Igel sucht sich einen Partner/eine Partnerin, Zeugung der<br />
Jungen, Austragen der Jungen durch das Weibchen.<br />
15 °C 35 °C Die Igel suchen sich Winterquartiere.<br />
6<br />
Januar<br />
Mai<br />
Februar<br />
April<br />
März<br />
21
22 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Was machen Fische im Winter? Lies den Text sorgfältig durch.<br />
Wenn das Wasser langsam kälter wird und zum Teil auch gefriert, beginnt die ruhige Zeit für die<br />
Fische. Sie bewegen sich nur so viel, wie unbedingt nötig ist. Sie leben von ihren Fettreserven, die sie<br />
sich im Sommer angefressen haben, und von den restlichen Pflanzen und kleinen Lebewesen, die sie im<br />
Winter noch im Wasser finden können. Der Fisch passt auch seine Körpertemperatur der Wärme des<br />
Wassers an; wird das Wasser kälter, wird der Fisch kälter. Aber wie verhält sich der Fisch, wenn der See<br />
zufriert?<br />
Sind Fische wechselwarm oder gleichwarm? Begründe deine Entscheidung.<br />
Fische sind wechselwarme Tiere. Ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebung an.<br />
Betrachte die Abbildung und erläutere, wie ein See im Winter zufriert.<br />
Gewässer frieren von oben nach<br />
unten zu. Am Grund des Sees<br />
ist es mit 4 °C am „wärmsten“,<br />
nach oben nimmt die Temperatur<br />
in Schritten ab. Oben auf<br />
dem See bildet sich dann bei 0 °C<br />
0 m<br />
10 m<br />
20 m<br />
30 m<br />
und weniger eine Eisschicht. Sie schwimmt gewissermaßen auf dem See (ähnlich wie etwa Eiswürfel in<br />
einem Wasserglas).<br />
Leite nun aus deinen Überlegungen ab, wo sich die Fische im Winter aufhalten könnten.<br />
Die Fische halten sich im Winter am Grund des Sees auf.<br />
Sie können ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anpassen.<br />
So überstehen sie den Winter unbeschadet.<br />
Eis<br />
0 °C<br />
1 °C<br />
2 °C<br />
Wenn die Temperatur des Sees wieder steigt, steigt auch die Körpertemperatur der Fische an.<br />
4 °C
1<br />
Leben in Eis und Wüste<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
Auch in extremen Lebensräumen der Erde leben viele Tiere. Sie sind mit ihrem Körperbau und ihrem Verhalten<br />
an die dort herrschenden Bedingungen angepasst.<br />
Fülle die folgende Tabelle aus. Nimm dazu die Seiten 82 bis 85 im Schülerbuch zu Hilfe.<br />
Lebensraum<br />
Umweltbedingungen im<br />
Lebensraum<br />
Körpermerkmale, die vor<br />
diesen Umweltbedingungen<br />
schützen (Angepasstheiten)<br />
Eisbär Dromedar<br />
• Packeis an den Küsten des<br />
Nordpolarmeeres<br />
• eiskaltes Wasser<br />
• eiskalte Umgebungstemperatur<br />
• dichtes Fell<br />
• dicke Speckschicht<br />
• schwarze Haut<br />
• trockene, heiße Sand- und<br />
Steinwüsten<br />
• nachts kalt, tagsüber heiß<br />
• Sandboden<br />
• Sandstürme<br />
• dickes, wolliges Fell<br />
• dicke, elastische Polster an<br />
den Fußsohlen<br />
• lange Wimpern<br />
• verschließbare Nasenlöcher<br />
23
24 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
Leben im Dunkeln<br />
Wir Menschen hören sie nicht und meistens sehen wir sie auch nicht. Für die einen sind sie unheimlich,<br />
für die anderen interessant: Fledermäuse sind fast überall auf der Welt anzutreffen.<br />
In den unten stehenden Textpäckchen wird der Ablauf eines Fledermausjahres beschrieben.<br />
a Übertrage die folgende Überschrift auf ein freies DIN-A4-Blatt: Das Fledermausjahr.<br />
b Fertige eine Kopie von dieser Seite an. Schneide dann die Textpäckchen und die Fledermaus von<br />
der kopierten Seite aus. Lege die Fledermaus in die Mitte deines DIN-A4-Blattes und klebe sie fest.<br />
c Nun liest du die Textpäckchen sorgfältig durch und schreibst jeweils die passenden Monate auf die<br />
Schreiblinie: März und April, April und Mai, Juni und Juli, Juli und August, August und September,<br />
September und Oktober, November und Dezember, Dezember bis März.<br />
d Ordne die so beschrifteten Textpäckchen um die Fledermaus und klebe sie fest.<br />
e Informiere dich anschließend über bei uns vorkommende Fledermäuse.<br />
März und April April und Mai Juni und Juli<br />
An den ersten milden Frühlingstagen,<br />
sobald es wieder<br />
Insekten gibt, erwachen unsere<br />
heimischen Fledermäuse aus<br />
dem Winterschlaf und verlassen<br />
ihre Überwinterungsquartiere.<br />
Auch die letzten Fledermäuse<br />
verschwinden in unterirdischen<br />
Winterquartieren. Durch die<br />
Absenkung ihrer Körpertemperatur<br />
bis nahe an die<br />
Umgebungstemperatur verringern<br />
Fledermäuse ihren<br />
Energie verbrauch.<br />
Viele Arten suchen schon jetzt<br />
unterirdische Quartiere auf, um<br />
einen echten Winterschlaf zu<br />
halten. Dieser kann aber unterbrochen<br />
werden, um die Hangplätze<br />
zu wechseln.<br />
Nach und nach suchen die<br />
Fledermäuse ihre Sommerquartiere<br />
auf. Die Männchen verteilen<br />
sich einzeln, die Weibchen<br />
finden sich in den sogenannten<br />
Wochenstuben zusammen.<br />
Diese Zeit dient den Fledermäusen<br />
zur Anlage von Fettreserven.<br />
In den Wochenstuben bringen<br />
die Weibchen jedes Jahr ein<br />
Junges zur Welt. Die neugeborenen<br />
Jungtiere sind während<br />
der ersten Tage nackt und blind.<br />
Sie hängen tagsüber an ihrer<br />
Mutter.<br />
Dezember bis März Juli und August<br />
Die Jungtiere werden drei bis<br />
sieben Wochen gesäugt. Ab<br />
August müssen sie selbst für<br />
ihre Nahrung sorgen. Zum<br />
Glück gibt es gerade jetzt die<br />
meisten Insekten.<br />
November und Dezember September und Oktober August und September<br />
Die Männchen und Weibchen<br />
suchen sich gegenseitig zur Paarung<br />
auf. Der Eisprung und<br />
damit die Befruchtung finden<br />
aber erst im darauffolgenden<br />
Frühjahr statt. Dies steigert die<br />
Überlebenschancen der Nachkommen.
1<br />
2<br />
Vielfalt lässt sich ordnen<br />
Obwohl die abgebildeten Tiere sehr<br />
unterschiedliche Körpermerkmale<br />
haben, gehören sie alle zu den Wirbeltieren.<br />
a Begründe.<br />
Sie haben alle ein Innenskelett mit<br />
Wirbelsäule.<br />
b Ergänze die Namen der<br />
abgebildeten Tierarten.<br />
1 Möwe<br />
4 Laubfrosch<br />
2 Pinguin<br />
5 Schlange<br />
Tiere in ihren Lebensräumen<br />
3 Braunbär<br />
6 Goldfisch<br />
Finde anhand der Abbildung die Merkmale heraus, an denen man Fische, Lurche, Kriechtiere, Vögel<br />
und Säugetiere erkennen und unterscheiden kann.<br />
a Trage die Merkmale in die Tabelle ein.<br />
b Ordne die Tiere (1–6) entsprechend zu.<br />
Fische Lurche Kriechtiere Vögel Säugetiere<br />
Gruppe Merkmale Tierart<br />
Fische<br />
Lurche<br />
Kriechtiere<br />
Vögel<br />
Säugetiere<br />
Haut mit Schuppen und Schleimschicht; Eiablage im Wasser;<br />
wechselwarm<br />
feuchte Haut; Eiablage im Wasser;<br />
wechselwarm<br />
trockene Haut mit Schuppen; Eiablage an Land;<br />
wechselwarm<br />
Haut mit Federn; Eiablage an Land;<br />
gleichwarm<br />
Haut mit Fell; die Jungen werden mit Milch gesäugt;<br />
gleichwarm<br />
4<br />
1<br />
2<br />
5<br />
6<br />
Goldfisch<br />
3<br />
Laubfrosch<br />
Schlange<br />
Möwe,<br />
Pinguin<br />
Braunbär<br />
25
26 Tiere in ihren Lebensräumen<br />
1<br />
Wirbeltiere in ihren Lebensräumen – auf einen Blick<br />
Nun hast du viel über Wirbeltiere in ihren Lebensräumen erfahren. Jetzt hast du sicher keine Schwierigkeiten,<br />
das folgende Rätsel zu lösen.<br />
Gesucht werden Tiere oder Tiergruppen. Lies die Beschreibungen und trage sie ein.<br />
Ein ä, ö oder ü wird auch so eingetragen.<br />
1 Er lebt unterirdisch und frisst Insekten.<br />
2 Es hat lange Wimpern zum Schutz gegen<br />
Sandstürme.<br />
3 Mit langen Beinen läuft es über die Steppe.<br />
4 Sie fallen in eine Winterstarre.<br />
5 Es lebt im Wasser des Nils.<br />
6 Ihre Heimat ist die Türkei.<br />
7 Dieses Wildtier ernährt sich von Hasen.<br />
8 Sie leben im Nordpolarmeer.<br />
9 Er hat lange Sprung- und Schwimmbeine.<br />
10 Er lebt in den Gewässern Mexikos.<br />
1 M A U L W U R F<br />
2 D R O M E D A R<br />
3 P F E R D<br />
4 K R I E C H T I E R E<br />
5 K R O K O D I L<br />
6 L A N D S C H I L D K R Ö T E<br />
7 L U C H S<br />
8 E I S B Ä R E N<br />
9 T E I C H F R O S C H<br />
10 A X O L O T L<br />
11 E I C H H Ö R N C H E N<br />
12 V Ö G E L<br />
13 Z A U N E I D E C H S E N<br />
14 P I N G U I N<br />
15 W Ü S T E N F U C H S<br />
16 16 K R E U Z O T T E R<br />
17 F L E D E R M A U S<br />
18 A M S E L<br />
19 W I L D S C H W E I N<br />
20 F I S C H E<br />
11 Es lebt in Parks und Gärten.<br />
12 Sie haben leichtere Knochen als Säugetiere.<br />
13 Sie mögen es warm und trocken.<br />
14 Er lebt im Eis und kann nicht fliegen.<br />
15 Seine langen Ohren schützen vor Hitze.<br />
16 Sie schlängelt sich durch das Gebüsch.<br />
17 Sie ist das einzige fliegende Säugetier.<br />
18 Sie polstert ihr Nest mit Gras, Stroh und<br />
Zweigen aus.<br />
19 Mit seiner Schnauze wühlt es im Laub.<br />
20 Ihr stromlinienförmiger Körper ist gut für die<br />
Fortbewegung im Wasser.<br />
Die Buchstaben in den unterlegten<br />
Feldern ergeben eine<br />
wichtige Maßnahme zum<br />
Schutz der Tiere. Achtung:<br />
Die Buchstaben stehen nicht<br />
in der richtigen Reihenfolge!<br />
Merk dir! Tiere besiedeln Lebensräume, an die ihr Körperbau und ihr Verhalten angepasst sind. Fische,<br />
Lurche, Kriechtiere, Vögel und Säugetiere gehören zu den Wirbeltieren.<br />
2<br />
LEBENSRAUMSCHUTZ
1<br />
2<br />
Die Pflanze besteht aus Blättern und …<br />
Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
Es gibt etwa 270 000 Arten von Samenpflanzen. Obwohl es bei ihnen auch eine große Merkmalsvielfalt gibt,<br />
hat doch jede Samenpflanze einen Spross mit Blättern und Blüten sowie eine Wurzel.<br />
Betrachte die Abbildung und benenne die Teile der Rapspflanze.<br />
Kennst du diese Pflanzen? Bilde aus den Silben die Namen der abgebildeten Pflanzen.<br />
Setze den Namen dann unter die Abbildung.<br />
BLU – BLÜM – BOCKS – CHEN – FIN – GÄN – GER – HUT – KRAUT –<br />
KRO – KUS – ME – NEN – PE – SCHAR – SE – SON – TUL<br />
Tulpe<br />
Gänse-<br />
blümchen<br />
Blüte<br />
Frucht<br />
Sprossachse<br />
Blatt<br />
Wurzeln<br />
Sonnen-<br />
blume<br />
Fingerhut<br />
Scharbocks-<br />
kraut<br />
Krokus<br />
27
28 Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Ob krautige Pflanzen, Sträucher oder Bäume, alle Samenpflanzen benötigen Wasser und Nährstoffe.<br />
Wie gelangt das Wasser in die Pflanze? Ergänze den Lückentext. → SB/S. 96<br />
Blütenpflanzen werden durch die Wurzeln in der Erde verankert. Mit ihnen nimmt<br />
die Pflanze Wasser und die darin gelösten Mineralstoffe auf. Diese Stoffe gelangen<br />
über Leitungsbahnen , die in der Wurzel und der Sprossachse vorhanden sind, bis in<br />
die Blätter und Blüten der Pflanzen.<br />
Erläutere, welche Funktionen die Wurzel besitzt.<br />
Die Wurzel hält die Pflanze im Boden fest und nimmt Wasser und die darin gelösten Mineralstoffe auf.<br />
Führe zur Überprüfung der Aussagen im<br />
Lückentext ein Experiment mit einer Pflanze<br />
nach der Abbildung durch.<br />
a Was würdest du vermuten? Kreuze die Antwort<br />
an, von der du annimmst, dass sie stimmt.<br />
✗<br />
Die Flüssigkeitssäule bleibt unverändert.<br />
Die Flüssigkeitssäule steigt an.<br />
Die Flüssigkeitssäule sinkt.<br />
b Führe nun das Experiment durch und<br />
über prüfe deine Vermutung.<br />
Meine Vermutung war richtig.<br />
Wasser kann über die Leitungsbahnen in<br />
der Sprossachse bis in die Blüte aufsteigen,<br />
denn die Flüssigkeitssäule ist gesunken.<br />
c Nenne den Zweck des Öls in der Versuchsanordnung.<br />
Das Öl verhindert die Verdunstung des Wassers.<br />
Blütenp�anze<br />
Ölschicht<br />
Messzylinder mit Wasser<br />
Im Blumenladen werden manchmal Schnittblumen in Farben verkauft, die so nicht in der Natur<br />
vorkommen, z. B. blaue Nelken. Finde eine Erklärung dafür, wie Gärtner solche Pflanzen herstellen.<br />
Blumen werden in Wasser mit gelösten Farbstoffen gestellt.<br />
Da Wasser in den Leitungsbahnen hochsteigt,<br />
gelangt es bis zur Blüte, die dadurch angefärbt wird.
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
Die Gestalt der Laubblätter kann sehr unterschiedlich sein. In einem Blattskelett kannst du aber besonders<br />
gut die vielen feinen Verzweigungen der Blattadern sehen. → SB/S. 98; 136<br />
Beschrifte im Blattskelett und im frischen Laubblatt die Teile eines Laubblattes.<br />
Ergänze den Lückentext.<br />
Die Blattspreite ist von vielen Blattadern durchzogen.<br />
Sie sind die Leitungsbahnen des Blattes.<br />
In ihnen werden Wasser und Nährstoffe in alle Teile des Blattes transportiert.<br />
So wie wir energiereiche Nährstoffe zum Essen brauchen, benötigt auch eine Pflanze bestimmte Stoffe<br />
und Energie zum Leben, um wachsen und gedeihen zu können.<br />
Betrachte die Abbildung. Ergänze die Zeichnung. Schreibe an die Pfeile, was die Pflanze aufnimmt und<br />
was sie abgibt.<br />
Wasser aus<br />
dem Boden<br />
Nenne die Funktion des Blattgrüns im Laubblatt.<br />
Blattspreite<br />
Blattadern<br />
Blattstiel<br />
Bildung von<br />
Zucker und Stärke<br />
Aufnahme von Licht für die Bildung der Nährstoffe (durch Fotosynthese).<br />
Licht<br />
Kohlenstoffdioxid (schwarz)<br />
Wasser (blau)<br />
Sauerstoff (rot)<br />
29
30 Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
1<br />
Wir bestimmen Bäume nach den Laubblättern<br />
Bestimmen erfolgt durch das schrittweise Vergleichen von zwei meist gegensätzlichen Merkmalen. Du musst<br />
feststellen, welches Merkmal jeweils zutrifft (z. B. 1 „Blätter flächig“ oder 1* „Blätter nadelförmig“). Der<br />
nummerierte Bestimmungsweg wird bis zum Art oder Gruppennamen fortgesetzt.<br />
Bestimme die abgebildeten Laubblätter mithilfe des Bestimmungsschlüssels und trage den Artnamen ein.<br />
1 Blätter flächig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
1 * Blätter nadelförmig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
2 Nadeln gedreht, paarig angeordnet . . . . . . . . . Wald-Kiefer<br />
2 * Nadeln in Büscheln stehend . . . . . . . . . Europäische Lärche<br />
3 Blätter aus Blättchen zusammengesetzt . . . . . . . . . . . . . 4<br />
3 * Blätter nicht zusammengesetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
4 5 bis 7 kurz gestielte Blättchenpaare . . . . . . . . . Eberesche<br />
4 * 4 bis 6 ungestielte Blättchenpaare . . . . . . . . Gemeine Esche<br />
5 Blattrand wellig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
5 * Blattrand anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
6 Blattstiel kürzer als 1 cm . . . . . . . . . . . . . . . Stiel-Eiche<br />
6 * Blattstiel 1 bis 3 cm. . . . . . . . . . . . . . . . Trauben-Eiche<br />
7 Blattrand glatt, Blattfläche herzförmig . . . . Gemeiner Flieder<br />
7 * Blattrand gezähnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
8 Blätter schmal und lang gestreckt . . . . . . . . . . Silberweide<br />
8 * Blätter anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
9 Blätter rundlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
9 * Blätter handförmig gelappt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
10 Blatt zugespitzt, Blattrand gesägt . . . . . . . . Sommer-Linde<br />
10 * Blatt ohne Spitze, Blattstiel sehr lang . . . . . . . Zitter-Pappel<br />
11 Blattlappen lang zugespitzt mit großen Zähnen . . Spitz-Ahorn<br />
11 * Blattlappen nicht gezähnt . . . . . . . . . . . . . . Berg-Ahorn<br />
Gemeiner Flieder<br />
Silberweide<br />
Spitz-Ahorn<br />
Europäische Lärche<br />
Zitter-Pappel<br />
Wald-Kiefer<br />
Berg-Ahorn<br />
Gemeine Esche<br />
Trauben-Eiche Sommer-Linde Eberesche Stiel-Eiche
1<br />
2<br />
Blüten – mehr als nur schön anzusehen<br />
Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
Eine vollständige Blüte setzt sich aus mehreren verschiedenen Blütenteilen zusammen. → SB/S. 105<br />
a Beschrifte die Teile der Blüte.<br />
Stempel<br />
b Trage in die Tabelle die Blütenteile und deren Funktion ein.<br />
Teile der Blüte Funktion<br />
Kelchblatt<br />
Narbe<br />
Griffel<br />
Fruchtknoten<br />
Auf einer Wiese wachsen viele verschiedene Samenpflanzen. Obwohl sie unterschiedlich aussehen,<br />
sind sie doch in ihrem Grundaufbau gleich.<br />
a Setze neben die Pflanze den jeweils richtigen Namen.<br />
• Heckenrose<br />
• Taubnessel<br />
b Beschrifte jeweils die Blütenteile.<br />
schützt die inneren Blütenteile vor schädlichen äußeren Einflüssen.<br />
Kronblatt<br />
Staubbeutel mit Pollen<br />
Staubblattstiel<br />
Kelchblatt<br />
Kronblatt Bei geschlossener Blüte schützt es die inneren Blütenteile; ist die Blüte geöffnet,<br />
dient es der Anlockung von Insekten.<br />
Staubblatt enthält im Staubbeutel den Pollen.<br />
Fruchtknoten trägt die Samenanlage; bildet zusammen mit Griffel und Narbe den Stempel.<br />
Staubblattstiel<br />
Frucht-<br />
knoten<br />
Taubnessel Heckenrose<br />
Staubbeutel<br />
Narbe<br />
Kronblatt<br />
Griffel<br />
Kelchblatt<br />
Kronblatt<br />
Staubbeutel<br />
Staubblattstiel<br />
Kelchblatt<br />
Fruchtknoten<br />
31
32 Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Wie kommt die Kirsche an den Baum?<br />
An einem warmen Frühlingstag lassen sich in einem blühenden Kirschbaum zahlreiche Bienen entdecken,<br />
die dort eifrig von einer Blüte zur anderen fliegen.<br />
Betrachte die Abbildungen. Wie werden diese Pflanzen bestäubt? Notiere die Art der Bestäubung.<br />
Windbestäubung Insektenbestäubung Insektenbestäubung Windbestäubung<br />
Ergänze den Lückentext zur Bestäubung und Befruchtung. → SB/S. 107<br />
Der Duft und die leuchtenden Farben der Blüten locken Insekten an. Mit ihrem Rüssel<br />
saugen sie den süßen Nektar der Blüten auf. Dabei berühren sie auch die Staubblätter<br />
der Blüten. Bei ihrem Flug von Blüte zu Blüte tragen sie dann den Pollen von einer Blüte zur<br />
klebrigen Narbe der nächsten Blüte.<br />
Dabei bleiben einige Pollenkörner auf der Narbe hängen, die Blüte wird bestäubt .<br />
Nach der Bestäubung wächst aus dem Pollenkorn ein feiner Pollenschlauch von der Narbe durch<br />
den Griffel bis zur Samenanlage. Dort wird die Eizelle befruchtet . Jetzt kann sich<br />
die neue Frucht entwickeln.<br />
Beschreibe in kurzen Sätzen die<br />
Entwicklung von der befruchteten<br />
Kirschblüte zur Frucht.<br />
1 Die Entwicklung zur Kirsche<br />
beginnt mit der Befruchtung der Eizelle<br />
in der Samenanlage.<br />
Narbe<br />
Fruchtknoten<br />
Pollenkorn<br />
Pollenschlauch<br />
Samenanlage<br />
mit Eizelle<br />
Pollenschlauch<br />
männliche<br />
Geschlechtszelle<br />
Samen<br />
1 2 3<br />
2 Kronblätter und Staubblätter welken und fallen ab. Griffel und Narbe trocknen ein.<br />
3 Der Fruchtknoten vergrößert und verfärbt sich langsam.<br />
Der Fruchtknoten bildet das saftige Fruchtfleisch.<br />
Im Innern befindet sich der Stein (Kirschkern) mit dem Samen.<br />
Frucht-<br />
�eisch
1<br />
2<br />
3<br />
Wie kommt der Löwenzahn auf die Mauer?<br />
Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
Unter der Krone einer Eiche findet man viele Eicheln. Würden sich aus allen Samen unter der Mutterpflanze<br />
Keimlinge entwickeln, hätten sie bald nicht mehr genug Nährstoffe und Licht. Samen und Früchte müssen<br />
deshalb verbreitet werden.<br />
Ordne den abgebildeten Früchten die entsprechenden Pflanzennamen zu.<br />
Tipp: Nimm ein Bestimmungsbuch oder ein Pflanzenlexikon zu Hilfe.<br />
Löwenzahn Linde Kiefer Mohn<br />
Nenne die beiden Arten der Verbreitung, die auf den Abbildungen dargestellt sind. Gib Beispiele an.<br />
Windverbreitung, z. B. Ahorn, Distel, Löwenzahn, Linde<br />
Selbstverbreitung, z. B. Mohn, Raps, Springkraut<br />
Wie wirkungsvoll ist Windverbreitung?<br />
a Führe mit den in der Tabelle aufgeführten Früchten selbst Flugversuche durch. Trage deine<br />
Ergebnisse in die Tabelle ein. Die Fallhöhe sollte in allen Versuchen gleich sein. Entferne dann<br />
von den Früchten die Flugeinrichtung. Trage auch diese Ergebnisse in die Tabelle ein.<br />
Pflanze (Früchte) Fallzeit mit Flugeinrichtung<br />
(in Sekunden)<br />
Löwenzahn<br />
Ahorn<br />
Linde<br />
b Ziehe Schlussfolgerungen aus den Versuchsergebnissen.<br />
Mit Flugeinrichtung schweben oder trudeln sie langsam zur Erde und<br />
werden von der Mutterpflanze weggetrieben.<br />
Ohne Flugeinrichtung fallen sie schnell zu Boden und<br />
bleiben dicht bei der Mutterpflanze.<br />
Fallzeit ohne Flugeinrichtung<br />
(in Sekunden)<br />
33
34 Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
1<br />
2<br />
Die neue Pflanze steckt bereits im Samen<br />
Du weißt sicherlich schon, dass sich aus einem Pflanzensamen, wenn er in die Erde gebracht wird, bald<br />
eine junge Pflanze entwickelt. Möglicherweise weißt du nicht, dass diese junge Pflanze bereits im Samen<br />
embryonal als winziger Keimling vorliegt. → SB/S. 114<br />
Feuerbohne Sonnenblume<br />
Radieschen<br />
Pflanzensamen unterscheiden sich in Größe, Form und Farbe.<br />
Lege Samen der Feuerbohne 24 Stunden lang in Wasser. Es erfolgt eine Quellung. Im gequollenen Zustand<br />
lässt sich die Samenschale mit einem kleinen Messer gut aufritzen und entfernen.<br />
Klappe nun die beiden Hälften der Bohne, es sind die Keimblätter, auseinander. Auf der glatten Innenfläche<br />
des Samens siehst du ein wenige Millimeter großes Gebilde, den Keimling der Feuerbohne. Mit<br />
der Lupe erkennst du deutlich dessen Bestandteile: zwei kleine Laubblätter, den Keimspross und die<br />
Keimwurzel. Beschrifte die folgende Zeichnung.<br />
Vergleiche trockene und gequollene Feuerbohnensamen.<br />
Feuerbohne Trocken Gequollen<br />
Druckfestigkeit<br />
Samenschale<br />
Masse in Gramm (10 Stück)<br />
Länge<br />
Erste Laubblätter<br />
Keimsprossachse Embryo<br />
Keimwurzel<br />
Keimblätter<br />
Samenschale<br />
hoch gering<br />
hart weich<br />
etwa 5 g etwa 30 g<br />
etwa 10 mm etwa 18 mm
3<br />
4<br />
Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
Wenn trockene Samen in feuchter Umgebung Wasser aufnehmen und dadurch größer werden, spricht<br />
man von Quellung. Das Wasser ermöglicht den normalen Ablauf der Lebensprozesse, wie etwa den<br />
Transport der gelösten Nährstoffe aus den Keimblättern zur Keimpflanze, damit diese wachsen kann.<br />
Bei der Quellung entwickeln Samen große Kräfte. Führe folgenden Versuch durch: Stelle aus 100 g Gips<br />
und Wasser einen Teig her. Drücke in diesen zu einem Kloß geformten Klumpen 5 trockene Samen der<br />
Feuerbohne. Lege den Klumpen nach dem Erhärten des Gipses in ein mit Wasser gefülltes Glasgefäß.<br />
Nach etwa 1 bis 2 Tagen wird der harte Gips gesprengt. Erkläre.<br />
1 bis 2 Tage später<br />
Infolge der Quellung der Bohnensamen kommt es zur Vergrößerung ihres Volumens.<br />
Der entstehende Quellungsdruck sprengt den Gipsklumpen.<br />
Weise nach, dass sich der Nährstoff Stärke nur in den Keimblättern und nicht in der Samenschale sowie<br />
nicht im Keimling befindet. Untersuche nach Anleitung durch deine Biologielehrerin / deinen Biologielehrer<br />
auf der Tüpfelplatte zunächst Stärkepulver mit Iod-Kalium iodid-Lösung. → SB/S. 11<br />
Teile Ergebnis<br />
Stärkepulver<br />
Samenschale<br />
Keimling<br />
Keimblätter<br />
Ergebnis:<br />
In den Keimblättern des Bohnensamens ist Stärke als Nährstoff gespeichert.<br />
positiv<br />
(Nachweis)<br />
negativ<br />
negativ<br />
positiv<br />
(Nachweis)<br />
35
36 Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
1<br />
2<br />
Lebenslauf einer Garten-Bohne<br />
Bringe Samen der Garten-Bohne im Freiland oder in Blumentöpfen aus. Vergleiche die Entwicklung<br />
mit der folgenden Zeichnung. Trage deine Beobachtungen in die Tabelle ein. Die vorgegebenen Entwicklungsabschnitte<br />
sollen dir bei der Einordnung deiner Beobachtungen helfen.<br />
A B C D E F G<br />
Bild Entwicklungsabschnitt Datum<br />
A<br />
B Gequollener Samen<br />
C<br />
D<br />
E<br />
F Beginn der Blütezeit<br />
G<br />
trockener Bohnensamen<br />
Keimwurzel und Keimspross entwickeln sich<br />
Wachstum der Sprossachse, Laubblätter entfalten sich<br />
Laubblätter wachsen, Keimblätter schrumpfen<br />
Beginn der Fruchtbildung<br />
Verfolge beim Wachstum der Garten-Bohne den Werdegang der Keimblätter. Erläutere, wie lange sie<br />
für die Entwicklung der Pflanze wichtig sind.<br />
Nach dem Austreiben der grünen Laubblätter kann die Pflanze mithilfe von Licht durch Fotosynthese<br />
selbst Nährstoffe (Traubenzucker bzw. Stärke) bilden. Die Nährstoffe der Keimblätter sind verbraucht,<br />
die Keimblätter schrumpfen.
1<br />
2<br />
Vermehrung ohne Samen<br />
Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
Neue Pflanzen können sich auch durch ungeschlechtliche Fortpflanzung entwickeln. → SB/S. 113<br />
Betrachte die Abbildungen und trage dazu die Form der Vermehrung ein.<br />
Ableger Steckling<br />
z. B. Grünlilie z. B. Usambaraveilchen<br />
z. B. Brutblatt<br />
Ziehe dir aus einer Zimmerpflanze Stecklinge. Geeignet sind der Weihnachtskaktus oder auch<br />
die Begonie.<br />
a Gehe dabei wie in den Abbildungen dargestellt vor.<br />
Beispiel: Weihnachtskaktus<br />
Einen Seitentrieb mit 2–3 Gliedern von der Pflanze<br />
abtrennen. Danach in Blumenerde stecken.<br />
Brutpflanzen<br />
Beispiel: Begonie<br />
An den Adern der Blattunterseite kleine Schnitte<br />
setzen. Blatt mit der Unterseite flach auf die Erde<br />
legen und mit Steinchen beschweren.<br />
b Stelle den Topf mit dem Begonienblatt an einen warmen Ort. Gieße regelmäßig, aber nicht zu viel.<br />
Beobachte und protokolliere, wie sich das Blatt verändert.<br />
An dem Blatt entwickeln sich nach einigen Wochen kleine Pflänzchen,<br />
die zu einer Pflanze heranwachsen.<br />
37
38 Aus dem Leben der Samenpflanzen<br />
1<br />
2<br />
Pflanzen verändern sich im Jahreslauf<br />
Die letzten Schneereste sind kaum weggetaut, da erblühen schon die ersten Samenpflanzen in unseren<br />
Gärten und Laubwäldern. Frühblüher besitzen unterirdische Speicherorgane, mit denen sie die ungünstige<br />
Jahreszeit überdauern. → SB/S. 117<br />
Kennst du die abgebildeten Frühblüher? Notiere ihren Namen und die ausgebildeten Speicherorgane.<br />
Artname: Schlüsselblume Artname: Schneeglöckchen<br />
Speicherorgan: Sprossknolle Speicherorgan: Zwiebel<br />
Wie überstehen Bäume den Winter? Ergänze den Lückentext.<br />
Laubblätter bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Über die Blätter verdunstet das Wasser ,<br />
das von den Wurzeln aufgenommen wird und über die Leitungsbahnen der Sprossachse<br />
zu den Blättern gelangt. Im Herbst verlieren die meisten Laubbäume ihre Blätter.<br />
In der Blattachsel des alten Blattes befindet sich die neue Knospe . Sie enthält bereits die<br />
Anlagen für die Blüte und Laubblätter des nächsten Jahres. Diese werden durch harte<br />
und klebrige Schuppen<br />
geschützt.<br />
Merk dir! Samenpflanzen bestehen aus der Wurzel und der Sprossachse mit Laubblättern und Blüten.<br />
Sie können sich geschlechtlich oder ungeschlechtlich fortpflanzen. Ihre Verbreitung erfolgt durch Samen<br />
und Früchte. Die Blätter bilden im Licht Nährstoffe.
1<br />
2<br />
Lebensraum Baum<br />
Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
Anna erzählt etwas über Bäume. Allerdings weiß sie die Fachbegriffe nicht mehr und hat Manches vergessen.<br />
Fülle die Lücken und ersetze die schräg gedruckten Wörter durch Fachbegriffe.<br />
„Es gibt total viele Bäume, sie wachsen überall. Bäume bestehen aus unterschiedlichen Teilen: den<br />
Blättern, dem Stamm , den Wurzeln und der Baumkrone . Diese Baumbereiche sind<br />
wichtig für viele Tiere, denn diese wohnen dort. Deshalb sind Bäume genau wie Rasen oder Gewässer<br />
Tierwohnungen Lebensräume . Bäume eignen sich gut als Tierwohnung Lebensraum , denn<br />
die Tiere finden hier Essen Nahrung , Nistplätze und Verstecke vor Bösewichten Feinden .<br />
Im Fußbereich Wurzelbereich des Baums wohnen zum Beispiel Ameisen, Igel und<br />
Schnecken . Am Hauptast Stamm kann man unter anderem Kleiber finden. Das sind sehr<br />
interessante Vögel, die den Baum hoch- und runterlaufen. Am gleichen Baumabschnitt gibt es außer-<br />
dem noch Kreuzspinnen und Spechte . Und oben, in den Blättern und der Baumkrone ,<br />
halten sich viele unterschiedliche Arten von Insekten, Vögeln und Säugetieren auf.“<br />
Nenne jeweils zwei Beispiele für Insekten, Vögel und Säugetiere, die in der Baumkrone leben.<br />
Insekten:<br />
Vögel:<br />
Säugetiere:<br />
Borkenkäfer, Schmetterling<br />
Blaumeise, Elster<br />
Eichhörnchen, Marder<br />
39
40 Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
3<br />
Du hast schon viel über Bäume gehört, wie zum Beispiel, dass viele Tiere Bäume als Lebensraum nutzen.<br />
Aber stimmt das auch wirklich? Sei eine Woche lang Baumdetektiv und finde es heraus. Hier dein<br />
Auftrag:<br />
a Suche dir einen großen Baum aus. Nimm dir eine Woche lang jeden Tag mindestens 10 Minuten Zeit<br />
für die Beobachtungen an dem ausgewählten Baum.<br />
Tipp: Damit du einen besseren Überblick bekommst, welche Tiere sich zu welcher Zeit am Baum<br />
aufhalten, solltest du deinen Auftrag möglichst zu unterschiedlichen Tageszeiten ausführen.<br />
b Was du dabeihaben solltest: Bestimmungsbuch, Fernglas, Ruhe und Geduld.<br />
c Fülle das folgende Beobachtungsprotokoll aus.<br />
Tag, Datum, Uhrzeit Arten und Anzahl der beobachteten Tiere an der Baumart:<br />
Wurzelbereich Stamm Baumkrone<br />
Lösung individuell
1<br />
2<br />
Hecken sind vielfältige Lebensräume<br />
Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
Naturnahe Hecken sind Lebensräume für die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen. Die unterschiedlichen<br />
Bereiche werden in Schichten eingeteilt. → SB/S. 139<br />
Hier siehst du die Skizze einer Hecke.<br />
a Beschrifte ihre Schichten, indem du die richtigen Begriffe an die Klammern schreibst.<br />
b Ordne das folgende Buchstabenchaos und schreibe die richtigen Begriffe auf die passenden Pfeile.<br />
• MAUS<br />
• NEZTURM<br />
• ACHD<br />
• LANTEM<br />
Baumschicht<br />
Strauchschicht<br />
Krautschicht<br />
Bodenschicht<br />
Zähle in der rechten Spalte der Kästen drei Pflanzen auf, die in der jeweiligen Schicht zu finden sind.<br />
Zeichne in die linke Spalte Blüte, Blatt und Frucht einer der von dir genannten Pflanzen.<br />
Baumschicht Strauchschicht<br />
Lösung individuell Erle<br />
Eberesche<br />
Birke<br />
Lösung individuell Heckenrose<br />
Hasel<br />
Liguster<br />
Dach<br />
Zentrum (Kernzone)<br />
Mantel<br />
Saum<br />
41
42 Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Wald ist nicht gleich Wald<br />
In einem Mischwald wachsen Birken, Eichen, Kiefern und an feuchten Stellen Erlen. Als Unterholz findet<br />
man Faulbaum, Schneeball, junge Eichen und Birken. Im reinen Kiefernforst dagegen gibt es nur die Wald<br />
Kiefer. Sträucher und junge Laubhölzer wachsen nur am Waldrand.<br />
Mischwald Kiefernforst<br />
Nenne die Schichten des Mischwaldes, die im geschlossenen Kiefernforst fehlen.<br />
Strauchschicht, Krautschicht und Moosschicht<br />
Welche der aufgezählten Tiere werden im Mischwald bzw. im Kiefernforst gute Lebensbedingungen finden?<br />
(Reh, Wildschwein, Eichelhäher, Kiefernspinner, Eichenwickler, Buntspecht, Tannenmeise, Laubfrosch,<br />
Nachtschwalbe.)<br />
Ordne die Tiere in die folgende Tabelle ein.<br />
Mischwald Kiefernforst<br />
Reh, Wildschwein<br />
Eichelhäher<br />
Eichenwickler<br />
Laubfrosch<br />
Buntspecht<br />
Tannenmeise<br />
Nachtschwalbe<br />
Kiefernspinner<br />
Erkunde, ob geschützte Pflanzen und Tiere in einem Wald in der Nähe deines Heimatortes vorkommen.<br />
Berichte über eine ausgewählte Pflanzenart und eine Tierart.
1<br />
Wir bestimmen heimische Spechte<br />
Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
In unseren Wäldern kommen sieben Spechtarten als Brutvögel vor. Sie sind auf dieser Seite abgebildet.<br />
Bestimme und beschrifte mithilfe des Bestimmungsschlüssels die dargestellten Arten!<br />
1 Vogel krähengroß, Gefieder schwarz, roter Oberkopf . . . Schwarzspecht<br />
1 * Kleiner, Gefieder anders gefärbt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
2 Körperoberseite überwiegend grün oder braun. . . . . . . . . . . . . . 3<br />
2 * Körperoberseite schwarzweiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
3 Körperoberseite rindenartig graubraun gemustert,<br />
Körperunterseite heller und quergebändert. . . . . . . . . . . Wendehals<br />
3 * Körperoberseite grün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
4 Oberkopf bis zum Nacken rot, Augenumgebung schwarz . . . Grünspecht<br />
4 * Oberkopf beim Männchen nur an der Stirn rot . . . . . . . . Grauspecht<br />
5 Sperlingsgroß, kleinster europäischer Specht, Oberkopf rot . . Kleinspecht<br />
5 * Amselgroß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
6 Oberkopf durchgängig rot, Unterschwanz rosa . . . . . . . Mittelspecht<br />
6 * Oberkopf schwarz, roter Fleck am Hinterkopf,<br />
Unterschwanz rot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buntspecht<br />
Grauspecht<br />
Buntspecht<br />
Mittelspecht<br />
Grünspecht<br />
Schwarzspecht<br />
Kleinspecht<br />
Wendehals<br />
43
44 Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
1<br />
2<br />
Angepasstheit von Wasservögeln<br />
An unseren Flüssen, Seen und Teichen finden wir eine interessante Vogelwelt. Viele Vogelarten sind an den<br />
Lebensraum Wasser gut angepasst.<br />
Die Stockente ist eine häufige einheimische Entenart. Beschreibe die Angepasstheit der Stockente an<br />
das Leben im und am Wasser.<br />
1 Körperform: kahnförmige Körperform<br />
2 Füße: Schwimmfüße mit Schwimmhäuten<br />
3 Schnabel: Seihschnabel<br />
4 Fortpflanzung/Aufzucht: Bodenbrüter am Ufer<br />
Wie die Stockente sind auch Löffel- und Reiherente einheimische Entenarten. Die drei Entenarten<br />
ernähren sich unterschiedlich. Betrachte jeweils den Schnabel und den Ort der Nahrungssuche und<br />
beschreibe, wie und wo sie ihre Nahrung finden und aufnehmen.<br />
Schnabelform der Löffel- und Reiherente Ort der Nahrungssuche<br />
Mit dem kräftigen kurzen Schnabel kann die Reiherente am Grund des Gewässers besonders<br />
Kleintiere verwerten. Die Löffelente ist eher auf Pflanzen an der Wasseroberfläche spezialisiert.<br />
Die Stockente taucht bei der Nahrungssuche nur Kopf und Vorderkörper in das Wasser ein und<br />
durchwühlt mit dem Schnabel den Schlamm nach Schnecken, Würmern und Wasserpflanzen.
1<br />
2<br />
3<br />
Nahrungsbeziehungen<br />
Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
Erstelle Nahrungsketten mit den aufgeführten Lebewesen. Tipp: Nutze dein Lehrbuch. → SB/S. 155<br />
Nahrungskette 1: Haselmaus – Blattlaus – Turmfalke – Marienkäfer – Heckenrose<br />
Nahrungskette 2: Heckenrose – Ohrwurm – Blattlaus – Amsel – Kreuzspinne – Turmfalke<br />
Nahrungskette 1: Nahrungskette 2:<br />
Turmfalke<br />
Haselmaus<br />
Marienkäfer<br />
Blattlaus<br />
Heckenrose<br />
bedeutet: … wird gefressen von<br />
Heckenrose<br />
bedeutet: … wird gefressen von<br />
Erstelle ein Nahrungsnetz mit den aufgeführten Lebewesen. Hole dir Hilfe aus dem<br />
Schülerbuch. → SB/S. 154 – 155<br />
Sperber – Heckenrose – Haselmaus – Igel – Ohrwurm – Fuchs – Blattlaus – Marienkäfer<br />
Ohrwurm<br />
Heckenrose<br />
Blattlaus<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
Igel<br />
Marienkäfer<br />
Turmfalke<br />
Amsel<br />
Kreuzspinne<br />
Ohrwurm<br />
Blattlaus<br />
Sperber<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
… wird gefressen von<br />
Haselmaus<br />
Schreibe einen Merktext mit den Begriffen Nahrungskette, Nahrungsnetz und Nahrungsquelle.<br />
Viele Tiere fressen unterschiedliche Pflanzen/Tiere. Sie haben mehrere Nahrungsquellen.<br />
Durch Fressen und Gefressenwerden sind bestimmte Lebewesen wie in einer Kette verbunden.<br />
Dies nennt man Nahrungskette. Die meisten Lebewesen haben jedoch mehrere Freßfeinde und<br />
sind damit Mitglieder eines Nahrungsnetzes.<br />
Fuchs<br />
45
46 Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
1<br />
2<br />
Der Kreislauf der Stoffe<br />
Tim und Peter spielen im Garten von Tims Opa Fußball. Plötzlich sieht Peter eine tote Amsel in der<br />
Hecke liegen. „Igitt, schau mal Tim, da liegt ein toter Vogel, komm den räumen wir weg!“ Aber Tim ist<br />
dagegen, denn er hat gestern im Biologieunterricht etwas über den Stoffkreislauf in der Natur gelernt:<br />
„Nein,“ sagt er, „der Vogel ist doch noch Nahrung für andere Lebewesen!“ Peter ist in der Parallelklasse<br />
und hat noch nichts vom Stoffkreislauf gehört. Er schaut Tim fragend an. → SB/S. 158<br />
Schreibe die Erklärung von Tim und verwende dabei folgende Wörter mit konkreten Beispielen:<br />
Verbraucher • Kohlenstoffdioxid • Erzeuger • Mineralstoffe<br />
Sonnenlicht • Wasser • Zersetzer • Sauerstoff<br />
Die Überreste der Amsel werden von den Zersetzern in der Hecke (z.B. Würmer, Bakterien) abgebaut<br />
und in Kohlenstoffdioxid, Wasser und Mineralstoffe umgewandelt. Diese Stoffe werden von den Erzeugern,<br />
den Pflanzen der Hecke, aufgenommen und dienen ihnen zusammen mit Sonnenlicht als „Nahrung“.<br />
Die Pflanze wächst und produziert Sauerstoff. Eine solche Pflanze ist die Heckenrose, die z. B. von<br />
Heuschrecken gefressen wird. Weil die Heuschrecke Blätter der Heckenrose als Nahrung verbraucht,<br />
gehört sie zu den Verbrauchern.<br />
Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Amsel dort lassen!<br />
Nicht nur in unseren heimischen Lebensräumen gibt es den Kreislauf der Stoffe, sondern überall. Man<br />
findet ihn zum Beispiel auch in der Savanne in Afrika. Fülle die Tabelle aus, benutze dazu die Tiere und<br />
Pflanzen im Kasten. Falls du weitere Informationen brauchst, kannst du in einem Biologiebuch oder im<br />
Internet nachschauen. Manche Begriffe kannst du öfter als einmal verwenden! → SB/S. 158<br />
Pilze, Löwe, Holunder, Maus, Savannengras, Fuchs, Assel, Gazelle, Bakterien, Dungkäfer<br />
Aufgabe heimische Hecke afrikanische Savanne<br />
Zersetzer<br />
Erzeuger<br />
Verbraucher<br />
Pilze, Bakterien, Assel Pilze, Bakterien, Dungkäfer<br />
Holunder Savannengras<br />
Maus, Fuchs Löwe, Gazelle
1<br />
2<br />
3<br />
Warum brauchen manche Wirbeliere besonderen Schutz?<br />
Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
Viele Tierarten sind gefährdet. Nenne Ursachen der Gefährdung und mögliche Schutzmaßnahmen.<br />
Finde Ursachen für die Gefährdung der Wirbeltiere. Fülle die Mindmap aus. → SB/S. 34, 40, 47, 51,<br />
164 – 165<br />
Bejagung<br />
Straßenverkehr<br />
Vernichtung von Lebensräumen<br />
Mögliche Ursachen<br />
der Gefährdung<br />
…<br />
Bejagung<br />
Vernichtung von Lebensräumen<br />
Vernichtung von Lebensräumen …<br />
…<br />
Säugetiere<br />
Vögel<br />
Lurche<br />
Kriechtiere<br />
Fische<br />
Über�schung<br />
Meeresverschmutzung<br />
Klimaveränderung<br />
…<br />
Straßenverkehr<br />
Vernichtung von Lebensräumen<br />
Vernichtung von Laichgewässern<br />
…<br />
Straßenverkehr<br />
Bejagung<br />
Vernichtung von Lebensräumen<br />
Fasse die Ergebnisse deiner Mindmap weiter zusammen. Nenne die wichtigsten Ursachen für<br />
die Gefährdung von Wirbeltieren.<br />
Die wichtigsten Ursachen für die Gefährdung von Wirbeltieren sind der Straßenverkehr und<br />
die Vernichtung von Lebensräumen.<br />
Der Mensch ist verantwortlich dafür.<br />
Erläutere, was die Menschen zum Schutz bedrohter Wirbeltiere tun könnten.<br />
Die Menschen könnten die Lebensräume von Wirbeltieren schützen.<br />
Beim Straßenbau kann darauf geachtet werden, dass keine weiteren Lebensräume zerstört werden.<br />
…<br />
47
48 Lebensräume in meiner Nachbarschaft<br />
1<br />
Lebensräume in meiner Nachbarschaft – auf einen Blick<br />
Im Kapitel „Lebensräume in meiner Nachbarschaft“ hast du viele Zusammenhänge erfahren. Eine Mindmap<br />
kannst du anfertigen, um dir etwas einzuprägen oder um Gelerntes übersichtlich darzustellen. → SB/S. 138,<br />
148, 152<br />
Vervollständige die Mindmap zum Kapitel „Lebensräume in meiner Nachbarschaft“.<br />
Du kannst so viele Begriffe ergänzen, wie du möchtest.<br />
Lösung individuell<br />
Vögel<br />
Lebensraum<br />
Tiere<br />
Was lebt in<br />
meiner Nachbarschaft?<br />
Pflanzen<br />
Merk dir! In deiner Umwelt gibt es unterschiedliche Lebensräume mit den an sie angepassten Lebewesen.<br />
Alle Nahrungsketten gehen von Pflanzen aus.
Autorinnen und Autoren:<br />
Hans Blümel, Dr. Wulf-Dieter Lepel, Dr. Sabine Müller,<br />
Dr. Ursula Pälchen, Linda Wurst<br />
Redaktion:<br />
Christine Amling, Horst-Dieter Gemeinhardt<br />
Illustration und Grafik:<br />
Hans-Joachim Behrendt, Ulrike Braun, diGraph, Peter Hesse, Karin Mall<br />
Layoutkonzept:<br />
Ellen Meister<br />
Umschlaggestaltung:<br />
V+I+S+K, Berlin<br />
Bildquellenverzeichnis:<br />
Archiv CV: 25.1 | Archiv Hoyer: 12.1 (Hartung), 15.1 o. re. (Maywald); Brehme, S.: 44.1; Bruns, E.:<br />
17.2 re. | Corbis: 16.3 (RF) | Deutscher Blindenverband e. V.: 15.1 li. o. | Digitalstock.de: 1 a re., 9.2 Mi.,<br />
25.3, 27.1 bis 4, 27.6, 32.3 | Döring, V.: 34.1–3 | Fotolia: com: 1.1 (Yurij Poznukhov), 1.2 (Christoph<br />
Pudras), 1 c (Thaut Image), 9.2 li. (Filev), 9.2 re. (Foto LS), 14.3 li. (Wolfgang Kruck), 14.3 re. (jeremybaile),<br />
15.1 u. li. (steamroller), 17.2 li. (Stoneman), 18.1 o. li. (Kevin Eaves), 18.1 Mi. li. (whiprabbits),<br />
18.1 Mi. re. (Tadija Savic), 18. 1 u. (Anita Zander), 24.1 (Art man), 25.6 (Perrush), 26.1 (Mammut<br />
Vision), 27.5 (Fotolyse), 32.1 (FK-Lichtbilder), 32.4 (Franz Pfluegl) | Gemeinschaft Deutscher Hundehalter<br />
e. V.: 15.1 u. re. | Hollatz, J.: 1 b | iStockphoto.com: 1.3 (Theresa Martinez), 15.1 Mi. (Maxim<br />
Kulko), 23.1 re. (Jurjen Draaijer), 25.4 (Pavel Lebedinsky), 25.5 (Ameng Wu) | Okapia: 23. 1 li. (Reinhardt)<br />
| Project Photos: 1 a li.o., 25.2, 31.2 re., 32.2 | Reinhardt Tierfoto, Heiligkreuzsteinach: 6.1 | Rudloff,<br />
K.: 44.4 | Theuerkauf, H.: 17.2 Mi., 31.2 li. | Wildlife: 38.1–2 (Harms).<br />
Technische Umsetzung:<br />
Burkhard Kehl, Berlin<br />
www.cornelsen.de<br />
© 2010 <strong>Cornelsen</strong> <strong>Verlag</strong>, Berlin<br />
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf<br />
der vorherigen schriftlichen Einwilligung des <strong>Verlag</strong>es.<br />
Hinweis zu § 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine<br />
solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt werden.<br />
Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.<br />
Das Arbeitsheft zu diesen Lösungen erhalten Sie unter der ISBN 978-3-06-014658-1.