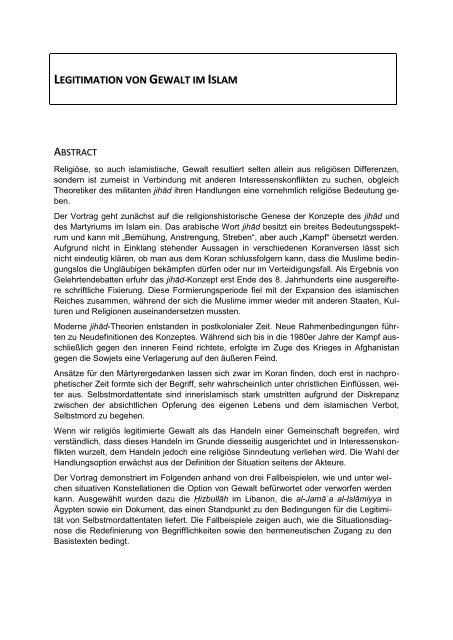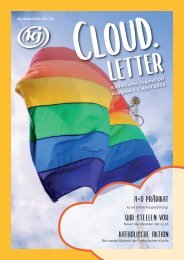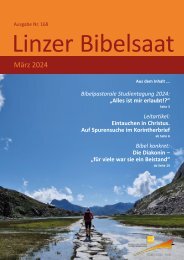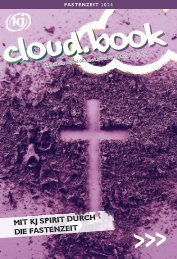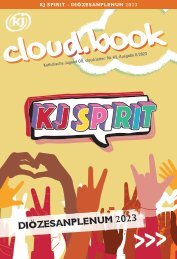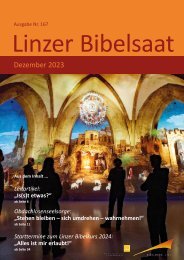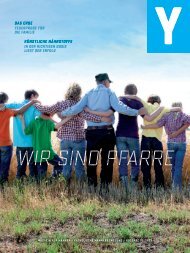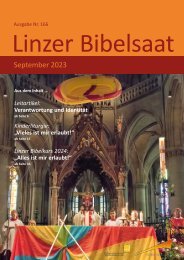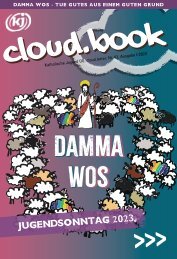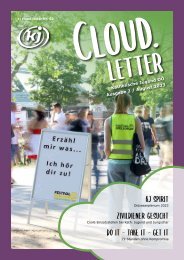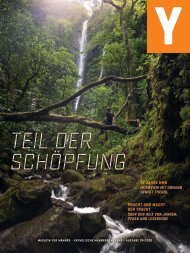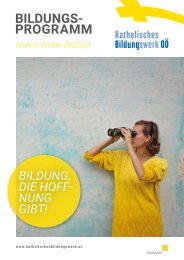Referenten: Lebenslauf/Publikationen/Statement
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LEGITIMATION VON GEWALT IM ISLAM<br />
ABSTRACT<br />
Religiöse, so auch islamistische, Gewalt resultiert selten allein aus religiösen Differenzen,<br />
sondern ist zumeist in Verbindung mit anderen Interessenskonflikten zu suchen, obgleich<br />
Theoretiker des militanten jihād ihren Handlungen eine vornehmlich religiöse Bedeutung geben.<br />
Der Vortrag geht zunächst auf die religionshistorische Genese der Konzepte des jihād und<br />
des Martyriums im Islam ein. Das arabische Wort jihād besitzt ein breites Bedeutungsspektrum<br />
und kann mit „Bemühung, Anstrengung, Streben“, aber auch „Kampf“ übersetzt werden.<br />
Aufgrund nicht in Einklang stehender Aussagen in verschiedenen Koranversen lässt sich<br />
nicht eindeutig klären, ob man aus dem Koran schlussfolgern kann, dass die Muslime bedingungslos<br />
die Ungläubigen bekämpfen dürfen oder nur im Verteidigungsfall. Als Ergebnis von<br />
Gelehrtendebatten erfuhr das jihād-Konzept erst Ende des 8. Jahrhunderts eine ausgereiftere<br />
schriftliche Fixierung. Diese Formierungsperiode fiel mit der Expansion des islamischen<br />
Reiches zusammen, während der sich die Muslime immer wieder mit anderen Staaten, Kulturen<br />
und Religionen auseinandersetzen mussten.<br />
Moderne jihād-Theorien entstanden in postkolonialer Zeit. Neue Rahmenbedingungen führten<br />
zu Neudefinitionen des Konzeptes. Während sich bis in die 1980er Jahre der Kampf ausschließlich<br />
gegen den inneren Feind richtete, erfolgte im Zuge des Krieges in Afghanistan<br />
gegen die Sowjets eine Verlagerung auf den äußeren Feind.<br />
Ansätze für den Märtyrergedanken lassen sich zwar im Koran finden, doch erst in nachprophetischer<br />
Zeit formte sich der Begriff, sehr wahrscheinlich unter christlichen Einflüssen, weiter<br />
aus. Selbstmordattentate sind innerislamisch stark umstritten aufgrund der Diskrepanz<br />
zwischen der absichtlichen Opferung des eigenen Lebens und dem islamischen Verbot,<br />
Selbstmord zu begehen.<br />
Wenn wir religiös legitimierte Gewalt als das Handeln einer Gemeinschaft begreifen, wird<br />
verständlich, dass dieses Handeln im Grunde diesseitig ausgerichtet und in Interessenskonflikten<br />
wurzelt, dem Handeln jedoch eine religiöse Sinndeutung verliehen wird. Die Wahl der<br />
Handlungsoption erwächst aus der Definition der Situation seitens der Akteure.<br />
Der Vortrag demonstriert im Folgenden anhand von drei Fallbeispielen, wie und unter welchen<br />
situativen Konstellationen die Option von Gewalt befürwortet oder verworfen werden<br />
kann. Ausgewählt wurden dazu die Ḥizbullāh im Libanon, die al-Jamāʿa al-Islāmiyya in<br />
Ägypten sowie ein Dokument, das einen Standpunkt zu den Bedingungen für die Legitimität<br />
von Selbstmordattentaten liefert. Die Fallbeispiele zeigen auch, wie die Situationsdiagnose<br />
die Redefinierung von Begrifflichkeiten sowie den hermeneutischen Zugang zu den<br />
Basistexten bedingt.