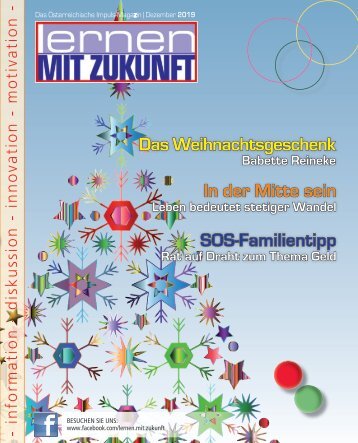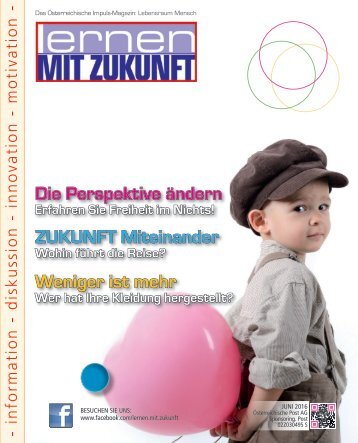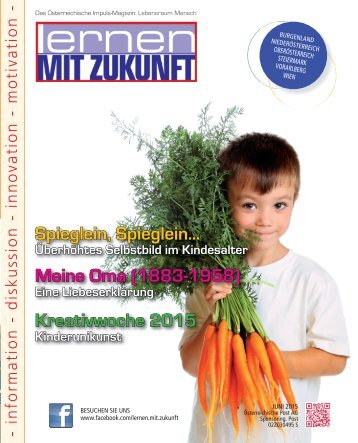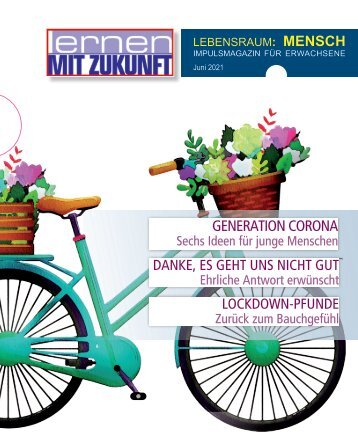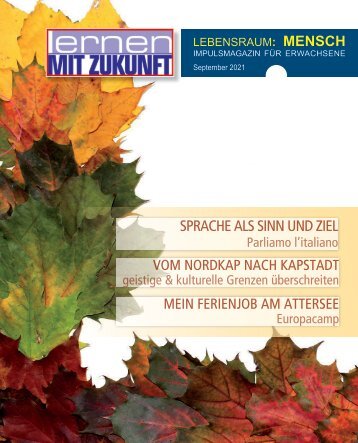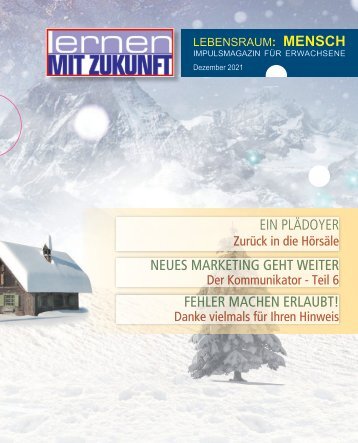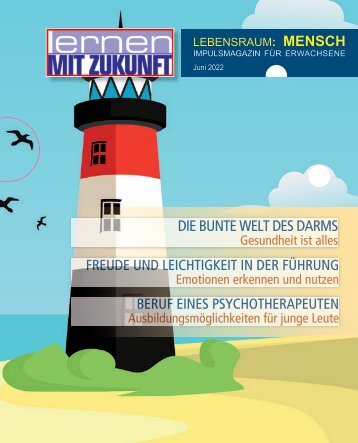LERNEN MIT ZUKUNFT September 2020
- Text
- Menschen
- Kindern
- Kommunikation
- Eltern
- Eulalia
- Zeit
- Welt
- Schule
- September
- Kinder
information & zukunft
information & zukunft Perspektivenwechsel: Home-learning an der Uni EIN SEMESTER MIT VIDEOKONFERENZEN UND DIGITALEN KAFFEEPAUSEN Tina Čakara Studentin Junge Autorin Foto: Fotostudio primephoto Es kann nur schiefgehen!, dachte ich und startete Skype. Ich studiere Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien und hatte letztes Semester erstmals eine Übung zum Thema Dolmetschen. Wie sollte das bitte online funktionieren? Ohne Dolmetschkabine und körperlicher Anwesenheit? Doch nicht nur die Studierenden mussten in diesem außergewöhnlichen Semester anders und neu denken. Auch die Lehrenden zeigten überraschend viel Kreativität in der Umsetzung ihrer Kurse. DER VIRTUELLE KONFERENZRAUM Ich sitze mit Kopfhörern vor dem Bildschirm und höre meiner Studienkollegin genau zu, wie sie eine kurze Präsentation auf Englisch hält. Ich soll ihre Rede nach zwei Minuten ohne Notizen zu machen ins Deutsche übersetzen. Konzentriert versuche ich mir jedes der Worte zu merken, die durch das Mikrofon in ihren Laptop dringen, um dann kilometerweit bis zu meinem zu reisen und durch die Kopfhörer wieder zu einer Stimme zu werden. Als die Präsentation meiner Kollegin zu Ende ist und mir ihr lächelndes Gesicht vom Bildschirm aus entgegenblickt, fange ich auch schon an: anfangs unsicher, dann aber mit überraschend viel Freude dolmetsche ich die eben gehörte Rede souverän ins Deutsche. DAS VIRTUELLE FEEDBACK Jede Woche üben meine Kollegin und ich einen anderen Aspekt des Dolmetschens. Einmal wiederholen wir die Inhalte in der gleichen Sprache, das nächste Mal dolmetschen wir vom Englischen ins Deutsche, dann umgekehrt, einmal mit und einmal ohne Notizen. Alles zu zweit. Alles per Videochat. Niemand außer ihr hört oder sieht mich. Dennoch spüre ich während des Dolmetschens Aufregung und Nervosität und am Ende Erleichterung. Genau die Gefühle, die wir in dieser Übung zu bewältigen lernen sollen. Feedback geben wir einander gegenseitig. Auch das sollen wir lernen. Also: mission accomplished! DIE VIRTUELLE KAFFEEPAUSE Nachdem wir alles erledigt haben, plaudern meine Kollegin und ich jedes Mal noch mindestens eine Stunde weiter. Was frustriert uns an der Uni? Was überfordert uns zu Hause? Was gibt uns Hoffnung, trotz der vielen Veränderungen? Mit welchem Gedanken stehen wir morgens auf? Jeden Montag um 17 Uhr haben wir eine Videokonferenz zu zweit. Meist klicken wir erst lange nach 19 Uhr auf den Auflege-Button. Denn home-learning bedeutet nicht nur virtuell Vorlesungen zu besuchen und Prüfungen abzulegen, sondern auch sich virtuell mit anderen Studierenden einen Kaffee beim Automaten holen gehen. Foto: © Christian Dorn | pixabay.com 32 | SEPTEMBER 2020
information & bewusstsein Hirnforschung und Sprache: Macht unserer Sprache SPRACHE HAT FAST IMMER EINE UNBEWUSSTE WIRKUNG Die Sprache beeinflusst unser Denken. Viele Metaphern, die wir ständig benutzen und welche unsere Alltagssprache prägen, beeinflussen unbewusst unser Denken. Neurolinguisten zeigen, dass bei einem Großteil unserer Metaphern die Areale im Gehirn aktiviert werden, die auf der rechten Gehirnhälfte für bildhafte Vorstellungen zuständig sind. Die Wirkung sprachlicher Bilder reicht oft zu einer körperlichen Reaktion. Hören Menschen, dass sich eine Person im sechsten Stock befindet, wandert ihr Blick automatisch nach oben. Lesen sie den Satz "Unser Kurs ist eine Treppe zum Erfolg" geht der Blick der Leser auch nach oben. Bei der Aussage „Die Anforderungen stürzen auf ihn ein“ wird sich der Leser unbewusst ein wenig zusammenziehen. Wer das Bild eines Tigers zu sehen bekam, schätzte die Geschwindigkeit eines Läufers schneller ein als der, dem das Bild einer Schildkröte gezeigt wurde. Zugleich ist es auch, dass Metaphern besser im Gedächtnis gespeichert werden als abstrakte Formulierungen. Das sollte man bedenken, wenn Texte für den Schulunterricht formuliert werden. Eine bildhafte Formulierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer sich an eine Anweisung hält. Beispiel für kleine Kinder: Bleib bei Rot stehen! Viele Wörter lösen bei uns sofort Gefühle aus. Besonders im Produktmarketing werden positive Worte gewählt. Würden Sie als Hersteller von Bitterschokolade ihr Produkt „Wiener Bitterschokolade“ nennen? Keine gute Idee, denn das Wort Bitterschokolade ruft Gefühle wach, die mit dem Begriff „bitter“ verbunden sind: Bitterkeit, verbittert, bittere Enttäuschung, bittere Kälte, bitteres Unrecht, das ist bitter für mein Kind. Menschen sind evolutionsbedingt konditioniert, bittere Nahrung zu meiden, da sie oft giftig ist. In der Natur sind sehr oft giftige Pflanzen und Früchte geschmacklich bitter. Als Hersteller ist es besser Ihr Produkt „edelbitter“ oder „zartbitter“ zu nennen, um ihr den bitteren Beigeschmack zu nehmen. Noch besser ist es, Ihr Produkt als „dunkle Schokolade“ oder mit „80 % Kakaoanteil“ zu beschreiben. Dipl.-Ing. Alexander Ristic Journalist Neurowissenschaftler sind sich sicher, dass unsere Entscheidungen immer einen emotionalen Aspekt haben. Manager erliegen oft der Illusion, sie treffen ihre Entscheidungen immer rational. In Wirklichkeit erliegen sie vielfältigen unbewussten und emotionalen Einflüssen. Wörter, die eine hohe Erregung erzielen, werden besser im Gedächtnis behalten, schneller wiedererkannt und lenken in höherem Maß die Aufmerksamkeit auf sich. Worte als Auslöser unangenehmer Gefühle: Besserwisser, Gegner, Nörgler, Räuber, beschuldigen, bevormunden, vergessen, ängstlich, entsetzt, kalt, nervös, sprunghaft, traurig ….. Worte als Auslöser angenehmer Gefühle: Bruder, Freund, Gastgeber, Professor, Kind, Schwester, erzählen, teilen, freundlich, kultiviert, verlässlich, verständnisvoll, weiblich, zufrieden ….. Foto: © Ralf Designs | pixabay.com 33 | SEPTEMBER 2020
- Seite 1 und 2: - information - diskussion - innova
- Seite 3 und 4: editorial & information impressum M
- Seite 5 und 6: information & lernen Am Wichtigsten
- Seite 7 und 8: information & entwicklung Mit feine
- Seite 9 und 10: information & kommunikation Der Kom
- Seite 11 und 12: information & nachhaltigkeit indem
- Seite 13 und 14: information & bewusstsein Auch die
- Seite 15 und 16: Sie wissen selbst am besten, womit
- Seite 17 und 18: information & freiheit Kostbarste R
- Seite 19 und 20: information & & pädagogik forschun
- Seite 21 und 22: information & wissenschaft nommenen
- Seite 23 und 24: Symbolfoto © Daniel Gollner, Carit
- Seite 25 und 26: information & bewusstsein Ohrensch
- Seite 27 und 28: information & integration und konnt
- Seite 29 und 30: information & nachhaltigkeit wirkli
- Seite 31: Bücher und die Stunde dient ihr au
- Seite 35 und 36: information & erinnerung und mußte
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...