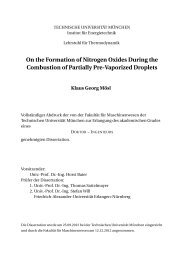Mein Vortrag soll erfolgreich sein proLehre - TUM
Mein Vortrag soll erfolgreich sein proLehre - TUM
Mein Vortrag soll erfolgreich sein proLehre - TUM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Mein</strong> <strong>Vortrag</strong> <strong>soll</strong><br />
<strong>erfolgreich</strong> <strong>sein</strong>!<br />
C. Ucke / PROLEHRE <strong>TUM</strong><br />
Am Anfang war das Wort<br />
Noch immer wird der Eindruck bei einem <strong>Vortrag</strong> wesentlich von der Rhetorik<br />
und vom Auftreten (Körpersprache) bestimmt. Eine gute Power-Point<br />
Präsentation, Overhead-Projektion, Dia-Projektion, Tafelanschrieb kann den<br />
Eindruck vervollkommnen.<br />
Rhetorik muss man üben, üben, üben. Und das tun die Zuhörer mit diesem<br />
<strong>Vortrag</strong> nicht.<br />
Hier werden nur einige Hinweise auf das ergänzende Umfeld zur Rhetorik<br />
gegeben.<br />
Vieles von dem, was hier gesagt und gezeigt wird, ist schon oft gesagt worden.<br />
Es wird nur häufig nicht beachtet.<br />
---------------------------------------------------------------------------------------<br />
Tiefschwarze Schrift auf weißem Hintergrund kann bei den heutigen, lichtstarken<br />
Beamern leicht zu kontraststark <strong>sein</strong>.<br />
1
Tiefschwarze Schrift auf weißem Hintergrund kann bei den heutigen, lichtstarken<br />
Beamern leicht zu kontraststark <strong>sein</strong>.<br />
Hier erscheint zusätzlich eine Art Trauerrand; fällt weg, wenn nur die Schrift<br />
projiziert wird.<br />
Bei der zweiten Folie ist ein schwach farbiger Hintergrund und die Schrift nicht<br />
mehr tiefschwarz.<br />
Das ist im allgemeinen angenehmer zu lesen.<br />
Dadurch ist der Kontrast schwächer als bei schwarzer Schrift auf weißem<br />
Hintergrund<br />
Helle Schrift auf dunklem Hintergrund kann hilfreich <strong>sein</strong>. Früher war gelb auf<br />
blauem Untergrund verbreitet.<br />
Hintergrund muss dunkel genug <strong>sein</strong>, damit Kontrast hinreichend deutlich.<br />
Rote Schrift auf blauem Hintergrund ist sehr unangenehm zu lesen. Derartige<br />
Farbkombination muss man vermeiden.<br />
So ein Hintergrund mit Palmen auf einer Südseeinsel ist bei einem <strong>Vortrag</strong> über<br />
eine Urlaubsreise angemessen. Eher nicht bei einem Seminarvortrag,<br />
Berufungsvortrag in der Physik, Fachvortrag in der Medizin o.ä.<br />
Welcher Einstieg gefällt am besten?<br />
2
Ein <strong>Vortrag</strong><br />
<strong>soll</strong>te …<br />
… inhaltlich<br />
– klar und übersichtlich gegliedert <strong>sein</strong>,<br />
– einen interessanten Einstieg bieten,<br />
– inhaltliche Prioritäten setzen/Kernaussagen<br />
bearbeiten,<br />
– nach Einleitung, Hauptteil und Schluss<br />
strukturiert <strong>sein</strong>,<br />
– Fragen, Probleme und Thesen aufwerfen,<br />
– am Schluss zu einer Diskussion überleiten/<br />
anregen.<br />
… formal<br />
– einen Umfang von 20-45 Minuten Sprechzeit<br />
nicht überschreiten,<br />
– als Redemanuskript in eine optisch übersichtliche<br />
Form gebracht werden (Absätze, Unterstreichungen,<br />
Hervorhebungen, breiter Rand)<br />
und am Rand mit persönlichen Regieanweisungen<br />
versehen <strong>sein</strong><br />
(z. B. Folie auflegen, Pause machen).<br />
Diese inhaltlichen und formalen Überlegungen müssen natürlich vor Beginn der<br />
<strong>Vortrag</strong>s gemacht <strong>sein</strong>.<br />
3/32<br />
3
Nur das Wichtigste als<br />
Bild!<br />
Weniger ist mehr!<br />
Gezeigte Folien oder Bilder <strong>soll</strong>en nur das Wichtigste enthalten und sie müssen<br />
in der Darstellung optimiert <strong>sein</strong>. Sie müssen nicht selbsterklärend <strong>sein</strong>.<br />
Die Bilder sind nicht der <strong>Vortrag</strong>!!<br />
Weniger ist mehr. Dieser Spruch aus der Kunst gilt auch für Vorträge und<br />
insbesondere auch für Folien und Power-Point Präsentationen.<br />
Auf keinen Fall eine effektüberladene Medienshow. Keine Folienschleuder (ca. 1<br />
Folie pro 2 Minuten)<br />
Beim Umschalten von einer Folie zur Nächsten Redepause machen!!<br />
Soll man bei Verwendung des eigenen notebooks dessen Monitor zur Kontrolle<br />
mitbenutzen? Das kann zu einem nicht sinnvollen „Zwiegespräch“ mit dem<br />
Monitor führen. Manche <strong>Vortrag</strong>ende sehen das jedoch positiv, da sie dann mit<br />
einem kurzem Blick sehen können, welche Folie gezeigt wird, ohne sich zur<br />
Projektionsfläche wenden zu müssen.<br />
Auf keinen Fall <strong>soll</strong> man jedoch versuchen, beim <strong>Vortrag</strong> vom Notebook-<br />
Monitor abzulesen. Alternativ kann man sich die Notizzettelausdrucke hinlegen<br />
und sich daran festhalten.<br />
4
Black 1<br />
Jetzt denken Sie vielleicht, der <strong>Vortrag</strong>ende hat einen Fehler in <strong>sein</strong>er<br />
Präsentation?<br />
Aber hier ist wirklich eine schwarze Folie als Bild!<br />
Um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf das Gesprochene zu lenken, kann eine<br />
Dunkelphase beim Beamer hilfreich <strong>sein</strong> (eine Folie mit schwarzem Hintergrund<br />
einfügen bzw. Taste B oder . auf der Tastatur; hier aber Vorsicht im Ausland: in<br />
Italien erzeugt die Taste n (= nero) Dunkelheit).<br />
Natürlich dann nicht, wenn der ganze Raum plötzlich im Dunkeln liegt.<br />
Beim Overhead-Projektor das Feld komplett abdecken (eine klappbare, dünne<br />
Pappe aus zwei 14cm x 28cm großen Teilen dafür vorbereiten!)<br />
-------------------------------------------------------------------------------<br />
Es muss um 470 vor Christus nach dem Sturz der Tyrannis in Syrakus gewesen<br />
<strong>sein</strong>, als der Sprachlehrer Korax <strong>sein</strong>em Schüler Teisias in der Technik des<br />
Redens unterwies. Am Ende verweigert Teisias dem Lehrer den Lohn. Seine<br />
Begründung gegenüber Korax scheint bestechend: Wenn du mir <strong>erfolgreich</strong> die<br />
Redetechnik beigebracht hast, muss ich dich überzeugen können, dass ich dir<br />
nichts schulde. Also zahle ich nichts. Wenn es mir nicht gelingt, hast du mich<br />
nicht gut genug unterrichtet, und ich zahle erst recht nichts.<br />
Korax wäre ein schlechter Lehrer, wüsste er keine Antwort. Darum entgegnet er:<br />
Wenn du mich überzeugen kannst, dass ich nichts verdiene, habe ich dir so gut<br />
die Redekunst beigebracht, dass ich den Lohn verdiene. Wenn du mich nicht<br />
überzeugen kannst, zahlst du sowieso.<br />
5/32<br />
5
hear and forget<br />
see and remember<br />
do and understand<br />
chinesisches Sprichwort<br />
Wird nach einer Dunkelphase der Beamer/Overheadprojektor wieder<br />
eingeschaltet, wird die ganze Konzentration auf das Bild gelenkt. Wir reagieren<br />
sehr stark auf Reizwechsel.<br />
Beobachten Sie die Augen ihrer Zuhörer in dem Moment des Wiedereinschaltens<br />
des Projektors/Beamers: sie wenden sich alle (!) zum Bild. Dem kann sich<br />
praktisch keiner entziehen.<br />
Der Sehkanal nimmt hundert Mal mehr Informationen auf als der Hörkanal (107 bit/s versus 105 bit/s). Das vermindert oder unterbricht die Konzentration auf das<br />
Gesprochene.<br />
Grundsätzlich <strong>soll</strong>te auch der Hintergrund des Redners möglichst reizarm <strong>sein</strong>:<br />
saubere, gut gewischte Tafel, keine Plakate mit Hinweisen auf die nächste<br />
Konferenz, Uniparty usw. (vgl. Vorbereitungen)<br />
Nur Hören erbringt eine Behaltensleistung von vielleicht 20% nach dem <strong>Vortrag</strong>,<br />
nur sehen etwa 30%. Wort und Bild zusammen kommen vielleicht auf 50%.<br />
Hören, Sehen und Diskutieren ca. 70%. Hören, Sehen, Diskutieren und Tun ca.<br />
90%.<br />
Die Zahlenangaben sind nur als sehr grobe Anhaltswerte zu nehmen und zeigen<br />
ungefähre Relationen auf (Werneck, T./Heidack, C.: Gedächtnistraining,<br />
München, 3.Aufl. 1986)<br />
Nach dem <strong>Vortrag</strong> setzt exponentielles Vergessen ein.<br />
6/32<br />
6
Man kann die Hörer schon zu Beginn auffordern, bei Unklarheiten gleich Fragen<br />
zu stellen. Das kann allerdings sehr kritisch werden, wenn dann mehr Fragen<br />
kommen, als man sich vorgestellt hat. Es unterbricht auch den Fluss des eigenen<br />
<strong>Vortrag</strong>s. In einer Vorlesung mit mehreren hundert Hörern ist das dann schon<br />
akustisch schwierig, weil normalerweise keine Mikrofone für die Frager zur<br />
Verfügung stehen. In so einem Fall die Frage immer nochmal für alle<br />
wiederholen.<br />
Stellt man eine Frage muss man bis zu 30 Sekunden warten, damit die Zuhörer<br />
das wirklich tun. Die Zeit kommt einem ziemlich lang vor!!<br />
Das Bild stellt natürlich auch die Diskrepanz zwischen verbaler Aufforderung<br />
und körperlichem Ausdruck deutlich dar. Durch die Übertreibung wirkt es aber<br />
eher auflockernd. Überhaupt können Karikaturen, Witze oder kleine Anekdoten<br />
selbst in sonst trockenen Mathematik- oder Technikvorlesungen eine<br />
angenehmere Atmosphäre schaffen. Aber Vorsicht: Karikaturen können auch<br />
verletzen!<br />
7/32<br />
7
Vorsicht: Karikaturen können auch verletzen!<br />
Die linke Karikatur habe ich selbst mit der Schrift ‚Technical University Munich‘<br />
versehen und in einem <strong>Vortrag</strong> gezeigt. Nach dem <strong>Vortrag</strong> kam ein älterer<br />
Ordinarius zu mir. Er fühlte die Technische Universität verunglimpft. Jetzt ist die<br />
<strong>TUM</strong> sogar eine Eliteuniversität. Da passt so ein Bild noch weniger?<br />
Die rechte Karikatur könnte Veranlassung zu der Frage geben, wieso hier gerade<br />
eine Frau dargestellt ist.<br />
Eine Menge geeigneter Karikaturen stammen von Sidney Harris (auch im WEB<br />
zu finden)<br />
8/32<br />
8
Erika<br />
a<br />
Sofie<br />
a ≈ E/5<br />
E<br />
Lesbarkeit<br />
schlechte<br />
Erfassbarkeit<br />
9/32<br />
schlechte<br />
Erkennbarkeit<br />
Abstand zur Tafel<br />
Eine Tafel oder Projektionsfläche der Breite a ist dann optimal, wenn ihre Breite<br />
etwa ein Fünftel des Betrachtungsabstandes beträgt.<br />
Für Sofie ist der Abstand gerade ok, für Erika noch tolerierbar.<br />
Ist der Abstand E zu klein, ist die Erfassbarkeit schlechter (Beispiel: Sitzen in der<br />
1. Reihe in einem Breitwandfilm)<br />
Ist der Abstand E zu groß, ist die Erkennbarkeit schlechter (Schrift kann nicht<br />
mehr entziffert werden).<br />
Ein einfacher, wenn auch grober Test: Man peilt aus der größten<br />
Zuschauerentfernung über die Handfläche des ausgestreckten Armes die<br />
Projektionsfläche an. Sie muss sich gerade abdecken lassen. Bei den meisten<br />
Menschen ist das Verhältnis Handflächenbreite zu Armlänge etwa 1 zu 5.<br />
9
h 2,3% a<br />
a<br />
Die Schriftgröße (Schrifthöhe) ist ausreichend, wenn sie 2,3% der Tafel-<br />
/Projektionsflächenbreite a beträgt<br />
Bei einer DIN A4-Folie (a = 300mm) ergibt sich damit eine Schriftgröße von<br />
300·0,023 = 6,9mm, d.h. etwa 7mm.<br />
Das trifft in gleicher Weise für die Beschriftung von Power-Point-Vorlagen zu.<br />
Bei einer Tafel von 3m Breite ergibt sich eine Schriftgröße von 7cm; bei<br />
kleineren Seminarräumen kann diese Größe auch unterschritten werden.<br />
Die Schriftstärke <strong>soll</strong>te etwa 1/10 der Schriftgröße betragen.<br />
Dieses Beispiel verdeutlicht auch, dass man bei Overheadprojektor/Beamer<br />
Querformat bevorzugen <strong>soll</strong>te. Bei Folien im Hochformat wird der untere Teil<br />
bei der Projektion leicht abgedeckt. Vermutlich haben viele <strong>Vortrag</strong>ende<br />
deswegen Folien im Hochformat, weil das die Default-Einstellung des Druckers<br />
ist. Andere Medien (Tafel, Fernsehen, Kino) haben Querformat.<br />
Weitere Einzelheiten sind in der DIN-Norm 19045 (Projektion von Steh- und<br />
Laufbild) nachzulesen. Lohnt aber nicht!<br />
10/32<br />
10
10m<br />
3mm<br />
α<br />
Bild<br />
XGA-Auflösung 1024 x 768<br />
1024 Pixel auf 3m ergeben<br />
Pixelbreite von ca. 3mm<br />
tanα = 3mm/10m = 0,0003<br />
α = 0,017 0 ≈ 1Minute<br />
Auflösungsgrenze des Auges!<br />
Exkurs: Heutige Beamer haben häufig eine Auflösung von 1024 x 768 Pixel<br />
(sog. XGA-Format)<br />
1000 Pixel auf eine Breite von 3m projiziert ergibt eine Pixelgröße von 3mm.<br />
Mit der angeführten Rechnung ergibt sich ein Sehwinkel von 1 Minute<br />
Das entspricht gerade der Auflösungsgrenze des Auges.<br />
Das heißt, die heutige Technik bei Beamern ist von der Auflösung her schon<br />
ausreichend.<br />
Ähnliches gilt bei Notebook-Bildschirmen (15 Zoll in 50cm Abstand).<br />
Die sogenannte Noniussehschärfe (die Unterscheidbarkeit der Versetzung zweier<br />
aneinander stoßenden Geraden) des Menschen ist allerdings bis zu zehnmal<br />
besser. Das sieht man auch bei diesem Bild sehr deutlich.<br />
Bei Dias oder Folien stellt sich die Frage der Auflösung nicht, da die optische<br />
Auflösung sowieso höher ist (Faktor 10 bis 30).<br />
Gute Dias haben deswegen noch immer ihre Berechtigung!<br />
11/32<br />
11
Diese Schrift ist Arial - 8 Punkt ≈ 2 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 10 Punkt ≈ 2,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 12 Punkt ≈ 3 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 14 Punkt ≈ 3,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 16 Punkt ≈ 4 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 18 Punkt ≈ 4,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 20 Punkt ≈ 5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 22 Punkt ≈ 5,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 24 Punkt ≈ 6 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 26 Punkt ≈ 6,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 28 Punkt ≈ 7 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 30 Punkt ≈ 7,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 32 Punkt ≈ 8 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 34 Punkt ≈ 8,5 mm<br />
Diese Schrift ist Arial - 36 Punkt ≈ 9 mm<br />
12/32<br />
Minimum<br />
← optimal<br />
Damit eine Schrift gut lesbar ist, <strong>soll</strong>te sie eine Größe von etwa 28 Punkt (7mm)<br />
aufweisen.<br />
Bei gut lesbarer, serifenloser Computer-Schrift (wie hier Arial) kann man bis auf 20<br />
Punkt (5 mm) hinuntergehen.<br />
Fette Schrift ist schlechter lesbar. Für Überschriften oder Hervorhebungen dennoch<br />
geeignet.<br />
Unterstreichungen vermeiden; sie sind ein Überbleibsel aus der Schreibmaschinenzeit.<br />
Bei gut lesbaren Schriften können Sie bis 5 mm Schriftgröße, also bei Arial oder<br />
Verdana 20 Punkt, heruntergehen. Kleinere Schrift ist verboten!<br />
Ingenieure und Naturwissenschaftler <strong>soll</strong>ten insbesondere bei den Achsenbeschriftungen<br />
von Grafiken auf lesbare Bezeichnungen und Einheiten achten!<br />
12
Dies ist Times New Roman - 8 Punkt 2 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 10 Punkt 2,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 12 Punkt 3 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 14 Punkt 3,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 16 Punkt 4 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 18 Punkt 4,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 20 Punkt 5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 22 Punkt 5,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 24 Punkt 6 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 26 Punkt 6,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 28 Punkt 7 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 30 Punkt 7,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 32 Punkt 8 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 34 Punkt 8,5 mm<br />
Dies ist Times New Roman - 36 Punkt 9 mm<br />
Times New Roman ist schlechter lesbar als Arial, wie aus dieser<br />
Zusammenstellung ersichtlich ist.<br />
Kursive Schriften vermeiden, insbesondere kursive Serifenschriften! Die<br />
Auflösung heutiger Monitore/Beamer ist dafür zu gering. Pixel sind Quadrate, die<br />
bei kursiver Schrift nicht in Rhomben verwandelt werden.<br />
13/32<br />
13
Kursive Schriften vermeiden, insbesondere kleine, kursive Serifenschriften! Die<br />
Auflösung heutiger Monitore/Beamer ist dafür häufig zu gering. Pixel sind<br />
Quadrate, die bei kursiver Schrift nicht in Rhomben verwandelt werden.<br />
Kursive Schriften sind schwerer lesbar.<br />
Bei hinreichend großen Schriften ist kursiv möglich. Visuell beurteilen!<br />
Heutige Drucker schaffen leicht 600 dpi bzw. sogar 1200 dpi. Das ist ausreichend<br />
auch für kursive Schriften.<br />
Antialiasing (Verschmierung mit Grautönen) nützt einiges (unteres Beispiel).<br />
14/32<br />
14
15/32<br />
Handschrift auf dem Overhead-Projektor:<br />
Schrifthöhe: 7mm<br />
Schriftstärke: 0,7mm<br />
Zeilenabstand: 11mm<br />
Auch Schrift auf Overhead-Folie <strong>soll</strong>te etwa 7mm groß <strong>sein</strong>.<br />
Beschreibt man die Folien vor dem <strong>Vortrag</strong>, kann man sich eine geeignete<br />
Schablone mit Linien unterlegen, um die Schriftgröße einzuhalten.<br />
Die Stiftstärke F (Fein) ist normalerweise etwas zu dünn; kräftiges Aufdrücken<br />
ergibt meist eine ausreichende Schrift.<br />
Die Stiftstärke M ist bei einer Schriftgröße von 7mm zu fett, schlecht lesbar und<br />
deshalb nicht geeignet.<br />
Schreibt man während des <strong>Vortrag</strong>es wohldosiert auf eine Folie (was die<br />
Aufmerksamkeit der Hörer sehr wohl erhöhen kann/Vorteil des OHP), <strong>soll</strong>te man<br />
die Schriftgröße natürlich auch einhalten.<br />
Beim Beamer kann man praktisch nichts dazu schreiben. Mit dem Schreibstift bei<br />
Power-Point kann man maximal Markierungen oder Hervorhebungen<br />
produzieren.<br />
Visualizer sind ein nicht optimaler Ausweg.<br />
15
Die richtige Projektion<br />
Beamer, Overhead-Projektor oder Dia<br />
Bildgröße: a = E/5 (E = Abstand Hörer – Leinwand)<br />
Schriftgröße: h = 2,3%·a (auf A4- Folie = 7 mm<br />
oder 27 Punkte Arial)<br />
Tafel<br />
Schriftgröße: h ≈ 0,5%·E (bei 10m Abstand = 5 cm)<br />
Eine Zwischenzusammenfassung nach einer gewissen Zeit bzw. eine<br />
Zusammenfassung am Ende eines <strong>Vortrag</strong>es ist immer hilfreich für die Hörer.<br />
Besonders bei Mathematikern, aber auch bei Ingenieuren, Informatikern und<br />
Physikern können die Zuhörer/Zuschauer durch langsames und damit<br />
entwickelndes Anschreiben an die Tafel (eventuell auch Folie) viel besser folgen.<br />
Indiskutabel ist die schnelle Projektion vieler mathematischer Gleichungen<br />
mittels Beamer oder OH-Projektor.<br />
16/32<br />
16
Eine ganze Seite mit Text auf einen Schlag unbedingt vermeiden. Ebenso große<br />
Tabellen, die sowieso nicht entzifferbar sind.<br />
Liest man es selbst vor, interferiert die eigene Lesegeschwindigkeit mit der des<br />
Zuhörers -> unangenehmer Effekt.<br />
Gibt man als <strong>Vortrag</strong>ender den Hörern Zeit zum Selberlesen und spricht in der<br />
Zeit nicht, so werden einige den Text schneller lesen, andere langsamer. Die<br />
Lesezeiten für eine Folie mit so einer optimierten Schriftgröße liegen zwischen<br />
20 und 40 Sekunden. Wenn die Schnellleser fertig sind, werden sie sich mit<br />
anderen Dingen beschäftigen und warten, bis die Langsamleser fertig sind. Das<br />
kann zu Störungen führen, wenn sie sich mit Nachbarn unterhalten, mit dem<br />
Kugelschreiber auf den Tisch klopfen oder auch nur auf dem Stuhl hin- und<br />
herrutschen o.ä.<br />
5 x 5 Regel bzw. 7 x 7 Regel: 7 Zeilen Schrift auf einer Seite und 7 Wörter pro<br />
Zeile <strong>soll</strong>ten nicht überschritten werden.<br />
Bei Aufzählungen bietet die Präsentation mit Power-Point die gute Möglichkeit,<br />
die Zeilen nacheinander erscheinen zu lassen. Bei Folien ist das nur mühsamer<br />
mit dem sukzessiven Entfernen von Abdeckungen zu erreichen.<br />
Was man erzählt, muss zum gezeigten Bild/Text passen (synchron/in Phase).<br />
17/32<br />
17
Fakultät für XYZ/Technische Universität München<br />
Der Name des <strong>Vortrag</strong>enden, dessen Institution und auch das Datum des <strong>Vortrag</strong>s<br />
auf jeder Folie engen die zur Verfügung stehende Fläche unnötig ein. Sie sind<br />
auch gar nicht notwendig, da jeder Zuhörer weiß, wo er sich befindet. Ebenso<br />
stört ein Rand, der den sowieso schon vorgegebenen Rand der Folie noch<br />
verstärkt.<br />
Bei manchen Instituten/Unis will allerdings der Chef/Präsident eine gewisse<br />
Form (corporate identity) in allen Institutsvorträgen enthalten sehen. In der<br />
Wirtschaft kann es sogar vorgeschrieben <strong>sein</strong>.<br />
18/32<br />
18
Farben und Folien<br />
Grundsatz: sparsam verwenden<br />
als Signal / Markierung benutzen<br />
Farbe sparsam und behutsam einsetzen. Nach Möglichkeit nicht mehr als 3<br />
verschiedene und zueinander passende Farben<br />
Mit Farben kann man im Extremfall eine ablehnende Haltung bei den Hörern<br />
erreichen.<br />
Farbe unterliegt sehr individuellen Vorlieben; die farbliche<br />
Hintergrundgestaltung bei Power-Point, Overhead-Folien, Dias ist ein Kapitel für<br />
sich.<br />
Besondere Vorsicht vor den Power-Point-Vorlagen mit farbigen<br />
Verlaufshintergründen.<br />
Technisch wichtig ist auch, dass die Farben auf dem Monitor sich deutlich von<br />
denen des Beamers unterscheiden können (z.B. rote oder gelbe<br />
Zwischenfarbtöne). Vorher einmal testen!<br />
19/32<br />
19
Ohmscher Widerstand<br />
Spule<br />
U<br />
U<br />
I<br />
I<br />
R<br />
L<br />
I<br />
U<br />
U ϕ<br />
Dieses Beispiel aus der Physik/Elektrotechnik zeigt den sinnvollen Einsatz von<br />
Farbe; die Farbe hat eine klare Markierungsfunktion: Strom immer rot, Spannung<br />
immer blau.<br />
I<br />
20/32<br />
20
Wer kann hier was erkennen?<br />
Siehe nächste Folie, dort mit Farbe!<br />
21/32<br />
21
Ungefähr 8% der männlichen Bevölkerung in Deutschland sind rot-grün-blind (=<br />
deuteranop). Nur 0,5% der weiblichen Bevölkerung. In der Schweiz angeblich<br />
aufgrund von Inzucht in abgelegenen Alpentälern mehr??<br />
Farbkontrast ist eine sehr wichtige Geschichte. Aufpassen bei solchen<br />
Farbkombination!<br />
Rote und grüne Laserpointer können da ein Problem <strong>sein</strong>. Insbesondere die<br />
schwachen, roten Laserpointer.<br />
Auch Vorsicht beim „Bloßstellen“ von Personen mit Farbenfehlsichtigkeit.<br />
Betroffene wollen das nicht unbedingt öffentlich machen.<br />
22/32<br />
22
Hausanschrift (12 Punkt) Hausanschrift (20 Punkt) Hausanschrift (28 Punkt)<br />
Es ist manchmal lehrreich, auch schlechte Beispiele zu zeigen.<br />
Die Eingangsseite der <strong>TUM</strong> ist ein Beispiel für ein mehrfach missglücktes<br />
Design.<br />
Obwohl für die Lesbarkeit von Schriften auf dem Monitor oder gar bei<br />
gedruckter Schrift etwas andere Verhältnisse gelten: Die Adresszeile hat eine viel<br />
zu kleine Schrift. Auch die Schrift in der Werbung darunter für den Bildungsfond<br />
ist zu klein.<br />
Die Großbuchstaben in der Adresszeile haben eine Größe von etwa 1,5mm (19‘‘-<br />
Bildschirm; 1152x864 Pixel). Die Schrift ist einfach zu klein. Nach ISO 9241/3<br />
<strong>soll</strong> die Zeichenhöhe bei einem Leseabstand von 50cm mindestens 2,8mm<br />
betragen. 12 bis 14 Punkt Schrift ist angemessen.<br />
Der Kontrast Schrift zu Untergrund ist bei den Farbfeldern zu gering. Allerdings<br />
vergrößert sich der Kontrast, wenn man ein Feld mit der Maus online anfährt.<br />
Blaue Schrift auf rotem Untergrund ist wegen der chromatischen Aberration des<br />
Auges besonders ungünstig<br />
Darüber hinaus wird durch die große weiße Fläche viel Platz verschenkt. Aber<br />
das ist offenbar bei Web-Designern gerade modern.<br />
23/32<br />
23
+<br />
+<br />
+<br />
TEXT SATZARTEN<br />
DER LINKSBÜNDIGE FLATTERSATZ<br />
Er entspricht unserer Lesegewohnheit.<br />
Sein Inhalt wird daher schnell erkannt.<br />
Er legt sich grafisch an eine linksseitige<br />
Vertikale.<br />
Diese ist zugleich die Orientierungsvertikale<br />
zur Auffindung des Zeilenanfangs.<br />
Diese und die nächste Folie stammen aus einem Seminar über Foliendesign von<br />
unserem Kollegen Dipl.-Ing. Gunther Partenfelder aus dem Lehrstuhl für<br />
Grundlagen der Gestaltung und Darstellung in der Fakultät für Architektur.<br />
Deswegen ist auch hier ein anderer Hintergrund. Das <strong>soll</strong>te man sonst nicht<br />
unbedingt machen.<br />
Beachte auch die Farbwahl (zueinander passende Farben)<br />
24/32<br />
24
ORDNUNG<br />
entsteht durch INBEZUGSETZUNG mittels<br />
ORDNUNGSHILFEN<br />
1 ACHSE<br />
2 RASTER<br />
3 SYMMETRIE<br />
4 GLEICHARTIGKEIT<br />
5 GLIEDERUNG<br />
1) Senkrechte und waagerechte (Gestaltungs-)Achsen in gleichem Abstand bei<br />
allen Folien können die Orientierung erheblich erleichtern<br />
2) Ein der ganzen Folie zugrunde liegendes Raster ist ebenfalls nützlich.<br />
3) Symmetrische Anordnungen (hier etwa bezüglich der Mitte der Gesamtfolie)<br />
wirken häufig unbewusst ästhetisch<br />
4) Gleichartige Strukturen (Quadrate/Rechtecke, Kreise/Ellipsen usw) für<br />
gleiche/ähnliche Inhalte sind für Verknüpfungen gut<br />
5) Eine Gliederung jeder Folie und über die gesamte Präsentation ist auch<br />
nützlich.<br />
25/32<br />
25
Vorbereitung im <strong>Vortrag</strong>sraum<br />
1) <strong>Vortrag</strong>sraum früh genug vor Beginn inspizieren<br />
2) Beamer mit Notebook testen<br />
3) Tafeln und evtl. Hintergrund reinigen<br />
4) Evtl. Mikrofon testen<br />
Vorbereitung: <strong>Vortrag</strong>sraum ausreichend früh vor dem <strong>Vortrag</strong> inspizieren;<br />
Tafel sauber?; sonstige Technik (z.B. Beleuchtung) ok?; Overhead-Projektor ok?;<br />
bei Power-Point-Präsentation unbedingt ausprobieren, ob das eigene Notebook<br />
mit dem vorhandenen Beamer funktioniert; bei mitgebrachtem, eigenen<br />
Datenträger (CD, Diskette usw.) probieren, ob auf dem vorhandenen Rechner alle<br />
notwendigen Programme/Schriften/Formeleditor usw. vorhanden sind.<br />
Zeigestab vorhanden (zur Sicherheit immer eigenen mitnehmen)<br />
Klären, ob man vorm <strong>Vortrag</strong> von jemand anderem<br />
(Einladenden/Seminardozenten) vorgestellt wird oder ob man das selbst machen<br />
muss. Evtl. muss man die Vorstellung selbst ergänzen.<br />
26/32<br />
26
Das Wichtigste nochmal<br />
Inhaltliche Struktur des <strong>Vortrag</strong>s<br />
– klar und übersichtlich gegliedert <strong>sein</strong>,<br />
– einen interessanten Einstieg bieten,<br />
– inhaltliche Prioritäten setzen/Kernaussagen bearbeiten,<br />
– nach Einleitung, Hauptteil und Schluss strukturiert <strong>sein</strong>,<br />
– Fragen, Probleme und Thesen aufwerfen,<br />
– am Schluss zu einer Diskussion überleiten/anregen.<br />
Formale Struktur<br />
– Nur das Wichtigste als Bild<br />
– Schriftgröße > 20 Punkt<br />
– Nicht mehr als 3 Farben<br />
– 5 x 5 Regel (7 x 7)<br />
Rhetorik üben<br />
Vorbereitung im <strong>Vortrag</strong>sraum<br />
27/32<br />
27
€9,90<br />
24.90 €<br />
Empfehlenswerte Bücher. Solche Hinweise helfen Hörern, die sich weiter<br />
informieren wollen. Aber nicht eine Liste von 15 Büchern oder 20<br />
Veröffentlichungen präsentieren.<br />
Im Internet finden sich auch viele Hinweise.<br />
Der linke Titel reicht für eine gute Vorbereitung aus.<br />
Den rechten Titel kann man Dozenten empfehlen, deren Vorträge/Vorlesungen<br />
verbesserungsbedürftig sind.<br />
28/32<br />
28
in der Carl von Linde- Akademie<br />
www.prolehre.tum.de<br />
Ruhiges Abschlussbild ohne großen Informationsgehalt. Oder Black-Taste oder<br />
Beamer ganz ausschalten.<br />
Auf keinen Fall am Ende die Windowsoberfläche zeigen. Das ist ein unruhiges<br />
Bild, das sehr stark ablenkt.<br />
29/32<br />
29
mail: ucke@tum.de<br />
Christian Ucke homepage: www.ph.tum.de/~cucke<br />
1) Mentor bei ProLehre<br />
2) Leitung Anfängerpraktikum<br />
für Physiker<br />
3) "Grundlagenforschung"<br />
Physik von Spielzeug<br />
Vorstellung<br />
Name: Christian Ucke<br />
Technische Universität München<br />
Fakultät für Physik<br />
Haupttätigkeit: Physikalisches Praktikum für Physiker<br />
Forschung + Hobby: Physik von Spielzeugen<br />
in der Carl von Linde-Akademie<br />
Fakultät für Physik<br />
30
Auflockern/Interaktivität<br />
1) Methoden- und Medienmix<br />
2) Persönliches, Anekdoten, Karrikaturen<br />
3) Zwischenfragen<br />
4) Objekte zeigen/herumreichen<br />
5) Experimente machen<br />
6) Kurze Filme/Videos/Simulationen<br />
7) Forum nutzen (my<strong>TUM</strong>-portal)<br />
Was kann man tun, um einen <strong>Vortrag</strong> aufzulockern oder sogar interaktiv zu<br />
gestalten?<br />
31