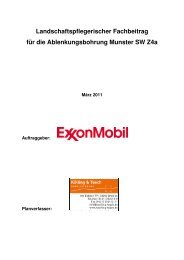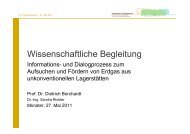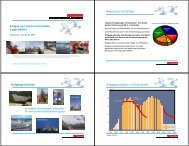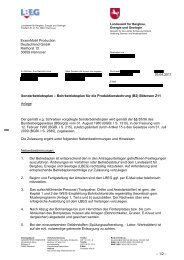Flächeninanspruchnahme, (oberirdische) Infrastruktur, Betrieb
Flächeninanspruchnahme, (oberirdische) Infrastruktur, Betrieb
Flächeninanspruchnahme, (oberirdische) Infrastruktur, Betrieb
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Informations- und Dialogprozess zum Aufsuchen und Fördern<br />
von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten<br />
(InfoDialog Fracking)<br />
Fachbeitrag zum Themenkreis Landschaft<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong>, (<strong>oberirdische</strong>) <strong>Infrastruktur</strong>, <strong>Betrieb</strong><br />
Bearbeitung<br />
Dipl.-Ing. Helmut Schneble<br />
M.Eng. Landschaftsarchitektur Katja Weinem<br />
Dipl.-Geograph Ingo Niethammer<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH<br />
April 2012
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Veranlassung und Aufgabenstellung ..................................................................................................6<br />
2 Grundlagen - Aufsuchen und Fördern von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten ...................9<br />
2.1 Unkonventionelle Lagerstätten und Explorationsgebiete ............................................................9<br />
2.2 Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten - Grundlagen......................................13<br />
2.2.1 Exploration und Feldesentwicklung ....................................................................................13<br />
2.2.2 Regelbetrieb - Erdgasförderung .........................................................................................16<br />
3 Methodischer Ansatz – Analyse der Wirkungszusammenhänge / Wirkungskettenanalyse .............16<br />
4 Projektwirkungen...............................................................................................................................18<br />
4.1 Exploration – Erkundungsbohrung und Feldesentwicklung – Bohrphase inkl. Fracking .........19<br />
4.1.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>...................................................................................................19<br />
4.1.2 Errichtung von Anlagenteilen / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen – mit Bohranlage .....................20<br />
4.1.3 Verkehrsaufkommen...........................................................................................................20<br />
4.1.4 Lärm ....................................................................................................................................21<br />
4.1.5 Licht.....................................................................................................................................22<br />
4.1.6 Visuelle Wirkungen (Bewegungen, Blendwirkung etc.) ......................................................22<br />
4.1.7 Erschütterungen..................................................................................................................22<br />
4.1.8 Luftschadstoffe / Gerüche...................................................................................................23<br />
4.1.9 Ableitung/Entsorgung von Oberflächenwasser...................................................................23<br />
4.1.10 Wasserbedarf und Entsorgung des “back-flow“ beim Fracking ...................................23<br />
4.1.11 Weiterer Untersuchungsbedarf bzw. Kenntnisdefizite .................................................24<br />
4.2 Regelbetrieb – Erdgasförderung / Bohrplatz .............................................................................25<br />
4.2.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>...................................................................................................25<br />
4.2.2 Anlagenteile / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen ............................................................................25<br />
4.2.3 Verkehrsaufkommen...........................................................................................................25<br />
4.2.4 Emissionen und visuelle Wirkungen ...................................................................................26<br />
4.2.5 Ableitung/Entsorgung von Oberflächenwasser...................................................................26<br />
4.3 Regelbetrieb – Erdgasförderung / Zentrale <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen .....................................27<br />
4.4 Zusammenfassung der zu erwartenden Verkehre ....................................................................28<br />
5 Beschreibung der Wirkungsbeziehungen und möglichen Konfliktpotenziale auf<br />
landschaftsgebundene Schutzgüter..................................................................................................30<br />
5.1 Schutzgut Landschaft – landschaftsgebundene Erholung ........................................................30<br />
5.1.1 Grundlagen / Aspekte Landschaft – Landschaftsbild .........................................................30<br />
5.1.2 Wirkräume...........................................................................................................................31<br />
5.1.3 Beziehungen Vorhaben - Landschaft .................................................................................31<br />
5.1.4 Wirkfaktoren/Wirkungsbeziehungen und Konfliktpotenziale...............................................32<br />
5.1.4.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>....................................................................................... 32<br />
5.1.4.2 Veränderung des Erscheinungsbildes .................................................................... 33<br />
5.1.4.3 Fahrbewegungen .................................................................................................... 37<br />
5.1.4.4 Lärm ........................................................................................................................ 37<br />
5.1.4.5 Licht......................................................................................................................... 38<br />
5.1.5 Zusammenfassung / Bewertungsmaßstäbe .......................................................................39<br />
5.2 Mensch inkl. siedlungsnaher Erholung......................................................................................40<br />
5.2.1 Aspekte ...............................................................................................................................40<br />
5.2.2 Wirkfaktoren/Wirkungsbeziehungen und Konfliktpotenziale...............................................40<br />
5.2.2.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>....................................................................................... 40<br />
5.2.2.2 Visuelle Störwirkungen............................................................................................ 41<br />
5.2.2.3 Lärm ........................................................................................................................ 42<br />
5.2.2.4 Erschütterungen...................................................................................................... 42<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 2 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.2.2.5 Licht......................................................................................................................... 43<br />
5.2.2.6 Luftschadstoffe/Gerüche......................................................................................... 43<br />
5.2.3 Hinweise zur Bewertung .....................................................................................................44<br />
5.3 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt...............................................................................45<br />
5.3.1 Aspekte - Funktionen ..........................................................................................................45<br />
5.3.2 Schutzgebietsausweisungen/Biotopverbund......................................................................45<br />
5.3.3 Wirkfaktoren/Wirkungsbeziehungen und Konfliktpotenziale...............................................46<br />
5.3.3.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>....................................................................................... 46<br />
5.3.3.2 Beeinträchtigungen durch Leitungen ...................................................................... 48<br />
5.3.3.3 Störwirkungen durch <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten – visuelle Störungen/Fahrbewegungen . 48<br />
5.3.3.4 Lärm ........................................................................................................................ 48<br />
5.3.3.5 Licht......................................................................................................................... 49<br />
5.3.3.6 Erschütterungen...................................................................................................... 49<br />
5.3.4 Hinweise zur Bewertung .....................................................................................................51<br />
5.4 Boden ........................................................................................................................................51<br />
5.4.1 Aspekte und Funktionen .....................................................................................................51<br />
5.4.2 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> (Versiegelung) ..........................................................................52<br />
5.4.3 Hinweise zur Bewertung .....................................................................................................53<br />
5.5 Wasser.......................................................................................................................................53<br />
5.6 Klima/Luft...................................................................................................................................53<br />
5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter .................................................................................................54<br />
5.7.1 Aspekte ...............................................................................................................................54<br />
5.7.2 Wirkungsbeziehungen ........................................................................................................54<br />
5.8 Freiraum- und Agrarbereiche – Land-/Forstwirtschaft...............................................................54<br />
5.8.1 Landwirtschaft.....................................................................................................................54<br />
5.8.2 Forstwirtschaft.....................................................................................................................55<br />
5.8.3 Jagdnutzung........................................................................................................................55<br />
6 Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase....................................................................................................................56<br />
7 Maßnahmen zur Konfliktminderung, -vermeidung und Kompensation.............................................57<br />
7.1 Standortauswahl ........................................................................................................................57<br />
7.2 Standortbezogene Maßnahmen - Einzelbohrplatz ....................................................................58<br />
7.3 Grünordnungskonzept/Kompensation (am Beispiel NRW/Münsterland) ..................................60<br />
8 Raumanalyse.....................................................................................................................................63<br />
8.1 Betrachtung in der Fläche (Explorationsgebiete) ......................................................................63<br />
8.1.1 Aufgaben- und Problemstellung, Methodik.........................................................................63<br />
8.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen........................................................................................64<br />
8.1.3 Vorläufige und derzeitige Explorationsgebiete ExxonMobil................................................64<br />
8.1.4 Flächenbedarf, Ausbaukonzeption .....................................................................................67<br />
8.1.4.1 Modellansatz und Gesamtflächenbedarf ................................................................ 67<br />
8.1.4.2 Schematisches Muster einer Verteilung von Bohrplätzen / Gewinnungs-<br />
anlagen in einem Explorationsgebiet...................................................................... 69<br />
8.1.5 Explorationsgebiete in Nordrhein-Westfalen ......................................................................70<br />
8.1.5.1 Kriterien................................................................................................................... 70<br />
8.1.5.2 Beschreibung / Analyse der Teil-Explorationsfläche 3 in NRW.............................. 73<br />
8.1.6 Explorationsgebiete in Niedersachsen ...............................................................................75<br />
8.1.6.1 Kriterien................................................................................................................... 75<br />
8.1.6.2 Beschreibung / Analyse der Teil-Explorationsfläche 4 in Niedersachsen .............. 78<br />
9 Schlussfolgerungen...........................................................................................................................80<br />
10 Quellen ..............................................................................................................................................85<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 3 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Bearbeitung des Fachbeitrages zum Themenkreis Landschaft<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH<br />
Havelstraße 7A<br />
64295 Darmstadt<br />
Telefon: 06151 9758-0<br />
Fax: 06151 9758-30<br />
E-mail: mail@umweltplanung-gmbh.de<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 4 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Anlagen<br />
Anlage (1) Grundlagenkarte der Explorationsgebiete – ExxonMobil;<br />
unmaßstäblich verkleinert (A3-Format)<br />
(Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH; 25.08.2011; Index d vom 23.02.12, M. 1:200.000)<br />
Anlage (2) Übersichtskarte der Explorationsgebiete – ExxonMobil; M. 1:200.000<br />
(Kartengrundlage: TK 200)<br />
Anlage (3) Einzelkarten der derzeitigen Explorationsgebiete NRW und Niedersachsen<br />
(Kartengrundlagen: Regionalplan Münsterland (Entwurf 2010) und Regionale Raumordnungsprogramme<br />
Diepholz, Emsland, Cloppenburg, Osnabrück, Vechta)<br />
(3.1) Teilgebiet 1 - Steinfurt<br />
(3.2.1) Teilgebiet 2 – Stadtlohn/Borken Süd/Süd<br />
(3.2.2) Teilgebiet 2 – Stadtlohn/Borken Süd/Nord<br />
(3.3) Teilgebiet 3 - Münsterland<br />
(3.4) Teilgebiet 4 - östlich von Lingen<br />
(3.5) Teilgebiet 5 - Quakenbrück<br />
(3.6) Teilgebiet 6 - südlich von Diepholz<br />
(3.7) Teilgebiet 7 - südlich von Osnabrück<br />
Legende Regionalplan Münsterland (betrifft Teilgebiete 1-3)<br />
Legende Regionales Raumordnungsprogramm Emsland (Teilgebiet 4)<br />
Anlage (4) 3D-Visualisierung Bohrplatz – Bitmanagement Software GmbH, Februar 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 5 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
1 Veranlassung und Aufgabenstellung<br />
Seit 2008 führt ExxonMobil Produktion Deutschland GmbH (nachfolgend ExxonMobil) in einigen Gebieten<br />
Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens ein neues Aufsuchungsprojekt durch. Es soll geklärt<br />
werden, ob die vermuteten Vorkommen von Erdgas aus neuen Lagerstätten (sogenannte unkonventionelle<br />
Lagerstätten) förderwürdig sind. An geeigneten Stellen soll - falls nötig - das im Gestein eingeschlossene<br />
Erdgas durch die Fracking-Technik freigesetzt und dann gefördert werden.<br />
Derzeitiger Stand: Die Fa. ExxonMobil hat im Jahre 2008 die Probebohrung „Oppenwehe 1“ abgeteuft<br />
mit dem Ziel, etwaige Gasvorkommen in einem Tonsteinhorizont (shale gas) zu gewinnen. Tests zur<br />
Bestimmung der Lagerstättenparameter wurden durchgeführt. Weitere Probebohrungen sind nach<br />
einem Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 1 im Bereich Nordwalde („Nordwalde 1“) auf die<br />
Erkundung von Kohleflözgas (CBM) und in den Bereichen Borken („Borkenwirthe Z1“) und Drensteinfurt<br />
(„Drennsteinfurt Z1“) geplant. Mit Schreiben vom 19.12.2011 hat die Fa. ExxonMobil einen neuen<br />
Hauptbetriebsplan für die Erkundungsbohrung „Nordwalde Z1“ - ohne fracs - bei der Bezirksregierung<br />
Arnsberg zur Genehmigung vorgelegt. 2<br />
Da sich in der öffentlichen Diskussion viele Bedenken und Fragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern,<br />
von Politikern und Wasserversorgern zeigen, hat sich ExxonMobil entschieden, diese von unabhängigen<br />
Wissenschaftlern im Rahmen eines breit angelegten Informations- und Dialogprozesses aufklären<br />
zu lassen (www.dialog-erdgasundfrac.de).<br />
In diesem Rahmen sind u.a. Fragestellungen zu den Themenbereichen Verkehr, Transport, Flächenverbrauch,<br />
Lärm aufgeworfen worden, die es zu beantworten gilt (siehe nachfolgende Tabelle).<br />
Das Büro Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH (UBS) wurde vom Dialog-Forum beauftragt, diesen<br />
Themen- und Fragenkomplex zu bearbeiten. Das grundsätzliche Untersuchungsprogramm wurde<br />
vom Büro UBS am 11.11.2011 bei einer Sitzung des Dialog-Forums vorgestellt.<br />
Am 06. und 07. März 2012 hat UBS an der Wissenschaftlichen Statuskonferenz des Neutralen Expertenkreises<br />
(„Die Fracking-Technologie zur Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten<br />
– Kriterien für Sicherheit und Umweltverträglichkeit“) in Berlin teilgenommen und die Zwischenergebnisse<br />
der Untersuchung vorgestellt. Die Anregungen und Kritikpunkte, welche am 07. März während des<br />
Arbeitskreises „Landschaftsbild und Flächenverbrauch“ diskutiert wurden, wurden - soweit sie das Themenfeld<br />
„Landschaft“ betrafen - bei der Endfertigstellung des Fachbeitrages berücksichtigt.<br />
Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Recherchen und Untersuchungen zum Themenkomplex<br />
Landschaft, <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>, (<strong>oberirdische</strong>) <strong>Infrastruktur</strong> und <strong>Betrieb</strong> vor.<br />
In Kapitel 2 Grundlagen sind die Rahmenbedingungen für das Aufsuchen und Fördern von Erdgas aus<br />
unkonventionellen Lagerstätten beschrieben.<br />
Nach einer methodischen Einführung zur Vorgehensweise (Kapitel 3) sind in Kapitel 4 ausführlich die<br />
Projektwirkungen beschrieben, die mit dem gesamten Prozess des Aufsuchens bis zum Regelbetrieb<br />
der Erdgasförderung verbunden sind – soweit diese im weitestgehenden Sinn den Themenkomplex<br />
Landschaft betreffen. In diesem Kapitel sind alle relevanten Fakten / Daten im Zusammenhang mit den<br />
<strong>oberirdische</strong>n Tätigkeiten bei der Exploration/Erkundung, der Bohrung und dem Fracking sowie dem<br />
Endausbauzustand (Produktion/Gasförderung/Aufbereitung, Druckerhöhung und Transport) beschrie-<br />
1 Bericht der Landesregierung zum Thema „Chancen und Risiken bei Probebohrungen und Gewinnung von unkonventionellem<br />
Erdgas unter besonderer Berücksichtigung von Wasser-, Natur-, Boden- und Klimaschutz“, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,<br />
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW, 11. Februar 2011.<br />
Zu den erteilten Aufsuchungserlaubnissen im Regierungsbezirk Arnsberg: siehe Vortrag „Aufsuchen von Erdgas aus unkonventionellen<br />
Lagerstätten“, Dialog mit Bürgerinitiativen und Naturschutzverbänden, Bezirksregierung Arnsberg, Dortmund 26.9.2011<br />
2 Bezirksregierung Arnsberg; http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/index.php; 17.02.12<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 6 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
ben. Grundlage sind insbesondere auch Angaben von ExxonMobil zu den einzelnen Phasen der Erkundung<br />
und Errichtung von Bohr- und Gewinnungsplätzen.<br />
In Kapitel 5 sind die möglichen Wirkungsbeziehungen und möglichen Konfliktpotenziale auf die<br />
landschaftsgebundenen Schutzgüter beschrieben. Es handelt sich insofern um mögliche Wirkungsbeziehungen<br />
/ mögliche Konfliktpotenziale, da derzeit keine konkreten Bohrplatz-Standorte vorliegen oder<br />
bekannt sind bzw. der Ansatz eines konkreten Standortes auch aufgrund der Vielzahl von möglichen<br />
Standortqualitäten und -ausprägungen nicht zielführend wäre.<br />
Das Kapitel 6 befasst sich mit dem Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase (Rückbau der Bohr-/Gewinnungsplätze)<br />
und es werden Hinweise zur Konfliktminderung, -vermeidung und Kompensation (Kapitel 7) gegeben.<br />
In Kapitel 8 werden die derzeitigen Explorationsgebiete von ExxonMobil beschrieben und der Gesamtflächenbedarf<br />
für die Ausbaukonzeption (modellhafter Ansatz) wird abgeschätzt. Die raumrelevanten<br />
Kriterien, die bei einer Auswahl/Festlegung von Bohr- und Gewinnungsplätzen insbesondere zu beachten<br />
wären, werden beschrieben und diskutiert sowie auf zwei beispielhafte Explorationsgebiete (NRW,<br />
Niedersachsen) untersucht. Auf dieser Grundlage wird ein Ausblick auf mögliche weitere Untersuchungen,<br />
die Vorgehensweise und anzuwendende Kriterien bei einer flächenhaften Festlegung von Bohr-<br />
und Gewinnungsplätzen gewagt.<br />
Zur Veranschaulichung des Erscheinungsbildes eines Bohrplatzes und als Grundlage für die Beschreibung<br />
möglicher Auswirkungen auf den Landschaftsraum wurde eine 3D-Visualisierung eines Bohrplatzes<br />
für die Bohrphase und den Regelbetrieb erstellt (Bitmanagement Software GmbH, s. Anlage 4).<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 7 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Die im Rahmen des Dialog-Verfahrens angesprochenen Fragestellungen sind nachfolgende aufgeführt<br />
3 . (mit * gekennzeichnete Fragen: nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung)<br />
Themenkomplex Landschaft Verkehr/Transport/Flächenverbrauch/Lärm<br />
Mit welchem Schwerlastverkehr ist zu rechnen?<br />
Wie viel Schwerlasttransporte sind pro Bohrplatz bei der Einrichtung, der Durchführung der Bohrung, beim Fracking zu<br />
erwarten?<br />
Wie werden die geförderten Gase transportiert?<br />
Wie erfolgt der Emissionsschutz (z.B. Lärm)?<br />
Wie groß ist die Lärmbelastung beim Bohren und beim Fracking?<br />
Welchen Belastungen unterliegen Straßen und Wirtschaftswege? Gibt es vorab eine Bestandsaufnahme?<br />
Wie wird die Zuwegung geregelt?<br />
Kann man Transportwege frühzeitig darstellen (schon beim Genehmigungsverfahren)?<br />
Von welchem Konzern bzw. von welcher Firma bezieht Exxon die chemischen Stoffe und wie viele Kilometer beträgt<br />
der Anfahrtsweg? *<br />
Flächenverbrauch und Nutzungskonflikte<br />
Welche konkreten Auswirkungen sind für die Flächennutzer der Forst- und Landwirtschaft zu erwarten? Sehen Sie hier<br />
Risiken für die zukünftige Entwicklung?<br />
Wird bei jeder Bohrung ein Standrohr gesetzt?<br />
Ist mit einer Vielzahl von Förderbohrungen pro Probebohrung zu rechnen?<br />
Wie hoch wären der Flächenverbrauch und die Versiegelung von Fläche im Fall einer kommerziellen Gewinnung?<br />
Anzahl der Bohrtürme? Wird nach der Förderung alles komplett zurückgebaut?<br />
Wie viele Bohrungen sind im Vergleich zur konventionellen Erdgasförderung zur Erkundung und Ausbeutung einer Lagerstätte<br />
notwendig?<br />
Wie lange bleibt das Bohrgerüst am Bohrplatz? Wie lange bleibt der Bohrplatz insgesamt eingerichtet? Wie viel Fläche<br />
verbraucht der Bohrplatz?<br />
Wie lange wird eine Bohrung voraussichtlich Erträge abwerfen? Wann ist mit einem vollständigen Rückbau einer Bohranlage<br />
zu rechnen?<br />
Sind die Investitionen für die Probebohrung (ca. 1,8 Mio. €) nicht erst dann wirtschaftlich, wenn hinterher eine Vielzahl<br />
von Förderbohrungen errichtet wird? *<br />
Wie groß ist der Abstand zwischen den einzelnen Bohrplätzen?<br />
Wer bezahlt die <strong>Infrastruktur</strong> (Zuwegung schwerlastverkehrtauglich, Wasser- und Stromversorgung etc.)?*<br />
Gibt es eine Beteiligung an den Unterhaltungskosten der zur Verfügung gestellten <strong>Infrastruktur</strong> (Verkehrswege)? *<br />
3 https://expertenkreis.dialog-erdgasundfrac.de/expertenkreis/node/58<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 8 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
2 Grundlagen - Aufsuchen und Fördern von Erdgas aus unkonventionellen<br />
Lagerstätten<br />
2.1 Unkonventionelle Lagerstätten und Explorationsgebiete<br />
Unkonventionelle Lagerstätten sind Lagerstätten, aus denen das Erdgas nicht ohne weitere technische<br />
Maßnahmen in förderungswürdiger Menge gewonnen werden kann.<br />
Unter unkonventioneller Erdgasgewinnung versteht man das Bohren in gasführende Steinschichten und<br />
das Verfügbarmachen des in dem Stein eingeschlossenen Erdgases mittels dem Fracking-Verfahren.<br />
Zu den unkonventionellen Vorkommen zählen Kohleflözgas („coal bed methane“-CBM), Gas in dichten<br />
Gesteinsformationen, wie z.B. in Schiefergestein („shale gas“) oder in dichten Sand- oder Kalksteinhorizonten<br />
(„tight gas“). Shale gas und tight gas werden auch unter der Bezeichnung LSB (lower saxony<br />
basins) zusammengefasst. 4<br />
Die Tiefe der Bohrung hängt von der Lage der gasführenden Schichten ab. Je nach Tiefe der Schichten<br />
variiert die Bohrzeit. In Abhängigkeit der geologischen, untertägigen und obertägigen Verhältnisse werden<br />
die Bohrungen oberirdisch zu Gruppen zusammen gefasst (Clusterplatz) oder als Einzelbohrungen<br />
im Explorationsgebiet verteilt. Im Regelfall wird der Ausbau zum Clusterplatz - auch aus Gründen der<br />
Rentabilität (z.B. zentrale Bündelung von Versorgungs-/<strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen) - angestrebt. Zudem<br />
ergibt sich die vergleichsweise geringste <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> bezogen auf das Gesamt-<br />
Explorationsgebiet.<br />
Die Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten kann - im Hinblick auf den hier zu betrachtenden<br />
Themenkreis - in folgende zwei Phasen unterteilt werden, die nachfolgend in Kapitel 2.2 beschrieben<br />
werden:<br />
�� Exploration – Erkundungsbohrung und Feldesentwicklung – Bohrphase inkl. Fracking<br />
�� Regelbetrieb – Erdgasförderung<br />
Nach Abschluss des Regelbetriebs wird der Bohrplatz zurückgebaut.<br />
Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen (ohne Grubengas) – Sachstand / Gebiete<br />
NRW 5<br />
In Nordrhein-Westfalen hat die Bezirksregierung Arnsberg bisher 21 Erlaubnisse zu gewerblichen Zwecken<br />
zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten erteilt, weitere 9<br />
derartige Anträge liegen vor (s. nachfolgende Abbildung und Tabellen).<br />
Die Fläche der erteilten Bergbauberechtigungen zur Aufsuchung (21 Erlaubnisse) umfasst ca. 52,7%<br />
der Fläche von NRW.<br />
Gewinnungsberechtigungen auf Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten sind in Nordrhein-<br />
Westfalen weder beantragt noch erteilt.<br />
Mit Datum vom 18.11.2011 liegt ein NRW-Erlass zur Vorgehensweise bzgl. der Erteilung von Genehmigungen<br />
für Bohrungen vor 6 .<br />
4<br />
http://www.europaunkonventionelleserdgas.de 2011<br />
5<br />
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN, 5. Sitzung des<br />
Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie am 12.01.2011<br />
6<br />
MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN-<br />
WESTFALEN / MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN, UND VERKEHR DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN -<br />
Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Genehmigungsfähigkeit von Bohrungen unterschiedlichster Art, Erlass vom 18. November,<br />
2011; http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/2011_11_23_erlass.pdf<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 9 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
7<br />
8<br />
7 http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/aufsuchungsfelder_karte.pdf<br />
8 http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/aufsuchungsfelder_erteilt.pdf<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 10 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
9<br />
Niedersachsen 10<br />
In Niedersachsen liegen mit Stand: 21.02.2012 folgende Bergbauberechtigungen für Kohlenwasserstoffe<br />
vor:<br />
�� 175 Bewilligungen<br />
�� 37 Erlaubnisse<br />
�� 5 Bergwerkseigentume<br />
9 http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/aufsuchungsfelder_beantragt.pdf<br />
10<br />
Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Referat Energiewirtschaft Erdöl und Erdgas, Bergbauberechtigungen;<br />
E-mail vom 21.02.2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 11 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Vorläufige und derzeitige Explorationsgebiete der Fa. ExxonMobil – Untersuchungsraum 1)<br />
Die Explorationsgebiete der Fa. ExxonMobil liegen im südwestlichen Teil von Niedersachsen bzw. im<br />
nordwestlichen Teil von Nordrhein-Westfalen.<br />
Die vorläufigen Explorationsgebiete (ungefähre Darstellungen der Lagerstätten) - je ein Gebiet für tight<br />
gas, shale gas und „coal bed methane“-CBM - erstrecken sich in dem Raum nördlich von Dorsten und<br />
Hamm (Nordrhein-Westfalen) bis südlich von Oldenburg (Niedersachsen) (s. Anhang 1 und 2).<br />
Von ExxonMobil wurden insgesamt 7 Untersuchungsgebiete (= derzeitige Explorationsgebiete: Rechteckflächen,<br />
3 Explorationsgebiete im shale gas und 4 Explorationsgebiete im CBM) gekennzeichnet<br />
(Ing.-Büro Heitfeld/Schetelig GmbH; 25.08.2011) (s. Anhang 1 und 2), die die Schwerpunkte der möglichen<br />
Bohrvorhaben/Explorationen darstellen.<br />
Die Lage der derzeitigen Explorationsgebiete ist in der nachfolgenden Übersichtskarte schematisch<br />
dargestellt. Nähere Angaben zu diesen Explorationsgebieten (Größe, Landkreise, Gebietsbeschreibungen<br />
ausgewählter Gebiete: s. Kapitel 8).<br />
Abbildung 1-1: Lage der derzeitigen Explorationsgebiete Fa. ExxonMobil im Raum -<br />
Übersicht/schematisch<br />
(im Weiteren: s. Auszug TK 200 mit konkreter Abgrenzung der vorläufigen und derzeitigen<br />
Explorationsgebiete, Anhang 2)<br />
Kartengrundlage: NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK (www.nls.niedersachsen.de)<br />
1) Grundlage: Derzeitige Explorationsgebiete (Untersuchungsgebiete) gemäß Karte<br />
Ing.-Büro Heitfeld/Schetelig GmbH 25.08.2011<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 12 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
2.2 Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten - Grundlagen<br />
2.2.1 Exploration und Feldesentwicklung<br />
Ablauf Bohrplatzbau bis Regelbetrieb [1]<br />
11 ExxonMobil 2012<br />
Errichtung Bohrplatz 11<br />
Zunächst wird der Bohrplatz auf einer Flächengröße von<br />
ca. 7.000 - 10.000 m² zur Gewährleistung der Befahrbarkeit<br />
sowie aus Gründen des Grundwasser- und Immissionsschutzes<br />
in Straßenbauweise hergestellt. Zusätzlich<br />
werden ca. 1.000 - 2.000 m² als Lagerflächen insbesondere<br />
für Oberboden und die Zuwegung beansprucht.<br />
Erforderliche Versorgungseinrichtungen, wie Strom- und<br />
Wasserversorgung, werden hergestellt und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
wie Büro- und Sozialcontainer, Material-<br />
Container werden aufgestellt. Vorzugsweise wird an bestehende<br />
<strong>Infrastruktur</strong> angeknüpft, wie z.B. Wegestrukturen,<br />
Wasser- und Stromanschluss.<br />
Der Bohrplatz ist in einen inneren und einen äußeren Bereich<br />
aufgeteilt. Innerhalb des inneren Bereiches wird die<br />
Bohrung (mit Handling wassergefährdender Stoffe) durchgeführt.<br />
Für die Entwässerung der Anlage werden zwei Abwasserbecken<br />
errichtet, sodass der innere und der äußere Bereich<br />
separat entwässert werden können. Das gefasste<br />
Oberflächenwasser des inneren Bereiches wird zur externen<br />
Entsorgung abgefahren. Das Oberflächenwasser des<br />
äußeren Bereiches wird nach Beprobung mit Tankkraftwagen<br />
(TKW) zur Kläranlage abgefahren oder ggf. einer<br />
sonstigen externen Entsorgung zugeführt.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 13 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Bohrung; vereinfachte schematische Darstellung [2]<br />
Vorbereitung für das Fracking; vereinfachte schematische<br />
Darstellung [3]<br />
12 ExxonMobil 2012<br />
13 ExxonMobil 2012<br />
Exploration (Erkundungsbohrung) 12<br />
Bei der Exploration der Lagerstätte wird eine Erkundungsbohrung<br />
abgeteuft. Die tiefe Bohrung wird vertikal niedergebracht<br />
und kann im Lagerstättenhorizont erforderlichenfalls<br />
auch horizontal vorangetrieben werden. Die Dauer der<br />
Bohraktivitäten kann mit ca. 6-10 Wochen (24 h/d, 7 Tage/Woche)<br />
abgeschätzt werden.<br />
Ziel dieser Bohrung ist es, Erkenntnisse über die Lagerstättenparameter<br />
und letztlich die Förderungswürdigkeit<br />
von Erdgasvorkommen zu erhalten.<br />
Nach der Durchführung der Bohrung wird die Bohranlage<br />
im Regelfall zunächst wieder abgebaut. Die Lagerstättenparameter<br />
werden ausgewertet. Ergeben sich keine Hinweise<br />
auf eine Förderwürdigkeit wird der Bohrplatz rückgebaut<br />
und die Standortfläche wird rekultiviert. Wird eine<br />
Förderungswürdigkeit nachgewiesen, wird das Ziel verfolgt,<br />
den Bohrplatz - nach Einholung der erforderlichen<br />
Genehmigungen/Bewilligungen – im Rahmen der Feldesentwicklung<br />
zu einem Cluster-Bohrplatz auszubauen.<br />
Feldesentwicklung – Bohrphase inkl. Fracking 13<br />
Ein Cluster-Platz wird im Regelfall durch Ausbau/Erweiterung<br />
des Explorations-Bohrplatzes hergerichtet.<br />
Bei einem Cluster-Platz werden hierzu mehrere Bohrungen<br />
nacheinander vertikal abgeteuft (6 bis 20 Bohrungen;<br />
Einsatz einer Bohranlage/Bohrturm auf dem Cluster-<br />
Platz), mit horizontaler Ablenkung im Untergrund. Der<br />
Zeitaufwand für die Bohraktivitäten kann je Bohrung mit ca.<br />
3 Wochen (24 h/d, 7 Tage/Woche), also je Clusterplatz mit<br />
bis zu rd. 14 Monaten (bei 20 Bohrungen) abgeschätzt<br />
werden.<br />
Die Erdgasgewinnung über Einzelbohrungen (jeweils<br />
Bohrplatz mit erforderlichen infrastrukturellen Einrichtungen,<br />
s. Kapitel 2.2.2.1) kommt aufgrund des höheren Aufwandes<br />
und des – bezogen auf das Explorationsgebiet –<br />
höheren Flächenbedarfs nach den Zielen von ExxonMobil<br />
eine nachrangige Bedeutung zu (wird nachfolgend nicht<br />
weiter betrachtet).<br />
Nachdem die Bohrphase sich in einem fortgeschrittenen<br />
Stadium befindet, wird das für das Fracking benötigte<br />
Equipment (Tanks, Silos, Hydraulikaggregate, Sand etc.)<br />
angeliefert.<br />
Unter dem Fracking-Vorgang versteht man das hydraulische<br />
Einbringen von Frac-Flüssigkeit (bestehend aus<br />
Wasser, mit Zugabe von Quarzsand und Additiven) in das<br />
Bohrloch, um im Gestein eingeschlossene Erdgasvorkommen<br />
verfügbar zu machen. Es kann davon ausgegangen<br />
werden, dass im shale gas alle Bohrungen gefrackt<br />
werden müssen (je Bohrung jeweils 10 große fracs mit<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 14 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Fracking-Prozess; vereinfachte schematische<br />
Darstellung [4]<br />
Einsatz von ca. 1.600 m³ Fracking-Flüssigkeit); im CBM<br />
(Coal bed methan) etwa 50 % der Bohrungen (dann je<br />
Bohrung jeweils 3 kleine fracs mit Einsatz von ca. 150 m³<br />
Fracking-Flüssigkeit).<br />
Shale gas – große fracs<br />
Das Fracking erfolgt nacheinander für die einzelnen Bohrlöcher<br />
und beginnt nachdem sich die Bohrphase in einem<br />
fortgeschrittenen Stadium befindet (z.B. nachdem etwa 3/4<br />
der Bohrungen niedergebracht sind). Die Dauer der Fracking-Vorgänge<br />
je Bohrloch kann mit ca. 4-5 Tagen abgeschätzt<br />
werden, wobei der eigentliche/einzelne Fracking-<br />
Vorgang jeweils nur ca. 3 h (Pumpvorgang) dauert. Daraus<br />
ergibt sich ein Zeitraum je Clusterplatz für die Durchführung<br />
des Frackings von ca. 60 – 70 Tagen (bei 14 Bohrlöchern)<br />
bis zu etwa 80-100 Tagen (bei 20 Bohrlöchern).<br />
Das Fracking (Pumpvorgänge) wird ausschließlich werktags<br />
durchgeführt. Die Frac-Flüssigkeit „back-flow“<br />
(oder flow-back) wird am Bohrplatz bei den einzelnen fracs<br />
überwiegend wiederverwendet (zu etwa 80-90%) 1415 .<br />
Der nach mehrmaliger Wiederverwertung verbleibende<br />
back-flow stellt nur noch einen Restteil der ursprünglichen<br />
Einsatzmenge dar und wird mit TKW abgefahren (näheres<br />
hierzu siehe Kapitel 4.4).<br />
Im Falle einer großflächigen Verteilung von Bohrplätzen im<br />
Raum (näheres siehe Kapitel 8) wird angestrebt, den<br />
Restteil des back-flow nach der Wiederverwendung leitungsgebunden<br />
von den einzelnen Bohrplätzen aus einer<br />
zentralen Aufbereitungseinheit zuzuführen. 16<br />
Coal bed methan-CBM – kleine fracs<br />
Bei CBM können die fracs je Bohrloch an einem Tag<br />
durchgeführt werden. Die Phasen des „back-flow“ können<br />
mit zusätzlich ca. 2-4 Wochen (bei 12 bis 20 Bohrungen)<br />
abgeschätzt werden.<br />
Etwa 20-60% 17 der Fracking-Flüssigkeit fallen als sogenannter<br />
„back-flow“ (oder flow-back) an und werden nach<br />
Abschluss des Frackings zu zentralen Aufbereitungsanlagen<br />
abgefahren. Die aufbereitete wässrige Fraktion wird<br />
dann an externen Stationen in den Untergrund verpresst.<br />
Die Phasen der Exploration (Erkundungsbohrung) und der<br />
Feldesentwicklung umfassen insgesamt einem Zeitraum<br />
von bis zu rd. 2 Jahren (ohne Auswertung der Bohrungen<br />
und ohne Einholung von Genehmigungen/Bewilligungen).<br />
14<br />
ExxonMobil 2012; E-mail vom 09.02.2012<br />
15<br />
ExxonMobil, Email vom 29.03.2012<br />
16<br />
ExxonMobil, Email vom 29.03.2012<br />
17<br />
UBA: 20-80%; Literatur/Fachgespräche: 23% (Universität Hannover, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik,<br />
E-mail vom 30.01.2012)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 15 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
2.2.2 Regelbetrieb - Erdgasförderung 18<br />
Gasförderung; vereinfachte schematische<br />
Darstellung [5]<br />
Nachdem die Phase des Frackings abgeschlossen ist, wird<br />
die Anlage zum Regelbetrieb / Förderbetrieb um-/rückgebaut.<br />
Der Um-/Rückbau inkl. Installation der Wasserabscheideanlage<br />
(Free-Water-Knockout – FWKO; Abtrennung<br />
Lagerstättenwasser vom (wassergesättigten) Gasstrom)<br />
und dem Leitungsbau (Gasleitung, Leitung Lagerstättenwasser)<br />
dauert ca. 6 Monate. Die Abwasserbecken<br />
werden verschlossen oder zurück gebaut. Das Regenwasser<br />
wird dann in angrenzenden Flächen versickert.<br />
Nach dem Zielkonzept von ExxonMobil ist vorgesehen,<br />
das geförderte Gas über ein unterirdisches Leitungsnetz<br />
einer zentral angesiedelten Gastrocknungsanlage (Lage in<br />
Gewerbe-/Industriegebiet; Konzeptansatz: Anschluss von<br />
10 Bohrplätzen an eine Gastrocknungsanlage, Ziel: bis zu<br />
4 Gastrocknungsanlagen an einem Standort (keine Entschwefelung<br />
bei shale gas und CBM); Anschluss von insgesamt<br />
40 Bohrplätzen) zuzuführen, bevor es in das öffentliche<br />
Versorgungsnetz eingespeist wird.<br />
Das in der FWKO abgetrennte Lagerstättenwasser soll<br />
über separate unterirdische Leitungen dem Standort der<br />
Gastrocknungsanlagen (s.o.) zur Aufbereitung und anschließenden<br />
externen Verpressung zugeführt werden.<br />
Die Dauer der Gasförderung hängt von der Ergiebigkeit<br />
der Quelle ab; in den meisten Fällen beträgt die Förderdauer<br />
etwa 15 bis 30 Jahre. Anschließend wird der Bohrplatz<br />
rückgebaut und rekultiviert.<br />
Die Fahrverkehre im Regelbetrieb beschränken sich auf<br />
einzelne Fahrten für die <strong>Betrieb</strong>s-/Sicherheitsüberwachung<br />
sowie Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.<br />
3 Methodischer Ansatz – Analyse der Wirkungszusammenhänge /<br />
Wirkungskettenanalyse<br />
Vorrangiges Ziel des vorliegenden Fachbeitrages ist es aufzuzeigen, welche Auswirkungen auf die<br />
Landschaft sich im Zusammenhang mit der unkonventionellen Erdgasgewinnung ergeben können.<br />
Um die konkreten Auswirkungen eines Vorhabens ermitteln zu können, müssen die Projektwirkungen<br />
des Vorhabens einerseits und die Umweltsituation/standörtlichen Verhältnisse andererseits bekannt<br />
sein. Im vorliegenden Fall liegen - insbesondere durch Angaben der Fa. ExxonMobil, durchgeführte<br />
Ortsbegehungen, Angaben zu vergleichbaren Vorhaben - umfängliche Kenntnisse zu den Projektwirkungen<br />
vor (s. Kapitel 4). Derzeit sind großräumige Explorationsgebiete abgegrenzt (s. Anhang 1 und<br />
2), ohne dass bereits konkrete Standorte für Bohrplätze festgelegt wurden. Dies bedeutet, dass mit diesem<br />
Kenntnisstand keine konkrete Auswirkungsprognose möglich ist.<br />
18 ExxonMobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 16 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Im Folgenden werden daher vorrangig die Wirkungszusammenhänge im Rahmen einer Wirkungskettenanalyse<br />
aufgezeigt, die sich bei der unkonventionellen Erdgasförderung durch die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>,<br />
die Errichtung der <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen und den <strong>Betrieb</strong> (Exploration/Erkundungsbohrung,<br />
Feldesentwicklung – Bohrungen inkl. Fracking und Regelbetrieb - Erdgasförderung)<br />
auf die Landschaft / Umwelt-Schutzgüter ergeben können.<br />
Abgeleitet aus den Vorhabensmerkmalen/Projektwirkungen wird aufgezeigt, welche Wirkfaktoren (z.B.<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong>, Aufstellung Bohrturm, Emissionen/Immissionen) relevant sind, welche Wirkungsbeziehungen/-pfade<br />
sich daraus ergeben können und wie sich daraus mögliche Beeinträchtigungen<br />
(z.B. Flächenverluste, Störwirkungen) bzw. Konfliktpotenziale ergeben können.<br />
Die Wirkungskettenanalyse wird differenziert nach einzelnen Schutzgütern durchgeführt. Die Bezeichnung/Untergliederung<br />
der Umwelt-Schutzgüter orientiert sich an § 2 Abs.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
(UVPG) und wird wie folgt vorgenommen:<br />
�� Landschaft (hier: inkl. landschaftsbezogener Erholung)<br />
�� Mensch (hier: inkl. siedlungsnaher Erholung)<br />
�� Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt<br />
�� Boden und Wasser<br />
�� Luft und Klima<br />
�� Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
�� hier: Freiraum- und Agrarbereiche – Land-/Forstwirtschaft<br />
Die Analyse der Wirkungszusammenhänge erfolgt als Einzelbetrachtung für einen Cluster-Bohrplatz.<br />
Diese Vorgehensweise wird der hier zu betrachtenden Fragestellung insofern gerecht, da bei jeweils<br />
einem Clusterplatz je 4-10 km² 19 die Clusterplätze soweit voneinander entfernt liegen, dass sich die<br />
räumlichen Wirkungsbereiche benachbarter Clusterplätze nicht überlagern.<br />
Die Auswirkungen der unkonventionellen Erdgasgewinnung in einem Explorationsgebiet (mit zahlreichen<br />
Bohrplätzen) auf den Landschaftsraum bzw. die Landschaftsregion werden in Kapitel 8 betrachtet.<br />
In Kapitel 4.3 werden Angaben zu den zentralen <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen (Gastrocknungsanlagen,<br />
Aufbereitung „back-flow“, Verpressstationen aufbereiteter wässriger „back-flow“ und Lagerstättenwasser)<br />
gemacht.<br />
Die Wirkungsanalyse bezieht sich ausschließlich auf den hier behandelten Themenkreis mit den vorgenannten<br />
Aspekten.<br />
Nicht betrachtet werden z.B. die Belange der menschlichen Gesundheit (Umwelt-/Human-Toxikologie<br />
etc.), der Anlagensicherheit (z.B. Risikobetrachtungen, Explosions-/Brandschutz) und von Stofffreisetzungen<br />
bei Störungen oder im Schadensfall (z.B. Freisetzung wassergefährdender Stoffe). Weiterhin<br />
nicht betrachtungsrelevant sind die <strong>Betrieb</strong>svorgänge unterhalb der Geländeoberkante (z.B. Bohrvorgänge,<br />
Fracking-Vorgänge im Untergrund).<br />
Im Folgenden werden die Wirkungszusammenhänge schutzgutbezogen aufgezeigt. Bei der Wirkungsanalyse<br />
werden die zeitlich begrenzten Phasen der Exploration/Erkundungsbohrung und der Feldesentwicklung<br />
(Bohrphase inkl. Fracking - Clusterplatz) einerseits und des dauerhafteren Regelbetriebes<br />
- Erdgasförderung andererseits (Förderbetrieb über ca. 15-30 Jahre) betrachtet. Die relevanten<br />
Wirkungsbeziehungen werden aufgezeigt und mögliche Konfliktpotentiale erläutert.<br />
Im Anschluss an die textlichen Erläuterungen zu den Schutzgütern werden die Wirkungszusammenhänge<br />
jeweils in Tabellenform zusammengefasst und es werden jeweils Hinweise auf die einschlägigen,<br />
fachgesetzlichen Bewertungsmaßstäbe gegeben.<br />
Die Feldesentwicklung mit einem Einzelbohrplatz (Ausnahme; jeweils geringere <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>/Emissionen<br />
als beim Clusterplatz) wird nicht weiter betrachtet.<br />
19 ExxonMobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 17 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4 Projektwirkungen<br />
Bei den Projektwirkungen werden die Phasen der<br />
�� Exploration (Erkundungsbohrung) und der Feldesentwicklung (Bohrphase inkl. Fracking)<br />
und des<br />
�� Regelbetriebes – Erdgasförderung<br />
unterschieden. Diese Aufgliederung bietet sich an, da es sich bei der Exploration und der Feldesentwicklung<br />
einerseits um jeweils temporäre/zeitlich begrenzte Phasen mit erhöhten <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten<br />
und Fahrverkehren handelt, die sich grundlegend vom Regelbetrieb (Dauer ca. 15-30 Jahre, nur im<br />
Einzelfall sichtbare <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten) unterscheiden.<br />
Folgende Projektwirkungen sind unter dem Themenkreis Landschaft für die einzelnen Phasen betrachtungsrelevant:<br />
Exploration (Erkundungsbohrung) und<br />
Feldesentwicklung (Bohrphase inkl. Fracking)<br />
Regelbetrieb – Erdgasförderung<br />
- <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> - <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
- Errichtung von Anlagenteilen / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
mit Bohrturm/-anlage und Fracking-Equipment<br />
- Anlagenteile / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
- Verkehrsaufkommen - Verkehrsaufkommen<br />
- Lärm - Emissionen und visuelle Wirkungen<br />
- Licht - Ableitung/Entsorgung von Oberflächenwasser<br />
- Visuelle Wirkungen (Bewegungen, Blendwirkung etc.) - leitungsgebundener Gastransport / Transport<br />
von Lagerstättenwasser<br />
- Erschütterungen<br />
- Luftschadstoffe / Gerüche<br />
- Ableitung/Entsorgung von Oberflächenwasser<br />
- Wasserbedarf und Entsorgung des “back-flow“ beim Fracking<br />
Die Beschreibung der Projektwirkungen erfolgt unter Berücksichtigung der Aspekte des Umfangs, der<br />
Intensität, der Dauer, des zeitlichen Verlaufes und des räumlichen Wirkungsbereiches.<br />
Die Cluster-Plätze werden - insbesondere in Abhängigkeit der Lagerstättenverhältnisse - mit bis zu<br />
20 Bohrungen/-löcher je Platz ausgebaut.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 18 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.1 Exploration – Erkundungsbohrung und Feldesentwicklung – Bohrphase<br />
inkl. Fracking<br />
4.1.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Umfang 20 : Der Flächenbedarf für eine Explorationsbohrung<br />
und die anschließende Nutzung als Clusterplatz liegt<br />
bei ca. 7.000 – 10.000 m² (Flächenversiegelung in Straßenbauweise<br />
mit Asphalt bzw. teilweise Beton; Flächenangaben<br />
bei 6-10 und bei 10-20 Bohrungen) zzgl. ca.<br />
1.000 – 2.000 m² für Nebenflächen (insbesondere Lagerung<br />
von Oberboden, Zuwegung). Die Herstellung des<br />
Platzes kann mit einer Dauer von ca. 2 Monaten abgeschätzt<br />
werden.<br />
Der Explorationsplatz wird nach der ca. 2-3-monatigen<br />
Phase der Erkundungsbohrung (inkl. Aufbau Bohranlage)<br />
und einem bis zu etwa einjährigen Zeitraum für die Auswertungen<br />
der Bohrung entweder rückgebaut oder nach<br />
Flächenversiegelung Bohrplatz [6]<br />
Einholung der erforderlichen Genehmigungen/Bewilligungen<br />
im Regelfall als Cluster-Bohrplatz genutzt/ausgebaut.<br />
Die Phase der Feldesentwicklung (reine Bohrzeit) kann - abgeleitet aus der angenommenen Zeitdauer<br />
der Bohraktivitäten je Bohrung (ca. 3 Wochen) – mit bis zu rd. 14 Monate abgeschätzt werden. Das<br />
Fracking wird innerhalb des Bohrzeitraums (nach ca. ¾ der Bohrzeit wird damit begonnen) durchgeführt.<br />
Die <strong>Betrieb</strong>sflächen werden aus Sicherheitsgründen mit einer ca. 2-2,5 m hohen Zaunanlage eingefriedet.<br />
Intensität: Mit der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> entfällt jeweils die bisher vorhandene Nutzung (z.B. als<br />
land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fläche).<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Die Gesamt-Dauer der Exploration mit der Feldesentwicklung kann (ohne<br />
Zeiten der Auswertungen der Explorationsbohrung und Zeiten für die Einholung von Genehmigungen/<br />
Bewilligungen) mit bis zu rd. 2 Jahren abgeschätzt werden.<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: Betroffen ist die unmittelbare Eingriffsfläche; zu betrachten sind jeweils<br />
ggf. Zerschneidungs-/Barrierewirkungen durch Gasleitungen (Zuleitung zu zentraler Gastrocknungsanlage,<br />
dortige Anbindung an das öffentliche Netz) und Leitungen für Lagerstättenwasser.<br />
20 Exxon Mobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 19 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.1.2 Errichtung von Anlagenteilen / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen – mit Bohranlage<br />
Umfang: Auf der in Straßenbauweise befestigten <strong>Betrieb</strong>sfläche wird das für die Erkundungsbohrung<br />
und für die Feldesentwicklung (Bohrphase inkl. Fracking) benötigte Equipment aufgestellt.<br />
Beispiel Bohrplatzzustand Bohrphase [7] - Foto 1<br />
Fracking-Phase; <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen [8] - Foto 2<br />
4.1.3 Verkehrsaufkommen<br />
Das Erscheinungsbild wird vorrangig durch die Bohranlagen<br />
(Arbeitshöhe: 26,8 bis 38,5 m) 21 , die Aufstellung von<br />
Containern (Büro-/Sozialcontainer / Materialcontainer), <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
(Lichtmasten, Gas-Kaltausbläser)<br />
und das Abstellen von Fahrzeugen bestimmt (s. Foto 1).<br />
In der Phase des Frackings werden zudem technische Anlagen<br />
/ Aggregate (im Wesentlichen Hydraulikaggregate,<br />
Behälter/Tanks und Siloanlagen für Hydraulik-Fracturing-<br />
Flüssigkeit, Sand etc.) benötigt (s. Foto 2). Die Höhe dieser<br />
Einrichtungen kann mit bis zu ca. 10 m angenommen<br />
werden. 22<br />
Intensität: Das Erscheinungsbild der <strong>Betrieb</strong>sfläche ähnelt<br />
dem einer Baustelleneinrichtungsfläche einer sonstigen<br />
Großbaustelle, mit hier zusätzlichem Bohrturm. Die Niederbringung<br />
der einzelnen Bohrungen erfolgt zeitlich nacheinander<br />
mit einem Bohrgerät.<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Die Phase der Erkundungsbohrung<br />
(inkl. Auf-/Abbau Bohranlage) dauert ca. 3-4 Monate<br />
an; die Phase der Feldesentwicklung (Bohrvorgänge inkl.<br />
Fracking) bis zu rd. 14 Monate (bei 20 Bohrungen).<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: Der räumliche Wirkungsbereich<br />
wird durch den 26,8 - 38,5 m hohen Bohrturm<br />
bestimmt. Unter Berücksichtigung der Bohrturmhöhe<br />
und der übrigen Abmessungen des Bohrturmes kann der<br />
räumliche Einwirkungsbereich mit im Regelfall rd. 400 -<br />
600 m abgeschätzt werden (zur Herleitung des Wirkungsbereiches:<br />
s. Kapitel 5.1.2).<br />
Umfang / Intensität: Das Verkehrsaufkommen für die Herstellung des Bohrplatzes kann mit insgesamt<br />
(über einen Zeitraum von 2 Monaten) 150-200 LKW abgeschätzt werden. 23<br />
Während der Durchführung der Bohrungen (Exploration bzw. Feldesentwicklung) kann das LKW-<br />
Aufkommen mit wöchentlich ca. 25-30 LKW abgeschätzt werden. Für Phasen des Frackings erhöht sich<br />
das Verkehrsaufkommen auf wöchentlich rd. 60 LKW (zeitliche Überlagerung der Bohr- und Fracking-<br />
Vorgänge). Ein höheres Verkehrsaufkommen beschränkt sich auf eng begrenzte Zeiten von Auf- und<br />
21<br />
ITAG, EQUIPMENT LIST AND TECHNICAL DATA OF DRILLING RIG, 12/10/2011;<br />
DRILLMEC SPA, DRILLING TECHNOLOGIES, aTREVIGROUP Company, HH102 Hydraulic drilling rig - semitrailer mounted,<br />
Operation and Maintenance Manual, Document code: UM189023/E - Revision 0 (02/2007), 2007 –<br />
E-mails Fa. ExxonMobil vom 13.01.12<br />
22<br />
ExxonMobil 2012<br />
23<br />
www.exxonmobil.de<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 20 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Abbauarbeiten inkl. Abfuhr des „back-flow“ (dann wöchentlich bis zu 100 LKW/TKW). 24 (näheres siehe<br />
Kapitel 4.4)<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Die LKW-Fahrten erfolgen ausschließlich werktags, überwiegend im Zeitraum<br />
von 7.00 – 18.00 Uhr; keine Fahrten zur Nachtzeit: 22.00 – 06.00 Uhr.<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: Von den Fahrverkehren sind die öffentlichen Straßen (Zufahrt) sowie<br />
ggf. eine separate Zuwegung zum <strong>Betrieb</strong>sgelände (Anbindung an das öffentliche Straßennetz) betroffen<br />
sowie das <strong>Betrieb</strong>sgelände selbst.<br />
4.1.4 Lärm<br />
Isophone, <strong>Betrieb</strong>splan Bötersen Z 11 [9]<br />
Bohrturm, Arbeitshöhe hier: 26,8 m [10]<br />
24 ExxonMobil 2012<br />
Umfang: Lärmemissionen entstehen im Zusammenhang<br />
mit den <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten auf dem Bohrplatzgelände<br />
(Bohr-/Pumpvorgänge, Materialbewegungen, Fahrverkehre,<br />
Absetzen/Aufnehmen von Containern, etc.) und den<br />
Fahrverkehren auf der Zufahrt zum Bohrplatz.<br />
Intensität: Die vergleichsweise höchsten Lärmemissionen<br />
sind während der werktäglichen <strong>Betrieb</strong>szeiten zu erwarten,<br />
in denen sich die Lärmemissionen der<br />
<strong>Betrieb</strong>stätigkeiten (Bohrtätigkeiten, zeitweise parallele<br />
Fracking-Vorgänge) mit den Fahrverkehren überlagern.<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Die LKW-Fahrten erfolgen ausschließlich<br />
werktags, überwiegend im Zeitraum von 7.00 –<br />
18.00 Uhr (s. Kapitel 4.1.3). Die Bohrtätigkeiten (Exploration<br />
und im Rahmen der Feldesentwicklung) werden an 7<br />
Tagen je Woche (also werktags und sonn- bzw. feiertags)<br />
sowohl zur Tagzeit (6.00 – 22.00 Uhr) als auch zur Nachtzeit<br />
(22.00 – 06.00 Uhr) durchgeführt.<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: Der räumliche Lärm-<br />
Wirkungsbereich der LKW-Fahrten auf öffentlichen Straßen<br />
begrenzt sich auf das nähere Umfeld der betroffenen<br />
Straßen.<br />
Die räumliche Reichweite der vom Bohrplatz ausgehenden<br />
Lärmeinwirkungen kann bis zu einem Umkreis von mehreren<br />
Hundert Metern betragen. Bei schalltechnischen Untersuchungen<br />
zur Erstellung des Rahmenbetriebsplanes<br />
Bötersen Z 11 wurde eine Minderung auf einen Schallleistungspegel<br />
von 60 dB(A) in einer Entfernung von ca. 50-<br />
100 m und eine Minderung auf 45 dB(A) in ca. 175 - 500 m<br />
Entfernung erreicht. Der für die Siedlungsflächen im Umfeld<br />
eines Bohrplatzes maßgebende Immissionsrichtwert<br />
ist abhängig von der Art der baulichen Nutzung (z.B.<br />
Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen); s. Kapitel<br />
5.2.2.3 Mensch.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 21 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.1.5 Licht<br />
Exemplarische Beleuchtung des Bohrplatzes [11]<br />
Umfang: Zur Ausleuchtung des Bohrplatzes während<br />
Dämmerungs- und Nachtzeiten werden Lichtmasten aufgestellt.<br />
Zudem werden der Bohrturm bzw. die Bohreinrichtungen<br />
beleuchtet.<br />
Intensität: Die Ausrichtung der Lichtmasten/-quellen erfolgt<br />
zweckgerichtet zur Beleuchtung des Bohrplatzes (Arbeitsplatzbeleuchtung).<br />
Die vergleichsweise größte visuelle<br />
Wahrnehmbarkeit der künstlichen Beleuchtung ergibt sich<br />
zu den Nachtzeiten.<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Die Bohrtätigkeiten werden sowohl<br />
zur Tag- als auch zur Nachzeit durchgeführt, so dass<br />
sich in Abhängigkeit der Jahreszeiten unterschiedlich lange<br />
nächtliche Zeiten der Bohrplatz-Beleuchtung ergeben.<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: Die Lichtmasten/-quellen werden so ausgerichtet, dass möglichst nur<br />
die <strong>Betrieb</strong>sflächen des Bohrplatzes ausgeleuchtet werden. Eine visuelle Wahrnehmbarkeit des Bohrplatzes<br />
ist - soweit keine abschirmenden Elemente vorhanden sind - insbesondere zur Nachtzeit in<br />
nicht bzw. weniger besiedelten Bereichen auch noch aus größerer Entfernung gegeben. Etwaige Störwirkungen<br />
nehmen mit zunehmender Entfernung ab. Bezugnehmend auf die Ausführungen in Kapitel<br />
5.1.2 wird der räumliche Einwirkungsbereich orientierend mit im Regelfall bis zu rd. 500 m abgeschätzt.<br />
4.1.6 Visuelle Wirkungen (Bewegungen, Blendwirkung etc.)<br />
Bewegungen ergeben sich vorrangig durch Fahrverkehre auf der Zufahrt und dem Bohrplatz.<br />
Bewegliche/rotierende Anlagenteile mit etwaigen Störwirkungen sind mit dem <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten auf<br />
dem Bohrplatz nicht verbunden. Die im Nahbereich visuell wahrnehmbaren langsamen Vertikalbewegungen<br />
im Bereich des Bohrturmes sind im Hinblick auf visuelle Störwirkungen durch Bewegungen vernachlässigbar.<br />
4.1.7 Erschütterungen<br />
Mit den <strong>oberirdische</strong>n <strong>Betrieb</strong>svorgängen sind im Regelfall keine umweltrelevanten Erschütterungen<br />
verbunden. Zu Siedlungseinheiten/-flächen werden Abstände von mindestens 100 m (Einzelgehöfte/<br />
-bebauungen) bzw. 200 m (Siedlungsflächen) eingehalten (s. Kapitel 5.2.2.1).<br />
Rammarbeiten können bedarfsweise messtechnisch überwacht durchgeführt werden. Die Beurteilungsmaßstäbe<br />
der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“ im Bereich der Siedlungsflächen werden<br />
eingehalten 25 .<br />
25 ExxonMobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 22 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.1.8 Luftschadstoffe / Gerüche<br />
Die Bohrplatzfläche und die Zufahrten sind/werden in Straßenbauweise befestigt/versiegelt, so dass<br />
von den Fahrverkehren keine nennenswerte Staubentwicklung ausgeht. Dies gilt auch für die Bauvorgänge<br />
zur Herrichtung des Bohrplatzes, da im Regelfall erdfeuchte Böden bewegt werden.<br />
Geruchsentwicklungen während des Frackings sind nicht zu besorgen, da die potenziell geruchsträchtigen<br />
Fracking-Flüssigkeiten (z.B. „back-flow“) in geschlossenen Systemen gehandhabt werden. Der<br />
„back-flow“ wird in Tanks aufgefangen, nach Möglichkeit bei den einzelnen Fracking-Vorgängen wiederverwertet<br />
und dann - insbesondere nach Abschluss der Frackingphase - in Tankfahrzeugen (oder<br />
bei einer großflächigen Bohrplatzverteilung im Raum leitungsgebunden 26 ) zur externen Aufbereitung/Verpressung<br />
abtransportiert.<br />
Bei Einsatz dieselbetriebener Antriebsaggregate werden Dieselmotoremissionen freigesetzt. Die einschlägigen<br />
Abgasnormen sind zu beachten und bei größeren Motorleistungen zudem die Anforderungen<br />
der TA Luft an die Emissionsbegrenzung (Ziff. 5.4.1.4) und die Ableitung der Abgase. Durch<br />
Beachtung der vorgenannten Anforderungen sollten etwaige Geruchswahrnehmungen vermieden<br />
werden können.<br />
4.1.9 Ableitung/Entsorgung von Oberflächenwasser<br />
Exemplarischer Bohrplatzplan [12]<br />
Umfang / Intensität 27 : Das auf den versiegelten <strong>Betrieb</strong>sflächen<br />
des Bohrplatzes anfallende Oberflächenwasser<br />
wird getrennt nach dem inneren Bereich (Bohrflächen mit<br />
Handling wassergefährdender Stoffe) und dem äußeren<br />
Bereich (übrige <strong>Betrieb</strong>sflächen) in zwei Becken gefasst/gesammelt<br />
(s. rotes und blaues Rechteck in Darstellung).<br />
Das Oberflächenwasser aus dem inneren Bereich wird mit<br />
Tankkraftwagen (TKW) zur externen Entsorgung abgefahren.<br />
Das Oberflächenwasser aus dem äußeren Bereich<br />
wird in Abhängigkeit der Wasserqualität (Kontrolle/Beprobung)<br />
zur Kläranlage oder anderweitigen Entsorgung<br />
abgefahren.<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Gesamt-Dauer der Exploration mit der Feldesentwicklung: bis zu rd. 2 Jahre<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: <strong>Betrieb</strong>sfläche; Abwasserbecken am Bohrplatzstandort<br />
4.1.10 Wasserbedarf und Entsorgung des “back-flow“ beim Fracking<br />
Umfang / Intensität 28 : Die Anzahl und die konkrete Ausführung der Fracking-Vorgänge (z.B. Wasserbedarf)<br />
ist abhängig von den spezifischen standörtlichen Lagerstättenverhältnissen.<br />
Je Fracking-Vorgang ergibt sich ein Wasserbedarf von ca. 150 - 1.600 m³ 29 .<br />
26 Email ExxonMobil, 29.03.2012<br />
27 ExxonMobil 2012<br />
28 ExxonMobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 23 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Bei 10 großen fracs ergibt sich demnach für ein Bohrloch ein Gesamt-Wasserbedarf für das Fracking<br />
von bis zu 16.000 m³ (Bruttowert, ohne Berücksichtigung Wiederverwertung „back-flow“, s.u.).<br />
Der Wasserbedarf wird zumindest bei großen fracs aus Brunnen oder dem Wassernetz gedeckt.<br />
Der „back-flow“ aus dem Fracking-Prozess (= ca. 20-60% 30 (CBM) , ca. 30 % 31 (shale gas) des Inputs<br />
Frackingwasser/-flüssigkeit) wird zum größten Teil bei den Fracking-Vorgängen vor Ort wiederverwertet.<br />
32 Der nach mehrmaliger Wiederverwertung verbleibende back-flow stellt nur noch einen kleinen<br />
Restteil der ursprünglichen Einsatzmenge dar und wird mit TKW abgefahren oder ggf. leitungsgebunden<br />
abtransportiert.<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Fracking-Zeitraum bei 14 Bohrungen mit je 10 großen fracs (s. Ansätze Kapitel<br />
4.4): ca. 2-3 Monate; eigentliche Fracking-Dauer je Bohrloch: ca. 3 h.<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: externe Aufbereitung/Verpressungsstation<br />
4.1.11 Weiterer Untersuchungsbedarf bzw. Kenntnisdefizite<br />
Die Projektwirkungen können mit derzeitigem Kenntnisstand nicht bis ins Detail beschrieben werden, da<br />
die konkrete Durchführung der Erkundungsbohrung und der Feldesentwicklung von den standortspezifischen<br />
Vor-Ort-Verhältnissen abhängig ist und derzeit noch keine konkreten Standorte für Bohrplätze<br />
festgelegt sind.<br />
Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgender weiterer Untersuchungsbedarf bzw. verbleiben folgende<br />
Kenntnisdefizite:<br />
�� Luftschadstoffemissionen (Bohrbetrieb, Fahrverkehr) und kleinräumige Auswirkungen auf die Lufthygiene<br />
(Immissionswerte TA Luft, Parameter insbesondere: PM 10, NOx etc....);<br />
Einsatz Dieselaggregate oder Anschluss an das Stromnetz;<br />
Hinweis: Verbrennungsmotor für Bohranlagen fallen gemäß Nr. 1.4 der 4. BImSchV nicht in den<br />
Anwendungsbereich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes<br />
�� Lärm: tieffrequenter Lärm (Bohrungen, Frac-<strong>Betrieb</strong>)<br />
�� Lichtverschmutzung: konkretes Ausleuchtungskonzept während Explorationsphase/Feldesentwicklung<br />
und Regelbetrieb<br />
�� Fracking: abschließende Anzahl der fracs pro Bohrloch; konkreter Bedarf an Wasser/ Wasserversorgung<br />
für fracs; „back-flow“ (konkrete Menge, Umfang der Wiederaufbereitung)<br />
�� Anfall/Menge und Zusammensetzung/Schadstoffpotenzial von Lagerstättenwasser<br />
�� Lage der zentralen <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen (Gasaufbereitung/-trocknung, Gas-Verdichterstation,<br />
Wasseraufbereitung, Verpressstationen, s. Kapitel 4.3)<br />
�� Leitungsführung (Gas, Lagerstättenwasser, back-flow)<br />
�� Räumlich-zeitliche Ausbaukonzeption / Ablaufplanung (s. Kapitel 8)<br />
�� Verkehr: Anzahl der TKW für das Abfahren des Oberflächenwassers (abhängig von der Menge<br />
des Niederschlagswassers ggf. Starkregenereignissen), Anzahl der LKW für den Leitungsbau<br />
(Baustellenfahrzeuge, Ab- und Antransport von Schüttgütern/Baustellenmaterialien/Leitungen)<br />
29<br />
ExxonMobil 2012; je nach Gestein: 212 - 4.000 m³ (Universität Hannover, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik,<br />
E-mail vom 30.01.2012)<br />
30<br />
UBA: 20-80%; Literatur/Fachgespräche: 23% (Universität Hannover, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik,<br />
E-mail vom 30.01.2012)<br />
31<br />
Email ExxonMobil vom 29.03.2012<br />
32<br />
Telefonat vom 28.03.2012, ExxonMobil<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 24 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.2 Regelbetrieb – Erdgasförderung / Bohrplatz<br />
4.2.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Modellhafte Ansicht eines Bohrplatzes im Regelbetrieb [13]<br />
4.2.2 Anlagenteile / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
Exemplarisch: Bohrplatz im Regelbetrieb [14]<br />
Detail FWKO – Wasserabscheideanlage (Regelbetrieb) [15]<br />
4.2.3 Verkehrsaufkommen<br />
Die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben<br />
bleibt über den gesamten Förderzeitraum<br />
(bis zu ca. 30 Jahre) erhalten. Dies ist nach Angaben<br />
der Fa. ExxonMobil insbesondere erforderlich, um im<br />
Bedarfsfall ggf. nochmals Fracking-Vorgänge durchführen<br />
zu können.<br />
Umfang / Intensität: Nach dem Abschluss des Frackings<br />
wird der Bohrplatz zum Regel-/Förderbetrieb um-/<br />
rückgebaut.<br />
Das Erscheinungsbild des Bohrplatzes wird im Regelfall<br />
im Förderbetrieb von den befestigten und umzäunten<br />
<strong>Betrieb</strong>sflächen mit Lichtmasten und untergeordneten<br />
technischen Einrichtungen (E-Kreuze Bohrungen,<br />
FWKO – Wasserabscheideanlage, Höhe ca. < 2,5 m)<br />
bestimmt.<br />
Dauer/zeitlicher Verlauf: Das Erscheinungsbildes des<br />
Bohrplatzes im Regelbetrieb bleibt über die ca. 15-30jährige<br />
Förderzeit unverändert.<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: Durch die Umsetzung<br />
von Eingrünungsmaßnahmen (s. Kapitel 7) bleibt der<br />
räumliche Einwirkungsbereich auf das nahe Umfeld<br />
des Bohrplatzes beschränkt.<br />
Die Fahrverkehre im Regelbetrieb beschränken sich auf einzelne Fahrten für die <strong>Betrieb</strong>s-/Sicherheitsüberwachung<br />
sowie Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 25 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.2.4 Emissionen und visuelle Wirkungen<br />
Modellhafter Blick auf den Bohrplatz im Regelbetrieb<br />
aus größerer Entfernung [16]<br />
4.2.5 Ableitung/Entsorgung von Oberflächenwasser<br />
Mit dem Regelbetrieb der Erdgasförderung sind keine umweltrelevanten<br />
Emissionen/Immissionen (Lärm, Erschütterungen<br />
/ Luftschadstoffe / Gerüche) und keine visuellen<br />
Wirkungen (Bewegungen, Blendwirkung etc.) verbunden.<br />
Der Bohrplatz wird aus sicherheitstechnischen Gründen in<br />
üblicher Weise (geringer Umfang) beleuchtet.<br />
Die für die Exploration/Feldesentwicklung errichteten Abwasserbecken werden verschlossen oder rückgebaut.<br />
Das Regenwasser der befestigten Oberflächen wird dann in angrenzenden Bereichen versickert.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 26 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.3 Regelbetrieb – Erdgasförderung / Zentrale <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
Nach derzeitigen Konzeptüberlegungen der Fa. ExxonMobil ist vorgesehen, im Regelbetrieb benötigte<br />
<strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen - unter Berücksichtigung umweltbezogener und betriebtechnischer/-wirtschaftlicher<br />
Aspekte - an zentralen Standorten zusammenzufassen. Es handelt sich dabei um folgende<br />
Einrichtungen/Anlagenteile:<br />
�� Gastrocknung (nach derzeitigem Konzept: Anschluss von 10 Clusterplätzen an 1 Gastrocknungsanlage;<br />
Ziel: 4 Gastrocknungsanlagen mit je ca. 50.000 m³/h je Standort; Anschluss von<br />
insgesamt ca. 40 Clusterplätzen) 33<br />
�� Gas-Verdichterstation<br />
�� Wasseraufbereitung (Feststoffabscheidung, Öl-Wassertrennung etc.) mit Tanks/Behältern<br />
– Lagerstättenwasser (Zuführung über Leitungen) und „back-flow“ (Anlieferung mit TKW oder<br />
leitungsgebunden)<br />
�� <strong>Betrieb</strong>sgebäude (Organisation/Abwicklung, Werkstatt, Lager etc.)<br />
Als Standorte der zentralen <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen kommen Gewerbe-/Industrieflächen in Betracht.<br />
Ziel ist es die verschiedenen Nebeneinrichtungen an diesen Standorten zusammenzufassen (z.B. Wasser-/back-flow-Aufbereitung<br />
und Gastrocknung).<br />
Das Gas und das Lagerstättenwasser (und ggf. der back-flow) werden über separate Leitungen den<br />
zentralen <strong>Infrastruktur</strong>standorten zugeführt; mögliche Leitungsquerschnitte z.B. Gas: DN 200 - 400; Lagerstättenwasser:<br />
DN 80 – 100) 34 – im Konkreten abhängig insbesondere von Leitungslänge, Anzahl/Ergiebigkeit<br />
angeschlossener Bohrungen.<br />
Die Verpressung der aufbereiteten wässrigen Fraktion ist an externen Verpressstationen geplant.<br />
Exemplarisch: Verpressungsstation [17] Exemplarische Gastrocknungsanlage [18]<br />
33 ExxonMobil 2012 – 05.01.2012; gem. e-mail vom 16.02.12 im Shale-Gas ggf. nur 4 Clusterplätze je Gastrocknungsanlage<br />
34 ExxonMobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 27 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
4.4 Zusammenfassung der zu erwartenden Verkehre<br />
Das LKW/TKW-Aufkommen von der Exploration bis zum Regelbetrieb lässt sich für einen modellhaften<br />
Clusterplatz (14 Bohrungen á jeweils 10 fracs) wie folgt überschlägig darstellen: 35<br />
Die oben dargestellten LKW-Verkehre treten innerhalb einer zeitlichen Spanne von ca. 1,5 Jahren auf<br />
(ohne Berücksichtigung von dazwischen liegenden Genehmigungsphasen).<br />
Das TKW-Aufkommen für den Abtransport des back-flow berücksichtigt eine weitgehende<br />
Wiederverwendung vor Ort und ist nur für einen Einzelbohrplatz maßgebend. Im Falle einer großflächigen<br />
Verteilung mehrerer Clusterplätze im Raum (vgl. hierzu Kapitel 8) ist vorgesehen, den back-flow<br />
nach Wiederverwendung leitungsgebunden zu einer zentralen Aufbereitungseinheit zu transportieren.<br />
Nach der Wiederaufbereitung sind für den restlichen Abtransport (ca. 0,4 % der ursprünglichen<br />
Einsatzmenge) ca. 90 TKW pro Clusterplatz (14 Bohrungen a 10 fracs) anzusetzen, die den back-flow<br />
von der zentralen Aufbereitungsanlage zur externen Entsorgung abtransportieren.<br />
Die LKW-Verkehre für den Leitungsbau sind in der derzeitigen Konzeptphase nicht abschätzbar. Sie<br />
setzen sich aus Baustellenfahrzeugen, Transportfahrzeugen für Leitungen/Baumaterialien/Schüttgütern<br />
zusammen und sind in hohem Maße von den standortbezogenen Gegebenheiten (Leitungsführung-<br />
/Länge/Untergrund/Verlegungsaufwand etc.) abhängig.<br />
35<br />
Exxon Mobil 2012 (Vermerk Ortstermin 05.01.2012, Email Exxon Mobil vom 12.01.2012, 29.03.2012,<br />
Telefonat Exxon Mobil vom 28.03.2012)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 28 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Weiterhin sind die LKW-Verkehre für den Abtransport des Regenwassers nicht aufgeführt, da diese<br />
ebenso variieren können (konkrete Größe der befestigten Flächen und der Auffangbecken, Niederschlagswasseraufkommen<br />
und -intensität/Abflussverhalten etc.).<br />
Die Frischwasserzufuhr erfolgt leitungsgebunden über örtliche Trinkwasserleitungen.<br />
Im Ergebnis ist von einem LKW-Aufkommen während der Durchführung der Bohrungen (Exploration<br />
bzw. Feldesentwicklung) von wöchentlich ca. 25-30 LKW auszugehen. Für Phasen des Frackings erhöht<br />
sich das Verkehrsaufkommen auf wöchentlich rd. 60 LKW (zeitliche Überlagerung der Bohr- und<br />
Fracking-Vorgänge). Ein höheres Verkehrsaufkommen beschränkt sich auf eng begrenzte Zeiten von<br />
Auf- und Abbauarbeiten inkl. Abfuhr des „back-flow“ (dann wöchentlich bis zu 100 LKW/TKW).<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 29 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5 Beschreibung der Wirkungsbeziehungen und möglichen Konfliktpotenziale<br />
auf landschaftsgebundene Schutzgüter<br />
5.1 Schutzgut Landschaft – landschaftsgebundene Erholung<br />
5.1.1 Grundlagen / Aspekte Landschaft – Landschaftsbild<br />
Unter dem Umwelt-Schutzgut „Landschaft“ kann einerseits der Landschaftshaushalt, andererseits die<br />
äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft – das Landschaftsbild – verstanden<br />
werden. Die Landschaft wird vom Menschen mit allen Sinnen wahrgenommen, deshalb ist<br />
nicht nur die visuelle Wahrnehmung von Bedeutung, sondern auch der Geruchs-, Gehör- und ggf. Tastsinn.<br />
Das Landschaftsbild umfasst alle wesentlichen Elemente und Strukturen der Landschaft, ungeachtet ob<br />
sie historisch oder aktuell, ob sie natürlich oder kulturbedingt entstanden sind. Dadurch dass das Landschaftsbild<br />
subjektiv wahrgenommen wird, sind nicht nur die Strukturen, sondern auch deren Bedeutungsinhalte<br />
wesentlich. 36<br />
Die Formstrukturen sind für jeden einzelnen Landschaftsteil charakteristisch und bedeutend. Die Landschaft<br />
wird bestimmt von flächigen Ausprägungen (reliefbestimmte Formen: z.B. Hügel; Vegetationsstrukturen<br />
mit flächenhafter Wirkung: z.B. Wald, ggf. im Wechsel mit Grünland- und Ackerflächen), linienhaften<br />
Ausprägungen (z.B. Horizont- und Konturenlinien, Wege/Pfade/Straßen, Schienenwege,<br />
Bach- und Flussläufe), Punktelementen (z.B. Kirchtürme, Aussichtstürme, Felsen) und anderen bedeutsamen<br />
ästhetischen Phänomenen (z.B. Schlossgarten, Parkanlage mit altem Baumbestand).<br />
Die Empfindlichkeit einer Landschaft gegenüber visueller Beeinträchtigung hängt stark von ihrer Einsehbarkeit<br />
ab und kann je nach Ausprägung z.B. von Relief, Strukturiertheit und natürlichen „Sichtschutzelementen“<br />
(z.B. Gehölzbeständen) sehr unterschiedlich sein. Insbesondere in anthropogen stark<br />
genutzten Räumen können Vorbelastungen z.B. in Form von technischen <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
(z.B. Hochspannungsmasten/-freileitungen, Windkraftanlagen, Industrieanlagen, Siloanlagen, Verkehrsinfrastruktur)<br />
vorhanden sein.<br />
Jeder Landschaftsteil ist geprägt durch besondere charakteristische Eigenarten. Im Bereich der Explorationsgebiete<br />
(s. Kapitel 8) handelt es sich um größtenteils ebene Landschaften, die insbesondere<br />
geprägt sind von Siedlungsstrukturen, einem meist relativ hohen Anteil von Einzelgehöften, landwirtschaftlichen<br />
Nutzflächen und mehr oder weniger flächenhaft ausgeprägten Vegetationsstrukturen. Die<br />
sieben Explorationsgebiete liegen in den Naturräumlichen Großregionen Deutschlands (1. Ordnung):<br />
„Norddeutsches Tiefland“ (Teilgebiete 1-6) und „Mittelgebirge“ (Teilgebiet 7). Angaben zu den betreffenden<br />
naturräumlichen Regionen Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens sind in Kapitel 8 enthalten.<br />
Durch die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> inkl. der Erschließungsmaßnahmen können sich Zerschneidungswirkungen<br />
in derzeit wenig zerschnittenen Räumen (z.B. unzerschnittene verkehrsarme Räume) ergeben.<br />
Als unzerschnittene verkehrsarme Räume werden Räume definiert, die nicht durch technogene<br />
Elemente wie: Straßen (mit mehr als 1.000 Kfz / 24h), Schienenwege, schiffbare Kanäle, flächenhafte<br />
Bebauung oder <strong>Betrieb</strong>sflächen mit besonderen Funktionen wie z.B. Verkehrsflugplätze zerschnitten<br />
werden. 37<br />
Der Aspekt der Zerschneidungswirkungen ist zum einem in Bezug auf Einzelbohrplätze (ca. 1 ha zzgl.<br />
Zuwegung), vor allem aber in Bezug auf die Erschließung eines Explorationsgebietes im räumlichen<br />
Zusammenhang zu betrachten (s. Kapitel 8).<br />
36 GASSNER/WINKELBRANDT/BERNOTAT, UVP und strategische Umweltprüfung,<br />
Rechtliche und fachliche Anleitung für die Umweltprüfung, 5. Auflage, C.F. Müller Verlag Heidelberg, 2010<br />
37 www.naturschutzinformationen-nrw.de<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 30 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.1.2 Wirkräume<br />
Wie vorstehend beschrieben, wird die Landschaft mit mehreren Sinnen wahrgenommen/erlebt, so dass<br />
sich der Wirkraum in Bezug auf ein Vorhaben aus wirkfaktorspezifischen Einzel-Wirkräumen zusammensetzt.<br />
Der visuelle Wirkraum ist der Raum, in dem ein Projekt in der Landschaft sichtbar wird. Er definiert sich<br />
durch die Sichtbeziehung zwischen Projekt und Umgebung. Hier ist nicht nur die Sichtbeziehung bei<br />
Tag bedeutend (hier: Sichtbarkeit Anlagenteile/Bohrturm und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen), sondern auch<br />
etwaige Sichtwahrnehmungen bei Nacht (hier: Ausleuchtung des Bohrplatzes). Die visuelle Sichtbarkeit,<br />
sowie etwaig auftretende Störungen (z.B. Lärm; akustischer Wirkraum), nehmen mit zunehmender<br />
Entfernung ab.<br />
Zur Abschätzung der räumlichen Reichweite des visuellen Wirkraumes bei einem ca. 27 bis 39 m hohen<br />
Bohrturm, kann auf einen Erlass aus Mecklenburg-Vorpommern und Einstufungen nach Breuer<br />
(2001) 38 zurückgegriffen werden. Der Bohrturm kann aufgrund seiner schlanken/feingliedrigen Erscheinung<br />
als mastartige Struktur bezeichnet werden.<br />
In Mecklenburg-Vorpommern wurde mit dem Erlass vom 23. September 2003 (Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern<br />
2003, Nr. 44, S. 966) für Antennenträger ein Verfahren eingeführt, das eine gestufte<br />
und recht differenzierte Zuordnung von Wirkradien bzw. Wirkzonen in Abhängigkeit von der Höhe der<br />
Antennenträger vorsieht. Bei einem Antennenträger mit einer Höhe von 40 m wird ein Wirkradius von<br />
590 m ermittelt.<br />
Nach Breuer (2001) kann bei Windkraftanlagen (Mast mit Rotor) ein Wirkzonenradius von der 50-100fachen<br />
Anlagenhöhe angenommen werden, wobei das Landschaftsbild mindestens im Umkreis der 15fachen<br />
Anlagenhöhe als erheblich beeinträchtigt und somit als kompensationspflichtig anzusehen sei,<br />
sofern es sich nicht um sichtverschattete Bereiche oder Bereiche mit sehr geringer Bedeutung oder<br />
Wertigkeit handelt.<br />
Aus den obigen Ausführungen kann ein visueller Wirkraum mit möglicherweise kompensationspflichtigen<br />
Beeinträchtigungen von rd. 400 – 600 m (Bohranlage ca. 27 – 39 m hoch) abgeleitet werden, der<br />
standortspezifisch zu verifizieren und erforderlichenfalls anzupassen ist.<br />
Der akustische Wirkraum ergibt sich zum einen aus den Lärmemissionen im Bereich der Zufahrt sowie<br />
den Lärmemissionen aus den <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten auf dem Bohrplatz. Bezugnehmend auf die Ausführungen<br />
in Kapitel 4.1.4. kann der akustische Wirkraum mit bis zu ca. 500 m (in Abhängigkeit von der<br />
Schallabstrahlung und ohne spezielle Schallminderungsmaßnahmen) angenommen werden.<br />
Der olfaktorische Wirkraum ist hier nicht näher betrachtungsrelevant, da mit den <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten auf<br />
dem Bohrplatz voraussichtlich keine relevanten Geruchsfreisetzungen/-wahrnehmungen verbunden<br />
sind (s. Kapitel 4.1.8).<br />
5.1.3 Beziehungen Vorhaben - Landschaft<br />
Die Errichtung von Anlagenteilen / <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen mit der Bohranlage sind bei der Exploration/Feldesentwicklung<br />
der unkonventionellen Erdgasgewinnung vorhabensbedingt und unvermeidbar.<br />
Inwieweit sich daraus Störwirkungen auf die Landschaft bzw. das Landschaftsbild ergeben, ist von den<br />
konkreten standörtlichen Gegebenheiten abhängig. Ausschlaggebende Faktoren sind insbesondere der<br />
38 Breuer, W. (2001): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes - Vorschläge für Maßnahmen<br />
bei Errichtung von Windkraftanlagen. - Naturschutz und Landschaftsplanung, 33 (8): 237-245.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 31 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Blickpunkt des Betrachters, die Entfernung/Nähe zum Standort, das Geländerelief und die Landschaftsstruktur/-ausprägungen<br />
im Umfeld des Standortes.<br />
Je geringer der Abstand zwischen dem Vorhabensstandort und dem Betrachter, desto deutlicher treten<br />
Landschaftsbild prägende Vorhabens-Elemente hervor. Je nach Position des Betrachters verändert sich<br />
der Blickwinkel und damit die Wahrnehmbarkeit. Dies gilt sowohl bezugnehmend auf die Entfernung als<br />
auch auf die Höhenlage des Betrachters bzw. des Vorhabens.<br />
Landschaftsprägende Strukturen, wie beispielsweise Wald, Feldgehölze oder Streuobstwiesen beeinflussen<br />
ebenfalls die Wahrnehmung seitens des Betrachters. Befinden sich Bohranlage und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
im optisch direkten Zusammenhang mit einem Wald (angenommen Baumhöhe ca. 20-<br />
25 m), treten sie anders – nämlich im Regelfall abgeschwächter - hervor, als wenn sie auf offener Fläche<br />
innerhalb ackerbaulich bewirtschafteter Flächen errichtet werden.<br />
Innerhalb des zusammenhängenden Waldes kann ein Bohrplatz durch die Einschnitt- und Lichtungssituation<br />
im Nahbereich wahrgenommen werden. Vor allem dem Erholungssuchenden fällt der Eingriff in<br />
den Wald mehr oder minder deutlich auf beim Joggen, Spazieren, Wandern usw..<br />
So können vorhandene Landschaftselemente die Wahrnehmung schmälern oder verstärken. Dies<br />
hängt im Besonderen von der Höhe der Landschaftselemente, der Position des Betrachtenden und der<br />
Positionierung des Bohrplatzes in Bezug zu den Landschaftselementen ab.<br />
Weiterhin sind Wechselwirkungen mit anderen landschaftsbildprägenden Elementen von Bedeutung.<br />
Dies betrifft zum einen strukturbildende Elemente (z.B. Kirchtürme) als auch etwaige Vorbelastungen<br />
durch technische Einrichtungen (z.B. Hochspannungsmasten). Im Allgemeinen dürfte - zumindest unter<br />
raumstrukturellen Aspekten und vorbehaltlich der Prüfung im Einzelfall - eine Bündelung von technischen<br />
Einrichtung gegenüber einer räumlich gestreuteren Verteilung bevorzugt werden.<br />
Der Bohrzeitraum (Exploration und Feldesentwicklung; Bohrturm) dauert bis zu rd. 2 Jahre. Der Regelbetrieb<br />
der Erdgasförderung kann bis zu 30 Jahren andauern; hier sind dann jedoch keine hohen Einrichtungen/Anlagenteile<br />
mehr vorhanden (Höhe bis zu ca. 2,5 m; zudem Lichtmasten).<br />
5.1.4 Wirkfaktoren/Wirkungsbeziehungen und Konfliktpotenziale<br />
5.1.4.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Modellhafte Darstellung Bohrplatz während der<br />
Bohrphase [19]<br />
�� Phase I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Für den Bau des Bohrplatzes werden ca. 1 ha zeitlich begrenzt<br />
(Nutzungsdauer/Regelbetrieb: ca. 15 - 30 Jahre)<br />
beansprucht. Zusätzlich werden innerhalb der Phase I ca.<br />
1.000 - 2.000 m² als zusätzliche Lager-/Stellplätze und für<br />
die Zuwegungen (siehe Kapitel 2.2.1) benötigt.<br />
Durch die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> können je nach den<br />
konkreten standörtlichen Verhältnissen landschaftsbildprägende<br />
Strukturen, Elemente, Vegetation und Arteninventare<br />
für den Nutzungszeitraum verloren gehen oder es können<br />
ggf. kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile beeinträchtigt<br />
werden.<br />
Des Weiteren ist es möglich, dass die landschaftsgebundene<br />
Erholung durch die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> beeinträchtigt<br />
wird. Wegebeziehungen können zerschnitten/beeinträchtigt<br />
werden oder müssen ggf. verlegt werden.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 32 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Die Standortvorauswahl ist durch die unterirdischen Gegebenheiten und die Lage der Lagerstätten bestimmt.<br />
Diese sollte im Rahmen der betriebstechnischen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der<br />
standörtlichen Verhältnisse optimiert werden.<br />
�� Phase II Regelbetrieb<br />
Modellhafte Darstellung eines Bohrplatzes im<br />
Regelbetrieb – mit Eingrünung [20]<br />
Veränderung des Erscheinungsbildes<br />
3D Modell Bohranlage und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen,<br />
schematische Darstellung [21]<br />
Während des Regelbetriebes bleibt die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
durch den Bohrplatz bestehen. Die Wirkungsbeziehungen<br />
ändern sich gegenüber der Phase I<br />
nicht.<br />
�� Phase I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Durch die temporäre Errichtung von Anlagenteilen und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
(s. Kapitel 4.1.2) kann das Erscheinungsbild<br />
der Landschaft verändert werden. Hier ist<br />
im Besonderen der ca. 27 – 39 m hohe Bohrturm zu erwähnen.<br />
Der visuelle Wirkraum kann mit rd. 400 - 600 m<br />
abgeschätzt werden (Herleitung: s. Kapitel 5.1.2).<br />
Bei der Bohranlage handelt es sich nicht um ein massives<br />
Bauwerk mit großem umbauten Raum (wie z.B. ein Kraftwerksgebäude).<br />
Der Bohrturm hat vielmehr eine schmale,<br />
mastartige Form, und ist - vergleichbar dem Aufbau eines<br />
Hochspannungsmastes - aus verschiedenen Einzelelementen<br />
aufgebaut, die je nach Blickrichtung auch einen<br />
Durchblick zum Horizont ermöglichen.<br />
Bei der Betrachtung der Wirkungszusammenhänge, die sich bei der Errichtung von Anlagenteilen und<br />
<strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen ergeben, sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen 39 :<br />
- technische Überfremdung der Kulturlandschaft<br />
- Eigenart- und Vielfaltverluste der kulturhistorisch geprägten Landschaft<br />
- Beeinträchtigung der Schönheit der Landschaft<br />
- Veränderung der Horizontlinie<br />
- Belastung des Blickfeldes/der Weitsicht<br />
- Veränderung der Landschaftsproportionen (Maßstabsverluste)<br />
39 NOHL, WERNER, „Ist das Landschaftsbild messbar und bewertbar? – Bestandsaufnahme und Ausblick, Institut für Landschafts-<br />
entwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN) an der Universität für Bodenkultur in Wien am 25. Februar 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 33 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Beispiel technische Überfremdung der<br />
Landschaft – Windkraftanlagen [22]<br />
Beispielhafter Ausschnitt Kulturlandschaft im Bereich<br />
der Explorationsgebiete [23]<br />
Technische Überfremdung<br />
Die Errichtung von baulichen Anlagen/Einrichtungen kann<br />
insbesondere bei massiver Ausprägung (z.B. Kraftwerkskomplex)<br />
oder bei einer Vielzahl von Objekten (z.B. Windkraftanlagen)<br />
zu einer technischen Überfremdung einer<br />
Landschaft führen. Insbesondere naturnahe Landschaften<br />
weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einer technischen<br />
Überfremdung auf. 40<br />
Bei der hier betrachtungsrelevanten Bohranlage handelt es<br />
sich um ein technisches Einzel-Element, dessen bautechnische<br />
Ausführung (auf ca. 27 - 39 m begrenzte Höhe,<br />
schlanke/filigrane Form) im Vergleich zu den vorgenannten<br />
technischen Anlagen deutlich weniger augenfällig/wahrnehmbar<br />
ist. Beeinträchtigungen einer Landschaft<br />
durch den Bohrturm sind in Abhängigkeit der Standortsituation<br />
möglich (s.u.). Eine technische Überfremdung<br />
durch den Einzelbohrturm ist anlagenbedingt nicht zu besorgen.<br />
Eigenart- und Vielfaltverlust der kulturhistorisch geprägten<br />
Landschaft<br />
Durch die Errichtung von Anlagenteilen und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
kann es zu Beeinträchtigungen des typischen,<br />
naturräumlichen und kulturräumlichen Landschaftscharakters<br />
kommen. Anlagenteile können den Landschaftscharakter<br />
stören oder negativ beeinflussen. Bei<br />
einer Bohrplatzgröße von ca. 1 ha und einer temporären<br />
Errichtung von Anlagenteilen (ca. 27 - 39 m) ist von einer<br />
begrenzten Störwirkung auszugehen, die als Beeinträchtigung<br />
und weniger als Eigenarts- und Vielfaltsverlust zu<br />
werten ist. 41<br />
Beeinträchtigung der Schönheit der Landschaft<br />
Die Schönheit der Landschaft ist zunächst ein subjektiver Begriff. Mögliche Wirkungsbeziehungen sind<br />
hier vor allem die Zerstörung von Harmonien und die Verfremdung der Landschaft. Durch die Veränderung<br />
des Erscheinungsbildes der Landschaft kann je nach Wahrnehmung des Betrachters ein „Stilbruch“<br />
entstehen, der als beeinträchtigend wahrgenommen wird. 42<br />
Veränderung der Horizontlinie<br />
Besonders durch die Errichtung von höheren Anlagenteilen, die ggf. gruppenartig angeordnet sind (z.B.<br />
Windparks), kann eine Veränderung der Horizontlinie - eine sogenannte „Horizontverschmutzung“ entstehen.<br />
Auf diese Weise kann das landschaftsästhetisch wirksame Erlebnis einer ungestörten horizontalen<br />
Schichtung von Himmel und Erde „kontaminiert“ werden. 43<br />
40 Nohl, 2010<br />
41 NOHL 2010<br />
42 NOHL 2010<br />
43 NOHL 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 34 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Durch die Errichtung eines ca. 27 - 39 m hohen schlanken/filigranen Einzel-Bohrturms kann es je nach<br />
Betrachtungsstandort bzw. Landschafts-Hintergrund kleinräumig zu einer Veränderung der Horizontlinie<br />
kommen. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Bohrturm-Silhouette gegenüber dem Horizont abgrenzt.<br />
Aufgrund der baulichen Ausführung des Bohrturmes wie vorstehend beschrieben (schlanker/filigraner<br />
Einzel-Bohrturm) kann grundsätzlich nicht von einer „Horizontverschmutzung“ ausgegangen werden.<br />
Soweit der Landschafts-Hintergrund durch Waldflächen oder hügelige Landschaft geprägt ist, ergibt<br />
sich möglicherweise nur eine verminderte oder gar keine Auswirkung auf die Horizontlinie.<br />
Höhenvergleich technische Anlagen in der Landschaft [24]<br />
Belastung des Blickfeldes/der Weitsicht<br />
Die Belastung der Weitsicht ist vorrangig bei hohen und massiven Anlagenteilen (wie z.B. Windkraftanlagen,<br />
Industrieanlagen) bedeutsam. Sichtbeziehungen können durch Bauwerke/Anlagenteile in Abhängigkeit<br />
des Betrachterstandortes, der Lage des Bauwerkes/Anlagenteils und der Blickrichtung auch<br />
bei weniger hohen Objekten beeinträchtigt oder ggf. ganz versperrt werden. 44<br />
Erhebliche Belastungen des Blickfeldes bzw. der Weitsicht sind aufgrund der baulichen Ausführung des<br />
Bohrturmes wie bereits vorstehend beschrieben im Regelfall nicht zu besorgen.<br />
Veränderung der Landschaftsproportionen<br />
Veränderungen der Landschaftsproportionen (sog. Maßstabsverluste) treten dann auf, wenn im Verhältnis<br />
zu anderen landschaftsbildenden Elementen besonders hervortretende Anlagen errichtet werden<br />
(z.B. Windkraftanlagen, Höhen bis ca. 150 m). Dann kann das ästhetische Höhenverhältnis der<br />
Landschaft, das z.B. durch Kirchtürme oder Solitär-Bäume (Höhen von meist ca. 20-30 m) bestimmt<br />
wird, außer Kraft gesetzt werden. Bei der Bohrturmhöhe von ca. 27 - 39 m sind im Regelfall keine Maßstabsverluste<br />
zu erwarten. 45<br />
44 NOHL 2010<br />
45 NOHL 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 35 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc<br />
39 m<br />
27 m
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Modellhafte Darstellung Clusterplatz im Regelbetrieb<br />
[25]<br />
Modellhafte Darstellung Clusterplatz im Regelbetrieb<br />
[26]<br />
�� Phase II Regelbetrieb<br />
Für den Regelbetrieb werden die für die Erkundung und<br />
Feldesentwicklung benötigten Anlagenteile (Bohrturm und<br />
<strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen) zurück gebaut und die für den<br />
Regelbetrieb erforderlichen technischen Einrichtungen installiert<br />
(Höhe bis zu ca. 2,5 m).<br />
Mit Eingrünungsmaßnahmen kann eine Einbindung des<br />
Bohrplatz-Standortes in die Landschaft erreicht werden<br />
(s. Kapitel 7).<br />
Modellhafte Darstellung Clusterplatz im Regelbetrieb –<br />
in räumlichem Bezug zu einem Siedlungsrand [27]<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 36 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.1.4.3 Fahrbewegungen<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Die Phasen der Exploration und der Feldesentwicklung zeichnen sich durch erhöhte <strong>Betrieb</strong>tätigkeiten<br />
und Fahrverkehre aus. Die Fahrgeschwindigkeit ist auf dem <strong>Betrieb</strong>gelände und der Zufahrt zum Bohrplatz<br />
begrenzt. Fahrverkehre erfolgen im Regelfall nur werktags.<br />
Inwieweit die Fahrbewegungen ggf. als Störung in der Landschaft wahrgenommen werden, hängt insbesondere<br />
von den standörtlichen Gegebenheiten (z.B. Vorbelastungen durch Fahrverkehr auf angrenzenden<br />
Straßen) ab. Soweit die Zufahrt von Wegebeziehungen gequert werden sollte, die von Erholungssuchenden<br />
genutzt werden, sind Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion nicht grundsätzlich<br />
auszuschließen.<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Während des Regelbetriebes sind Fahrverkehre auf Einzelfälle beschränkt.<br />
5.1.4.4 Lärm<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Lärmemissionen sind mit den Fahrverkehren (Zufahrt, Bohrplatz; werktags) und den <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten<br />
auf dem Bohrplatz (Bohren: 24 h/d an 7 Tage/Woche, Fracking etc.) verbunden.<br />
Verlärmung der Landschaft / Beeinträchtigung der Erlebbarkeit landschaftstypischer Geräusche<br />
Durch Lärmimmissionen kann jene landschaftliche Stille verloren gehen, die notwendig ist, um die<br />
Landschaft in ihrer Eigenart und Ursprünglichkeit ganzheitlich zu erleben. Landschaftstypische Geräusche<br />
wie z.B. Blätterrauschen, Bachplättschern, Vogelzwitschern, Tierlaute (z.B. Heuschreckenzirpen)<br />
können in ihrer Wahrnehmbarkeit beeinträchtigt bzw. überlagert werden, wodurch sich ggf. auch Auswirkungen<br />
auf die landschaftsgebundene Erholung ergeben können. 46,47<br />
Bei schalltechnischen Untersuchungen zur Erstellung des Rahmenbetriebsplanes Bötersen Z 11 wurde<br />
eine Minderung auf einen Schalleistungspegel von 60 dB(A) in einer Entfernung von ca. 50-100 m und<br />
eine Minderung auf 45 dB(A) in ca. 175 - 500 m Entfernung erreicht. Die 45 dB(A)-Isophone kann als<br />
Abgrenzung des Bereiches angesetzt werden, bis zu dem Beeinträchtigungen der landschaftsgebundene<br />
Erholung möglich sind 48 .<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Mit dem Regelbetrieb sind keine betrachtungsrelevanten Lärmemissionen verbunden.<br />
46 KÖHLER, BABETTE, PREIß, ANKE, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Erfassung und Bewertung des<br />
Landschaftsbildes, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2000<br />
47 NOHL 2010<br />
48 GASSNER/WINKELBRANDT/BERNOTAT 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 37 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.1.4.5 Licht<br />
Exemplarische Bohrplatzausleuchtung [28]<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Während der Explorationsphase und der Feldesentwicklung<br />
werden die Bohrvorgänge zur Tag- und Nachtzeit<br />
durchgeführt. Dies bedingt eine nächtliche Beleuchtung<br />
der Anlage.<br />
Durch die Beleuchtung kann eine Störung der „Nachtlandschaft“<br />
hervor gerufen werden. Die Wahrnehmbarkeit von<br />
Naturphänomenen (z.B. sternklarer Nachthimmel, Mondnacht)<br />
kann beeinflusst werden.<br />
Durch gezielte Minderungsmaßnahmen (Ausrichtung der Lichtquellen, näheres siehe Kapitel 7) kann<br />
der Einwirkbereich des Lichtkegels verringert werden.<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Während des Regelbetriebs wird der Bohrplatz aus sicherheitstechnischen Gründen in geringem Umfang<br />
beleuchtet. Eine Arbeitsplatzausleuchtung ist nur im Einzelfall (z.B. bei nächtlichen<br />
Reparaturarbeiten) erforderlich.<br />
Zusammenfassende tabellarische Darstellung der Wirkungsbeziehungen - Landschaft<br />
Wirkfaktoren Wirkungsbeziehungen - Potenzielle Beeinträchtigungen / Konfliktpotenziale<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Veränderung<br />
des Erscheinungsbildes<br />
Fahrbe-<br />
wegungen<br />
PHASE I: Exploration/Feldesentwicklung<br />
Mit der anlagenbedingt unvermeidbaren <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> von ca. 1 ha können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/ Konflikte verbunden sein:<br />
- Verlust/Beeinträchtigung landschaftsbildprägender Strukturen, Elemente, Vegetation und Arteninventare<br />
- Verlust/Beeinträchtigung kulturhistorisch bedeutsamer Landschaftsteile/-elemente<br />
- Verlust von Flächen für die landschaftsgebundene Erholung<br />
- Zerschneidung von Wegebeziehungen<br />
Im Rahmen der konkreten Standortfestlegung sollten Verminderung- und Vermeidungspotenziale<br />
unter Berücksichtigung der betriebstechnischen Erfordernissen geprüft werden.<br />
Mit der temporären Errichtung einer Bohranlage und von <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/Konflikte verbunden sein:<br />
- Eigenarts- und Vielfaltsverluste der kulturhistorisch geprägten Landschaft<br />
- Beeinträchtigung der Schönheit der Landschaft<br />
- Veränderung der Horizontlinie (Zerstörung und Beeinträchtigung von charakteristischen Silhouetten)<br />
- Belastung des Blickfeldes/der Weitsicht (Beeinträchtigung von Blickbeziehungen/Sichtachsen)<br />
Begrenzte Störwirkung aufgrund der schlanken/filigranen, mastartigen Bohrturmausführung mit<br />
einer Höhe von ca. 27-39 m; Wirkungsbereich: bis zu rd. 400-600 m; Prüfung/Umsetzung von Eingrünungsmaßnahmen<br />
Mit den temporären LKW-Verkehren können insbesondere folgende Beeinträchtigungen verbunden<br />
sein:<br />
- Visuelle Störungen durch Fahrbewegungen<br />
- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch den Fahrverkehr (z.B. bei Querung von Wegen)<br />
Eher geringeres Konfliktpotenzial aufgrund der vergleichsweise geringen Fahrbewegungen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 38 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Lärm<br />
Licht<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Veränderung<br />
des Erscheinungsbildes<br />
Mit den temporären Schalleinwirkungen durch LKW-Verkehre/<strong>Betrieb</strong>stätigkeiten können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale verbunden sein:<br />
- Verlärmung der Landschaft („Verlust der Stille“)<br />
- Beeinträchtigung der Erlebbarkeit landschaftstypischer Geräusche (z.B. Blätterrauschen, Wasserplätschern,<br />
Vogelzwitschern etc.)<br />
Räumlicher Wirkungsbereich: bis zu rd. 500 m; im Einzelfall: Prüfung von Schallminderungsmaßnahmen<br />
Mit temporären Lichtemissionen während der Bohrung können insbesondere folgende Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale<br />
verbunden sein:<br />
- Störung der „Nachtlandschaft“ (Beeinträchtigung der Wahrnehmbarkeit von Naturphänomenen, wie<br />
z.B. eine wolkenlose sternklare Nacht, eine Mondnacht usw.)<br />
Durch Minderungsmaßnahmen kann der Einwirkbereich verringert werden.<br />
PHASE II: Regelbetrieb<br />
unverändert PHASE I; s.o.<br />
Im Regelbetrieb verbleiben wenige <strong>oberirdische</strong> technische Einrichtungen (Höhe < ca. 2,5 m),<br />
sodass bei Umsetzung von Eingrünungsmaßnahmen Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale<br />
weitgehend vermindert werden können.<br />
5.1.5 Zusammenfassung / Bewertungsmaßstäbe<br />
Mögliche Beeinträchtigungen der Landschaft und des Landschaftsbildes sind vorrangig in der zeitlich<br />
begrenzten Phase der Exploration und der Feldesentwicklung durch die Aufstellung der bis zu ca. 27 -<br />
39 m hohen Bohreinrichtungen betrachtungsrelevant. Im Regelbetrieb ist die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
unter landschaftlichen Aspekten von primärer Bedeutung, da nur wenige, jeweils niedrige technische<br />
Einrichtungen verbleiben.<br />
In folgenden Genehmigungsverfahren ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) der relevante Bewertungsmaßstab<br />
für die Beurteilung von Eingriffen in die Landschaft bzw. das Landschaftsbild. Nach<br />
den in § 1 des BNatSchG genannten Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Natur<br />
und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des<br />
Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich u.a. so zu schützen, dass die Vielfalt, Eigenart<br />
und Schönheit von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Weitere landschafts-/freiraumbezogene<br />
Ziele sind in § 1 Abs. 4, 5 und 6 BNatSchG enthalten.<br />
Dem BNatSchG nachrangig sind zudem sind die Maßgaben des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes<br />
zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und in Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Sicherung<br />
des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) zu beachten sowie<br />
etwaige untergesetzliche Regelungen zur Umsetzung/Ausführung.<br />
Mit einem gezielten, den standörtlichen Gegebenheiten angepassten Eingrünungskonzept (z.B. in Form<br />
eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes - LBP) können insbesondere für die weniger hohen technischen<br />
Einrichtungen - in Abhängigkeit der Sichtbeziehungen/Blickpositionen aber ggf. auch in Bezug<br />
auf den Bohrturm - wirksame Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden (weitere Angaben zu Eingrünungskonzept<br />
– Kompensation: s. Kapitel 7).<br />
Nach Abschluss des Regelbetriebes wird der Bohrplatz mit den noch vorhandenen Einrichtungen rückgebaut,<br />
so dass die Fläche dann wieder in den Voreingriffszustand zurückgeführt wird bzw. alternativ<br />
eine gewünschte landschaftliche Neugestaltung umgesetzt werden kann.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 39 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.2 Mensch inkl. siedlungsnaher Erholung<br />
5.2.1 Aspekte<br />
Beim Schutzgut Mensch können allgemein die Aspekte von „Gesundheit und Wohlbefinden“, der<br />
„Wohn- und Wohnumfeldfunktion“ und der Erholungs- und Freizeitfunktion“ unterschieden werden.<br />
Die gesundheitlichen Aspekte sind hier in Bezug auf die Immissionen (vorrangig Schall, Luftschadstoffe)<br />
betrachtungsrelevant. Umweltmedizinische/-toxikologische Belange fallen nicht unter den hier behandelten<br />
Themenkreis Landschaft. Störungen des Wohlbefindens können sich z.B. durch visuelle Störungen<br />
ergeben.<br />
Das Wohn-/Wohnumfeld ist von Bedeutung, da Menschen hier ihren Lebensmittelpunkt haben und<br />
einen Großteil ihrer Freizeit sowie ihrer Arbeitszeit dort verbringen. Ein intaktes Wohn- und Wohnumfeld<br />
ist für das Wohlbefinden des Menschen von zentraler Bedeutung.<br />
Die Erholungs- und Freizeitfunktion ist in Ergänzung zu den Wohnumfeldfunktionen für das Wohlbefinden,<br />
die Rekreation und die Gesundheit des Menschen ebenfalls von nachgewiesener Weise hoher<br />
Bedeutung 49 .<br />
Nachfolgend werden die sich aus der Projektwirkungen (s. Kapitel 4) ableitenden Wirkungszusammenhänge<br />
erläutert.<br />
5.2.2 Wirkfaktoren/Wirkungsbeziehungen und Konfliktpotenziale<br />
5.2.2.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Beispielhaftes Foto eines Bohrplatzes während<br />
der Bohrphase [29]<br />
49 GASSNER/WINKELBRANDT/BERNOTAT 2010<br />
50 ExxonMobil 2012<br />
Siedlungsflächen werden nicht als Explorationsflächen/Bohrplätze<br />
genutzt und sind somit nicht von einer<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong> betroffen. Unter Siedlungsflächen<br />
werden zum einen planerisch ausgewiesene Siedlungsflächen/-bereiche<br />
- Bestand und Planung (Regionalplanung,<br />
Bauleitplanung) verstanden, zum anderen Einzelgehöfte<br />
und Einzelanwesen. Siedlungsflächen können<br />
nach dem Zweck bzw. der Art ihrer baulichen Nutzung<br />
(Bauflächen) untergliedert werden: z.B. reine Wohngebiete,<br />
allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete,<br />
Gewerbegebiete etc..<br />
Zu Siedlungsflächen sollen unter sicherheitstechnischen<br />
Aspekten - vorbehaltlich der Einhaltung der maßgebenden<br />
Immissionswerte - grundsätzlich Mindestabstände von 200<br />
m eingehalten werden, zu Einzelbebauungen/-gehöften<br />
mindestens 100 m. 50<br />
Aufgrund der möglichen Nähe von Siedlungsflächen/-einheiten<br />
und Bohrplätzen können sich durch die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
ggf. Konfliktpotenziale mit den Belangen<br />
der siedlungsnahen Erholung (Teilanspruchnahe von Flä-<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 40 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.2.2.2 Visuelle Störwirkungen<br />
Modellhafte Darstellung Bohrplatz/Bohranlage,<br />
mit Verkehrsinfrastruktur / Zufahrt [30]<br />
Exemplarisches Luftbild:<br />
Bohrplatz während der Bohrphase [31]<br />
chen mit Erholungsfunktionen, im Einzelfall ggf. Beeinträchtigung<br />
von Wegebeziehungen) ergeben.<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Soweit der Bohrplatz von Siedlungsflächen oder von Flächen<br />
für die siedlungsnahe Erholung aus eingesehen werden<br />
kann, können die Anlagenteile/<strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
- insbesondere der im Arbeitsbetrieb ca. 27 – 39 m<br />
hohe Bohrturm - sowie evtl. auch die Fahrbewegungen von<br />
den Anwohner ggf. als optisch störend wahrgenommen<br />
werden. Der Grad etwaiger Störwirkung ist u.a. abhängig<br />
von der Entfernung zum Bohrplatz, dem konkreten Blickpunkt<br />
des Betrachters (z.B. Höhenlage, Geschosshöhe),<br />
dem Umfang der Einsehbarkeit und der landschaftlichen<br />
Struktur der wahrgenommenen Sichträume (im Weiteren s.<br />
auch Kapitel 5.1 Landschaft). Durch Vermeidungs- und<br />
Minimierungsmaßnahmen (Eingrünungskonzept) lässt sich<br />
die Einsehbarkeit und damit die visuelle Störwirkung verringern<br />
(näheres s. Kapitel 7).<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Die im Regelbetrieb vor Ort verbleibenden technischen Einrichtungen (E-Kreuze Bohrungen, Wasserabscheideanlage,<br />
Umzäunung) haben mit bis zu 2,5 m eine geringe Höhe. Die einzelnen Lichtmasten<br />
stellen keine markanten Störelemente dar.<br />
Durch die geringe Höhe der Einrichtungen kann eine wirksame Eingrünung erfolgen (s. Kapitel 7).<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 41 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.2.2.3 Lärm<br />
Exemplarisches Foto: Bohranlage/Bohrplatz mit<br />
Lärmschutzwand [32]<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Betrachtungsrelevant ist, inwieweit sich durch die Lärmemissionen/-immissionen<br />
aus den <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten auf<br />
dem Bohrplatzgelände (Fahrverkehre, Absetzen/Aufnehmen<br />
von Containern, Bohr-/Pumpvorgänge etc.) und den<br />
Fahrverkehren auf der Zufahrt Störwirkungen/Beeinträchtigungen<br />
für die Anwohner/Nachbarn ergeben können.<br />
Die Zufahrt zum Bohrplatz kann i.d.R. so gestaltet werden,<br />
dass möglichst wenige bzw. keine Siedlungsflächen durchfahren<br />
werden. Die <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten auf dem Bohrplatzgelände<br />
erfolgenden weitgehend stationär; hier können<br />
emissionsquellenbezogene Minderungsmaßnahmen umgesetzt<br />
werden (z.B. Schallschutzwand, im Weiteren s.<br />
Kapitel 7).<br />
Wie in Kapitel 4.1.4 erläutert, ist davon auszugehen, dass – vorbehaltlich der Umsetzung spezieller<br />
Schallschutzmaßnahmen – die vom Bohrplatz ausgehenden Schallimmissionen bis in eine Entfernung<br />
von ca. 50-100 m von der Schallquelle (Bohranlage) der Schallleistungspegel auf 60 dB(A) abnimmt.<br />
Die Minderung auf einen Schalleistungspegel von 45 dB(A) wird in ca. 175 - 500 m Entfernung erreicht.<br />
Arbeiten im Rahmen der Aufsuchung, Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen fallen ausdrücklich<br />
nicht in den Anwendungsbereich der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen<br />
Baulärm (AVV Baulärm). Maßgebende Bewertungsgrundlage für anlagenbezogene Schallimmissionen<br />
ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm.<br />
In der TA Lärm sind Immissionsrichtwerte für unterschiedliche bauliche Gebietswidmungen (Art der<br />
baulichen Nutzung) benannt, die im Zusammenwirken mit etwaigen Geräuscheinwirkungen anderer Anlagen<br />
einzuhalten sind. Bei den Immissionsrichtwerten wird nach der Tagzeit (6.00 – 22.00 Uhr) und der<br />
Nachtzeit (22.00 – 6.00 Uhr) unterschieden. Für ein allgemeines Wohngebiet wären z.B. folgende Immissionsrichtwerte<br />
einzuhalten: tags: 55 dB(A) / nachts: 40 dB(A).<br />
Durch die Lage und Entfernung des Bohrplatzes zu den nächstgelegenen Siedlungsflächen bzw. ergänzende<br />
Schallschutzmaßnahmen (z.B. mobile Schallschutzwände) ist sicherzustellen, dass die jeweils<br />
zutreffenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden.<br />
Soweit Flächen im Umfeld des Bohrplatzes für ruhebezogene siedlungsnahe Erholungsaktivitäten (Joggen,<br />
Spazieren gehen, Radfahren etc.) genutzt werden, können sich ggf. die vom Bohrplatz ausgehenden<br />
Schallimmissionen störend auswirken (s. auch Kapitel 5.1 Landschaft).<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Vom Regelbetrieb gehen keine betrachtungsrelevanten Lärmwirkungen aus.<br />
5.2.2.4 Erschütterungen<br />
Wie in Kapitel 4.1.7 erläutert, werden die Beurteilungsmaßstäbe der DIN 4150 „Erschütterungen im<br />
Bauwesen“ im Bereich der Siedlungsflächen eingehalten.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 42 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.2.2.5 Licht<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Die Bohrtätigkeiten werden sowohl zur Tag- als auch zur Nachzeit durchgeführt, so dass sich in Abhängigkeit<br />
der Jahreszeiten unterschiedlich lange nächtliche Zeiten der Bohrplatz-Beleuchtung ergeben.<br />
Wie in Kapitel 5.2.2.1 erläutert, wird im Regelfall ein Abstand von mindestens 200 m zu Siedlungsflächen<br />
eingehalten. Berücksichtigt man weiterhin, dass durch eine gezielte, den örtlichen Rahmenbedingungen<br />
angepasste Beleuchtung erfolgt, kann davon ausgegangen werden, dass keine schädlichen<br />
Umwelteinwirkungen durch Lichtimmissionen im Sinne der Licht-Richtlinie des Länderausschusses für<br />
Immissionsschutz (LAI, 1994: Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen) im Bereich von Siedlungsflächen<br />
zu besorgen sind.<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist im Regelbetrieb eine nächtliche Beleuchtung in geringem/üblichen<br />
Umfang (keine Arbeitsplatzausleuchtung) erforderlich.<br />
5.2.2.6 Luftschadstoffe/Gerüche<br />
Staub-/Geruchsfreisetzungen sind bei den Bau-/<strong>Betrieb</strong>stätigkeiten nach derzeitigem Kenntnistand von<br />
untergeordneter Bedeutung (s. Kapitel 4.1.8).<br />
Weitere Untersuchungsbedarf besteht hier noch bzgl. der Abgasemissionen beim <strong>Betrieb</strong> von Dieselmotoraggregaten<br />
(s. Kapitel 4.1.11).<br />
Zusammenfassende tabellarische Darstellung der Wirkungsbeziehungen - Mensch<br />
Wirkfaktoren<br />
PHASE I: Exploration/Feldesentwicklung<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Visuelle<br />
Störwirkungen<br />
Lärm<br />
Licht<br />
Wirkungsbeziehungen - Potenzielle Beeinträchtigungen / Konfliktpotenziale<br />
Mit der anlagenbedingt unvermeidbaren <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> von ca. 1 ha können<br />
insbesondere folgende Beeinträchtigungen/Konflikte verbunden sein:<br />
- Verlust/Beeinträchtigung von Flächen mit Bedeutung für die siedlungsnahe Erholung<br />
Prüfung/Umsetzung Verminderungs- und Vermeidungspotenziale im örtlichen Bezug<br />
Mit der Errichtung von Anlagenteilen und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/Konflikte verbunden sein:<br />
- Visuelle Störung des Wohlbefindens durch Anlagenteile und <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen insbesondere<br />
Bohrturm<br />
Begrenzte Störwirkung aufgrund der schlanken/filigranen, mastartigen Bohrturmausführung<br />
mit einer Höhe von ca. 27 - 39 m; Wirkungsbereich: bis zu rd. 400-600 m;<br />
Prüfung/Umsetzung von Eingrünungsmaßnahmen<br />
Mit der temporären Schalleinwirkung durch LKW-Verkehre/<strong>Betrieb</strong>stätigkeiten können<br />
insbesondere folgende Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale verbunden sein:<br />
- Störwirkung auf Anwohner/Nachbarn<br />
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche/Lärm durch Einhaltung<br />
der Anforderungen der TA Lärm<br />
Mit temporären Lichtemissionen während der Bohrung können insbesondere folgende<br />
Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale verbunden sein:<br />
- Störwirkungen durch Lichtimmissionen<br />
Möglichkeit der Verminderung des Einwirkungsbereiches durch optimiertes Ausleuchtungskonzept<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 43 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Luftschadstoffe<br />
PHASE II: Regelbetrieb<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Visuelle Störwirkungen<br />
Betrachtungsrelevant sind vorrangig Abgasemissionen beim <strong>Betrieb</strong> von Dieselaggregaten.<br />
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Einhaltung der Immissionswerte<br />
der TA Luft.<br />
unverändert PHASE I; s.o.<br />
Im Regelbetrieb verbleiben wenige <strong>oberirdische</strong> technische Einrichtungen (Höhe<br />
< ca. 2,5 m), sodass bei Umsetzung von Eingrünungsmaßnahmen Beeinträchtigungen/Konflikt-potenziale<br />
weitgehend vermindert werden können.<br />
5.2.3 Hinweise zur Bewertung<br />
Zur Beurteilung von Umwelteinwirkungen durch Lärm und Luftschadstoffe liegen mit der sechsten allgemeinen<br />
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum<br />
Schutz gegen Lärm – TA Lärm), der ersten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) und der neununddreißigsten<br />
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über<br />
Luftqualitätstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV) auf fachgesetzlicher Grundlage<br />
festgelegte Immissions-/Beurteilungswerte vor.<br />
Die TA Lärm gibt Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden in abhängig der<br />
Gebietswidmungen (z.B. Gewerbegebiet, Mischgebiet, reines Wohngebiet) vor.<br />
In der TA Luft bzw. der 39. BImSchG sind u.a. Immissionswerte (TA Luft) bzw. Immissionsgrenzwerte<br />
und Zielwerte (39. BImSchV) jeweils zum Schutz der menschlichen Gesundheit enthalten.<br />
Der Nachweis der Einhaltung der Immissions-/Beurteilungswerte kann - unter Berücksichtigung emissionsseitiger<br />
Anforderungen (Abgaswerte, ggf. Schallschutzmaßnahmen) - auf Grundlage entsprechender<br />
Ausbreitungsrechnungen/Immissionsprognosen im Zuge erforderlicher Genehmigungsverfahren erbracht<br />
werden.<br />
Die Beurteilung von Lichtimmissionen kann auf Grundlage der Licht-Richtlinie des Länderausschusses<br />
für Immissionsschutz (LAI, 1994) erfolgen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 44 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.3 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt<br />
5.3.1 Aspekte - Funktionen<br />
Pflanzen und Tiere sind biotische Bestandteile des Naturhaushaltes. Tier- und Pflanzenarten leben zusammen<br />
in Biozönosen und bilden gemeinsam mit der anorganisch-physikalischen Umwelt (Boden,<br />
Wasser, Luft etc.) Ökosysteme.<br />
Die Vegetation erfüllt verschiedene ökosystemare und nutzungsbezogene Funktionen innerhalb des<br />
Naturhaushaltes, z.B. Lebensraum- und Nahrungsfunktion für Tierarten, Informationsbereitstellung (z.B.<br />
durch Bioindikatoren), Ästhetik und Erlebbarkeit, Regulation (z.B. Schadstofffilterung, Lärmminderung,<br />
positive Beeinflussung des Klimas, positive Beeinflussung des Wasserhaushaltes etc.).<br />
Tiere sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und der biologischen Vielfalt in ihren Lebensgemeinschaften<br />
und in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre<br />
Lebensstätten und Lebensräume sind zu schützen, zu pflegen und wiederherzustellen. Tiere haben zu<br />
allen Umweltschutzgütern enge Beziehungen, wobei diese Beziehungsstrukturen von Art zu Art sehr<br />
unterschiedlich sind. So sind die Habitatansprüche von Tierarten häufig durch bestimmte abiotische und<br />
biotische Parameter bestimmt. Andererseits sind Tiere aber auch Bestandteil der Bodenlebewelt oder<br />
des Landschaftsbildes. Die ökosystemaren und nutzungsbezogenen Leistungen und Funktionen von<br />
Tieren sind vielfältig und lassen sich unter anderem grob ordnen nach Produktionsleistungen (z.B. die<br />
Umsetzung von organischer Substanz als Konsumenten und Destruenten), Informationsleistungen (z.B.<br />
als Bioindikatoren), Regulationsleistungen und ästhetischen Leistungen. 51<br />
Bestandteile der örtlichen Tier- und Pflanzenwelt können durch verschiedenartige projektbezogene Wirkungen<br />
in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.<br />
5.3.2 Schutzgebietsausweisungen/Biotopverbund<br />
Ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die<br />
Schaffung eines Netzes verbundener Biotope (Biotopverbund) im Zusammenhang mit der überwiegend<br />
flächenbezogenen Gebietsausweisung bestimmter, besonders schützenswürdiger Teile von Natur und<br />
Landschaft (Schutzgebietsausweisungen).<br />
Natura 2000<br />
Auf europäischer Ebene werden die Gebiete zum Schutz der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-<br />
Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG) bzw. der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) unterschieden.<br />
Die wesentlichen Ziele der FFH-Richtlinie können mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt subsumiert<br />
werden (siehe RL 92/43/EWG, Artikel 2). FFH-Gebiete bilden zusammen mit den europäischen Vogelschutzgebieten<br />
das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000.<br />
Für Pläne und Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten ein<br />
Gebiet des NATURA 2000-Netzes erheblich beeinträchtigen können, schreibt Artikel 6 Absatz 3 der<br />
FFH-Richtlinie bzw. § 34 des BNatSchG die Prüfung der Verträglichkeit dieses Projektes oder Planes<br />
mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes vor.<br />
51 GASSNER/WINKELBRANDT/BERNOTAT 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 45 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
BNatSchG - Schutzgebiete nach Abschnitt 1 des BNatSchG<br />
Teile von Natur und Landschaft werden z.B. als Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder<br />
geschützte Landschaftsbestandteile ausgewiesen. Der Schutzgegenstand und die jeweiligen Schutzzwecke<br />
sind in den Schutzgebietsverordnungen beschrieben.<br />
Regionalplanung<br />
Weiterhin werden in den Regionalplänen Flächen/Bereiche zum Schutz von Natur- und Landschaft abgegrenzt.<br />
5.3.3 Wirkfaktoren/Wirkungsbeziehungen und Konfliktpotenziale<br />
5.3.3.1 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Exemplarisches Foto:<br />
Bohrplatz während Bohrphase [33]<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Als <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> werden bis zu ca. 1 ha Fläche<br />
versiegelt; der Umzäunungsbereich mit Nebenflächen/Grünflächen<br />
kann mit bis zu ca. 2 ha abgeschätzt<br />
werden.<br />
Naturschutzrechtliche Regelungen: Siedlungsflächen werden als Bohrplatz-Standorte ausgeschlossen.<br />
Dies bedeutet, dass die Bohrplätze im unbesiedelten Außenbereich liegen, und demzufolge davon<br />
auszugehen ist, dass mit der Errichtung des Bohrplatzes - unabhängig der konkreten Biotopausstattung<br />
- ein Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG verbunden ist. Die Regelungen des<br />
BNatSchG zum Ausgleich/Ersatz (§ 15 BNatSchG) sind demzufolge anzuwenden (näheres zur Kompensation:<br />
s. Kapitel 7).<br />
Ein besonderer/erhöhter Prüfungsbedarf ergibt sich in dem Fall, wenn von der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
naturschutzrechtlich oder raumordnerisch ausgewiesene Schutzgebietsflächen (s. Kapitel 5.3.2)<br />
betroffen sind. Dann ist zu prüfen, inwieweit die Schutzzwecke vom Vorhaben berührt werden können.<br />
Sollte von der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> - oder den in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen vorhabensbedingten<br />
Einwirkungen - ein Natura 2000-Gebiet betroffen sein, ist die Verträglichkeit des Vorhabens<br />
mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Natura 2000-Gebietes zu prüfen (FFH-Erheblichkeits-<br />
/Vorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung). Falls im Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung festgestellt<br />
werden sollte, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die<br />
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, darf ein Projekt nur<br />
dann zugelassen werden, soweit es aus zwingenden Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses,<br />
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen nicht<br />
gegeben sind (§ 34 BNatSchG).<br />
Im Einzelfall sind - je nach Biotopausstattung - ggf. auch artenschutzrechtliche Belange gesondert zu<br />
prüfen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 46 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Flora: Die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> durch Versiegelung führt zu einem vollständigen Verlust der vorhandenen<br />
Biotopstrukturen. Im Regelfall ist vor dem Eingriff eine Bestandsaufnahme durchzuführen,<br />
um festzustellen, welche Biotope/Biotoptypen betroffen sind. Im Anschluss an die Bohrplatznutzung ist<br />
eine dem Standort angemessene Kompensationsplanung durchzuführen (s. Kapitel 7), um die beeinträchtigten<br />
Funktionen des Naturhaushalts in gleichwertiger Weise wiederherzustellen. Erforderlichenfalls<br />
sind zudem o.g. Prüfschritte durchzuführen.<br />
Die Bestandsaufnahme stellt weiterhin sicher, dass besonders geschützte und besonders streng geschützte<br />
Arten erfasst werden, die dem Artenschutz unterliegen. Auf diese Arten muss innerhalb der<br />
Kompensationsplanung gesondert eingegangen werden.<br />
Fauna: Der Verlust der floristischen Biotopstrukturen kann zu einem Lebensraumverlust für die Fauna<br />
führen. Je nach den standörtlichen Gegebenheiten können zudem von der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Zerschneidungswirkungen für Lebensräume/Habitate im Umfeld des Bohrplatzes ausgehen.<br />
Zur Ermittlung, ob besonders geschützte und/oder besonders streng geschützte Tierarten im Plangebiet<br />
und dessen Einwirkbereich vorhanden sind, ist je nach Abhängigkeit der vor Ort vorhandenen Biotopstrukturen,<br />
eine faunistische Kartierung notwendig. Die zu erhebenden Tiergruppen sind in Abhängigkeit<br />
der Biotopausstattung festzulegen. Werden auf dem Standort besonders streng geschützte Tierarten<br />
festgestellt, sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (CEF-Maßnahmen), die<br />
sicherstellen, dass die Population der Tierart in ihrem Bestand und der von ihr besiedelte Lebensraum<br />
nicht geschädigt oder gestört wird und der derzeitige Erhaltungszustand der Art im Naturraum erhalten<br />
bleibt.<br />
Um besonders Brutvögel nicht zu gefährden sind für eventuell anfallende Rodungsarbeiten (Entfernung<br />
Baumbestand/Gehölze) im Rahmen des Bohrplatzbaus die Verbotszeiträume des § 39, Abs. 5 (2)<br />
BNatSchG (1. März bis 30. September) zu beachten.<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Bohrplatz während des Regelbetriebes –<br />
mit Eingrünung (Modellhafte Darstellung) [34]<br />
Während des Regelbetriebes (bis zu ca. 30 Jahre) bleibt<br />
die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> unverändert bestehen.<br />
Nach Beendigung des Regelbetriebes und Rückbau der<br />
Anlage kann die Fläche einer Rekultivierung zugeführt<br />
werden und der Ursprungszustand kann wieder hergestellt<br />
oder ein gewünschter sonstiger Zustand kann neu gestaltet<br />
werden (z.B. bei naturfernen Biotopstrukturen im Voreingriffszustand).<br />
Die Bohrplatzfläche ist dann als Biotopstandort<br />
wieder verfügbar und kann wieder Lebensraumfunktionen<br />
wahrnehmen. Die Zeiträume bis zum Erreichen<br />
des Ursprungszustand sind je nach Biotoptyp sehr unterschiedlich<br />
und reichen von wenigen Monaten (Ruderal-/<br />
Sukzessionsfläche) bis zu über hundert Jahren (Altholzbestand).<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 47 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.3.3.2 Beeinträchtigungen durch Leitungen<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Durch den Bau der Zufahrt und den Umbau des Bohrplatzes für den Regelbetrieb am Ende der Phase I<br />
mit dem Leitungsbau (Gasleitung und Leitung für Lagerstättenwasser/back-flow, Zuführung zu zentralem<br />
<strong>Infrastruktur</strong>platz) können insbesondere baubedingt temporäre Zerschneidungs- und Barrierewirkungen<br />
auftreten.<br />
In Abhängigkeit der standörtlichen Verhältnisse können sich u.a. folgende Konfliktpotenziale ergeben:<br />
- Zerschneidung/Störung räumlich-funktionaler Beziehungen zwischen Teilhabitaten und<br />
Teilpopulationen und Trennung bzw. Isolation von Teilhabitaten durch Lebensraumbarrieren<br />
- Unterbindung/Beeinträchtigung des genetischen Austauschs und ggf. erforderlicher<br />
Neu-/Wiederbesiedelungsprozesse<br />
- Lebensraumverkleinerung und Unterschreitung des Minimumareals von Individuen / Populationen<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Von den unterirdisch verlegten Leitungen geht bei geeigneter Trassenführung im Regelbetrieb keine<br />
bzw. nur eine begrenzte Zerschneidungswirkung für Tiere/Pflanzen aus. Der Bereich der Leitungstrasse<br />
kann nach der Verlegung der Leitungen im Regelfall wieder gemäß bzw. in Anlehnung an den Ursprungszustand<br />
hergestellt werden und Lebensraumfunktionen übernehmen. Die Leistungstrasse ist<br />
beidseits in einem Schutzstreifen von 2 m von tiefwurzelnden Pflanzen freizuhalten.<br />
5.3.3.3 Störwirkungen durch <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten – visuelle Störungen / Fahrbewegungen<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Der Bohrplatzbau, die Exploration und die Feldesentwicklung sind mit <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten und Fahrverkehren<br />
verbunden. Visuelle Störungen der Fauna können zum einen durch die Errichtung/Anwesenheit<br />
von Anlagenteilen/Einrichtungen bzw. andererseits durch <strong>Betrieb</strong>s-/Fahrbewegungen auftreten. Derartige<br />
<strong>Betrieb</strong>svorgänge sind vergleichbar mit denen auf sonstigen Großbaustellen.<br />
Visuelle Störungen, zum größten Teil ausgelöst durch Fahrbewegungen, können ggf. Flucht- und Meidereaktionen<br />
(z.B. bei Vögel, Rotwild) auslösen. Zusätzlich besteht bei den LKW-Fahrten die Gefahr<br />
von Individuenverluste durch Überfahren oder Vogelschlag. Allerdings ist die Anzahl der täglichen LKW-<br />
Bewegungen begrenzt.<br />
Der Grad der visuellen Störwirkungen ist u.a. abhängig von den standörtlichen Verhältnissen (z.B. unbelasteter,<br />
naturnaher Raum (z.B. NSG) oder anthropogen vorbelastetes Umfeld (z.B. Straßen, Industrie-/Gewerbetätigkeiten).<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Im Regelbetrieb beschränken sich Fahrten auf wenige Einzelereignisse.<br />
5.3.3.4 Lärm<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Vom Bau des Standortes, von den Fahrverkehren und vom Bohrvorgang selbst gehen temporäre bzw.<br />
zeitlich befristete Lärmemissionen aus.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 48 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
In Abhängigkeit der standörtlichen Verhältnisse können ggf. faunistische Lebens-/Funktionsräume<br />
durch Lärmemissionen beeinträchtigt werden. Als lärmempfindliche Tiergruppen sind insbesondere Vögel<br />
und Fledermäuse betrachtungsrelevant. Es können zum einen Stör- und Scheuchwirkungen auftreten,<br />
zum anderen kann die Reproduktions-, Ausbreitungs-, und Überlebensfähigkeit von Tieren beeinträchtigt<br />
werden.<br />
Aufgrund bekannter Labordaten zur Wahrnehmung von Signalen in Störschall ist zu erwarten, dass bei<br />
Störschallpegeln von 47 dB(A) z.B. bei vielen Vogelarten eine Verfremdung relevanter Information in<br />
Kommunikationssignalen möglich ist, die das Verhalten beeinflussen (BFN, Lärm und Landschaft, Heft<br />
44, 2001).<br />
Im Zuge des Rahmenbetriebsplanes Bötersen Z11 ist ein schalltechnischer Beitrag erstellt worden,<br />
nachdem die Lärmimmissionen bis in Entfernungen von ca. 175 m bis 500 m auf ca. 45 dB(A) abnehmen.<br />
Es kann demzufolge - vorbehaltlich der Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen - von einem Lärm-<br />
Einwirkungsbereich von < 175 m bis < 500 m ausgegangen werden.<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Im Regelbetrieb treten keine relevanten Lärmemissionen auf.<br />
5.3.3.5 Licht<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Während der Bohrtätigkeiten (Exploration und Feldesentwicklung) wird der Standort zeitweise beleuchtet,<br />
da die Bohrtätigkeiten Tag und Nacht durchgeführt werden. Dadurch ergeben sich potenzielle Ausund<br />
Störwirkungen auf die Tierwelt. Intensive Lichtquellen, vor allem mit hohen UV-Anteilen (wie<br />
Quecksilber-Hochdruckdampflampen) ziehen besonders stark Insekten an. Zusätzlich können sich<br />
Störwirkungen auf nachtaktive Tiere ergeben.<br />
Mit einer gezielten Ausrichtung der Lichtquellen auf den Bohrplatz und der Verwendung von speziellen<br />
Leuchtmitteln - soweit erforderlich - können Auswirkungen minimiert werden (weitere Ausführungen zu<br />
Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen s. Kapitel 7).<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Im Regelbetrieb wird der Bohrplatz aus sicherheitstechnischen Gründen in geringem Umfang in üblicher<br />
Weise beleuchtet.<br />
5.3.3.6 Erschütterungen<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Mit dem Bohrtätigkeiten werden keine erheblichen Erschütterungen erwartet (s. Kapitel 4.1.7).<br />
Es wird mit derzeitigem Kenntnisstand nicht davon ausgegangen, dass ein betrachtungsrelevanter Wirkungspfad<br />
bzgl. etwaiger Auswirkungen von Erschütterungen auf die Tierwelt besteht.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 49 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Während des Regelbetriebes ist nicht mit Erschütterungen zu rechnen.<br />
Zusammenfassende tabellarische Darstellung der Wirkungsbeziehungen -<br />
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt<br />
Wirkfaktoren Wirkungsbeziehungen - Potenzielle Beeinträchtigungen / Konfliktpotenziale<br />
PHASE I: Exploration/Feldesentwicklung<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Beeinträchtigungen<br />
durch Leitungsbau<br />
Störungen durch <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten<br />
–<br />
visuelle Störungen /<br />
Fahrbewegungen<br />
Lärm<br />
Licht<br />
PHASE II: Regelbetrieb<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Mit der unvermeidbaren <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> von ca. 1 ha können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/Konflikte verbunden sein:<br />
- Verlust von Biotopen bzw. Biozönosen; Verluste der Habitate, Teilhabitate oder Habitatelemente<br />
von Arten<br />
- Konflikte mit Schutzzwecken und Erhaltungszielen (bei Schutzgebieten),<br />
artenschutzrechtliche Belange<br />
- Zerschneidungsfunktion für Lebensräume/Habitate<br />
Im Rahmen der konkreten Standortfestlegung sind Verminderung- und Vermeidungspotenziale<br />
unter Berücksichtigung der betriebstechnischen Erfordernisse zu prüfen<br />
Mit Zuge des Leistungsbau (Gas / Lagerstättenwasser/back-flow) können folgende Konfliktpotenziale/Beeinträchtigungen<br />
auftreten:<br />
- Zerschneidung/Störung räumlich-funktionaler Beziehungen zwischen Teilhabitaten und<br />
Teilpopulationen und Trennung bzw. Isolation von Teilhabitaten durch Lebensraumbarrieren<br />
- Unterbindung/Beeinträchtigung des genetischen Austauschs und ggf. erforderlicher Neu-<br />
/Wiederbesiedelungsprozesse<br />
- Lebensraumverkleinerung und Unterschreitung des Minimumareals von Individuen / Populationen<br />
Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungspotenzialen durch angepasste Bauablaufplanung<br />
Mit den <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten und Fahrverkehren können insbesondere folgende Konfliktpotenziale/Beeinträchtigungen<br />
verbunden sein:<br />
- Störwirkungen bzw. Habitatverluste durch Flucht- und Meidereaktionen<br />
- Individuenverluste: Tod durch Überfahren oder Vogelschlag<br />
Störwirkung abhängig von standörtlichen Verhältnissen; geringes LKW-Aufkommen<br />
Mit der temporären Schalleinwirkung durch LKW-Verkehre/Bohrung können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale verbunden sein:<br />
- Stör- und Scheuchwirkungen (ggf. Habitatverluste)<br />
- Verminderte Reproduktions-, Ausbreitungs- und Überlebensfähigkeit<br />
Soweit erforderlich: Möglichkeit von Vermeidung-/Minderungsmaßnahmen durch Umsetzung<br />
von Schallschutzmaßnahmen<br />
Mit temporären Lichtemissionen während der Bohrung können insbesondere folgende<br />
Beeinträchtigungen/Konfliktpotenziale verbunden sein:<br />
- Störwirkungen durch Lichtreize (vor allem bei Insekten, Fledermäusen, Vögeln)<br />
Möglichkeit der Verminderung/Vermeidung durch betriebstechnische Maßnahmen gegeben<br />
unverändert PHASE I; s.o.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 50 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.3.4 Hinweise zur Bewertung<br />
Vorrangige Bewertungsgrundlage für das Schutzgut „Tiere Pflanzen und die biologische Vielfalt“ ist das<br />
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Hier sind u.a. die Belange der Eingriffsregelung (§14 ff), der<br />
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes (§ 34) und des besonderen Artenschutzes<br />
(Abschnitt 3) geregelt.<br />
Dem BNatSchG nachrangig sind zudem die Maßgaben des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes<br />
zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und in Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Sicherung<br />
des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz) zu beachten sowie etwaige<br />
untergesetzliche Regelungen zur Umsetzung/Ausführung.<br />
Im Zuge der Genehmigungsverfahren werden die Belange von Natur und Landschaft in der Regel im<br />
Rahmen eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes berücksichtigt.<br />
Ein Rückbau/Rekultivierung des Bohrplatzstandortes erfolgt nach Abschluss der Regelbetriebs-Phase<br />
(Dauer: ca. 15-30 Jahre).<br />
5.4 Boden<br />
5.4.1 Aspekte und Funktionen<br />
Nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) wird unter dem Boden die obere Schicht der Erdkruste<br />
einschließlich flüssiger oder gasförmiger Bestandteile verstanden, soweit folgende Bodenfunktionen<br />
(§ 2 Abs. 2 BBodSchG) wahrgenommen werden:<br />
1. Natürliche Funktionen als<br />
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen („Lebensraumfunktion“)<br />
- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen<br />
(„Regler- und Speicherfunktion“)<br />
- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer-<br />
und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers<br />
(„Filter- und Pufferfunktion“)<br />
2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte („Archivfunktion“)<br />
3. Nutzungsfunktionen (Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, Standort für die land-<br />
und forstwirtschaftliche Nutzung, Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen,<br />
Verkehr, Ver- und Entsorgung)<br />
Im Folgenden ist als relevanter Wirkungspfad ausschließlich die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> zu betrachten.<br />
Etwaige Wirkungen durch Stoffeinträge (im Wesentlichen bei Störungen/Unfällen) werden im Themenkreis<br />
Landschaft nicht untersucht (s. Kapitel 3).<br />
Nachteilige Auswirkungen auf den Boden durch den Pfad Oberflächenwasser – Boden sind nicht zu besorgen.<br />
Auf den versiegelten <strong>Betrieb</strong>sflächen anfallendes Oberflächenwasser wird gefasst/gesammelt<br />
und einer externen Entsorgung zugeführt. Eine Versickerung von Oberflächenwasser (unbelastetes<br />
Niederschlagswasser) erfolgt erst nach Aufnahme des Regelbetriebs.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 51 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.4.2 <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> (Versiegelung)<br />
�� PHASE I Exploration und Feldesentwicklung<br />
Die <strong>Betrieb</strong>sfläche des Bohrplatzes wird als vorbereitende Maßnahme der Exploration und Feldesentwicklung<br />
in einem Umfang von ca. 7.000 – 10.000 m² je Clusterplatz versiegelt.<br />
Bei der Herrichtung des Platzes wird der vorhandene Oberboden abgeschoben und vor Ort in Bodenmieten<br />
gelagert. Mit der Flächenversiegelung entfallen die in Kapitel 5.4.1 genannten natürlichen Bodenfunktionen<br />
am Bohrplatzstandort. Die Bodenmieten können ggf. in das Eingrünungskonzept (Begrünung/Bepflanzung)<br />
einbezogen werden (s. Kapitel 7).<br />
Die Versiegelung dient der Sicherstellung der Befahrbarkeit sowie dem Grundwasser- und Immissionsschutz.<br />
Die Versiegelung ist in diesem Sinne anlagenbedingt und nicht vermeidbar. Der Umfang der<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong> ist durch ein optimiertes Nutzungskonzept (kompakte Aufstellung/Anordnung<br />
der <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen) auf ein betrieblicherseits erforderliches Mindestmaß begrenzt.<br />
Bei der Standortauswahl ist in Bezug auf die etwaige Inanspruchnahme von besonders schutzwürdigen<br />
Böden (z.B. Böden mit Archivfunktion) und Böden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit ein besonderes<br />
Gewicht bei der Abwägung beizumessen (Regionalplan Münsterland, Entwurf 2010).<br />
�� PHASE II Regelbetrieb<br />
Während des Regelbetriebes bleibt die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> (bis zu ca. 1 ha) bestehen. .<br />
Nach Abschluss des Regelbetriebes (Förderzeitraum: ca. 15-30 Jahre) wird der Bohrplatz rückgebaut,<br />
so dass dann wieder Bodenfunktionen am Standort wahrgenommen werden können (s. Kapitel 5.4.1).<br />
Zusammenfassende tabellarische Darstellung der Wirkungsbeziehungen - Boden<br />
Wirkfaktoren<br />
PHASE I: Exploration/Feldesentwicklung<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
PHASE II: Regelbetrieb<br />
<strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
Wirkungsbeziehungen - Potenzielle Beeinträchtigungen / Konfliktpotenziale<br />
Mit der anlagenbedingten <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> von ca. 1 ha können insbesondere<br />
folgende Beeinträchtigungen/Konflikte verbunden sein:<br />
- Verlust der natürlichen Bodenfunktionen<br />
- ggf. Verlust der Archivfunktion<br />
Die Umfang der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> ist auf das betrieblicherseits notwendige Maß zu<br />
begrenzen.<br />
unverändert PHASE I; s.o.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 52 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.4.3 Hinweise zur Bewertung<br />
Fachgesetzliche Bewertungsmaßstäbe zum Schutz des Bodens finden sich im Bundes-Bodenschutzgesetz<br />
(BBodSchG) und im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).<br />
Nach § 1 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren.<br />
Gemäß den Zielen und Grundsätzen des BNatSchG sind Böden als Teil des Naturhaushaltes in ihrer<br />
Leistungs- und Funktionsfähigkeit zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln bzw. so zur erhalten, dass<br />
sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG).<br />
Die Flächenversiegelung ist anlagenbedingt und bei der unkonventionellen Erdgasförderungen an den<br />
einzelnen Bohrplätzen nicht vermeidbar. Nach Abschluss des Regelbetriebs und Rückbau der Anlage<br />
sollten die Bodenfunktionen am Gesamt-Standort möglichst weitgehend wiederhergestellt werden, ggf.<br />
unter Umsetzung bodenverbessernder Maßnahmen.<br />
5.5 Wasser<br />
Beim Schutzgut Wasser kann zwischen dem Grundwasserkörper und Oberflächengewässern unterschieden<br />
werden.<br />
Der Grundwasserkörper einschließlich seiner Nutzungsfunktion (u.a. Trinkwasserschutzgebiete) sowie<br />
etwaige Stofffreisetzungen (z.B. bei Schadensfällen) mit Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser<br />
sind kein Betrachtungsgegenstand beim Themenkreis Landschaft.<br />
Oberflächengewässer übernehmen im Naturhaushalt eine Reihe wichtiger Regulationsfunktionen. Dies<br />
umfasst u.a. den Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser, klimatische Ausgleichsfunktionen durch<br />
Wärme-/Kältespeicherung und biologische Abbaufunktionen im Rahmen der natürlichen Selbstreinigung.<br />
Auf Grund seiner vielfältigen Lebensraumfunktionen, die insbesondere im Fall von Fließgewässern<br />
auch Biotop- und Habitatverbundfunktionen umfassen, bestehen enge Beziehungen zu den<br />
Schutzgütern Pflanzen und Tiere. 52<br />
Es kann davon ausgegangen werden, dass keine permanent Wasser führenden Gewässer überbaut<br />
werden. Eine Überbauung von Grabenstrukturen (z.B. Entwässerungsgräben) kann nicht grundsätzlich<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Soweit Bohrplätze im Bereich wasserrechtlicher Schutzgebiete geplant werden sollten, sind die entsprechenden<br />
wasserrechtlichen Vorgaben zu beachten (z.B. Schutzgebietsverordnungen) sowie die erforderlichen<br />
Genehmigungsvoraussetzungen (z.B. bei Lage im Überschwemmungsgebiet) zu schaffen.<br />
5.6 Klima/Luft<br />
Nachteilige Auswirkungen auf regionale oder örtliche Ausprägungen des Klimas (Regional- und Lokal-/<br />
Standortklima) sind nicht zu besorgen.<br />
Staub-/Geruchsfreisetzungen sind bei den Bau-/<strong>Betrieb</strong>stätigkeiten nach derzeitigem Kenntnistand von<br />
untergeordneter Bedeutung. Weitere Untersuchungsbedarf besteht hier noch bzgl. der Abgasemissionen<br />
beim <strong>Betrieb</strong> von Dieselmotoraggregaten (s. Kapitel 4.1.11).<br />
52 GASSNER/WINKELBRANDT/BERNOTAT 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 53 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
5.7.1 Aspekte<br />
Kulturgüter können definiert werden als Zeugnisse menschlichen Handelns ideeler, geistiger und materieller<br />
Art, die als solche für die Geschichte des Menschen bedeutsam sind und sich als Sachen, als<br />
Raumdispositionen oder als Orte in der Kulturlandschaft beschreiben und lokalisieren lassen. Der Begriff<br />
Kulturgut umfasst damit sowohl Einzelobjekte oder Mehrheiten von Objekten, einschließlich ihres<br />
notwendigen Umgebungsbezugs, als auch flächenhafte Ausprägungen sowie räumliche Beziehungen<br />
bis hin zu kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen und Landschaften. Hinzuzurechnen sind<br />
auch noch Güter, welche die prähistorische Entwicklung dokumentieren (archäologische Funde, Bodendenkmale<br />
etc.). Hier zeigt sich der Überschneidungsbereich zur Archivfunktion von Böden. Im Hinblick<br />
auf kulturhistorische Landschaftsteile und Landschaften bestehen Bezüge zu dem Schutzgut<br />
Landschaft und Landschaftsbild.<br />
Zu den sonstigen Sachgütern zählen gesellschaftliche Werte, die z.B. eine hohe funktionale Bedeutung<br />
hatten oder noch haben: z.B. Brücken, Tunnel, Gebäude, Geräte etc.. Aufgrund der Funktionsbedeutung<br />
dieser Sachgüter oder aber weil ihre Konstruktion bzw. ihre Wiederherstellung selbst unter hohen<br />
Umweltaufwendungen erfolgte (Baumaterial usw.), sind sie zu erhalten. 53<br />
5.7.2 Wirkungsbeziehungen<br />
Im Zuge der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> ist eine Beeinträchtigung von Kulturgütern (insbesondere Bodendenkmäler,<br />
wie z.B. Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen oder Fundgegenstände) nicht<br />
grundsätzlich auszuschließen. Mögliche Konfliktpotenziale können durch eine entsprechende Standortauswahl<br />
minimiert werden.<br />
Hinweise auf mögliche Kulturgüter können bei den örtlichen Denkmalschutzbehörden eingeholt werden.<br />
Unter deren Einbeziehung kann geprüft werden, ob bzw. unter welchen Maßgaben der Eingriff möglich/zulässig<br />
ist.<br />
Die Inanspruchnahme von Sachgütern im vorgenannten Sinne kann weitgehend ausgeschlossen werden.<br />
5.8 Freiraum- und Agrarbereiche – Land-/Forstwirtschaft<br />
5.8.1 Landwirtschaft<br />
Soweit von der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> landwirtschaftliche Nutzflächen betroffen sind, entfällt die<br />
landwirtschaftliche Nutzung für die gesamte Dauer von der Exploration bis zum Abschluss der Erdgasförderungen<br />
(Gesamtzeitraum von bis zu rd. 32 Jahren). Landwirtschaftliche Nutzflächen können sich<br />
beispielsweise unterscheiden in Bezug auf ihre Bodenfruchtbarkeit / Ertragsfähigkeit oder ihre Eignung<br />
für den Anbau von Sonderkulturen (z.B. Spargel).<br />
Nach Rückbau des Bohrplatzes (Flächenversiegelung / technische Einrichtungen) und Aufbringung von<br />
Oberboden kann die Fläche dann wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.<br />
Indirekte Auswirkungen könnten sich auf benachbarte Landwirtschaftsflächen ergeben, falls durch den<br />
Bohrplatz bzw. die Zuwegungen ungünstig geschnittene Restflächen verbleiben, die nur mit erhöhtem<br />
Bewirtschaftungsaufwand zu nutzen wären.<br />
53 Gassner/Winkelbrandt/Bernotat 2010<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 54 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Im Regelfall werden solche Flächen mit gepachtet, so dass in der Praxis derartige indirekte Auswirkungen<br />
nicht zum Tragen kommen. 54<br />
Im Einzelfall nicht auszuschließen ist, dass sich für angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen ggf.<br />
Vermarktungsprobleme ergeben könnten (z.B. bei örtlicher Direktvermarktung).<br />
Zusätzlich zu landwirtschaftlichen Flächen, die durch den Bohrplatz beansprucht werden, können im<br />
Rahmen der Ausgleichskonzeption (näheres hierzu siehe Kapitel 7.3) Flächen benötigt werden, um<br />
den Eingriff (nach § 14 BNatSchG) umfassend auszugleichen. Der Umfang der benötigten Ausgleichsflächen<br />
ist ohne konkrete Standortbestimmung nicht abschätzbar. Ein Kompensationsbedarf im gleichen<br />
Flächenverhältnis (1:1) ist jedoch nicht zu erwarten, da es sich bei landwirtschaftlich genutzten<br />
Flächen meist um geringwertige Biotopstrukturen handelt (z.B. intensiv genutzter Acker). Im Rahmen<br />
des Kompensationskonzeptes kann auf weitaus kleinerer Fläche mit der Herstellung eines höherwertigen<br />
Biotops der Ausgleich erreicht werden.<br />
Die landwirtschaftlichen Aspekte sind - ergänzend zu den Betrachtungen an den Einzel-Bohrstandorten<br />
- bei der Erschließung von Explorationsgebieten (s. Kapitel 8) raumbezogen auch unter agrarstrukturellen<br />
Belangen und wirtschaftlichen Kriterien zu betrachten.<br />
5.8.2 Forstwirtschaft<br />
Soweit von der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> forstwirtschaftliche Nutzflächen betroffen sind, ist eine Rodung<br />
(inkl. Rodungsgenehmigung) des vorhandenen Baumbestandes erforderlich. Die Holzernte kann<br />
dann entsprechend vermarktet werden.<br />
Zusätzlich zum Baumbestand/Holzertrag können sich Waldbestände beispielsweise hinsichtlich ihrer<br />
Wald/-Schutzfunktionen (z.B. Immissionsschutz, Sichtschutz, Schutz vor Bodenerosion) und besonderen<br />
forstwirtschaftlichen Funktionen (z.B. forstwirtschaftliche Versuchsflächen, historische Waldnutzungsfunktionen)<br />
unterscheiden.<br />
Eine weitere forstliche Nutzung (Wiederaufforstung) kann dann erst wieder nach Abschluss der Erdgasförderung<br />
und erfolgtem Rückbau der Fläche aufgenommen werden. Je nach Art/Ausprägung des vorhandenen<br />
Baumbestandes kann der Zeitraum bis zur Erreichung des Voreingriffszustandes (Urspungszustand)<br />
ggf. über 100 Jahre (Hochwaldstadium) betragen.<br />
Soweit der Bohrplatz in einem großflächigeren Baumbestand/Waldgebiet liegt, können sich durch den<br />
Holzschlag indirekte Einflüsse/Wirkungen auf die verbleibenden Bestände ergeben (z.B. Schaffung<br />
neuer Waldränder mit Erhöhung der Windbruchgefahr (Windangriff an Bäumen im bisher geschlossen/zusammenhängenden<br />
Bestand), Bewirtschaftungserschwernisse z.B. bei Rodungen). Wie bei der<br />
landwirtschaftlichen Nutzung können Bewirtschaftungserschwernisse für die Forstwirtschaft durch ausreichend<br />
große Pachtflächen vermieden werden.<br />
Im Hinblick auf die flächenhafte Erschließung der Explorationsgebiete (s. Kapitel 8) sind raumbezogen<br />
auch die Belange der regionalen Waldstruktur und der Waldbewirtschaftung zu betrachten.<br />
5.8.3 Jagdnutzung<br />
Soweit sich der Bohrplatz in einem Bereich der Jagdnutzung befindet, sind nachteilige Auswirkungen<br />
auf die Jagdtätigkeit (Störeinflüsse auf das Wild) nicht auszuschließen.<br />
54 http://www.erdgassuche-in-deutschland.de/sicherheit_und_umwelt/landschaft/index.html<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 55 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
6 Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase<br />
Nach dem Abschluss des Förderbetriebes (Erschöpfung des förderungswürdigen Erdgasvorkommens)<br />
erfolgt - entsprechend den genehmigungsrechtlichen Regelungen (z.B. Festsetzungen des <strong>Betrieb</strong>splanes)<br />
- im Regelfall zeitnah ein vollständiger Rückbau der <strong>oberirdische</strong>n <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen (bauliche<br />
und betriebstechnische Anlagen) einschließlich der Flächenbefestigung.<br />
Unter Beachtung der konkreten genehmigungsrechtlichen Vorgaben wird entweder der Ursprungszustand<br />
der Standortfläche wieder hergestellt oder alternativ wird die Standortfläche in gewünschter Weise<br />
anderweitig genutzt (z.B. Nutzung einer vormals landwirtschaftlichen Fläche für naturschutzfachliche<br />
Maßnahmen/Kompensation).<br />
Eine erneute landwirtschaftliche Nutzung dürfte nur nach tiefgreifender Melioration 55 in Abhängigkeit<br />
der vormaligen Bewirtschaftungsart (Grünlandnutzung, Ackerbau) möglich sein.<br />
Die Fortsetzung einer vormaligen forstlichen Nutzung würde mit einer Wiederaufforstung beginnen und<br />
benötigt - in Abhängigkeit des vorherigen Baumbestandes - entsprechend lange Zeiten zur Erreichung<br />
des Voreingriffszustandes.<br />
Im Weiteren kann die Standortfläche dann sukzessive wieder Funktionen im Natur- und Landschaftshaushalt<br />
(z.B. Biotopfunktion, Bodenfunktionen, Funktionen im Wasserhaushalt) übernehmen. Die<br />
Gestaltung/Nutzung der Standortfläche sollte so erfolgen, dass eine geeignete Einbindung in die Landschaft<br />
bzw. das Landschaftsbild erreicht wird. Die Bodenfunktionen/-eigenschaften sind in ihrer ursprünglichen<br />
Ausprägung/Charakteristik nur nach langer Zeit wieder erzielbar.<br />
Planungen/Konzeptionen von Standortnutzungen nach dem Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase sollten nicht nur<br />
mit dem Fokus auf jeden Einzelbohrplatz, sondern auch unter zeitlich-räumlichen Aspekten auf die Gesamtsituation<br />
in einem Explorationsgebiet (mit zahlreichen Bohrplätze; s. Kapitel 8) hin geprüft und<br />
entwickelt werden.<br />
55 Melioration: kulturtechnische Maßnahmen zur Werterhöhung des Bodens, also zur Steigerung seiner Ertragsfähigkeit, zur Vereinfachung<br />
seiner Bewirtschaftung und zum Schutz vor Schädigung oder Zerstörung zu sehen. Solche Maßnahmen sind zum<br />
Beispiel die Be- oder Entwässerung, Drainierung, Eindeichung von Überschwemmungsgebieten und die Urbarmachung von Ödland.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 56 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
7 Maßnahmen zur Konfliktminderung, -vermeidung und Kompensation<br />
7.1 Standortauswahl<br />
Die Festlegung von Explorationsgebieten, die Rasterweite zwischen einzelnen Bohrplätzen im Explorationsgebiet<br />
und die angestrebte Lage der einzelnen Bohrplätze ergibt sich aus lagerstättentechnischen<br />
Kriterien.<br />
Aus diesen Kriterien resultieren unterirdische Zielkoordination der einzelnen Lagerstätten/Gewinnungsstellen.<br />
Insbesondere in Abhängigkeit der Bohrtiefe und der Lagerstättencharakteristik<br />
ergeben sich daraus unterschiedlich große Radien für Suchräume (z.B. 500 m-Radius) 56 zur Festlegung<br />
eines konkreten <strong>oberirdische</strong>n Bohrplatzes.<br />
Die Realisierbarkeit der sich aus den Lagerstättenverhältnissen idealtypischerweise ergebenden Bohrplatzdichte/-lage<br />
ist unter Beachtung der <strong>oberirdische</strong>n standörtlichen Verhältnisse zu prüfen bzw. erforderlichenfalls<br />
an diese Verhältnisse anzupassen.<br />
Zu Lokalisation der konkreten Bohrplätze in einem Explorationsgebiet sollten einheitliche Kriterien angewendet<br />
bzw. entwickelt werden, insbesondere mit den Zielen:<br />
o Vermeidung von Konflikten mit den menschlichen Schutzbedürfnissen<br />
(möglichst großer Abstand zu Siedlungs-(Wohngebiets)flächen)<br />
o Günstige Verkehrsanbindung<br />
o Standorte mit möglichst geringem Konfliktpotenzial bzgl. Natur und Landschaft, Boden etc.<br />
(Hier insbesondere relevant, wenn hochwertige Strukturen und Artenschutz betroffen sind -<br />
zwingend insbesondere auch bei etwaigen Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten)<br />
o Prüfung auf Bündelung / Nutzung vorhandener <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
s. auch Kapitel 9: Schlussfolgerungen.<br />
Als Ausschlusskriterien für einen Bohrplatz werden von ExxonMobil derzeit angewendet 57 :<br />
- <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen wie Leitungen (z.B. Hochspannungsfreileitung), Straßen, Richtfunkstrecken<br />
etc. mit jeweilig einzuhaltenden Sicherheitsabständen<br />
- Umkreis von Einzelgehöften/-bebauungen mit einem Sicherheitsabstand von mind. 100 m<br />
- Umkreis von Siedlungsflächen mit einem Sicherheitsabstand von mind. 200 m<br />
56 ExxonMobil 2012<br />
57 ExxonMobil 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 57 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
7.2 Standortbezogene Maßnahmen - Einzelbohrplatz<br />
Ergänzend zu den übergeordneten Kriterien/Zielen bei der Standortauswahl (s. Kapitel 7.1) sind für die<br />
Einzelbohrplatze standortbezogene Maßnahmen zur Konfliktvermeidung/-minderung und zur Kompensation<br />
zu prüfen bzw. umzusetzen.<br />
Insbesondere folgende Maßnahmen kommen hier in Bezug auf die einzelnen Schutzgüter in Betracht<br />
(Reihenfolge der Schutzgüter gemäß Kapitel 5):<br />
Landschaft – landschaftsgebundene Erholung<br />
�� frühzeitige und landschaftsgerechte/-angepasste Eingrünung des Standortes zur Minderung der<br />
Einsehbarkeit – Eingrünungskonzept (s. Kapitel 7.3)<br />
�� ggf. ergänzende Sichtschutzzäune (Exploration/Feldesentwicklung)<br />
�� zügige Ablaufplanung der Bohrtätigkeiten<br />
(Begrenzung der Zeitdauer der Aufstellung der Bohranlage)<br />
�� evtl. technische Weiterentwicklung der Bohrtürme (filigraner, niedriger)<br />
�� Einrichtung zentraler <strong>Infrastruktur</strong>standorte für Gastrocknung/Wasseraufbereitung, z.B. im Industrie-<br />
/Gewerbegebiet; Vermeidungsmaßnahme für die Einzelbohrplätze<br />
�� zügiger Rückbau der <strong>Infrastruktur</strong>einrichtung/Flächenbefestigung nach Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase;<br />
zügige Aufnahme einer Folgenutzung (Ursprungszustand oder gewünschter anderweitige Nutzung,<br />
s. Kapitel 6)<br />
Mensch (vorrangig relevant: Phase der Exploration/Feldesentwicklung)<br />
Lärm - technische / betriebliche Maßnahmen:<br />
- Aufstellungskonzept lärmtechnisch relevanter Aggregate / ggf. Kapselung von Aggregaten<br />
(größte Schallabstrahlung möglichst nicht in Siedlungsrichtung)<br />
- möglichst Vermeidung von Einzelgeräusche / tieffrequenten Geräuschen;<br />
ggf. Nutzung Elektroantrieb anstelle von Dieselaggregaten<br />
- betriebtechnische Ablaufplanung / Aggregateeinsatzplanung, insbesondere zur Nachtzeit<br />
- Bohrverfahren / Art des Meißelantriebes<br />
- Abschirmung (z.B. durch mobile Lärmschutzwände/Teileinhausung)<br />
- messtechnische Überwachung von Schallemissionen/-immissionen<br />
- technische Weiterentwicklung der Bohrgeräte; elektrischer Antrieb (evtl. leiseres Bohren,<br />
- in dem Zuge auch Vermeidung/Verminderung von Schadstoffemissionen)<br />
�� Verkehr:<br />
- adäquater Ausbau der Verkehrswege / Zufahrt (Befestigung in Straßenbauweise)<br />
- bedarfsweise Steuerung der Verkehre (z.B. LKW-Anzahl / Anlieferzeiten / Zufahrtsstrecken)<br />
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (Zufahrt, Bohrplatz)<br />
�� Licht:<br />
- bedarfsweise Anpassung der Ausleuchtung des Bohrplatzes an die standörtlichen<br />
Verhältnisse (z.B. konkrete Ausrichtung der Lichtquellen, Einsatz blendarmer Leuchtmittel<br />
(hier: ebenfalls technische Weiterentwicklung in der Zukunft), indirekte Beleuchtung) 58<br />
�� Eingrünung des Anlagenstandortes – Eingrünungskonzept (s. Kapitel 7.3):<br />
- Minderung der Einsehbarkeit / Wahrnehmbarkeit von <strong>Betrieb</strong>stätigkeiten/Fahrbewegungen<br />
58 IMT DEUTSCHLAND, IQL Grün „ClearSky“ ökologische ökonomische Beleuchtung, (ohne Datum)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 58 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Boden<br />
�� Minimierung der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> im Rahmen der betriebtechnischen Erfordernisse bzw.<br />
Möglichkeiten<br />
�� Separierung/Sicherung des Oberbodens, ggf. Nutzung als Pflanzwall<br />
�� Evtl. Teilrückbau der Bohrplatzfläche während der Regelbetriebsphase auf ein notweniges Mindestmaß<br />
(falls ausgeschlossen werden kann, dass etwaige Nach-fracs durchgeführt werden müssen,<br />
für die man die gesamte Flächengröße des Bohrplatzes benötigt; Einzelfallentscheidung)<br />
�� zügiger Rückbau der <strong>Infrastruktur</strong>einrichtung/Flächenbefestigung nach Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase;<br />
zügige Aufbringung des Oberbodens, ggf. Umsetzung bodenverbessernder Maßnahmen,<br />
s. Kapitel 6)<br />
Wasser<br />
�� Fassung und Entsorgung von Niederschlagswasser während der Exploration/Feldesentwicklung<br />
�� Grundwasserhaushalt: Versickerung nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers in der<br />
Phase des Regelbetriebes<br />
Tiere und Pflanzen / Biotope und Arten<br />
�� Minimierung der <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> im Rahmen der betriebtechnischen Erfordernisse bzw.<br />
Möglichkeiten; möglichst Inanspruchnahme naturschutzfachlich vergleichsweise weniger bedeutsamer<br />
Standorte<br />
�� Durchführung etwaiger Rodungsarbeiten (Entfernung Baumbestand/Gehölze) im Rahmen des<br />
Bohrplatzbaus außerhalb der Verbotszeiträume des § 39, Abs. 5 (2) BNatSchG (1. März bis 30.<br />
September)<br />
�� Ausgleich und Ersatz (Kompensation), möglichst standortbezogen bzw. im gleichen Naturraum<br />
(auch im Hinblick auf Eingriffskompensation Eingriff in das Landschaftsbild)<br />
�� ggf. spezielle artenschutzfachliche Maßnahmen, z.B. vorgezogene CEF-Maßnahmen<br />
�� bedarfsweise Anpassung der Ausleuchtung des Bohrplatzes an die standörtlichen Verhältnisse<br />
(z.B. Einsatz spezifischer Leuchtmittel bei besonderer Anforderungen Fauna/Insekten)<br />
�� nach Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase und Rückbau: Einbindung der Standortfläche in den Natur- und<br />
Landschaftshaushalt; soweit keine land-/forstwirtschaftliche Nutzung nach Ende des Regelbetriebs<br />
vorgesehen ist<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 59 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
7.3 Grünordnungskonzept/Kompensation (am Beispiel NRW/Münsterland)<br />
Es ist davon auszugehen, dass mit der Errichtung der Bohrplätze jeweils Eingriffe in Natur und Landschaft<br />
nach § 14 BNatSchG verbunden sind, da - infolge des Ausschlusses von Siedlungsflächen als<br />
Bohrplätze - die Bohrstandorte im unbesiedelten Außenbereich liegen. Die Regelungen des BNatSchG<br />
zum Ausgleich/Ersatz (§ 15 BNatSchG) sind demzufolge anzuwenden (s. Kapitel 5.3.3.1).<br />
Im Zusammenhang mit der naturschutzfachlichen Kompensation einerseits und mit dem Ziel der Verminderung<br />
der Einsehbarkeit und der Eingliederung in die Landschaft, kommt einer frühzeitigen und<br />
landschaftsgerechten/-angepassten Eingrünung der Bohrplatz-Standorte eine hohe Bedeutung zu.<br />
Um mit einem Eingrünungskonzept die Zielvorgaben einer landschaftsgerechten/-angepassten Eingrünung<br />
erfüllen zu können, müssen zunächst die Landschaftsstrukturen in ihrer konkreten Ausprägung im<br />
Bestand bzw. in der Planung betrachtet und ausgewertet werden.<br />
Im Folgenden wird beispielhaft ein Eingrünungskonzept für Bohrplatz-Standorte im Münsterland aufgezeigt.<br />
Die Zielvorgaben an die Ausgestaltung des Eingrünungskonzeptes lassen sich hier aus den Vorgaben<br />
des Regionalplanes Münsterland (Entwurf, 2010) an die Kulturlandschaft sowie den Maßgaben<br />
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe „Heckenmanagement im Münsterland“ (2010) und der „Arbeitshilfe<br />
zur Anlage und Pflege von Hecken in der Landschaft“ des Kreise Borken (April 2009) ableiten.<br />
„Bei allen raumwirksamen Planungen und Maßnahmen sind der Charakter der gewachsenen Kulturlandschaft<br />
mit ihren bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen und -elementen sowie die historisch<br />
wertvollen Orts- und Landschaftsbilder zu bewahren und behutsam weiter zu entwickeln.<br />
Kulturhistorisch charakteristische Siedlungs- und Freiraumstrukturen, die das Orts- und Landschaftsbild<br />
in besonderer Weise bestimmen bzw. durch geeignete Maßnahmen entsprechend aufgewertet werden<br />
können, sollen planerisch gesichert und in ihrer Funktion erhalten und entwickelt werden. Hierzu sollen<br />
die in der Anlage zur Erläuterungskarte II-1 aufgeführten Leitbilder berücksichtigt werden.“ (Regionalplan<br />
Münsterland, Entwurf 2010)<br />
Beispielhafter Ausschnitt Kulturlandschaft Münsterland [35]<br />
Die Kulturlandschaft des Münsterlandes zeichnet<br />
sich durch vielfältige landschaftsbildprägende Elemente<br />
aus. Eines dieser Elemente sind Heckenstrukturen.<br />
Hecken sind im Münsterland seit Jahrhunderten<br />
landschaftsbildend und prägen die Kulturlandschaft.<br />
Trotz ihres starken Rückgangs in<br />
den letzten Jahrzehnten sind sie heute ein wichtiger<br />
Teil der regionalen Identität und tragen als wesentlicher<br />
Bestandteil der Münsterländischen Parklandschaft<br />
zum touristischen Erfolg der Region bei.<br />
Auch unter ökologischen Gesichtspunkten spielen<br />
Hecken im Münsterland eine wichtige Rolle. In vielen<br />
Bereichen bilden sie das Grundgerüst für den<br />
Biotopverbund und die Strukturvielfalt der Region.<br />
In einem durch intensive Landwirtschaft geprägten Raum stellen Hecken daher heute umso mehr einen<br />
wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar und leisten so einen wichtigen Beitrag für den Erhalt<br />
der Biodiversität.<br />
(http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Bildung_Kultur/Kulturlandschaft/Heckenmanagement_MSL)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 60 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Beispielhaftes Grünordnungskonzept – Heckenpflanzung 59<br />
Der Bohrplatz kann mit einer Strauchpflanzung/Hecke eingefasst werden (siehe nachfolgendes Pflanzbeispiel).<br />
Beim Pflanzen sollten standortgerechte bodenständige Laubgehölzarten regionaler Herkunft<br />
verwendet werden. Anhaltspunkte zur Artenzusammensetzung können vorhandene Gehölzstrukturen<br />
im Umland liefern, wobei vor allem alte Hecken und naturnahe Waldränder berücksichtigt werden sollten.<br />
Da zwei Drittel der in Nordrhein-Westfalen heimischen Wildsträucher eher nährstoffarme Böden<br />
bevorzugen, bietet sich (ggf. teilweise) das Anlegen einer Wallhecke an. Der Wall trägt zum einen zu<br />
einem besseren Sichtschutz schon während der Bohrphase bei, zum anderen bietet er einen gewissen<br />
Schutz vor Nährstoffeinträgen und fördert die Aushagerungsprozesse, sodass die Ansiedlungschancen<br />
der naturraumtypischen Magerkeitsflora verbessert werden.<br />
Container<br />
Bohranlage<br />
Zaun<br />
Skizzenhafte Darstellung einer Bohrplatzeingrünung (Ansicht) nach 2-3 Jahren Wachstumsphase [36]<br />
(Bohranlage nicht in voller Höhe abgebildet)<br />
Beim Aufbau der Pflanzung sollten die ökologischen Ansprüche der einzelnen Gehölzarten berücksichtigt<br />
werden. Ein Faktor ist dabei das Lichtdargebot, das stark vom Verlauf der neu anzulegenden Hecke<br />
abhängt. Lichtbedürftige Arten, wie z.B. die Hundsrose, sollten an süd- oder westexponierten Heckenflanken<br />
platziert werden, während schattenbedürftige und feuchtigkeitsliebende Arten, wie Pfaffenhütchen,<br />
Hasel oder Faulbaum sich auch im Heckenzentrum oder an lichtabgewandten Seiten behaupten<br />
können. Schnellwüchsige Arten, wie z.B. Hundsrose oder Vogelbeere sollten einzeln innerhalb der Hecke<br />
gepflanzt werden, langsam- oder schwachwüchsige Arten (z.B. Schlehe oder Hasel) werden in<br />
Gruppen von drei bis vier Pflanzen zusammengesetzt, mittelwüchsige Arten sollten in zweier Gruppen<br />
gepflanzt werden. Die beste Pflanzzeit zum Anlegen der Gehölzpflanzung ist Ende Oktober bis Anfang<br />
April. In der Regel beträgt der Pflanzabstand zwischen den Pflanzen ca. 1 bis 1,5 m.<br />
Zu prüfen wäre, ob die Sträucher mittels Verbissschutz vor Verbissschäden durch Wild geschützt werden<br />
müssen. Um zu verhindern, dass Wildkräuter die frisch angepflanzten Gehölze in den ersten Jahren<br />
erdrücken, sollten die Neupflanzungen zumindest im ersten und zweiten Pflanzjahr ausgemäht<br />
werden.<br />
59<br />
Inhalte basierend auf der „Arbeitshilfe zur Anlage und Pflege von Hecken in der Landschaft“, West Münsterland, Kreis Borken,<br />
April 2009<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 61 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Nach Beendigung des Regelbetriebes und im Rahmen des Rückbaus der Anlage kann die Hecke - analog<br />
einer landschaftstypischen Heckenbewirtschaftung - auf Stock gesetzt werden und das Holz vermarktet<br />
werden. Die Hecke kann danach wieder austreiben und ein struktur- und landschaftsbildprägender<br />
Bestandteil der Kulturlandschaft bleiben.<br />
Eine Heckenpflanzung kann nach folgender Artenverwendungsliste ausgeführt werden:<br />
Artenverwendungsliste<br />
Standortheimische Gehölze für die Anlage der Gehölzpflanzung<br />
Mindestqualität des Pflanzgutes: Sträucher, 2 x verschult, 100-150 cm Anpflanzungshöhe<br />
Acer campestre Feldahorn<br />
Carpinus betulus Hainbuche<br />
Cornus sanguinea Hartriegel<br />
Corylus avellana Hasel<br />
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn<br />
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen<br />
Faulbaum Frangula alnus<br />
Ligustrum vulgare Liguster<br />
Prunus mahaleb Felsenkirsche, Steinweichsel<br />
Prunus spinosa Schlehe<br />
Rosa canina Hundsrose<br />
Salix caprea Salweide<br />
Sambucus nigra Schwarzer Holunder<br />
Taxus baccata Eibe<br />
Bäume – standortheimisch; Stammumfang 16/18 cm, mB (mit Ballen)<br />
Acer platanoides Spitzahorn<br />
Prunus avium Wildkirsche<br />
Tilia platyphyllos Sommerlinde<br />
Sorbus aucuparia Eberesche<br />
Quercus petraea Traubeneiche<br />
Modellhafte Darstellung: Bohrplatz im Regelbetrieb –<br />
mit Eingrünung [37]<br />
Die Heckenpflanzung sollte möglichst frühzeitig, d.h.<br />
zeitnah im Anschluss an die Herrichtung des Bohrplatzes<br />
durchgeführt werden. Der vor Ort separierte<br />
Oberboden kann dann als Wall profiliert und als<br />
Grundlage für Pflanzwälle genutzt werden. In den<br />
Zeiträumen bis zur Bohrphase (Feldesentwicklung)<br />
- vorlaufend: Explorationsbohrung, Auswertung der<br />
Bohrungen, Genehmigungseinholung für Feldesentwicklung<br />
inkl. Frack-ing / Regelbetrieb, Ausbau zum<br />
Cluster-Bohrplatz - kann sich aus den Pflanzungen<br />
ein vitaler, hochwüchsiger Heckenbestand entwickeln.<br />
Auf diese Weise kann die Einsehbarkeit auf<br />
den Bohrplatz mit den <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
(Containern, Lagerflächen etc.) vermindert werden.<br />
Der Bohrturm selbst bleibt bei Höhen von ca. 27 –<br />
39 m überwiegend sichtbar.<br />
Zusätzlich zu dem unmittelbaren Ausgleich vor Ort können Flächen benötigt werden, um den Eingriff<br />
(nach §§ 14,15 BNatSchG) umfassend zu kompensieren. Der Umfang der benötigten Ausgleichsflächen<br />
ist ohne konkrete Standortbestimmung nicht abschätzbar. Ein Kompensationsbedarf im gleichen<br />
Flächenverhältnis (1:1) ist jedoch nicht zu erwarten, da es sich bei den potentiellen Ausgleichsflächen<br />
meist um landwirtschaftlich genutzten Flächen handelt, die oft einem geringwertigen Biotoptyp zugeordnet<br />
werden (z.B. intensiv genutzter Acker). Im Rahmen des Kompensationskonzeptes kann auf<br />
weitaus kleinerer Fläche mit der Herstellung eines höherwertigen Biotops der Ausgleich erreicht werden.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 62 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
8 Raumanalyse<br />
8.1 Betrachtung in der Fläche (Explorationsgebiete)<br />
8.1.1 Aufgaben- und Problemstellung, Methodik<br />
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die möglichen Auswirkungen eines Bohrplatzes auf die landschaftsgebundenen<br />
Umweltfaktoren dargestellt.<br />
Diese Betrachtung lässt außen vor, dass für die wirtschaftliche Erschließung eines derzeitigen Explorationsgebietes<br />
(Größe bis zu rd. 960 km²) oder eines vorläufigen Explorationsgebietes ein mehr oder<br />
weniger dichtes Netz von Bohr-/Gewinnungsplätzen zu errichten und zu betreiben ist.<br />
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann unter Ansatz einer worst-case-Betrachtung (s. Kapitel 8.1.4)<br />
davon ausgegangen werden, dass Bohr- und Gewinnungsplätze unter Betrachtung rein explorationstechnischer<br />
Belange einen Bereich von 4 bis 10 km² abdecken - ohne Berücksichtigung der <strong>oberirdische</strong>n<br />
Restriktionen/Einschränkungen bei der Standortwahl von Bohr-/Gewinnungsplätzen. Der Abstand<br />
der Bohrplätze zueinander ergibt sich dann entsprechend (rein rechnerisch, bei mittiger Anordnung)<br />
mit 2 km bis 3,2 km oder mehr Kilometer.<br />
Im vorliegenden Fachbeitrag wird eine Rastergröße von 9 km² angesetzt (Abstand der Bohrplätze<br />
zueinander: 3 km). Dies ist der am wahrscheinlichsten zu erwartende Ausbauzustand. 60<br />
Insofern stellt sich die Frage nach dem Gesamt-Flächenbedarf und nach den möglichen Auswirkungen<br />
auf landschaftsgebundene Umweltfaktoren bei einer flächendeckenden Erschließung von Explorationsgebieten<br />
mit Bohr-/Gewinnungsplätzen.<br />
Zunächst wäre zu klären, mit wie vielen Bohr-/Gewinnungsplätzen bei einer flächendeckenden Erschließung<br />
zu rechnen ist, wie eine Verteilung/Anordnung in der Fläche aussehen könnte und in welchem<br />
zeitlichen Rahmen eine solche flächendeckende Erschließung förderungswürdiger Gewinnungsgebiete<br />
realisiert werden könnte. Bereits diese Fragestellungen sind zum derzeitigen Untersuchungs-/Kenntnisstand<br />
nicht einfach zu beantworten.<br />
Im Weiteren wäre dann zu prüfen und zu diskutieren, welche flächenhaften / raumrelevanten Belange<br />
bei der Auswahl von Bohr-/Gewinnungsplätzen zu berücksichtigen und zu beachten sind. Aufgrund der<br />
Größe (flächenmäßigen Ausdehnung) der Explorationsgebiete und der möglichen Anzahl der Bohr-<br />
/Gewinnungsplätze (s. Kapitel 8.1.4) bietet es sich an, hier die raumordnungsrelevanten Ziele/Kriterien<br />
zu betrachten, die für die jeweiligen Explorationsgebiete relevant sind (s. Kapitel 8.1.5 und 8.1.6). Um<br />
mögliche Auswirkungen eines Netzes von Bohr-/Gewinnungsplätzen zu beschreiben, müssen die flächenhaften/raumrelevanten<br />
Kriterien herangezogen und diskutiert werden.<br />
Die Beschreibung der derzeit diskutierten Explorationsgebiete nach landschafts-/raumordnungsrelevanten<br />
Kriterien hat zum Ziel, die möglichen Auswirkungen auf landschaftsrelevante Belange bei einer<br />
flächenhaften Erschließung von unkonventionellen Gasvorkommen ansatzweise erkennen zu können.<br />
In Kapitel 9 (Schlussfolgerungen) werden die Ergebnisse der raumanalytischen Betrachtungen mit<br />
Hinweisen/Angaben zur Raumwirksamkeit/-relevanz zusammengefasst.<br />
60 Email Herr Kassner, ExxonMobil, 23.03.2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 63 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
8.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Erdgas zählt zu den Kohlenwasserstoffen und ist somit ein sogenannter bergfreier Bodenschatz im Sinne<br />
des § 3 Abs. 3 der Bundesberggesetzes (BBergG). Die Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung<br />
von Erdgas unterliegt daher den Bestimmungen des BBergG.<br />
Für die Aufsuchung (Maßnahmen zur Erkundung und zur Feststellung der Ausdehnung der vermuteten<br />
Lagerstätte) von Erdgas bedarf es zunächst einer nach dem BBergG zu erteilenden Erlaubnis (§ 6<br />
BBergG) und für die Gewinnung einer Bewilligung (§ 8 BBergG) oder des Bergeigentums (§ 9 BBergG);<br />
Sammelbegriff „Bergbauberechtigung“. 61<br />
Gemäß der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau;<br />
§ 1 Abs. 2 a)) bedürfen Vorhaben zur Gewinnung von Erdgas zu gewerblichen Zwecken mit einem<br />
täglichen Fördervolumen von täglich mehr als 500.000 m³ Erdgas einer Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
(UVP).<br />
Die Tight-Gas-, Kohleflözgas- und Schiefergas-Vorhaben fallen bisher aus der Pflicht zur umfänglichen<br />
Überprüfung der Umweltauswirkungen heraus, da die üblichen Gas-Fördermengen deutlich niedriger<br />
ausfallen. Selbst bei günstigen Standortbedingungen gewinnt man nur etwa 25 % des oben genannten<br />
Fördervolumens. 62<br />
Nach dem Verordnungsantrag des Landes Nordrhein-Westfalen (Bundesrat, Drucksache 388/11 vom<br />
29.06.2011) zur Änderung der UVP-V Bergbau soll der Anwendungsbereich für die Durchführung der<br />
UVP für die Gewinnung von Erdgas zu gewerblichen Zwecken ausgeweitet werden. Vorgesehen ist, eine<br />
UVP u.a. für Vorhaben der Erdgasgewinnung mit drei oder mehr Bohrstandorten, die betrieblich<br />
durch Leitungen miteinander verbunden sind sowie für Tiefenbohrungen, wenn dabei mit hydraulischem<br />
Druck ein Aufbrechen erfolgt oder unterstützt wird (hier: Fracking), vorzuschreiben.<br />
Nach der Stellungsnahme zur Anhörung von Experten im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
des Deutschen Bundestages am 21. November 2011 63 wird eine allgemeine Vorprüfung<br />
des Einzelfalls nach § 3c UVPG für alle Tight-Gas-, Kohleflözgas- und Schiefer-Projekte gefordert.<br />
8.1.3 Vorläufige und derzeitige Explorationsgebiete ExxonMobil<br />
Die Explorationsgebiete der Fa. ExxonMobil liegen im südwestlichen Teil von Niedersachsen bzw. im<br />
nordwestlichen Teil von Nordrhein-Westfalen.<br />
Die vorläufigen Explorationsgebiete (ungefähre Darstellungen der Lagerstätten) - je ein Gebiet für tight<br />
gas, shale gas und „coal bed methane“-CBM - erstrecken sich in dem Raum nördlich von Dorsten und<br />
Hamm (Nordrhein-Westfalen) bis südlich von Oldenburg (Niedersachsen) (s. nachfolgende Abbildung<br />
8-1 und Anhang 1 und 2).<br />
Von ExxonMobil wurden insgesamt 7 Untersuchungsgebiete (= derzeitige Explorationsgebiete: Rechteckflächen,<br />
3 Explorationsgebiete im shale gas und 4 Explorationsgebiete im CBM) gekennzeichnet<br />
(Ing.-Büro Heitfeld/Schetelig GmbH; 25.08.2011) (s. nachfolgende Auflistung und Abbildung 8-1), welche<br />
die Schwerpunkte der möglichen Bohrvorhaben/Explorationen darstellen.<br />
61<br />
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN, Ausschuss für<br />
Wirtschaft, Mittelstand und Energie, 5. Sitzung, 12.01.2011<br />
62<br />
SCHOLLE, DR., Stellungsnahme zur Anhörung von Experten im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit des<br />
Deutschen Bundestages am 21. November 2011<br />
63<br />
SCHOLLE, DR., Stellungsnahme zur Anhörung von Experten im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit des<br />
Deutschen Bundestages am 21. November 2011<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 64 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Die Explorationsgebiete umfassen nach derzeitigem Kenntnisstand ganz überwiegend Lagerstätten mit<br />
CBM- und Shale Gas-Vorkommen. Mögliche Tight-Gas-Explorationsgebiete befinden sich im Raum<br />
Cloppenburg/Vechta (im erweiterten Bereich der vorläufigen Explorationsgebiete von ExxonMobil).<br />
Auflistung der derzeitigen Explorationsgebiete / Teilgebiete ExxonMobil<br />
Teilgebiete 1 - 3 Nordrhein-Westfalen<br />
Teilgebiet 1: Steinfurt (ca. 270 km²)<br />
Landkreis Steinfurt (Hauptteil); Nordrhein-Westfalen<br />
Landkreis Borken (südwestlicher Teil); Nordrhein-Westfalen<br />
Teilgebiet 3: Münster Süd (ca. 940 km²)<br />
Landkreis Coesfeld (Hauptteil); Nordrhein-Westfalen<br />
Landkreis Warendorf (östlicher Teil); Nordrhein-Westfalen<br />
Landkreis Münster (nördliche Teilfläche); Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
Landkreis Recklinghausen (südwestlicher Teil); NRW<br />
Landkreise Unna und Hamm (südliche Restflächen);<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Teilgebiete 4 - 7 Niedersachsen (vollständig oder überwiegend)<br />
Teilgebiet 4: Östlich von Lingen (ca. 440 km²)<br />
Landkreis Emsland, (Hauptteil); Niedersachsen<br />
Landkreis Osnabrück (nordöstlicher Randbereich); Niedersachsen<br />
Landkreis Steinfurt (südöstlicher Teil), Nordrhein-Westfalen<br />
Teilgebiet 5: Quakenbrück (ca. 500 km²)<br />
Landkreis Osnabrück (Hauptteil); Niedersachsen<br />
Landkreis Vechta (östliche Randflächen): Niedersachsen<br />
Landkreis Cloppenburg (nördliche Randflächen); Niedersachsen<br />
Teilgebiet 2: Borken Süd/Stadtlohn (ca. 960 km²)<br />
Landkreis Borken (Hauptteil); Nordrhein-Westfalen<br />
Landkreis Coesfeld (östlicher Teil); Nordrhein-Westfalen<br />
Landkreis Recklinghausen (südöstlicher Teil); NRW<br />
Landkreis Wesel (südwestliche Randfläche); NRW<br />
Niederlande: nord-westliche Teilfläche<br />
Teilgebiet 6: Südlich von Diepholz (ca. 680 km²)<br />
Landkreis Vechta (nordwestlicher Teil); Niedersachsen<br />
Landkreis Osnabrück (südwestlicher Teil); Niedersachsen<br />
Landkreis Diepholz (nordöstlicher Teil); Niedersachsen<br />
Landkreis Minden-Lübbeke (südöstlicher Teil); NRW<br />
Teilgebiet 7: Südlich von Osnabrück (ca. 720 km²)<br />
Landkreis Osnabrück (Hauptteil); Niedersachsen<br />
Landkreis Steinfurt (westlicher Teil); Nordrhein-Westfalen<br />
Landkreis Warendorf (südlicher Randbereich), NRW<br />
Landkreis Gütersloh, (südöstlicher Teil), Nordrhein-Westfalen<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 65 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
2<br />
1<br />
4<br />
3<br />
5<br />
Abbildung 8-1: Abgrenzung der vorläufigen Explorationsgebiete (ovale Gebiete – braun: Tight-Gas,<br />
grün: Shale Gas, magenta: CBM) u. derzeitigen Explorationsgebiete (Rechtecke 1-7)<br />
Heitfeld / Schetelig, 25.08.2011; Auszug – ergänzende Eintragung der Nummerierung)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 66 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc<br />
7<br />
6
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
8.1.4 Flächenbedarf, Ausbaukonzeption<br />
8.1.4.1 Modellansatz und Gesamtflächenbedarf<br />
Der Flächenbedarf für eine vollständige (flächendeckende) Erschließung einer unkonventionellen Lagerstätte<br />
für Erdgas ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die zum derzeitigen Erkundungs-<br />
/Planungsstand noch nicht alle hinreichend genau geprüft bzw. bekannt sind, insbesondere:<br />
- Art der Lagerstätte (Geologische Formation und Merkmale der Lagerstätten, coal bed methan<br />
(CBM), shale gas, tight gas)<br />
- Ausbaustandard von Bohr-/Gewinnungsplätzen (Einzelbohrplätze, Cluster-Bohrplätze), Bohrtechnik<br />
- Ergiebigkeit der Lagerstätten<br />
- Oberirdische Restriktionen bei der Anlage von Bohr-/Gewinnungsplätzen<br />
Eine erste Abschätzung des Gesamt-Flächenbedarfs für die <strong>oberirdische</strong>n Einrichtungen (Bohr-/Gewinnungsplätze)<br />
kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.<br />
Modellansatz für die Ermittlung des Flächenbedarfs in einem modellhaften Explorationsgebiet mit<br />
100 km² / 400 km² unter folgenden Annahmen:<br />
- Clusterbohrplätze<br />
- Flächenbedarf mit oder ohne Fracking: kein relevanter Unterschied<br />
- Die untertägige Feldgröße entspricht im Sinne einer konservativen Annahme dem <strong>oberirdische</strong>n<br />
Raster (Flächengröße) für die Errichtung von Cluster-Bohrplätzen bei vollständiger Flächenabdeckung<br />
eines Feldes, worst-case-Betrachung (in der Realität aufgrund von <strong>oberirdische</strong>n Einschränkungen<br />
in der Anlage von Cluster-Bohrplätzen in der Regel nicht realisierbar und ohne Berücksichtigung<br />
sonstiger geotechnischer / lagerstättentechnischer Einschränkungen)<br />
Parameter Einheit Shale Gas / Schiefergas Kohleflözgas / Coal bed methane<br />
Untertägige Gewinnungsfläche /<br />
Feld<br />
Anzahl der Cluster 64 pro<br />
(unterirdischem) Feld<br />
Spezifisch: Feldgröße/obertägig<br />
(Ansatz: bildet untertägige Feldgröße<br />
1:1 ab))<br />
km 2 100 400 100 400<br />
St. 20 40 20 100<br />
km 2 5 (500 ha) 10 (1.000 ha) 5 (500 ha) 4 (400 ha)<br />
Flächenbedarf pro Cluster-Bohrplatz (für <strong>Infrastruktur</strong>, Bohrbetrieb/Fracking und Regelbetrieb)<br />
▪ Explorationsphase m 2 3.000 65 3.000 3.000 3.000<br />
▪ Bohrungen / Feldesentwicklung m 2 7.000 - 10.000 10.000 7.000 10.000<br />
▪ Produktionsbetrieb<br />
(permanent) 66<br />
Anzahl der Bohrungen;<br />
im Einzelfall bis zu 20 Bohrungen<br />
Gesamtflächenbedarf 67<br />
im Explorationsgebiet<br />
m 2 < 7.000 < 7.000 < 5.000 < 5.000<br />
ha<br />
%<br />
6 10 bis 20 4 6<br />
20<br />
0,2 %<br />
40<br />
0,1 %<br />
14<br />
0,14 %<br />
100<br />
0,25 %<br />
64<br />
Cluster: Bohrplatz mit mehreren Bohrungen / Produktionsbohrungen<br />
65<br />
Mindestflächenbedarf (Ansatz: eine Explorationsbohrung). Im Regelfall wird der Bohrplatz bereits auf die endgültige Größe<br />
ausgebaut<br />
66<br />
Mindestflächenansatz für Produktionsbetrieb; je nach Standort / Einzelfall kann der Bohrplatz rückgebaut werden auf die Mindestfläche<br />
(wird i.d.R. aus betrieblichen Gründen nicht gemacht, z.B. um bedarfsweise weitere fracs durchführen zu können)<br />
67<br />
Ohne weitere Flächen für Nebeneinrichtungen: Leitungstrassen, Anlagen zu Wiedereinpressung von Lagerstättenwasser, sonstige<br />
Nebenflächen<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 67 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Im Ergebnis lässt sich im worst-case (vollständige flächenhafte Erschließung) ein obertägiges „Einzugsgebiet“<br />
je Clusterplatz von 4 – 10 km² angeben. Entsprechend kann der Abstand der einzelnen<br />
Bohrplätze abgeschätzt werden.<br />
Damit ist mit rechnerisch 10 bis 25 Bohrplätzen auf 100 km² (Bezugsrahmen) zu rechnen.<br />
Im wahrscheinlichsten Fall ist ein obertägiges „Einzugsgebiet“ je Clusterplatz von 9 km² anzusetzen.<br />
68 Damit ist rechnerisch eine Anzahl von rd. 22 Bohrplätzen für ein Gebiet von 200 km²<br />
möglich.<br />
Die Gastrocknungsanlagen sollen nach derzeitiger Konzeption an zentraler Stelle in einem Gewerbe-/<br />
Industriegebiet angeordnet werden (Konzept: Anschluss 1 Gastrocknungsanlage an 10 Clusterplätze;<br />
Ziel: 4 Gastrocknungsanlagen für insgesamt 40 Cluster-Plätze; inkl. Verdichterstation).<br />
Ebenfalls zentral geplant werden <strong>Betrieb</strong>sgebäude sowie Verpressungsstationen für die Verpressung<br />
der aufbereiteten wässrigen Fraktion des „back-flow“ und von Lagerstättenwasser in den Untergrund.<br />
Zeitliche Ablaufplanung<br />
Nach Auskunft von ExxonMobil (2012) ist der Einsatz von gleichzeitig bis zu vier Bohrgeräten geplant.<br />
Mit einem Bohrgerät lassen sich rd. 12-15 Bohrungen pro Jahr herstellen, insgesamt also rd. 50-60<br />
Bohrungen pro Jahr.<br />
In Abhängigkeit der Anzahl der Bohrungen je Clusterfeld (Spanne von 4 bis 10, im Einzelfall bis 20 Bohrungen)<br />
lassen sich somit etwa 6 bis 15 Bohr-/Gewinnungsplätze (im Einzelfall bei mehr als 10 Bohrungen<br />
je Clusterfeld entsprechend weniger) erschließen.<br />
Bei einer Gesamt-Feldesgröße von 100 km² (Bezugsrahmen) und einem durchschnittlichen „Erschließungsgebiet<br />
je Clusterplatz“ von 9 km² (= 11 Bohrplätze) würde die Erschließung (reine Bohrtätigkeit<br />
während der Feldesentwicklung) bei 14 Bohrungen je Clusterplatz (insgesamt 154 Bohrungen) ca. 2 - 3<br />
Jahre in Anspruch nehmen (50-60 Bohrungen/Jahr).<br />
Bei einer Gesamt-Feldesgröße von 200 km² (näheres siehe Kapitel 8.1.4.2) würde die Erschließungsdauer<br />
(reine Bohrtätigkeit während der Feldesentwicklung) analog dazu ca. 4 - 6 Jahre andauern. Nicht<br />
eingerechnet sind dabei u.a. die Explorationsphase, Genehmigungsphasen und Auf- und Abbauphasen<br />
der Bohranlagen.<br />
Die derzeitigen Explorationsgebiete gemäß der Abbildung 8-1 sind zwischen rd. 270 km² und rd. 960<br />
km² groß.<br />
Es ist davon auszugehen, dass mit der steigenden Feldesgröße (bis zu ca. 960 km²) eine höhere Anzahl<br />
Bohrgeräte zum Einsatz kommt und somit derzeit keine abschließenden Angaben zur<br />
Erschließungsdauer gemacht werden können.<br />
68 Email vom 23.03.2012, Herr Kassner, ExxonMobil<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 68 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
8.1.4.2 Schematisches Muster einer Verteilung von Bohrplätzen / Gewinnungsanlagen in<br />
einem Explorationsgebiet<br />
Die nachfolgende Abbildung 8-2 zeigt idealisiert/schematisch die Verteilung von Bohrplätzen in einem<br />
Explorationsgebiet im wahrscheinlichsten Ausbauzustand (angenommene Rastergröße 9 km², Größe<br />
Bohrplatz ca. 1 ha/maßstabsgerecht im Raster dargestellt).<br />
Zusätzlich wurden modellhaft die Leitungsführungen eingezeichnet, um ein schematisches Bild der Flächenverteilung<br />
im Raum darzustellen. Die Leitungen führen jeweils zu zwei Gasaufbereitungs-<br />
/trockungsanlagen, die sich jeweils in Gewerbegebieten befinden.<br />
Abbildung 8-2: Verteilung von Bohrplätzen in einem Explorationsgebiet – schematisiert/modellhaft<br />
(Rastergröße ca. 9 km², Größe Bohrplatz ca. 1 ha / maßstabsgerechte Darstellung)<br />
Blau: Clusterplätze (22 Stk.), Magenta: Trassenführung,<br />
Orange: Gastrocknungs-/-aufbereitungsanlagen, Wasseraufbereitung<br />
Diese Abbildung dient lediglich zur Verdeutlichung der Aufgabenstellung, sich mit den räumlichen Strukturen<br />
und Kriterien für eine flächenhafte Standortauswahl geeigneter Bohr-/Gewinnungsplätze auseinander<br />
zu setzen - nach möglichst einheitlichen, nachvollziehbaren Kriterien.<br />
Die Festlegung der Bohrplätze erfolgt unter Berücksichtigung der konkreten standörtlichen Verhältnisse<br />
(lagerstättentechnische Kriterien, <strong>Infrastruktur</strong>anbindung/Zuwegung, Abstände zu Siedlungsflächen, naturschutzfachliche<br />
Belange etc.), so dass sich in der Praxis ein weniger gleichmäßig verteiltes Bohrplatz-Raster<br />
ergeben dürfte.<br />
Angaben zu möglichen Leitungsquerschnitten sind in Kapitel 4.3 enthalten.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 69 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Im Folgenden wird eine modellhafte Flächenabschätzung durchgeführt, um die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
durch Bohrplätze, Leitungen (Gasleitungen, Lagerstättenwasser, leitungsgebundener back-flow<br />
Transport) und die dazu gehörigen Gastrocknungs-/-aufbereitungsanlagen modellhaft hochrechnen zu<br />
können (siehe hierzu Abbildung 8-2).<br />
In einem 200 km² großen Landschaftsraum werden 22 Bohrplätze á14 Bohrungen (Rastergröße je<br />
Bohrplatz 9 km², Abstand der Bohrplätze zueinander ca. 3 km) verteilt. Hierbei sind zum einen Abstände<br />
zu Siedlungsflächen/Einzelgehöften zu beachten (200 bzw. 100 m), zum anderen sind die Bohrplätze<br />
vorzugsweise an bestehenden Wegeverbindungen platziert worden, um die vorhandenen <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen<br />
nutzen zu können. Siedlungsflächen und Einzelgehöfte sind Ausschlussflächen. Hier<br />
befindet sich kein Bohrplatz. Die Trassenführung der Leitungen zu den 2 Gastrocknungs-/aufbereitungsanlagen<br />
(Ziel: Anschluss von ca. 10 Bohrplätzen an eine Gasaufbereitungsanlage; hier:<br />
jeweils Anschluss von 11 Clusterplätzen an eine Gastrocknungs-/-aufbereitungsanlage) orientieren sich<br />
überwiegend an vorhandenen Wegestrukturen. Die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> für die Leitungsführung<br />
wird mit einem jeweils 2 m breiten Schutzstreifen beidseitig der Trassenführung (insges. 4 m) kalkuliert.<br />
Es wird angenommen, dass sich benötigte Aufbereitungseinheiten für das Lagerstättenwasser und den<br />
den back-flow am Standort der Gastrocknungs-/-aufbereitungsanlage mit angliedern.<br />
Im vorgestellten Beispiel gemäß Abbildung 8-2 ergibt sich Folgendes:<br />
�� <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> durch 22 Clusterplätze (je 1 ha) ca. 220.000 m²<br />
�� <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> durch Aufbereitungsanlagen (Gas, Wasser) ca. 5.000 m²<br />
�� Trassenlänge für die Leitungen: ca. 72,5 km.<br />
Grundsätzlich stellt die Trassenführung eine temporäre <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> dar. Nach Leitungsverlegung<br />
kann die Fläche unter Berücksichtigung von Sicherheitsbestimmungen (Sicherung der Trasse<br />
gegen unbefugtes Zerstören etc.) und Vorgaben bei einer evtl. Bepflanzung (z.B. keine tiefwurzelnden<br />
Bäume) wieder genutzt werden (z.B. für die landwirtschaftliche Nutzung).<br />
Nach dem Zielkonzept von ExxonMobil ist vorgesehen, die Aufbereitungsanlagen (Gas, Wasser) in<br />
Industrie-/Gewerbegebieten anzusiedeln, sodass sich hier keine Eingriff in Natur und Landschaft ergeben.<br />
Sollte im Einzelfall kein geeigneter Industrie-/Gewerbestandort verfügbar sein, können die Aufbereitungsanlagen<br />
dann an einem (flächenmäßig größer dimensionierten) Bohrplatzstandort aufgestellt<br />
werden.<br />
Im Falle der beschriebenen modellhaften Darstellung ist von einem Zeitraum (reine Bohrtätigkeit während<br />
der Feldesentwicklung) von ca. 4 - 6 Jahren auszugehen. Zusätzlich ergeben sich u.a. Zeitabschnitte<br />
für die Explorationsphase, Genehmigungsverfahren und Auf- und Abbauphasen.<br />
8.1.5 Explorationsgebiete in Nordrhein-Westfalen<br />
8.1.5.1 Kriterien<br />
Die Beschreibung der einzelnen derzeitigen Explorationsgebiete/Teilflächen (s. Abbildung 8-1 in Kapitel<br />
8.1.3, Teilgebiete 1-3) erfolgt hier exemplarisch für die Teilfläche 3 und hat das Ziel, die räumlichen/regionalplanerischen<br />
Anforderungen zu umreißen bzw. zu thematisieren und insofern auf das Erfordernis<br />
einer geordneten Explorationsplanung hinzuweisen.<br />
Grundlage der Beschreibung sind zunächst die Kriterien nach dem Entwurf Fortschreibung des Regionalplans<br />
Münsterland, Sept. 2010 (Text und Kartenteil M. 1:50.000), da die Teilfläche 3 nahezu vollständig<br />
über den Regionalplan Münsterland abgedeckt werden. Die nur randlich betroffenen sonstigen<br />
Planungsräume (z.B. Gebietsentwicklungsplan Emscher-Lippe) werden nicht betrachtet.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 70 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Die Beschreibung der Explorations-Teilfläche 3 (s. Kapitel 8.1.5.2) beinhaltet:<br />
- Eine Beschreibung hinsichtlich Lage und naturräumliche Einordnung/Landschaftsräume. Letztere<br />
können auch als eine Grundlage/Orientierungshilfe bei Standortentscheidungen/-planungen für<br />
Bohrplätze (Eingriffe in die Landschaft bzw. das Landschaftsbild) sowie der Planung von Kompensationsmaßnahmen<br />
dienen.<br />
- Eine Beschreibung des Gebiets nach raumordnungsrelevanten Kriterien. Die Beschreibung beschränkt<br />
sich im Wesentlichen auf die zeichnerisch dargestellten Ziele und Grundsätze des Regionalplans,<br />
mit ergänzenden Informationen/Hinweisen.<br />
Erläuterung / Diskussion der Kriterien des Regionalplans Münsterland, Sept. 2010 Entwurf:<br />
1. Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben, abschließend abgewogene Festlegungen; diese<br />
Ziele sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten, d.h. sie können nicht im<br />
Wege der Abwägung überwunden werden.<br />
2. Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes<br />
als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Sie sind bei raumbedeutsamen<br />
Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen, d.h. in die planerische Abwägung einzustellen<br />
und können daher im Gegensatz zu Zielen im Wege der Abwägung überwunden werden.<br />
Erläuterung der Kriterien im Einzelnen:<br />
1. Zeichnerisch dargestellte Ziele der Raumordnung (Auswahl) - Vorranggebiete<br />
Bereiche zur Sicherung und zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze (zugleich Wirkung von<br />
Eignungsgebieten): Vorranggebiete, die der langfristigen Sicherung von Flächen zum Abbau oberflächennaher<br />
Bodenschätze dienen. Nicht mit der Rohstoffgewinnung vereinbarende Nutzungen sind auszuschließen.<br />
Im Einzelfall wäre insofern zu prüfen, ob ein Standort für einen Bohrplatz bzw. für eine<br />
Gewinnungsanlage für eine Erdgasförderung aus einer unkonventionellen Lagerstätte mit dem Ziel der<br />
Sicherung von oberflächennahen Bodenschätzen zu vereinbaren ist.<br />
Allgemeine Siedlungsbereiche / Industrieansiedlungsbereiche (auch für zweckgebundene Nutzungen):<br />
Allgemeine Siedlungsbereiche (Bestand und Planung) sind nicht durch eine <strong>Flächeninanspruchnahme</strong><br />
betroffen; auf die möglichen indirekten Wirkungen (s. Kapitel 4 und Kapitel 5.2)<br />
wird hingewiesen, insbesondere auf die Anforderungen bzgl. Lärmschutz. Unbeschadet der zeichnerischen<br />
Darstellungen von Siedlungsbereichen im Regionalplan gilt dies auch für Splitter-<br />
/Streusiedlungen und Einzelanwesen.<br />
Flächen/Bereiche für Industrie und Gewerbe wären ggf. für nachgeordnete Einrichtungen im Zusammenhang<br />
mit der Gasförderung (z.B. Anlagen zur Gastrocknung, Verdichterstationen zu prüfen,<br />
soweit dies nach sicherheitstechnischen und bauleitplanerischen Kriterien möglich ist.<br />
Waldbereiche: Vorranggebiet bzw. der Vorrang des Waldes ist zu beachten. Insbesondere dürfen<br />
Waldgebiete nur für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden, wenn die angestrebte Nutzung<br />
nicht außerhalb des Waldes realisierbar ist, der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt<br />
wird und (bei unabweisbarer Inanspruchnahme) eine flächengleiche Ersatzaufforstung erfolgt.<br />
Bereiche für den Schutz der Natur (ökologisch hochwertige, schutzwürdige/-bedürftige Gebiete; u.a.<br />
Naturschutzgebiete (ausgewiesen, einstweilig sichergestellt, zukünftige Ausweisung), FFH-Gebiete,<br />
europäische Vogelschutzgebiete):<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 71 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Den Bereichen für den Schutz der Natur ist dem Arten- und Biotopschutz Vorrang vor beeinträchtigenden<br />
Maßnahmen einzuräumen. Nutzungseingriffe wie die Anlage von Bohr-/Gewinnungsplätzen<br />
haben sich insofern den biotop- und artenschutzfachlichen Erfordernissen zur Erhaltung und Entwicklung<br />
anzupassen.<br />
Hinweis 1: FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete: Hinweis auf Prüfung der für die Gebiete geltenden<br />
Erhaltungsziele.<br />
Hinweis 2: Gebiete unterhalb der Darstellungsschwelle von 10 ha (Gebiet < 10 ha im Regionalplan nicht<br />
zeichnerisch dargestellt): prüfen auf Ebene der Schutzgebietsverordnungen, Standarddatenbögen,<br />
Landschaftspläne etc. bzw. durch Vor-Ort-Bestandsaufnahmen.<br />
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche mit zweckgebundener Nutzung: Ferieneinrichtungen<br />
und Freizeitanlagen, Militärische Einrichtungen - Zweckbindungen in Allgemeinen Freiraum- und<br />
Agrarbereichen sind zu beachten, wie z.B. Ferien- und Freizeitanlagen. Militärische Einrichtungen im<br />
Freiraum sind für die Dauer ihrer Nutzung zu sichern. Im Einzelfall wäre zu prüfen, ob bei einer Aufgabe<br />
von militärischen Nutzungen diese unter Beachtung der zukünftigen Ziele für die Anlage von Bohr-<br />
/Gewinnungsplätzen geeignet sind.<br />
Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz + Oberflächengewässer: Vorranggebiet zum<br />
Schutz von Grundwasser und Gewässer. Grundwasser wird hier nicht weiter betrachtet. Im Hinblick auf<br />
Oberflächengewässer: Keine Inanspruchnahme von Gewässern; Einzelfallbetrachtung: Ökologische<br />
Funktionen und die Qualität dürfen nicht beeinträchtigt werden.<br />
Überschwemmungsbereiche: Vorranggebiete, die vor entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten<br />
sind (insbesondere Freihalten von zusätzlichen Siedlungsflächen). Inwieweit im Einzelfall bauliche Anlagen<br />
zulässig wären, wäre im Einzelfall zu prüfen unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen<br />
und ökologischen Belange.<br />
Windenergieeignungsbereiche (Eignungsgebiete): Windkraftanlagen sind in der Regel nur innerhalb<br />
der Eignungsbereich zulässig. In diesen Bereichen sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen,<br />
soweit diese mit dem Bau und <strong>Betrieb</strong> von Windkraftanlagen nicht vereinbar sind. Insofern<br />
wäre im Einzelfall zu prüfen, inwieweit diese Eignungsgebiet für die Errichtung von Bohr-/Gewinnungsplätzen<br />
in Frage kommen, zumal in diesen Flächenbereichen bereits im planerischen Abwägungsprozess<br />
auf Ebene der Regionalplanung z.B. besonders schutzwürdige Bereiche für Natur und Landschaft<br />
und Räume mit hoher artenschutzrechtlichen Bedeutung ausgeschlossen worden sind.<br />
2. Zeichnerisch dargestellte Grundsätze der Raumordnung (Auswahl) - Vorbehaltsgebiete<br />
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche: Vorbehaltsgebiete mit dem Grundsatz, die Freiräume wegen<br />
ihrer Nutz- und Schutzfunktionen und ihrer Funktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere grundsätzlich<br />
zu erhalten. Im Rahmen der Standortplanungen sind die Freiraumfunktionen im Einzelfall in die<br />
Prüfung/Abwägung einzubeziehen. Ein besonderes Gewicht im Rahmen der Prüfung von Standortflächen<br />
für Bohr-/Gewinnungsplätzen ist besonders schutzwürdigen Böden und Böden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit<br />
beizumessen.<br />
Die agrarstrukturellen Belange sind bei der Standortauswahl von Bohr-/Gewinnungsplätzen insofern<br />
zu beachten, als dass diese Vorrang vor anderen Nutzungen haben; Bestand / Entwicklungsmöglichkeit<br />
der Landwirtschaft sollen nicht gefährdet werden.<br />
Bereich für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung: Vorbehaltsgebiet<br />
für die Erhaltung des Landschaftsbildes, die ökologischen Funktionen und die natürliche<br />
Vielfalt. Planungen und Maßnahmen, die zu Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes<br />
führen, sollen möglichst vermieden werden.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 72 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
8.1.5.2 Beschreibung / Analyse der Teil-Explorationsfläche 3 in NRW<br />
Im Folgenden wird beispielhaft für die Teil-Explorationsflächen 1-3 in NRW die Teilfläche 3 beschrieben.<br />
Die Teilfläche 3 wurde ausgewählt, da es sich hier um eine der beiden größten Flächen handelt<br />
und dadurch zahlreiche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete der Raumordnung betroffen sind.<br />
Teilgebiet 3 Münster Süd<br />
Kartendarstellung: siehe nachfolgende Abbildung 8-3 sowie Anlage (2) und Anlage (3.3)<br />
Landschaft und Struktur: Das Explorationsgebiet Münster Süd liegt süd-/südwestlich der Stadt Münster<br />
und erstreckt sich in Ost-West-Richtung von Dülmen im Westen bis Ahlen im Osten und nach Süden<br />
bis auf Höhe der Gemeinden Nordkirchen und Herbern. Verkehrsinfrastruktur: A 43 im Westen und die<br />
Nord-Süd-Richtung verlaufende A 1 sowie als Wasserstraße der Dortmund-Ems-Kanal.<br />
Das Explorationsgebiet umfasst eine Fläche von rd. 20 km (Nord-Süd) auf rd. 47 km in der Ost-Westausstreckung,<br />
mithin mit eine Flächengröße von rd. 940 km² 1) .<br />
Abbildung 8-3: Teilfläche 4 - Ausschnitt TK M. 1: 200.000; hier unmaßstäblich verkleinert<br />
1) Bei 940 km² errechnet sich bei einer Bohrplatzdichte von je einem Bohrplatz je 9 km² - ohne Berücksichtigung<br />
von Einschränkungen durch Siedlungsbereiche, sonstige Ausschlusskriterien/Restriktionen - eine Bohrplatzanzahl<br />
von rd. 100 Bohrplätzen<br />
Das Gebiet ist der Großlandschaft des Kernmünsterlandes zuzuordnen. Bestimmend für das Kernmünsterland<br />
sind typische Parklandschaften mit kleinen Waldparzellen, Hecken, Gebüschen und Gehölzstreifen<br />
an Bächen und Gräben sowie Baumgruppen an verstreut liegenden Höfen. In der Landnutzung<br />
dominiert die Ackernutzung; große Waldbereiche sind nur noch reliktisch vorhanden. Der<br />
Strukturreichtum ist trotz der ausgeprägten agrarischen Nutzung groß durch naturnahe Fließgewässer,<br />
Stillgewässer, Gräften, Gräben sowie Gehölze. Kulturhistorisch zeichnet sich der Raum durch eine<br />
Vielzahl von historischen Elementen / Bebauungen und Einzelgehöften aus. Die Siedlungsstruktur ist<br />
(außerhalb der Städte) locker und durch kleine Dörfer und Einzelanwesen geprägt.<br />
Besonderheiten im Explorationsgebiet sind die Bischofsstadt Münster und Nordkirchen Park und Umgebung.<br />
Leitbild und Ziel für diese Kulturlandschaften ist insbesondere der Erhalt der Münsterländischen<br />
Parklandschaft mit den weiten offenen Blickbeziehungen, der Vielfalt und der Naturnähe der<br />
Landschaft. Blickbeziehungen bei der Errichtung von <strong>Infrastruktur</strong>anlagen wie Richtfunkmasten, Windkraftanlagen<br />
sind zu berücksichtigen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 73 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Abbildung 8-4: Auszug aus dem Regionalplan Münsterplan (Entwurf, 2010)<br />
– Auszug Teilfläche 3 (s. Anlage 3.3)<br />
Bereiche zur Sicherung und zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze (zugleich Wirkung von<br />
Eignungsgebieten): Flächen mit dieser Ausweisung finden sich nur kleinräumig/vereinzelt im Explorationsgebiet.<br />
Allgemeine Siedlungsbereiche / Industrieansiedlungsbereiche (auch für zweckgebundene Nutzungen):<br />
Neben den Siedlungsbereichen (Städte/Dörfer mit entsprechenden Schutzabständen, mind.<br />
200 m) sind insbesondere die Einzelgehöfte restriktiv bei der Auswahl von Bohrplätzen (bei Einhaltung<br />
des erforderlichen Schutzabstandes von mind. 100 m). Industrieansiedlungsbereiche müssten im Einzelnen<br />
auf ihre mögliche Eignung für zentrale nachgeschaltete Einrichtungen wie Gasaufbereitung etc.<br />
untersucht werden.<br />
Waldbereiche/Bereiche für den Schutz der Natur: Größere Waldbereiche finden sich insbesondere<br />
südlich von Münster („Die Davert“). Dieses zusammenhängende, ausgedehnte historische Waldgebiet<br />
ist als FFH-Gebiet (Waldbiotop von internationaler Bedeutung) ausgewiesen (Vorranggebiet Schutz der<br />
Natur). Weitere wichtige Waldbereiche finden sich nordöstlich von Nordkirchen (FFH-Gebiet, Vorranggebiet<br />
Schutz der Natur), südwestlich von Ahlen (teilw. zweckgebundene Nutzung Militär), nördlich<br />
von Lüdinghausen (Dicke Mark, Berenbrock), um Buldern und südlich von Dülmen (Zweckbindung Militär,<br />
Nachfolgeausweisung: Vorranggebiet Schutz der Natur). Weiterhin sind zahlreiche kleinere Waldflächen<br />
mit Schutzfunktionen (Schutz der Natur, Vorbehaltsgebiet Schutz der Landschaft aufgewiesen)<br />
zu finden.<br />
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche mit zweckgebundener Nutzung: „Ferieneinrichtungen<br />
und Freizeitanlagen“ gemäß der Kartendarstellung des Regionalplanes befinden sich im Bereich Lüdinghausen<br />
und Senden sowie südlich von Hiltrup. „Militärische Einrichtungen“ sind mit den Truppenübungsplätzen<br />
Borkenberge (südlich Dülmen) und Ahlen (südwestlich von Ahlen) dargestellt.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 74 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz, Oberflächengewässer / Überschwemmungsbereiche:<br />
Grundwasser – insbesondere das Schutzgebiet Hohe Ward (südöstlich von Münster).<br />
Im Hinblick auf den Gewässerschutz und Überschwemmungsbereiche haben praktisch alle Fließgewässer<br />
besondere Schutzfunktionen und sind als Gewässerschutzbereiche / Überschwemmungsbereiche<br />
ausgewiesen.<br />
Windenergieeignungsbereiche: Im Explorationsgebiet sind größere Teilflächen als Windenergieeignungsbereiche<br />
ausgewiesen. Diese zeichnen sich meist ohne eine weitere Überlagerung mit einer anderen<br />
Schutzfunktion (Vorranggebiet) aus.<br />
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche: Das gesamte Explorationsgebiet ist überwiegend (soweit<br />
nicht durch ein Vorranggebiet Siedlung / Wald gekennzeichnet) als Vorbehaltsgebiet „Allgemeine Freiraum-<br />
und Agrarbereiche“ ausgewiesen. Die Funktionen dieser Flächen für Pflanzen und Tiere sind<br />
grundsätzlich zu erhalten. Die Bodenfruchtbarkeit und die agrarstrukturellen Belange sind in diesen Bereichen<br />
besonders zu beachten. Weite Teile der so gekennzeichneten Flächen sind zudem als Bereich<br />
für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung gekennzeichnet.<br />
Im Ergebnis/Zusammenfassend:<br />
Das Kernmünsterland zeichnet sich durch eine hoch schützenswürdige Park- und Kulturlandschaft aus.<br />
Auf größeren Teilflächen sind Waldflächen mit hohen Biotopschutzfunktionen (FFH-Gebiete, Bereiche<br />
für den Schutz der Natur) vorhanden. Innerhalb des großflächigen Explorationsgebietes befinden sich<br />
mehrere Ortslagen. Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen finden sich - über das ganze<br />
Explorationsgebiet verteilt - eine Vielzahl an Einzelgehöften. Die an mehreren Stellen ausgewiesenen<br />
Windenergieeignungsbereiche zeichnen sich durch ein geringeres Maß an überlagernden Schutzfunktionen<br />
aus.<br />
Bei einer flächenhaften Erschließung des Explorationsgebietes sind Konfliktpotenziale mit den vorhandenen<br />
unterschiedlichen Schutz- und Nutzungsansprüchen - wie vorstehend beschrieben - gegeben.<br />
8.1.6 Explorationsgebiete in Niedersachsen<br />
8.1.6.1 Kriterien<br />
In Niedersachsen sind die Träger der Regionalplanung die Landkreise. Die in den derzeitigen Explorationsgebieten<br />
von ExxonMobil liegenden Landkreise sind in Kapitel 8.1.3, siehe auch Abbildung 8-1,<br />
aufgeführt.<br />
Die Kriterien für die darstellende Beschreibung werden hier stellvertretend für die Teilfläche 4 „Östlich<br />
von Lingen“ bzw. nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 Landkreis Emsland diskutiert.<br />
Die Kriterien sind weitgehend vergleichbar mit den Raumordnungsprogrammen für die übrigen Landkreise<br />
in Niedersachsen, siehe Aufstellung in Kapitel 8.1.3.<br />
Die nachfolgend aufgeführten raumordnungsrelevanten Kriterien (Raumordnungsprogramm Landkreis<br />
Emsland, 2010) beschränken sich im Wesentlichen auf die zeichnerisch dargestellten Ziele (Vorranggebiete)<br />
und Grundsätze (Vorbehaltsgebiete), mit ergänzenden Informationen/Hinweisen:<br />
Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder<br />
bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogene Festlegungen zur Entwicklung,<br />
Ordnung und Sicherung des Raums<br />
Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als<br />
Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen (§ 3 (1) Nr. 2 und 3 Raumordnungsgesetz)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 75 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
1. Raum- und Siedlungsstruktur: Vorhandene bauleitplanerisch gesicherte Bereiche bzw. vorhandene<br />
Bebauungen dienen der Siedlungsentwicklung der Städte und Gemeinden und stehen für Anlagen<br />
der Gasförderung grundsätzlich nicht zur Verfügung. Auf die erforderlichen Schutzabstände zu Siedlungsbereichen<br />
ist in Kapitel 5.2.2.1 eingegangen.<br />
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für industrielle Anlagen und Gewerbe wären im Hinblick auf ihre Eignung<br />
für nachgeordnete Einrichtungen im Zusammenhang mit der Gasförderung (z.B. Anlagen zur Gastrocknung,<br />
Verdichterstationen) zu prüfen, soweit dies nach sicherheitstechnischen und bauleitplanerischen<br />
Kriterien möglich ist.<br />
2. Natur und Landschaft: Vorranggebiet Natura 2000: Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen<br />
müssen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. Die Vorranggebiete Natura<br />
2000 können sich mit Vorranggebieten für Natur und Landschaft und anderen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten<br />
überlagern, soweit diese Festlegungen nicht im Widerspruch mit der Vorrangnutzung Natura<br />
2000 stehen. Planungen und Maßnahmen müssen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar<br />
sein.<br />
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft: Unter den Vorrangebieten für Natur und Landschaft<br />
sind neben vorhandenen Naturschutzgebieten weitere für den Naturschutz wertvolle Gebiete internationaler,<br />
nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung festgelegt. In den Vorranggebieten für<br />
Natur und Landschaft müssen alle raumbedeutsamen Maßnahmen so abgestimmt werden, dass diese<br />
Gebiete in ihrer Eignung und ihrer besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.<br />
Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft umfassen Landschaftsschutzgebiete und weitere Gebiete.<br />
3. Erholung: Vorranggebiete für „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ sind aufgrund ihrer landschaftlichen<br />
Eignung für die Erholung sowie das ungestörte Erleben der Natur für die Bevölkerung vorzuhalten<br />
und zu sichern. Die Vorranggebiete „Erholung mit starker Inanspruchnahme“ sind gekennzeichnet<br />
durch ihre räumliche Nähe zu Siedlungsgebieten und werden aufgrund ihrer Attraktivität in hohem<br />
Maße beansprucht.<br />
Weitere Vorranggebiete für Erholungszwecke, die im Rahmen einer Standortauswahl für Bohr-/Gewinnungsplätze<br />
zu beachten sind, sind regional bedeutsame Sportanlagen und regional bedeutsame Wanderwege.<br />
Diese Vorranggebiete weisen eine besondere Bedeutung für die einheimische Bevölkerung<br />
und für den Tourismus auf und sind entsprechend zu sichern.<br />
Vorbehaltsgebiete für Erholung, die aufgrund ihrer natürlichen Eignung und ihres landschaftlichen Wertes<br />
für verschiedene Erholungsaktivitäten von Bedeutung sind, sollen gesichert und weiterentwickelt<br />
werden; bei raumbedeutsamen Maßnahmen sollen diese Gebiete in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt<br />
werden.<br />
Neben den Vorranggebieten sind weiterhin noch Standorte mit besonderen Entwicklungsaufgaben und<br />
in den Bereichen Tourismus und Erholung zu beachten. Bei letzteren ist insbesondere die umgebende<br />
Landschaft für Erholung und Freizeit, Umweltqualität etc. zu sichern und zu entwickeln.<br />
4. Landwirtschaft: Landwirtschaftlich wertvolle Flächen sind als Vorbehaltsgebiete - auf Grund hohen<br />
Ertragspotenzials festgelegt.<br />
Weitere landwirtschaftliche Flächen mit vergleichsweise geringem Ertragspotenzial sind auf Grund besonderer<br />
Funktionen als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen (hoher Grundwasserstand zum Beispiel). Auf<br />
diesen Flächen soll möglichst eine standortgerechte Bodennutzung aufrecht erhalten bleiben (oftmals<br />
Überlagerung mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft).<br />
5. Forstwirtschaft: Waldflächen sind als Vorbehaltsflächen in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesen.<br />
Diese können auch mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur und Land und/oder Erholung<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 76 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
überlagert sein. Die Darstellung als Vorbehaltsfläche dient insbesondere dazu, die Waldflächen dauerhaft<br />
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Zur Sicherung der Waldbestände soll bei der Aus-<br />
/Neubau von Verkehr- und Leitungsinfrastruktur möglichst nicht zu Lasten des Waldes gehen bzw.<br />
Funktionsverluste sind zu vermeiden.<br />
Flächen zur Vergrößerung des Waldanteils (Waldmehrung) sind als Vorbehaltsgebiet dargestellt.<br />
6. Bodenschutz – Nach § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder<br />
wiederherzustellen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner Funktion als Archiv<br />
der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. Eine gesonderte (zeichnerische)<br />
Darstellung erfolgt nicht.<br />
7. Kulturelle Sachgüter – Keine gesonderte (zeichnerische) Darstellung; Einzelfallprüfung im Rahmen<br />
der konkreten Festlegung von Bohrstandorten.<br />
8. Lärmschutz – Lärmbereiche (Fluglärmzonen); im Einzelfall zu prüfen bzw. zu beachten<br />
9. Rohstoffgewinnung: Als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung sind regional bedeutsame Torf-,<br />
Sand- und Tonvorkommen festgelegt. Planungen und Maßnahmen (in der näheren Umgebung von Vorranggebieten<br />
Rohstoffgewinnung) dürfen die benachbarte Nutzung Rohstoffgewinnung nicht beeinträchtigen.<br />
Zur längerfristigen regionalen Bedarfsdeckung sind weiterhin Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung<br />
festgelegt.<br />
10 Verkehr – Insofern nicht betrachtungsrelevant, als dass Verkehrsinfrastrukturanlagen nicht als Bohr-<br />
/Gewinnungsplätze in Frage kommen und Sicherheitsabstände entsprechend geregelt sind.<br />
11. Wasserwirtschaft: Vorranggebiete für die Trinkwassergewinnung umfassen die festgesetzten und<br />
geplanten Wasserschutzgebiete um die Wasserwerke. Weiterhin sind in der zeichnerischen Darstellung<br />
Vorbehaltsgebiete für Trinkwassergewinnung dargestellt. In diesen Vorbehaltsgebieten sind alle raumbedeutsamen<br />
Maßnahmen / Planungen so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und ihrer<br />
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.<br />
Weitere Vorrang- und Vorbehaltsgebiete betreffen die Abwasserbehandlung und den Hochwasserschutz.<br />
Die Vorranggebiete Hochwasserschutz sind von Bebauung freizuhalten. Überschwemmungsgebiete<br />
(keine zeichnerische Darstellung) sind in ihrer Funktion als natürliche Rückhalteräume zu sichern.<br />
12. Weitere Ziele (Vorranggebiete) und Grundsätze (Vorbehaltsgebiete) betreffen die Abfall- und<br />
Energiewirtschaft und Bereiche für besondere öffentliche Zwecke. Im Einzelfall könnte geprüft werden,<br />
inwieweit sich hieraus für die Anlage von Bohr-/Gewinnungsplätzen ggf. Synergieeffekte realisieren lassen.<br />
Dies wäre insbesondere auch für Vorranggebiete für Windenergienutzung zu prüfen (Bündelungsgebot).<br />
Dies wäre im Übrigen auch für bauleitplanerisch rechtsgültig gewordene Sondergebiets-/Sonderbauflächen<br />
für Windenergie oder für sonstige Energieerzeugungsanlagen zu prüfen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 77 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
8.1.6.2 Beschreibung / Analyse der Teil-Explorationsfläche 4 in Niedersachsen<br />
Analog zu den Beschreibungen der Teil-Explorationsgebiete in NRW wird auch für die Teil-<br />
Explorationsgebiete in Niedersachsen beispielhaft ein Teilgebiet (hier: Teilgebiet 4 „Östlich von Lingen“)<br />
beschrieben.<br />
Teilgebiet 4: Östlich von Lingen<br />
Kartendarstellung: siehe nachfolgende Abbildung 8-5 sowie Anlage (2) und Anlage (3.4)<br />
Lage und Abgrenzung: Das Explorationsgebiet 4 umfasst den Raum östlich von Lingen bis Freren im<br />
Osten und erstreckt sich nach Süd-/Südost bis zu den Ortslagen Schapen (Hopsten in NRW) und Spele;<br />
Ausdehnung ca. 23 km x 19 km, rd. 440 km² 1) .<br />
Abbildung 8-5: Teilfläche 4 - Ausschnitt TK M. 1: 200.000; hier unmaßstäblich verkleinert<br />
1) Bei 440 km² errechnet sich bei einer Bohrplatzdichte von je einem Bohrplatz je 9 km² - ohne Berücksichtigung<br />
von Einschränkungen durch Siedlungsbereiche, sonstige Ausschlusskriterien/Restriktionen - eine Bohrplatzanzahl<br />
von nahezu 50 Bohrplätzen<br />
Naturräumliche Beschreibung: Das Explorationsgebiet liegt größtenteils in den Landschaftseinheiten<br />
Lingener Land und Plantlünner Sandebene/östliches Bentheimer Sandgebiet (siehe nachfolgende Abbildung).<br />
Die westliche Begrenzung bildet das südliche Emstal. Die Sandebene bzw. das Sandgebiet<br />
ist eine vielgestaltige Landschaftseinheit mit Hoch-/Niedermoor, Talsandflächen, Grund- und Endmoränen,<br />
Flugsandfelder und Kreidegebirge, die zu einem großen Teil auch für Ackerbau genutzt wird. Das<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 78 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Lingener Land ist im Bereich der von West nach Ost verlaufenden Lingener Höhe (bis 91 müNN) bewaldet,<br />
ansonsten (nördlich von Lengerich) großflächige Eignung für Ackerbau.<br />
Abbildung 8-4: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 – Landkreis Emsland<br />
– Auszug Teilfläche 4 (s. Anlage 3.4)<br />
Raum- und Siedlungsstruktur: Die Raum- und Siedlungsstruktur wird / ist durch die Ems bzw. den<br />
Dortmund-Ems-Kanal geprägt. Größere Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für industrielle Anlagen und<br />
Gewerbe finden sich südlich von Lingen (Ems) und bei Spelle.<br />
Natur und Landschaft/Erholung und Bodennutzung: Das Emstal (westlich Dortmund-Ems-Kanal) ist<br />
überlagert mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft, Natura 2000 und Wald. Östlich<br />
davon wechseln sich kleinteilig Acker- und Grünlandflächen; im Bereich Lingener Höhe zusammenhängende<br />
Waldflächen (Funktion auch für die Wasserwirtschaft/Trinkwassergewinnung und<br />
Erholung). In den Talauen von Speller Aa und Große Aa: Überschwemmungsgebiete und Grünlandbewirtschaftung.<br />
Wasserwirtschaft/Trinkwassergewinnung: Vorrangebiete für die Trinkwassergewinnung sind östlich<br />
von Lingen (Ems) im Bereich der Lingener Höhe ausgewiesen. Größere Vorbehaltsgebiete für die TW-<br />
Gewinnung sind um die Gemeinde Schapen und südlich von Freren ausgewiesen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 79 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Forst- und Landwirtschaft: Südlich und auch nördlich der Lingener Höhe, östlich des Emstals findet<br />
sich überwiegend Ackernutzung (hohes Ertragspotenzial, Vorbehaltsgebiet), kleinteilige Nutzungsstruktur,<br />
in den Tallagen Grünland, kleinteilig einzelne Waldflächen (Kiefernforste auf trockeneren Standorten).<br />
Im Ergebnis/Zusammenfassend:<br />
Insbesondere der Bereich westlich des Dortmund-Ems-Kanals, westlich von Lünne (Zusammenfluss<br />
Speller Aa / Große Aa), um Lingen (Ems) und im Bereich der Lingener Höhe überlagern sich zahlreiche<br />
Nutzungsfunktion/-ansprüche an den Raum, was aus der Überlagerung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten<br />
ersichtlich wird. Große Teilflächen (Raum zwischen den Gemeinden Bramsche, Feren, Schapen<br />
und Spelle) werden als Acker- und teilweise als Grünland (Talsandgebiete) genutzt, teilweise gegliedert<br />
durch Wallhecken, und weisen ein hohes Ertragspotenzial aus (Vorranggebiet für Landwirtschaft).<br />
Bei einer flächenhaften Erschließung des Explorationsgebietes sind Konfliktpotenziale mit den vorhandenen<br />
unterschiedlichen Schutz- und Nutzungsansprüchen - wie vorstehend beschrieben - gegeben.<br />
9 Schlussfolgerungen<br />
Im vorliegenden Fachbeitrag wurden ausgehend von den Projektwirkungen zunächst die Wirkungsbeziehungen<br />
und möglichen Konfliktpotenziale auf landschaftsbezogene Schutzgüter betrachtet, die sich<br />
durch die <strong>Flächeninanspruchnahme</strong>, die (<strong>oberirdische</strong>) <strong>Infrastruktur</strong> und den <strong>Betrieb</strong> von Einzel-<br />
Bohrplätzen (Clusterplätze mit bis zu 20 Bohrungen) ergeben können (s. Kapitel 1 bis 5). Zudem wurden<br />
standortbezogene Maßnahmen zur Konfliktminderung, -vermeidung und Kompensation einschließlich<br />
Maßnahmen nach dem Ende der <strong>Betrieb</strong>sphase beschrieben (s. Kapitel 6 und 7).<br />
Der Flächenbedarf für einen Bohrplatz kann mit ca. 7.000 – 10.000 m² zzgl. 1.000 – 2.000 m² für Nebenflächen<br />
(insbesondere Lager Oberboden, Zuwegung) abgeschätzt werden.<br />
Ziel der unkonventionellen Erdgasgewinnung ist, die Lagerstätten in einem Explorationsgebiet möglichst<br />
flächendeckend - unter Berücksichtigung der <strong>oberirdische</strong>n standörtlichen Verhältnisse/Restriktionen<br />
- auszuschöpfen.<br />
Bei einer Bohrplatzdichte von bis zu einem Bohrplatz je 4-10 km² 69 (wahrscheinlichste Bohrplatzdichte 9<br />
km² 70 ) liegen die Einzel-Bohrplätze soweit auseinander, dass sich die räumlichen Einwirkungsbereiche<br />
benachbarter Bohrplätze (Wirk-/Beeinträchtigungszonen) im Regelfall nicht überlagern, sofern keine<br />
besonders sensiblen / empfindlichen Naturräume betroffen sind und auch die Belange der Leitungsführung<br />
/ Trassenführung umweltverträglich angelegt und gestaltet werden können.<br />
Die (<strong>oberirdische</strong>n) Auswirkungen eines oder mehrerer Standorte auf die Landschaft und die damit einhergehenden<br />
landschaftsgebundenen Aspekte lassen sich bei geeigneter Standortauswahl, geeigneter<br />
Technik und geeigneten Minderungsmaßnahmen (Lärmminderung, Eingrünung, Kompensation, Monitoring)<br />
umweltverträglich gestalten (dies zeigen z.B. die bereits genehmigten/durchgeführten Bohrvorhaben).<br />
Die Beeinträchtigungen von landschaftsbezogenen Aspekten der Umwelt durch einen Bohrplatz<br />
sind räumlich begrenzt (Lärm, Licht, Landschaftsbild, <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> und damit verbundene<br />
Wirkungen); auch die Verkehre lassen sich bei geeigneter Erschließung und Standortwahl verträglich<br />
abwickeln.<br />
Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wesentliche wirkungsrelevante Beeinträchtigungen<br />
zeitlich auf die Bohrphase (und das ggf. erforderliche Fracking) begrenzt sind und im Regelbetrieb<br />
der Gasförderung von einer Gewinnungsstelle keine relevanten Wirkungen mehr auf die landschaftsge-<br />
69 Bohrplatzdichte ergibt sich durch begrenzte unterirdische horizontale Erschließungsreichweiten<br />
70 Email vom 23.03.2012, Herr Kassner, ExxonMobil<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 80 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
bundenen Belange - außer der verbleibenden <strong>Flächeninanspruchnahme</strong> - ausgehen. Nach dem aktuellen<br />
Planungskonzept ist vorgesehen, dass <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen für den Regelbetrieb (Gastrocknung/-aufbereitung,<br />
Wasseraufbereitung) an zentralen Sonder-Standorten (z.B. in Gewerbe-/Industriegebieten)<br />
errichtet werden (Nutzung/Anbindung von mehreren Cluster-Bohrplätzen).<br />
In Kapitel 8 (Raumanalyse) wurde der Frage nachgegangen, wie sich der Gesamt-Flächenbedarf und<br />
die möglichen Auswirkungen auf die landschaftsgebundenen Umweltfaktoren bei einer flächendeckenden<br />
Erschließung von Explorationsgebieten mit Bohr-/Gewinnungsplätzen darstellen.<br />
Bei einer Größe der Explorationsgebiete von mehreren Hundert Quadratkilometern und einer unter lagerstättentechnischen<br />
Aspekten angestrebten Bohrplatzdichte von einem Bohrplatz je 9 km² ist - auch<br />
unter Berücksichtigung <strong>oberirdische</strong>r Ausschlussflächen/Restriktionen - von einer Vielzahl an Bohrplätzen<br />
je Explorationsgebiet auszugehen. Dies legt den Schluss nahe, dass die unkonventionelle Erdgasgewinnung<br />
in ihren Auswirkungen nicht nur bezogen auf Einzel-Bohrplätze, sondern im räumlichzeitlichen<br />
Gesamtzusammenhang der Erschließung/Ausschöpfung von großräumigen Explorationsgebieten<br />
zu betrachten ist.<br />
Die Auswirkungen auf die Landschaft und die landschaftsgebundenen Umweltfaktoren (insbesondere<br />
auch Landschaftsbild, Biotope, Arten, Biotopstrukturen, Böden / Bodennutzung, aber auch Erholung),<br />
also der „Landschaftsverbrauch“ lassen sich erst unter diesem Ansatz in ihrer Gesamtheit erfassen.<br />
Dies gilt um so mehr, da die Explorationsgebiete in Landschaftsräumen liegen, die durch die Überlagerung<br />
von regionalplanerischen Schutz- und Nutzungsansprüchen geprägt sind (s. Kapitel 8.1.5 und<br />
8.1.6).<br />
Der Beurteilungs-/Bewertungsmaßstab bzw. der Betrachtungshorizont kann deshalb nicht ausschließlich<br />
auf den Wirkungsraum eines oder auch mehrerer Bohr- und Gewinnungsplätze begrenzt werden<br />
(wie dies derzeit noch in den Genehmigungsverfahren angelegt ist). Aktuelle Bestrebungen zu einer<br />
Erweiterung der UVP-Pflicht greifen hier noch zu kurz.<br />
Vielmehr wären die möglichen Auswirkungen auf den Raum bzw. auf die raumordnungsrelevanten<br />
Nutz- und Schutzfunktionen bei einer möglichen oder angestrebten vollständigen Erschließung eines<br />
Fördergebietes (Größen der Exlorationsgebiete bis zu rd. 1.000 km² 71 ) zu betrachten. Der Untersuchungs-/Betrachtungsraum<br />
wäre somit sowohl räumlich und als auch vor dem Hintergrund der zeitlichen<br />
Entwicklung/Erschließung entscheidend auszudehnen. Der Zeitraum für die Erschließung eines<br />
großräumigeren Explorationsgebietes kann bei einer entsprechenden Vielzahl an Bohrplätzen/Bohrungen<br />
selbst bei zeitparallelem Einsatz von mehreren Bohrgeräten leicht ein Jahrzehnt bzw.<br />
deutlich darüber hinaus betragen. Der Regelbetrieb erstreckt sich dann über mehrere Jahrzehnte.<br />
Die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten ist gerade auch dadurch gekennzeichnet,<br />
dass für die Ausschöpfung der Erdgasvorkommen eine Vielzahl von Bohrungen / Bohrplätzen auch<br />
bei Ausbau von Cluster-Bohrplätzen (� Minderung Flächenverbrauch im Explorationsgebiet) erforderlich<br />
sein werden. Damit können (über den einzelnen Standort hinaus) unter räumlichen Aspekten<br />
(z.B. Erholungsfunktionen) weiter reichende Umweltauswirkungen auf die landschaftsbezogenen<br />
Schutzgüter verbunden sein (Stichwort: industrielle Zersiedelung), als dies bei Betrachtung nur eines<br />
einzelnen (oder weniger) Bohr- und Gewinnungsplatzes der Fall wäre.<br />
71 Karte der Explorationsgebiete; INGENIEURBÜRO HEITFELD-SCHETELIG GMBH, 25.08.2011<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 81 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Aufgrund der erforderlichen Vielzahl von Bohrplätzen einerseits und den dichten/hohen Nutz- und<br />
Schutzfunktionen/-ansprüchen in den dicht besiedelten Räumen in Deutschland andererseits erscheint<br />
deshalb eine geordnete und strukturierte Entwicklungsplanung der unkonventionellen Erdgasgewinnung<br />
auf räumlicher Ebene geboten. Dies gilt sowohl bezogen auf die <strong>oberirdische</strong>n Raum-<br />
Aspekte (insbesondere von Natur und Landschaft), als auch in Bezug auf Nutzungen des Untergrundes.<br />
So wurde vom Deutschen Industrie- und Handelstag vorgeschlagen, potentielle Bereiche zur Förderung<br />
unkonventioneller Erdgases schon auf der Ebene der Raumordnung auszuwählen, um zukünftig<br />
konfligierende Nutzungen des Untergrundes frühzeitig zu vermeiden 72 .<br />
Leitvorstellung der Raumordnung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen<br />
Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt (§ 1 Abs. 2<br />
ROG - Raumordnungsgesetz). Nach den Grundsätzen der Raumordnung sind u.a. die räumlichen Voraussetzungen<br />
für die vorsorgende Sicherung sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von<br />
standortgebundenen Rohstoffen zu schaffen (§ 2 Abs. 2, Nr. 4 ROG).<br />
Aus folgenden Aspekten könnte sich eine Raumwirksamkeit der unkonventionellen Erdgasgewinnung<br />
und ggf. eine Raumbedeutsamkeit im Sinne des Raumordnungsgesetzes (ROG) - u.a. Vorhaben, durch<br />
die Raum in Anspruch genommen wird oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes<br />
beeinflusst wird (§ 3 Abs. 1, Nr. 6 ROG) – ableiten lassen:<br />
�� Erschließung/Ausschöpfung großräumiger Explorationsgebiete (Betroffenheit verschiedener Gebietskörperschaften)<br />
mit einer Vielzahl von Bohrplätzen im räumlich-zeitlichen Zusammenhang<br />
(zeitparalleler Einsatz mehrerer Bohranlagen, Erschließungszeitraum über mehrere Jahre, Regelbetrieb<br />
über mehrere Jahrzehnte)<br />
�� Einrichtung zentraler <strong>Infrastruktur</strong>-Standorte (insbesondere Gastrocknung/-aufbereitung, Wasseraufbereitung);<br />
leitungsgebundene Vernetzung von Bohrstandorten bzw. zentraler <strong>Infrastruktur</strong>einrichtung<br />
Im Zusammenhang einer räumlich geordneten/strukturierten Entwicklungsplanung wären insbesondere<br />
zu diskutieren:<br />
- Diskussion/Festlegung von möglichst einheitlichen Kriterien für die Standortauswahl von Bohrplätzen<br />
- Festlegung / Definition von Mindestanforderungen / Umweltschutzanforderungen an Bohrverfahren<br />
und das technische Equipment (wie z.B. dieselbetriebene Stromaggregate, Lärmschutzanforderungen,<br />
Mindestanforderungen an die Eingründung etc.)<br />
- Festlegung / Diskussion von Positivkriterien /-geboten (z.B. Bündelungsgebot)<br />
- Diskussion / Festlegung von Ausschluss- und Abwägungskriterien für die Standortauswahl von<br />
konkreten Bohr- und Gewinnungsplätzen und von zentralen <strong>Infrastruktur</strong>-Einrichtungen<br />
- Zeitliche Aspekte / Zeitlich-räumliche Ablaufplanung<br />
- Bewertungsverfahren / -ansätze für den Standortvergleich bzw. die Standortauswahl, Grundsätze<br />
für eine Interessenabwägung<br />
- Anforderungen an zentrale <strong>Infrastruktur</strong>anlagen und an die Optimierung von leitungsgebundenen<br />
Trassen, Standorte für zentrale <strong>Infrastruktur</strong>einrichtungen (Gastrocknung/-aufbereitung,<br />
Wasseraufbereitung, Verpressstationen)<br />
72 DIHK, 2012: Faktenpapier unkonventionelles Erdgas in Deutschland – Hintergrundinformationen zum IHK-Jahresthema 2012<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 82 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
- Einbindung der relevanten Behörden/Träger öffentlicher Belange und sonstiger Dritter / sonstigen<br />
Betroffenen und Transparenz bei der Aufstellung eines Gesamt-Entwicklungskonzeptes;<br />
nachvollziehbare Entscheidungsfindung bis zu den einzelnen Standorten<br />
Zusammenfassend ist bei einer großflächigen Erschließung unkonventioneller Erdgaslagerstätten eine<br />
geordnete/strukturierte Entwicklungsplanung auf Raumordnungsebene zu empfehlen. Dieser Planungs-<br />
und Abwägungsprozess könnte die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit für die zukünftige räumliche<br />
Entwicklung fördern und eine sachgerechte Abwägung mit den vorhandenen Nutzungs- und<br />
Schutzfunktionen ermöglichen.<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH<br />
Darmstadt, April 2012<br />
Dipl.-Ing. Helmut Schneble M.Eng. Landschaftsarchitektur Katja Weinem<br />
Dipl.-Geograph Ingo Niethammer<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 83 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Bildverzeichnis<br />
[1] Quelle: ExxonMobil; zusammengestellt: UBS<br />
[2,3,4,5] http://www.europaunkonventionelleserdgas.de<br />
[6-8,11,13-17,19-21,25-34,37] ExxonMobil Production Deutschland GmbH<br />
[9,12] Rahmenbetriebsplan Bötersen Z11 (ExxonMobil Production<br />
Deutschland GmbH)<br />
[10] DRILLMEC SPA, DRILLING TECHNOLOGIES, aTREVI-<br />
GROUP Company, HH102 Hydraulic drilling rig - semitrailer<br />
mounted, Operation and Maintenance Manual, Document code:<br />
UM189023/E - Revision 0 (02/2007), 2007<br />
[23,35] Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-<br />
Westfalen // Grundlagen und Empfehlungen für die Landesplanung;<br />
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) / LWL-Amt<br />
für Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Landschaftsverband<br />
Rheinland (LVR) Umweltamt; Foto: LWL / W. D. Gessner-<br />
Krone, Münster / Köln November 2007<br />
[18,24,36] Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH<br />
[22] UVP Report 4/11, „Born in the USA“, Seite 210,<br />
Dezember 2011, Photo: Prof. Dr. Johann Köppel<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 84 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
10 Quellen<br />
Rechtliche Grundlagen<br />
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)<br />
("Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes<br />
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2557) geändert worden ist"<br />
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)<br />
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten<br />
("Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes<br />
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist")<br />
FFH-Richtlinie<br />
RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume<br />
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen<br />
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)<br />
("Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar<br />
2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986)<br />
geändert worden ist")<br />
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft<br />
(Landschaftsgesetz – LG)<br />
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000, GV. NRW. S. 568, zuletzt geändert am 16.<br />
März 2010, GV. NRW. S. 185<br />
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)<br />
Vom 19. Februar 2010, GVBl. S. 104<br />
Raumordnungsgesetz (ROG)<br />
Vom 22.12.2008 (BGl. I S. S. 2986); zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 31.07.2009<br />
(BGBl. I S. 2585)<br />
TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm<br />
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998<br />
(GMBl. S. 503)<br />
TA Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft<br />
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 24. Juli 2002 (GMBl.<br />
S. 511)<br />
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau)<br />
(“Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 13. Juli 1090 (BGBl.<br />
I S. 1420), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261) geändert<br />
worden ist.“)<br />
Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV<br />
Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. August<br />
2010 (BGBl. S. 1065)<br />
Vogelschutzrichtlinie (VSRL)<br />
RICHTLINIE DES RATES vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten<br />
(79/409/EWG)<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 85 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
Regionalplanung<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Regionalplan Münsterland, Entwurf 2010<br />
Niedersachsen<br />
Landkreis Cloppenburg, Regionales Raumordnungsprogramm 2005<br />
Landkreis Diepholz, Regionales Raumordnungsprogramm 2004<br />
Landkreis Emsland, Regionales Raumordnungsprogramm 2010<br />
Landkreis Osnabrück, Regionales Raumordnungsprogramm 2004<br />
Landkreis Vechta, Regionales Raumordnungsprogramm 1997<br />
Literatur<br />
ASPO DEUTSCHLAND, ZITTEL, DR., WERNER, Kurzstudie „Unkonventionelles Erdgas“, Kurzfassung, (ohne<br />
Datum)<br />
BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG, DEZERNAT 33, „Verwendung heimischer Gehölze für Pflanzungen in<br />
Nordrhein-Westfalen, 15.10 2008<br />
BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG, Vorschläge zur Änderung des Bergrechts 2011, am 18. Februar 2011 an<br />
das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen sowie an das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen übersandt<br />
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF, BÜNDNIS 90 – DIE GRÜNEN -, Anfrage an die Regierungspräsidentin,<br />
Unkonventionelle Erdgasförderung im Regierungsbezirk Düsseldorf, 16.12.2010<br />
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF, Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90 – Die<br />
Grünen vom 16.12.2010, (ohne Datum)<br />
BFN - Bundesamt für Naturschutz „Lärm und Landschaft“, Angewandte Landschaftsökologie, Heft 44,<br />
Bonn, Bad Godesberg, 2001<br />
BREUER, W.: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes - Vorschläge<br />
für Maßnahmen bei Errichtung von Windkraftanlagen. - Naturschutz und Landschaftsplanung,<br />
33 (8): 237-245, 2001<br />
BORCHARDT, PROF. DR. DIETRICH, RICHTER, DR.-ING., SANDRA, “Informations- und Dialogprozess zum<br />
Aufsuchen und Fördern von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten“, Osnabrück, 10. Oktober<br />
2011<br />
BUNDESRAT, Verordnungsantrag des Landes Nordrhein-Westfalen, Drucksache 388/11, Entwurf einer<br />
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher<br />
Vorhaben, 29.06.11<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 86 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
DIHK, DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG, Faktenpapier unkonventionelles Erdgas in<br />
Deutschland, Hintergrundinformationen zum IHK-Jahresthema 2012, 22. Dezember 2011<br />
DIN 4150 „ERSCHÜTTERUNGEN IM BAUWESEN“, 1999/065<br />
DMT GMBH & CO. KG, Gutachterliche Stellungnahme, Erschütterungsmessungen in Oppenwehe,<br />
23.12.2010<br />
DRILLMEC SPA, DRILLING TECHNOLOGIES, aTREVIGROUP Company, HH102 Hydraulic drilling rig - semitrailer<br />
mounted, Operation and Maintenance Manual, Document code: UM189023/E - Revision<br />
0 (02/2007), 2007<br />
EXXONMOBIL 2012,<br />
- Arbeitsgespräch/Abstimmungstermin mit Fa. ExxonMobil zu Fachbeitrag Landschaft<br />
am 05.01.2012 und zugehöriger Ergebnisvermerk<br />
- Telefonat vom 11.01.2012,<br />
u.a. Flächenverbrauch, Transport Lagerstättenwasser/ “back-flow“, Gastrocknung<br />
- E-mail vom 12.01.2012, Explorationsgebiete, LKW-Verkehre<br />
- E-mail vom 16.01.2012, Bohranlage, Kaltausbläser<br />
- 3-D-Darstellungen Bohrplatz (mit Schreiben Giftge Consult GmbH vom 17.01.2012)<br />
- E-mail vom 08.02.2012 Wiederverwendung flowback<br />
- E-mail vom 16.02.2012, Leitungsquerschnitte<br />
- E-mail vom 23.03.2012, ExxonMobil (Rastergröße 9 km²)<br />
- Telefonat vom 28.03.2012, ExxonMobil (TKW Transporte, back-flow)<br />
- E-mail vom 29.03.2012, ExxonMobil (TKW Transporte, back-flow)<br />
EXXON MOBIL, „Bohrvorhaben – Auswirkung auf Landschaft“, 5. Januar 2012<br />
Exxon Mobil, „Bohren nach Erdgas und Erdöl – Auf der Suche nach heimischen Lagerstätten“ 08/2009<br />
EXXON MOBIL, Development, „Einführung in die Bohr-, und Komplettierungstechnik“, (ohne Datum)<br />
EXXON MOBIL, „Erdöl und Erdgas: Suchen, Fördern, Verarbeiten“, Weidmann, Hamburg,<br />
15. Auflage 2003<br />
EXXON MOBIL, Erdgas- und Erdölleitungen – Schutzanweisungen <strong>Betrieb</strong> Öl - / Schutzanweisungen <strong>Betrieb</strong><br />
Gas West/Ost, 06/2010, 08/2010<br />
EXXON MOBIL, Rahmenbetriebsplan für die Produktionsbohrung (B2) Bötersen Z11, November 2010<br />
EXXON MOBIL, Well Pad Design EMPG – Unconventional Gas, A. Anderer, Bötersen Z 11, 15.09.2011<br />
FRENZ, PROFESSOR DR. WALTER, Aachen, FFH-Abweichungsentscheidungen, UPR 3/2011<br />
GASSNER/WINKELBRANDT/BERNOTAT, UVP und strategische Umweltprüfung, Rechtliche und fachliche<br />
Anleitung für die Umweltprüfung, 5. Auflage, C.F. Müller Verlag Heidelberg, 2010<br />
ITAG, Equipment List and technical data of drilling rig, Rig 120 – diesel-electric drive, Exxon Mobil Production<br />
Germany – 170 t Land Drilling Rig for Nothern Germany, 12/10/2011<br />
IMT DEUTSCHLAND, IQL Grün „ClearSky“ ökologische ökonomische Beleuchtung, (ohne Datum)<br />
JOHNSON, NELS, The Nature Conservancy, Shale Gas Development: Natural Habitat Impacts and Conservation<br />
Opportunities, Januar 2011<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 87 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
LBEG, LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE NIEDERSACHSEN, Referat Energiewirtschaft<br />
Erdöl und Erdgas, Bergbauberechtigungen, Sven Brinkmann – Bergbauberechtigungen in<br />
Niedersachsen, Email vom 21.02.2012<br />
LÄNDERAUSSCHUSS FÜR IMMISSIONSSCHUTZ (LAI) - MESSUNG UND BEURTEILUNG VON LICHTIMMISSIONEN<br />
(LICHT-RICHTLINIE), ERICH SCHMIDT VERLAG, BERLIN 1994<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE, Mecklenburg Vorpommern, Kriedemann, Ing.-<br />
Büro für Umweltplanung, Hinweise zur Eingriffsbewertung und Kompensationsplanung für<br />
Windkraftanlagen, Antennenträger und vergleichbare Vertikalstrukturen, 22.05.2006<br />
KÖHLER, BABETTE, PREIß, ANKE, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Erfassung und Bewertung<br />
des Landschaftsbildes, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2000<br />
KREIS BORKEN, Arbeitshilfe zur Anlage und Pflege von Hecken in der Landschaft, April 2009<br />
MAYNEN, EMIL, SCHMITHUSEN, JOSEF, Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, Bundesanstalt<br />
für Landeskunde, Remagen/Bad Godesberg 1953/1962 (Karte: 1: 1.000.000) mit<br />
Haupteinheiten 1960<br />
MILK, VOLKER, Abteilungsdirektor, Aufsuchung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten - Dialog<br />
mit Wasserversorgern und Wasserverbänden, Bezirksregierung Arnsberg Dortmund,<br />
26.09.2011<br />
MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, Bericht der Landesregierung zum Thema „Chancen und Risiken bei<br />
Probebohrungen und Gewinnung von unkonventionellem Erdgas unter besonderer Berücksichtigung<br />
von Wasser-, Natur-, Boden- und Klimaschutz“, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-<br />
und Verbraucherschutz des Landes NRW, 11. Februar 2011<br />
MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LAN-<br />
DES NORDRHEIN-WESTFALEN / MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN, UND<br />
VERKEHR DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN -<br />
Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Genehmigungsfähigkeit von Bohrungen unterschiedlichster<br />
Art, Erlass vom 18. November, 2011<br />
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/2011_11_23_erlass.pdf<br />
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR DES LANDES NORDRHEIN-<br />
WESTFALEN, 5. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie am<br />
12.01.2011<br />
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT; UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES MECKLENBURG-<br />
VORPOMMERN: Erlass vom 23. September 2003, Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern<br />
2003, Nr. 44 S. 966<br />
NOHL, WERNER, „Ist das Landschaftsbild messbar und bewertbar? – Bestandsaufnahme und Ausblick,<br />
Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN) an der Universität<br />
für Bodenkultur in Wien am 25. Februar 2010<br />
NOHL, WERNER, Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe, Materialien für<br />
die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung, Im Auftrag des Ministeriums<br />
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, geänderte<br />
Fassung August 1993<br />
ÖKO TEST, „Unkonventionelles Erdgas - Weltweit umstritten“, Auflage 285195 Seite 18-26, 11/2011<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 88 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
PENNSTATE, COOPERATIVE EXTENSION, COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES, „Landscape and habitat<br />
changes associated with Marcellus Shale exploration and development – What will it mean<br />
for wildlife?”, (ohne Datum)<br />
SCHOLLE, DR., Stellungsnahme zur Anhörung von Experten im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und<br />
Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages am 21. November 2011<br />
UMWELTBUNDESAMT, Stellungsnahme – Einschätzung der Schiefergasförderung in Deutschland<br />
- Entwurf-, August 2011<br />
UMWELTBUNDESAMT, Stellungsnahme – Einschätzung der Schiefergasförderung in Deutschland<br />
- Stand Dezember 2011 -<br />
UNIVERSITÄT HANNOVER, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik (ISAH);<br />
E-mail vom 30.01.2012<br />
VERORDNUNGSANTRAG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN – Entwurf einer Verordnung zur Änderung<br />
der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben;<br />
Bundesrat, Drucksache 388/11 vom 29.06.2011<br />
ZOBACK, MARK, KITASEI, SAYA, COPITHORNE, BRAD, „Addressing the Environmental Risks from Shale<br />
Gas Development”, Worldwatch Institute – Natural Gas and sustainable energy initiative, July<br />
2010<br />
Sonstige Kartengrundlagen<br />
BUNDESAMT FÜR KARTOGRAFIE UND GEODÄSIE, TOP 200 Bundesrepublik Deutschland, 2009<br />
(Lizenznummer: 3776)<br />
IHS INGENIEURBÜRO HEITFELD-SCHETELIG GMBH, Wasserschutz- und Wassergewinnungsgebiete sowie<br />
Explorationsgebiete in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, 25.08.2011;<br />
Index d, 23.02.12<br />
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK, GRUNDLAGENKARTE,<br />
www.nls.niedersachsen.de/.../003%20Land%20Niedersachsen.pdf, 11. Januar 2012<br />
Internet<br />
www.dialog-erdgasundfrac.de<br />
https://expertenkreis.dialog-erdgasundfrac.de/expertenkreis/node/58<br />
http://www.europaunkonventionelleserdgas.de/<br />
www.exxonmobil.com<br />
www.naturschutzinformationen-nrw.de<br />
http://lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Bildung_Kultur/Kulturlandschaft/Heckenmanagement_MSL/<br />
www.umweltbundesamt.de<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 89 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc
Fachbeitrag Themenkreis Landschaft InfoDialog Fracking<br />
www.erdgassuche-in-deutschland.de<br />
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/index.php<br />
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/author/jkrueger/<br />
http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=5459&article_id=101214&_psmand=18<br />
&mode=print<br />
http://www.erdoel-erdgas.de/<br />
Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH / Bearbeitungsstand: März 2012 Seite 90 von 90<br />
F:\11Projekte\PS\1137002_Dialog-Fracking\3_UBS\Konzept\120329_Bericht_Rev_2.doc