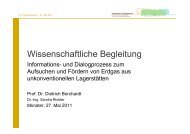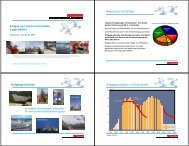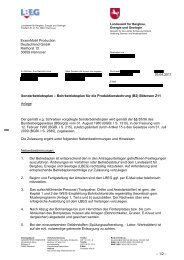Landschaftspflegerischer Fachbeitrag für die Ablenkungsbohrung ...
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag für die Ablenkungsbohrung ...
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag für die Ablenkungsbohrung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a<br />
Auftraggeber:<br />
Planverfasser:<br />
März 2011
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a<br />
Auftraggeber: ExxonMobil Production Deutschland GmbH<br />
Riethorst 12<br />
30 659 Hannover<br />
Planverfasser: Kölling & Tesch Umweltplanung<br />
Am Dobben 79<br />
28203 Bremen<br />
Bearbeitung: Thilo Koch, M.Sc. Geogr., Stadt- & Landschaftsökologe<br />
Gisela Kempf, Dipl.-Geogr., Landschaftsökologin<br />
Tanja Tesch, Dipl. Landschaftsarchitektin
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einführung ................................................................................................5<br />
2. Grundlagen ...............................................................................................5<br />
2.1 Lage der Erweiterungsbohrung Munster Z4a und naturräumliche<br />
Einordnung .................................................................................................5<br />
2.2 Flächennutzung und Infrastruktur...............................................................7<br />
2.3 Planerische Vorgaben ................................................................................7<br />
3. Bestandsaufnahme und Bewertung .......................................................8<br />
3.1 Arten und Lebensgemeinschaften..............................................................8<br />
3.1.1 Biotoptypen.................................................................................................8<br />
3.1.2 Brutvögel ..................................................................................................12<br />
3.1.3 Fledermäuse.............................................................................................17<br />
3.1.4 Amphibien.................................................................................................18<br />
3.2 Boden .......................................................................................................19<br />
3.3 Wasser .....................................................................................................19<br />
3.4 Klima und Luft...........................................................................................20<br />
3.5 Landschaftsbild.........................................................................................20<br />
4. Auswirkungen der Baumaßnahme........................................................21<br />
4.1 Beschreibung der Baumaßnahme............................................................21<br />
4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft..................................................23<br />
4.2.1 Auswirkungen auf Arten und Lebensgemeinschaften ..............................23<br />
4.2.2 Auswirkungen auf den Boden...................................................................25<br />
4.2.3 Auswirkungen auf das Wasser.................................................................25<br />
4.2.4 Auswirkungen auf das Klima ....................................................................26<br />
4.2.5 Auswirkungen auf das Landschaftsbild ....................................................26<br />
4.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffswirkungen ...26<br />
4.4 Erhebliche Beeinträchtigungen.................................................................27<br />
5. Literatur und Unterlagen........................................................................28<br />
6. Anhang ....................................................................................................30<br />
7. Karten ......................................................................................................31<br />
Karte 1: Biotopbestand und temporäre Auswirkungen...........................................31<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen (NLÖ, 2004)....................................................8<br />
Tabelle 2: Flächenanteile der Biotoptypen ..................................................................9<br />
Tabelle 3: Potenzielle Brutvogelarten Munster SW Z4a............................................13<br />
Tabelle 4: Potenzielle Fledermausarten ....................................................................18<br />
Tabelle 5: Von der Baumaßnahme betroffene Biotoptypen ......................................23<br />
Tabelle 6: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen..........................................26<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: Lage der Aufschlussbohrung ..........................................................................6<br />
Abb. 2: Geplante Flächeninanspruchnahme .............................................................22<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 5<br />
1. Einführung<br />
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH plant <strong>die</strong> Durchführung der<br />
<strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a am Standort der stillgelegten Gewinnungsanlage<br />
Munster SW Z4. Dabei werden, ausgehend vom unteren Ende der bestehenden<br />
Förderleitung, neue Bohrungen in horizontaler Lage abgeteuft, um weitere erdgasführende<br />
Bereiche des erschlossenen Feldes zu erkunden. Hierzu müssen zeitweise Flächen in<br />
Anspruch genommen werden, <strong>die</strong> über den bestehenden Förderplatz hinaus gehen. Nach<br />
Abschluss der Bohrphase werden alle errichteten Anlagenbestandteile zurückgebaut und <strong>die</strong><br />
in Anspruch genommenen Flächen in ihre ursprüngliche Nutzung überführt.<br />
Im vorliegenden Landschaftspflegerischen <strong>Fachbeitrag</strong> wird dargelegt, ob es sich bei der<br />
Erweiterung des Bohrplatzes um einen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 des<br />
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)<br />
in Verbindung mit § 5 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz<br />
(NAGBNatSchG) handelt.<br />
2. Grundlagen<br />
2.1 Lage der Erweiterungsbohrung Munster Z4a und naturräumliche<br />
Einordnung<br />
Die Erweiterungsbohrung erfolgt über <strong>die</strong> bestehende Förderanlage Munster SW Z4. Der<br />
Standort liegt im Bundesland Niedersachsen, Landkreis Soltau-Fallingbostel, etwa 6 km<br />
östlich des Ortes Wietzendorf. Er befindet sich unmittelbar südlich des Truppenübungsplatzes<br />
Munster-Süd an der K 11 (s. Abb. 1).<br />
Naturräumlich betrachtet fällt das Vorhaben in den südöstlichen Teil der Unterregion<br />
„Lüneburger Heide“. In <strong>die</strong>sem Bereich überwiegen sandige Geeststrukturen wie End- und<br />
Grundmoränen. Außerhalb der sandig-lehmigen und damit durch Podsol und Braunerden<br />
geprägten Bereiche, <strong>die</strong> als Acker und Wald genutzt werden, treten zudem zahlreiche<br />
Niederungsbereiche bzw. vermoorte Senken sowie sandige Offenbodenbereiche auf.<br />
(DRACHENFELS, 2010)<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 6<br />
Abb. 1: Lage der Aufschlussbohrung<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 7<br />
2.2 Flächennutzung und Infrastruktur<br />
Das Bohrvorhaben wird auf dem bestehenden Platz der Anlage Munster SW Z4 realisiert, so<br />
dass darüber hinaus nur eine als Intensivgrünland genutzte Fläche temporär durch <strong>die</strong><br />
Herstellung von geschotterten Parkplätzen und <strong>die</strong> Oberbodenlagerung in Anspruch<br />
genommen wird. Dieses Intensivgrünland tritt angrenzend südlich, östlich und westlich des<br />
bestehenden Platzes auf. Im Norden liegt im Anschluss an <strong>die</strong> Kreisstraße 11 ein Nadelforst,<br />
der bereits zum Truppenübungsplatz Munster-Süd gehört. Die weitere Umgebung ist primär<br />
durch Nadelforste und -wälder geprägt, <strong>die</strong> stellenweise durch Grünland oder Ackerbereiche<br />
unterbrochen werden. Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich ca. 420 m westlich<br />
an der K11 und gehört zur Gemeinde Wietzendorf.<br />
Über <strong>die</strong> bereits genannte K 11 kann <strong>die</strong> im Westen verlaufende Bundesstraße 3 (Soltau-<br />
Celle) mit Anschluss an <strong>die</strong> BAB 7 erreicht werden. In Richtung Osten schließt sie an <strong>die</strong><br />
L 240 an, <strong>die</strong> sich zwischen Celle und der B 71 (Soltau - Munster - Uelzen) befindet.<br />
2.3 Planerische Vorgaben<br />
Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Soltau-Fallingbostel (RROP SFA,2000)<br />
Der Bereich, in dem sich das Vorhaben befindet, ist als Vorrangstandort <strong>für</strong> <strong>die</strong> Errichtung<br />
obertätiger Anlagen zur Erdgasgewinnung ausgewiesen. Vorrangstandorte sind von<br />
entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten.<br />
Die Freiflächen der Umgebung sind sowohl als Vorsorgegebiete <strong>für</strong> <strong>die</strong> Landwirtschaft, als<br />
auch als Vorsorgegebiet <strong>für</strong> Erholung dargestellt. Andere raumbedeutsamen Planungen und<br />
Maßnahmen sind so abzustimmen, dass <strong>die</strong> Eignung und besondere Bedeutung der<br />
Vorsorgegebiete möglichst nicht beeinträchtigt werden.<br />
Die bewaldeten Bereiche nördlich und östlich sind durch den Truppenübungsplatz Munster-<br />
Süd als Sperrgebiet <strong>für</strong> militärische Nutzung ausgewiesen. Gleichzeitig sind große Teile der<br />
Fläche als Vorranggebiet <strong>für</strong> Natur und Landschaft dargestellt. Dies trifft auch auf <strong>die</strong> südlich<br />
des Vorhabenstandortes liegende Niederung der Örtze zu.<br />
Rechtlich festgesetzte Schutzgebiete<br />
In der näheren Umgebung des geplanten Vorhabenstandortes befinden sich drei NATURA-<br />
2000 Gebiete.<br />
In etwa 150 m Entfernung südlich der bestehenden Anlage verläuft entlang der<br />
Wietzeniederung das FFH-Gebiet 81 „Örtze mit Nebenbächen“.<br />
Ein Ausläufer des FFH-Gebietes 80 „Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz<br />
Munster-Süd“ grenzt in ca. 270 m Entfernung an den bestehenden Anlagenplatz an, der<br />
zugleich zum größeren EU-Vogelschutzgebiet V30 „Truppenübungsplätze Munster-Nord und<br />
Süd“ zählt.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 8<br />
3. Bestandsaufnahme und Bewertung<br />
In <strong>die</strong>sem Kapitel werden <strong>die</strong> Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bewertung <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
eingriffsrelevanten Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden und Wasser,<br />
Klima/Luft und Landschaftsbild dargestellt.<br />
3.1 Arten und Lebensgemeinschaften<br />
Die Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzgut Arten und<br />
Lebensgemeinschaften erfolgt über eine Bestandserfassung und -bewertung der vorkommenden<br />
Biotoptypen, eine Potenzialabschätzung der Avifauna sowie der Fledermäuse<br />
und Amphibien. Eine vollständige Kartierung der genannten Artengruppen konnte aufgrund<br />
des engen Zeitrahmens nicht durchgeführt werden. Durch <strong>die</strong> Strukturierung des<br />
Untersuchungsgebietes sind keine weiteren Tierartenvorkommen anzunehmen, <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind.<br />
Für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wurde ein ca. 13 ha großes Untersuchungsgebiet<br />
abgegrenzt, das den Standort des geplanten Vorhabens und <strong>die</strong> nähere<br />
Umgebung umfasst (s. Karte 1).<br />
3.1.1 Biotoptypen<br />
Aufgrund des engen Planungszeitraumes musste <strong>die</strong> örtliche Bestandsaufnahme im Februar<br />
2011 erfolgen. Aufgrund der Witterungsbedingungen in <strong>die</strong>ser Zeit ist eine Biotoptypenkartierung<br />
nur eingeschränkt möglich, da <strong>die</strong> Vegetation teilweise eingezogen und damit<br />
nicht vorhanden ist. Zugrunde gelegt wurde der Biotopschlüssel des Niedersächsischen<br />
Landesamtes <strong>für</strong> Ökologie (DRACHENFELS, 2004), es war aber nicht <strong>für</strong> alle Biotope möglich,<br />
<strong>die</strong>se vollständig den Untereinheiten zuzuordnen. Die nicht klar zu bestimmenden<br />
Biotoptypen wurden daher nur in <strong>die</strong> Obergruppen bzw. Haupteinheiten eingestuft.<br />
Die Biotoptypen wurden nach dem Bewertungsschema des NLÖ (2004) bewertet<br />
(s. Tabelle 1). Die Bedeutung der Lebensräume <strong>für</strong> den Naturschutz und <strong>die</strong><br />
Landschaftspflege werden über <strong>die</strong> Wertstufen ausgedrückt.<br />
Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen (NLÖ, 2004)<br />
Wertstufe Beschreibung<br />
V<br />
Biotoptypen von besonderer Bedeutung<br />
(gute Ausprägungen naturnaher und halbnatürlicher Biotoptypen)<br />
IV Biotoptypen von besonderer bis allgemeiner Bedeutung<br />
III Biotoptypen von allgemeiner Bedeutung<br />
II Biotoptypen von allgemeiner bis geringer Bedeutung<br />
I<br />
Biotoptypen von geringer Bedeutung<br />
(v. a. intensiv genutzte, artenarme Biotoptypen)<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 9<br />
Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen<br />
Die Kartierung ergab im Untersuchungsgebiet insgesamt 18 verschiedene Biotoptypen, <strong>die</strong><br />
in Tabelle 2 aufgelistet sind. Sie gibt einen Überblick über <strong>die</strong> kartierten Biotoptypen, ihre<br />
jeweiligen Flächengrößen und den Flächenanteil an der Gesamtfläche des<br />
Untersuchungsgebietes. Bei Biotoptypen-Kombinationen (z. B. UH/OVW) sind <strong>die</strong><br />
dominanten Bestandteile zuerst genannt. Nach § 30 BNatSchG in Kombination mit<br />
§ 24 NAGBNatSchG geschützte Biotope kamen nicht vor. Biotoptypen, <strong>die</strong> Lebensraumtypen<br />
nach der FFH-Richtlinie der EU zuzuordnen sind, waren nicht anzutreffen.<br />
Tabelle 2: Flächenanteile der Biotoptypen<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
Wälder<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
Fläche<br />
[ha]<br />
Anteil<br />
[%]<br />
Wertstufe<br />
WKT Kiefernwald armer, trockener Sandböden 0,86 6,62 III<br />
WZF Fichtenforst 0,69 5,31 II<br />
Zwischensumme 1,54 11,93<br />
Gebüsche und Gehölzbestände<br />
HBA Allee/Baumreihe 0,40 3,08 III - IV<br />
HPS Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand 0,08 0,62 III<br />
HPG Sonstige standortgerechte Gehölzpflanzung 0,02 0,15 II<br />
HPX Sonstiger standortfremder Gehölzbestand 0,22 1,69 II<br />
HBE Einzelbaum - - III<br />
Zwischensumme 0,72 5,54<br />
Binnengewässer<br />
FG Graben 0,03 0,23 II<br />
FXM Mäßig ausgebauter Bach 0,03 0,23 III<br />
SXF Naturferner Fischteich 0,14 1,08 II<br />
Zwischensumme 0,20 1,54<br />
Grünland<br />
GI Intensiv-Grünland 5,01 38,54 I<br />
Acker- und Gartenbaubiotope<br />
AS Sandacker 3,81 29,31 I<br />
Ruderalfluren<br />
UH Halbruderale Gras- und Staudenflur 0,32 2,46 II - III<br />
UH/OVW<br />
Halbruderale Gras- und Staudenflur in Kombination<br />
mit unbefestigtem Weg<br />
0,45 3,54 II
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 10<br />
Kürzel Biotoptyp<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
Fläche<br />
[ha]<br />
Anteil<br />
[%]<br />
Zwischensumme 0,77 6,00<br />
Gebäude-, Verkehrs und Industrieflächen<br />
OVS Straße 0,44 3,38 I<br />
OVW Unbefestigter Weg 0,02 0,15 I<br />
OSZ Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage 0,47 3,62 I<br />
Zwischensumme 0,93 7,15<br />
Gesamtfläche 13,00 100<br />
Wertstufe<br />
Im Untersuchungsgebiet dominieren mit einem Anteil von rund 68 % <strong>die</strong> landwirtschaftlich<br />
genutzten und gänzlich ausgeräumten Intensiv-Grünland- (GI, Bt-Nr. 3) und Ackerflächen<br />
(AS, BT-Nr. 16), <strong>die</strong> von einer ca. 5 m breiten und als landwirtschaftlicher Weg genutzten<br />
Grasflur (UH/OVW, Bt-Nr. 15) umlaufen werden (vgl. Karte 1). Die weitläufigen Areale<br />
befinden sich südlich und westlich der bestehenden Anlage, in Richtung Osten reicht <strong>die</strong><br />
Grünlandfläche bis zum dort anschließenden Kiefernwald. Die Flächen zeigen durch <strong>die</strong><br />
intensive Nutzung eine Artenverarmung, so dass sie nur eine allgemeine bis geringe<br />
Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz aufweisen (Wertstufe II). Im westlichen Teil des<br />
Untersuchungsgebietes wird der Weg von einer Baumreihe (HBA, Bt-Nr. 18) begleitet.<br />
Diese besteht aus vitalen Eichen und Birken mit einem BHD von 30 - 50 cm und besitzt<br />
aufgrund des teilweise hohen Alters und ihrer Ausprägung eine besondere bis allgemeine<br />
Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz (Wertstufe IV). Südlich der Baumreihe befindet sich ein<br />
abflussloser Graben (FG, Bt-Nr. 17). Das etwa 35 cm breite Gewässer weist Röhrichtstrukturen<br />
sowie submerse Vegetation auf. Aufgrund der standortgerechten Vegetationsstrukturen<br />
wird er mit der Wertstufe III (allgemeine Bedeutung) bewertet.<br />
Der im Osten des Untersuchungsgebietes stockende Kiefernwald armer Sandböden<br />
(WKT, Bt-Nr. 13) besteht neben der bestandsbildenden Kiefer aus vereinzelten Fichten,<br />
Birken und Eichen. Die Bäume weisen einen BHD von 25 - 40 cm (mittleres Alter) auf, <strong>die</strong><br />
Strauchschicht wird durch aufkommende Junggehölze der genannten Arten sowie Holunder<br />
im lichteren Randbereich gebildet. Als Waldbestand mittleren Alters mit Beimischung<br />
standortfremder Fichte besitzt <strong>die</strong>ser eine allgemeine Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz<br />
(Wertstufe III). Der unbefestigte Weg (OVW, Bt-Nr. 12), der als Zufahrt von der Kreisstraße<br />
<strong>die</strong>nt, besitzt nur eine geringe Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz (Wertstufe I).<br />
Der Platz der bestehenden Erdgasgewinnungsanlage (OSZ, Bt-Nr. 9) ist versiegelt und ist<br />
daher von geringer Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz (Wertstufe I). Er wird westlich der Zufahrt<br />
von einem 450 m² großen und dichten standortgerechtem Gehölzbestand (HPS, Bt-Nr. 7)<br />
aus Kiefern und wenigen Birken mit einem BHD von überwiegend weniger als 15 cm<br />
eingegrünt. Auf der westlichen Seite des Platzes befindet sich ein standortgerechter<br />
Gehölzbestand (HPS, Bt-Nr. 8) aus Weiden, Birken und Holunder. Die Gehölze weisen<br />
überwiegend einen BHD von 10 - 15 cm, vereinzelt auch 20 - 25 cm, auf. Beide<br />
standortgerechten Gehölzbestände mit heimischen Arten besitzen eine allgemeine<br />
Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz (Wertstufe III). Südlich und östlich grenzt im Bereich der<br />
Böschungen des Platzes eine ca. 2 m breit halbruderale Gras- und Staudenflur (UH, Bt-<br />
Nr. 14) an, <strong>die</strong> aufgrund der Lage zwischen dem versiegelten Platz und dem Intensivgrün-
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 11<br />
land und dem Charakter einer nitrophilen Randvegetation (Vorkommen von Rainfarn) mit der<br />
Wertstufe II (allgemeine bis geringe Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz) bewertet wird.<br />
Nördlich der Anlage verläuft <strong>die</strong> 10 m breite Kreisstraße 11 (OVS, Bt-Nr. 11), <strong>die</strong> als<br />
Verkehrsweg eine geringe Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz (Wertstufe I) aufweist. Sie wird<br />
beidseitig von ca. 2 - 2,5 m breitem Straßenbegleitgrün aus halbruderaler Grasflur (UH,<br />
Bt-Nr. 4) gesäumt, das aufgrund der artenarmen Zusammensetzung mit der Wertstufe II<br />
(allgemeine bis geringe Bedeutung) bewertet wird.<br />
Im Norden schließt sich daran eine Baumreihe (HBA, Bt-Nr. 5) aus Laubgehölzen (Eichen<br />
und Birken mit BHD 20 - 30 cm) an, <strong>die</strong> als Straße begleitendes Gehölz heimischer Arten mit<br />
der Wertstufe III (allgemeine Bedeutung) bewertet wird. Diese Baumreihe bildet den<br />
Übergang zum dahinterliegenden Fichtenforst (WZF, Bt-Nr. 6) auf dem Sperrgebiet des<br />
Truppenübungsplatzes Munster-Süd, der als standortfremder Gehölzbestand nur eine<br />
allgemeine bis geringe Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz besitzt. Nach Osten wechselt der<br />
Fichtenforst in einen Kiefernwald armer Sandböden (WKT, Bt-Nr. 10), der Beimischung<br />
von Birken und Eichen aufweist und als standortgerechter Bestand mittleren Alters (BHD 25<br />
- 35 cm) mit der Wertstufe III (allgemeine Bedeutung) bewertet wird. Eine Zufahrt erhält als<br />
unbefestigter Weg (OVW, Bt-Nr. 12) <strong>die</strong> Wertstufe I (geringe Bedeutung).<br />
Am nordwestlichen Rand des Untersuchungsgebietes stockt südlich der Straße an einem<br />
Fließgewässer eine Baumgruppe (HBE, Bt-Nr. 1) aus standortgerechten Schwarz-Erlen mit<br />
einem BHD von 15 - 25 cm, der mit der Wertstufe III bewertet wird. Die etwa 10 m östlich<br />
davon entfernt befindliche Eiche wird als heimischer Einzelbaum (HBE, Bt-Nr. 2) mit einem<br />
BHD von 50 cm mit derselben Wertstufe bewertet. In südlicher Richtung fließt über eine als<br />
Intensiv-Grünland genutzte Fläche ein mäßig verbauter Bach (FXM, Bt-Nr. 19). Das ca.<br />
30 cm breite Gewässer ist unbeschattet und besitzt keine Randstreifen, verläuft aber auch<br />
nicht in einem eingeschnittenen Regelprofil. Da er zudem submerse Vegetation aufweist,<br />
wird er mit der Wertstufe III (allgemeine Bedeutung) bewertet. Im Unterlauf besitzt das<br />
Gewässer den Charakter eines Wasserwirtschaftsgrabens (Bt-Nr. 24), so dass er aufgrund<br />
von nun fehlender Wasservegetation und der fehlenden natürlichen Hydraulik mit der<br />
Wertstufe II (allgemeine bis geringe Bedeutung) bewertet wird.<br />
An der südwestlichen Grenze des Untersuchungsgebietes existieren zwei naturferne<br />
Fischteiche (SXF, Bt-Nr. 22), <strong>die</strong> aufgrund der Bewirtschaftung nur eine allgemeine bis<br />
geringe Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz aufweisen. Sie sind verbunden durch einen<br />
vegetationslosen Graben (FG, Bt.-Nr. 23) der nur eine allgemeine bis geringe Bedeutung <strong>für</strong><br />
den Naturschutz besitzt (Wertstufe II).<br />
Umgeben sind <strong>die</strong> Gewässer von einem standortfremden Gehölzbestand (HPX, Bt-Nr.<br />
25), der in der Baumschicht aus Kiefern und Fichten und einzelnen Tannen besteht,<br />
während <strong>die</strong> randliche Strauchschicht überwiegend durch Ziergehölze (Rhododrendron)<br />
gebildet wird. Zudem sind hier ein Unterstand sowie Gerätschaften zur Angel- und<br />
Freizeitnutzung vorhanden, so dass der Gehölzbestand mit der Wertstufe II (allgemeine bis<br />
geringe Bedeutung) bewertet wird.<br />
Nördlich der Fischteiche ist eine standortgerechte Gehölzpflanzung (HPG, Bt-Nr. 20) mit<br />
relativ dicht gesetzten Weiden erfolgt, <strong>die</strong> mit ihrer Höhe von mind. 2 m eine allgemeine<br />
Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz besitzen (Wertstufe III). In etwa auf der Höhe des<br />
nördlichsten Teiches wurden zwischen dem standortfremden Gehölzbestand und der<br />
Weiden-Anpflanzung eine Baumreihe (HBA, Bt-Nr. 21) aus Obstgehölzen (Prunus spp.)<br />
gepflanzt, <strong>die</strong> einen BHD von ca. 10 - 15 cm aufweisen und mit der Wertstufe III (allgemeine<br />
Bedeutung) bewertet wurden.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 12<br />
3.1.2 Brutvögel<br />
Zur Abschätzung der potenziellen Eignung als Lebensraum <strong>für</strong> Brutvögel wurden <strong>die</strong><br />
Biotopstrukturen im Februar 2011 untersucht und zudem vom Boden aus sichtbare Horste<br />
und Baumhöhlen erfasst. Daten des Verzeichnisses der in Niedersachsen besonders oder<br />
streng geschützten Arten (THEUNERT 2008) und weiterführender Fachliteratur (z.B. BAUER et<br />
al. 2005, FLADE 1994, HECKENROTH & LASKE 1997, NLWKN 2010) wurden bei der Ermittlung<br />
der potenziellen Artengemeinschaften berücksichtigt.<br />
Einen Überblick über <strong>die</strong> Ergebnisse der Brutvogel-Potenzialstu<strong>die</strong> zeigt Tabelle 4. Für jede<br />
potenziell vorkommende Art ist der Gefährdungsstatus laut Roter Liste Deutschlands bzw.<br />
Niedersachsens (SÜDBECK et al. 2007, KRÜGER & OLTMANNS 2007) angegeben. Arten des<br />
Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) werden gekennzeichnet.<br />
Potenzieller Brutvogelbestand<br />
Insgesamt können 53 Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet vorkommen. Damit weist das<br />
Gebiet eine überdurchschnittliche Artenvielfalt laut Arten-Areal-Kurve (Anhang 2) auf. Es<br />
handelt sich überwiegend um weit verbreitete Ubiquisten wie Amsel, Buchfink oder<br />
Ringeltaube, <strong>die</strong> in mehreren Biotopen als Brutvögel auftreten können. Zahlreiche Arten,<br />
darunter auch anspruchsvollere Spezialisten (z.B. Spechte) sind an <strong>die</strong> Gehölzstrukturen am<br />
Rande des Gebiets gebunden. Für viele Arten, insbesondere <strong>für</strong> Arten mit großräumigen<br />
und komplexen Habitatansprüchen stellt das Untersuchungsgebiet einen Teillebensraum<br />
(Teil des Reviers) dar. Zu den Großvogelarten gehören Graureiher, Habicht, Mäusebussard,<br />
Turmfalke, Schleiereule, Sperber, Waldohreule und Waldkauz sowie der Schwarzspecht.<br />
Die Arten nutzen das Gebiet als Nahrungslebensraum. Habicht, Sperber, Mäusebussard,<br />
Turmfalke und Waldohreule könnten auch geeignete Brutplätze im Gebiet finden. Während<br />
der Geländebegehung wurden jedoch keine Nester von Großvögeln entdeckt. Die meisten<br />
Arten nutzen nicht nur bestehende Nester sondern legen in jeder Brutsaison neue Nester<br />
an, so dass mit einem potenziellen Brutplatzvorkommen der genannten Arten gerechnet<br />
werden muss.<br />
Weitere potenzielle Brutplätze der Großvogelarten befinden sich in den Waldbeständen<br />
außerhalb des untersuchten Gebietes. Die siedlungsgebundenen Arten (z.B. Schleiereule)<br />
treten lediglich als Nahrungsgäste auf, da im Untersuchungsgebiet keine Gebäude mit<br />
geeigneten Strukturen zur Nestanlage vorhanden sind.<br />
Mit fünf bestandsgefährdeten Arten (Grünspecht, Kleinspecht, Rebhuhn, Turteltaube und<br />
Waldohreule) ist der Anteil von Arten der Roten Liste Deutschlands und/oder<br />
Niedersachsens potenziell hoch. Bis auf das Rebhuhn sind <strong>die</strong> potenziellen Rote-Liste-Arten<br />
an <strong>die</strong> vorhandenen Gehölzstrukturen gebunden. Fünf potenziell vorkommende Arten sind<br />
aktuell noch nicht gefährdet, werden aber aufgrund merklicher Bestandsabnahmen in der<br />
Vorwarnliste Niedersachsens geführt. Dies sind Feldsperling, Girlitz, Star, Turmfalke und<br />
Waldkauz. Der potenziell vorkommende Schwarzspecht ist nach Anhang I der EU-<br />
Vogelschutzrichtlinie besonders geschützt.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 13<br />
Tabelle 3: Potenzielle Brutvogelarten Munster SW Z4a<br />
Artname<br />
RL D<br />
Amsel . . . . A, B<br />
Bachstelze . . . . A, B, C<br />
Blaumeise . . . . A, B<br />
Buchfink . . . . A, B<br />
Buntspecht . . . . B<br />
Dohle . . . . A, B<br />
Eichelhäher . . . . B<br />
Elster . . . . A, B<br />
Erlenzeisig . . . . B<br />
Fasan . . . . A, B<br />
Feldsperling V V V . B<br />
Fichtenkreuzschnabel . . . . B<br />
Fitis . . . . B<br />
Gartenbaumläufer . . . . B<br />
Gartengrasmücke . . . . B<br />
Gimpel . . . . B<br />
Girlitz . V V . B<br />
(Graureiher) . . . . C<br />
Grünfink . . . . A, B<br />
Grünspecht . 3 3 . A, B<br />
(Habicht) . . . . A, B<br />
Haubenmeise . . . . B<br />
Heckenbraunelle . . . . B<br />
Klappergrasmücke . . . . B<br />
Kleiber . . . . B<br />
Kleinspecht V 3 3 . B<br />
Kohlmeise . . . . B<br />
Kolkrabe . . . . A, B<br />
(Mäusebussard) . . . . B<br />
Misteldrossel . . . . B<br />
Mönchsgrasmücke . . . . B<br />
Rabenkrähe . . . . A, B<br />
(Rebhuhn) 2 3 3 . A, B<br />
Ringeltaube . . . . A, B<br />
Rotkehlchen . . . . B<br />
(Schleiereule) . . . . A<br />
(Schwarzspecht) . . . X B<br />
Singdrossel . . . . A, B<br />
Sommergoldhähnchen . . . . B<br />
(Sperber) . . . . B<br />
Star . V V . A, B<br />
Stockente . . . . C<br />
Sumpfmeise . . . . B<br />
Tannenmeise . . . . B<br />
RL NI<br />
RL NI-TO<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
EU-VSchRL<br />
Lebensraum
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 14<br />
Artname<br />
RL D<br />
(Turmfalke) . V V . A, B<br />
Turteltaube 3 2 . . B<br />
Waldbaumläufer . . . . B<br />
(Waldkauz) . V V . A, B<br />
(Waldohreule) . 3 3 . B<br />
Weidenmeise . . . . B<br />
Wintergoldhähnchen . . . . B<br />
Zaunkönig . . . . B<br />
Zilpzalp . . . . B<br />
Legende<br />
RL NI<br />
RL D = Rote Liste Deutschland,<br />
RL NI = Rote Liste Niedersachsen,<br />
RL NI-TO = Rote Liste Niedersachsen Tiefland-Ost,<br />
EU-VSchRL - Vogelschutzrichtlinie, Anhang I,<br />
() = Teilrevier / Nahrungslebensraum<br />
A = Offenlandbereiche<br />
B = Wald und Gehölze<br />
C = Gewässer<br />
Der Wert des Untersuchungsgebietes <strong>für</strong> <strong>die</strong> Vogelwelt wird anhand folgender Kriterien<br />
ermittelt:<br />
Bestandsgefährdung der Arten (Rote Listen Niedersachsen und Deutschland),<br />
Verbreitung,<br />
Artenvielfalt,<br />
Vollständigkeit und Repräsentanz der Avizönosen.<br />
Die Bedeutung wird in einer fünfstufigen Bewertungsskala ausgedrückt:<br />
geringe Bedeutung<br />
mäßige Bedeutung<br />
mittlere Bedeutung<br />
hohe Bedeutung<br />
sehr hohe Bedeutung<br />
Im Untersuchungsgebiet wurden zur Auswertung drei Funktionsräume/Biotopkomplexe<br />
abgegrenzt (s. Karte 1):<br />
• A „Offenlandbereiche”<br />
• B „Wald und Gehölze”<br />
• C „Gewässer“.<br />
RL NI-TO<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
EU-VSchRL<br />
Lebensraum
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 15<br />
Entsprechend der Habitatstruktur und Funktionalität der Biotopkomplexe ergeben sich<br />
spezielle Brutvogelgemeinschaften. Im Folgenden werden <strong>die</strong> Biotopkomplexe hinsichtlich<br />
ihrer potenziellen Bedeutung als Brutvogellebensräume bewertet.<br />
A „Offenlandbereiche“<br />
Offene Acker- und Grünlandflächen nehmen den überwiegenden Teil des<br />
Untersuchungsgebietes ein. Ein Vorkommen von bodenbrütenden Offenlandarten wie<br />
Feldlerche oder Kiebitz wird aufgrund der vorhandenen Vertikalstrukturen (Waldränder,<br />
Gehölze, Erdgasgewinnungsanlage, Strommasten) nicht erwartet. Feldlerche und Kiebitz<br />
legen ihre Nester ohne Deckung am Boden an. Sie benötigen weithin freie Sicht um ihren<br />
Brutplatz vor nahenden Fressfeinden zu schützen und reagieren empfindlich gegenüber<br />
optischen Störungen und Einschränkungen des Blickfeldes. Bei der Revierwahl hält <strong>die</strong><br />
Feldlerche mindestens 60 - 120 m Abstand zu bewaldeten Gebieten und<br />
sichteinschränkenden Vertikalstrukturen ein. Ähnlich wie bei der Feldlerche hält der Kiebitz<br />
Abstände zu sichteinschränkenden Strukturen ein. Potenzielle Brutplätze sind im Bereich<br />
des geplanten Standortes nicht zu erwarten.<br />
Als potenzielle Feldvogelart kommt das Rebhuhn mit einem Teilrevier vor. Geeignete<br />
Brutplätze der bestandsgefährdeten Art befinden sich in den deckungsreichen Strukturen<br />
der Gehölzbestände und Saumstrukturen im Westen des Gebiets (s. Biotopkomplex B<br />
„Waldbestand und Gehölze“). Die Acker- und Grünlandfläche wird potenziell als<br />
Nahrungslebensraum genutzt. Im Bereich der Eingriffsfläche sind keine geeigneten<br />
Vegetationsstrukturen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Anlage des Bodennestes vorhanden.<br />
Als Nahrungslebensraum ist <strong>die</strong> Acker- und Grünlandfläche <strong>für</strong> (Groß-)Vogelarten, deren<br />
Brutplätze in den Gehölzstrukturen und den umliegenden Siedlungsbereichen liegen (z.B.<br />
Waldkauz, Schleiereule, Turmfalke) wertvoll. Entscheidend sind <strong>die</strong> Strukturen der<br />
Gehölzbestände und der Waldrandbereiche, da <strong>die</strong> Vertikalstrukturen von den Eulen- und<br />
Greifvogelarten als Ansitze genutzt werden um in den offenen Flächen Kleinsäuger zu<br />
jagen.<br />
Bewertung: Die Acker- und Grünland hat eine mäßige Bedeutung als Lebensraum <strong>für</strong><br />
Brutvögel.<br />
Brutplätze gefährdeter Arten kommen potenziell nicht vor, das Rebhuhn nutzt das Offenland<br />
potenziell zur Nahrungssuche. Daneben nutzen zahlreiche allgemein verbreitete Arten und<br />
Arten der Vorwarnlisten <strong>die</strong> Äcker als Nahrungslebensraum. Deren Nistplätze befinden sich<br />
in den angrenzenden Biotopen oder außerhalb des Gebiets.<br />
B „Wald und Gehölze“<br />
An den Rändern des Gebietes befinden sich Fichtenforstbestände sowie Kiefernwald mit<br />
einzelnen Birken und Eichen mittleren Alters. Totholz ist nur gering vorhanden. Stellenweise<br />
weisen <strong>die</strong> Bestände kraut- und strauchreichen Unterwuchs auf. Weiterhin sind junge<br />
Gehölzpflanzungen und kleine Baumbestände mit Erlen und Birken vorhanden, in denen ein<br />
Brutvorkommen des Kleinspechts möglich ist. Die Altbäume der Baumreihe im Westen sind<br />
potenzielle Höhlenbäume <strong>für</strong> Grün- und Schwarzspecht. Der Schwarzspecht beansprucht<br />
sehr große Reviere und kommt potenziell mit einem Teilrevier im Gebiet vor. Die<br />
Habitatansprüche des Grünspechts reichen ebenfalls über <strong>die</strong> Grenzen des Gebietes<br />
hinaus. An den strukturreichen Rändern der Waldbestände und in der Deckung des<br />
Fichtenforstes besteht ein Potenzial als Brutlebensraum <strong>für</strong> <strong>die</strong> Waldohreule. Die<br />
Turteltaube bevorzugt ursprünglich lichte sommertrockene Wälder und kommt heute auch in<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 16<br />
der halboffenen Kulturlandschaft vor. Im Gebiet findet sie möglicherweise an den<br />
Waldrändern und im Übergangsbereich der Gehölze zum Offenland geeignete<br />
Lebensraumstrukturen. Das Rebhuhn legt seine Bodennester in deckungsreicher Vegetation<br />
an. Zur Nahrungssuche werden vor allem Feld- und Wegränder aufgesucht. Wesentliche<br />
Habitatbestandteile sind neben Wegrainen, Acker- und Wiesenrändern, auch unbefestigte<br />
Feldwege, Brachen und Grünländer. Derartige Strukturen sind im Untersuchungsgebiet<br />
kleinflächig im Westen des Gebietes im Umfeld der Baumreihe (Bt.-Nr. 18, HBA), des<br />
Grabens (Bt.-Nr. 17, FG) und in den umgebenden halbruderalen Gras- und Staudenfluren<br />
(Bt.-Nr. 15, UH/OVW) vorhanden (s. Karte 1). Auf <strong>die</strong> Fläche bezogen reicht das<br />
Strukturangebot nicht aus um <strong>die</strong> Revieransprüche der Art zu decken. Deshalb kommt <strong>die</strong><br />
Art potenziell nur mit einem Teilrevier im Gebiet vor.<br />
Geeignete Strukturen und Bäume zum Höhlenbau sowie einige Höhlen und Astlöcher <strong>für</strong><br />
Höhlen- und Nischenbrüter wie z.B. Feldsperling, Kleiber, Buntspecht, Star und verschiedene<br />
Meisenarten sind vorhanden. Die Gehölze können auch von Greifvögeln als<br />
Brutstandort (z.B. Mäusebussard, Turmfalke) oder Ansitzwarten im Jagdrevier genutzt<br />
werden. In den Gehölzen können außerdem weit verbreitete Gebüsch- und Gehölzfreibrüter<br />
wie Amsel, Buchfink, Ringeltaube und Zaunkönig vorkommen. Auch Vogelarten wie<br />
beispielsweise Grasmücken, <strong>die</strong> bei der Nahrungssuche und Nestanlage auf Deckung<br />
bietende Vegetationsstrukturen angewiesen sind, sowie Bäume und Gebüsche als<br />
Singwarten nutzende Arten, finden geeignete Strukturen.<br />
Bewertung: Die Gehölzstrukturen haben eine hohe Bedeutung als Lebensraum <strong>für</strong> Vögel.<br />
Als bestandsgefährdete Arten sind potenziell Klein- und Grünspecht, Rebhuhn, Waldohreule<br />
und Turteltaube vertreten, wobei <strong>die</strong> meisten Arten nur mit Teilrevieren vorkommen. Arten<br />
der Vorwarnlisten sind potenziell: Feldsperling, Girlitz, Star, Turmfalke und Waldkauz. Der<br />
Schwarzspecht wird in Anhang I der EU-VSchRL geführt.<br />
C „Gewässer“<br />
Im Südwesten des Gebiets befinden sich ein naturferner Fischteich, der von Nadelgehölzen<br />
umgeben ist, sowie ein Graben. An der Westgrenze des Gebiets verläuft ein ausgebauter<br />
Bach ohne nennenswerte Ufervegetation. Die Gewässer weisen kaum natürliche<br />
Uferstrukturen auf. Ein Vorkommen spezialisierter Vogelarten, z.B. Röhrichtbrüter oder<br />
anspruchsvolle Wasservögel, werden nicht erwartet. Als Brutvogel ist lediglich <strong>die</strong> Stockente<br />
zu vermuten. Die Art zählt zu den ungefährdeten und weit verbreiteten Wasservogelarten,<br />
<strong>die</strong> keine speziellen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. Als potenzieller Nahrungsgast<br />
ist der Graureiher zu nennen.<br />
Bewertung: Die Gewässer haben eine mäßige Bedeutung als Lebensraum <strong>für</strong> Brutvögel.<br />
Bestandsgefährdete Brutvogelarten kommen nicht vor.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 17<br />
3.1.3 Fledermäuse<br />
Während der Geländebegehung sind geeignete Bäume und Teillebensräume <strong>für</strong><br />
Fledermäuse erfasst worden. Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotope sind auf<br />
ihr Potenzial als Fledermauslebensraum geprüft worden, wobei <strong>die</strong> Ausprägung der<br />
Habitatstrukturen zur Ermittlung der potenziell vorkommenden Arten herangezogen wurde.<br />
Die Bewertung der Bedeutung des Untersuchungsgebietes <strong>für</strong> Fledermäuse erfolgt verbalargumentativ.<br />
Der Jahreslebensraum von Fledermäusen setzt sich aus verschiedenen, artspezifischen<br />
Teillebensräumen zusammen. Grundsätzlich unterscheiden sie sich in Sommer-, Zwischen-,<br />
Paarungs- und Winterquartiere sowie nacht- und jahreszeitlich unterschiedliche Jagdgebiete<br />
und Flugstraßen. Die Jagdgebiete können von den Tagesschlafplätzen mehrere Kilometer<br />
weit entfernt liegen, wobei <strong>die</strong> verschiedenen Arten unterschiedliche Habitate und<br />
Jagdstrategien nutzen.<br />
Alle einheimischen Fledermausarten zählen zu den streng geschützten Arten. Die meisten<br />
heimischen Fledermausarten werden in den Roten Listen Niedersachsens (RL-NI) bzw.<br />
Deutschlands (RL-D) geführt (HECKENROTH 1993, BOYE et al. 1998).<br />
Da im Untersuchungsgebiet keine Gebäude vorhanden sind, fehlen geeignete Fortpflanzungslebensräume<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> typischen Gebäudefledermäuse (z.B. Breitflügelfledermaus).<br />
Die meisten Arten haben aber große Aktionsra<strong>die</strong>n, so dass <strong>die</strong> im Gebiet vorhandenen<br />
Nahrungslebensräume auch von den Gebäudefledermäusen, <strong>die</strong> in der Umgebung<br />
(Wochenstuben-)Quartiere beziehen, aufgesucht werden. Gebäudefledermäuse wie Große<br />
und Kleine Bartfledermaus sowie <strong>die</strong> Breitflügelfledermaus jagen möglicherweise über den<br />
Gewässern und entlang der Gehölzstrukturen im Gebiet. Ein Vorkommen von Fledermausarten,<br />
<strong>die</strong> an Wälder gebunden sind, wird ausgeschlossen. Im Gebiet befinden sich<br />
lediglich <strong>die</strong> Randbereiche größerer Wald- und Forstbestände. Funktionsbeziehungen von<br />
Waldfledermäusen, <strong>die</strong> potenziell im Wald außerhalb des Gebiets ihre Quartiere finden,<br />
bestehen nicht. Die Rauhautfledermaus, <strong>die</strong> zu den Waldfledermäusen zählt, könnte auf<br />
dem Zug in <strong>die</strong> im Südwesten gelegenen Überwinterungsgebiete als Nahrungsgast auftreten<br />
und an den Rändern der Gehölze Beute jagen. Für Baumfledermäuse wie<br />
Wasserfledermaus oder Großer Abendsegler bieten <strong>die</strong> Baumbestände, insbesondere im<br />
Westen des Gebietes (Bt.-Nr. 18, HBA, s. Karte 1) eventuell Quartiermöglichkeiten. Auch <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Zwergfledermaus, <strong>die</strong> selten Baumhöhlen bezieht und <strong>für</strong> <strong>die</strong> Mückenfledermaus, <strong>die</strong><br />
Baumhöhlen als Balzquartiere nutzt, besteht ein potenzielles Quartierangebot im Gebiet. In<br />
der Baumreihe im Westen (Bt.-Nr. 18, HBA, s. Karte 1) können geräumige Baumhöhlen<br />
vermutet werden. Die Binnengewässer sind insbesondere <strong>für</strong> <strong>die</strong> Wasserfledermaus<br />
potenziell geeignete Nahrungslebensräume. Die Art jagt knapp über der Wasseroberfläche<br />
nach Insekten. Die Fischteiche sind jedoch teilweise mit Netzen abgespannt, so dass das<br />
Nahrungsangebot <strong>für</strong> Fledermäuse unerreichbar ist.<br />
Tabelle 4 zeigt eine Aufstellung aller potenziell vorkommenden Feldermausarten im<br />
Untersuchungsgebiet.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 18<br />
Tabelle 4: Potenzielle Fledermausarten<br />
Artname<br />
Breitflügelfledermaus V 2 IV J<br />
Große Bartfledermaus 2 2 IV J<br />
Kleine Bartfledermaus 3 2 IV J<br />
RL D<br />
RL NI<br />
FFH-RL<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
Lebensraumfunktion<br />
Großer Abendsegler 3 2 IV Q, J, Z<br />
Kleiner Abendsegler IV J<br />
Mückenfledermaus D N IV Q, J<br />
Rauhautfledermaus G 2 IV Z, J<br />
Wasserfledermaus . 3 IV Q, J<br />
Zwergfledermaus D 3 IV Q, J<br />
RL D = Rote Liste Deutschland, RL NI = Rote Liste Niedersachsen,<br />
FFH-RL - Flora-Fauna-Habitatrichtlinie, Anhang IV,<br />
D = Daten defizitär (erst in jüngster Zeit Trennung der Pipistrellusarten Zwerg- und<br />
Mückenfledermaus), G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt,<br />
N = erst nach Veröffentlichung der Roten Liste nachgewiesen (Status unbekannt),<br />
J = Jagdlebensraum, Q = (Wochenstuben-)Quartier, Z = Zug<br />
3.1.4 Amphibien<br />
Die beiden im Südwesten gelegenen Fischteiche werden intensiv bewirtschaftet und sind als<br />
Amphibienlebensräume wenig geeignet. Sie besitzen steile Böschungen, denen natürliche<br />
Uferstrukturen fehlen. Eine submerse Vegetation fehlt vollständig. Der südliche Teich ist<br />
durch <strong>die</strong> umgebenden Gehölze stark beschattet. Die Wasserfläche des nördlich gelegenen<br />
Teiches ist dagegen besonnt. In beiden Kleingewässern wird ein hoher Fischbestand<br />
vermutet. Aufgrund der naturfernen Eigenschaften der Gewässer und des Fischbesatzes<br />
haben <strong>die</strong> Biotope eine geringe Bedeutung als Amphibienlebensraum.<br />
Im Westen befinden sich ein mäßig ausgebauter Bach (Bt-Nr. 19) sowie ein Graben (Bt-Nr.<br />
17). Der Bach ist ebenfalls als Amphibienlebensraum kaum geeignet, seine Böschungen<br />
sind steil, eine Ufervegetation fehlt. Der Graben weist dagegen charakteristische Ufersäume<br />
mit Röhrichtpflanzen und submerser Vegetation auf, woran Kröten und Frösche ihren Laich<br />
ablegen können. Der Graben ist potenzieller Fortpflanzungslebensraum weit verbreiteter,<br />
sehr anpassungsfähiger Amphibienarten wie Grasfrosch (Rana temporaria), Erdkröte (Bufo<br />
bufo) oder Teichmolch (Triturus vulgaris). Die potenziell vorkommenden Arten sind bundes-<br />
und landesweit nicht in ihrem Bestand gefährdet und werden nicht in den<br />
Gefährdungskategorien der Roten Listen geführt.<br />
Amphibien nutzen jahreszeitabhängig verschiedene Lebensräume. Die Überwinterungen<br />
erfolgen bei Grasfröschen und Molchen teilweise in Laubholzbeständen oder auch in<br />
Gewässern, während Erdkröten ausschließlich in Gehölz- und Waldbeständen (auch<br />
Hecken) überwintern. Daher können <strong>die</strong> im Untersuchungsgebiet vorhandenen<br />
Gehölzstrukturen als Sommer- und Winterlebensraum <strong>die</strong>nen. Auf ihren Wanderungen zu<br />
den verschiedenen Lebensräumen orientieren sich <strong>die</strong> Amphibien entlang von<br />
Feuchtbiotopen und Gehölzstrukturen, <strong>die</strong> ausgeräumte Agrarlandschaft wird weitgehend
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 19<br />
gemieden. In <strong>die</strong>sem Zusammenhang bestehen keine Funktionsbeziehungen zwischen der<br />
Eingriffsfläche des Vorhabens und der im Gebiet vorhandenen Amphibienlebensräume.<br />
3.2 Boden<br />
Das Untersuchungsgebiet <strong>für</strong> das Schutzgut Boden umfasst <strong>die</strong> temporär in Anspruch<br />
genommene Fläche, <strong>die</strong> über den bestehenden und bereits voll versiegelten Anlagenbereich<br />
hinausgeht (s. Karte 1). Die Bestandsdarstellung und Bewertung des gegenwärtigen<br />
Zustandes erfolgt durch Auswertung der digitalen Bodenkarte des NLfB (1998).<br />
Im Untersuchungsgebiet tritt der Bodentyp der Podsol-Braunerde auf, der sich aus<br />
Geschiebedecksanden über Schmelzwasserablagerungen aufbaut. Er hat sich aus einer<br />
Braunerde entwickelt, <strong>die</strong> aufgrund des basenarmen Substrates und der damit<br />
einhergehende Auswaschung von Metalloxiden der Entwicklung zu einem Podsol unterliegt.<br />
Podsolböden sind natürlicherweise ertragsarm, aber aufgrund der sandigen Bodenart<br />
wasserdurchlässig.<br />
Der anstehende Boden ist durch intensive Bewirtschaftung bereits in gewissem Umfang<br />
anthropogen überformt und von grundsätzlicher Bedeutung. Böden mit besonderen<br />
Standorteigenschaften (Extremstandorte), naturnahe Böden, Böden mit kultur- oder<br />
naturhistorischer Bedeutung, Moorböden oder sonstige seltene Böden sind im<br />
Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.<br />
3.3 Wasser<br />
Das Untersuchungsgebiet <strong>für</strong> das Schutzgut Wasser umfasst das Untersuchungsgebiet <strong>für</strong><br />
das Schutzgut Tiere und Pflanzen.<br />
Grundwasser<br />
Die Lage der Grundwasseroberfläche liegt nach Information aus der Hydrogeologischen<br />
Übersichtskarte 1:200.000 (HÜK 200, LBEG) bei > 55 - 60 mNN. Bei Annahme der Grundwasseroberfläche<br />
bei 60 mNN und der Geländehöhe von 62 - 63 m beträgt der vermutliche<br />
Grundwasserflurabstand 2 - 3 m. Der vorliegende terrestrische Bodentyp der Podsol-Braunerde<br />
(NLfB, 1998) lässt ebenfalls auf einen Grundwasserflurabstand in <strong>die</strong>ser Größenordnung<br />
schließen. Zudem entspricht <strong>die</strong>ser Wert in etwa der Differenz der Geländehöhe<br />
des Untersuchungsgebietes zur südlich gelegenen Wietzeniederung. Insgesamt kann daher<br />
ein Grundwasserflurabstand von mindestens 2 m angenommen werden.<br />
Die Grundwasserneubildungsrate liegt zwischen 151 - 200 mm/Jahr. Eine besondere<br />
Bedeutung (GW-Neubildungsrate > 200 mm/Jahr) liegt nicht vor. Die Funktionsfähigkeit des<br />
Bodens zum Grundwasserschutz ist über <strong>die</strong> Filterwirkung zu erfassen. Aufgrund des<br />
vorliegenden Bodentyps aus sandigem Substrat liegt eine geringe Filterwirkung vor, so dass<br />
das Schutzpotenzial der Grundwasserdeckschicht aufgrund einer Mächtigkeit von < 5 m als<br />
gering bewertet wird (LBEG WMS HYDROGEOLOGISCHE KARTEN, 2009).<br />
Insgesamt liegt <strong>für</strong> das Schutzgut Wasser eine allgemeine Bedeutung vor.<br />
Oberflächengewässer<br />
Im Westen des Untersuchungsgebietes fließt von einer vermoorten Senke nördlich der K11<br />
aus ein mäßig ausgebauter Bach in Richtung Süden, der in <strong>die</strong> Wietze entwässert. Das<br />
Gewässer speist zuvor im südwestlichen Untersuchungsgebiet einen Fischteich und bildet<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 20<br />
unmittelbar südlich durch Aufstauung einen weiteren. Südlich der Baumreihe entlang des<br />
Grasweges befindet sich zudem ein abflussloser Graben. Angaben zur Klassifizierung der<br />
biologischen und chemischen Güte oder der Strukturgüte der Gewässer liegen nicht vor.<br />
3.4 Klima und Luft<br />
Zur Beurteilung der Bedeutung der Flächen des Untersuchungsgebietes <strong>für</strong> <strong>die</strong> Schutzgüter<br />
Klima und Luft werden folgende Kriterien herangezogen:<br />
• Bereiche mit luftreinigender oder klimaschützender Wirkung,<br />
• Frischluftentstehungsgebiete,<br />
• Luftaustausch/Klimaausgleich.<br />
Das Untersuchungsgebiet selbst enthält Bereiche mit luftreinigender oder klimaschützender<br />
Wirkung in Form der angrenzenden großflächigen Waldbereiche in der Umgebung. Die als<br />
Grünland genutzten Flächen sind Bereiche mit mittlerer bis hoher Kalt- bzw.<br />
Frischluftproduktion.<br />
Der Bereich des Untersuchungsgebietes besitzt als nicht versiegelte Fläche grundsätzlich<br />
eine klimatische Ausgleichsfunktion. Da keine dicht besiedelten Gebiete mit erhöhtem<br />
Frischluftbedarf zu <strong>die</strong>sen Bereichen in Beziehung stehen, kann keine besondere Bedeutung<br />
als klimatischer Ausgleichsraum festgestellt werden.<br />
3.5 Landschaftsbild<br />
Als Betrachtungsraum <strong>für</strong> das Schutzgut Landschaftsbild wurde ein Radius von ca. 250 m<br />
um den geplanten Bohransatzpunkt gewählt. Er umfasst <strong>die</strong> Vorhabensfläche sowie <strong>die</strong><br />
nähere Umgebung.<br />
Für <strong>die</strong> Beurteilung des Landschaftsbildes spielen folgende so genannte objektive<br />
Gestaltmerkmale eine wesentliche Rolle:<br />
vielfältige Landschaftselemente und -strukturen, <strong>die</strong> <strong>für</strong> Abwechslung sorgen und<br />
Interesse wecken,<br />
<strong>die</strong> Möglichkeit der Gliederung und Differenzierung von Landschaftsräumen, um<br />
eine Landschaft nach menschlichen Maßstäben überschaubar zu machen und<br />
<strong>die</strong> Möglichkeit der Orientierung, <strong>die</strong> ein Zurechtfinden in der Landschaft<br />
ermöglicht und damit ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.<br />
Das Untersuchungsgebiet ist nach Süden und Westen als halboffene und gering<br />
strukturierte Kulturlandschaft zu beschreiben. Kulissenbildende Nadelwälder und -bestände<br />
grenzen <strong>die</strong>sen Landschaftsraum ein. Eine Gliederung der Äcker und Grünländer erfolgt nur<br />
durch eine Laubbaumreihe im Westen. Nördlich der Fischteiche sind Anpflanzungen von<br />
Weiden und randlich Obstbäumen erfolgt, <strong>die</strong> als weiteres Landschaftselement <strong>für</strong><br />
Abwechselung gegenüber der durch Nadelgehölze dominierten Umgebung sorgen, aber<br />
nicht zur Strukturierung innerhalb des offenen Landschaftsraumes beitragen.<br />
Als Vorbelastungen sind <strong>die</strong> bestehende Förderanlage sowie ein einzelner, von einer<br />
ehemalig obertägig verlaufenden 20 kV-Leitung stammender, Transformatormast zu<br />
nennen. Die K11 verursacht mit Fahrzeugen jeder Größenordnung teilweise recht hohe<br />
Lärmemissionen durch den militärischen als auch zivilen Verkehr. In Bezug auf den<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 21<br />
Naturraum sind <strong>die</strong> standortfremden Fichtenforste bzw. deutliche Fichtenbeimischungen als<br />
Beeinträchtigung zu werten.<br />
Zusammenfassend wird dem Untersuchungsgebiet unter Berücksichtigung der<br />
Vorbelastungen und der geringen Strukturierung eine allgemeine Bedeutung <strong>für</strong> das<br />
Landschaftsbild zugesprochen.<br />
4. Auswirkungen der Baumaßnahme<br />
4.1 Beschreibung der Baumaßnahme<br />
Es ist geplant, ab Anfang Mai 2011 den vorhandenen Förderplatz der stillgelegten Munster<br />
SW Z4 <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong>, <strong>die</strong> durch das vorhandene Bohrloch erfolgt,<br />
herzurichten, sowie temporäre Parkplätze und ein Bodenlager herzustellen. Diese Baumaßnahmen<br />
nehmen mit einkalkuliertem Zeitpuffer ca. 2 Monate in Anspruch. Nach Abschluss<br />
der Bohrphase erfolgt ein kompletter Rückbau der hergestellen Flächen.<br />
Für <strong>die</strong> Bohrung werden auf dem Förderplatz ein ca. 42 m hoher Bohrturm mit den zugehörigen<br />
technischen Gerätschaften sowie mehrere Container aufgestellt. Diese Bestandteile<br />
werden nach Abschluss der Bohrung vollständig zurückgebaut. Das gesamte Vorhaben hat<br />
einen Zeitbedarf von voraussichtlich 4 - 6 Monaten.<br />
Temporärer Flächenbedarf<br />
Der bestehende Förderplatz bietet ausreichend Flächen <strong>für</strong> den Bohrturm sowie den<br />
Großteil der benötigten technischen Bestandteile und Containerstellplätze. Es werden<br />
darüber hinaus <strong>für</strong> zusätzliche Containerstandorte, zur Anlage der Parkplätze und des<br />
Bodenlagers temporär Flächen östlich des bestehenden Förderplatzes in Anspruch<br />
genommen (s. Abb. 2). Insgesamt besitzt das Vorhaben einen temporären Flächenbedarf<br />
von ca. 1.930 m².<br />
Die Parkplätze benötigen ca. 730 m² Fläche, <strong>die</strong> mit Schotter oder einem Mineralgemisch<br />
teilversiegelt wird. Die gleiche Befestigung wird ebenfalls auf ca. 750 m² <strong>für</strong> <strong>die</strong> zusätzlichen<br />
Containerstandorte hergestellt. Der abgeschobene Oberboden wird temporär südlich der<br />
Parkplätze auf ca. 450 m² temporär gelagert. Die Höhe der aufgeschütteten Fläche beträgt<br />
maximal 2 m, an allen Seiten wird eine Böschungsneigung von 1:2 hergestellt.<br />
Alle errichteten Anlagenbestandteile werden nach Abschluss der Bohrphase vollständig<br />
zurückgebaut, der Boden wieder vor Ort eingebaut und <strong>die</strong> Flächen zurück in <strong>die</strong><br />
ursprüngliche Nutzung überführt.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 22<br />
Abb. 2: Geplante Flächeninanspruchnahme<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 23<br />
Entwässerung<br />
Während der Bohrphase wird das anfallende Niederschlagswasser im Rahmen des<br />
Spülbohrverfahrens eingesetzt oder durch Tanklastwagen abgefahren. Die während der<br />
Bohrung anfallenden Spülungsschlämme werden in bergamtlich genehmigten Deponien und<br />
Kavernen eingelagert. Wassergefährdende Stoffe (Öl, Diesel, Chemikalien) werden in<br />
geeigneten Containern bzw. Tanks ordnungsgemäß gelagert.<br />
Bau- und Bohrbetrieb<br />
Zur Herrichtung des bestehenden Platzes und der darüber hinaus benötigten Flächen<br />
werden tagsüber ca. 10 Personen auf der Baustelle anwesend sein. Zum Einsatz kommen<br />
übliche Baugeräte wie LKW und Radlader.<br />
Die Bohrung wird in einem Zeitraum von ca. 8 - 12 Wochen rund um <strong>die</strong> Uhr an 7 Tagen in<br />
der Woche (inklusive Wochenenden und Feiertage) von durchschnittlich 10 anwesenden<br />
Personen durchgeführt. Zur Beleuchtung werden Leuchtstoffröhren im Mast der Bohranlage<br />
und Strahler angebracht. Die Lichtemissionen werden auf das mögliche Minimum reduziert,<br />
da <strong>die</strong> Leuchtstoffröhren nur im Nahbereich wirksam sind und <strong>für</strong> <strong>die</strong> Strahler eine exakte<br />
Ausrichtung erfolgt. Besondere Wärmeeinwirkungen oder Schadstoffemissionen ergeben<br />
sich nicht.<br />
4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft<br />
Im folgenden Kapitel werden <strong>die</strong> Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens auf Natur und<br />
Landschaft dargestellt und erhebliche Beeinträchtigungen hervorgehoben. Für <strong>die</strong><br />
rechnerische Ermittlung des Eingriffs wird das Bewertungsverfahren „Leitlinie Naturschutz<br />
und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz“ (NLÖ, 2002)<br />
angewandt.<br />
4.2.1 Auswirkungen auf Arten und Lebensgemeinschaften<br />
Biotopverluste<br />
Die temporäre Flächeninanspruchnahme des Vorhabens hat einen Verlust der gegenwärtig<br />
vorkommenden Biotope auf ca. 1.930 m² zur Folge. Tabelle 5 zeigt <strong>die</strong> Biotope, <strong>die</strong> durch<br />
<strong>die</strong> Vorhabensflächen verloren gehen, mit ihrer Bedeutung <strong>für</strong> den Naturschutz und der<br />
Verlustfläche.<br />
Tabelle 5: Von der Baumaßnahme betroffene Biotoptypen<br />
Biotoptyp Code<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
Wertstufe<br />
(NLÖ, 2004)<br />
Flächenverlust<br />
Intensiv-Grünland GI II 1.830 m²<br />
Halbruderale Gras- und Staudenflur UH II 100 m²<br />
1.930 m²<br />
Nach dem Bewertungsverfahren des NLÖ (2002) wird von einer erheblichen Beeinträchtigung<br />
ausgegangen, wenn Biotoptypen der Wertstufen III – V beeinträchtigt werden.<br />
Da <strong>die</strong> betroffenen Biotoptypen <strong>die</strong> Wertstufe II aufweisen und zudem kurzfristig widerherstellbar<br />
sind, liegen keine erheblichen Beeinträchtigungen vor.
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 24<br />
Auswirkungen auf <strong>die</strong> Avifauna<br />
Der Vorhabensstandort wird derzeit als Grünland genutzt. Aufgrund der Nähe zum Waldrand<br />
eignet sich der Bereich nicht als Bruthabitat <strong>für</strong> Brutvögel der offenen Kulturlandschaft wie<br />
Feldlerche oder Kiebitz, da <strong>die</strong> Arten zu sichteinschränkenden Vertikalstrukturen Abstände<br />
von 60 – 120 m einhalten. Andere im Gebiet vorkommende Bodenbrüter benötigen<br />
deckungsreiche Vegetation zur Nestanlage und finden in der Eingriffsfläche ebenfalls keine<br />
geeigneten Brutplätze. Durch das Vorhaben liegt daher kein Eingriff in Bezug auf<br />
Neststandorte von Brutvögeln vor. Da keine Gehölzfällungen vorgenommen werden, ist eine<br />
Betroffenheiten von Brutstätten der Gehölzfrei- und Gehölzhöhlenbrüter ausgeschlossen.<br />
Der temporäre Verlust von potenziellen Nahrungsflächen durch <strong>die</strong> Überbauung des<br />
Grünlandes ist im Vergleich zur Umgebung verhältnismäßig gering. Die ökologische<br />
Funktion des Lebensraumes bleibt <strong>für</strong> alle potenziell vorkommenden Brutvogelarten im<br />
räumlichen Zusammenhang erhalten, da ähnliche und besser geeignete Ersatzräume zur<br />
Nahrungssuche in der Umgebung aufgesucht werden können.<br />
Der Platzbau ist <strong>für</strong> den Zeitraum von Anfang Mai 2011 bis Ende Juni 2011 geplant, danach<br />
beginnt <strong>die</strong> Bohrung. Die Arbeiten fallen demnach in <strong>die</strong> Hauptbrutzeit der potenziell (in<br />
Teilrevieren) vorkommenden gefährdeten Brutvögel. Potenziell geeignete Brutplätze des<br />
Rebhuhns und der Spechtarten befinden sich im Westen des Gebietes, in ca. 150 m<br />
Entfernung zur Eingriffsfläche. Die Störwirkungen durch Lärm, Licht und Vibration treten<br />
temporär in der Umgebung des Bauplatzes auf. Beeinträchtigungen werden nicht in<br />
erheblichem Maße erwartet, da sich <strong>die</strong> potenziellen Neststandorte in größerer Distanz zur<br />
Störquelle befinden und sich <strong>die</strong> Nester artspezifisch in geschützten Anlagen, in Bruthöhlen<br />
(Spechte) bzw. in Deckung bodennaher Vegetation befinden (Rebhuhn). Potenzielle<br />
Niststätten im Fichtenforst im Norden (Waldohreule) und im Kiefernwald im Osten<br />
(Turteltaube) könnten von den Störungen zeitweise betroffen sein. Beide Arten gelten aber<br />
als störungsunempfindlich, da sie in dörflichen Siedlungen, in Gärten brüten und folglich <strong>die</strong><br />
Anwesenheit von Menschen und Betriebslärm gewohnt sind. Die Turteltaube brütet sogar in<br />
der Nähe verkehrsreicher Straßen (SÜDBECK et. al 2005). Darüber hinaus stellen <strong>die</strong> Straße,<br />
über <strong>die</strong> auch Panzerverkehr des Truppenübungsplatzes führt, sowie <strong>die</strong> nahe gelegenen<br />
Schießstände eine Vorbelastung dar. Beeinträchtigungen durch <strong>die</strong> temporären Störungen<br />
sind nicht zu erwarten. Nachhaltige Veränderungen ergeben sich <strong>für</strong> <strong>die</strong> Eingriffsfläche und<br />
ihre nahe Umgebung nicht, da nach ca. vier bis sechs Monaten ein vollständiger Rückbau<br />
der Baustelle erfolgt.<br />
Auswirkungen auf Fledermäuse<br />
Eine direkte Beeinträchtigung von Fledermausquartieren kann ausgeschlossen werden, da<br />
sich im Eingriffsbereich keine potenziellen Höhlenbäume befinden und Gehölzfällungen nicht<br />
vorgenommen werden. Potenzielle Fortpflanzungslebensräume mit Baumhöhlen und<br />
Quartiermöglichkeiten <strong>für</strong> Baumfledermausarten befinden sich kleinräumig im Westen des<br />
Untersuchungsgebiets. Während der Bau- und Bohrphase temporär auftretende Störungen<br />
beeinträchtigen <strong>die</strong>se potenziellen Baumhöhlenquartiere nicht, da <strong>die</strong> Distanz zum Bauplatz<br />
etwa 150 m beträgt. Durch <strong>die</strong> temporäre Überbauung des Grünlands wird das<br />
Nahrungsangebot <strong>für</strong> Fledermäuse zeitweilig nur sehr geringfügig vermindert. Durch <strong>die</strong><br />
temporären Störungen durch Beleuchtung werden kleine Teile der Jagdlebensräume der<br />
Fledermäuse ebenfalls beeinträchtigt. Da in der Umgebung ähnlich und besser geeignete<br />
Nahrungsquellen vorhanden sind, bestehen genügend Ausweichmöglichkeiten zur Jagd. Die<br />
Funktion des Jagdgebietes bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 25<br />
Für Fledermäuse sind insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen durch das geplante<br />
Vorhaben zu erwarten.<br />
Auswirkungen auf Amphibien<br />
Durch den Eingriff sind keine Beeinträchtigungen von potenziellen Amphibienlebensräumen<br />
zu erwarten. Die Gefahr der Tötung oder der Zerschneidung von Vernetzungsstrukturen<br />
bestehen nicht, Vermeidungsmaßnahmen sind nicht notwendig. Die potenziell<br />
vorkommenden Amphibienarten sind nicht in ihrem Bestand gefährdet. Das potenzielle<br />
Laichgewässer, der Graben im Westen des Gebietes (Bt.-Nr. 17, s. Karte 1) sowie <strong>die</strong><br />
potenziellen Sommer- und Winterlebensräume liegen außerhalb des Eingriffsbereiches des<br />
geplanten Vorhabens. Es bestehen keine Funktionsbeziehungen zur Vorhabensfläche.<br />
4.2.2 Auswirkungen auf den Boden<br />
Der vorkommende Boden ist auf ca. 1.480 m² von Teilversiegelung sowie auf 450 m² von<br />
Überbauung betroffen.<br />
Im Bereich teilversiegelter Flächen gehen <strong>die</strong> Bodenfunktionen teilweise verloren. Weiterhin<br />
ist der Boden dort von Austauschmaßnahmen betroffen, so dass das natürliche<br />
Bodengefüge gestört ist und der vorkommende Bodentyp nicht mehr seine<br />
standorttypischen Merkmale aufweist. Durch Überbauung unterliegt der Boden einer<br />
Verdichtung, <strong>die</strong> sich auf seine Funktionserfüllungen in Bezug auf den eng verknüpften<br />
Wasserhaushalt auswirken können.<br />
Der vorliegende Boden ist durch <strong>die</strong> intensive landwirtschaftliche Nutzung bereits<br />
vorbelastet. Die Beanspruchung durch das Vorhaben ist zeitlich auf 4 - 6 Monate begrenzt,<br />
nach dem Rückbau werden der gelagerte Oberboden vor Ort eingebaut und <strong>die</strong> Flächen<br />
ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt. Der Boden hat danach <strong>die</strong> Möglichkeit hat, sich<br />
wieder zu regenerieren.<br />
Somit sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden festzustellen.<br />
4.2.3 Auswirkungen auf das Wasser<br />
Grundwasser<br />
Die Inanspruchnahme von 1.930 m² Fläche kann durch <strong>die</strong> Verdichtung des Bodens als<br />
Folge der Teilversiegelung und Überbauung zu einer Verringerung der Versickerungsrate<br />
führen. Diese Beeinträchtigung ist auf <strong>die</strong> Bau- und Bohrphase (4 - 6 Monate) begrenzt. Da<br />
das Vorhaben keine Bereiche mit besonderer Bedeutung in Bezug auf das Grundwasser in<br />
Anspruch nimmt und versiegelten Flächen sowie das Bodenlager nach Bohrabschluss<br />
zurück- bzw. eingebaut werden, liegen durch das Vorhaben keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen <strong>für</strong> das Grundwasser vor.<br />
Oberflächengewässer<br />
Es sind keine Oberflächengewässer von Auswirkungen des Vorhabens betroffen.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 26<br />
4.2.4 Auswirkungen auf das Klima<br />
Flächenversiegelung wirken sich durch eine Erhöhung der Temperatur und Verringerung der<br />
Luftfeuchtigkeit auf das Lokalklima aus. Als Folge der Versiegelung wird außerdem <strong>die</strong><br />
lufthygienische Funktion des betroffenen Raumes eingeschränkt.<br />
Durch das Vorhaben erfolgen keine neuen Vollversiegelungen. Die Teilversiegelung auf ca.<br />
1.480 m² Fläche führt zu keiner relevanten Erwärmung, zudem sind in der Umgebung mit<br />
ausgedehnten Wald- und Grünlandflächen mehrfach größere und klimatisch relevantere<br />
Bereiche weiterhin vorhanden. Darüber hinaus steht der Untersuchungsraum in keiner<br />
Beziehung zu Siedlungsbereichen, in denen klimatische Ausgleichsleistungen von<br />
herausragender Bedeutung sein könnten.<br />
Erhebliche Beeinträchtigungen <strong>für</strong> das Schutzgut Klima/Luft liegen durch das Vorhaben nicht<br />
vor.<br />
4.2.5 Auswirkungen auf das Landschaftsbild<br />
Während der zeitlich beschränkten Bohrzeit sind der 42 m hohe Bohrturm sowie <strong>die</strong><br />
aufgestellten Container und das technische Equipment <strong>die</strong> prägenden Elemente im Umfeld<br />
des Vorhabens. Dies führt zu einer starken technogenen Überprägung der Landschaft.<br />
Da aber alle <strong>für</strong> <strong>die</strong> Bohrung errichteten Anlagen nach Bohrabschluss vollständig<br />
zurückgebaut werden, ergeben sich durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen<br />
auf das Landschaftsbild.<br />
4.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung<br />
Folgende Maßnahmen nach § 15 BNatSchG in Verbindung mit § 6 NNAGBNatSchG werden<br />
durchgeführt, um negative Auswirkungen des Bauvorhabens zu vermeiden:<br />
Tabelle 6: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen<br />
Schutzgut Maßnahmen<br />
Arten und<br />
Lebensgemeinschaften<br />
Boden<br />
Schutz der angrenzenden Gehölze während der Bauphase als<br />
Lebensraum sowie zur Minimierung der Beeinträchtigungen<br />
<strong>für</strong> das Landschaftsbild<br />
Rückführung der betroffenen Biotoptypen in ihre vorherige<br />
Nutzung<br />
Reduzierung der Bau- und Betriebsflächen auf das<br />
notwendige Minimum<br />
Rückbau aller über den bestehenden Platz hinausgehenden<br />
beanspruchten Flächen<br />
Tiefenlockerung der verdichteten Bereiche vor dem Einbau<br />
des Oberbodens<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 27<br />
4.4 Erhebliche Beeinträchtigungen<br />
Wie im Kapitel 4.2 dargestellt, liegen durch das Vorhaben keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser,<br />
Klima/Luft und Landschaftsbild vor. Bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung<br />
und Minimie-rung sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen<br />
festzustellen, <strong>die</strong> nach §15 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 6 NNAGBNatSchG ausgeglichen<br />
oder ersetzt werden müssen.<br />
Daher sind keine Kompensationsmaßnahmen notwendig.<br />
Bremen, den 04.03.2011..........................................................................................................<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
Tanja Tesch
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 28<br />
5. Literatur und Unterlagen<br />
BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas.<br />
Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes - Nichtsperlingsvögel.<br />
Aula-Verlag Wiebelsheim, 808 S.<br />
BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas.<br />
Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2: Passeriformes - Sperlingsvögel.<br />
Aula-Verlag Wiebelsheim, 622 S.<br />
BLANA, H. (1978): Die Bedeutung der Landschaftsstruktur <strong>für</strong> <strong>die</strong> Vogelwelt – Modell einer<br />
ornithologischen Landschaftsbewertung. Beitr. z. Avifauna des Rheinlandes 12.<br />
BOYE, P., HUTTER, R. & H. BEHNKE (1998): Rote Liste der Säugetiere (Mammalia). In: Rote<br />
Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenreihe <strong>für</strong> Landschaftspflege und<br />
Naturschtuz, 55: 33-39.<br />
BUSCHE, G. (1975): Zur Siedlungsdichte und Ökologie von Sommervögeln in der Marsch<br />
Schleswig-Holsteins. Corax 5: 51-101.<br />
Drachenfels, O. v. (2004) : KARTIERSCHLÜSSEL FÜR BIOTOPTYPEN IN NIEDERSACHSEN. –<br />
NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN NIEDERSACHSEN A/4, O. O.<br />
DRACHENFELS, O. V. (2010): Überarbeitung der naturräumlichen Regionen Niedersachsens.<br />
In: NLWKN - Informations<strong>die</strong>nst Naturschutz Niedersachsen (4/2010), Hannover.<br />
FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen<br />
<strong>für</strong> den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching: IHW-<br />
Verlag, 879 S.<br />
HECKENROTH, H. (1993): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten<br />
Säugetierarten. - Inform.d. Naturschutz Nieders. 13/6: 221-226, Hannover.<br />
HECKENROTH, H. & V. LASKE (1997): Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981-1995.<br />
Naturschutz Landschaftspfl. H37: 1-329, Hannover.<br />
HÖTKER, H. (1990). Der Wiesenpieper. Neue Brehm-Bücherei, 595, Ziemsen, Wittenberg<br />
Lutherstadt.<br />
JENNY, M. (1990): Territorialität und Brutbiologie der Feldlerche (Alauda arvensis) in einer<br />
intensiv genutzten Agrarlandschaft. J. Orn. 131: 241-265.<br />
KRÜGER, T. & B. OLTMANNS (2007): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten<br />
Brutvögel. – Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 27/3: 131-175.<br />
KÖPPEL ET AL. (1998): Praxis der Eingriffsregelung, Stuttgart<br />
LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL (2000): Regionales Raumordnungsprogramm, Soltau.<br />
LBEG (O.J.) (LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG): WMS Karten<strong>die</strong>nst<br />
„Hydrogeologische Karten“ (online).<br />
NLFB (1998) (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG): Böden in Niedersachsen,<br />
Digitale Bodenkarte M. 1: 50.000, Hannover.<br />
NLÖ (2002) (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE) (Hrsg.): Leitlinie Naturschutz<br />
und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz. – Informations<strong>die</strong>nst<br />
Naturschutz Niedersachsen, Hannover.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 29<br />
NLÖ (2004) (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE) (Hrsg.): Wertstufen und<br />
Regenerationsfähigkeit der Biotoptypen in Niedersachsen. – Informations<strong>die</strong>nst<br />
Naturschutz Niedersachsen, Hannover.<br />
OELKE, H. (1968): Wo beginnt bzw. wo endet der Biotop der Feldlerche? J. Ornithol. 109: 25-<br />
29.<br />
REICHHOLF, J. (1980): Die Arten-Areal-Kurve bei Vögeln in Mitteleuropa. - Anzeiger der<br />
ornithologischen Gesellschaft in Bayern 19: 13-26.<br />
REICHHOLF, J. (1987): Indikatoren <strong>für</strong> Biotopqualitäten, notwendige Mindestflächengrö¬ßen<br />
und Vernetzungsdistanzen. – Veröffentlichungen der Akademie <strong>für</strong> Raumforschung<br />
und Landesplanung, Forschungs- und Sitzungsberichte Nr. 165: 291-309, Hannover.<br />
SÜDBECK, P., BAUER, H.-G., BOSCHERT, M., BOYE, P. & W. KNIEF (2007): Rote Liste der<br />
Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung, 30. Nov. 2007. - Ber. Vogelschutz 44<br />
THEUNERT, R. (2008): Verzeichnis der Niedersachsen besonders oder streng geschützten<br />
Arten. - Inform.d. Naturschutz Nieders. 28/3: 69-141, Hannover.<br />
ZENKER, W. (1982): Beziehungen zwischen Vogelbestand und der Kulturlandschaft. Beiträge<br />
zur Avifauna des Rheinlandes 15, Kilda Verlag.<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 30<br />
6. Anhang<br />
Anhang 1: Arten-Arealkurve aus REICHHOLF (1987)<br />
Erwartungswerte durchschnittlicher Anzahl Kleinvögel in Flächen bis 100 ha<br />
Fläche<br />
(ha)<br />
Artenzahl Fläche<br />
(ha)<br />
Artenzahl Fläche<br />
(ha)<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung<br />
Artenzahl<br />
1 12 7 18 30 30<br />
2 14 8 18 40 34<br />
3 15 9 19 50 37<br />
4 16 10 19 70 39<br />
5 17 15 22 90 40<br />
6 17 20 25 100 41
<strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Fachbeitrag</strong> <strong>Ablenkungsbohrung</strong> Munster SW Z4a 31<br />
7. Karten<br />
Karte 1: Biotopbestand und temporäre Auswirkungen<br />
KÖLLING & TESCH Umweltplanung