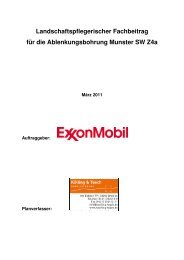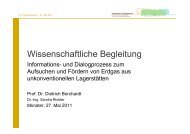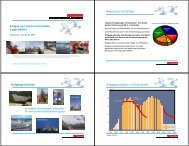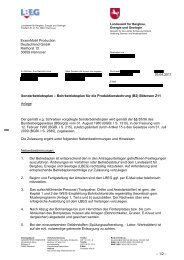Rechtliche Einordnung der Ergebnisse
Rechtliche Einordnung der Ergebnisse
Rechtliche Einordnung der Ergebnisse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissenschaftliche Statuskonferenz, Berlin 06./07.03.2012<br />
Ergebnisprotokoll Arbeitsgruppe 7 „<strong>Rechtliche</strong> <strong>Einordnung</strong> <strong>der</strong> <strong>Ergebnisse</strong>“<br />
Anmerkungen und Vorschläge <strong>der</strong> AG-Teilnehmer sind blau gesetzt<br />
Experten: Prof. Dr. Michael Reinhardt, LL.M. (Institut für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht,<br />
Universität Trier); Prof. Dr. Alexan<strong>der</strong> Roßnagel (Universität Kassel, Mitglied<br />
Expertenkreis)<br />
Mo<strong>der</strong>ation: Ruth Hammerbacher<br />
Protokoll: Anja Hentschel, Andreas Polzer<br />
Zusammenfassung <strong>der</strong> wichtigsten Fragen aus <strong>der</strong> Diskussion durch die Experten<br />
Zu Beginn <strong>der</strong> Diskussion wurden fünf wesentliche Fragenkomplexe identifiziert:<br />
Wie wird <strong>der</strong> Grundwasserbegriff nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ausgelegt?<br />
Wann liegt eine Gewässerbenutzung nach WHG vor und wie verhält es sich mit dem<br />
Besorgnisgrundsatz?<br />
Unter welchen Voraussetzungen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen?<br />
Wer haftet für Schäden und wer übernimmt die Regulierung dieser?<br />
Ergeben sich durch die För<strong>der</strong>ung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten<br />
raumbedeutsame Auswirkungen und wie sind diese zu bewerten?<br />
Aus Zeitgründen konnte <strong>der</strong> Fragenkomplex <strong>der</strong> Raumordnung nicht mehr erörtert werden. Außerdem<br />
fragte ein Teilnehmer, inwiefern die Vorgaben <strong>der</strong> REACH-Verordnung beim Fracking zu beachten<br />
seien. Dazu sagte Roßnagel, dass diese Fragestellung im abschließenden rechtlichen Gutachten mit<br />
einbezogen werde.<br />
Fragen und Anmerkungen, Diskussion:<br />
Grundwasserbegriff nach WHG:<br />
◦ Auslegung und Definition des Grundwasserbegriffs nach WHG, vor allem auch, ob vom<br />
Gesetz auch die Wässer in großen Tiefen erfasst werden.<br />
◦ Kann Sole auch Grundwasser im Sinne des WHG sein?<br />
◦ Warum kann nicht das nutzbare Grundwasser in den Karten zu den Settings (vgl. hierzu aus<br />
dem neutralen Expertenkreis Helmig/Sauer) grundsätzlich eingezeichnet und somit eindeutig<br />
ausgewiesen werden?<br />
◦ Kann ein Fließbild o<strong>der</strong> -schema zum Grundwasserbegriff und <strong>der</strong> Grundwasserbenutzung<br />
nach WHG entwickelt werden, das für Behörden als Entscheidungshilfe eingesetzt werde<br />
könnte?<br />
◦ <strong>Rechtliche</strong> <strong>Einordnung</strong> des im Rahmen des Steinkohlbergbaus anfallenden und<br />
somit auch bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Erdgas aus CBM-Lagerstätten möglicherweise mit zu<br />
för<strong>der</strong>nden Grubenwassers.<br />
◦ Werden in Bezug auf den Wasserhaushalt offene o<strong>der</strong> geschlossene Systeme betrachtet?<br />
Roßnagel führte aus, dass zwischen dem Begriff des Grundwassers nach WHG sowie dem Zweck<br />
des Schutzregimes nach WHG zu unterscheiden sei. Grundsätzlich sei vom Grundwasserbegriff nach<br />
WHG jegliches unterirdisches Wasser in <strong>der</strong> Sättigungszone erfasst, dass in unmittelbarer Berührung<br />
mit dem Boden o<strong>der</strong> dem Untergrund stehe, unabhängig auch von z. B. dem jeweiligen Salzgehalt<br />
und <strong>der</strong> Tiefe in <strong>der</strong> es vorkomme. Man müsse sich allerdings fragen, ob das WHG all diese Wässer<br />
regeln wolle. Einschränkend wirke, dass das WHG auf ein Bewirtschaftungsregime abstelle. Insoweit<br />
könne sich <strong>der</strong> Schutzbedarf des Grundwassers z. B. mit <strong>der</strong> Tiefe seines Vorkommens verän<strong>der</strong>n<br />
und somit auch die wirtschaftliche Bedeutung des Grundwassers. Vom Zweck des Gesetzes könne<br />
man ableiten, dass tiefes Grundwasser immer dann zu schützen ist, wenn wir etwas tun, was
Auswirkungen auf das von uns genutzte Wasser haben kann. Dies sei in jedem Fall, in dem dies nicht<br />
von vornherein auszuschließen ist, durch die Behörden im Einzelfall zu überprüfen.<br />
Der Begriff Sole sei als Bodenschatz im Bundesberggesetz (BBergG) definiert, dies schließe allerdings<br />
nicht aus, dass auch für Sole die Vorgaben des WHG zur Anwendung kommen müssten. Entsprechend<br />
seien bei diesbezüglichen Fragestellungen beide Rechtsbereiche, Berg- und Wasserrecht,<br />
zu betrachten. Die Nutzung unterfalle dem Bergrecht, kann aber auch zusätzlich nach Wasserrecht zu<br />
beurteilen sein.<br />
Der Zweck des Gesetzes frage danach, ob das in Rede stehende Wasser bewirtschaftungsfähig sei.<br />
Da die Definition des Grundwassers umfassend sei, könne man nur durch Forschung herausfinden,<br />
ob bestimmte Wässer auch dem Regime des Wasserrechts unterfallen würden. Beim Fracken müsse<br />
man untersuchen, ob Tiefenwasser im Kontakt mit dem bewirtschafteten Grundwasser stehen kann.<br />
Reinhardt stimmte den Ausführungen zu und ergänzte, dass <strong>der</strong> nach § 3 Nr. 3 WHG definierte<br />
Grundwasserbegriff zur Abgrenzung <strong>der</strong> beiden Rechtsbereiche des Wasserrechts und des Bodenschutzrechts<br />
diene, nicht aber zur Abgrenzung von den Vorgaben des Bergrechts. Häufig würden aus<br />
dem Zusammenhang heraus Zitate des Bundesverwaltungsgerichts gewählt, die besagten, dass<br />
Grundwasser das Wasser sei, was <strong>der</strong> Bewirtschaftung zugänglich sei. Eine Grenze werde vom<br />
Gericht jedoch nie gezogen. Insoweit sei die Anwendbarkeit des Grundwasserbegriffes auf Tiefengrundwasser<br />
vor allem nicht „in Metern“ messbar und darstellbar.<br />
Die europäische Grundwasserrichtlinie verfolge zwei Zielrichtungen. Einerseits solle oberflächennahes,<br />
zusammenhängendes Grundwasser in Wasserkörpern geschützt und die Verschlechterung<br />
<strong>der</strong> Qualität dieser Wasserkörper verhin<strong>der</strong>t werden, nicht aber explizit ein bestimmter chemischer<br />
Zustand bzw. ein guter ökologischer Zustand erreicht werden. An<strong>der</strong>erseits stehe <strong>der</strong> Trinkwasserschutz<br />
im Vor<strong>der</strong>grund, wobei <strong>der</strong> angelegte Schutzmaßstab bei Süßwasser und salinem Wasser<br />
unterschiedlich sei. Salines Grundwasser könne aber auch als Heilwasser schützenswert sein und<br />
unterliege dann auch dem WHG.<br />
Gewässerbenutzung nach WHG und Besorgnisgrundsatz:<br />
◦ Liegt bei <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>bringung einer Bohrung eine Gewässerbenutzung nach WHG vor<br />
und wenn ja, handelt es sich um eine „echte“ o<strong>der</strong> „unechte“ Benutzung?<br />
◦ Ist <strong>der</strong> Besorgnisgrundsatz nach § 48 Abs. 1 WHG beim Fracking zu beachten und wie ist<br />
<strong>der</strong> Begriff „besorgen“ in diesem Zusammenhang zu verstehen?<br />
◦ Ist bei Durchführung von Fracking-Maßnahmen Vorsorge in Bezug auf Wassereinzugsgebiete<br />
zu treffen?<br />
◦ Ist <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten anfallende<br />
Flowback als Abwasser im Sinne des WHG zu definieren?<br />
◦ Beim Bohren läge keine Gewässerbenutzung vor („Einbringen von Stoffen in Gewässer“<br />
nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG), wenn die eingebrachten Stoffe vom Deutschen Institut für<br />
Bautechnik (DIBt) für die Verwendung im Grundwasserbereich zugelassen seien. Dies<br />
ergebe sich auch aus Aussage in <strong>der</strong> Begründung zum Regierungsentwurf zur Neufassung<br />
des WHG aus dem Jahr 2009.<br />
◦ Ist beim Fracking <strong>der</strong> § 49 WHG, <strong>der</strong> Erdaufschlüsse betrifft, zu berücksichtigen?<br />
Roßnagel wies darauf hin, dass bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten bei<br />
<strong>der</strong> Beurteilung, ob eine Gewässerbenutzung nach WHG vorläge, die drei Prozesse – Bohren,<br />
Fracking und Verpressen – zu unterscheiden seien. Für alle Prozesse sei im Ergebnis keine echte,<br />
son<strong>der</strong>n eine unechte Gewässerbenutzung nach WHG anzunehmen.<br />
Reinhardt führte hierzu aus, dass durch die Neufassung des WHG im Jahr 2010 <strong>der</strong> Tatbestand des<br />
„Einbringens von festen Stoffen“ in Gewässer nun auch als Benutzung von Gewässern im Sinne des<br />
WHG anzusehen sei. Somit sei, sofern beim Bohren ein „Durchstechen“ eines Grundwasserkörpers<br />
erfolge, durchaus eine „echte“ Gewässerbenutzung gegeben, da feste Stoffe in das Grundwasser<br />
eingebracht würden. Der Tatbestand werde nur dann nicht erfüllt, wenn die Bohrung so erfolge, dass<br />
ein Grundwasserkörper nicht durchstochen werde und die Bohrung z. B. neben diesem erfolge. Weiter<br />
sei, z. B. bei <strong>der</strong> Gewinnung von Erdwärme, zwar eindeutig, dass zweckgerichtet Stoffe in<br />
Entwurf Ergebnisprotokoll AG 7 „<strong>Rechtliche</strong> <strong>Einordnung</strong> <strong>der</strong> <strong>Ergebnisse</strong>“, Seite 2
Grundwasser eingebracht werden und dies beim Fracking nicht <strong>der</strong> Fall sei und dass das Durchstechen<br />
nur eine Nebenfolge darstelle. Es werde aber in Kauf genommen, dass ein Grundwasserkörper<br />
durchbohrt werden müsse. Deshalb sei im Sinne des WHG auch in diesem Fall eine zweckgerichtete<br />
Inanspruchnahme des Grundwassers und somit die Anwendung des echten Benutzungstatbestandes<br />
gerechtfertigt. Obwohl auch die Bejahung einer unechten Gewässerbenutzung im Ergebnis<br />
zu einer Erlaubnispflicht führe, sei diese Unterscheidung aber vor allem von Bedeutung, weil nur <strong>der</strong><br />
echte Benutzungstatbestand zur Anwendung des Besorgnisgrundsatzes nach § 48 Abs. 1 WHG führe.<br />
Es erfolgte auch <strong>der</strong> Hinweis, dass bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Erdgas aus großen Tiefen auch Wärme „mit<br />
geför<strong>der</strong>t“ werde und so ein (nachteiliger) Einfluss auf den chemischen Zustand eines Grundwasserkörpers,<br />
z. B. durch Anregung des Wachstums von Mikroorganismen o<strong>der</strong> eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Keimzusammensetzung, ausgeübt werden könne.<br />
Roßnagel argumentierte, dass <strong>der</strong> neu eingeführte Tatbestand des Einbringens vor allem auf die Erdwärmenutzung<br />
abziele. Sinn <strong>der</strong> neuen Regelung sei es gerade, Handlungen zu erfassen, die Stoffe<br />
einbringen, um das Grundwasser zu beeinflussen. Unstrittig werde <strong>der</strong> Tatbestand erfüllt, wenn etwas<br />
in das Wasser eingebracht werden würde, was sich dann auflöse. Bedenken habe er allerdings, wenn<br />
er sich den Tatbestand anschaue und zum Beispiel an Brückenpfeiler im Wasser denke. Diese<br />
würden bei Auslegung des Tatbestandes, wie Reinhardt sie vornehme, diesem unterfallen. Das<br />
Nie<strong>der</strong>bringen von Bohrungen werde aber traditionell nicht als Benutzung im Sinne des WHG<br />
gewertet und würde bei entsprechen<strong>der</strong> Neuauslegung bedeuten, dass die Verwaltungspraxis<br />
entsprechend geän<strong>der</strong>t werden müsste. Auch deshalb werde im Gutachten nicht <strong>der</strong> echte<br />
Benutzungstatbestand vertreten. Auch werde <strong>der</strong> Besorgnisgrundsatz überschätzt, so dass <strong>der</strong><br />
Unterschied zwischen „echter“ und „unechter Benutzung“ im Ergebnis gering sei.<br />
Reinhardt betonte, dass die Verneinung einer echten Benutzung dazu führe, dass <strong>der</strong> Besorgnisgrundsatz<br />
nach WHG nicht angewendet werden müsse. Dieser for<strong>der</strong>e, dass eine Genehmigung nicht<br />
erteilt werden dürfe, wenn zu besorgen sei, dass das Wasser gefährdet würde. Damit liege ein<br />
zwingen<strong>der</strong> gesetzlicher Versagungsgrund vor. Die Nichtanwendung des § 48 Abs. 1 WHG sei nicht<br />
unbedenklich, da bei Anwendung des Besorgnismaßstabes in Bezug auf die Frage, ob eine Maßnahme<br />
erlaubnisfähig sei o<strong>der</strong> nicht, <strong>der</strong> Behörde kein Ermessen zustehe und das Prinzip <strong>der</strong><br />
Verhältnismäßigkeit „operationalisiert“ werden würde. Die Gerichte könnten die Anwendung des<br />
Besorgnisgrundsatzes voll überprüfen. Bei Nichtanwendung des strengen Besorgnismaßstabes sei<br />
genau dies nicht <strong>der</strong> Fall. Die Anwendbarkeit des Besorgnisgrundsatzes sei allerdings auch nicht mit<br />
einem absoluten Verbot von bestimmten Maßnahmen gleichzusetzen. Der Besorgnisgrundsatz müsse<br />
in jedem Fall auf den Einzelfall betrachtet bewertet werden. Kein Gesetzgeber könne einen Wert<br />
festlegen, ab dem eine Genehmigung zwingend zu versagen sei. Insofern behelfe sich <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Diese müssten dann von den Behörden ausgefüllt und<br />
könnten von den Gerichten überprüft werden.<br />
Dass es den Besorgnisgrundsatz nicht im EU-Recht gebe, sei unschädlich, denn <strong>der</strong> AEUV lasse<br />
gerade strengere Regelungen im nationalen Recht zu. Da sich <strong>der</strong> Grundsatz in <strong>der</strong> deutschen Praxis<br />
bewährt habe, habe man diesen auch beibehalten. Er müsse nur für den Einzelfall konkretisiert<br />
werden.<br />
Auf die Frage nach <strong>der</strong> Definition des Abwasserbegriffes nach WHG führte Reinhardt aus, dass durch<br />
Neufassung des WHG jegliches Wasser, das in seinen Eigenschaften – unabhängig davon wie –<br />
verän<strong>der</strong>t wurde, nunmehr als Abwasser angesehen werden könne.<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)<br />
◦ Wie ist die nach UVP-V Bergbau vorgesehene Vorgabe zu bewerten, wonach für die<br />
Gewinnung von Erdgas eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nur vorgesehen ist, wenn<br />
täglich mehr als 500 000 Kubikmeter Erdgas geför<strong>der</strong>t werden sollen?<br />
◦ Wie ist die Durchführung einer einzelnen Bohrung im Unterschied zur Umsetzung von<br />
mehreren Bohrungen, auch im zeitlichen Abstand von nur wenigen Monaten, zu beurteilen?<br />
◦ Warum sieht <strong>der</strong> neutrale Expertenkreis keine obligatorische UVP für die betrachteten<br />
Vorhaben vor?<br />
◦ Hat die Durchführung einer UVP Auswirkungen auf die Anwendbarkeit <strong>der</strong> wasserrechtlichen<br />
Vorgaben, ist insbeson<strong>der</strong>e eine „Aushebelung“ des Wasserrechts zu erwarten?<br />
Entwurf Ergebnisprotokoll AG 7 „<strong>Rechtliche</strong> <strong>Einordnung</strong> <strong>der</strong> <strong>Ergebnisse</strong>“, Seite 3
Roßnagel führte aus, dass sich die nach UVP-V Bergbau festgelegte Vorgabe zur UVP-Pflichtigkeit<br />
bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von mehr als 500 000 Kubikmeter Erdgas pro Tag auf die in einem Betriebsplan<br />
dargestellten Vorhaben beziehe. Im Rahmen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Erdgas aus unkonventionellen<br />
Lagerstätten werde diese Grenze allerdings praktisch nicht überschritten, weshalb diese zur<br />
Bewertung von Fracking-Maßnahmen auch nicht zweckmäßig sei. Seitens <strong>der</strong> Teilnehmer wurden<br />
unterschiedlich Ansichten dazu geäußert, auf was sich die Grenze <strong>der</strong> 500.000 Kubikmeter pro Tag<br />
beziehe. So wurde u. a. vertreten, dass mit <strong>der</strong> Formulierung solche Vorhaben gemeint seien, die in<br />
einem „gesamten Feld“ durchgeführt werden sollen. Dagegen wurde eingewandt, dass <strong>der</strong> Verordnungstext<br />
explizit bezogen auf „Einzelbohrungen“ formuliert sei. Ebenfalls wurde vermutet, da es<br />
keine ähnliche Regelung wie in <strong>der</strong> Bundes-Immissionsschutzverordnung gebe, die auf die objektive<br />
Leistungsmöglichkeit abstelle, För<strong>der</strong>menge künstlich tief gehalten werden könne, um so eine UVP-<br />
Pflicht zu umgehen.<br />
Zur Frage, warum <strong>der</strong> neutrale Expertenkreis keine obligatorische UVP für die betrachteten Vorhaben<br />
vorsehe, beschrieb Roßnagel zunächst grundsätzlich die Aufgabe einer UVP als zusätzliches Verfahren<br />
zur Informationsgewinnung und Wissensgenerierung in einem ohnehin durchzuführenden<br />
Genehmigungsverfahren und stellte klar, dass es sich nicht um ein selbständiges Verfahren handele.<br />
Vielmehr solle eine Behörde für ein durchzuführendes Verfahren Informationen über Umweltauswirkungen<br />
eines Projektes erhalten, die <strong>der</strong> Entscheidungsfindung dienen sollten. Durch die<br />
Verpflichtung, eine UVP durchführen zu müssen, würden jedoch keine weiteren Kriterien in einem<br />
Genehmigungsverfahren zur Anwendung gelangen, die möglicherweise zur Versagung einer<br />
Genehmigung führen könnten. Diese Informationsgewinnung sei in jedem Fall hilfreich und nützlich.<br />
Sie müsse nur nicht zweimal durchgeführt werden. Er for<strong>der</strong>e eine Raumplanung zu dem jeweils zu<br />
erschließenden Feld. Wenn in diesem Verfahren eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt<br />
werde, lägen die allgemeinen Informationen über die Umweltauswirkungen im gesamten Feld<br />
vor. Eine obligatorische UVP für jedes Bohrloch sei dann nicht zweckdienlich, wenn sie zu den<br />
gleichen Informationen führen würde. Daher sei eine UVP im Rahmen eines Betriebsplanzulassungsverfahren<br />
für einen einzelnen Bohrplatz nur notwendig, wenn nach einzelfallbezogener/standortbezogener<br />
Vorprüfung sich Risiken ergäben, die zusätzliche Informationen erfor<strong>der</strong>lich machten.<br />
Ansonsten seien die benötigten Informationen dann bereits erhoben worden und könnten<br />
entsprechend abgefragt werden.<br />
Reinhardt stellt fest, dass die Sinnhaftigkeit <strong>der</strong> im Gesetz vorgegeben 500 000 Kubikmeter Erdgas<br />
nicht aus juristischer Sichtweise diskutiert werden müsste, son<strong>der</strong>n auf politischer Eben zu beurteilen<br />
sei.<br />
Haftung und Regulierung von Schäden<br />
◦ Es wurde gefragt, ob <strong>der</strong> Ansicht zugestimmt werde, dass die Erfassung von Gebäuden im<br />
Vorfeld einer Fracking-Maßnahme im Falle von Schäden zur Verbesserung <strong>der</strong> Beweisführung<br />
beiträgt.<br />
◦ Es erfolgte <strong>der</strong> Hinweis, dass die Bereitstellung von Soforthilfen wünschenswert wäre.<br />
◦ Gilt die Bergschadensvermutung für die Erdgasaufsuchung? Wie ist die Formulierung im<br />
Gesetzestext zu verstehen, dass diese nur den Einwirkungsbereich <strong>der</strong> untertägigen<br />
Aufsuchung o<strong>der</strong> Gewinnung eines Bergbaubetriebes betrifft?<br />
Roßnagel stellte fest, dass es im Rahmen von Bergbauvorhaben grundsätzlich schwierig sei, im Fall<br />
von Schäden den Kausalitätsnachweis zu führen. Zwar könne man die Norm sprachlich nachbessern,<br />
doch bleibe das Grundproblem das gleiche. Es sei grundsätzlich hilfreich, um im Nachgang eines<br />
Schadens den Nachweis eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen Schaden und einer Tätigkeit<br />
zu ermöglichen o<strong>der</strong> zu vereinfachen, den Zustand eines Gebäudes o<strong>der</strong> eines an<strong>der</strong>en Sachverhaltes<br />
vor Umsetzung einer Bergbautätigkeit zu kennen. In den USA sei eine Verschuldensvermutung<br />
dann gegeben, wenn 6 Monate nach Durchführung einer Fracking-Maßnahme und im Umkreis von<br />
„500 feet“ zur Bohrstelle ein Schaden auftrete. Nach Ablauf dieser Frist o<strong>der</strong> in einem größeren<br />
Radius zur Bohrstelle sei diese Vermutung nicht mehr gegeben. Insofern habe man da zwar eine klare<br />
Regelung getroffen. Diese sei jedoch nicht beson<strong>der</strong>s gelungen, denn alles, was erst nach 6 Monaten<br />
erkennbar sei, würde nicht mehr erfasst.<br />
Entwurf Ergebnisprotokoll AG 7 „<strong>Rechtliche</strong> <strong>Einordnung</strong> <strong>der</strong> <strong>Ergebnisse</strong>“, Seite 4
Hinweise eines Teilnehmers:<br />
Die Aussage „Grundsätzlich sei vom Grundwasserbegriff nach WHG jegliches unterirdisches Wasser<br />
in <strong>der</strong> Sättigungszone erfasst, dass in unmittelbarer Berührung mit dem Boden o<strong>der</strong> dem Untergrund<br />
stehe, unabhängig auch von z. B. dem jeweiligen Salzgehalt und <strong>der</strong> Tiefe in <strong>der</strong> es vorkomme.“<br />
provoziert die Nachfrage: Was ist mit Haftwasser und Kristallwasser in <strong>der</strong> Sättigungszone? Ist das<br />
dann auch Grundwasser?<br />
Es wurde angeboten den Solebegriff als Abgrenzung zwischen Wasserrecht und Bergrecht zu nutzen.<br />
Ein Sowohl-als-auch ist im Vollzug nicht hilfreich.<br />
Der Gutachter sollte diesen Gedanken spielen. Was wäre wenn man sagen würde, dass Sole kein<br />
Grundwasser son<strong>der</strong>n nur ein bergfreier Bodenschatz ist? Er wäre dann nach dem Bundesberggesetz<br />
immer noch schützenswert. Wenn <strong>der</strong> Unternehmer in den salinen Aquifer einleiten will, muss er<br />
nachweisen, dass es sich bei <strong>der</strong> dort vorhandenen Flüssigkeit um Sole handelt. Ist es Sole wird keine<br />
wasserrechtliche Erlaubnis benötigt. Der Schutz erfolgt über § 55 Abs. 1 Nr. 4 BBergG „Die Zulassung<br />
eines Betriebsplanes im Sinne des § 52 ist zu erteilen, wenn … 4. keine Beeinträchtigung von<br />
Bodenschätzen, <strong>der</strong>en Schutz im öffentlichen Interesse liegt, eintreten wird, …“<br />
Übrigens wird durch die För<strong>der</strong>ung von Kohlenwasserstoffen in Form von Nassöl und <strong>der</strong> obertägigen<br />
Separierung das Grundwasser von den Kohlenwasserstoffen gereinigt. Das Wasser was wir einleiten<br />
enthält weniger wassergefährdende Stoffe, als das Wasser das wir för<strong>der</strong>n.<br />
Die Physik lehrt: Stünde das salzige Tiefenwasser im Kontakt mit den nutzbaren Grundwasserleitern,<br />
so gäbe es einen Diffusionsausgleich. Die Salzgehalte <strong>der</strong> Wässer würden sich angleichen.<br />
Es mangelt an einem Erlass durch den <strong>der</strong> politisch verantwortliche Kopf <strong>der</strong> Exekutive eine<br />
Abgrenzung von echter und unechter Benutzung vornimmt. Diese Abgrenzung würde mindestens für<br />
die Legislaturperiode gelten.<br />
Entwurf Ergebnisprotokoll AG 7 „<strong>Rechtliche</strong> <strong>Einordnung</strong> <strong>der</strong> <strong>Ergebnisse</strong>“, Seite 5