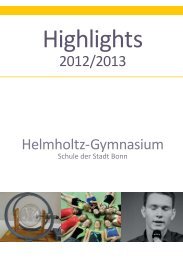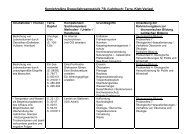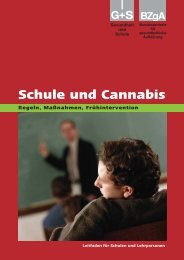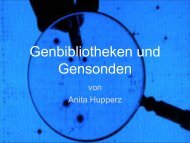Sexuelle Selektion nach Eberle & Fichtel 1.pdf - Helmholtz ...
Sexuelle Selektion nach Eberle & Fichtel 1.pdf - Helmholtz ...
Sexuelle Selektion nach Eberle & Fichtel 1.pdf - Helmholtz ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Sexuelle</strong> <strong>Selektion</strong> und die Evolution von Paarungssystemen bei Primaten <strong>Eberle</strong> & <strong>Fichtel</strong>, PdN-BioS 3/58<br />
Online-Ergänzungen (Ebene(n) von <strong>Selektion</strong>, Komponenten von Sozialsystemen, Literatur)<br />
Komponenten von Sozialsystemen: Soziale Organisation - Soziale Struktur - Paarungssysteme<br />
Soziale Organisation<br />
Solitär. Solitär wird fälschlicherweise oft<br />
gleichgesetzt mit 'nicht sozial', bedeutet aber<br />
nur 'überwiegend nicht assoziiert'. Wenn adulte<br />
Individuen während ihrer Aktivitätsphase nicht<br />
permanent mit Artgenossen assoziiert sind und<br />
ihre Bewegungen nicht direkt mit anderen<br />
koordinieren, werden sie als einzelgängerisch<br />
oder solitär bezeichnet. Die Mehrzahl aller<br />
Tierarten ist solitär, aber nur ca. ein Viertel der<br />
Primatenarten, wobei diese alle bis auf eine<br />
(Orang-Utan, Pongo) zu den Strepsirrhini<br />
gehören und <strong>nach</strong>taktiv sind.<br />
Paarlebend. Die kleinste soziale Einheit bilden<br />
ein adultes Männchen und ein adultes<br />
Weibchen, die ihre Aktivitäten miteinander<br />
koordinieren. Paarlebende Säuger bilden die<br />
Ausnahme. Verhältnismäßig viele dieser Arten<br />
finden sich aus noch nicht befriedigend<br />
erklärten Gründen unter den Lemuren. Es ist<br />
wichtig, zwischen paarlebend und Monogamie<br />
zu unterscheiden, da es bei vielen paarlebenden<br />
Arten regelmäßig zu Kopulationen außerhalb<br />
des Paarverbundes kommt. Aufgrund der<br />
unterschiedlichen potentiellen Reproduktionsraten<br />
der Geschlechter ist Paarleben vor allem<br />
aus Sicht der Männchen erklärungsbedürftig.<br />
Um die Frage <strong>nach</strong> den selektiven Zwängen,<br />
die ein Leben in Paaren begünstigen, zu<br />
beantworten, wurden mehrere Hypothesen<br />
postuliert. Die wichtigste nimmt an, dass<br />
elterliche Fürsorge beider Paarpartner für das<br />
Überleben des Nachwuchses essentiell ist.<br />
Leben in Gruppen. Arten, bei denen drei oder<br />
mehr adulte Individuen permanent assoziiert<br />
sind, werden als gruppenlebend bezeichnet.<br />
Die Größe von Gruppen bei Primaten reicht<br />
von drei Tieren bis zu (stark substrukturierten)<br />
Verbänden von mehreren hundert Individuen.<br />
Die sexuellen Strategien von Männchen und<br />
Weibchen können neben der Gruppengröße<br />
auch einen Einfluss auf die Zusammensetzung<br />
einer Gruppe haben. Die Frage, ob eine Gruppe<br />
ein oder mehrere Männchen enthält, ist von<br />
grundlegender Bedeutung für die Fortpflanzungsstrategien<br />
beider Geschlechter.<br />
Männchen in bisexuellen Gruppen sollten<br />
daran interessiert sein, den Zugang zu<br />
Weibchen mit möglichst wenigen Rivalen<br />
teilen zu müssen. Weibchen können aber ein<br />
Interesse daran haben, mehr Männchen in der<br />
Gruppe zu Auswahl zu haben, als für die<br />
Männchen optimal ist. Die Zusammensetzung<br />
von Primatengruppen ist entsprechend<br />
dynamisch. Das sekundäre Geschlechterverhältnis<br />
vieler Gruppen ist jedoch zu den<br />
Weibchen hin verschoben und Haremsgruppen<br />
mit nur einem Männchen, bei unterschiedlicher<br />
Anzahl von Weibchen, sind nicht selten (Abb.<br />
2). Bei Lemuren findet man, bis dato ebenfalls<br />
aus noch nicht befriedigend erklärten Gründen,<br />
verhältnismäßig viele gruppenlebende Arten<br />
mit einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis,<br />
welches aber nicht notwendigerweise<br />
einhergeht mit einem ausgeglichenen<br />
Fortpflanzungserfolg, trotz fehlendem Sexualdimorphismus<br />
(Lemur-Syndrome, [25]). Bei<br />
manchen Primatenarten, bei denen Männchen<br />
Gruppen von Weibchen monopolisieren,<br />
können sich 'überzählige' Männchen zu<br />
Junggesellen-Gruppen zusammen schließen.<br />
Soziale Struktur<br />
Die sozialen Strukturen der Primatengemeinschaften<br />
sind außerordentlich vielfältig.<br />
Bei solitären Arten gibt es naturgemäß wenig<br />
soziale Interaktionen, die darüber hinaus wenig<br />
untersucht sind (alle bis auf eine Art sind<br />
<strong>nach</strong>taktiv). Während bei paarlebenden Arten<br />
die Interaktionen hauptsächlich auf die<br />
Paarpartner beschränkt sind, kann besonders in<br />
Gruppen eine intensive reziproke Kommunikation<br />
zwischen den Individuen stattfinden und<br />
ihre Mitglieder stehen häufig in Kooperations-<br />
und Dominanzbeziehungen zueinander. Eine<br />
Besonderheit innerhalb der Primaten betrifft<br />
die sozialen Strukturen der Lemuren besonders<br />
im Vergleich zu jenen der haplorrhinen<br />
Primaten. Lemuren zeichnen sich durch<br />
kleinere Gruppen und durch wenig oder<br />
diffusere Dominanzbeziehungen aus. Eine<br />
spezielle Form von mehreren dyadischen<br />
Beziehungen zwischen bestimmten Männchen<br />
und Weibchen innerhalb einer einzigen Gruppe<br />
findet sich bei Rotstirnmakis (Eulemur fulvus<br />
rufus). Bei Lemuren finden sich zudem<br />
Gruppen mit viel mehr Männchen, während es<br />
keine Haremgruppen gibt. Auf der anderen<br />
Seite findet sich eine verhältnismäßig hohe<br />
Aggression unter den Weibchen und Weibchen<br />
dominieren fast durchgehend die Männchen.<br />
4