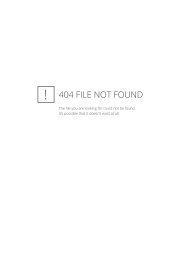Download - CCFW
Download - CCFW
Download - CCFW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung des EGMR im Ergebnis dazu führt,<br />
dass in sog. "Aussage-gegen-Aussage-Fällen" keine Verurteilung erfolgen kann, wenn der<br />
Belastungszeuge nicht bereit ist, auf die Wahrung seiner Anonymität zu verzichten. Diese<br />
Konsequenz erscheint in ihrer Absolutheit fragwürdig und vermag dem Einzelfall unter Umständen<br />
nicht gerecht zu werden. Insbesondere in Konstellationen wie der BGE 133 I 33 zugrunde<br />
liegenden würde der Schluss auf die Unverwertbarkeit der Aussagen des anonymisiert<br />
einvernommenen Belastungszeugen aus meiner Sicht die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege<br />
als Ganzes in Frage stellen, denn bei sich in einem gewaltbereiten Milieu abspielenden Delikten<br />
lassen sich Zeugen kaum dazu bewegen, unter Preisgabe ihrer Identität auszusagen. Würde dies<br />
vom Staat indirekt doch verlangt, indem er die Verwertbarkeit der Aussagen an diese Voraussetzung<br />
knüpft (bzw. vom Vorhandensein weiterer Beweismittel abhängig macht), müsste er sich den<br />
Vorwurf gefallen lassen, den Zeugen leichtfertig einer ernsthaften Lebensgefahr auszusetzen. Selbst<br />
wenn die Aussagen des anonymisierten Zeugen folglich das ausschlaggebende Beweismittel<br />
darstellen, kann das Verfahren m.E. unter Umständen in einen Schuldspruch münden und muss<br />
nicht per se zu einem Freispruch "in dubio pro reo" führen.<br />
Erklärung:<br />
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit resp. die von mir ausgewiesene Leistung<br />
selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Unterstützung der angegebenen Quellen verfasst<br />
resp. erbracht habe.<br />
Nils Stohner<br />
gericht an der Schuld der beschuldigten Person hätte zweifeln müssen. Dabei sind bloss abstrakte und<br />
theoretische Zweifel nicht massgebend, weil solche immer möglich sind und absolute Gewissheit nicht<br />
verlangt werden kann, sondern es muss sich um erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel handeln,<br />
d.h. um solche, die sich nach der objektiven Sachlage aufdrängen. Vgl. hierzu BGE 127 I 38 E. 2a; 124<br />
IV 86 E. 2a; 120 Ia 31 E. 2c, je mit Hinweisen.<br />
31