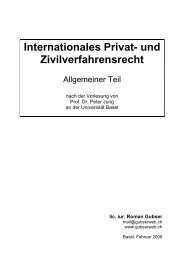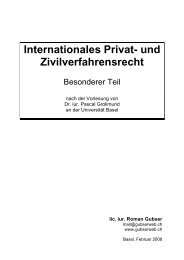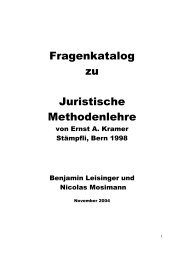1. Der Vorlesung
1. Der Vorlesung
1. Der Vorlesung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
<strong>1.</strong> <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Die Aufgabe der Zwangsvollstreckung<br />
Dazu §§1-3 im Buch<br />
§1 Die Funktion und Natur des Schuldbetreibungsrechts<br />
<strong>1.</strong> Was ist die Funktion des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes?<br />
Es hat die Funktion, dass das Recht auch durchgesetzt wird. Die Erzwingbarkeit erweist sich<br />
als ein wesentliches Merkmal des Rechts. Wo sie fehlt kann von Rechtspflichten im Sinne des<br />
Wortes nicht die Rede sein. Erzwingbar ist in Fällen der Nichtbeachtung meist aber nur die<br />
Pflicht, den durch Nichterfüllung verursachten Schaden in Geld zu ersetzen.<br />
2. Wann ist die Voraussetzung des Zwangsvollzuges gegeben?<br />
Sie ist gegeben, sowohl wenn ein Pflichtiger seine Verbindlichkeiten bestreitet als auch wenn<br />
er gegen ihre Geltendmachung bloss passiven Widerstand leistet.<br />
3. *Wie ist die zwangsweise Verwirklichung möglich?<br />
Sie ist erstens in sehr wenigen Fällen auf dem Wege der Selbsthilfe des Leistungsberechtigten<br />
möglich. OR 52 III (wenn amtliche Hilfe nicht rechtzeitig und sonst der Anspruch vereitelt<br />
oder erheblich erschwert würde); ZGB 926. Sonst ist jedermann auf den staatlichen<br />
Rechtsschutz angewiesen.<br />
4. *Was ist Aufgabe des Zivilprozesses?<br />
Seine Aufgabe ist es im Gerichtsentscheid die Grundlage der Vollstreckung, den<br />
Vollstreckbaren Titel zu schaffen. Insofern dient es der Rechtsverwirklichung.<br />
5. Wie wird die Rechtsverwirklichung selbst durchgesetzt?<br />
Durch die Vollstreckung. Da wird die Erfüllung des urteilsmässig festgestellten Anspruchs<br />
vollzogen.<br />
6. *Was ist Gegenstand des Zivilprozessrechtes im weiteren Sinne?<br />
Das Zivilprozessrecht und die Vollstreckung.<br />
7. Was ist das Zivilprozessrecht im engeren Sinne?<br />
Es befasst sich nur mit dem Verfahren in welchem über den Bestand bestrittener Ansprüche<br />
befunden wird (dem Erkenntnisverfahren), während das das Vollstreckungsrecht das<br />
Verfahren regelt, in welchem die im Zivilprozess als unbestreitbar erklärten Ansprüche<br />
erzwungen werden können.<br />
8. *In welchen Hinsichten unterscheidet sich die schuldbetreibungsrechtliche<br />
Vollstreckung von der zivilprozessualen?<br />
Sie unterscheidet sich von dieser in vierfacher Hinsicht: nach ihrem Gegenstand, ihrem<br />
Verfahren, ihrem Anwendungsbereich sowie nach ihrer Organisation.<br />
- Gegenstand der Schuldbetreibung bildet ausschliesslich die Eintreibung von<br />
Geldforderungen. Ansprüche auf Geldzahlung sind der zivilprozessualen<br />
Vollstreckung entzogen, diese ist auf alle anderen Arten von privatrechtlichen<br />
Leistungen beschränkt. <strong>Der</strong> betreibungsrechtlichen Vollstreckung unterliegt aber nicht<br />
nur die auf Privatrecht beruhenden Geldforderungen sondern auch die<br />
öffentlichrechtlichen.<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger kann mit einem einfachen Begehren direkt an die Vollstreckungsbehörde<br />
gelangen. Im Gegensatz zur zivilprozessualen Vollstreckung, wo ein vollstreckbarer<br />
Gerichtsentscheid vorliegen muss. <strong>Der</strong> Schuldner oder die anderen<br />
1
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Betreibungsgläubiger haben aber die Möglichkeit den Richter anzurufen. Das wahrt das<br />
Interesse des Schuldners hinreichend.<br />
- <strong>Der</strong> Anwendungsbereich des Betreibungsrechts richtet sich auf das ganze Gebiet der<br />
Schweiz. <strong>Der</strong>, der zivilprozessualen Vollstreckung untersteht der kantonalen<br />
Gesetzgebung.<br />
- Die Durchführung der Schuldbetreibung muss einer besonderen Behördenorganisation<br />
anvertraut werden.<br />
9. Zu welchem Bereich des Rechts gehört das SchKG?<br />
Es gehört zum öffentlichen Recht.<br />
10. *Wieso kann das Betreibungsverfahren so strikt und ohne gerichtliche<br />
Einschaltung abgehandelt werden?<br />
Weil es viele Möglichkeiten für den Schuldner gibt, sich zu wehren z.B. Aberkennungsklage<br />
SchKG 83, Rückforderungsklage, wenn der Schuldner eine Nichtschuld bezahlen musste<br />
SchKG 86…<br />
1<strong>1.</strong> Welches sind die Haupttypen betreibungsrechtlicher Zwangsvollstreckung?<br />
- <strong>Der</strong> Konkurs. Da wird das gesamte Vermögen des Schuldners zur Vollstreckung<br />
herangezogen, um aus dem Erlös alle bekannten Gläubiger im Rahmen des Möglichen<br />
gleichzeitig und gleichmässig zu befriedigen. Es werden alle Schuldverhältnisse<br />
zwischen einem Schuldner und seinen Gläubigern um das ganze Schuldnervermögen<br />
liquidiert. Es handelt sich um eine Generalexekution.<br />
- Die Spezialexekution. Da wird die Vollstreckung darauf beschränkt, nur den Anspruch<br />
eines einzigen oder einzelner Gläubiger aus dem Verwertungserlös einzelner, besonders<br />
bezeichneter Vermögensstücke des Schuldners zu befriedigen. Die zur Verwertung<br />
gelangenden Vermögensgegenstände werden entweder von der Vollstreckungsbehörde<br />
im amtlichen Pfändungsverfahren oder vorher schon durch private Bestellung eines<br />
Pfandes, sei es durch den Schuldner selbst oder durch einen Dritten, bestimmt. Diese<br />
beiden Vollstreckungsarten, die sog. Pfändungs- und die Pfandverwertungsbetreibung,<br />
bezeichnet man als Spezialexekutionen.<br />
§2 Geschichtlicher Rückblick auf das schweizerische Schuldbetreibungsrecht<br />
§3 Rechtsquellen des Schuldbetreibungsrechts<br />
12. *Welches sind die Rechtsquellen des Schuldbetreibungsrechts?<br />
- BV Art. 122 Kompetenznorm/die in der BV enthaltenen verfassungsmässigen Rechte<br />
beanspruchen Geltung.<br />
- Bundesgesetze:<br />
o SchKG<br />
o ZGB<br />
o OR<br />
o IPRG<br />
o Privat- und Sozialversicherungsrecht<br />
o Bankenrecht (BankG)<br />
- Eidgenössische Vollziehungserlasse<br />
o BGer Oberaufsicht Art. 15 SchKG<br />
o BRat zuständig für die Aufstellung des Gebührentarifs Art. 16 SchKG<br />
2
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
∟Sie erfüllen ihre Aufgaben vor allem durch den Erlass von allgemein<br />
verbindlichen Verordnungen sowie von Kreisschreiben an die kantonalen<br />
Aufsichtsbehörden.<br />
Bsp. VZG, VVAG, KOV<br />
- Kantonale Gesetze.<br />
(Sie haben z.B. die Zahl und die Grösse der Betreibungs- und Konkurskreise sowie die<br />
Organisation der Behörden und der Hilfsorgane festzulegen. Sie müssen eine<br />
beschleunigtes und ein summarisches Gerichtsverfahren vorsehen und regeln (SchKG<br />
25). Andere Bereiche gesetzlich zu ordnen ist den Kantonen frei gestellt. Die in<br />
Ausführung des SchKG erlassenen kantonalen Gesetze und Verordnungen unterliegen<br />
der Genehmigung des Bundesrates; diese Genehmigung ist Gültigkeitserfordernis<br />
SchKG 29<br />
- Konkordat<br />
- Staatsverträge<br />
- Gewohnheitsrecht<br />
13. Welche Vollstreckungsbestimmungen gehen im internationalen Verhältnis vor?<br />
Es gehen dort die Vollstreckungsbestimmungen von Staatsverträgen und bei deren Fehlen die<br />
des IPRG dem SchKG vor SchKG 30a. Dank dieser Regel werden Normenkonflikte<br />
vermieden.<br />
14. *Kann sich die Betreibungsbehörde einer Betreibung widersetzen, wenn diese<br />
absurd erscheint?<br />
Nein, nur in Ausnahmefällen, in denen es auf der Hand liegt, dass der Betreibende seine<br />
Möglichkeiten zu Zwecken missbraucht, die nicht das mindeste mit den Einrichtungen des<br />
Vollstreckungsrechts zu tun haben, namentlich in Fällen reiner Schikane oder mit dem Ziel<br />
der Kreditschädigung.<br />
2. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Die Organe des Betreibungs- und Konkurswesens<br />
<strong>1.</strong> Kapitel: Organisation des Betreibungs- und Konkurswesens<br />
15. Mit welchen Gegenständen muss sich die Organisation des<br />
Betreibungsverfahrens befassen?<br />
- Die Organe müssen bezeichnet werden, denen die Durchführung von Betreibung und<br />
Konkurs obliegt.<br />
- <strong>Der</strong>en örtliche und sachliche Zuständigkeit muss umschrieben werden<br />
- Die Rechtsstellung der Organe, ihre Unabhängigkeit und ihre Verantwortlichkeit muss<br />
klargelegt werden<br />
- Es bedarf weiter einer Regelung der Aufsicht, insbesondere des Beschwerdeverfahrens<br />
§4 Die Organe, ihre Funktion und Rechtsstellung<br />
16. *Welchen Arten von Organen obliegt die Anwendung des<br />
Schuldbetreibungsrechtes?<br />
- den Betreibungs- und Konkursämtern<br />
- den Aufsichtebehörden<br />
- Gerichten<br />
- Hilfsorganen<br />
- Atypischen Organen<br />
3
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
17. Was ist Sache der Kantone?<br />
Die Organisation der Behörden, die Bestimmung ihres Amtssitzes, ihrer Besetzung sowie der<br />
Amtssprache.<br />
18. *Wer hat die Oberste Aufsicht über das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen?<br />
Das Bundesgericht Art. 15 SchKG.<br />
19. Was für einen Charakter hat das SchKG?<br />
Es hat den Charakter eines Rahmengesetzes, da es eine Reihe für die kantonalen Gesetzgeber<br />
verbindliche Organisationsbestimmungen enthält (SchKG 2, 5ff, 23-25).<br />
20. Was muss gegeben sein, damit die von den Kantonen in Ausführung des SchKG<br />
erlassenen Gesetze gültig sind?<br />
Sie müssen vom BRat genehmigt werden SchKG 29.<br />
2<strong>1.</strong> Welche Organe bilden die Grundlage der Organisation des Betreibungswesens?<br />
Die Betreibungs- und Konkurskreise. Sie ergeben die territoriale Gliederung der zuständigen<br />
Betreibungs- und Konkursämter. Nach SchKG 1 umfasst das Gebiet jedes Kantons einen oder<br />
mehrere Kreise.<br />
22. Welches sind die Aufgaben des Betreibungsamtes?<br />
- die Schuldbetreibung durchzuführen<br />
- die Spezialexekution zu vollziehen<br />
- Zahlungen für Rechnungen des betreibenden Gläubigers entgegenzunehmen SchKG 12.<br />
23. Wie ist das Betreibungsamt organisiert?<br />
Es ist teils bundes-, teils kantonalrechtlich festgelegt (SchKG 2):<br />
- In jedem Kreis besteht ein Betreibungsamt, das von einem Betreibungsbeamten geleitet<br />
wird. Dieser ist für die Geschäftsführung verantwortlich. Dem Betreibungsbeamten ist<br />
ein Stellvertreter beigeordnet, der ihn bei Ausstand oder tatsächlicher Verhinderung<br />
ersetzt SchKG 2 III.<br />
- Im Übrigen sind die Kantone in ihrer Organisation frei SchKG 2 V.<br />
24. Welches sind die Aufgaben des Konkursamtes?<br />
- es führt die vom Gericht eröffneten Konkurse durch, sofern die Gläubiger für die<br />
Durchführung nicht eine besondere ausseramtliche Konkursverwaltung einsetzen.<br />
25. Wie ist das Konkursamt organisiert?<br />
Es ist ähnlich wie das Betreibungsamt organisiert. Jeder Kreis hat sein Amt, das mit dem<br />
Betreibungsamt vereinigt sein kann SchKG 2 II IV. Ihm steht ein Konkursbeamter vor, dem<br />
auch hier vorsorglich ein ständiger Stellvertreter beizustellen ist (SchKG 2 III).<br />
26. *Wie ist die rechtliche Stellung der Beamten?<br />
Alle Betreibungs- und Konkursbeamten sind kantonale Beamte, ausgestattet mit staatlicher<br />
Zwangsgewalt. Sie sind der kantonalen Beamtenorganisation zugehörig und werden vom<br />
Kanton besoldet (z.T. gilt noch das Sportel-System, wo jeder ein % Satz von den<br />
Betreibungen die er durchführt bekommt) SchKG 3.<br />
In ihrer betreibungsrechtlichen Tätigkeit wenden sie aber öffentliches Bundesrecht an. Es ist<br />
ihre Pflicht die Interessen der am Verfahren Beteiligten unparteiisch wahrzunehmen SchKG<br />
95 V und 125 II.<br />
4
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
27. Welche allgemeinen Pflichten haben die Beamten und Angestellten im Zuge der<br />
Verfahrensabwicklung?<br />
Z.B. erlassen des Zahlungsbefehles SchKG 69,<br />
Vollzug der Pfändung SchKG 89<br />
Verwertung von beweglichen Sachen und Gegenständen SchKG 122<br />
28. *Welche weiteren Pflichten müssen die Beamten und Angestellten bei ihrer<br />
Amtstätigkeit beachten?<br />
Positive Pflichten:<br />
- Pflicht zur Protokoll und Registerführung Art. 8 I SchKG. Rechtlich stellen sie<br />
öffentliche Urkunden dar. Es kommt ihnen vorrangige Beweiskraft zu (Inhalt gilt als<br />
richtig solange nicht das Gegenteil bewiesen wird (SchKG 8 II und ZGB 9)<br />
- Einsichtsrechte und Auskunftspflichten SchKG 8a I<br />
- Pflicht zur Zahlungsentgegennahme und zur Verwahrung SchKG 12. Ämter müssen<br />
Geld, Wertsachen usw. wenn über sie nicht binnen 3 Tagen verfügt wird bei der<br />
kantonalen Depositenstelle hinterlegen SchKG 9<br />
Negative Pflichten (Zwecks Missbrauchsverhütung der Amtsmacht, Gewährleistung der<br />
Unparteilichkeit →Übertretung kann die Haftung des Staates zur Folge haben SchKG 5ff):<br />
- Ausstandspflicht SchKG 10 (Ausstandsgründe im Gesetz sind abschliessend)<br />
Stellvertreter muss für Beamten handeln und Gläubiger müssen davon benachrichtigt<br />
werden SchKG 10 II.<br />
- Verbot des Selbstkontrahierens SchKG 11 Rechtsfolge bei Verstoss: Nichtigkeit<br />
29. Was fällt unter den in Art. 8a SchKG benützten Begriff „glaubhaft machen“?<br />
Glaubhaft ist das Interesse, wenn es auf Grund ernsthafter Indizien wahrscheinlich gemacht<br />
wird. Blosse Neugier genügt nicht. Schutzwürdig ist nur ein rechtserhebliches Interesse.<br />
30. Wer ist zur Einsicht in die Protokolle und Register der Betreibungs- und<br />
Konkursämter berechtigt?<br />
- die Betreibungsparteien<br />
- ausgewiesene Gläubiger, welche die eingetragene Person noch nicht betrieben haben<br />
- potentielle Gläubiger (solche, die mit der eingetragenen Person erst gerade<br />
Verhandlungen aufgenommen haben)<br />
- Bürgen und Prozessgegner des Schuldners<br />
- Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben<br />
3<strong>1.</strong> Wann dürfen selbst die berechtigten Personen nicht alle Einträge einsehen?<br />
Wenn sonst einer Person im Gesellschafts- oder Geschäftsleben ungerechtfertigte Nachteile<br />
erwachsen können (Gründe des Datenschutzes).<br />
32. *Über welche Punkte darf das Betreibungsamt keine Auskünfte erteilen?<br />
SchKG 8a III.<br />
- nichtige Betreibungen<br />
- Betreibungen, die auf Grund einer Beschwerde oder eines Urteils aufgehoben worden<br />
sind<br />
- Betreibungen, wo der Schuldner mit einer Rückforderungsklage obsiegt hat<br />
- Betreibungen, die der Gläubiger zurückgezogen hat<br />
- ! Irrtümliche Betreibungen (nicht im Gesetz erwähnt)<br />
- Erträge über Verfahren, die weiter als 5 Jahre zurück liegen (Gerichte… können diese<br />
Auszüge weiter verlangen SchKG Art. 8a IV<br />
5
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
33. Welches Rechtsmittel braucht man, wenn das Betreibungs- oder Konkursamt<br />
einem die Einsicht verweigert?<br />
Die betreibungsrechtliche Beschwerde SchKG Art. 17 selbst bei schon abgeschlossenem<br />
Verfahren.<br />
34. Welches Rechtsmittel braucht man bei unrichtiger oder unzulässiger Auskunft<br />
des Betr.- oder Konkursamt<br />
Da stellt sich die Frage der Staatshaftung SchKG 5.<br />
35. Was passiert mit den Amtshandlungen, wenn ein Beamter die Ausstandspflicht<br />
verletzt?<br />
Die Amtshandlungen sind nicht ohne weiteres ungültig, sondern bloss mit Beschwerde<br />
anfechtbar. Die Aufsichtsbehörde kann sie aber in krassen Fällen von Amtes wegen aufheben.<br />
Ein kann. Entscheid über ein Ausstandsbegehren kann nur mit StBE an das BGer<br />
weitergezogen werden.<br />
36. Wer sorgt für Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Verfahrensabwicklung?<br />
Die Aufsichtsbehörden<br />
37. *Müssen Aufsichtsbehörden gewählt werden?<br />
Ja, von Bundesrechtswegen Art. 13 SchKG die Kantone können auch für einen oder mehrere<br />
Kreise noch untere Aufsichtsbehörden bestellen. Sie müssen nicht unbedingt eigene Behörden<br />
für die Aufsicht schaffen, sie können auch schon bestehende Gerichts oder<br />
Verwaltungsbehörden mit dieser Aufgabe betrauen.<br />
38. *Wem steht die Oberaufsicht über das Betreibungswesen zu?<br />
Dem BGer Art. 15 I SchKG.<br />
39. *Welches sind die Obliegenheiten der kantonalen Aufsichtsbehörde?<br />
- allgemeine Überwachung der Ämter unter dem Gesichtspunkt der gesetzmässigen<br />
Verwaltung SchKG 13 I<br />
- Erlass von Weisungen und Kreisschreiben<br />
- Inspektionsweise jährliche Prüfung der Geschäftsführung SchKG 14 I<br />
- Ausübung der Disziplinarbefugnisse SchKG 14 II<br />
- Entscheidung von Beschwerden SchKG 17<br />
- Aufhebung nichtiger Verfügungen von Amtes wegen SchKG 22<br />
- Erstattung eines Jahresberichts an das BGer SchKG 15 III<br />
40. Welche Aufgaben obliegen dem BGer?<br />
gleichmässige Anwendung des Gesetzes SchKG 15 I (beinhaltet SchKG II-IV, SchKG 19<br />
ist oberste Beschwerdeinstanz)<br />
4<strong>1.</strong> *Wann können Gerichtsbehörden im Betreibungsverfahren mitwirken?<br />
Wenn dies das Gesetz ausdrücklich vorsieht SchKG 17 I.<br />
42. *Welche Streitigkeiten sind von den Gerichten im Verlauf des<br />
Vollstreckungsverfahrens oder im Zusammenhang mit demselben zu Regeln?<br />
- materiellrechtliche Streitigkeiten<br />
- rein betreibungs- oder formellrechtliche Streitigkeiten von besonderer Bedeutung<br />
- die formell betreibungsrechtlichen Streitigkeiten, die das materielle Recht berühren<br />
(sog. Betreibungsrechtliche Streitigkeiten mit Reflexwirkung)<br />
6
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
43. *Um was geht es bei den rein materiellrechtlichen Streitigkeiten/Bsp.?<br />
Da geht es vor allem die Feststellung des materiellen Rechts als Grundlage gerechtfertigter<br />
Vollstreckung oder zum Zwecke der Korrektur einer bereits durchgeführten,<br />
ungerechtfertigten Vollstreckung. Das Urteil, das darin ergeht hat volle materielle Rechtskraft<br />
und nicht nur Wirkung für die hängige Betreibung, die den Prozess veranlasst hat.<br />
Bsp.<br />
- Art. 79 SchKG: Wenn ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben<br />
wurde die Betreibung fortsetzen will, Klage auf Feststellung und Leistung der<br />
Forderung<br />
- Art. 86 SchKG: <strong>Der</strong>, der Infolge einer Nichtschuld bezahlt hat, kann auf dem<br />
Prozessweg beweisen, dass dies so ist und so die Leitung rückgängig machen<br />
- Art. 279 SchKG: Arrestprosequierungsklage des Gläubigers zur Aufrechterhaltung des<br />
Arrestbeschlages<br />
44. *Wie ist die örtliche Zuständigkeit der Gerichte bei materiellrechtlichen<br />
Streitigkeiten?<br />
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den Bet. Des GestG, soweit das SchKG nicht<br />
ausdrücklich etwas anderes vorsieht. Im euro-internationalen Verhältnis sind bei diesen<br />
Klagen die besonderen Gerichtsstände des LugÜ zu beachten; sie gehen dem GestG und dem<br />
SchKG vor.<br />
45. *Um was geht es bei den rein betreibungsrechtlichen Streitigkeiten bei denen ein<br />
Gericht zuständig ist/Bsp.?<br />
Ist streitig ob die Zwangsvollstreckung an sich zulässig und deshalb fortzusetzen ist, steht nur<br />
eine rein verfahrensrechtliche Frage zur Beurteilung. Normalerweisen entscheiden dies sonst<br />
die Aufsichtsbehörden im Beschwerdenverfahren.<br />
Bsp. <strong>Der</strong> Beurteilung durch Gerichte:<br />
- Art. 181 SchKG Rechtsvorschlag des Gläubigers wird dem Gericht vorgelegt das<br />
Gericht entscheidet ob es den Rechtsvorschlag bewilligt<br />
46. *Wie ist die örtliche Zuständigkeit der Gerichte bei rein betreibungsrechtlichen<br />
Streitigkeiten?<br />
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich rein nach den Bestimmungen des SchKG, da rein<br />
betreibungsrechtliche Streitigkeiten keine Zivilsachen i.S. v. GestG 1 I sind.<br />
47. *Um was geht es bei den betreibungsrechtlichen Streitigkeiten mit<br />
Reflexwirkung/Bsp.?<br />
Hier ist grundsätzlich nur eine formelle, verfahrensrechtliche Frage zu entscheiden. Doch<br />
muss dabei auf materielles Recht zurückgegriffen werden, also Vorfrageweise materielles<br />
Recht angewendet werden. Zudem wirkt sich die Entscheidung über die formelle Frage unter<br />
Umständen auch auf das materielle Recht aus. Die Reflexwirkung beschränkt sich aber auf<br />
die Durchführung der hängigen Betreibung. Das Urteil wirkt nur in dieser Betreibung.<br />
Bsp.<br />
- SchKG 242: Eine Sache wird gepfändet, die von einem Dritten beansprucht wird. 242 II<br />
SchKG: das Konkursamt glaubt dem Dritten nicht →er kann zum Gericht gehen<br />
<strong>1.</strong> die Sache zu Verwerten ist eine betreibungsrechtliche Frage<br />
2. Ob der Schuldiger oder der Dritte Eigentümer ist, ist eine materiellrechtliche Frage<br />
- Kollokationsplan: Schuldenruf, 244 SchKG Schuldner bestätigt jede eingegangene<br />
Forderung einzeln, 245 SchKG Konkursverwaltung entscheidet über die Anerkennung<br />
der Forderung. 246 SchKG Forderungen des GB werden aufgenommen, 247 SchKG<br />
7
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Kollokationsplan (da werden auch die abgewiesenen Forderungen aufgeführt 248<br />
SchKG), 249 SchKG Auflage des Plans, 250 SchKG Kollokationsklage: ein Gläubiger,<br />
der mit Kollokationsplan nicht zu frieden ist muss zum Richter.<br />
<strong>1.</strong> bertreibungsrechtliche Frage: Kollokationsplan<br />
2. Besteht die Forderung wie der Gläubiger sie eingegeben hat? Materiellrechtliche<br />
Frage. Davon hängt ab ob der Kollokationsplan geändert wird oder nicht.<br />
48. *Wie ist die örtliche Zuständigkeit der Gerichte bei betreibungsrechtlichen<br />
Streitigkeiten mit Reflexwirkung?<br />
Da sie nach h.L. als Zivilsachen gelten richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach GestG,<br />
soweit das SchKG nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht.<br />
49. *Wieso ist es wichtig zu wissen ob ein Gericht eine materiellrechtliche oder eine<br />
betreibungsrechtliche Entscheidung macht?<br />
Um zu wissen ob man die Streitigkeit bis ans BGer ziehen kann. Laut OG muss es sich dafür<br />
um Zivilrechtsmaterie handeln. Betreibungsrechtliche Streitigkeiten gehören nicht zur<br />
Zivilrechtsmaterie. Bei ihnen endet der Instanzenzug beim oberen kantonalen Gericht. Die<br />
Reflexklagen gelten nach h.L. als Zivilsachen und können daher auch ans BGer weiter<br />
gezogen werden.<br />
50. Wo ist die Zuständigkeit des BGer in Prozessen geregelt?<br />
In SchKG 7 und im OG. Nach OG kann das BGer v.a. durch Berufung OG 43 ff (nur<br />
mat.rechtliche und betr.rechtliche mit Reflexwirkung), mit Nichtigkeitsbeschwerde OG 68 ff.<br />
ff (nur mat.rechtliche und betr.rechtliche mit Reflexwirkung und wenn der Streitwert zu<br />
wenig hoch ist für eine Berufung ist) oder mit StBE BV 189 I und OG 84 ff (auch für rein<br />
betreibungsrechtliche Sachen) oder mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde OG 97 ff.<br />
angerufen werden. Ausnahmsweise ist auch der direkte Prozess zulässig OG 41 ff.<br />
5<strong>1.</strong> Wie sieht die Gerichtsorganisation der Kantone aus für Sachen, die aus dem<br />
Betreibungsrechtlichen Verfahren an ein Gericht gezogen werden?<br />
Die Organisation der in Schuldbetreibungssachen zuständigen Gerichte ist fast ganz den<br />
Kantonen überlassen SchKG 23. Mit drei Ausnahmen regeln die Kantone auch die<br />
funktionelle Zuständigkeit; nur für den Konkursentscheid, für die Bewilligung des<br />
Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung und für den Einspracheentscheid im<br />
Arrestverfahren schreibt das Bundesgesetz selbst die Weiterziehungsmöglichkeit an eine<br />
obere Instanz vor (SchKG 174, 185, 278).<br />
52. *Welche Verfahrensarten kommen in Betreibungssachen zur Anwendung?<br />
Beide Verfahrensarten, die die Zivilprozessordnung regelmässig zur Verfügung stellt: das<br />
Ordentliche und das summarische Verfahren. Ausserdem verlangt das SchKG für bestimmte<br />
Streitigkeiten ein beschleunigtes Verfahren, das sich aber vom ordentlichen nur durch<br />
raschere Abwicklung unterscheidet.<br />
53. *Wo kommt das ordentliche Verfahren zur Anwendung?<br />
Es kommt überall da zur Anwendung, wo das SchKG nicht das beschleunigte oder das<br />
summarische Verfahren vorschreibt. Wegleitend für dieses Verfahren sind ausschliesslich die<br />
kantonalen Zivilprozessordnungen.<br />
8
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
54. *Wie ist das beschleunigte Verfahren von den Kantonen auszugestalten/Bsp. <strong>Der</strong><br />
Anwendung?<br />
Es ist so zu gestalten, dass es die beiden in SchKG 25 I Ziff. 1 aufgestellten<br />
Mindestanforderungen erfüllt.<br />
Es ist z.B. für die materiellrechtliche Feststellungsklage nach SchKG 85a erforderlich oder für<br />
die Kollokationsklage…<br />
55. *Wie ist das summarische Verfahren von den Kantonen auszugestalten?<br />
Sie sind in dieser Ausgestaltung bei Einhaltung der verfassungsrechtlichen<br />
Rahmenbestimmungen völlig frei. Es unterscheidet sich sowohl vom ordentlichen wie vom<br />
beschleunigten Verfahren.<br />
Seine charakteristischen Merkmale sind:<br />
- rasche Durchführung, oft nur mündlich<br />
- Beschränkung der Einwendungen zur Verteidigung<br />
- Beschränkung des Beweises<br />
Die Anwendungsfälle sind in SchKG 25 Ziff. 2 aufgezählt.<br />
56. *Wo ist eine Klage einzureichen?<br />
Beim Richter am Konkursort (das Gerichtsverfahren geht immer nach kantonaler ZPO)<br />
57. *Welche Hilfsorgane gibt es?<br />
- die von den Kantonen gestützt auf SchKG 24 zu bestellenden Depositenanstalten für die<br />
Aufbewahrung von Geld…<br />
- Grundbuchämter, insoweit sie die vollzogenen Pfändungen und andere<br />
Verfügungsbeschränkungen im Grundbuch vor- oder anzumerken haben z.B. SchKG<br />
101<br />
- Handelsregisterämter z.B. SchKG 39 III<br />
- Polizei z.B. SchKG 91 II<br />
58. *Welches sind die Atypischen Organe?<br />
- Gläubigerversammlung im Konkurs<br />
- Ein von den Gläubigern gewählter Gläubigerausschuss<br />
- Die von den Gläubigern gewählte ausseramtliche Konkursverwaltung<br />
- Sachwalter im Nachlasstundungsverfahren<br />
- Liquidatoren beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung<br />
§5 Das Verantwortlichkeitsrecht (nicht in der <strong>Vorlesung</strong>sdisposition)<br />
59. Was ist der Zweck des Verantwortlichkeitsrechts?<br />
Es bietet dem Bürger Schutz vor rechtswidrigem Verhalten der Vollstreckungsorgane bei der<br />
Ausübung ihrer öffentlichen Funktionen. Es ergänzt in dieser Zielsetzung das<br />
Beschwerderecht.<br />
60. Welche Arten von Verantwortlichkeit müssen unterschieden werden?<br />
Die disziplinarische (SchKG 14 II, es sind Ordnungsstrafen bei Dienstpflichtverletzungen, nur<br />
mit StBE ans BGer, betreibungsrechtl. Beschwerde 19 I SchKG ist ausgeschlossen), die<br />
strafrechtliche und die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit (äussert sich in der<br />
bundesrechtlich vorgesehenen Haftung des Staates SchKG 5-7 (*direkte Staatshaftung).<br />
6<strong>1.</strong> *Welches sind die Voraussetzungen einer Staatshaftung nach SchKG 5?<br />
- Widerrechtlichkeit<br />
9
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Schaden<br />
- Adäquate Kausalität<br />
- Ein Organ muss Schädiger sein (Aufzählung in SchKG 5 I)<br />
- Funktionaler Zusammenhang zwischen Schaden und Erfüllung der amtlichen Aufgaben<br />
(sonst nur Belangung des Schädigers nach OR 41 möglich)<br />
- Erfüllung der Schadensminderungspflicht des Geschädigten d.h.die Haftung des Staates<br />
ist subsidiär zur Selbsthilfe auf dem Beschwerdeweg, als Schadenersatz nur gefordert<br />
werden kann, wenn der Schaden nicht durch rechtzeitige Beschwerde hätte abgewendet<br />
werden können<br />
Verschulden ist nicht erforderlich somit ist die Haftung kausal.<br />
<strong>Der</strong> Fehlbare hat gegenüber diem Geschädigten keinen Anspruch (Exklusivität der<br />
Staatshaftung SchKG 5 II). Rückgriffmöglichkeiten des Kantons auf den Schädiger regelt das<br />
kantonale Recht SchKG III.<br />
Verjährung SchKG 6 I: Relativ: in 1 Jahr von dem Tag an, wo der Geschädigte von<br />
der Schädigung Kenntnis erhalten hat<br />
Absolut: nach Ablauf von 10 Jahren nach Schadenseintritt<br />
3. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Die betreibungsrechtliche Beschwerde<br />
§6 *Die betreibungsrechtliche Beschwerde<br />
62. Was ist der Sinn der betreibungsrechtlichen Beschwerde?<br />
Ein rechtmässiges Verfahren zu haben. Sie bietet die Möglichkeit eine verfahrensrechtliche<br />
Korrektur zu erlangen. Sie ist das Instrument, mit welchem die Aufsichtsbehörden (SchKG<br />
13) ihre Überwachungsaufgabe erst richtig erfüllen können. Sie müssen entweder bei<br />
gesetzeswidriger oder unangemessener Tätigkeit von Amtes wegen einschreiten (SchKG 22)<br />
oder aufgrund einer Beschwerde eines Betroffenen (SchKG 21).<br />
63. Kann die Beschwerde auch nur auf Feststellung eines unrechtmässigen<br />
Zustandes gerichtet sein?<br />
Nein, die Beschwerde muss immer einen praktischen Zweck verfolgen. Weil es darum geht,<br />
eine verfahrensrechtliche Korrektur zu erwirken, muss ein Zurückkommen auf die Sache<br />
überhaupt noch möglich sein; das setzt voraus, dass das Verfahren noch in Gang ist.<br />
64. Wie ist die Rechtsnatur der betreibungsrechtlichen Beschwerde?<br />
Sie ist ein der Verwaltungsbeschwerde nachgebildeter Rechtsbehelf. Das zeigt sich darin,<br />
- dass die von der Aufsichtsinstanz beurteilt wird, die dem betreffenden<br />
Vollstreckungsorgan übergeordnet ist<br />
- dass ihr Gegenstand auf Handlungen der Vollstreckungsorgane begrenzt ist; im<br />
Beschwerdeverfahren wird nur über deren Verfahrenstätigkeit entschieden, nicht über<br />
materiellrechtliche Fragen (materiellrechtliche Fragen sind nur ausnahmsweise im<br />
Beschwerdenverfahren zu prüfen, wenn ihre Beurteilung Vorfrage der zu<br />
entscheidenden betreibungsrechtlichen Streitfrage ist).<br />
65. Was kann Beschwerdegegenstand einer betreibungsrechtlichen Beschwerde sein?<br />
Mit der Betreibungsrechtlichen Beschwerde können funktionsgemäss nur Verfügungen oder<br />
Unterlassungen (SchKG 18 II, 19 II) der Vollstreckungsorgane angefochten werden: konkrete<br />
auf den Verfahrensgang einwirkende Massnahmen (SchKG 17 I). (Nicht anfechtbar ist z.B.<br />
die Amtstätigkeit als solche, Meinungs- oder Absichtsäusserungen eines<br />
Vollstreckungsorgans, die im Verfahrensablauf getroffenen Zwischenentscheide, die<br />
10
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Erteilung oder Verweigerung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde,<br />
rechtsgeschäftliche Handlungen)<br />
66. Was ist Ermessensmissbrauch?<br />
Es liegt vor, wenn die im Rechtssatz umschriebenen Voraussetzungen und Grenzen des<br />
Ermessens zwar beachtet worden sind, aber das Ermessen unter unmassgeblichen<br />
Gesichtspunkten, insbesondere willkürlich und rechtsungleich betätigt wird.<br />
Ermessensmissbrauch stellt eine Rechtsverletzung dar.<br />
67. Was ist Ermessensüberschreitung?<br />
Das liegt vor, wenn das Ermessen in einem Bereich ausgeübt wird, in dem der Rechtsschutz<br />
kein Ermessen eingeräumt hat. Dies ist der Fall, wenn der Rechtssatz gar keine<br />
Ermessensbetätigung gestattet, aber auch, wenn die Behörde eine Massnahme trifft, die der<br />
Rechtssatz nicht zur Wahl stellt. Die Ermessensüberschreitung ist eine Rechtsverletzung.<br />
68. Was sind die Beschwerdegründe?<br />
SchKG 17 I (<strong>Der</strong> Beschwerdeführer muss auf jeden Fall einen Verfahrensfehler geltend<br />
machen).<br />
- Gesetzesverletzung: (Bsp. SchKG 92)<br />
Verletzung von Bundesrecht<br />
- des Verfassungsrechts, der EMRK…(vor BGer nur mit StBE)<br />
- der Normen des SchKG und seiner Ausführungsverordnungen<br />
- Bestimmungen anderer Bundesgesetze und Verordnungen<br />
- Bestimmunen von Staatsverträgen<br />
- ungeschriebenes Recht<br />
- Als Verletzung von Bundesrecht gilt auch die unvollständige oder<br />
unrichtige Feststellung des Sachverhalts soweit sie auf Missachtung der<br />
Untersuchungsmaxime beruht.<br />
Verletzung von kantonalem Recht<br />
Vor dem BGer nur mit StBE<br />
- Unangemessenheit: (Bsp. SchKG 93)<br />
Unangemessen ist eine Verfügung, wenn die den gegebenen<br />
Verhältnissen nicht angemessen ist. Die Frage der Angemessenheit<br />
kann sich nur stellen, wo überhaupt eine Verfügung nach freiem<br />
Ermessen gestaltet werden darf. (Ist Ermessen im Gesetz nicht<br />
vorgesehen und auch der Sache nach ausgeschlossen, liegt bei einer<br />
fehlerhaften Verfügung eine Rechtsverletzung vor; als solche gilt auch<br />
das Überschreiten des Rahmens freier Ermessensbefugnis, der<br />
Missbrauch des Ermessens SchKG 19 I.)<br />
- Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (SchKG 17 III)<br />
Dieser Beschwerdegrund liegt vor, wenn eine gesetzlich<br />
vorgeschriebene Amtshandlung überhaupt nicht oder nicht binnen<br />
gesetzlicher oder angemessener Frist vorgenommen wird.<br />
(kann ans BGer weitergezogen werden?)<br />
69. Welche praktische Relevanz hat die Unterscheidung ob eine Fehlhandlung der<br />
Behörde unangemessen, die Ermessungsbefugnis überschreitend oder<br />
ermessensmissbräuchlich ist?<br />
Reine Ermessensfehler können grundsätzlich mit der Betreibungsbeschwerden nicht vor<br />
Bundesgericht gebracht werden (104 OG, wohl aber Ermessensmissbrauch als Rechtsverstoss<br />
(SchKG 19 I)<br />
11
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
70. Wer kann bei einer betreibungsrechtlichen Beschwerde Beschwerdeführer sein?<br />
Hier geht es um die formelle Legitimation zum Verfahren und nicht wie im Zivilprozess um<br />
die materielle Legitimation zur Sache. Legitimiert ist, wer durch eine Verfügung eines<br />
Vollstreckungsorgans (oder wegen Unterlassung einer solchen) in seinem rechtlich<br />
geschützten oder tatsächlichen Interesse betroffen, dadurch beschwert ist und deshalb ein<br />
schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der Verfügung hat (Beschwer).<br />
Legitimiert sind daher z.B. der Schuldner (gleichgültig ob er privatrechtlicher oder<br />
öffentlichrechtlicher Natur ist), allfällige Mitbetriebene, die Gläubiger, die am<br />
Vollstreckungsverfahren beteiligt sind, legitimiert sind auch Dritte, deren Interessen durch<br />
eine Amtshandlung verletzt werden (z.B. Eigentümer gepfändeter Sachen…)<br />
7<strong>1.</strong> Wer kann Beschwerdegegner sein?<br />
Beschwerdegegner ist immer das Vollstreckungsorgan, das die angefochtene Verfügung<br />
getroffen hat oder von dem sie erwartet wird.<br />
72. Was ist die Requisition<br />
Wenn das die Betreibung führende Amt um Rechtshilfe des für die Vornahme der<br />
Handlungen zuständigen Amtes nachsucht SchKG 4. Dem ist so, wenn in einem<br />
Betreibungsverfahren Amtshandlungen in einem anderen Betreibungskreis vorgenommen<br />
werden müssen. Z.B. die Pfändung von Sachen, die sich dort befinden.<br />
73. Wer ist in Fällen der Requisition Beschwerdegegner?<br />
Das requirierende Amt ist Beschwerdegegner, wenn die Anordnungen der Pfändung oder der<br />
Versteigerung angefochten wird. Dagegen ist die Beschwerde gegen das requirierte Amt zu<br />
richten, wenn die Art und Weise, wie die angefochtene Verfügung ausgeführt worden ist,<br />
beanstandet wird.<br />
74. Wie lange ist die Beschwerdefrist?<br />
- Bei Rüge der Gesetzwidrigkeit oder Unangemessenheit ist das Beschwerderecht<br />
regelmässig auf 10 Tage befristet SchKG 17 II, ausnahmsweise nur 5, nämlich bei der<br />
Wechselbetreibung SchKG 20 sowie im Konkurs gegen Beschlüsse der ersten<br />
Gläubigerversammlung SchKG 230. Die Frist läuft vom Tage an dem der<br />
Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat. Die Aufsichtsbehörden<br />
müssen von Amtes wegen feststellen ob sie eingehalten worden ist. Sie tragen die<br />
Beweislast für die Behauptung die Beschwerde sei ihnen nicht rechtzeitig zugegangen.<br />
(Wahrung der Frist schKG 32 f)<br />
- Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt<br />
werden SchKG 18 III.<br />
- Als unbefristet werden Beschwerden bezeichnet, durch welche die Aufsichtsbehörde auf<br />
Gesetzesverletzungen aufmerksam gemacht wird, wo sie eigentlich schon von Amtes<br />
wegen hätte eingreifen sollen SchKG 22 (bei Verstoss gegen zwingendes Recht) BGer<br />
greift aber ni von Amtes wegen ein, sondern nur die kantonale Behörde. <strong>Der</strong>lei<br />
Verfügungen sind ex tunc nichtig. (Es braucht nur die Nichtigkeit festgestellt zu werden,<br />
die Verfügung muss nicht einmal formell aufgehoben werden).<br />
75. Wer hat bei der betreibungsrechtlichen Beschwerde die<br />
Entscheidungskompetenz?<br />
Die Aufsichtsbehörde SchKG 17 I. Welche Aufsichtsbehörde zuständig ist entscheidet sich<br />
nach dem Beschwerdegegner, dem Beschwerdegrund, dem Verfügungsort sowie der Funktion<br />
12
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
der Aufsichtsbehörde. Die Zuständigkeitsordnung beruht auf Bundesrecht sowie, wo zwei<br />
kantonale Aufsichtsbehörden bestehen (SchKG 13 II) auch auf kantonalem Recht.<br />
- erstinstanzlich sachliche Zuständigkeit<br />
Die Aufsichtsbehörden aller Stufen können erstinstanzlich zum Entscheid über eine<br />
Beschwerde berufen sein. Ihre sachliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem<br />
Beschwerdegrund. Bei Gesetzes- oder Ermessensverletzungen, Rechtsverweigerung<br />
oder Rechtsverzögerung durch ein Vollstreckungsorgan ist erstinstanzlich immer eine<br />
kantonale Aufsichtsbehörde zuständig SchKG 17 I. Bei Rechtsverweigerung oder<br />
Rechtsverzögerung durch eine untere kantonale Aufsichtsbehörde ist die obere<br />
(SchKG 18 II), bei einer solchen durch die obere oder einzige kantonale<br />
Aufsichtsbehörde das BGer erstinstanzlich zuständig SchKG 19 II.<br />
- die örtliche Zuständigkeit<br />
Von mehreren auf gleicher Stufe zuständigen Aufsichtsbehörden hat diejenige zu<br />
entscheiden, in deren Kreis die anfechtbare Verfügung getroffen wurde oder hätte<br />
getroffen werden sollen.<br />
- Die funktionelle Zuständigkeit<br />
Sie regelt den Instanzenzug. Hat ein Kanton eine obere und ein untere<br />
Aufsichtsbehörde SchKG 13 II, so kann er die Zuständigkeit innerhalb des Kantons<br />
selbst regeln. Es muss einfach von der unteren an die obere weiter gezogen werden<br />
(SchKG 18 I)Ans BGer kann nur der Entscheid einer oberen oder einer einzigen<br />
kantonalen Aufsichtsbehörde SchKG 19 I.<br />
76. Was ist weitere Prozessvoraussetzung für die Beschwerde?<br />
Partei- (=Rechtsfähigkeit ZGB 11) und Beschwerdefähigkeit (Handlungsfähigkeit ZGB 13).<br />
! ZGB 19 II.<br />
77. **Wie ist das Beschwerdeverfahren geregelt?<br />
In Art. 20a SchKG. Weitgehend ist die Regelung den Kantonen überlassen SchKG 20a III.<br />
Bundesrechtlich gelten aber 20a I/II und einige in der Rechtsprechung entwickelte<br />
Grundsätze.<br />
- Form und Inhalt der Beschwerde<br />
Form bestimmen die Kantone, bei verbesserlichen Fehlern ist aber von Bundesrechtswegen<br />
die Möglichkeit der Verbesserung gegeben (SchKG 32 IV)<br />
An den Inhalt der Beschwerden →Bundessrechtliche Anforderungen:<br />
Angabe des Beschwerdeführers welche Änderung des angefochtenen Entscheids er beantragt,<br />
sowie ausführen welche Rechtssätze verletzt sein sollen und aus welchem Grund<br />
- Behandlung der Beschwerde<br />
Nach kantonalem Recht ausser das was:<br />
- SchKG 20a II bestimmt:<br />
- Verfahren kann schriftlich oder mündl. sein Ziff. 3<br />
- Sachverhalt von Amtes wegen abgeklärt Ziff. 2<br />
- Mitwirkungsverpflichtung der Parteien Ziff. 2<br />
- Freie Beweiswürdigung Ziff. 3<br />
- Bindung an Parteibegehren Ziff. 3 ausser Fälle von SchKG 22<br />
- Beschwerdeentscheid ist zu begründen, schriftl. zu eröffnen und mit<br />
Rechtsmittelbelehrungen zu versehen Ziff. 4<br />
- In ? die Parteien sind berechtigt mitzuwirken<br />
- SchKG 17 IV<br />
- Dem Beschwerdegegner ist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben<br />
- SchKG 20 a I<br />
- Verfahren kostenlos<br />
13
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Frist zur Erledigung der Beschwerde gibt es grundsätzlich keine aber es gibt<br />
2 Ausnahmen:<br />
<strong>1.</strong> In der Wechselbetreibung Durchführung in 5 Tagen SchKG 20<br />
2.Beschwerde gegen Beschlüsse der ersten Gläubigerversammlung<br />
Verfahren innert kurzer Zeit SchKG 239 II.<br />
- Wirkung der Beschwerde<br />
- Devolutiveffekt<br />
- Keine Suspensivwirkung<br />
- Beschwerdeentscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde<br />
- Entweder tritt sie auf die Beschwerde gar nicht erst ein, sie weist sie ab oder sie heisst<br />
sie gut.<br />
78. Was ist der Devolutiveffekt?<br />
Das heisst, dass vom Augenblick an, in dem die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde<br />
eingereicht ist, sich der Streitfall grundsätzlich in deren Zuständigkeit befindet. Dieser Effekt<br />
wird aber modifiziert: Solange die Beschwerdefrist nach läuft oder das Vollstreckungsorgan<br />
zu einer eingelegten Beschwerde noch keine Vernehmlassung erstattet hat, darf es seine<br />
Verfügung in Widererwägung ziehen (Selbstberichtigungsrecht SchKG 17 IV)<br />
79. Was ist der Suspensiveffekt?<br />
Die formelle Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit der angefochtenen Verfügung sind nicht<br />
aufgehoben. D.h. z.B., dass trotz Beschwerde ein Gegenstand verpfändet werden kann.<br />
Suspensivwirkung kommt der Beschwerde nur auf besondere Anordnung der<br />
Aufsichtsbehörde oder ihres Präsidenten zu SchKG 36. Die Aufschiebende Wirkung kann auf<br />
Antrag oder von Amtes wegen gewährt werden.<br />
80. Welche Beschwerdeentscheide können die kantonalen Aufsichtsbehörden<br />
machen/Wirkungen dieser?<br />
8<strong>1.</strong> Nichteintretensentscheid:<br />
Wo es an einer Verfahrensvoraussetzung mangelt (z.B. versäumte Beschwerdefrist).<br />
Damit bleibt die angefochtene Verfügung rechtskräftig und wird endgültig<br />
vollstreckbar ausser sie wäre nichtig<br />
- Eintritt auf die Beschwerde:<br />
o Entweder Abweisung: wenn Beschwerde unbegründet, selbe Wirkung wie<br />
Nichteintreten<br />
o Gutheissung<br />
82. Welche Möglichkeiten hat die Aufsichtsbehörde bei einer Gutheissung der<br />
Beschwerde<br />
- Sie kann die angefochtene Verfügung aufheben (z.B. zurückweisen) oder selbst<br />
berichtigen (Kassation oder Reformation)<br />
- Wo unbegründethermassen eine Amtshandlung verweigert oder verzögert wurde, wird<br />
sie den Vollzug anordnen<br />
Die Aufhebung einer Verfügung wirkt immer ex tunc, eine Berichtigung ex nunc und im Falle<br />
einer Rückweisung wird das Verfahren zurückgewälzt.<br />
83. Wie wird der Beschwerdeentscheid weiter gezogen/welche Grundsätze gelten<br />
hier?<br />
- <strong>Der</strong> Beschwerdeentscheid einer unteren kantonalen Aufsichtsbehörde kann an die obere<br />
kantonale Aufsichtsbehörde weiter gezogen werden SchKG 18 I. (Frist zur<br />
Weiterziehug SchKG 18 I/Zur Weiterziehung legitimiert ist, wer durch den Entscheid<br />
14
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
beschwert ist/auch das Weiterziehungsverfahren wird durch kantonales Recht geregelt,<br />
soweit nicht das Bundesrecht eingreift, es gelten die gleichen Grundsätze wie im<br />
erstinstanzlichen Verfahren SchKG 20a aber Weiterziehung immer schriftlich SchKG<br />
32/inwieweit neue Tatsachen und Beweise (nova) hervorgebracht werden dürfen<br />
entscheidet das kantonale Recht)<br />
- Die Beschwerde ans Bundesgericht (Verfahren in SchKG 19 und in OG 76 ff.)<br />
84. Welche Beschwerdeentscheide sind vor Bundesgericht anfechtbar?<br />
Nur rechtswidrige Entscheide einer oberen oder der einzigen kantonalen Aufsichtsbehörde<br />
(SchKG 19, OG 76 ff). Die Rechtsverletzung muss eine Verletzung von Bundesrecht sein.<br />
Die in einem Beschwerdeverfahren getroffenen Zwischenentscheide einer kantonalen<br />
Aufsichtsbehörde sind auch vor Bundesgericht nicht anfechtbar (wird durch den<br />
Zwischenentscheid ein verfassungsmässiges Recht verletzt ist aber die StBE möglich).<br />
85. Wer ist zur Beschwerde beim Bundesgericht Legitimiert…welche<br />
Voraussetzungen müssen beachtet werden?<br />
Hinsichtlich Legitimation, der Beschwerdefrist SchKG 19 I und 20 und der Kosten SchKG<br />
20a gilt das gleiche wie für die Weiterziehung an die kantonale Behörde.<br />
- alles weitere ist in OG z5 ff geregelt<br />
- ausser das BGer hat seiner Entscheidung die Sachverhaltsfeststellung der kantonalen<br />
Aufsichtsbehörde zugrunde zu legen nur wenn da eine Verletzung legt, kann es den<br />
Sachverhalt neu überprüfen./Das Bger ist auch an die Parteibegehren gebunden<br />
Vorbehalten bleibt die Aufhebung eines Entscheides wegen Nichtigkeit.<br />
- <strong>Der</strong> Beschwerdeentscheid des BGer kann auch auf Nichteintreten, Abweisung oder<br />
Gutheissung lauten<br />
86. Wie ist das Verhältnis der Beschwerde zur gerichtlichen Klage?<br />
Beschwerdeverfahren und Zivilprozess sind streng auseinander zu halten. SchKG 17 I sagt<br />
ausdrücklich, dass nur dort Beschwerde geführt werden kann, wo das Gesetz nicht den Weg<br />
der gerichtlichen Klage vorschreibt. Die gerichtliche Klage schliesst also die Beschwerde aus.<br />
87. Wie ist das Verhältnis der betreibungsrechtlichen zur staatsrechtlichen<br />
Beschwerde?<br />
Das Bundesgericht überprüft im betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren die richtige<br />
Anwendung des Bundesrechts – einschliesslich der Staatsverträge, aber ohne das<br />
Verfassungsrecht – durch die kantonalen Instanzen; gegen Verletzung der Verfassung ist die<br />
StBE ausdrücklich vorbehalten. Die StBE ist grundsätzlich zur betreibungsrechtlichen<br />
Beschwerde subsidiär hinsichtlich Verfassungsverletzungen aber primär.<br />
4. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Das Einleitungsverfahren: Zahlungsbefehl und Rechtsvorschlag<br />
2. Kapitel: Gegenstand, Parteien und Arten der Betreibung<br />
§7 <strong>Der</strong> Betreibungsgegenstand (in der <strong>Vorlesung</strong> fast nicht behandelt)<br />
88. Was will man wissen, wenn man nach dem Betreibungsgegenstand fragt?<br />
Welche Ansprüche im Verfahren der Schuldbetreibung vollstreckt werden können.<br />
89. Was kann Betreibungsgegenstand der Schuldbetreibung sein?<br />
Alle Ansprüche auf Geld, sei es auf Zahlung oder auch bloss auf Sicherheitsleistung in Geld<br />
SchKG 38 I. Es spielt keine Rolle ob die Geldforderung öffentlichrechtlicher oder<br />
15
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
privatrechtlicher Natur ist, ob sie bestritten oder unbestritten, zuweilen nicht einmal ob sie<br />
fällig oder nicht fällig ist (Konkurs bewirkt Fälligkeit aller Forderungen gegen den Schuldner<br />
der Arrest wenigstens unter gewissen Voraussetzungen SchKG 208 I, 271 II). Das BGer<br />
anerkennt seit neustem auch dass Sicherheitsleistungen, die nicht auf Geld lauten nach SchKG<br />
vollstreckt werden können.<br />
90. Was ist unter Ansprüchen auf Geldleistung zu Verstehen?<br />
Darunter sind nur Forderungen auf Zahlung in Schweizerwährung zu verstehen. Auf eine<br />
ausländische Währung lautende Forderung kann auf dem Betreibungswege nur geltend<br />
gemacht werden, wenn sie in Schweizer Währung umgerechnet sind SchKG 67 I Ziff. 3.<br />
9<strong>1.</strong> Kann eine Forderung, die im Konkurs in eine Geldforderung umgewandelt<br />
wurde Betrieben werden?<br />
Nein Art 211 SchKG.<br />
92. Wann Betreibt ein Gläubiger dem Schuldner auf Sicherheitsleistung?<br />
Wenn ein Gläubiger die Erfüllung einer Verpflichtung durch den Schuldner sicherstellen will.<br />
Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung kann gesetzlich begründet sein, auf einem richterlichen<br />
Entscheid der auf einem Vertrag beruhen.<br />
93. Was ist Ziel der Betreibung auf Sicherheit?<br />
Grundsätzlich die Leistung der beanspruchten Sicherheit in Geld. Andersartige Sicherheit z.B.<br />
die Bestellung eines Pfandes kann aber ebenfalls auf dem Betreibungsweg erzwungen<br />
werden. Die Sicherheit wird bei der kantonalen Depositenanstalt hinterlegt SchKG 9.<br />
94. Wie Verläuft das Verfahren auf Betreibung auf Sicherheit?<br />
Es Verläuft gleich wie dasjenige auf Geldzahlung. Es kommt aber nur die Spezialexekution in<br />
Frage (Betreibung auf Pfändung) auch gegenüber einem konkursfähigen Schuldner SchKG 43<br />
I Ziff. 3. <strong>Der</strong> einzige Unterschied zur Betreibung auf Zahlung besteht darin, dass die vom<br />
Schuldner geleistete Sicherheit dem Gläubiger nicht ausgezahlt oder übergeben sondern nur<br />
für ihn hinterlegt werden darf.<br />
Leistet der Schuldner die geschuldete Sicherheit so erlischt die Betreibung Art. 12 II SchKG.<br />
Stellt er Sicherheit auf andere Weise als der Überweisung ans Betreibungsamt so erlicht die<br />
Betreibung erst, wenn der Gläubiger diese Sicherheit annimmt und die Betreibung<br />
zurückzieht. Tut er das nicht kann der Schuldner ans Gericht wo der Richter über das<br />
Genügen der anderweitigen Sicherheit entscheidet 85 SchKG.<br />
95. Für welche Geldforderung existieren Sonderbestimmungen, die sie entweder dem<br />
Schuldbetreibungsrecht entziehen oder bei denen die Betreibung nach SchKG<br />
nur modifiziert anwendbar ist?<br />
- SchKG 30 I: falls eine besondere eidgenössische oder kantonale Vorschrift besteht, gilt<br />
das SchKG nicht für die Zwangsvollstreckung gegen Kantone, Bezirke und Gemeinden<br />
- SchKG 30 II: behält ausserdem weitere bundesrechtliche Sondererlasse vor<br />
o BG über die Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahnen und<br />
Schifffahrtsunternehmungen<br />
o Die besonderen insolvenzrechtlichen Bestimmungen des BankG<br />
- SchKG 44: die Verwertung von Gegenständen, welche auf Grund strafrechtlicher oder<br />
fiskalischer Gesetze mit Beschlag belegt sind, geschieht nach den zutreffenden<br />
eidgenössischen oder kantonalen Gesetzesbestimmungen.<br />
- SchKG 45 Forderungen der Pfandleihanstalten sind nach den Bestimmungen in ZGB<br />
910 ff geltend zu machen.<br />
16
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Das Völkerrecht kann die Zwangsvollstreckung durch Immunität beschränken oder<br />
verbieten. SchKG 30a Vorrang des Völkerrechts. Ob die Forderung vollstreckbar ist<br />
kommt darauf an, ob sie privatrechtlicher oder hoheitlicher Natur ist, ist sie<br />
privatrechtlicher Natur, kann sie vollstreckt werden. Bei der Vollstreckung gegen einen<br />
fremden Staat sind auf jeden Fall besondere Unpfändbarkeiten zu beachten sie sind im<br />
Kreisschreiben des EJPD zusammengefasst. SchKG 92 Z 11 erklärt weiter<br />
Vermögenswerte eines ausländischen Staaten oder einer ausländischen Zentralbank, die<br />
hoheitlichen Zwecken dienen für unpfändbar.<br />
96. Unterliegen die schweizerische Eidgenossenschaft und ihre öffentlichrechtlichen<br />
Anstalten der Zwangsvollstreckung nach SchKG?<br />
Ja, aber gegen sie kann nur die Spezialexekution ins Finanzvermögen in Frage kommen.<br />
§8 Die Betreibungsparteien (Fast nie in der <strong>Vorlesung</strong> erwähnt)<br />
97. Welches sind die Betreibungsparteien?<br />
<strong>Der</strong>, der einen Anspruch auf Geldzahlung (oder Sicherheitsleistung) geltend macht und<br />
derjenige, gegen den der Anspruch erhoben wird.<br />
98. Was Versteht das SchKG unter den von ihm benützten Begriffe „Schuldner“ und<br />
„Gläubiger“?<br />
Unter Gläubiger versteht das Gesetz auch Personen, die bloss behaupten Gläubiger zu sein<br />
und unter Schuldner auch solche, die von diesen als solche bezeichnet werden.<br />
99. Was sind wesentliche Voraussetzungen jeder Vollstreckung die die Parteien<br />
erfüllen müssen?<br />
Dass die Parteien Parteifähig und Betreibungsfähig sind. Das muss von Amtes wegen beachtet<br />
werden, auch vom Bundesgericht.<br />
100. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit jemand Parteifähig<br />
ist/Ausnahmen?<br />
Die Parteifähigkeit entspricht der Rechtsfähigkeit; diese bestimmt sich nach dem Zivilrecht<br />
(OR; ZGB) oder dem öffentlichen Recht (Staats- und Verwaltungsrecht). Wer danach<br />
Rechtsfähig ist, ist stets auch Parteifähig. Gilt für den Schuldner und den Gläubiger.<br />
- In bestimmten vom Gesetz vorgesehenen Fällen muss eine Partei nicht Parteifähig<br />
(Rechtsfähig)sein:<br />
o Eine unverteilte Erbschaft für die Betreibung gemäss SchKG 49 bzw. 59<br />
o Die Konkursmasse SchKG 240 oder die Nachlassmasse beim<br />
Liquidationsvergleich SchKG 319 IV<br />
o Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer<br />
o Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft<br />
10<strong>1.</strong> Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit jemand betreibungsfähig ist?<br />
Voraussetzung für die Betreibungs- oder Verfahrensfähigkeit ist Handlungsfähigkeit. Wo sie<br />
fehlt muss die betroffene Partei gesetzlich vertreten sein. Die Betreibungsfähigkeit wird<br />
vermutet solange keine Indizien dagegen sprechen.<br />
Bei der Bestimmung der passiven Betreibungsfähigkeit sind aber besondere<br />
Schutzbestimmungen zu beachten SchKG 68 c- 68d. <strong>Der</strong> Schuldner kann nur dann allein<br />
Betrieben werden, wenn er voll handlungsfähig ist. Die aktive und die passive<br />
Betreibungsfähigkeit decken sich somit nicht immer.<br />
17
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
102. Betreibt der Gläubiger den Schuldner immer selber?<br />
Nein, es gibt folgende Möglichkeiten:<br />
- Selbständige Betreibung:<br />
Selbständige Geltendmachung eines Anspruchs. Das können alle voll handlungsfähigen,<br />
natürlichen Personen. Juristische Personen sowie Kollektiv- und Kommanditgesellschafter<br />
handeln durch ihre gesetzlichen oder statutarischen Organe bzw. Vertreter. Massgeblich<br />
für das Vertretungsverhältnis ist die Aussage des Handelsregisters<br />
- Gesetzliche Vertretung:<br />
Für die natürlichen Personen, die handlungsunfähig sind. Die handlungsunfähige Person<br />
bleibt aber Partei. Unter besonderen Voraussetzungen können aber auch<br />
handlungsunfähige als Gläubiger selbständig betreiben (z.B. bevormundete Personen, die<br />
urteilsfähig, und zur Ausübung eines Berufes oder eines eigenen Gewerbes ermächtigt<br />
sind, Minderjährige hinsichtlich ihres Selbstverwalteten freien Kindesvermögens)<br />
- Vertragliche Vertretung:<br />
Kantone können die gewerbsmässige Vertretung regeln SchKG 27. Jeder<br />
betreibungsfähige Gläubiger kann sich nach eigener Wahl vertreten lassen (SchKG 27 und<br />
67 I Ziff. 1). Die Kosten dieser Vertretung können aber nicht auf den Schuldner abgewälzt<br />
werden SchKG 27 III.<br />
103. Wieso empfiehlt es sich für einen Gläubiger im Ausland einen Vertreter in der<br />
Schweiz zu bestellen?<br />
Weil sonst die für ihn bestimmten Betreibungsurkunden und Mitteilungen auf dem Amt und<br />
die ihm zufallenden Geldbeträge bei der Depositenanstalt hinterlegt werden SchKG 67 I Ziff.<br />
1, 272 II. Das gilt auch im Konkursverfahren SchKG 232 II Ziff. 6.<br />
104. Wem ist bei gesetzlicher Vertretung die Betreibungsurkunde zuzustellen?<br />
- beim handlungsunfähigen Schuldner wird die Betreibungsurkunde ausschliesslich dem<br />
gesetzlichen Vertreter zugestellt SchKG 68c.<br />
- Urteilsfähigen Minderjährigen und Entmündigten die bezügl. Ihres freien Vermögens<br />
handeln muss eine Betreibungsurkunde zugestellt werden, wie auch ihren gesetzlichen<br />
Vertretern.<br />
- Steht Schuldner unter Verwaltungsbeiratschaft ist der Beirat mit zu betreiben, wenn der<br />
Gläubiger auch aus der Vermögenssubstanz Befriedigung sucht SchKG 68c III.<br />
- Schuldner unter Mitwirkungsbeiratschft kann immer alleine betrieben werden ZGB 395<br />
I.<br />
- Ist der Schuldner verbeiständet muss der Beistand immer mit betrieben werden SchKG<br />
68 I Ziffer 2.<br />
105. Was kann ohne eigentlichen Schuldner durchgeführt werden?<br />
Die konkursamtliche Liquidation der ausgeschlagenen oder überschuldeten Verlassenschaft<br />
SchKG 193.<br />
106. Was ist ein Mitbetriebener/Bsp.?<br />
Einer, der ausser dem Schuldner betrieben wird, weil er in der Betreibung unter Umständen<br />
eigene Rechte wahrzunehmen hat. Er ist aber weder vormundschaftliches Organ, noch<br />
gesetzlicher Vertreter des Schuldners, noch schuldet er persönlich etwas. Er kann im<br />
Gegensatz zu den gesetzlichen Vertretern aus eigenem Recht Rechtsvorschlag erheben, wie<br />
der Schuldner.<br />
Mitbetriebener ist:<br />
- der Dritteigentümer eines Pfandes in der Pfandverwertungsbetreibung SchKG 153 II<br />
- der in Gütergemeinschaft mit dem Schuldner lebenden Ehegatten SchKG 68a<br />
18
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- der Ehegatten in der Betreibung auf Pfandverwertung eines Grundstücks, das als<br />
Familienwohnung dient SchKG 153 II.<br />
§9 Die Betreibungsarten *<br />
*Welche Betreibungsarten stellt das Gesetz zur Verfügung?<br />
- Die Spezialexekution:<br />
Hauptart: Pfändungsbetreibung<br />
Sonderart: Pfandverwertungsbetreibung<br />
- Die Generalexekution:<br />
Hauptart: Konkursbetreibung<br />
Sonderart: Wechselbetreibung<br />
107. *Wie bestimmt sich ob die ordentliche Spezial- oder Generalexekution<br />
durchzuführen ist, wie, ob allenfalls eine Sonderart der Betreibungen in Frage<br />
kommt?<br />
Im Grossen und Ganzen bestimmt sich nach der Person des Schuldners ob die Betreibung<br />
auf dem Wege der ordentlichen Spezial- oder Generalexekution durchzuführen ist (SchKG<br />
39 ff), nach der Art der Forderung dagegen, welche Sonderart der Betreibung allenfalls<br />
in Frag kommt.<br />
108. *Wann kommt die Konkursbetreibung zum Zuge?<br />
- „Handelsregistereintrag“<br />
Wer in einer der in SchKG 39 I abschliessend genannten Eigenschaften im Handelsregister<br />
eingetragen ist, gilt als konkursfähig und unterliegt deshalb der Konkursbetreibung. Sie<br />
unterliegen für sämtliche Schulden der Konkursbetreibung, auch für die nicht aus dem<br />
Geschäftsbetriebherrührenden (ausgenommen Forderungsarten von SchKG 43). <strong>Der</strong><br />
Handelsregistereintrag ist unter Vorbehalt von SchKG 40 I für die Konkursfähigkeit<br />
konstitutiv.<br />
- materieller Konkursgrund<br />
da können auch die nicht konkursfähigen Personen in Konkurs geraten<br />
SchKG 190-194<br />
109. Wann beginnt die Konkursfähigkeit<br />
Sie beginnt in allen Fällen erst am Tage nach der Veröffentlichung der Eintragung im<br />
schweizerischen Handelsamtsblatt und dauert noch während 6 Monaten seit der<br />
Veröffentlichung ihrer Streichung an SchKG 39 III und 40 I.<br />
110. *Wann ist die Konkursbetreibung trotz Konkursfähigkeit des Schuldners<br />
ausgeschlossen?<br />
Für die in SchKG 43 abschliessend aufgezählten Forderungsarten. Man kann in diesen Fällen<br />
aber auf Pfändung oder Pfandverwertung betreiben.<br />
11<strong>1.</strong> *Wer unterliegt der Betreibung auf Pfändung?<br />
Die nicht in einer Eigenschaft gemäss SchKG 39 I im Handelsregister eingetragenen Personen<br />
unterliegen grundsätzlich der Betreibung auf Pfändung SchKG 42 I.<br />
112. *Wann kommt die Betreibung auf Pfandverwertung zum Zuge/Ausnahme?<br />
Ohne Rücksicht darauf ob der Schuldner konkursfähig ist oder der Pfändungsbetreibung<br />
unterliegt, sind pfandgesicherte Forderungen grundsätzlich durch Betreibung auf<br />
Pfandverwertung geltend zu machen.<br />
19
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Ausnahme bildet SchKG 41 II: Da wird dem Gläubiger die Wahl gelassen, ob er für<br />
grundpfandgesicherte Zinsen oder Annuitäten wirklich die Pfandverwertung geltend machen<br />
will oder ob je nach Person des Schuldners nicht die Betreibung auf Konkurs oder die<br />
Betreibung auf Pfändung stattfinden soll. (Dieser Absatz kommt immer dann zur Anwendung,<br />
wenn das Pfand viel mehr Wert hat als die Schuld).<br />
113. Welches Rechtsmittel muss man anwenden, wenn man zwar die Voraussetzungen<br />
der Konkursbetreibung erfüllen würde, aber wegen etwas betrieben wird, für<br />
welches nach Art. 43 SchKG die Konkursbetreibung ausgeschlossen ist?<br />
Man muss wegen Gesetzesverletzung eine Beschwerde nach SchKG 17 machen.<br />
114. Wem obliegt die Bestimmung der Betreibungsart?<br />
Sie obliegt im Allgemeinen dem Betreibungsamt SchKG 38 III.<br />
115. In welchen Fällen kann der Gläubiger bestimmen, welche Betreibungsart zur<br />
Anwendung kommen soll?<br />
- bei der Eintreibung grundpfändlich gesicherter Zinsen und Annuitäten SchKG 41 II<br />
- bei der Eintreibung einer pfand- oder ungesicherten Wechsel- oder Checkforderung<br />
gegenüber einem konkursfähigen Schuldner SchKG 41 II.<br />
- gegenüber einem nicht konkursfähigen Schuldner, der die Voraussetzungen von SchKG<br />
190 I Ziff. 1 und 3 zur Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung erfüllt.<br />
116. Wo werden Streitigkeiten über die anzuwendende Betreibungsart entschieden?<br />
Im Beschwerdeverfahren SchKG 17 ff. Weil die Durchführung der richtigen Betreibungsart<br />
oft sogar im öffentlichen Interesse liegt, können die Aufsichtsbehörden gegebenenfalls auch<br />
von Amtes wegen einschreiten und die Nichtigkeit der falschen Betreibung feststellen SchKG<br />
22. Kein Interesse Dritter oder gar der Öffentlichkeit wird berührt, wen sich der Schuldner<br />
einer pfandgesicherten Forderung auf eine andere Betreibungsart als jene auf<br />
Pfandverwertung einlässt.<br />
117. Was muss ein Schuldner machen, bei dem der Gläubiger ein anderes Verfahren<br />
als das Pfandverwertungsverfahren wählt, wenn er dies nicht will?<br />
Er muss Beschwerde einlegen SchKG 41 I bis ; SchKG 17.<br />
3. Kapitel Allgemeine Regeln des Betreibungsverfahrens<br />
§10 <strong>Der</strong> Betreibungsort<br />
118. Wofür ist der Betreibungsort massgebend?<br />
Für die örtliche Zuständigkeit des Amtes, welches die Betreibung durchzuführen hat.<br />
119. Nach welchem Gesetz bestimmt sich an welchem Ort eine Betreibung<br />
durchgeführt werden kann/warum?<br />
Ob überhaupt in der Schweiz eine Betreibung durchgeführt werden kann bestimmt sich nach<br />
dem SchKG.<br />
Grund: Garantie für die Parteien für die ordnungsmässige Durchführung des<br />
Vollstreckungsverfahrens; Dritte sollen ihre Interessen zuverlässig wahren können. Deshalb<br />
ist die Bestimmung des konkret in Frage kommenden Betreibungsortes zwingend. <strong>Der</strong><br />
Grundsatz der Einheit des Betreibungsortes stellt die Einheit der Betreibung sicher. Jede<br />
Vereinbarung eines anderen als des gesetzlichen Betreibungsortes ist nichtig (Ausgenommen<br />
Wahl eines Spezialdomizils SchKG 50 II).<br />
20
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
120. Kann der Grundsatz der Einheit der Betreibung durchbrochen werden?<br />
Ja, wenn gleichzeitig die Voraussetzungen verschiedener Betreibungsorte erfüllt sind. (z.B.<br />
wo verschiedenartige Schulden bestehen SchKG 41 II, 51).<br />
12<strong>1.</strong> Wie wird die Einhaltung des Grundsatzes der Einheit des Konkurses garantiert?<br />
Mit der Vorschrift, die besagt, dass der Konkurs stets dort als eröffnet gilt, wo er zuerst<br />
erkannt wirde SchKG 55.<br />
122. Wann kann der Grundsatz der Einheit des Konkurses durchbrochen werden?<br />
Wenn ein Schuldner mit Domizil im Ausland in der Schweiz mehrere eingetragene<br />
Zweigniederlassungen hat, dann kann es ausnahmsweise zu mehreren nebeneinander<br />
laufenden Sonderkonkursen kommen SchKG 50 I.<br />
123. Wieso sieht das Gesetz verschiedene Betreibungsorte vor?<br />
Aus Zweckmässigkeitsgründen.<br />
124. Stellt jeder Betreibungsort einen Konkursort dar?<br />
Nein (einige besondere Betreibungsorte nicht: Spezialdomizil SchKG 50 II; Ort der gelegenen<br />
Pfandsache SchKG 51 und Arrestort SchKG 52). Die Eröffnung und Durchführung des<br />
Konkurses kann stattfinden:<br />
- am ordentlichen Betreibungsort SchKG 46<br />
- nach der Praxis auch am Aufenthaltsort SchKG 48<br />
- über einen flüchtigen Schuldner an dessen Wohnsitz SchKG 54<br />
- über eine Geschäftsniederlassung eines im Ausland domizilierten Schuldners am Ort<br />
derselben SchKG 50 I<br />
- über eine Erbschaft eines konkursfähigen Erblassers an dessen Konkursort SchKG 49,<br />
59<br />
- am Orte des Vermögens im Falle eines sog. Hilfskonkurses nach IPRG<br />
125. Wo Befindet sich der ordentliche Betreibungsort?<br />
Es gilt allgemein: jeder Schuldner kann an seinem schweizerischen Domizil betrieben werden<br />
sofern nicht ein besonderer Betreibungsort in Betracht kommt.<br />
- Bei natürlichen Personen ist der ordentliche Betreibungsort am Wohnsitz des<br />
Schuldners SchKG 46 I. Mit Wohnsitz ist der im Zivilrecht gebrauchte Begriff gemeint<br />
ZGB 23 ff.<br />
o Handlungsfähige natürliche Person Ort wo Absicht des dauernden<br />
Verbleibes besteht/Anders als im ZGB bleibt ein Wohnsitz nicht bestehen, bis<br />
ein anderer gefunden wurde (faktischer Wohnsitz) sondern da gilt nach SchKG<br />
48 der Aufenthaltsort als Betreibungsort/Letzte Wohnsitz spielt nur für<br />
flüchtigen Schuldner eine Rolle SchKG 54.<br />
o Ein Schuldner der im Ausland wohnt hat in der Schweiz keinen ordentlichen<br />
Betreibungsort, er kann nur an einem besonderen Betreibungsort betrieben<br />
werden SchKG 50-54.<br />
o Für Handlungsunfähige Personen befindet sich der Betreibungsort für<br />
unmündige Kinder unter elterlicher Gewalt am Wohnsitz der Eltern ZGB 25 I.<br />
Für Bevormundete Personen am Sitz der Vormundschaftsbehörde ZGB 25 II.<br />
(Dieser ordentliche Betreibungsort gilt auch, wenn es sich um Betreibung auf<br />
Vollstreckung des freien selbstverwalteten Vermögens handelt.)<br />
- Bei im Handelsregister eingetragenen juristische Personen und Gesellschaften ist<br />
der Betreibungsort an ihrem Sitz SchKG 46 II. Wo ein solcher fehlt ist er am Ort, wo die<br />
21
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Geschäfte tatsächlich geführt werden ZGB 56. Mit Rücksicht auf die Einheit des<br />
Betreibungsortes kommt als Betreibungsort nur der Hauptsitz in Betracht.<br />
- Die nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personendes Privatrechts<br />
sind am Hauptsitz ihrer Verwaltung zu betreiben SchKG 46 II. Öffentlichrechtliche<br />
juristische Personen haben ihren Betreibungsort an dem durch das Gesetz bestimmten<br />
Verwaltungssitz.<br />
- Die Gemeinderschaften sind selber nicht parteifähig, infolgedessen können nur die<br />
einzelnen Gemeinder betrieben werden und zwar am Wohnsitz des als gemeinsamer<br />
Vertreter bestimmten Gemeinders. Hat sie keinen Vertreter, kann jeder der Gemeinder<br />
am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden SchKG 46 III<br />
- Bei den Stockwerkeigentümern ist der Ort der gelegenen Sache Betreibungsort SchKG<br />
46 IV<br />
126. Welches sind die besonderen Betreibungsorte?<br />
- <strong>Der</strong> Aufenthaltsort (gilt bei Schuldnern die weder in der Schweiz noch im Ausland<br />
eine festen Wohnsitz haben, sie können am schweizerischen Aufenthaltsort betrieben<br />
werden/ gilt auch für Schuldner, die bisherigen Wohnsitz aufgegeben haben und noch<br />
kein neuen begründet haben). Zufällige Anwesenheit genügt nicht um eine<br />
Aufenthaltsort zu begründen.<br />
- Die Geschäftsniederlassung gilt nie als Betreibungsort für einen Schuldner, der in der<br />
Schweiz sein Domizil hat. Nur ein Schuldner mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland kann<br />
am Ort seiner schweizerischen Geschäftsniederlassung betrieben werden SchKG 50 I.<br />
- Das Spezialdomizil SchKG 50 II. Ein im Ausland wohnender Schuldner der zur<br />
Erfüllung einer Verbindlichkeit ein Spezialdomizil gewählt hat kann für diese<br />
Verbindlichkeit an diesem Ort betrieben werden. Das gilt in der Praxis auch bei Fehlen<br />
eines festen Wohnsitzes. Ob der Betreibungsort wirklich begründet wurde ist nach dem<br />
ausdrücklichen oder dich aus den Umständen ergebenden Parteiwillen zu beurteilen.<br />
Das gewählte Spezialdomizil braucht nicht mit dem Erfüllungsort überein zustimmen.<br />
Da das Spezialdomizil nur der Vollstreckung einer bestimmten Forderung dient, ist da<br />
weder Anschlusspfändung noch Konkurseröffnung zulässig.<br />
- <strong>Der</strong> Arrestort SchKG 52 Forderungen für die ein Arrest gelegt ist, können auch dort<br />
eingetrieben werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet. Hat der Schuldner den<br />
Wohnsitz in der Schweiz, kann ihn der Gläubiger wahlweise am Arrestort oder am<br />
ordentlichen Betreibungsort betreiben. Am Arrestort kann aber nur das Vermögen<br />
gepfändet und verwertet werden, das unter Arrest gelegt wurde. Demzufolge kann nur<br />
Betreibung auf Pfändung nie aber Konkursbetreibung in Frage kommen.<br />
- <strong>Der</strong> Standort der Pfandsachen SchKG 5<strong>1.</strong> Handelt es sich um ein Grundpfand, kommt<br />
ausschliesslich der Betreibungsort am Ort der gelegenen Sache in Frage. Wählt indessen<br />
der Gläubiger für Zinsen und Annuitäten die gewöhnliche Betreibung SchKG 41 II so<br />
ist am zutreffenden Betreibungsort nach SchKG 46-50 vorzugehen. Sind Pfandsachen<br />
an mehreren Orten verstreut ist derjenige Ort als Betreibungsort massgebend, wo der<br />
wertvollste Teil der Pfandgegenstände liegt.<br />
- <strong>Der</strong> Betreibungsort der Erbschaft. Sie kann, wenn die Voraussetzungen von SchKG<br />
49 gegeben sind am Betreibungsort des Erblassers betrieben werden. Auch die<br />
Konkursbetreibung kommt in Frage, wenn der Erblasser konkursfähig gewesen ist<br />
127. Was bringt das Prinzip der gesetzesmässigen Betreibungsortes mit sich?<br />
Dass alle Stadien des Verfahrens grundsätzlich am richtigen Ort durchgeführt werden müssen.<br />
Das kann unter Umständen dazu führen, dass im Verlaufe des Verfahrens das Forum ändert,<br />
z.B. bei einem Wohnsitzwechsel. Dann muss die Betreibung am neuen Wohnsitz fortgeführt<br />
werden.<br />
22
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Das Gesetz bestimmt jedoch für die verschiedenen Betreibungsarten je einen Zeitpunkt, von<br />
dem an der Betreibungsort unverrückbar bleibt SchKG 53. So wird ein Domizilwechsel des<br />
Schuldners unbeachtlich:<br />
- in der Pfändungsbetreibung nach der Pfändungsankündigung<br />
- in der Konkursbetreibung nach der Konkursandrohung<br />
- in der Wechselbetreibung sowie in der Betreibung auf Pfandverwertung nach der<br />
Zustellung des Zahlungsbefehls<br />
- im Fall eines materiellrechtlichen Konkursgrundes nach der Vorladung zur<br />
Konkursverhandlung<br />
128. Wann ist ein Wohnsitz- oder Aufenthaltsortswechsel des Schuldners von Anfang<br />
an unbeachtlich?<br />
Wenn die Betreibung an einem besonderen Betreibungsort begonnen hat.<br />
129. Wer ist Verantwortlich dafür, dass die Zuständigkeitsordnung eingehalten wird?<br />
Die Aufsichtsbehörde.<br />
- Steht das öffentliche Interesse oder Interessen Dritter auf dem Spiel schreiten sie von<br />
Amtes wegen ein SchKG 22.<br />
- Berührt die Verletzung der Zuständigkeitsordnung bloss die Interessen der<br />
Betreibungsparteien so greift die Aufsichtsbehörde bloss auf Beschwerden hin ein.<br />
§11 Die Zeitbestimmungen im Schuldbetreibungsrecht<br />
130. Was sind die Funktionen der Zeitbestimmungen?<br />
- Durch Fristen soll ein möglichst rascher, dennoch aber zuverlässiger Verfahrensgang<br />
gewährleistet werden. Zu diesem Zweck werden sie einerseits den Parteien oder den<br />
vom Verfahren betroffenen Dritten andererseits den Vollstreckungsorganen gesetzt.<br />
- Schonzeiten wollen den Bedürfnissen des Schuldners Rechnung tragen<br />
13<strong>1.</strong> Betreffen alle Fristen das Betreibungsverfahren?<br />
Nein, die einen betreffen das Betreibungsverfahren, die anderen das materielle Recht.<br />
132. Welche verfahrensrechtlichen Fristen gibt es?<br />
- Ordnungsfristen<br />
- Qualifizierende oder Zustandsfristen<br />
- Bedenkfristen<br />
- Verwirkungsfristen<br />
133. An wen sind die Ordnungsfristen gerichtet/welchen Zweck verfolgen sie?<br />
Das sind Fristen, die das Gesetz den Vollstreckungsorganen zur Vornahme der ihnen<br />
obliegenden Amtshandlungen setzt. Sie regeln den zeitlichen Ablauf des Verfahrens.<br />
134. Sind die Ordnungsfristen immer etwa gleich lang?<br />
Nein, in bestimmten Fällen ermächtigt das Gesetz die Aufsichtsbehörde ausdrücklich eine<br />
Ordnungsfrist ausnahmsweise zu verlängern z.B. die Frist für die Erstellung eines<br />
Kollokationsplans SchKG 247 IV. Vereinzelt verlangt das Gesetz sofortiges oder<br />
unverzügliches Handeln z.B. SchKG 89. Es gibt auch Amtshandlungen für die das Gesetz<br />
keine bestimmte Frist vorschreibt, die sind binnen der durch die Umstände gebotenen Frist<br />
vorzunehmen.<br />
23
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
135. Was für Konsequenzen kann es geben, wenn die Ordnungsfrist nicht eingehalten<br />
wird?<br />
- <strong>Der</strong> Betroffene kann sich wegen Rechtsverzögerung beschweren (Betreibungsrechtliche<br />
Beschwerde)<br />
- Wo die Verspätung eine Schaden verursacht hat kann sich die Frage der Staatshaftung<br />
stellen SchKG 5 ff.<br />
136. Was passiert mit Amtshandlungen, die nach Ablauf der Ordnungsfrist<br />
vorgenommen wurden?<br />
Sie sind gültig.<br />
137. Welche Bedeutung haben qualifizierende oder Zustandsfristen?<br />
Sie haben die Bedeutung, dass während einer bestimmten Dauer einer Partei, einem<br />
Vermögensobjekt oder einer Forderung eine bestimmte betreibungsrechtliche Eigenschaft<br />
zukommt oder ein bestimmter betreibungsrechtlich relevanter Zustand herrscht. Z.B. ist die 6<br />
Monate Frist, in der die Konkursfähigkeit einer Person nach Veröffentlichung der Streichung<br />
eines Handelsregistereintrags im Handelsblatt noch gilt eine solche qualifizierte Frist.<br />
138. Kann man die Länge der qualifizierten Fristen verändern?<br />
Nein, sie sind weder verlängerbar noch können sie nach SchKG 33 IV wiederhergestellt<br />
werden.<br />
139. Was ist der Sinn der Bedenkfrist/wieso sind sie für das Verfahren wichtig?<br />
Sie sind da, um dem Schuldner Zeit zu geben doch noch einzulenken. Wichtig für das<br />
Verfahren sind sie insofern, als dass vor ihrem Ablauf nicht weiter gegen den Schuldner<br />
vorgegangen werden darf.<br />
140. Welche Fristen fallen unter die Bedenkfristen?<br />
- Die Zahlungsfristen z.B. SchKG 69 II<br />
- Die Fristen, die der Gläubiger zu respektieren hat, bevor er das Verwertungsbegehren<br />
(SchKG 116 I) oder das Konkursbegehren (SchKG 160 I; 166 I) stellen darf<br />
- Die Frist, die das Betreibungsamt nach Eingang des Verwaltungsbegehrens beachten<br />
muss, bevor es ein Grundstück verwertet<br />
Diese sind gesetzlichen Ausnahmen vorbehalten nicht abänderbar<br />
14<strong>1.</strong> Was passiert, wenn Verwirkungsfristen von den Personen gegen die sie laufen<br />
nicht eingehalten werden?<br />
- Es erwachsen ihnen Rechtsnachteile<br />
- Handlungen, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgenommen wurden, sind grundsätzlich<br />
wirkungslos. Immerhin wirkt der Rechtsverlust nur in der hängigen Betreibung, in<br />
welcher die Frist versäumt wurde. Ist eine solche Frist verwirkt, kann sich aber noch die<br />
Frage ihrer Widerherstellbarkeit stellen SchKG 33 IV.<br />
142. Welche Fristen sind Verwirkungsfristen?<br />
Nur wo das Gesetz es ausdrücklich sagt, hat die einer Partei bestimmte Frist keine<br />
peremptorische Wirkung.<br />
143. Welche materiellrechtlichen Fristen gibt es?<br />
Die Verjährungs- und die Verwirkungsfristen<br />
24
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
144. Was unterliegt der Verjährung?<br />
- Betreibungsforderung selbst<br />
- Schadenersatz und Genugtuungsansprüche aus der Staatshaftung SchKG 6<br />
- Schadenersatzforderungen gegen den Arrestgläubiger SchKG 273<br />
- Forderungen aus einem Pfändungs- oder Konkursschein SchKG 149a, 265 II<br />
Bezüglich dieser Anspruchsverjährung sind die Bestimmungen des Obligationenrechts<br />
anwendbar. Die Verjährungsfristen können auch beliebig unterbrochen werden.<br />
145. Wo liegt eine Verwirkungsfrist vor?<br />
Beim Rückforderungsanspruch SchKG 86 und 187.<br />
146. Kann die Länge der materiellrechtlichen Verwirkungsfrist geändert werden?<br />
Nein, sie kann weder verlängert noch wiederhergestellt noch unterbrochen werden. Ihr Lauf<br />
kann aber gehemmt sein, z.B. während der Dauer einer Nachlasstundung SchKG 293 IV.<br />
147. Wer setzt die Fristen an?<br />
- Gesetz und<br />
- Z.T. die Verfügungen der Vollstreckungsorgane<br />
Z.B. SchKG 69 II<br />
148. Wo ist die Fristenberechnung geregelt?<br />
SchKG 31<br />
149. *Was ist der letztmögliche Handlungszeitpunkt, wo die Fristen noch gewahrt<br />
sind?<br />
Die Frist läuft um Mitternacht des letzten Tages aus. Sie wird durch rechtzeitige Aufgabe der<br />
Sendung bei der schweizerischen Post gewahrt, bei Aufgabe im Ausland durch Übergabe der<br />
Sendung an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz zuhanden der<br />
schweizerischen Post SchKG 32 I. Einreichen bei einer unzuständigen Behörde schadet nicht<br />
SchKG 32 II; die Eingabe wird von Amtes wegen an die zuständige Behörde überwiesen.<br />
150. Was passiert mit falsch eingereichten Klagen aus dem Schuldbetreibungsrecht?<br />
Sie werden nicht von Amtes wegen an das zuständige Gericht überwiesen; dem Kläger wird<br />
zur Einreichung am richtigen Ort eine neue Frist von gleicher Dauer zugestanden SchKG 32<br />
III. Das gilt für die Klagebegehren sowohl im ordentlichen bzw. im beschleunigten wie auch<br />
im summarischen Verfahren.<br />
15<strong>1.</strong> Können die Verfahrensfristen abgeändert werden?<br />
Nein, sie sind grundsätzlich zwingend. Eine Partei kann aber darauf verzichten, die<br />
Nichteinhaltung einer ausschliesslich zu ihren Gunsten laufenden Frist geltend zu machen,<br />
wodurch der Mangel heilt SchKG 33 III.<br />
152. Können die Fristen verlängert werden?<br />
Grundsätzlich nicht. Nur wenn ein am Verfahren Beteiligter im Ausland wohnt oder ein<br />
Aufenthalt oder Wohnort unbekannt sind, dürfen sie die Fristen den Umständen entsprechend<br />
erstrecken SchKG 33 II.<br />
Es können nur noch kurze Eingabefristen verlängert werden, Fristen also, die auch bei<br />
Säumnis wiederherstellbar wären.Vorbehalten bleiben besondere gesetzlich vorgesehene<br />
Verlängerungsmöglichkeiten (z.B. Verwertungsaufschub SchKG 123).<br />
25
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
153. Können betreibungsrechtliche Fristen wiederhergestellt werden?<br />
Wie die Fristenverlängerung, kann auch die Wiederherstellung von Fristen nur aus Gründen<br />
der öffentlichen Ordnung und nur für kurze Eingabefristen in Frage kommen.<br />
154. *Unter welchen Umständen kommt die Wiederherstellung der Frist in Frage?<br />
- nur wenn diese wegen eines unverschuldeten Hindernisses versäumt worden ist SchKG<br />
33 IV<br />
- <strong>Der</strong> Betroffen muss innerhalb der selben Frist wie der versäumten mit einem<br />
Wiederherstellungsgesuch gelangen und gleichzeitig die Eingabe beim zuständigen<br />
Vollstreckungsorgan nachholen<br />
Wiederherstellung ist aber nur so lange zulässig, als sie praktisch noch Sinn hat.<br />
<strong>Der</strong> Entscheid über das Gesuch ist ein Ermessensentscheid.<br />
155. Wer befindet über die Wiederherstellung von Klagefristen?<br />
Darüber befindet nicht die Aufsichtsbehörde sondern das zuständige Gericht. Die Klage ist<br />
binnen gleicher Frist anzuheben.<br />
156. Was passiert mit den bereits vollzogenen Massnahmen, wenn die<br />
Wiederherstellung eines Gesuches gutgeheissen wird?<br />
Sie müssen vorderhand aufrecht erhalten bleiben. Sie sind nur rückgängig zu machen, wenn<br />
dies unmittelbar die Folge des wiederhergestellten und erfolgreichen Rechtsbehelfs ist. Es<br />
dürfen aber keine neuen Massnahmen getroffen werden, sofern sie das Ziel des<br />
wiederhergestellten Rechtsbehelfes vereiteln oder unverhältnismässig erschweren würden.<br />
157. Welche Arten von Schonzeiten gibt es/wo sind sie geregelt?<br />
- Geschlossene Zeiten, SchKG 56 I Ziff. <strong>1.</strong> Sie gelten allgemein gegen alle Schuldner<br />
- Betreibungsferien, SchKG 56 I Ziff. 2. Sie gelten allgemein auch zu Gunsten aller<br />
Schuldner. Nur in der Wechselbetreibung und im Konkursverfahren (nach Eröffnung<br />
des Konkurses gibt es keine Betreibungsferien.<br />
- Rechtsstillstand, Nachlass- und Notstundung SchKG 56 I Ziff. 3, 294, 334 und 337 ff.<br />
Gilt normalerweise nur für einen einzelnen sich in einer besonderen Lage befindenden<br />
Schuldner SchKG 57-6<strong>1.</strong> Bei Vorliegen ausserordentlicher Verhältnisse kann er aber für<br />
alle davon betroffenen Schuldner gelten SchKG 62. Eine Nachlass- oder Notstundung<br />
wirkt immer nur individuell SchKG 295, 337 ff.<br />
158. Welches sind die allgemeinen Wirkungen der Schonzeit?<br />
- Das Betreibungsverbot während dieser Dauer. <strong>Der</strong> Schuldner geniesst einen befristeten<br />
Aufschub.<br />
- Einfluss auf laufende Fristen. Sämtliche bereits vorher begonnene Fristen laufen<br />
während der Schonzeit ungehemmt weiter, SchKG 63 Satz <strong>1.</strong> Es wird aber ihr Ablaufen<br />
hinausgeschoben, wenn es in diese Zeit fällt. Ihr Ablauf wird nach BGer auch um die<br />
gleiche Anzahl Tage hinausgeschoben, wenn die Frist direkt nach Ablauf der Schonzeit<br />
endet, wie wenn die Frist während der Schonzeit abgelaufen wäre. Diese<br />
Fristenerstreckung kann nur für Eingabefristen Bedeutung haben.<br />
159. Was passiert mit Betreibungshandlungen die während der Schonzeit ausgeführt<br />
wurden?<br />
Sie sind nicht nichtig, sie entfalten ihre Wirkung einfach erst nach Ablauf der Schonzeit.<br />
160. Wirken die Schonzeiten nur Zugunsten des Schuldners?<br />
26
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Nein, sie wirken auch insofern Zugunsten des Gläubigers und beteiligter Dritter, als die<br />
gesetzliche Fristerstreckung nach SchKG 63 auch für sie gilt. Sie können ihre Begehren auch<br />
während der Schonzeit stellen doch dürfen die Vollstreckungsorgane ihnen einstweilen nicht<br />
stattgeben.<br />
16<strong>1.</strong> Welches sind in der Schonzeit verbotenen „Betreibungshandlungen“ nach<br />
SchKG 56/Bsp.?<br />
Für die Bestimmung, welche Handlungen solche verbotene Betreibungshandlungen darstellen<br />
sind zwei Merkmale von Bedeutung:<br />
- Um eine solche Handlung darstellen zu können kommt nur eine Amtshandlung in Frage.<br />
Die Handlung muss also von einem Vollstreckungsorgan ausgehen.<br />
- Weiter muss es sich um eine eigentliche Vollstreckungsmassnahme handeln: eine<br />
Handlung also, die auf Befriedigung des Gläubigers aus dem Vermögen des Schuldners<br />
hinzielt. Die Handlung muss geeignet sein, den Gläubiger durch Einleitung oder<br />
Fortsetzung der Betreibung diesem Ziel näher zu bringen und auf diese Weise in die<br />
Rechtslage des Schuldners präjudizierend einzugreifen.<br />
Betreibungshandlungen sind z.B.<br />
- Zustellung des Zahlungsbefehls SchKG 71;<br />
- Rechtsöffnung SchKG 80 ff<br />
- Pfändungsankündigung SchKG 90<br />
Nicht als Betreibungshandlungen gelten z.B.<br />
- alle Handlungen der Parteien, insbesondere des Gläubigers (Begehren, die an eine<br />
Behörde gerichtet sind)<br />
- interne Amtshandlungen<br />
- Handlungen, die nach der Konkurseröffnung vom Konkursamt oder von der<br />
Konkursverwaltung vorgenommen werden<br />
- Betreibungsrechtliche Vorkehren nach durchgeführter Verwertung<br />
- Entscheide der Aufsichtsbehörde, die sich nur über die Begründetheit einer Beschwerde<br />
aussprechen.<br />
- Die in SchKG 56 Satz 1 genannten Massnahmen, da sich diese nicht auf Vollstreckung<br />
sondern nur auf einstweilige Sicherheit von Vollstreckungssubstrat beziehen.<br />
162. Aus Welchen Gründen wird dem Schuldner Rechtsstillstand gewährt?<br />
- in der Nachlass- und Notstundung<br />
- Bei Militär-, Zivil- oder Zivilschutzdienstes des Schuldners oder seines gesetzlichen<br />
Vertreters SchKG 57 (für fam.rechtliche Unterhaltspflichten kann der Schuldner sich<br />
aber nicht darauf berufen SchKG 57 III, ebenso wenig, wenn er den Dienst auf Grund<br />
eines Arbeitsverhältnisses leistet SchKG 57 IV, nach SchKG 57d kann der<br />
Rechtsstillstand aus diesem Gund weiter aufgehoben werden, wenn ein in diesem Art.<br />
Aufgezählter Grund vorliegt). Auch dem handlungsunfähigen Schuldner und den<br />
Gesellschaftern, deren gesetzliche Vertreter bzw. Organe sich im Dienste befinden, wird<br />
Rechtsstillstand gewährt, bis sie in der Lage sind, einen anderen Vertreter zu bestellen<br />
SchKG 57e. Betreibungshandlungen während diesem Rechtsstillstand sind nichtig. <strong>Der</strong><br />
Gläubiger darf aber während dieser Zeit die Aufnahme eines Güterverzeichnisses<br />
verlangen, wenn der Schuldner ihm die Forderung nicht sonst sicher stellt SchKG 57c.<br />
Arrest kann der Gläubiger, wenn ein Grund vorliegt auch verlangen SchKG 271 ff.<br />
- Bei Todesfall in der Familie SchKG 58<br />
- Bei Tod des Schuldners SchKG 59 I<br />
- Bei Haft des Schuldners SchKG 60<br />
27
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Bei Krankheit des Schuldners SchKG 6<strong>1.</strong> Da geschieht die Gewährung des<br />
Rechtsstillstandes von Amtes wegen oder auf Antrag des Schuldners oder eines<br />
Angehörigen auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses<br />
- Allgemeiner Notzustand (allgemeines Moratotium) SchKG 62<br />
§12 Formvorschriften<br />
163. Wo sind die Formvorschriften für die im amtlichen Verkehr mit dem Publikum<br />
stehenden Behörden geregelt?<br />
- Für die Gerichte sind die Formvorschriften in der ZPO geregelt<br />
- Für Schuldbetreibungsbehörden im SchKG<br />
164. Welche Formen sind im SchKG für Handlungen der Schuldbetreibungsbehörde<br />
vorgesehen?<br />
- die Mitteilung SchKG 34/ Ausnahmsweise Mitteilung durch gewöhnlichen Brief<br />
- die öffentliche Bekanntmachung SchKG 35<br />
- die formelle Zustimmung SchKG 64 ff.<br />
165. Welche Formvorschriften müssen gewahrt sein, dass eine Anordnung einer vom<br />
Gesetz geforderten „Mitteilung“ genügt?<br />
Die Anordnungen müssen immer schriftlich erlassen werden, mit der Unterschrift der<br />
betreffenden Amtsstelle versehen werden und durch eingeschriebenen Brief oder durch<br />
Übergabe gegen Empfangsbescheinigung zugestellt werden SchKG 34. Die Mittelungsformen<br />
sind aus Beweisgründen vorgeschrieben und haben reinen Ordnungscharakter. Sie sind stets<br />
einzuhalten soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt.<br />
166. Ist eine Mitteilung, bei welcher die Formvorschriften nicht eingehalten wurden<br />
trotzdem gültig?<br />
Ja, doch trifft dann das Vollstreckungsorgan die Beweislast dafür, dass die Mitteilung den<br />
Adressaten erreicht hat.<br />
167. Welches sind die Formvorschriften, die die öffentliche Bekanntmachung erfüllen<br />
muss/wo ist das geregelt?<br />
SchKG 35<br />
- Sie muss im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im betreffenden kantonalen<br />
Amtsblatt erscheinen<br />
- Wenn die Verhältnisse es erfordern kann die Bekanntmachung auch durch andere<br />
Blätter oder auf dem Wege des öffentlichen Aufrufs geschehen. Die Wahl einer dieser<br />
beiden zusätzlichen Publikationsformen ist eine Ermessensfrage und daher nur durch<br />
Beschwerde an eine kantonale Aufsichtsbehörde anfechtbar.<br />
168. Was wird mit der öffentlichen Bekanntmachung bezweckt?<br />
- sie hat Bedeutung im Verwertungsverfahren und im Konkurs- und Nachlassverfahren,<br />
und zwar immer dort, wo man sich an ein breites Publikum wenden will<br />
- Sie dient weiter als Ersatz für die ordentliche Mitteilung oder Zustellung an unbekannte<br />
Personen, Personen, deren Adresse nicht bekannt ist, oder an eine im Ausland wohnende<br />
Person, wen Mitteilung oder Zustellung an diese nicht innert angemessener Zeit möglich<br />
ist, SchKG 66 IV.<br />
28
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
169. Welche Urkunden müssen formell zugestellt werden?<br />
Die Betreibungsurkunden, SchKG 64 ff. Darunter sind aber hier nur Urkunden zu verstehen,<br />
in denen der Schuldner aufgefordert wird, den Gläubiger zu befriedigen, wobei ihm<br />
gleichzeitig eine bestimmte Rechtsfolge angedroht wird, falls er dieser Aufforderung nicht<br />
nachkommen sollte.<br />
Die Bedeutung des Inhalts der Urkunde begründet ihre formelle Zustellungsbedürftigkeit.<br />
Betreibungsurkunden i.S. von SchKG 64 ff sind demgemäss der Zahlungsbefehl und die<br />
Konkursandrohung (BGer sieht die Pfändungsankündigung SchKG 90nicht als eine solche<br />
Urkunde)<br />
170. In welcher Form muss die Zustellung vorgenommen werden?<br />
Da muss die Betreibungsurkunde dem Schuldner offen übergeben werden, wobei dieser<br />
Vorgang gleichzeitig auf dem Original und einem Doppel vom zustellenden<br />
Betreibungsbeamten oder Angestellten oder durch den Briefträger zu bescheinigen ist SchKG<br />
72 II. Mit der Übergabe der Urkunde ist die Zustellung vollzogen. Wird der Schuldner nicht<br />
angetroffen und fällt auch keine Ersatzzustellung in Betracht so muss ein neuer<br />
Zustellungsversuch unternommen werden. Auch der Briefträger muss die Urkunde offen<br />
übergeben damit notfalls auf der Stelle Rechtsvorschlag erhoben werden kann.<br />
17<strong>1.</strong> An wen alles darf die Zustellung erfolgen?<br />
- wohnt der Schuldner am Betreibungsort regelt dies SchKG 64 I. Die Ersatzzustellung<br />
für diesen Fall regelt SchKG 64 I und II<br />
- Wohnt der Schuldner nicht am Betreibungsort→3 Hauptfälle:<br />
o Wohnt er in der Schweiz ist es in SchKG 66 I und II geregelt wobei SchKG 66<br />
II auf SchKG 64 verweist.<br />
o Wohnt der Schuldner im Ausland ist es in SchKG 66 III geregelt<br />
o Ist eine formelle Zustellung nicht möglich (Fälle von Art. 66 IV SchKG) so<br />
wird die Zustellung durch die öffentliche Bekanntmachung SchKG 35 ersetzt<br />
- Wird ein handlungsunfähiger Schuldner betrieben, müssen die Betreibungsurkunden<br />
seinem gesetzlichen Vertreter zugestellt werden SchKG 68c I.<br />
- Betreibungsurkunden für juristische Personen oder netreibungsfähige<br />
Personengesellschaften sind ihrem Vertreter zuzustellen. Wer als Vertreter gilt sagt<br />
SchKG 65 I. Die Ersatzzustellung für diesen Fall ist in SchKG II geregelt.<br />
- Die Person, an welche eine Zustellung im Falle der Betreibung einer unverteilten<br />
Erbschaft erfolgt ist in SchKG 65 III geregelt.<br />
172. *Welches sind die Rechtsfolgen einer mangelhaften Zustellung?<br />
Gegen die Zustellung einer Betreibungsurkunde in ungesetzlicher Form oder an einen nicht<br />
legitimierten Empfänger kann sich der Schuldner bei der Aufsichtsbehörde beschweren und<br />
deren Aufhebung verlangen. Unterlässt er dies oder steht fest, dass er die Urkunde trotz des<br />
Zustellungsfehlers erhalten hat, ist die Zustellung wirksam und die Urkunde gültig. Im Falle<br />
der Anfechtung ist das Betreibungsamt für die angebliche Heilung des Mangels<br />
beweispflichtig.<br />
Nichtig ist eine Zustellung nur dann, wenn die Notifikation an den Schuldner sowie die<br />
Zustellungsbescheinigung fehlen oder wenn infolge sonst fehlerhafter Zustellung die Urkunde<br />
nicht in die Hände des Betriebenen gelangt ist.<br />
§13 Die Betreibungs- und die Parteikosten<br />
173. Welche Kostenarten gibt es im Schuldbetreibungsverfahren?<br />
- Gebühren: die bezieht der Staat als Entgelt für die Tätigkeit seiner Rechtspflegeorgane<br />
29
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Auslagen: das sind die Kosten, die bei einer Amtshandlung entstehen (Verpflegung,<br />
Unterkunft, Beweiserhebung, Inserierung…)<br />
- Parteikosten: darunter sind alle Aufwendungen zu verstehen, die einer Partei im Verlauf<br />
eines Verfahrens erwachsen, insbesondere für die Entschädigung ihres Vertreters<br />
174. Welche Kosten bilden die Betreibungskosten?<br />
Die Gebühren und Auslagen.<br />
Zu den Betreibungskosten zählen aber auch die Gerichtskosten der rein<br />
betreibungsrechtlichen Summarsachen, da hier die Gerichte als Vollstreckungsorgane<br />
zuständig sind.,<br />
175. Wo sind die Betreibungskosten geregelt?<br />
Sie sind in der vom BRat gestützt auf SchKG 16 I erlassenen Gebührenverordnung (GVO)<br />
abschliessend geregelt.<br />
176. Welche Kosten gehören nicht zu den Betreibungskosten?<br />
Keine Betreibungskosten sind grundsätzlich die Parteikosten, vor allem aber auch nicht die<br />
Gerichtskosten eines ordentlichen Zivilprozesses.<br />
177. Wie werden die Betreibungskosten festgesetzt?<br />
Welche Gebühren im Einzelfall zu belasten und wie sie zu bemessen sind, bestimmt<br />
ausschliesslich der SchKG-Tarif. Andere als die darin vorgesehenen Gebühren und<br />
Entschädigungen dürfen in einem Vollstreckungs- Nachlass- oder Notstundungsverfahren<br />
nicht erhoben werden.<br />
178. Wer hat die Einhaltung des Tarifs zu überwachen?<br />
Die Aufsichtsbehörden.<br />
179. Wer hat welche Beschwerde zur Verfügung wenn er mit einer Kostenverfügung<br />
von der er betroffen ist nicht einverstanden ist?<br />
Jedem von einer Kostenverfügung betroffenen – auch den amtlichen und ausseramtlichen<br />
Organen steht das Beschwerderecht zu (Beschwerde nach SchKG 17). Reine<br />
Bemessungsfragen können aber nicht ans Bundesgericht weiter gezogen werden.<br />
180. Wer trägt die Betreibungskosten?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner, wenn er sich nicht erfolgreich der Betreibung widersetzen kann, SchKG 68.<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger muss aber vorschiessen. Ohne Vorschuss des Gläubigers ist das<br />
Betreibungsamt berechtigt, die gewünschte Handlung einstweilen zu unterlassen SchKG 68 I.<br />
Dem Gläubiger steht aber das Recht zu von den Zahlungen des Schuldners die<br />
Betreibungskosten vorab zu erheben SchKG 68 II.<br />
18<strong>1.</strong> Wer trägt die Parteikosten?<br />
Jede Partei trägt ihre eignen Parteikosten, auch die obsiegende. Insbesondere darf die<br />
Entschädigung eines Gläubigervertreters nicht auf den Schuldner abgewälzt werden SchKG<br />
27 III. Dieses Verbot gilt aber nur für den Einsatz eines Parteivertreters vor den Betreibungs-<br />
und Konkursämtern, nicht aber, sobald Schwierigkeiten auftreten, die ein Gerichtsverfahren<br />
auslösen. So ist der Richter ausdrücklich berechtigt für die in betreibungsrechtlichen<br />
Summarsachen entstandenen Parteikosten eine angemessene Parteientschädigung<br />
zuzusprechen GebV, die dann zu den Betreibungskosten geschlagen werden.<br />
30
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
182. Fallen Parteikosten eines ordentlichen Gerichtsverfahrens auch unter die<br />
Betreibungskosten?<br />
Nein, sie werden nach kantonalem Recht verteilt.<br />
183. Wie werden die Kosten im Beschwerdeverfahren verteilt?<br />
Gar nicht, dieses Verfahren ist nach SchKG 20a I kostenfrei. Nur bei böswilliger oder<br />
mutwilliger Beschwerdeführung kann einer Partei eine Busse sowie Gebühren und Auslagen<br />
auferlegt werden.<br />
184. Gilt es die unentgeltliche Rechtspflege auch im SchKG?<br />
Ja.<br />
§12 Die öffentlich rechtlichen Nebenfolgen der Schuldbetreibung (nie konkret in der<br />
<strong>Vorlesung</strong> erwähnt)<br />
185. Wie wird die ordnungsmässige Durchführung der Zwangsvollstreckung<br />
gesichert?<br />
Durch Bestimmungen im Strafgesetzbuch.<br />
186. Gibt es administrative Folgen einer fruchtlosen Pfändung und der<br />
Konkurseröffnung?<br />
Kantonales- und Bundesrecht können an die Insolvenz öffentlichrechtliche Folgen knüpfen<br />
SchKG 26 I. Sie haben jedoch gewisse bundesrechtliche Schranken einzuhalten. Wenn einer<br />
der in SchKG 26 II aufgeführten Fälle vorliegt, sind die Rechtsfolgen in jedem Fall wieder<br />
aufzuheben.<br />
4. Kapitel: Das Einleitungsverfahren:<br />
§15 ***Die Funktion des Einleitungsverfahrens<br />
187. Was bedeutet „Schuldbetreibung“ oder „Zwangsvollstreckung im weiteren<br />
Sinn“?<br />
Das Betreibungsverfahren im Ganzen.<br />
188. *In welche zwei Abschnitte teilt sich das Betreibungsverfahren?<br />
SchKG 38 II<br />
- in das Einleitungsverfahren (Schuldbetreibung im engeren Sinn)<br />
- das eigentliche Zwangsvollstreckungsverfahren (Zwangsvollstreckung im engeren Sinn)<br />
(Prof. nennt es Fortsetzungsverfahren?)<br />
189. *Was ist die Funktion des Einleitungsverfahrens?<br />
- Prüfung ob der Anspruch überhaupt vollstreckbar ist (unter Umständen sogar dessen<br />
materiellrechtlicher Bestand und Umfang)<br />
- Schauen welche Vollstreckung zur Anwendung kommt (wie es weitergeht kommt auf<br />
die Aktivität des Schuldners an).<br />
190. Welche Möglichkeiten bleiben dem Schuldner während des<br />
Einleitungsverfahrens?<br />
- Zahlen<br />
- Rechtsvorschlag<br />
31
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
19<strong>1.</strong> *Welche Stadien umfasst das Einleitungsverfahren?<br />
<strong>1.</strong>das Betreibungsbegehren des Gläubigers<br />
2.den Erlass des Zahlungsbefehls durch das Betreibungsamt<br />
Gläubiger macht<br />
nichts<br />
Verfahren stoppt<br />
3. ev. Rechtsvorschlag<br />
Verfahren wird gestoppt<br />
4. Rechtsöffnung durch den Richter<br />
Fortsetzungsverfahren<br />
Gläubiger verschafft sich<br />
Rechtsöffnung<br />
Nichts<br />
Fortsetzungsverfahren<br />
Danach kommt das Fortsetzungsverfahren nämlich die Betreibung auf Pfändung, auf<br />
Pfandverwertung oder auf Konkurs zum Zuge. (Nur in der Wechselbetreibung weicht schon<br />
das Einleitungsverfahren vom ordentlichen Verfahren in einigen wesentlichen Punkten ab=.<br />
192. Wann ist das Einleitungsverfahren abgeschlossen?<br />
Sobald feststeht, dass der Schuldner keinen Rechtsvorschlag erhoben oder der Richter dessen<br />
Wirkung durch Rechtsöffnung endgültig beseitigt hat.<br />
§ 16 *Das Betreibungsbegehren<br />
193. Wird eine Betreibung je von Amtes wegen durchgeführt?<br />
Nein, es braucht einen Anstoss durch den Rechtssuchenden. <strong>Der</strong> Gläubiger oder sein Vertreter<br />
muss dem Betreibungsamt beantragen die Betreibung in Gang zu setzen. Eines solchen<br />
Betreibungsbegehrens bedarf es sowohl für privat- als auch für öffentlichrechtliche<br />
Forderungen.<br />
194. *Welche Wirkungen hat en formell korrekt eingereichtes Begehren?<br />
Betreibungsrechtliche und zivilrechtliche Wirkungen<br />
- Betreibungsrechtlich veranlasst es das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl zu erlassen<br />
und dem Schuldner zuzustellen. Erst mit dieser amtlichen Massnahme beginnt die<br />
Schuldbetreibung, SchKG 38 II.<br />
- Zivilrechtlich unterbricht schon die Absendung des Betreibungsbegehrens den Lauf der<br />
Verjährung; die Verjährung beginnt hierauf mit jeder Betreibungshandlung neu zu<br />
laufen<br />
195. *In welcher Form muss das Betreibungsbegehren sein?<br />
Das Betreibungsbegehren kann schriftlich oder mündlich beim Betreibungsamt gestellt<br />
werden SchKG 67 I. Mit Vorteil bedient man sich dazu der amtlichen Formulare. Sie sind<br />
zwar nicht vorgeschrieben, bieten aber grössere Gewähr für Rechtsgenüglichkeit.<br />
Wird das Begehren mündlich angebracht, füllt der Betreibungsbeamte das Formular aus. So<br />
oder so muss der Gläubiger sein Begehren unterschreiben. Fehlende Unterschrift, wie<br />
32
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
verbesserliche Formfehler schaden aber nicht SchKG 32 IV. Einreichen am falschen Ort<br />
schadet nicht SchKG 32 II. Um sich den Beweis zu sichern kann der Gläubiger vom<br />
Betreibungsamt eine gebührenfreie Bescheinigung des Eingangs verlangen SchKG 67 III<br />
196. Was passiert, wenn der Inhalt eines Betreibungsbegehrens unvollständig oder<br />
fehlerhaft ist?<br />
In diesen Fällen muss das Amt Gelegenheit zur Verbesserung geben SchKG 32 IV. Von<br />
Amtes wegen wird abgesehen von offensichtlichen Missschreibungen nichts korrigiert.<br />
197. *Was ist notwendiger Inhalt des Betreibungsbegehrens?<br />
- Name und Wohnort des Gläubigers sowie seines allfälligen Vertreters (SchKG 67 I Ziff.<br />
1 und genaueres). Mehrere Gläubiger, die einen Schuldner gemeinsam betreiben wollen,<br />
müssen mit Namen und Wohnort einzeln aufgeführt sein.<br />
- Name und Wohnort des Schuldners sowie gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters,<br />
insbesondere auch des empfangsberechtigten Vertreters einer zu betreibenden<br />
juristischen Person SchKG 67 I Ziff. 2<br />
- Forderung ist in Schweizer Währung anzugeben. Bei verzinslichen Forderungen müssen<br />
ausserdem der Zinsfuss und der Tag von dem an der Zins gefordert wird genannt<br />
werden. Wird für die Zinsen allein betrieben, sind sie als Hauütschuld betragsmässig zu<br />
beziffern.<br />
- Forderungsurkunde und deren Datum muss bezeichnet werden, liegt keine solche vor,<br />
ist der Forderungsgrund anzugeben.<br />
- Allfällige weitere Bemerkungen: Da muss angegeben werden:<br />
o Wenn das Begehren für eine Pfand gesicherte Forderung gemacht wird, muss<br />
der Pfandgegenstand sowie der Namen des allfälligen Dritteigentümers des<br />
Pfandes stehen SchKG 67 II i.V.m. 151 I a<br />
o Besteht eine Pfandsicherung in einem Grundstück, das als Familienwohnung<br />
dient, ist auch dieser Umstand anzugeben SchKG 151 I b.<br />
198. Was kann der Schuldner machen, wenn die Forderung ungenügend bezeichnet<br />
wird?<br />
Er kann den Zahlungsbefehl, der auf den Angaben des Betreibungsbegehrens beruht mit<br />
Beschwerden anfechten.<br />
§ 17 *<strong>Der</strong> Zahlungsbefehl<br />
199. Wann erlässt das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl/was prüft es bevor es ihn<br />
ausstellt?<br />
Nach Empfang des Betreibungsbegehrens SchKG 69 I. Hierzu hat es nur zu prüfen, ob ein<br />
formgültiges Betreibungsbegehren vorliegt.<br />
200. Um was handelt es sich beim Zahlungsbefehl?<br />
Um eine Zahlungsaufforderung mit der Weisung, entweder den Gläubiger zu befriedigen oder<br />
durch Rechtsvorschlag die Betreibung zum Stillstand zu bringen. Um dieser Weisung<br />
Nachdruck zu verleihen, wird dem Schuldner angedroht, dass die Betreibung ihre Fortsetzung<br />
nehme, wenn er weder zahle noch Recht vorschlage. SchKG 69 II Ziff. 2-4.<br />
20<strong>1.</strong> Was ist das Endziel des Zahlungsbefehls?<br />
Das ist, bei Ausbleiben der geforderten Zahlung für die hängigen Betreibungen einen<br />
vollstreckbaren Titel zu machen. Das wird erreicht, indem – mangels Rechtsvorschlages oder<br />
nach Beseitigung seiner Hemmungswirkung durch den Richter – der Zahlungsbefehl<br />
33
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
rechtskräftig und gestützt darauf der geltend gemachte Anspruch vollstreckbar wird. <strong>Der</strong><br />
Zahlungsbefehl bildet somit die Grundlage der Betreibung.<br />
202. Was passiert mit Betreibungshandlungen, die ohne gültigen Zahlungsbefehl<br />
vorgenommen wurden?<br />
Sie sind nichtig und müssen von Amtes wegen aufgehoben werden SchKG 22 (Ausnahmen).<br />
203. *Welchen Inhalt muss der Zahlungsbefehl haben?<br />
- Wiederholen sämtlicher Angaben des Betreibungsbegehrens<br />
- Die Aufforderung an den Schuldner, binnen bestimmter Frist den Gläubiger für dessen<br />
Forderung samt Betreibungskosten zu befriedigen<br />
- Die Mittelung an den Schuldner, dass er sich binnen bestimmter Frist durch<br />
Rechtsvorschlag der Bertreibung widersetzen kann<br />
- <strong>Der</strong> ausdrückliche Hinweis auf die Rechtsfolge bei passivem Verhalten des Schuldners:<br />
nämlich die Androhung, dass die Betreibung ihren Fortgang nehme, wenn er weder<br />
Zahlung leiste noch Recht vorschlage.<br />
204. In welcher Form muss der Zahlungsbefehl ergehen?<br />
- er wird immer auf einem amtlichen Formular erlassen (er ist eine Betreibungsurkunde<br />
im weiteren Sinne/da für die verschiedenen Betreibungsarten verschiedene Formulare<br />
bestehen, muss der Betreibungsbeamte schon nach Eingang des Betreibungsbegehrens<br />
prüfen, ob die Betreibung auf Pfändung, Pfandverwertung, Konkurs oder<br />
Wechselbetreibung in Frage kommt SchKG 38 III)<br />
- <strong>Der</strong> Zahlungsbefehl wird doppelt ausgefertigt. Eine Ausfertigung ist für den Schuldner<br />
die andere für den Gläubiger bestimmt SchKG 70 I.<br />
- In bestimmten Fällen müssen zusätzliche Zahlungsbefehle ausgestellt werden<br />
205. In welchen Fällen müssen zusätzliche Zahlungsbefehle ausgestellt werden?<br />
- wenn gleichzeitig mehrere Mitschuldner betrieben werden, muss jedem einzelnen von<br />
ihnen einen Zahlungsbefehl ausgestellt werden SchKG 70 II<br />
- dem Ehegatten des in Gütergemeinschaft lebenden Schuldners SchKG 68a<br />
- in der Betreibung auf Pfandverwertung dem Dritteigentümer des Pfandes sowie<br />
allenfalls dem Ehegatten SchKG 153 II<br />
- in der Betreibung gegen Schuldner unter elterlicher Gewalt, vormund-, Beirat- und<br />
Beistandschaft ihrem gesetzlichen Vertreter SchKG 68c ff.<br />
206. In welchem Zeitpunkt muss der Zahlungsbefehl Zugestellt werden?<br />
Nach Eingang des Betreibungsbegehrens SchKG 71 I. Damit ist gemeint, dass die Zustellung<br />
binnen angemessen kurzer Frist erfolgen soll. Liegen gegen einen Schuldner mehrere<br />
Betreibungsbegehren vor, so muss das Amt sämtliche Zahlungsbefehle gleichzeitig zustellen,<br />
damit niemand begünstigt oder benachteiligt wird SchKG 71 II und III.<br />
207. Wer haftet, wenn ein Schaden durch ungebührliche Verzögerung der Zustellung<br />
entstanden ist?<br />
<strong>Der</strong> Staat.<br />
208. *Wie und wann wird dem Gläubiger die für ihn bestimmte Ausfertigung des<br />
Zahlungsbefehls zugestellt?<br />
Nicht formell sondern bloss in der Form der Mitteilung SchKG 34. Dies geschieht aber erst,<br />
nachdem der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben hat, andernfalls sofort nach Ablauf der<br />
34
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Bestreitungsfrist. Auf diese Weise erhält der Gläubiger gleichzeitig davon Kenntnis, ob ihm<br />
Recht vorgeschlagen wird oder nicht und gegebenenfalls mit welchem Inhalt SchKG 76.<br />
209. *Welche verfahrensmässigen Rechte stehen dem Schuldner zu, der einen<br />
Zahlungsbefehl erhalten hat?<br />
- er kann verlangen, dass das Betreibungsamt den Gläubiger auffordere, die Beweismittel<br />
für die Forderung innerhalb der Bestreitungsfrist bei Amt zur Einsicht aufzuerlegen.<br />
Durch dieses Begehren wird der Ablauf der Bestreitungsfrist aber nicht gehemmt<br />
SchKG 73.<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner kann dem Gläubiger Recht vorschlagen SchKG 74 f<br />
- Schliesslich hat der Schuldner das Recht, die Zustellung des Zahlungsbefehls mit<br />
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde anzufechten, sofern betreibungsrechtliche<br />
Vorschriften verletzt worden sind<br />
210. *Wann wird der Zahlungsbefehl substanzkräftig?<br />
Nachdem die Bestreitungsfrist (im Normalfall 10 Tage) abgelaufen ist SchKG 69 II Ziff. 3.<br />
21<strong>1.</strong> Wann darf das Fortsetzungsverfahren begonnen werden?<br />
Noch nicht im Moment, wo der Zahlungsbefehl substanzkräftig geworden ist. Erst nachdem<br />
die Zahlungsfrist abgelaufen ist (im Normalfall 20 Tage SchKG 69 I Ziff. 2).<br />
§18 <strong>Der</strong> Rechtsvorschlag<br />
212. Was passiert aufgrund eines Rechtsvorschlages?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner bringt damit die Betreibung zum Stillstand SchKG 78. Er verweist damit den<br />
Gläubiger, wenn er mit der Betreibung weiterfahren will auf den Rechtsweg.<br />
213. Was ist Gegenstand der Prüfung des Richters, wenn Rechtsvorschlag erhoben<br />
wurde?<br />
Es ist immer der Bestand, der Umfang, die Erzwingbarkeit oder die betreibungsrechtliche<br />
Vollstreckbarkeit der geltend gemachten Forderung. Vor allem soll dem Schuldner sie<br />
materiellrechtliche Beurteilung des Anspruchs durch den Richter offen stehen.<br />
214. Wer ist berechtigt Recht vorzuschlagen?<br />
Wer von der Betreibung selbst betroffen ist und deshalb an ihrem Stillstand ein legitimes<br />
Interesse hat.<br />
215. *Aus welchen Gründen kann der Rechtsvorschlag erhoben werden?<br />
Aus materiellrechtlichen wie auch aus vollstreckungsrechtlichen Gründen SchKG 69 II Ziff.<br />
3.<br />
- Bei materiellrechtlichen Gründen bestreitet der Betriebene den Bestand, die Fälligkeit<br />
oder die Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung. Sein Rechtsvorschlag ist gegen<br />
die Forderung selbst gerichtet.<br />
- Bei vollstreckungsrechtlichen Gründen bestreitet der Schuldner bloss die<br />
Vollstreckbarkeit der Forderung auf dem Wege der Schuldbetreibung.<br />
o Sachliche Zulässigkeit der Betreibung sei nicht gegeben<br />
o Im konkreten Fall sei der Betreibungsweg nicht zulässig<br />
35
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
216. *Wann nimmt man den Rechtsvorschlag und wann die Beschwerde als<br />
Rechtsbehelf gegen den Zahlungsbefehl?<br />
- Anlass zum Rechtsvorschlag bietet immer eine Tatsache, welche den Schuldner<br />
berechtigt, sich (aus materiellrechtlichem oder vollstreckungsrechtlichem Grund) der<br />
Geltendmachung des Anspruchs an sich zu widersetzen.<br />
- Rein formelle Mängel der Betreibung – Fehlen von Verfahrensvoraussetzungen,<br />
Verletzung betreibungsrechtlicher Verfahrensvorschriften sind dagegen mit Beschwerde<br />
zu rügen.<br />
217. Was macht man, wenn ein Beschwerdegrund und ein Bestreitungsgrund<br />
vorliegen?<br />
Da empfiehlt es sich neben der Beschwerde vorsorglich zugleich einen Rechtsvorschlag zu<br />
erheben für den Fall, dass die Beschwerde abgewiesen werden sollte.<br />
218. Welche Form muss der Rechtsvorschlag haben?<br />
Er muss keine Form haben: er kann schriftlich oder mündlich gemacht werden, SchKG 74 I.<br />
- Schriftlich wird Recht vorgeschlagen mit eingeschriebenem oder gewöhnlichem Brief.<br />
Zulässig ist auch ein Rechtsvorschlag über Fax. Versehentliche Einreichung des<br />
schriftlichen Rechtsvorschlages bei einem unzuständigen Amt schadet nicht SchKG 32<br />
II.<br />
- mündlich kann der Rechtsvorschlag erhoben werden:<br />
o sofort bei der Zustellung des Zahlungsbefehls, wobei der Überbringer die<br />
Erklärung des Schuldners sogleich auf beiden Doppeln des Zahlungsbefehls<br />
bescheinigt<br />
o nachher auf dem Betreibungsamt, wo der Rechtsvorschlag protokolliert wird<br />
o unter Umständen auch telefonisch beim Betreibungsamt<br />
219. Innert welcher Frist muss Recht vorgeschlagen werden?<br />
Binnen der gesetzlichen, im Zahlungsbefehl genannten Frist erhoben werden. Diese beträgt je<br />
nach der Betreibungsart 10 oder 5 Tage seit der Zustellung SchKG 69 II ziff. 3, 179 I.<br />
220. Von welchem Moment an beginnt die Frist zu laufen?<br />
Von dem Augenblick an, da der Schuldner vom Zahlungsbefehl Kenntnis erhalten hat.<br />
22<strong>1.</strong> *Muss ein Rechtsvorschlag begründet werden?<br />
Nein, es gibt aber Ausnahmen 75 II und 75 III.<br />
222. In welchen Fällen muss der Rechtsvorschlag begründet werden?<br />
- in der Betreibung auf Grund eines Konkursverlustscheines ist die Einrede mangelnden<br />
Vermögens mit Rechtsvorschlag vorzubringen SchKG 75<br />
- In der Wechselbetreibung ist schriftliche Begründung ausdrücklich vorgeschrieben, weil<br />
der Rechtsvorschlag hier ebenfalls noch vom Richter auf seine Begründetheit hin<br />
geprüft werden muss SchKG 75 III.<br />
- Zu begründen ist sodann des Wiederherstellungsgesuch bei einem späteren<br />
Rechtsvorschlag SchKG 33 IV.<br />
- Schliesslich muss der nachträgliche Rechtsvorschlag begründet werden SchKG 75 III,<br />
77.<br />
223. *Kann ein Schuldner nur ein Teil der Forderung bestreiten?<br />
Ja, er muss aber den bestrittenen Betrag genau angeben, andernfalls gilt die ganze Forderung<br />
als bestritten SchKG 74 II. Nicht zulässig wäre aber einen auf die Betreibungskosten<br />
36
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
beschränkter Rechtsvorschlag, denn dafür haftet der Schuldner von Gesetzes wegen SchKG<br />
68.<br />
224. *Was prüft das Betreibungsamt beim Entscheid über den Rechtsvorschlag?<br />
Er prüft nur, ob er formgültig erhoben wurde, nicht auch ob er sachlich begründet ist. Bei der<br />
Prüfung, ob alle Formerfordernisse erfüllt sind sollte das Betreibungsamt aber jede nicht<br />
unbedingt gebotene formale Strenge vermeiden SchKG 32 IV.<br />
225. Was macht man gegen einen Entscheid des Amtes bezüglich des<br />
Rechtsvorschlages?<br />
Beide Parteien des Verfahrens können gegen den Entscheid des Amtes bei der<br />
Aufsichtsbehörde Beschwerde führen.<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger wegen Entgegennahme eines ungültigen Rechtsvorschlages<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner wegen Ablehnung eines gültigen Rechtsvorschlages<br />
226. *Was ist der verspätete Rechtsvorschlag?<br />
Er ist ein Anwendungsfall des Wiederherstellungsgesuches SchKG 33 IV.<br />
227. *Was ist der Nachträgliche Rechtsvorschlag?<br />
Er kann einem Schuldner gewährt werden, wenn ihm im Laufe der Betreibung neue Einreden<br />
gegen den Anspruch des Gläubigers erwachsen, Einreden, die er innert der ordentlichen<br />
Bestreitungsfrist noch gar nicht hat geltend machen können.<br />
228. Welche Voraussetzungen müssen für einen nachträglichen Rechtsvorschlag<br />
gegeben sein?<br />
SchKG 77<br />
- Es muss nach Ablauf der ordentlichen Bestreitungsfrist ein neuer Tatbestand eingetreten<br />
sein, der dem Schuldner neue Einreden gibt.<br />
- Die Vollstreckung darf noch nicht bis zur Verteilung oder Konkurseröffnung gediehen<br />
sein<br />
- <strong>Der</strong> nachträgliche Rechtsvorschlag muss innert 10 Tagen seit Kenntnis der neuen<br />
Sachlage beim Richter des Betreibungsortes schriftlich und begründet angebracht<br />
werden. Diese Frist beginnt nach der amtlichen Anzeige des neuen Sachverhaltes zu<br />
laufen<br />
229. Was macht der Richter, wenn ein nachträglicher Rechtsvorschlag zugegangen<br />
ist?<br />
Er entscheidet in einem summarischen Verfahren SchKG 25 ob der Rechtsvorschlag zu<br />
bewilligen sei oder nicht. Schon bei Empfang des Rechtsvorschlages kann der die Betreibung<br />
vorläufig einstellen SchKG 77 III. <strong>Der</strong> Schuldner muss die Einrede nur glaubhaft machen<br />
SchKG 77 II. Bewilligt der Richter den Rechtsvorschlag muss der Gläubiger, wenn er mit der<br />
Betreibung fortfahren will auf Anerkennung seiner Forderung klagen SchKG 79, da einfache<br />
Rechtsöffnungsverfahren ist ihm verschlossen. Die Bewilligung des nachträglichen<br />
Rechtsvorschlages wirkt nicht zurück, vorher vollzogene Vollstreckungshandlungen<br />
insbesondere die Pfändung bleiben bestehen. <strong>Der</strong> Gläubiger hat aber eine 10 tägige Frist zur<br />
Anerkennungsklage SchKG 77 IV. Nichteinhalten dieser Frist führt nicht zu Untergang des<br />
Klagerechts sondern bloss zum Hinfall der Pfändung.<br />
37
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
230. Welches sind die Wirkungen des Rechtsvorschlages?<br />
Jeder Rechtsvorschlag wirkt ausschliesslich betreibungsrechtlich: er bringt dem Schuldner die<br />
Einstellung der Betreibung. Bestreiter der Schuldner nur einen Teil der Forderung, so kann<br />
die Betreibung für den Rest der Forderung fortgesetzt werden.<br />
Im Übrigen bleibt die Betreibung so lange gehemmt, als die Wirksamkeit des<br />
Rechtsvorschlages nicht durch gerichtlichen Entscheid aufgehoben wird.<br />
Auch die Unterlassung des Rechtsvorschlages wirkt sich nur betreibungsrechtlich aus. Sie<br />
kann dem Betriebenen nicht als Schuldanerkennung entgegengehalten werden.<br />
§ 21 Die Betreibung eines Ehegatten<br />
23<strong>1.</strong> Welche Regeln gelten für die Betreibung unter Ehegatten?<br />
Dieselben wie für die Betreibung durch einen Dritten ausser:<br />
- Forderungen werden zwar während der Ehe fällig, verjähren aber während der Ehe nicht<br />
OR 134<br />
- Gläubiger-Gatte hat das Vorrecht auf privilegierten Pfändungsanschluss SchKG 111<br />
- Schuldner-Gatte hat ausgenommen für laufende Unterhaltsforderungen gegenüber dem<br />
Gläubiger-Gatte Anspruch auf besondere Zahlungsfristen, wenn ihm die Zahlung<br />
ernstliche Schwierigkeiten bereitet.<br />
232. Wer ist zu betreiben, wenn die Ehegatten in Errungenschaftsbeteiligung oder in<br />
Gütertrennung leben?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner ist allein zu betreiben. Nur im Falle, wo für seine Schuld ein ihm gehörendes<br />
Grundstück verpfändet ist, das als Familienwohnung dient, muss in der Betreibung auf<br />
Pfandverwertung auch der Nichtschuldnerehegatte mitbetrieben werden SchKG 15<strong>1.</strong> Sodann<br />
dürfen Forderungen des Schuldner-Ehegatten gegen seinen Ehegatten erst in letzter Linie<br />
gepfändet werden SchKG 95a.<br />
233. Welchen materiellrechtlichen Verhältnissen muss bei der Betreibung von<br />
Ehegatten in Gütertrennung oder Errungenschaftsbeteiligung Rechnung<br />
getragen werden?<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner haftet mit seinem gesamten Vermögen (Eigengut und Errungenschaft)<br />
persönlich für alle Schulden, die er eingegangen ist und solidarisch für Schulden, die der<br />
andere Ehegatte in Vertretung der ehelichen Gemeinschaft begründet hat.<br />
- <strong>Der</strong> Betrag zur freien Verfügung des Schuldnergatten ist nur für solche Forderungen<br />
pfändbar, die mit dessen erweiterten persönlichen Bedürfnissen zu tun haben.<br />
234. Was kann ein Ehegatte in Gütertrennung/Errungenschaftsb. machen, wenn sein<br />
Vermögenswert zur Vollstreckung herangezogen wurde?<br />
Ihm steht das Widerspruchsverfahren oder im Konkurs die Aussonderung zu.<br />
235. Wie haftet der Schuldnerehegatte bei Gütergemeinschaft?<br />
- Für Vollschulden (Sachen für die Ehegemeinschaft) haftet er mit seinem Eigengut und dem<br />
Gesamtgut<br />
- Für Eigenschulden (für seine individuellen Bedürfnisse) haftet er mit seinem Eigengut und<br />
mit der Hälfte des Wertes des Gesamtgutes SchKG 68b III. Die Pfändung diese Anteils<br />
kommt aber erst zum Zuge, wenn das Eigengut des Schuldners zur Deckung der<br />
Betreibungsforderung nicht ausreicht. Kommt es zur Pfändung des Gesamtgutes, so kann der<br />
Nichtschuldner-Gatte vom Richter die Anordnung der Gütertrennung verlangen SchKG 68b<br />
V. Um diesen komplizierten Weg zu vermeiden kann direkter Zugriff auf das<br />
38
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Erwerbseinkommen des Schuldner-Gatten genommen werden auch ohne vorherige Auflösung<br />
der Gütergemeinschaft SchKG 68b III.<br />
236. Muss der Ehegatte auch mitbetrieben werden?<br />
Nur wenn die Ehegatten in Gütergemeinschaft leben oder, bei Errungenschaftsbeteiligung<br />
oder Gütertrennung, wenn das Grundstück, auf dem die Familienwohnung steht gepfändet<br />
wird. Dann sind alle Betreibungsurkunden auch dem nicht betriebenen Ehegatten zuzustellen.<br />
Er ist dann Mitbetriebener. Er kann als solcher alle Rechte des Betriebenen ausüben SchKG<br />
68a I.<br />
237. Was kann jeder Ehegatte in der Gütergemeinschaft geltend machen, wenn ein<br />
gepfändeter Vermögenswert zum Eigengut des bloss mitbetriebenen<br />
Nichtschuldner-Gatten gehört?<br />
Er kann das im Widerspruchsverfahren geltend machen SchKG 68 I.<br />
238. Welche Folge hat die Konkurseröffnung auf die Gütergemeinschaft der<br />
Ehegatten?<br />
Er hat auf jeden Fall Gütertrennung zur Folge.<br />
5. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Die Rechtsöffnung<br />
§ 19 *Die Rechtsöffnung<br />
239. *Welches ist die Funktion der Rechtsöffnung?<br />
<strong>Der</strong> Rechtsvorschlag des Schuldners verschliesst dem Gläubiger den Betreibungsweg. Die<br />
Betreibung steht still und droht dahinzufallen, wenn sie nicht binnen nützlicher Frist wieder in<br />
Gang gebracht wird. <strong>Der</strong> Verschlossnen Weg muss zu diesem Zweck geöffnet, das Hindernis<br />
beseitigt werden. Dem dient die Rechtsöffnung. Die Initiative dazu liegt beim Gläubiger. Er<br />
bedarf aber der Mitwirkung des Richters. Das nicht nur, wenn die materielle Begründetheit<br />
der Betreibungsforderung zu beurteilen ist, sondern auch dann, wenn bloss ihre<br />
Vollstreckbarkeit bestritten und abzuklären ist.<br />
240. *Was ist der Begriff der Rechtsöffnung?<br />
Es ist die gerichtliche Erlaubnis mit der Betreibung fortzufahren.<br />
24<strong>1.</strong> *Welche Arten der Rechtsöffnung gibt es?<br />
Je nach Urkunden – den sogenannten Rechtsöffnungs- oder Vollstreckungstiteln –, welche der<br />
Gläubiger beizubringen vermag erlangt er eine mehr oder weniger stark wirkende<br />
Rechtsöffnung (bezieht sich nur auf <strong>1.</strong> und 2.):<br />
- Definitive Rechtsöffnung SchKG 80<br />
- Provisorische Rechtsöffnung SchKG 82<br />
- Rechtsöffnung mittels gerichtlicher Klage (Anerkennungsklage)<br />
242. *Was bedeutet Rechtsöffnung im weiteren Sinn?<br />
Damit ist die Anerkennungsklage gemeint. In diesem Fall hat der Gläubiger noch nichts in der<br />
Hand und die Rechtsöffnung im engeren Sinn. (?)<br />
243. *Was bedeutet Rechtsöffnung im engeren Sinn<br />
Definitive Rechtsöffnung und die provisorische Rechtsöffnung. Bei beiden hat der Gläubiger<br />
schon etwas in der Hand. (?)<br />
39
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
244. *Wann muss ein Gläubiger die Anerkennungsklage brauchen?<br />
Wenn ihm keine geeigneten Rechtsöffnungstitel zur Verfügung stehen. Also kein<br />
gerichtliches Urteil oder Urteilssurrogat, das für die definitive Rechtsöffnung gebraucht wird,<br />
noch eine öffentliche Urkunde oder eine Schuldanerkennung, die eine provisorische<br />
Rechtsöffnung ermöglichen würden.<br />
245. Kommt es bei der Anerkennungsklage darauf an, ob eine privatrechtliche<br />
Forderung oder eine öffentlichrechtliche Forderung auf Anerkennung eingeklagt<br />
wird?<br />
Es kommt insoweit darauf an, als bei rein privatrechtlichen Forderungen die Forderung auf<br />
dem ordentlichen Prozessweg geltend gemacht werden muss SchKG 79. Öffentlichrechtliche<br />
Forderungen, für die noch kein Rechtsöffnungstitel besteht, sind im Verwaltungsverfahren<br />
geltend zu machen SchKG 79 I.<br />
246. Muss der Gläubiger, bei Klage auf Anerkennung einer Forderung nachdem er<br />
diesen Titel erhalten hat noch im summarischen Verfahren die Rechtsöffnung<br />
beantragen?<br />
Bei einer privatrechtlichen Forderung:<br />
<strong>Der</strong> Zivilprozess steht im Gegensatz zum bloss summarischen Rechtsöffnungsverfahren<br />
eigentlich ausserhalb der Schuldbetreibung. Da aber seine erfolgreiche Durchführung<br />
ebenfalls Voraussetzung für den Fortgang der Betreibung ist, kann er mit der Rechtsöffnung<br />
verbunden werden. Verlangt der Gläubiger nämlich in diesem Verfahren zugleich die<br />
Rechtsöffnung so erübrigt das Zivilurteil in der Sache noch ein besonderes<br />
Rechtsöffnungsverfahren. Ist das Zivilurteil rechtskräftig, darf der Gläubiger also ohne<br />
weiteres die Fortsetzung der Betreibung verlangen. Auch eine Abstandserklärung des<br />
Schuldners oder einem gerichtlichen Vergleich in diesem Prozess muss die gleiche Wirkung<br />
zukommen wie einem rechtskräftigen Urteil. Stammt das Urteil aber aus einem anderen<br />
Kanton als demjenigen, indem die Betreibung geführt wird, muss dem Schuldner vom<br />
Fortsetzungsbegehren des Gläubigers vorher noch Kenntnis gegeben werden, damit der die<br />
Einrede von SchKG 81 II geltend machen kann, da er die gleichen Einreden haben soll, die<br />
ihm auch im förmlichen Rechtsöffnungsverfahren zustünden. Erhebt er diese Einrede, so<br />
muss vor der Fortsetzung der Betreibung noch ein auf SchKG 81 II beschränktes Mini<br />
Rechtsöffnungsverfahren durchgeführt werden SchKG 79 II.<br />
Bei einer öffentlichrechtlichen Forderung:<br />
Auf Grund eines rechtskräftigen Verwaltungsentscheides kann dann unter den gleichen<br />
Voraussetzungen wie bei einem im ordentlichen Prozessverfahren ergangenen Zivilurteil<br />
ebenfalls ohne anschliessendes Rechtsöffnungsverfahren die Fortsetzung der Betreibung<br />
verlangt werden SchKG 79 I.<br />
247. Wie läuft das Rechtsöffnungsverfahren ab/wo ist es geregelt?<br />
Es ist teils bundesrechtlich geregelt, teils durch das kantonale Prozessrecht:<br />
- es wird nur auf Begehren des Gläubigers eingeleitet. <strong>Der</strong> bestrittene Zahlungsbefehl und<br />
die Urkunde, auf welche das Rechtsöffnungsbegehren gestützt wird, sind dem Richter<br />
vorzulegen ZPO<br />
- Zuständig ist von Bundesrechtswegen der Richter am Betreibungsort SchKG 84 I<br />
- Das Verfahren ist summarisch und kontradiktorisch SchKG 25 Ziff. 2. Es kann<br />
mündlich oder schriftlich sein SchKG 84 II. <strong>Der</strong> Richter soll binnen 5 Tagen seit<br />
Eingang der Vernehmlassung des Schuldners oder nach unbenütztem Ablauf der<br />
Vernehmlassungsfrist entscheiden SchKG 84 II.<br />
40
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Die Rechtsöffnungskosten bestimmen sich nach dem Gebührentarif GebV. Sie bilden<br />
Bestandteil der Betreibungskosten. Prozesskostensicherheiten dürfen keine verlangt<br />
werden.<br />
- Während der Dauer des Rechtsöffnungsverfahrens steht die Frist, welche die<br />
Gültigkeitsdauer des Zahlungsbefehls bestimmt still SchKG 88 II.<br />
- Das Mitwirken an einem Rechtsöffnungsentscheid begründet keine<br />
Unvoreingenommenheit im nachfolgenden Anerkennungsverfahren.<br />
248. *Um geht es beim Rechtsöffnungsentscheid?<br />
Es ist nur darüber zu entscheiden, ob die durch den Rechtsvorschlag gehemmte Betreibung<br />
weitergeführt werden darf oder nicht. <strong>Der</strong> Entscheid lautet also auf Abweisung oder auf<br />
Gutheissung des Begehrens. Über den materiellen Bestand der Betreibungsforderung sagt der<br />
Rechtsöffnungsentscheid im Gegensatz zur Anerkennungsklage nichts aus. Er hat somit<br />
ausschliesslich betreibungsrechtliche Wirkung und auch das nur für die hängige Betreibung.<br />
Im Rechtsöffnungsverfahren einer neuen Betreibung kann deshalb die Einrede der res iudicata<br />
nicht erhoben werden.<br />
249. Welche Rechtsmittel kann man gegen den Rechtsöffnungsentscheid ergreifen?<br />
- die kantonalen Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid bestimmt das kantonale<br />
Prozessrecht<br />
- materielle Einwendungen: die von SchKG 81 (?)<br />
250. Was kann man machen, wenn man mit dem Rechtsöffnungsentscheid nicht zu<br />
frieden ist?<br />
Man kann es im Kanton weiterziehen, wenn es noch eine höhere Instanz gibt und wenn das<br />
kantonale Recht ein Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid enthält. Bei der<br />
definitiven wie auch bei der provisorischen Rechtsöffnung führt wegen ihrer rein<br />
betreibungsrechtlichen Natur nur die StBE ans BGer, falls ihre Voraussetzungen gegeben<br />
sind. Ausgeschlossen ist die Betreibungsrechtliche Beschwerden auf einen<br />
Rechtsöffnungsentscheid da es sich bei der Rechtsöffnung um eine Gerichtssache handelt.<br />
25<strong>1.</strong> Was braucht es, damit ein ausländischer Vollstrechungstitel in der Schweiz<br />
vollstreckt werden kann?<br />
Es bedarf des Equateurs, d.h. einer Vollstreckungserklärung bzw. Vollstreckungsbewilligung<br />
der nach kantonalem Prozessrecht dafür zuständigen Behörde. Bedingung und Verfahren des<br />
Equateurs können in einem Staatsvertrag geregelt sein; bei Fehlen oder Lückenhaftigkeit<br />
eines solchen gilt das IPRG. Es geht hier auch nur um Fragen der Vollstreckbarkeit, deshalb<br />
kann man einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid nur allenfalls mit StBE vors BGer<br />
ziehen.<br />
Zweckmässigerweise sollen Equateur und Rechtsöffnung in einem Verfahren vereinigt<br />
werden, wie es SchKG 81 III seit jeher für ausländische Urteile vorsieht, die aus einem Staat<br />
stammen, mit dem die Schweiz ein Vollstreckungsabkommen abgeschlossen hat. Danach<br />
kann der Gläubiger direkt Betreibung einleiten. Im definitiven Rechtsöffnungsverfahren<br />
erfolgt ja die Anerkennung eines ausländischen Entscheides inzident.<br />
252. *Was ist unter definitiver Rechtsöffnung zu verstehen?<br />
Darunter ist der richterliche Entscheid zu verstehen, der auf Grund eines Vollstreckbaren<br />
Urteils oder eines gleichwertigen anderen vollstreckbaren Titels kantonalen, eidgenössischen<br />
oder ausländischen Rechts die Wirkung des Rechtsvorschlages gegen den Zahlungsbefehl<br />
endgültig beseitigt.<br />
41
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
253. *Was sind alles definitive Rechtsöffnungstitel?<br />
Sie sind in SchKG 80 aufgezählt.<br />
254. *Was ist ein gerichtliches Urteil i.S. SchKG 80 I?<br />
Ein gerichtliches Urteil in diesem Sinne ist jeder Entscheid, der von einem Gericht in<br />
gesetzlichem Verfahren und in gesetzlicher Form über eine Geldforderung (oder<br />
Sicherheitsleistung in Geld) ergangen ist. In Frage kommen nicht nur Endentscheide in der<br />
Hauptsache, sondern auch vorsorgliche Verfügungen sowie Sprüche über Gerichts- und<br />
Parteikosten.<br />
255. *Wann ist ein gerichtlicher Entscheid vollstreckbar?<br />
Wenn er rechtskräftig ist und im Vollstreckungskanton als Vollstreckungstitel anerkannt ist.<br />
Diese Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit sind von Amtes wegen zu prüfen.<br />
256. *Wann ist ein gerichtlicher Entscheid rechtskräftig?<br />
Rechtskräftig sind alle ordnungsgemäss eröffneten gerichtlichen Entscheide, die nicht mehr<br />
mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden können.<br />
257. Was kommt als Vollstrechungstitel i.S. von SchKG 80 I in Frage?<br />
- Bundesurteile (Entscheide verschiedener Gerichte des Bundes)<br />
- Kantonale, gerichtliche Entscheide (die des Vollstreckungskantons aber auch<br />
ausserkantonale Entscheide, also solche aus einem anderen Kanton) Innerhalb eines<br />
Bundes sind die Gliedstaaten verpflichtet Urteile anderer Gliedstaaten wie eigene zu<br />
beurteilen<br />
- Schweizerische Schiedssprüche<br />
- Ausländische gerichtliche Entscheide<br />
- Ausländische Schiedssprüche, wenn keine Ablehnungsgründe in der NYC bestehen<br />
258. Was ist unter „Urteilssurrogate“ zu verstehen?<br />
Darunter sind die nach SchKG den gerichtlichen Urteilen gleichgestellten Urkunden zu<br />
verstehen SchKG 80 II.<br />
259. *Welches sind solche Urteilssurrogat/wo sind sie aufgezählt?<br />
Sie sind in SchkG 80 II aufgezählt.<br />
260. *Welche Verteidigungsmöglichkeiten hat der Schuldner bei der definitiven<br />
Rechtsöffnung?<br />
- Prozessuale Einwände: Diese richten sich gegen die Rechtmässigkeit des<br />
Rechtsöffnungsverfahrens an sich. Mit ihnen wird das Fehlen einer<br />
Prozessvoraussetzung geltend gemacht.<br />
- Materielle Einwände: Mit ihnen stellt der Schuldner die Tauglichkeit der vom Gläubiger<br />
vorgelegten Urkunde als Rechtsöffnungstitel in Frage. Je nach Herkunft des<br />
Rechtsöffnungstitels stehen dem Schuldner mehr oder weniger materielle<br />
Einwendungen zur Verfügung:<br />
o Bei Entscheiden des Bundes oder des Vollstreckungskantons siehe SchKG 81<br />
I. Er könnt sich weiter höchstens darauf berufen, dass gar kein<br />
Rechtsöffnungstitel i.S. SchKG 80 I, II vorliege oder dass der Titel noch nicht<br />
rechtskräftig sei.<br />
o Bei ausserkantonalen Entscheiden siehe SchKG 81 I und 81 II die wesentliche<br />
Erleichterung für den Schuldner hier ist, dass er im Gegensatz zu den<br />
42
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Einwendungen in 81 i diese Einwendungen in 81 II nicht beweisen muss, dies<br />
obliegt dem Gläubiger.<br />
o Bei Ausländischen Entscheiden<br />
� Wo ein Vollstreckungsabkommen besteht Einwendungen von 81 I und<br />
die, die im Vertrag vorgesehen sind<br />
� Wo kein Staatsvertrag besteht Einwendungen von SchKG 81 und jene<br />
aus dem IPRG<br />
26<strong>1.</strong> Was passiert mit dem Rechtsöffnungsgesuch, wenn der Schuldner mit seinem<br />
Einwand Recht hat.<br />
- Bei prozessualen Einwänden wird das Rechtsöffnungsgesuch zurückgewiesen<br />
- Bei materiellen Einwänden wird es abgewiesen<br />
262. *Was ist die Wirkung der definitiven Rechtsöffnung?<br />
Mit dem rechtskräftigen Rechtsöffnungsentscheid ist die hemmende Wirkung des<br />
Rechtsvorschlags eine für alle Mal beseitigt. Die Betreibung kann ohne weiteres ihren<br />
Fortgang nehmen, sobald der Gläubiger das Fortsetzungsbegehren stellt SchKG 88 II. Die<br />
definitive Rechtsöffnung schliesst das Einleitungsverfahren ab. (Da der<br />
Rechtsöffnungsentscheid keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage hat, bleibt dem<br />
Schuldner den betreibungsrechtlichen Rechtsschutz aus materiellrechltichen Gründen<br />
gewahrt.<br />
263. *Welches ist das Besondere am Schweizer Betreibungssystem im Vergleich zu<br />
den anderen Rechtsordnungen?<br />
In allen anderen Rechtsordnungen kann ein Gläubiger, der ein rechtskräftiges Urteil hat, zum<br />
Betreibungsamt und direkt Pfändung…verlangen. In der Schweiz sieht man anhand der<br />
Definitiven Rechtsöffnung, wo ja schon ein Titel vorhanden ist, dass man trotz dass man<br />
einen Titel hat, den Schuldner zuerst betreiben muss…kurz das ganze Verfahren durchführen<br />
muss.<br />
264. Was versteht man unter der provisorischen Rechtsöffnung?<br />
Unter provisorischer Rechtsöffnung versteht man den gerichtlichen Entscheid, der auf Grund<br />
einer schriftlichen Schuldanerkennung die Wirkung des Rechtsvorschlages bloss bedingt<br />
aufhebt, indem er noch die Nachprüfung des materiellen Bestandes der Forderung durch den<br />
ordentlichen Richter vorbehält (Aberkennungsklagen SchKG 83 II). Die Pfändung ist nur<br />
provisorisch und die Vollstreckung darf erst fortgesetzt werden, wenn das Provisorium<br />
beendet, die Rechtsöffnung definitiv geworden ist.<br />
265. *Was ist der Begriff der Schuldanerkennung?<br />
Die Schuldanerkennung stellt eine Willenserklärung dar, wonach sich der Schuldner<br />
vorbehaltlos und unbedingt zur Bezahlung eines bestimmten oder leicht bestimmbaren<br />
Geldbetrages zu bestimmter Zeit verpflichtet.<br />
266. Was kommt nach SchKG 82 I als Schuldanerkennung in Betracht?<br />
Danach kommt nur eine verurkundete Schuldanerkennung (öffentliche oder Privaturkunde) in<br />
Betracht. Sie ist bloss ein Beweismittel; dadurch unterscheidet sie sich vom vollstreckbaren<br />
gerichtlichen Entscheid, der eine autoritative Feststellung über den Forderungsbestand enthält.<br />
267. *Wieso konnte das Bundesgericht zur Klärung Einheitlichkeit, was genau alles<br />
unter „Schuldanerkennung“ fallen sollt nicht viel beitragen?<br />
43
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Da sie nicht eine zivilrechtliche Sache darstellt und somit nur mit StBE ans Bundesgericht<br />
gebracht werden kann.<br />
268. Welche Formen müssen die Schuldanerkennungen haben?<br />
Es kommen nur schriftliche Schuldanerkennungen in Frage SchKG 82 I<br />
- Die Verpflichtungserklärung kann in einer öffentlichen Urkunde enthalten sein. Auch<br />
eine ausländische öffentliche Urkunde taugt als provisorischer Rechtsöffnungstitel.<br />
- Oder in einer Privaturkunde<br />
269. Wann gilt eine Urkunde als öffentliche Urkunde?<br />
Als solche gilt jede Urkunde, die von der zuständigen Urkundeperson in gesetzlicher Form<br />
abgefasst ist. Das Verfahren der öffentlichen Beurkundung bestimmt das kantonale Recht.<br />
Auch behördliche Protokolle, insbesondere der Gerichte kommen in Betracht. Vermutung der<br />
Richtigkeit muss mit Nachweis der Unrichtigkeit umgestossen werden.<br />
270. Was fällt alles unter „Privaturkunde“?<br />
Alle von den Parteien privat aufgesetzten Schriftstücke, wie Briefe…sie eignen sich aber nur<br />
wenn sie die Unterschrift des Schuldners oder seines Vertreters tragen SchKG 82 I. Bestreiter<br />
der Schuldner ihre Richtigkeit, muss sie der Gläubiger beweisen.<br />
27<strong>1.</strong> Welche Arten der Schuldanerkennung gibt es?<br />
- Es kommen alle Urkunden über eine einseitige Verpflichtung zu einer Geldzahlung in<br />
Betracht<br />
- Die zweiseitigen Rechtsgeschäfte, in denen Verpflichtungen zu einer Geldzahlung<br />
enthalten sind<br />
- Betreibungsrechtliche Ausfallbescheinigungen →sind Urteilssurrogate (der definitive<br />
Pfändungsverlustschein und der Pfandausfallschein/der Konkursschein nur, wenn der<br />
Gemeinschuldner die Forderung im Konkursverfahren persönlich anerkannt hat.<br />
Das Zahlungsversprechen des Schuldners muss sich nicht notwendig aus einer einzigen<br />
Urkunde ergeben; es kann auch aus einer Gesamtheit von Urkunden hervorgehen<br />
(Forderungsbetrag muss aber bestimmbar sein/bedingungslos zu zahlen)<br />
272. Welche Verteidigungsmöglichkeiten hat der Schuldner bei der provisorischen<br />
Rechtsöffnung?<br />
- Prozessuale Einwände: die Gleichen wie bei der definitiven Rechtsöffnung<br />
- Materielle Einwände: Alle Einwendungen, welche die Schuldanerkennung als solche<br />
entkräfte können SchKG 82 II. Er muss die materiellen Einwendungen anders als bei der<br />
definitiven Rechtsöffnung hier nur glaubhaft machen. <strong>Der</strong> Schuldner hat Einwände<br />
gegen Schuld (auch materiellrechtlich: Verjährung, Verrechnung…) und gegen die<br />
Anerkennung (gegen da Papier z.B. mangelnde Handlungsfähigkeit bei Unterschrift,<br />
Sittenwidrigkeit wegen Drohung…)<br />
273. Was passiert je nachdem mit dem Rechtsöffnungsgesuch, wie erfolgreich der<br />
Schuldner sich verteidigt hat/hat er weiter Möglichkeiten, wenn das Gesuch<br />
abgelehnt wird?<br />
Dringt der Schuldner mit seiner Verteidigung durch, ist das Rechtsöffnungsgesuch<br />
abzuweisen. Dem Gläubiger steht dann nur noch der ordentliche Prozessweg mit der<br />
Anerkennungsklage offen. Gelingt es dem Schuldner hingegen nicht bleibt ihm nur noch die<br />
Aberkennungsklage SchKG 83 II.<br />
44
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
274. Welche Verfahrensläufe kann es geben, bis eine provisorische Rechsöffnung<br />
definitiv wird?<br />
Gläubiger verlangt nach SchKG 82 I provisorische Rechtsöffnung<br />
Schuldner macht glaubhaft,<br />
dass keine Schuld besteht<br />
SchKG 82 II<br />
Gelingt Schuldner nicht<br />
→provisorische Rechtsöffnung 82 II<br />
Schuldner kann die kantonalen Rechtsmittel gegen<br />
den Entscheid des Richters geltend machen<br />
Gelingt es dem Schuldner nicht<br />
→provisorische Rechtsöffnung<br />
Schuldner kann Aberkennungsklage machen<br />
(! RÖ muss dafür rechtskräftig sein d.h. es<br />
müssen alle ordentlichen kantonalen<br />
Rechtsmittel ausgeschöpft sein)<br />
Klage abgewiesen<br />
→provisorische Rechtsöffnung<br />
Schuldner kann kantonale<br />
Rechtsmittel dagegen erheben<br />
Geht das nicht<br />
Berufung ans BGer möglich<br />
Kein Erfolg →aus der provisorischen<br />
Rechtsöffnung wird eine definitive<br />
Schuldner macht nichts<br />
Gläubiger erhält vorerst<br />
provisorische<br />
Rechtsöffnung, die dann zur<br />
definitiven wird<br />
Es gelingt Schuldner<br />
→keine provisorische<br />
Rechtsöffnung<br />
45
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
275. Was heisst „glaubhaft machen“?<br />
Das heisst, dass ein Einwand vor dem Richter mit liquiden Beweismitteln wahrscheinlich zu<br />
machen ist.<br />
276. Auf was zielt die Klage ab?<br />
Wie die Anerkennungsklage ist sie materiellrechtlicher Natur und zielt auf die Frage des<br />
Bestehens oder des Nichtbestehens eines materiellrechtlichen Anspruchs ab. Die<br />
Aberkennungsklage ist eine negative Feststellungsklage.<br />
277. Welches sind die Wirkungen der provisorischen Rechtsöffnung?<br />
- die Einstellung der Betreibung wird nur bedingt aufgehoben, indem dem Schuldner<br />
vorbehalten wird innert 20 Tagen sie Anerkennungsklage zu erheben SchKG 83 II.<br />
Durch die Einreichung der Klage wird der Schwebezustand bloss provisorischer<br />
Rechtsöffnung aufrechterhalten.<br />
- Vollstreckungsmassnahmen sind vorerst ausgeschlossen. <strong>Der</strong> Gläubiger kann aber nach<br />
Ablauf der Zahlungsfrist auch wenn der Schuldner die Aberkennungsklage eingereicht<br />
hat fordern:<br />
o Provisorische Pfändung, wenn der Schuldner der Pfändungsbetreibung<br />
unterleigt SchKG 83 I dies kann er auch, wenn der Schuldner die<br />
Aberkennungsklage eingereicht hat.<br />
o Von einem konkursfähigen Schuldner kann die Aufnahme eines<br />
Güterverzeichnisses verlangt werden SchKG 83 I<br />
- Volle Wirkung erlangt der Rechtsöffnungsentscheid erst, wenn der Schuldner nicht<br />
rechtzeitig auf Aberkennung klagt, oder wenn seine Klage abgewiesen wurde und das<br />
Zivilurteil rechtskräftig geworden ist. Dann fällt das Provisorium dahin und die<br />
Rechtsöffnung wird definitiv und äussert alle Wirkungen einer solchen. Dasselbe gilt für<br />
eine provisorische Pfändung SchKG 83 III.<br />
278. *Was kann der Schuldner mit der Aberkennungsklage erreichen?<br />
- Verlängerung des ledig provisorischen Charakters der Rechtsöffnung<br />
- Überprüfung der materiellen Rechtslage im ordentlichen Gerichtsverfahren<br />
279. Wie lange ist die Klagefrist?<br />
Die Klage ist 20 Tage nach der Rechtsöffnung beim Gericht einzureichen SchKG 83 II.<br />
Massgebend für den Fristbeginn ist die formelle Rechtskraft des Rechtsöffnungsentscheides<br />
(Faustregel). Die Frist ist aber trotz Verwirkungsfrist verlänger- und wiederherstellbar.<br />
Verwirkung der Klagefrist berührt das materielle Recht nicht. Dem Schuldner wird nach wie<br />
vor Schutz aus materiellrechtlichen Gründen gewährt (SchKG 85, 85a, 86).<br />
280. Wie läuft das Verfahren der Aberkennungsklage?<br />
Sie wird im ordentlichen Verfahren nach kantonalem Zivilrecht beurteilt. Gerichtsstand ist am<br />
Betreibngsort SchKG 83 II (streitig manche sagen Norm nicht zwingend daher kann es auch<br />
nach GestG bestimmt werden).<br />
28<strong>1.</strong> *Wo liegt die Beweislast bei der Aberkennungsklage?<br />
Beim Gläubiger, er muss beweisen, dass der Anspruch besteht.<br />
282. Welche Wirkung hat das Urteil der Anerkennungsklage?<br />
Es hat volle materielle Rechtskraft. Seine Wirkung beschränkt sich somit nicht auf die<br />
hängige Betreibung. <strong>Der</strong> letztinstanzliche kantonale Entscheid kann bei gegebenen<br />
46
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Voraussetzungen – als Zivilrechtssache – mit Berufung oder Nichtigkeitsbeschwerden ans<br />
BGer weitergezogen werden.<br />
283. Welche Folgen hat das rechtskräftige Urteil für das Betreibungsverfahren?<br />
- Abweisung der Klage lässt die provisorische Rechtsöffnung definitiv werden/Gläubiger<br />
kann Fortsetzung der Betreibung verlangen<br />
- Gutheissung der Klage erledigt die Betreibung endgültig.<br />
284. *Wann kann der Schuldner erst die Aberkennungsklage machen?<br />
Wenn die provisorische Rechtsöffnung rechtskräftig geworden ist. Das Wort „rechtskräftig“<br />
wurde in SchKG 83 II vergessen. Rechtskräftig ist die provisorische Rechtsöffnung wenn die<br />
kantonalen Rechtsmittel gebraucht wurden oder wenn die Frist für ihre Geltendmachung<br />
abgelaufen ist.<br />
285. *Warum nützt es dem Schuldner auch wenn er weiss, dass er mit der<br />
Aberkennungsklage keine Chance hat eine solche geltend zu machen?<br />
Weil während des Verfahrens die provisorische Rechtsöffnung bestehen bleibt und damit<br />
natürlich eine allfällige provisorische Pfändung auch nur provisorisch ist. Mit diesem<br />
Verfahren kann er Zeit gewinnen, da man ja nichts Verwerten kann um sich Geld zu<br />
beschaffen.<br />
286. *Wann kann man das Verwertungsbegehren stellen?<br />
Erst bei definitiver Pfändung.<br />
287. *Wer hat bei der Aberkennungsklage die Beweislast?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger. Die Tatsache, dass der Schuldner Kläger ist ändert nichts daran, dass im<br />
Endeffekt der Gläubiger der ist, der etwas will, nämlich, dass die Schuld besteht. Es sind<br />
einfach die Parteirollen vertauscht.<br />
288. *Welche Art von Klage ist die Aberkennungsklage?<br />
Eine negative Feststellungsklage.<br />
6. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: <strong>Der</strong> Schutz des Schuldners aus materiellrechtlichen Gründen<br />
§20 <strong>Der</strong> Schutz des Schuldners aus materiellrechtlichen Gründen<br />
289. Welche besonderen Schutzvorkehrungen gibt es für den Schuldner, wenn er was<br />
verpasst?<br />
Wenn der Schuldner verpasst:<br />
- rechtzeitig Recht vorzuschlagen und er auch die Wiederherstellung der Frist nicht erhält<br />
SchKG 33 IV<br />
- wenn er im Rechtsöffnungsverfahren seine Einrede vorzubringen versäumt oder wenn er<br />
diese wegen des summarischen Verfahrens nicht durchzusetzen vermag<br />
- wenn er die Frist für die Aberkennungsklage unbenützt verstreichen lässt<br />
In diesen Fällen gewährt das Gesetz dem Schuldner folgende besondere Schutzvorkehrungen:<br />
- die Aufhebung oder Einstellung der Betreibung durch den Vollstreckungsrichter auf<br />
Antrag des Schuldners (SchKG 85)<br />
- die Klage auf Feststellung der Nichtschuld oder Stundung beim ordentlichen Gericht<br />
SchKG 85a<br />
- die betreibungsrechtliche Rückforderungsklage SchKG 86, 187<br />
47
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
290. Was stellen diese Schutzvorkehrungen dar?<br />
Sie sind Korrektive für die sachlich nicht gerechtfertigten Folgen der Formstrenge des<br />
Betreibungsverfahrens.<br />
29<strong>1.</strong> Wieso amtet der Richter bei SchKG 85 als Vollstreckungsrichter und nicht als<br />
Zivilrichter?<br />
Weil er nur über die Zulässigkeit der Betreibung entscheidet. <strong>Der</strong> Bestand der<br />
Betreibungsforderung (oder ihre Fälligkeit) ist nur materielle Vorfrage über die er auch dann<br />
befinden kann, wenn sie an und für sich eine andere Zuständigkeit fiele (z.B. wie bei<br />
öffentlichrechtlichen Ansprüchen).<br />
292. Was sind die Voraussetzungen von SchKG 85?<br />
Schuldner muss nachweisen, dass die Schuld samt Zinsen und Kosten<br />
- gestundet oder<br />
- getilgt ist.<br />
- Dieser Nachweis kann nur mit Urkunde erbracht werden<br />
293. Was kann der Schuldner machen, wenn er keine taugliche Urkunde hat?<br />
- Feststellungsklage nach SchKG 85a<br />
- Oder den Gläubiger zu befriedigen und das Geleistete dann auf dem Vollstreckungsweg<br />
wieder zurückzufordern SchKG 86<br />
294. Was für eine Art Verfahren ist das Verfahren von SchKG 85?<br />
Ein Summarisches Verfahren SchKG 25 Ziff. 2.<br />
295. In welchem Stadium der Betreibung kann das Verfahren von SchKG 85<br />
durchgeführt werden?<br />
Das Verfahren kann jederzeit und in jedem Stadium der Betreibung durchgeführt werden. Nur<br />
nach Verteilung des Verwertungserlöses oder nach der Konkurseröffnung kommt es nicht<br />
mehr in Frage.<br />
296. Welche Wirkungen hat ein Entscheid nach SchKG 85?<br />
Ein solcher Einstellungs- oder Aufhebungsentscheid hat ausschliesslich betreibungsrechtliche<br />
Wirkung. Unterliegt der Schuldner hat er immer noch die Feststellungs- oder die<br />
Rückforderungsklage (SchKG 85a; 86); obsiegt er kann der Gläubiger immer noch mit der<br />
Forderungsklage gegen ihn vorgehen. Weil es ein rein vollstreckungsrechtlicher Entscheid ist<br />
kann er nur mit StBE vors Bundesgericht gebracht werden.<br />
297. Welche Rechtsnatur hat die Feststellungsklage nach SchKG 85a?<br />
Die Klage bezweckt als materiellrechtliche Klage wie die Aberkennungsklage die<br />
Feststellung der Nichtschuld bzw. der Stundung. Sie hat aber auch wie die Klage nach SchKG<br />
85 eine unmittelbare betreibungsrechtliche Wirkung, indem der Richter mit ihrer Gutheissung<br />
die Betreibung einstellt oder aufhebt. Wegen der materiellen und der Betreibungsrechtlichen<br />
Wirkung, die diese Klage hat sagt man sie weise eine Doppelnatur auf.<br />
298. In welchem Stadium der Betreibung kann diese Klage (SchKG 85a) erhoben<br />
werden?<br />
Erst wenn der Zahlungsbefehl rechtskräftig geworden ist. Diese Feststellungsklage dient also<br />
nur als Notbehelf. Ausgeschlossen ist die Feststellungsklage in der Wechselbetreibung wegen<br />
der formellen Wechselstrenge.<br />
48
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Weiter kann er die Klage nur geltend machen, solange die Betreibung noch nicht<br />
abgeschlossen oder dahingefallen ist d.h. die Verteilung noch nicht erfolgt bzw. der Konkurs<br />
nicht eröffnet ist. Fehlt das ist die Klage zurückzuweisen.<br />
299. Wann ist der Zahlungsbefehl rechtskräftig?<br />
Er ist rechtskräftig:<br />
- wenn der Schuldner die Zahlungsfrist verstreichen lässt, ohne zu zahlen und ohne Recht<br />
vorzuschlagen SchKG 69 I Ziff. 2, 88 I<br />
- wenn ihm ein nachträglicher Rechtsvorschlag verweigert wird SchKG 77<br />
- wenn er seinen Rechtsvorschlag zurückzieht<br />
- wenn der Gläubiger definitiv Rechtsöffnung erlangt hat<br />
300. Ist diese materiell wirkende Feststellungsklage (SchKG 85) auch nach definitiver<br />
Rechtsöffnung zulässig?<br />
Ja. Aber bei ihrer Beurteilung muss gegebenenfalls die res iudicata Wirkung eines definitiven<br />
Rechtsöffnungstitels beachtet werden (Da dieses Urteil ja auch materielle Wirkung hat und es<br />
unglaubwürdig erscheinen würde, wenn ein Gericht 2x über die gleiche Sache (Bestehen der<br />
Forderung oder nicht) entscheiden würde.<br />
30<strong>1.</strong> Was darf der Schuldner bei der Feststellungsklage nach SchKG 85 nur<br />
vorbringen (wegen res iudicata), wenn ein def. Rechtsöffnungstitel in Form eines<br />
gerichtlichen Entscheides oder einer Verwaltungsverfügung zugrunde liegt?<br />
- Einreden aus dem gerichtlichen Entscheid selbst<br />
- Echt nova (d.h. Einreden, die erst nach der Rechtskraft des Entscheides entstanden sind)<br />
Nur gegenüber einem gerichtlichen Vergleich oder einer Abstandserklärung kann er auch<br />
Einwendungen vorbringen, welche die Entstehung der Forderung betreffen.<br />
302. Welche Art Verfahren ist für die Feststellungsklage 85a SchKG vorgesehen?<br />
Es handelt sich um einen ordentlichen aber beschleunigten Zivilprozess SchKG 85a IV.<br />
303. Wer kann die Feststellungsklage nach SchKG 85a geltend machen?<br />
Nur der Schuldner als Betriebener. Nicht als Betriebener i.S. v. SchKG 85a gilt ein<br />
Drittpfandbesteller.<br />
304. Hat die Klage nach SchKG 85a Aufschiebende Wirkung?<br />
Nein, die Betreibung läuft trotz Anhebung der Klage weiter. <strong>Der</strong> Richter muss als vorsorglich<br />
eingreifen, um zu verhindern, dass die Klage wegen fortgeschrittener Vollstreckung<br />
gegenstandslos wird.<br />
305. Was bedeutet „sehr wahrscheinlich begründet“ in SchKG 85a II?<br />
Das heiss, dass die Prozesschance des Schuldners deutlich besser erscheinen muss als die des<br />
Gläubigers.<br />
306. Ist der Entscheid von SchKG 85a ans BGer weiterziehbar?<br />
Ja mit Berufung oder Nichtigkeitsbeschwerde, da es sich um eine Zivilrechtsstreitigkeit<br />
handelt.<br />
307. Lässt sich ein zu unrecht Betriebener die Sachen pfänden weil er sowieso die<br />
Rückforderungsklage anstrengen kann?<br />
Nein, er zahlt besser das Geld und verlangt es dann per Rückforderungsklage zurück. Lässt er<br />
seine Sachen versilbern bekommt er nur das Geld zurück, das für die Gegenstände erhalten<br />
49
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
wurde. Man bekommt aber Gegenstände immer viel weniger Geld als sie Wert haben und<br />
deshalb würde er so einen Verlust machen.<br />
308. Wieso leistet ein Schuldner besser ans Betreibungsamt als auf irgendein Konto?<br />
Weil das Betreibungsamt wenn die Zahlung kommt das Fortsetzungsbegehren des Gläubigers<br />
verweigert.<br />
309. Welcher Klage des OR ist die Rückforderungsklage nachgebildet/Unterschied zu<br />
dieser Klage?<br />
Sie ist der Bereicherungsklage nach OR 62 nachgebildet und dort ausdrücklich vorbehalten.<br />
Beide Klagen haben gemeinsam:<br />
- Bezahlung eines nicht geschuldeten Betrages<br />
Im Gegensatz zur Klage im OR wo die freiwillige und irrtümliche Zahlung vorausgesetzt wird<br />
muss hier keinen Grund angegeben werden, wieso gezahlt wurde.<br />
310. Kann die Rückforderungsklage auch zum Zuge kommen, wenn der<br />
Rechtsvorschlag durch Rechtsöffnung beseitigt wurde?<br />
Ja, aber es kommt darauf an in welcher Weise die Rechtsöffnung erteilt wurde.<br />
Wurde die Rechtsöffnung aufgrund der Anerkennungsklage erteilt darf die<br />
Rückforderungsklage nicht gemacht werden, da diese Klage eine materiellrechtliche Klage ist<br />
und deshalb die Einrede der res iudicata dem entgegen steht.<br />
Erfolgt die Rechtsöffnung aufgrund einer definitiven Rechtsöffnung ist die<br />
Rückforderungsklage möglich, da die definitive Rechtsöffnung bloss in einem summarischen<br />
Verfahren ablief und der Schuldner nicht die Möglichkeit hatte, alle Einwände zu bringen.<br />
Erfolgt die Rechtsöffnung aufgrund einer provisorischen Rechtsöffnung ist sie die<br />
Rückforderungsklage auch möglich.<br />
31<strong>1.</strong> Um welche Art von Streitigkeit handelt es sich bei der Rückforderungsklage?<br />
Es handelt sich um eine materiellrechtliche Streitigkeit.<br />
312. Wer hat die Beweislast bei der Rückforderungsklage?<br />
<strong>Der</strong> Betriebene.<br />
313. Was bewirkt das gutgeheissene Urteil von SchKG 86?<br />
Es bewirkt eine restitutio in integrum. <strong>Der</strong> Gläubiger wird darin zur Rückzahlung des vom<br />
Schuldner geleisteten verurteilt.<br />
314. Kann der letztinstanzliche kantonale Entscheid vors BGer weiter gezogen<br />
werden?<br />
Ja, da es sich um eine Zivilrechtsstreitigkeit handelt.<br />
7. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Das Pfändungsverfahren<br />
5. Kapitel: Die Durchführung der Betreibung auf Pfändung<br />
§22 Das Pfändungsverfahren<br />
315. *In welchen Stadien Wickelt sich die Vollstreckung im engeren Sinne ab?<br />
- in demjenigen der Pfändung<br />
- der Verwertung<br />
- und der Verteilung<br />
50
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
316. Was berechtigt zur eigentlichen Vollstreckung?<br />
<strong>Der</strong> rechtskräftige Zahlungsbefehl<br />
317. Wann kann der Gang der Vollstreckung trotz Rechtskraft des Zahlungsbefehls<br />
(zumindest vorläufig) wieder gehemmt werden?<br />
Z.B. durch Wiederherstellung der Frist zum Rechtsvorschlag oder zur Aberkennungsklage.<br />
Ausserdem bleiben dem Schuldner die Schutzbehelfe aus materiellrechtlichen Gründen<br />
vorbehalten SchKG 85, 85a.<br />
318. Wann wird die Betreibung auf dem Weg der Betreibung auf Pfändung<br />
fortgesetzt?<br />
Wenn der Schuldner nicht der Konkursbetreibung unterliegt oder wenn es sich um eine<br />
Forderung i.S. von SchKG 43 handelt und die Forderung nicht pfandgesichert ist.<br />
319. Was heisst Pfändung?<br />
Pfändung heisst amtliche Beschlagnahme einzelner Vermögenswerte des Schuldners zur<br />
Verwendung als Vollstreckungssubstrat. Beschlagnahme muss nicht immer zugleich<br />
physische Wegnahme der betroffenen Vermögenswerte bedeuten. Es ist ein Hoheotsakt.<br />
320. Wird das Vollstreckungsverfahren von Amtes wegen durchgeführt?<br />
Nein nur auf ausdrückliches Begehren des Gläubigers.<br />
32<strong>1.</strong> *Welche Voraussetzungen müssen für das Fortsetzungsbegehren gegeben sein?<br />
- ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl (zwei Ausnahmen)<br />
- Gläubiger muss einige Fristen beachten, auf die selbst der Schuldner nicht verzichten<br />
kann<br />
o Vor Ablauf von 20 Tagen seit Zustellung des Zahlungsbefehls darf nichts<br />
unternommen werden; das ist die gesetzliche Zahlungsfrist, die dem Schuldner<br />
ungestört belassen bleiben soll. (Auch einem Pfändungsbegehren auf<br />
provisorische Pfändung ist erst nach dieser Frist stattzugeben). Einem<br />
verfrühten Begehren kann erst nach dieser Frist stattgegeben werden.<br />
o <strong>Der</strong> Pfändungsanspruch muss innerhalb eines Jahres seit Zustellung des<br />
Zahlungsbefehls geltend gemacht werden, sonst verwirkt dieses Recht: <strong>Der</strong><br />
Zahlungsbefehl verliert seine Gültigkeit und die Betreibung fällt dahin (SchKG<br />
88 II)<br />
322. Welche Form muss das Fortsetzungsbegehren haben?<br />
Es ist formlos gültig. Sicherheitshalber ist anzuraten das amtliche Formular dafür zu<br />
brauchen.<br />
323. Muss dem Fortsetzungsbegehren etwas beigelegt werden?<br />
- <strong>Der</strong> Zahlungsbefehl, wenn er von einem anderen Amt ausgestellt wurde als demjenigen,<br />
bei dem um Pfändung ersucht wird<br />
- Wenn der Rückzug des Rechtsvorschlags auf dem Zahlungsbefehl vermerkt ist muss er<br />
immer beigelegt werden<br />
- Ein allfälliger Gerichtsentscheid<br />
- Rechtskraftsbescheinigung für den Rechtsöffnungsentscheid ausser die Rechtskraft gäbe<br />
sich klar aus Gesetz.<br />
51
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
324. An wen muss das Fortsetzungsbegehren gerichtet werden?<br />
An das am Betreibungsort zuständige Betreibungsamt. Ein am falschen Betreibungsamt<br />
abgegebenes Begehren wird von Amtes wegen weiter geleitet. Einem neu zuständigen<br />
Betreibungsamt muss der Gläubiger aber des Original des ihm gemäss SchKG 70 zugestellten<br />
Doppels des Zahlungsbefehls vorlegen.<br />
325. Darf das Fortsetzungsbegehren Bedingungen enthalten?<br />
Nein, es muss eindeutig und unbedingt sein.<br />
326. Was passiert, wenn der Gläubiger länger als 1 Jahr mit dem<br />
Fortsetzungsbegehren gewartet hat?<br />
Er muss wieder von vorne anfangen und eine Betreibung einleiten SchKG 88 II.<br />
327. *Wer ist für die Pfändung zuständig?<br />
Sachlich obliegt der Vollzug der Pfändung dem Betreibungsamt SchKG 89.<br />
Bezüglich der örtlichen Zuständigkeit ist zu unterscheiden:<br />
- Die Pfändung anordnen kann immer nur das Amt, welches die Betreibung führt, also<br />
das Amt des Betreibungsortes<br />
- Sie durchführen darf hingegen ausschliesslich das Amt am Ort der gelegenen Sache<br />
SchKG 4 II. Liegen einzelne Vermögenswerte ausserhalb des Betreibungskreises muss<br />
das die Betreibung führende Amt das auswärtige Amt mit dem eigentlichen<br />
Pfändungsvollzug beauftragen sog. Requisitionspfändung SchKG 89.<br />
328. *Als an welchem Ort gelegen bezeichnet man Wertpapiere und Forderungen?<br />
- Wertpapiere werden wie Sachen am Ort wo sie liegen gepfändet.<br />
- Forderungen die nicht in Wertpapieren verkörpert sind, werden als da gelegen<br />
angeschaut, wo der Wohnsitz des Gläubigers der Forderung ist.<br />
- Rechte an Immaterialgüter sind am Wohnsitz oder Sitz des Berechtigten zu pfänden<br />
329. *Was passiert mit einer Pfändung, wo die Zuständigkeitsordnung missachtet<br />
wurde?<br />
Sie wäre nichtig.<br />
330. *Welche Rechte und Pflichten hat der Gläubiger im Pfändungsverfahren?<br />
- Er hat die Kosten des Pfändungsvollzuges sowie der Aufbewahrung und des Unterhalts<br />
gepfändeter Vermögenswerte vorzuschiessen SchKG 68 I und 105.<br />
- Am Vollzug der Pfändung nimmt der Schuldner nicht teil; er darf aber das Amt auf<br />
Vermögenswerte des Schuldners hinweisen und die Pfändung dieser verlangen (das<br />
kann er auf dem Fortsetzungsbegehren unter der Rubrik „Bemerkungen“ anbringen).<br />
33<strong>1.</strong> *Welches sind die Rechte und Pflichten des Schuldners?<br />
Recht des Schuldners:<br />
- Die Pfändung muss ihm spätestens am Vortag mit genauer Zeitangabe angekündigt<br />
werden. Die Mitteilung muss ihn auch auf seine Pflichten im Pfändungsverfahren<br />
aufmerksam machen SchKG 90.<br />
Pflichten des Schuldners:<br />
- Er oder sein Vertreter muss der Betreibung persönlich beiwohnen SchKG 91 Ziff. 1<br />
- Er muss dem pfändenden Beamten jede für eine erfolgreiche Pfändung erforderliche<br />
Auskunft erteilen SchKG 92 I Ziff. 1<br />
- Schliesslich sind dem Betreibungsbeamten auf Verlangen Räume und Behältnisse zu<br />
öffnen SchKG 91 III.<br />
52
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
332. *Wieso muss der Schuldner bei der Pfändung anwesend sein?<br />
Es wird eine Pfändungsurkunde aufgenommen und er soll sagen welche Gegenstände ihm<br />
gehören, ob er noch Sachen bei einem Dritten hat und welche Forderungen gegen Dritte hat.<br />
333. *Was ist ein Signifikanter Unterschied zwischen dem deutschen und dem<br />
Schweizerischen Recht bezüglich der gepfändeten Sache?<br />
In Deutschland bekommt der Gläubiger selbst ein Pfandrecht an der Sache und kann sie auf<br />
Grund dessen verwerten.<br />
In der Schweiz erhält der Gläubiger nicht selbst ein Pfandrecht an der Sache, er kann sich nur<br />
beim Amt beschweren, wenn es die gepfändete Sache nicht verwertet.<br />
334. *Was ist eine klassische Forderung, die ein Schuldner gegen einen Drittschuldner<br />
hat und die täglich gepfändet wird?<br />
<strong>Der</strong> Lohn.<br />
335. Was kann der Schuldner machen, wenn ihm die Pfändung nicht angekündigt<br />
wurde?<br />
- Wurde die Ankündigung unterlassen und wohnte der Schuldner (oder sein Vertreter) der<br />
Pfändung nicht bei, kann er die Gültigkeit der mit Beschwerde anfechten<br />
- War der Schuldner oder sein Vertreter aber zufälligerweise da, wird der Mangel geheilt<br />
336. Was sind die Sanktionen, wenn der Schuldner seine Pflichten im<br />
Pfändungsverfahren nicht erfüllt?<br />
Er macht sich strafbar. Verheimlicht der Schuldner Bestandteile seines Vermögens kann der<br />
Gläubiger ausserdem sofort ohne vorgängige Konkursbetreibung beim Gericht die<br />
Konkursöffnung verlangen SchKG 190 I Ziff. <strong>1.</strong> Bleibt der Schuldner ohne genügende<br />
Entschuldigung der Pfändung fern kann das Betreibungsamt ihn durch die Polizei vorführen<br />
lassen.<br />
337. Welche Recht und Pflichten haben Dritte im Pfändungsverfahren?<br />
Dritte können insoweit von einer Pfändung betroffen sein, als sich in ihrem Gewahrsam<br />
Vermögenswerte des Schuldners befinden, die für eine genügende Pfändung herangezogen<br />
werden müssen.<br />
Diese Dritte haben die Pflicht, dem Betreibungsamt Auskunft zu geben, Räume und<br />
Behältnisse zu öffnen und allenfalls deren zwangsweise Öffnung zu dulden SchKG 91 IV.<br />
Auch Behörden sind wie Dritte in gleicher Weise wie der Schuldner auskunftspflichtig<br />
SchKG 91 V.<br />
338. *Was passiert, wenn etwas von einem Dritten gepfändet wird und der Schuldner<br />
sagt nicht, dass es einem Dritten gehört?<br />
<strong>Der</strong> Dritte kann das im Widerspruchsverfahren geltend machen.<br />
339. *Was passiert mit einer Sache die der Schuldner als einem Dritten gehörig<br />
bezeichnet?<br />
<strong>Der</strong> Beamte kann die Sache trotzdem pfänden, er muss sich aber eine Notiz machen SchKG<br />
95 III.<br />
340. Welche Vorschriften sind beim Vollzug des Pfändungsaktes zu beachten?<br />
- die Reihenfolge, in der die einzelnen gesetzlichen Vermögenswerte zu pfänden sind<br />
- das Ausmass der Pfändung<br />
53
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- die Form des Vollzugs<br />
- die Sicherung der Pfändungsrechte<br />
34<strong>1.</strong> *In welcher Reihenfolge muss gepfändet werden?<br />
Das Betreibungsamt soll bei der Auswahl des Pfändungsgutes nach Möglichkeit die<br />
Interessen der Betreibungsparteien und die der betroffenen Dritten berücksichtigen SchKG 95<br />
V. <strong>Der</strong> Entscheid über die Reihenfolge der Pfändung ist insoweit Ermessenssache.<br />
SchKG 95 I-IV stellt aber Richtlichtlinien auf. Diese sind aber nicht absolut verbindlich<br />
SchKG 95 IV bis . Zuletzt werden Forderungen des betriebenen Schuldners gegen seinen<br />
Ehegatten gepfändet SchKG 95a.<br />
342. *In welchem Ausmass darf gepfändet werden?<br />
Es darf nicht mehr gepfändet werden, als zur Befriedigung der betreibenden Gläubiger samt<br />
Zinsen und Kosten benötigt wird SchKG 97 II. Das bedingt eine Schätzung der gepfändeten<br />
Gegenstände; unter Umständen wird hierzu ein Sachverständiger beigezogen SchKG 97 I. Die<br />
Schätzung und damit auch die von ihr abhängige Bestimmung des Ausmasses der Pfändung<br />
ist im wesentlichen Ermessenssache. Ihre Unterlassung macht aber die Pfändung nicht<br />
ungültig. Die Schätzung kann aber auf Beschwerde hin oder von Amtes wegen nachgeholt<br />
werden.<br />
343. *Welche Gegenstände dürfen gepfändet werden?<br />
Alles, was einen Verkehrswert hat kann gepfändet werden. Es gibt aber ein paar Gegenständ,<br />
die nicht gepfändet werden dürfen SchKG 92.<br />
344. *Was kann wer machen, wenn zuviel gepfändet wurde?<br />
Gegen eine Überpfändung SchKG 97kann sich neben dem Schuldner ausnahmsweise auch ein<br />
Dritter, der ein eigenes Recht an der gepfändeten Sache beansprucht, beschwerden SchKG 17<br />
(Ermessensbeschwerden).<br />
345. Wie kann sich der Gläubiger wehren, wenn er findet es sei für die Deckung<br />
seiner Forderung viel zu wenig gepfändet worden?<br />
Er kann eine Beschwerde nach SchKG 17 machen (Ermessensbeschwerde).<br />
346. *Wie wird der Pfändungsakt vollzogen?<br />
<strong>Der</strong> Pfändungsakt wird durch ausdrückliche Pfändungserklärung gegenüber dem Schuldner<br />
oder seinem Vertreter vollzogen SchKG 96 I. Sie enthält:<br />
- die Eröffnung, dass einzeln genau bezeichnete Vermögenswerte gepfändet sind<br />
- das ausdrückliche Verbot bei Strafdrohung, ohne Bewilligung des Betreibungsamtes<br />
über sie zu verfügen<br />
Diese Pfändungserklärung ist konstituierendes Element der Pfändung.<br />
347. Können bei einer Pfändung Vermögensgesamtheiten gepfändet werden?<br />
Nein, es gilt das Spezialitätsprinzip sonst ist die Pfändung wirkungslos.<br />
348. *Kann die Pfändung bedingt ausgesprochen werden?<br />
Grundsätzlich nicht, aber bedingte Pfändung ist in einem Ausnahmefall zulässig. Ein an sich<br />
unpfändbarer Gegenstand von besonders hohem Wert darf nämlich nur unter der Bedingung<br />
gepfändet werden, dass der Gläubiger dem Schuldner an Stelle des teuren Kompetenzstückes<br />
eine gleichartige Sache von geringerem Wert als Ersatz oder den zur Anschaffung nötigen<br />
Geldbetrag zur Verfügung stellt SchKG 92 III.<br />
54
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
349. Wann ist die Pfändung rechtswirksam vollzogen?<br />
Mit der Beschlagnahmeerklärung des Betreibungsamtes.<br />
350. *Welche Vorkehren zur Sicherung des Pfändungsgutes können nötigenfalls<br />
getroffen werden?<br />
- Geld, Inhaber- und Orderpapiere werden sowie Wertsachen in amtliche Verwahrung<br />
genommen SchKG 98 I und 9.<br />
- Andere bewegliche Sachen können nach Ermessen des Amtes gegen die Verpflichtung<br />
sie jederzeit zur Verfügung zu halten vorerst da gelassen werden wo sie sind SchKG 98<br />
II oder die können einem anderen Dritten in Verwahrung gegeben oder selber in<br />
Verwahrung genommen werden SchKG 98 III.<br />
- Bei der Pfändung von gewöhnlichen Forderungen, insbesondere auch von<br />
Lohnguthaben, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig und<br />
nur noch an das Betreibungsamt leisten könne SchKG 99. Fällige Forderungen sind<br />
ungesäumt einzuziehen SchKG 100.<br />
- Die Pfändung eines Grundstückes wird dem Grundbuchamt zur Vormerkung der<br />
Verfügungsbeschränkung im Grundbuch unverzüglich mitgeteilt SchKG 101 I.<br />
- Die Pfändung eines Nutzniessungsrechts oder eines Anteilsrechts an einem<br />
Gemeinschaftsvermögen wird den beteiligten Dritten angezeigt SchKG 104.<br />
- Gepfändete Ansprüche des Schuldners aus Personenversicherungen werden nach den<br />
Vorschriften der VPAV gesichert.<br />
- Auch dem Sachversicherer zeigt das Betreibungsamt die Pfändung an und weist ihn<br />
darauf hin, dass er eine allfällige Ersatzleistung nur gültig an das Betreibungsamt<br />
ausrichten kann.<br />
- Vieh das der Schuldner zu warten ablehnt, kann das Betreibungsamt sofort verkaufen<br />
oder bei einem Dritten zur Wartung einstellen<br />
35<strong>1.</strong> *Welche Wirkungen hat die Pfändung auf die Rechtsstellung des Schuldners?<br />
- Schuldner bleibt bis zur Verwertung Eigentümer der gepfändeten Vermögenswerte<br />
- Sein Verfügungsrecht wird aber in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht stark<br />
beschränkt SchKG 96 I (Verfügungsverbot).<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner bleibt aber voll handlungsfähig, so dass er über das Pfändungsgut<br />
zivilrechtlich gültig Rechtsgeschäfte abschliessen kann. Diese Verfügungen sind aber<br />
betreibungsrechtlich ungültig soweit dadurch die den Gläubigern aus der Pfändung<br />
erwachsenen Rechte beeinträchtigt werden; auf solche Verfügungen wird bei der<br />
Verwertung keine Rücksicht genommen SchKG 96 II. Nötigenfalls wird das veräusserte<br />
Pfändungsgut mit polizeilicher Hilfe wieder zur Stelle gebracht. In jedem Fall bleibt<br />
aber der gutgläubige Erwerb von Rechten am Pfändungsgut vorbehalten SchKG 96 II.<br />
Das Verfügungsverbot erstreckt sich auch auf Bestandteile und Zugehör des<br />
Grundstückes<br />
352. *Welche Wirkung hat die Pfändung auf die Rechte des Gläubigers?<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger erhält mit der Pfändung einen öffentlichrechtlichen Anspruch darauf, das<br />
Pfändungsgut zu seinen Gunsten verwerten zu lassen SchKG 116.<br />
- Er kann daher zur Sicherung die amtliche Verwahrung gepfändeter beweglicher Sachen<br />
verlangen<br />
- Er kann gegen einen Drittansprecher auf eine gepfändete Sache im<br />
Widerspruchsverfahren als Partei auftreten<br />
353. Kann eine Forderung durch einen gutgläubigern Dritten erworben werden?<br />
Nein, bei Forderungen gibt es gar keinen Erwerb durch gutgläubige Dritte.<br />
55
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
354. Welche Wirkungen hat die Pfändung auf die Rechtsstellung Dritter?<br />
Eine Pfändung kann sich in verschiedener Hinsicht auch auf Drittpersonen auswirken:<br />
- Sie kann Gegenstände erfassen, an denen ein Dritter eigene Rechte beansprucht, die der<br />
Pfändung vorgehen oder sie ausschliessen. Solche Rechte kann der Dritte im<br />
Widerspruchsverfahren verteidigen oder durch Beschwerde.<br />
- Dritte können auch als Erwerber von Pfändungsgut betroffen sein.<br />
- Drittschuldner können sich durch Zahlung an das Betreibungsamt von ihrer<br />
Schuldpflicht befreien SchKG 99 und Drittverwahrer gepfändeter Sachen dürfen den<br />
Schuldner nicht mehr darüber verfügen lassen.<br />
355. Welcher Inhalt hat die Pfändungsurkunde?<br />
Die Pfändung muss vom vollziehenden Beamten in einem Protokoll verurkundet werden<br />
SchKG 112 I. Diese Pfändungsurkunde ist auf amtlichem Formular. Welchen Inhalt sie<br />
enthalten muss steht in SchKG 112.<br />
356. Wer bekommt alles eine Pfändungsurkunde zugestellt?<br />
- Nach Ablauf der Teilnahmefrist SchKG 110 erhalten alle Pfändungsgläubiger und der<br />
Schuldner unverzüglich je eine Abschrift der Pfändungsurkunde SchKG 114.<br />
- Sie wird in Form der einfachen Mitteilung zugestellt<br />
- Besonders wichtig ist die Zustellung der Pfändungsurkunde an den Schuldner, wenn er<br />
bei der Pfändung weder anwesend noch vertreten war; dann unterliegt er dem<br />
Verfügungsverbot erst von diesem Zeitpunkt an.<br />
357. Was ist die Rechtsnatur der Pfändungsurkunde?<br />
Sie ist eine öffentliche Urkunde.<br />
358. Welches sind die Wirkungen der Pfändungsurkunde?<br />
Sie schafft den Beweis für die vorgenommene Pfändung. Nur die in der Urkunde<br />
bezeichneten Gegenstände gelten als gepfändet und unterliegen demzufolge der<br />
Verfügungsbeschränkung. Nur sie können später auch verwertet werden.<br />
Im Übrigen sind die Wirkungen der Pfändungsurkunde verschieden, je nach dem Ergebnis des<br />
Pfändungsvollzuges<br />
- Wurde kein pfändbares Vermögen vorgefunden, bleibt die Pfändungsurkunde leer. So<br />
gilt die zugleich als definitiver Verlustschein SchKG 115 I i.V.m. 149. Voraussetzung<br />
zur Ausstellung eines provisorischen oder endgültigen Verlustscheines ist aber immer<br />
eine definitive Pfändung.<br />
- War nach der Schätzung des Pfändungsbeamten nicht genügend Vermögen vorhanden,<br />
um die Forderung samt Zinsen und Kosten zu decken, so dient die Pfändungsurkunde<br />
dem Gläubiger als provisorischer Verlustschein. Dadurch wird der Gläubiger zur<br />
Anfechtungsklage und zum Arrest berechtigt und er kann die Nachpfändung verlangen<br />
359. Wer muss das Pfändungsgut unterhalten?<br />
Das Betreibungsamt soweit es nicht dem Schuldner zur Verfügung und Bewirtschaftung<br />
überlassen bleibt.<br />
360. Wann darf das Pfändungsgut noch während der Verwaltung bevor der<br />
Gläubiger berechtigt ist die Verwertung zu verlangen verwertet werden?<br />
SchKG 124:<br />
- auf Begehren des Schuldners SchKG 124 I<br />
- wenn die Voraussetzungen eines Notverkaufs vorliegen SchKG 124 II<br />
56
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
36<strong>1.</strong> Welche Aufgaben hat das Betreibungsamt im Rahmen seiner<br />
Verwaltungstätigkeit?<br />
Es muss in erster Linie das Pfändungsgut erhalten<br />
- Es muss die Zahlung auf fällige Forderungen erheben SchKG 100 es muss aber nicht<br />
selbst die Betreibung für solche Forderungen einleiten<br />
- Es muss Erträgnisse einziehen soweit sie nicht allfälligen Pfandgläubigern zustehen<br />
SchKG 102 I, 103 I<br />
Es muss die Verwaltung gepfändeter Grundstücke vornehmen da es bei diesen auch schon<br />
länger geht, bis sie verwertet werden dürfen (VZG 16-22, SchKG 102, 103)<br />
- Grundpfandgläubigern, Mietern und Pächtern wird die Pfändung des Grundstückes<br />
mitgeteilt SchKG 102 II. Miet- und Pachtzinse können nur noch befreiend an das<br />
Betreibungsamt geleistet werden<br />
- Die Bewirtschaftung kann das Betreibungsamt weiter dem Schuldner überlassen oder<br />
einen Dritten beiziehen. Dieser handelt als Hilfsperson des Betreibungsamtes.<br />
- Sind ausserordentliche Verwaltungsmassnahmen erforderlich muss das Betreibungsamt<br />
das Einverständnis der Beteiligten oder die Weisung der Aufsichtsbehörde einholen.<br />
362. Wie werden die aus der Bewirtschaftung und Verwaltung des Pfandgutes<br />
fliessenden Erträgnisse verwendet?<br />
- Vorweg sind die Verwaltungskosten und Auslagen zu decken. Reichen die Erträgnisse<br />
dazu nicht aus kann das Betreibungsamt vom Gläubiger einen Kostenvorschuss<br />
verlangen SchKG 105<br />
- Ist der Schuldner bedürftig, wird aus dem Ertrag der Unterhalt des Schuldners und<br />
seiner Familie bestritten SchKG 103 II. Massgebend dafür ist das betreibungsrechtliche<br />
Existenzminimum<br />
- Erst ein allfälliger Ertragsüberschuss wird zur Befriedigung der Ansprüche der<br />
beteiligten Pfand- und Pfändungsgläubiger verwendet. Können deren Forderungen<br />
daraus gedeckt werden nimmt das Betreibungsamt die Schlussverteilung vor und<br />
schliesst die Betreibung ab.<br />
363. Wieso wird das Pfändungsgut nicht direkt nach der Pfändung verwertet?<br />
- Man will dem Schuldner noch eine weitere Möglichkeit geben das Geld aufzutreiben<br />
- Man braucht die Zeit um die Vorbereitung der Verwertung vorzunehmen<br />
§25 Die Anschlusspfändung<br />
364. Was ist charakteristisch für die Spezialexekution?<br />
Die Begünstigung des betreibenden Gläubigers (Prioritätsprinzip). Es ist aber dadurch<br />
gemildert, dass in gewissem Rahmen die gleichmässige Teilnahme mehrer<br />
Betreibungsgläubiger an ein und derselben Pfändung ermöglicht wird. Das ist zum Beispiel<br />
bei der Anschlusspfändung der Fall.<br />
365. Was ist typisch für die Generalexekution?<br />
Die Konkurrenz sämtlicher Gläubiger eines Schuldners, die gemeinsam und gleichzeitig, in<br />
der Regel anteilsmässig, Befriedigung aus dem Erlös des gesamten Schuldnervermögens<br />
fordern (Gleichbehandlung). <strong>Der</strong> Grundsatz der Gleichbehandlung ist aber teilweise<br />
durchbrochen von Privilegien, die gewisse Gruppen von Gläubigern bevorzugen SchKG 219<br />
IV.<br />
57
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
366. Welche zwei Arten der Anschlusspfändung gibt es?<br />
- es gibt eine ordentliche, die jedem Gläubiger offen steht SchKG 110<br />
- und eine privilegierte, die nur von bestimmten Gläubigern und nur für bestimmte<br />
Forderungen beansprucht werden kann SchKG 11<strong>1.</strong><br />
367. Welche Voraussetzungen braucht die ordentliche Anschlusspfändung?<br />
SchKG 110:<br />
- Vollzug einer Hauptpfändung<br />
- Es müssen gegen den Schuldner aus weiteren Betreibungen weitere<br />
Fortsetzungsbegehren vorliegen (Pfändungsanschluss ohne ausdrückliches<br />
Fortsetzungsbegehren gibt es nur in einem Ausnahmefall: <strong>Der</strong> Gläubiger, der einen<br />
Arrest erwirkt hat und dessen Arrestgegenstände für einen anderen Gläubiger gepfändet<br />
werden, bevor er selber das Fortsetzungsbegehren stellen kann, nimmt von Gesetzes<br />
wegen an dieser Pfändung teil.)<br />
- Wahrung der Anschlussfrist, denn nur Fortsetzungsbegehren, die binnen 30 Tagen seit<br />
dem Vollzug der Hauptpfändung gestellt werden, führen zum Pfändungsanschluss. Die<br />
Anschlussfrist läuft unabhängig davon, ob der Anschlussberechtigte von der Pfändung<br />
Kenntnis erhalten hat.<br />
- Anschlussverfügung. Das Betreibungsamt muss den Anschluss des hinzutretenden<br />
Gläubigers noch ausdrücklich vollziehen, sei es durch eine Ergänzungspfändung SchKG<br />
110 I Satz 2 oder wo das nicht notwendig ist durch blosse Mitteilung der Teilnahme an<br />
die Parteien. In beiden Fällen erfolgt ein Nachtrag auf der Pfändungsurkunde SchKG<br />
113<br />
368. *Was ist der Unterschied zwischen der ordentlichen Anschlusspfändung und<br />
dem Konkurs?<br />
Man kann bei der ordentlichen Anschlusspfändung nicht einfach anrufen und sagen, man<br />
schliesse sich an, sondern nur der, der das Einleitungsverfahren absolviert hat „Gläubiger, die<br />
das Fortsetzungsbegehren innert 30..“ SchKG 110 I können sich anschliessen.<br />
Die Ausnahmen bilden die Gläubiger, die einen Verlustschein haben, die können nach SchKG<br />
149 III während 6 Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl<br />
die Betreibung fortsetzen.<br />
Weiter, die Arrestgläubiger, deren Arrestgegenstände von einem anderen Gläubiger gepfändet<br />
werden, die nehmen provisorisch an der Pfändung teil SchKG 281 I.<br />
369. Wer haftet für den Schaden eines Gläubigers, wenn die Anschlussverfügung<br />
versäumt wurde?<br />
<strong>Der</strong> Staat SchKG 5 ff.<br />
370. Welche Gläubiger bilden welche Pfändungsgruppen?<br />
Sämtliche Gläubiger, die während der Anschlussfrist das Fortsetzungsbegehren stellen, bilden<br />
mit dem ersten zusammen eine Pfändungsgruppe SchKG 110 I.<br />
Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach der Anschlussfrist stellen, bilden eine<br />
weitere Gruppe mit gesonderter Pfändung SchKG 110 II.<br />
37<strong>1.</strong> Wie wird der Erlös innerhalb der Gruppe verteilt?<br />
Es besteht innerhalb der Gruppe insofern Gleichberechtigung, als die für die Gruppe<br />
gepfändeten Vermögensobjekte zugunsten aller Gruppengläubiger verwertet und der Erlös<br />
sowie die Verwertungskosten im Verhältnis ihrer Forderungsbeträge unter sie verteilt werden.<br />
Im Falle ungenügender Deckung greift die konkursrechtliche Rangordnung Platz.<br />
58
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
372. Wer kann in der Pfändungsgruppe die Rechte geltend machen?<br />
Jeder Gläubiger wahrt trotz Gruppenzugehörigkeit seine Rechte selber (Regel der<br />
individuellen Rechtswahrung). Rechtshandlungen die er vornimmt, wirken nur für oder gegen<br />
ihn selbst. Die Pfändungsgruppe ist keine Interessensgemeinschaft. Jeder Gläubiger kann den<br />
Pfändungsanschluss eines Konkurrenten mit Beschwerde anfechten und dessen Forderung mit<br />
der Kollokationsklage bestreiten.<br />
373. Welche Ausnahmen von der Regel der individuellen Rechtswahrung gibt es?<br />
- Das Verwertungsbegehren eines Gläubigers wirkt für alle Teilnehmer der Gruppe<br />
SchKG 117 I.<br />
- Jede Änderung der Pfändung auf Beschwerde eines Gläubigers hin wirkt zugunsten aller<br />
Gruppengläubiger<br />
374. *Was ist die Ergänzungspfändung?<br />
Können die Forderungen einer Gruppe nicht gedeckt werden (Gegenstände fallen heraus<br />
→Widerspruchsverfahren/weitere Gläubiger kommen hinzu) muss die bestehende Pfändung<br />
erweitert werden. Diese Erweiterung der ersten Pfändung nennt man Ergänzungspfändung.<br />
Sie ist von Amtes wegen vorzunehmen. Diese Ergänzungspfändungen finden unmittelbar vor<br />
oder nach Ablauf der Teilnahmefrist statt. Sie ist keine rechtlich selbständige Pfändung<br />
sondern bloss eine Ausdehnung der Hauptpfändung. Daher kann an der Ergänzungspfändung<br />
kein neuer Gläubiger mehr teilnehmen und ihr Vollzug löst keine neue Anschlussfrist aus.<br />
375. Weshalb wird die Pfändungsurkunde erst 30 Tage nach der Pfändung die<br />
Pfändungsurkunde zugestellt SchKG 114<br />
Das ist wegen der Ergänzungspfändung, dass allenfalls noch weitere Objekte in der Urkunde<br />
nachträglich angefügt werden können.<br />
376. Was ist die Nachpfändung?<br />
SchKG 145. Sie erfolgt erst nach Ablauf der Anschlussfrist und hat selbständigen Charakter.<br />
Sie ist selber wieder eine Hauptpfändung und löst infolge dessen ihrerseits Anschlussfristen<br />
aus SchKG 145 III. Sie ist von Amtes wegen vorzunehmen z.B. wenn sich das<br />
Betreibungsamt verschätzt hat und zu wenig gepfändet hat. Die Unterlassung der durch die<br />
Umstände gebotenen Nachpfändung kann als Rechtsverweigerung mit Beschwerde gerügt<br />
werden.<br />
377. *Was passiert, wenn nach Ablauf der Anschlussfrist weitere Gläubiger den<br />
Schuldner betreiben?<br />
Es können wie die erste Gläubigergruppe je weitere Gruppen gebildet werden SchKG 110 II,<br />
da die Gläubiger, die nach Ablauf der Ausschlusspflicht hinzukommen nicht in die vorherige<br />
Gruppe einsteigen können. Die Rechtsstellung der Gläubiger untereinander ist gleich wie in<br />
der ersten Gruppe Die verschiedenen Gruppen sind von einander unabhängig. Für jede<br />
einzelne Gruppe besteht eine gesonderte Pfändung. Diese Unabhängigkeit gilt auch<br />
hinsichtlich der Verwertung und der Verteilung des Erlöses unter die Gruppengläubiger. Die<br />
Pfändung für den Mehrerlös ist aber möglich SchKG 110 III d.h. wenn in der ersten<br />
Gläubigergruppe alle Gläubiger befriedigt wurden und es noch einen Rest gibt, kann dieser<br />
wieder von der nächsten Gläubigergruppe gepfändet werden.<br />
378. *Was ist die Voraussetzung, dass es überhaupt eine 2. Gläubigergruppe geben<br />
kann?<br />
Es muss noch etwas pfändbares vorhanden sein.<br />
59
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
379. Wie können Gläubiger der einen Gruppe die Rechte der Gläubiger der anderen<br />
Gruppe anfechten?<br />
Nur mit Beschwerde.<br />
380. Welches Vorrecht geniessen die Teilnehmer der Privilegierten<br />
Anschlusspfändung?<br />
- Für sie beträgt die Anschlussfrist 40 anstatt nur 30 Tage SchKG 111 I<br />
- Sie dürfen sich ohne vorgängige Betreibung der Hauptpfändung ihrer Konkurrenten<br />
anschliessen<br />
38<strong>1.</strong> An welche Voraussetzungen ist das Anschlussprivileg geknüpft?<br />
- Persönliche: es steht einzig den in SchKG 111 I abschliessend aufgezählten Personen zu<br />
- Sachliche: nur für ganz bestimmte Forderungen SchKG 111<br />
382. Wie muss das Anschlussprivileg geltend gemacht werden?<br />
- Durch Anschlusserklärung. <strong>Der</strong> privilegierte Pfändungsanschluss muss ausdrücklich als<br />
solcher verlangt werden. In der Anschlusserklärung sind ausdrücklich der Betrag und<br />
der Entstehungsgrund der Forderung anzugeben. Das Privileg wird nicht von Amtes<br />
wegen berücksichtigt. Sie ist formlos. Zur abgabe der Anschlusserklärung sind noch alle<br />
in SchKG 111 II aufgezählten Personen berechtigt.<br />
- Zeitlich ist die Geltendmachung des Anschlussrechts in doppelter Weise beschränkt:<br />
o Die Anschlusspfändung muss innert 40 Tagen seit dem Vollzug der<br />
Hauptpfändung abgegeben werden SchKG 111 I. Das Betreibungsamt teilt den<br />
bekannten Anschlussberechtigten den Vollzug einer Hauptpfändung mit<br />
SchKG 111 III.<br />
o Bestimmte in SchKG 111 II aufgezählte Personen können den privilegierten<br />
Anschluss nur an eine Pfändung verlangen, die während des ehelichen oder<br />
vormundschaftlichen Verhältnisses oder doch noch innerhalb eines Jahres seit<br />
dessen Wegfall vollzogen wurde SchKG 111 II und zwar nur für eine<br />
Forderung, die noch vor Wegfall entstanden ist. Als qualifiziert Frist kann<br />
diese Jahresfrist weder verlängert noch wiederhergestellt werden.<br />
383. Kann der privilegierte Anschluss, wie der ordentliche Anschluss durch<br />
Anschlussverfügung des Betreibungsamtes hergestellt werden?<br />
Nein, es braucht ein Anschlussverfahren.<br />
384. Wer braucht warum Schutz vor Missbrauch bei der privilegierten<br />
Anschlusspfändung?<br />
Es braucht einen doppelten Schutz vor Missbrauch:<br />
- der Schuldner bracht Schutz, da er keine Gelegenheit hat seine Rechte geltend zu<br />
machen (anders als wenn ein Einleitungsverfahren stattfinden würde).<br />
- Die anderen Gläubiger, da sie dann das Pfändungssubstrat mit noch mehr Leuten teilen<br />
müssen<br />
<strong>Der</strong> Schutz garantiert SchKG 111 IV.<br />
385. Wer kann den Anschluss bestreiten?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner und die anderen Gläubiger.<br />
386. Wann ist man einfacher, wann notwendiger Streitgenosse?<br />
Notwendige Streitgenossen sind sie, wenn beide nur gemeinsam Recht oder Unrecht haben<br />
können und nicht der eine teilweise Recht hat und der andere nicht.<br />
60
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
387. Was passiert, wenn der Gläubiger und der Schuldner bestritten haben?<br />
Beide sind Beklagte. Sie sind notwendige Streitgenossen.<br />
388. In welchen Stadien wickelt sich das Anschlussverfahren ab?<br />
- In einem Vorverfahren, worin die Betroffenen (die anderen Gläubiger und der<br />
Schuldner) zur Anschlusserklärung Stellung nehmen können<br />
- Im Anschlussprozess, in welchem nötigenfalls gerichtlich über den bestrittenen<br />
Anschluss entschieden wird.<br />
389. Wie und von wem wird das Vorverfahren eingeleitet?<br />
Es wird vom Betreibungsamt eingeleitet, indem es dem Schuldner und den übrigen<br />
Gläubigern von der Anschlusserklärung Kenntnis gibt SchKG 34 und ihnen gleichzeitig 10<br />
Tag Frist einräumt um den angemeldeten Anspruch zu bestreiten SchKG 111 IV.<br />
Nichtbestreiten binnen der Frist gilt als Anerkennung des Anspruchs. <strong>Der</strong> Anschlussgläubiger<br />
nimmt dann definitiv neben den anderen Gruppengläubigern an der an der Pfändung teil.<br />
390. Was passiert, wenn jemand den Anspruch bestreitet?<br />
Die Bestreitung durch den Schuldner oder ein anderer Gläubiger bewirkt, dass der<br />
Anschlussgläubiger:<br />
- vorderhand nur provisorisch an der Pfändung Teil nimmt und demzufolge einstweilen<br />
nicht berechtigt ist, das Verwertungsbegehren zu stellen; inzwischen laufen dafür aber<br />
die Fristen auch nicht SchKG 111 V und 118.<br />
- Binnen 20 Tagen beim Gericht Klage auf Zulassung des Anschlusses erheben muss,<br />
wenn er verhindern will dass seine Teilnahme endgültig verloren geht. Die rechtzeitig<br />
erhobene Klage hält die provisorische Teilnahme bis zum rechtskräftigen Abschluss des<br />
Prozesses aufrecht SchKG 111 V. Unterlassung der Klage bedeutet Verzicht auf den<br />
privilegierten Anschluss.<br />
39<strong>1.</strong> Wie/wo läuft das Verfahren des Anschlussprozesses?<br />
- Die Klage auf Zulassung des privilegierten Anschlusses richtet sich immer gegen den<br />
Bestreitenden sie es der Schuldner, ein Gläubiger oder seien es beide.<br />
- Die Klagefrist ist Verwirkungsfrist, ihre Einhaltung ist Prozessvoraussetzung; doch ist<br />
sie verlänger- und wiederherstellbar. Sie läuft von der Mitteilung der Bestreitung an<br />
- Streitwert bestimmt sich entweder nach dem Betrag der bestrittenen Forderung oder<br />
nach dem geringeren Wert der gepfändeten Gegenstände bzw. dem geringeren<br />
Prozessgewinn<br />
- <strong>Der</strong> Gerichtsstand liegt am Betreibungsort SchKG 111 V. Im Übrigen kommt die<br />
kantonale ZPO zur Anwendung, bundesrechtlich ist nur das beschleunigte Verfahren<br />
vorgeschrieben SchKG 111 V.<br />
392. Was ist Gegenstand der gerichtlichen Beurteilung?<br />
Gegenstand der gerichtlichen Beurteilung bilden sowohl der Bestand und Umfang der<br />
Forderung des Anschlussgläubigers als auch die Voraussetzung des Anschlussprivilegs.<br />
Das Gericht hat zu entscheiden ob der privilegierende Anschluss für die geltend gemachte<br />
Forderung in der laufenden Betreibung zu gewähren sei oder nicht. Das ist eine<br />
betreibungsrechtliche Frage, bei der Vorfrageweise materielles Zivilrecht anzuwenden ist.<br />
393. ***Welche Wirkung hat das Urteil?<br />
- Gutheissung der Anschlussklage erlaubt dem Ansprecher definitiv an der Pfändung<br />
teilzunehmen<br />
61
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Abweisung der Klage lässt die provisorische Teilnahme des Ansprechers dahinfallen<br />
Das Urteil wirkt grundsätzlich nur in der hängigen Betreibung. Sie ist eine<br />
betreibungsrechtliche Frage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht. Doch nur wenn<br />
der Gläubiger gegen den Anschliessenden klagt*. Ist der Schuldner der, der die<br />
Forderung bestreitet, hat das Urteil rein materielle Wirkung und schafft die rem<br />
iudicatem. <strong>Der</strong> Prozess zwischen Ansprecher und Gläubiger hat keine rem iudicatem<br />
Wirkung.<br />
394. *Wem kommt ein Prozessgewinn, gegen ein privilegiert anschliessender zugute?<br />
- Bestritt es der Schuldner kommt er allen Gläubigern zugute<br />
- Bestritt es ein Gläubiger, kommt er nur dem Gläubigern zu Gute, die am Prozess<br />
teilgenommen haben (Lohn der Angst)<br />
395. Kann das Urteil and BGer weitergezogen werden?<br />
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann es ans BGer weiter gezogen werden und zwar<br />
mit Berufung oder Nichtigkeitsbeschwerde.<br />
8. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Gegenstand der Pfändung<br />
§23 <strong>Der</strong> Gegenstand der Pfändung<br />
396. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Gegenstand pfändbar<br />
ist?<br />
- Es muss rechtlich dem Schuldner gehören. Behauptet der Schuldner oder ein Dritter,<br />
dass der Gegenstand ihm gehöre, darf er erst in letzter Linie gepfändet werden (?)<br />
SchKG 95 III. Die Abklärung der rechtlichen Zugehörigkeit erfolgt dann im<br />
Widerspruchsverfahren. Die Pfändung von Gegenständen, die offensichtlich einem<br />
Dritten gehören ist nichtig. Fiduziarisches Eigentum darf gepfändet werden; dem<br />
Fiduzianten muss aber das Widerspruchsverfahren offen stehen.<br />
- Die Gegenstände müssen verkehrsfähig und gegen Geld veräusserbar sein.<br />
- Die Pfändung darf nicht durch eine Vorschrift des Bundesrechtes ausgeschlossen sein.<br />
Unpfändbarkeit kraft kantonalem Recht oder auf Grund privater Vereinbarung wäre<br />
dagegen unbeachtlich.<br />
397. Was passiert mit der Pfändung eines der Natur nach nicht verwertbaren<br />
Vermögensstückes?<br />
Sie wäre nichtig.<br />
398. Was ist der Unterschied in der Versilberung zwischen dem italienischen und dem<br />
Schweizerrecht (Frage <strong>Vorlesung</strong>)?<br />
In Italien kann der Gläubiger direkt Gegenstände von S übernehmen. In der Schweiz nicht,<br />
die Sachen müssen verkauft werden (ausser im Konkurs gibt es Ausnahmen).<br />
399. Wann ist ein nicht Kompetenzstück trotz gegebenen Verkehrswertes nicht<br />
pfändbar?<br />
Wenn wegen der hohen Verwatlungs- und Verwertungskosten nur ein geringer Reinerlös zu<br />
erwarten ist. Er muss aber mit seinem Schätzungswert in der Pfändungsurkunde vorgemerkt<br />
werden SchKG 92 II.<br />
62
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
400. Welche Gegenstände haben z.B. keinen verkehrswert?<br />
- Blosse Familienandenken: Briefe, Geschäftsbücher, Diplome, Ausweise…ausser es<br />
handelt sich um Sachen mit künstlerischem oder historischem Wert<br />
- Weil unveräusserlich: alle höchstpersönlichen Rechte: z.B. Wohnrecht, Blut und Organe<br />
- Weil nicht in Geld schätzbar: Anwartschaften…<br />
40<strong>1.</strong> Wie wird bestimmt ob und inwiefern ein Vermögenswert unpfändbar sei?<br />
Das hat der Betreibungsbeamte zu entscheiden er muss sich aber an die gesetzlichen<br />
Schranken halten.<br />
402. Kann der Schuldner auf die Geltendmachung der Unpfändbarkeit verzichten?<br />
Nur insofern, als dass er gegen eine vollzogene Pfändung nicht Beschwerde führt SchKG 17<br />
ff. An einen Verzicht im Voraus wäre er nicht gebunden. <strong>Der</strong> Verzicht auf die Anfechtung ist<br />
aber nichtig, wenn ein Nichtigkeitsgrund i.S. von SchKG 22 vorliegt.<br />
Selbst der gültige Verzicht wirkt nur im hängigen Betreibungsverfahren. In einem neuen<br />
Verfahren könnte sich der Schuldner wieder auf die Unpfändbarkeit berufen.<br />
403. Auf was beruht die Unpfändbarkeit von Vermögenswerten?<br />
Auf moralischen, sozialen und wirtschaftlichen Gründen oder auf ihrer besonderen Natur oder<br />
Zweckbestimmung.<br />
404. Wieso sind einige Gegenstände aus moralischen, sozialen und wirtschaftlichen<br />
Gründen unpfändbar?<br />
Das Lebensnotwendige und eine gewisse Lebensqualität müssen dem Schuldner verbleiben.<br />
Die Kompetenzstücke = Notwendigstes müssen dem Schuldner gelassen werden.<br />
405. Wie bestimmt sich, was als Kompetenzstück in Betracht kommt?<br />
Das sagt das Gesetz. <strong>Der</strong> Beamte muss aber in jedem Einzelfall von Amtes wegen abklären<br />
und entscheiden, ob ein bestimmter Gegenstand im Zeitpunkt der Pfändung für den Schuldner<br />
Kompetenzeigenschaft hat.<br />
406. Wann kann ein Kompetenzstück bedingt gepfändet werden?<br />
Wenn es einen hohen Wert hat. Dann steht dem Gläubiger das Auswechslungsrecht zu<br />
SchKG 92 III.<br />
407. Was fällt unter die Unpfändbarkeit aus moralischen, sozialen und<br />
wirtschaftlichen Gründen?<br />
- Das Kompetenzgut der Hausgemeinschaft. Darunter fällt alles, was der Schuldner für<br />
sich und seine Familie in der Hausgemeinschaft benötigt. Familie umfasst alle, die mit<br />
dem Schuldner in einem Haus, Wohnung…wohnen.<br />
o Zum persönlichen Gebrach dienendes SchKG 92 I Ziff. 1<br />
o Eine bestimmte Anzahl Haustiere SchKG 92 I Ziff. 4 soweit zur Ernährung<br />
oder Aufrechterhaltung des Betriebes des Schuldners nötig.<br />
o Für 2 Monate notwendige Nahrungs- und Feuerungsmittel oder das Geld zur<br />
Anschaffung dessen SchKG 92 I Ziff. 5<br />
o Tiere im häuslichen Bereich, die nicht zu Vermögens- und Erwerbszwecken<br />
gehalten werden SchKG 92 I Ziff. 1a<br />
- Das Kompetenzgut des Berufsstandes. Die Berufsausübung durch den Schuldner und<br />
seine Familie soll gewährt bleiben. SchKG 92 I Ziff. 3. Es dürfen dem Schuldner aber<br />
nur die für die Berufsausübung notwendigen Gegenstände belassen werden. Dabei ist<br />
63
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
immerhin den Erfordernissen einer rationellen und konkurrenzfähigen Berufsausübung<br />
Rechnung zu tragen.<br />
- Die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände SchKG 92 I Ziff. 2. Sie müssen<br />
aber tatsächlich benützt werden.<br />
- <strong>Der</strong> Verkaufserlös von Kompetenzstücken ist auch unpfändbar, wenn er gebraucht wird,<br />
um neue Kompetenzstücke zu kaufen.<br />
408. Wird durch SchKG 92 I Ziff. 3 jede wirtschaftliche Betätigung geschützt?<br />
Nein, nur die Berufstätigkeit im engeren Sinn. Entscheidend dafür ist die Abgrenzung<br />
zwischen Beruf und Unternehmen.<br />
- <strong>Der</strong> Begriff des Berufes setzt die Anwendung persönlicher Fähigkeiten, eigener<br />
Arbeitskraft und eigenen Wissens voraus. Nicht notwendig ist aber, dass der Beruf eine<br />
erhebliche Ausbildung verlangt. Es kann sich auch um einen Nebenberuf oder einen<br />
Saisonberuf handeln. <strong>Der</strong> Schuldner muss aber seinen Beruf gewerbsmässig ausüben<br />
und die Berufsgegenstände tatsächlich dafür brauchen.<br />
- Die Unternehmung ist demgegenüber industriell entwickelt und unterbaut. <strong>Der</strong><br />
Unternehmer benützt über seine persönlichen Fähigkeiten hinaus, in grösserem Stil<br />
maschinelle Einrichtlungen, beansprucht in stärkerem Mass die Arbeitskraft Dritter,<br />
gelegentlich auch die Ausbeutung von Naturkräften. <strong>Der</strong> Kapitaleinsatz hat hier<br />
ausschlaggebende Rolle.<br />
Ob man es jeweils mit einem Beruf oder einer Unternehmung zu tun hat, hängt im<br />
Wesentlichen davon ab, welche Faktoren überwiegen: die persönliche Arbeitskraft des<br />
Schuldners oder das Kapital und fremde Arbeitskraft. Muss nach den Umständen des<br />
Einzelfalls und nur bei natürlichen Personen unterschieden werden, da die juristischen<br />
Personen mit ihrem gesamten Vermögen der Vollstreckung unterliegen.<br />
409. Werden für eine Beschäftigung ohne Erwerbszweck Kompetenzstücke<br />
ausgeschieden?<br />
Nein.<br />
410. Worauf kommt es an ob ein Stück, das mit Rücksicht auf die besondere Natur<br />
der Vermögenswerte unpfändbar ist unter diese Beschreibung fällt?<br />
Ob solche Stücke gepfändet werden können, kommt nur darauf an ob sie im Gesetz stehen<br />
oder nicht. Anders als bei den Kompetenzstücken, kann der Beamte nicht nach den<br />
Umständen des Einzelfalles entscheiden ob ein Stück unter die vom Gesetz beschriebene<br />
Auflistung fällt. Eine Pfändung solcher Stücke, die im Gesetz als nichtpfändbar bestimmt<br />
werden wäre nichtig.<br />
41<strong>1.</strong> Was fällt unter Unpfändbarkeit mit Rücksicht auf die besondere Natur der<br />
Vermögenswerte?<br />
- SchKG 92 I Ziff. 6: Best. Dienstsachen von Soldaten aber nur solange er noch<br />
wehrpflichtig ist.<br />
- SchKG 92 I Ziff. 7-10: Gewisse Leistungsansprüche des Schuldners mit Rücksicht auf<br />
ihre Rechtsnatur sowie vor allem auf ihre soziale Bestimmung.<br />
- Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die<br />
hoheitlichen Zwecken dienen SchKG 92 I Ziff. 11<br />
- Unpfändbarkeitsbestimmungen sind gelegentlich auch in anderen Bundesgesetzen<br />
anzutreffen SchKG 92 IV wie z.B. für:<br />
o Ansprüche aus einer Lebensversicherung<br />
o Peculium<br />
o Gewisse Immaterialgüterrechte<br />
64
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
412. Welche „Vermögenswerte“ sind nur beschränkt pfändbar?<br />
- Einkünfte SchKG 93<br />
- Früchte SchKG 94<br />
413. Wann sind diese Vermögenswerte nur beschränkt pfändbar?<br />
Unter bestimmten sachlichen oder zeitlichen Voraussetzungen<br />
- Sachlich aus sozialen Gründen, ist die Pfändbarkeit gewisser Einkünfte des Schuldners<br />
beschränkt auf den Betrag, der für ihn und seine Familie „nicht unbedingt notwendig“<br />
ist SchKG 93<br />
- Aus reinen Zweckmässigkeitsgründen ist die gesonderte Pfändbarkeit der hängenden<br />
und stehenden Früchten auf die für ein günstiges Verwertungsergebnis geeignete<br />
Reifezeit hinausgeschoben SchKG 94<br />
414. Welche Kategorien von Einkünften sind beschränkt pfändbar?<br />
- Erwerbseinkommen und seine Surrogate (Leistungen, die einen Erwerbsausfall<br />
abgelten)<br />
- Unterhaltsbeiträge und deren Surrogate<br />
- Nutzniessung und deren Erträge<br />
- Die einzelnen Leibrentenbetreffnisse<br />
Ob Einkommen unpfändbar ist bestimmt ausschliesslich und abschliessend das Bundesrecht.<br />
415. *Was ist entscheiden bei der Überlegung, was man pfändet (z.B. nach SchKG 93<br />
abgesehen davon, dass man nicht unter das Existenzminimum kommen darf)?<br />
Das verbot der Überpfändung muss stets beachtet werden. Wenn die Erträgnisse reichen, darf<br />
das Stammrecht nicht gepfändet werden.<br />
416. Was ist unter dem Erwerbseinkommen zu verstehen?<br />
Jedes Entgelt für persönliche Arbeitsleistung, gleichgültig, wie es im Einzelfall bezeichnet<br />
wird SchKG 93 I.<br />
Gleichgültig ist, ob das Einkommen Entgelt für eine dauernde oder bloss gelegentliche Arbeit<br />
darstellt, ob es bar oder in Naturalien entrichtet wird sowie ob es sich um bereits verfallene<br />
oder erst künftige Ansprüche handelt.<br />
Nicht nur das Erwerbseinkommen an sich sondern auch seine Surrogate sind beschränkt<br />
Pfändbar. Die Form des Ersatzeinkommens – z.B. ob Rente, Taggeld oder Kapitalabfindung –<br />
spielt keine Rolle.<br />
417. Was wird vom Begriff „Unterhaltsbeiträge“ umfasst?<br />
Er Umfasst z.B. die familienrechtlichen Unterhaltsbeiträge sowie Stipendien. Auch deren<br />
Surrogate, wie Hinterlassenenrenten<br />
418. Was darf bei den Leibrenten alles gepfändet werden?<br />
Alles ausser das Stammrecht nicht SchKG 92.<br />
419. Darf auch das künftige Einkommen nach SchKG 93 gepfändet werden?<br />
Ja, nicht nur fälliges Einkommen kann gepfändet werden sondern auch künftiges Einkommen.<br />
Doch ist die Pfändung von Zukunftseinkommen längstens für die Dauer eines Jahres zulässig<br />
SchKG 93 II. Eine längere Pfändung wäre nichtig SchKG 22.<br />
Reicht das für die Höchstdauer eines Jahres gepfändete Einkommen nicht aus, um den<br />
betreibenden Gläubiger zu befriedigen, so ist eine Nachpfändung von Einkommen selbst mit<br />
Zustimmung des Schuldners ausgeschlossen. Das Betreibungsamt muss dann für den nicht<br />
65
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
gedeckten Betrag einer Forderung einen Verlustschein ausstellen. Erst in einer auf Grund<br />
desselben fortgesetzten SchKG 149 III oder einer erneut angehobenen Betreibung kann der<br />
Gläubiger wieder eine neue Einkommenspfändung für die Dauer eines weiteren Jahres<br />
verlangen.<br />
420. *Welches ist die pfändbare Quote nach SchKG 93?<br />
Zur Bestimmung der pfändbaren Quote ist vom Gesamteinkommen des Schuldners<br />
auszugehen; sowohl von den Einkünften, die nach SchKG 92 gänzlich unpfändbar sind, als<br />
auch von denjenigen, die nach SchKG 93 beschränkt pfändbar sind. Diesem<br />
Gesamteinkommen ist das Existenzminimum = Notbedarf oder wie SchKG 93 I sagt „das<br />
unbedingt notwendige“ gegenüber zu stellen. Die Differenz zwischen Gesamteinkommen und<br />
Notbedarf des Schuldners und seiner Familie gibt die pfändbare Quote<br />
a<br />
c<br />
b<br />
e<br />
d<br />
a: Gesamteinkommen des Schuldners<br />
b: unpfändbare Einkünfte SchKG 92<br />
c: pfändbare Einkünfte SchKG 93<br />
d: Existenzminimum<br />
e: pfändbare Quote<br />
Die für die Bestimmung der Bemessungsgrundlagen massgebenden Verhältnisse sind vom<br />
Betreibungsamt von Amtes wegen abzuklären.<br />
42<strong>1.</strong> Welche Ausnahme gibt es, wo der Schuldner trotz, dass einige Gläubiger nicht<br />
befriedigt sind dennoch mehr hat als das Existenzminimum?<br />
Wenn ein Einkommen, das unpfändbar ist nach SchKG 92 das Existenzminimum des<br />
Schuldners übersteigt. Erzielt der Schuldner aber ausserdem noch nach SchKG 93 beschränkt<br />
pfändbares Einkommen, so darf dieses nun zum Ausgleich voll gepfändet werden.<br />
422. *Wie wird das Gesamteinkommen bestimmt?<br />
- Feststellung der Einkommensverhältnisse: Das Betreibungsamt stellt auf die Auskünfte<br />
des Schuldners, seines Arbeitgebers oder auch auf solche von Dritten oder Behörden ab.<br />
- Das Familieneinkommen als Gesamteinkommen: weil bei der Pfändung der Notbedarf<br />
des Schuldners und seiner Familie berücksichtigt wir, muss neben seinem persönlichen<br />
Einkommen auch dasjenige seiner Familienangehörigen gebührend in Rechnung gestellt<br />
werden: so die Unterhaltsbeiträge des Ehegatten, sowie der im elterlichen Haushalt<br />
lebenden Kinder.<br />
- Besondere Einkommensverhältnisse:<br />
o Saisonlohn muss auf ein Jahr verteilt werden; denn der Saisonarbeiter muss<br />
seinen und seiner Familie Jahresunterhalt daraus bestreiten<br />
o Schwankenden Lohn gibt dem Schuldner Anspruch auf einen Ausgleich, wenn<br />
der Lohn während der Pfändungsperiode zeitweise unter das Existenzminimum<br />
fällt.<br />
423. *Wie wird der Notbedarf bemessen?<br />
<strong>Der</strong> Betreibungsbeamte hat das gesetzlich garantierte Existenzminimum in jedem Einzelfall<br />
nach seinem Ermessen festzusetzen. Es gibt einige Richtlinien, sie sind aber unverbindlich.<br />
66
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Zur Bestimmung ist der tatsächliche, objektive Notbedarf des Schuldners und seiner Familie,<br />
nicht etwa der standesgemässe oder gewohnte Bedarf. Dabei sind zu berücksichtigen:<br />
- der notwendige Unterhalt des Schuldners und seiner Familie sowie weiterer<br />
unterstützungsberechtigter Personen. (Nahrung, Kleidung, Körperpflege, Strom, Wasser,<br />
Post, Telefon und kulturelle Bedürfnisse und weitere Zuschläge für Miete, Ausbildung<br />
der Kinder…)<br />
- Die Effektiven Existenzbedingungen in den verschiedenen städtischen und ländlichen<br />
Verhältnissen.<br />
424. *Wer kann eine Verfügung des Betreibungsbeamten über die Bestimmung des<br />
Notbedarfes mit welchem Rechtsmittel anfechten?<br />
Sofern kein Ermessensmissbrauch vorliegt, kann sein Entscheid nur wegen<br />
Unangemessenheit angefochten werden. Dazu sind nicht nur der Gläubiger und der Schuldner<br />
legitimiert sondern auch die Familienangehörigen des Schuldners, welche durch die<br />
Verfügung betroffen werden.<br />
Eine in krasser Missachtung des Notbedarfs vollzogene Einkommenspfändung, die den<br />
Schuldner in eine unhaltbare Lage brächte, wäre nichtig SchKG 22.<br />
425. Wie wird die pfändbare Quote im Falle des mitverdienenden Ehegatten<br />
berechnet?<br />
Zunächst werden die Nettoeinkommen der beiden Ehegatten und ihr gemeinsames<br />
Existenzminimum bestimmt; dieses wird dann im Verhältnis der beiden Nettoeinkommen auf<br />
die Ehegatten aufgeteilt. <strong>Der</strong> pfändbare Teil des Einkommens des betriebenen Ehegatten<br />
ergibt sich hierauf durch Abzug seines Anteils am Existenzminimum von seinem<br />
Nettoeinkommen.<br />
a<br />
b<br />
c<br />
a: Nettoeinkommen E1<br />
b: Nettoeinkommen E2<br />
c: gemeinsames<br />
Existenzminimum<br />
426. Wie ist es, wenn der Schuldner für Unterhaltsansprüche betrieben wird?<br />
Dem für Unterhaltsleistungen betriebene Schuldner wird das Existenzminimum nicht<br />
unbedingt gewährleistet; denn dann spielt auch das Existenzminimum des<br />
Alimentengläubigers eine Rolle. Ist es nicht mehr gedeckt, kann sich der Schuldner nicht auf<br />
sein eigenes Existenzminimum berufen. Dann muss er sein unzureichendes Einkommen mit<br />
dem ebenfalls notbedürftigen Alimentengläubiger teilen, und zwar so, wie wenn dieser zur<br />
Familie gehören würde. Schuldner und Gläubiger erleiden auf diese Weise verhältnismässig<br />
die gleiche Einbusse auf ihren Notbedarf.<br />
67
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Das Bundesgericht entwickelte folgende Formel für die Bestimmung des dem<br />
Alimentengläubiger zustehenden Teilbetrages (pfändbare Quote X).<br />
Pfändbare Quote X = E x U/N<br />
E: Einkommen des Schuldners<br />
U: Unterhaltsbeitrag<br />
N: Norbedarf des Schuldners und seiner Familie mit Einschluss des Gläubigers (N)<br />
427. Wie wird die Einkommenspfändung vollzogen?<br />
Sie wird durch Pfändungserklärung gegenüber dem Schuldner vollzogen; rechtsgültig ist sie<br />
aber nur, wenn alle Bemessungsgrundlagen, insbesondere der Berechnung des Notbedarfs in<br />
der Pfändungsurkunde ersichtlich sind.<br />
428. Kann die Pfändung künftigen Einkommens veränderten Verhältnissen angepasst<br />
werden?<br />
Ja, sie muss sogar angepasst werden SchKG 93 III. In solchen Fällen bleibt zwar die<br />
Pfändung grundsätzlich bestehen, doch soll das Betreibungsamt sie von Amtes wegen der<br />
neuen Sachlage entsprechend modifizieren; jede Partei hat aber Anspruch darauf, vor einer<br />
Änderung zu ihren Ungunsten angehört zu werden.<br />
429. *Wie wird die Einkommenspfändung/Verwertung bei einer bestrittenen<br />
Forderung durchgeführt?<br />
Ist der gepfändete Anspruch des Schuldners bestritten oder erhebt der Leistungsschuldner eine<br />
Einrede, die der betreibende Gläubiger nicht anerkennt, muss das gepfändete Guthaben als<br />
bestrittene Forderung gepfändet und verwertet werden. Das geschieht dass meist nicht durch<br />
Versteigerung des Guthabens, sondern durch Forderungsüberweisung gemäss SchKG 131;<br />
<strong>Der</strong> Betreibungsgläubiger tritt in die Recht des Schuldners ein. Er kann nun den<br />
Leistungsschuldner betreiben und seine Forderung gegen ich gelten zu machen versuchen.<br />
(Nötigenfalls auf dem Prozessweg, im Prätendentenstreit (OR 168), nicht im<br />
Widerspruchsverfahren.)<br />
430. Wie ist das Verhältnis der Pfändung künftigen Einkommens zu einer<br />
bestehenden Zession?<br />
Künftiges Einkommen kann nicht nur amtlich gepfändet sondern soweit es pfändbar ist durch<br />
privates Rechtsgeschäft abgetreten oder verpfändet werden.<br />
Eine nach der Pfändung vorgenommene Abtretung künftigen Einkommens bleibt jener<br />
gegenüber wirkungslos. Hingegen geht nach herrschender Praxis eine Abtretung vor der<br />
Pfändung dieser vor; dann wird nur gepfändet, wenn der Gläubiger die Gültigkeit der Zession<br />
bestreitet, und zwar als bestrittene Lohnforderung.<br />
Solange jedoch eine vorbestehende Abtretung dem gutgläubigen debitor cessus<br />
(Leistungsschuldner) nicht angezeigt ist, braucht auf sie keine Rücksicht genommen zu<br />
werden: Bis zur Notifikation hat die Lohnpfändung Vorrang; erst nachher kann der debitor<br />
cessus nicht mehr mit befreiender Wirkung ans Betreibungsamt zahlen.<br />
43<strong>1.</strong> *Unter welchen Umständen sind heut Abtretungen von Lohnforderungen noch<br />
zulässig?<br />
Sie können nur noch für Unterhaltsforderungen abetreten werden. Eine Abtretung für einen<br />
anderen Zweck wäre nichtig OR 325 II. Das ist damit sich ein Schuldner nicht der Pfändung<br />
entziehen kann, indem er seine Lohnforderungen immer schon abgetreten hat bevor sie<br />
gepfändet werden können und die Pfändung somit ins leere läuft.<br />
68
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
432. *Wie wird z.B. das Trinkgeld, das auch einen Teil des Lohnes darstellt<br />
gepfändet?<br />
Durch sogenannte Taschenpfändung. Es kommt jemand an den Arbeitsplatz und entnimmt<br />
dem Schuldner das Geld.<br />
433. Können Frücht separat gepfändet werden?<br />
Ja, kommt im Gegnschluss aus SchKG 94 I heraus. Bei einem unbelasteten Grundstück<br />
können die Früchte separat gepfändet werden.<br />
434. Wie lange können hängende und stehende Früchte gesondert gepfändet werden?<br />
Nur so lange, als nicht schon das Grundstück, das sie abwirft, selber gepfändet ist; denn dann<br />
gelten sie als mitgepfändet SchKG 102 I.<br />
Die gesonderte Pfändbarkeit der natürlichen Früchte vor der Ernte ist auf die Reifezeit<br />
hinausgeschoben SchKG 94 I. Vorher wäre die Pfändung nichtig. <strong>Der</strong> Schuldner kann aber<br />
zustimmen Früchte schon vor ihrer Reife zu pfänden SchKG 122 II. Die Veräusserung der<br />
Ernte vor ihrer Pfändbarkeit ist dem Gläubiger gegenüber ungültig, SchKG 94 II. (Nach Buch<br />
im Widerspruch zu den Notitzen, wo die Ernte Trotz Grundpfandrecht gepfändet werden kann<br />
und der grundpfandgläubiger nur ein Vorrecht hat, wenn er die Betreibung auf Verwertung<br />
des Grundpfandes eingeleitet hat bevor die Verwertung der gepfändeten Früchte stattfindet.=<br />
Zu 9. der <strong>Vorlesung</strong>: Das Widerspruchsverfahren<br />
§24 Das Widerspruchsverfahren<br />
435. Was passiert mit einer Pfändung von Gegenständen, die offensichtlich einem<br />
Dritten gehören?<br />
Die Pfändung solcher Gegenstände wäre nichtig.<br />
436. In welchem Fall sollen umstrittene Vermögenswerte zur Vollstreckung<br />
herangezogen werden/wieso dann?<br />
In Letzter Linie sollen die umstrittenen Vermögenswerte zur Vollstreckung herangezogen<br />
werden (Forderungen der Ehegatten gegeneinander?) und selbst dann nur,<br />
- wenn dem Betreibungsbeamten die Berechtigung des Schuldners zumindest als möglich<br />
erscheint,<br />
- oder wenn der Gläubiger die Pfändung ausdrücklich verlangt und die Berechtigung des<br />
Schuldners glaubhaft macht; dann darf sogar ein Grundstück gepfändet werden, das im<br />
Grundbuch auf den Namen eines Dritten eingetragen ist.<br />
Das gleiche gilt auch, wenn zwar die Zugehörigkeit zum Schuldnervermögen unbestritten ist,<br />
jedoch Rechte eines Dritten am Pfändungsgegenstand geltend gemacht werden, die<br />
demjenigen des Pfändungsgläubigers vorgehen.<br />
Das ist so, weil man einen kostspieligen und zeitraubenden Rechtsstreit vermeiden will.<br />
437. Können die Vollstreckungsorgane im Falle solcher Drittansprüche verbindlich<br />
über die materielle Rechtslage entscheiden?<br />
Nein, sie dürfen aber deshalb nicht von der Pfändung absehen. Vielmehr sind sie zum Vollzug<br />
verpflichtet, wenn ihre summarische Prüfung der Verhältnisse ergibt, dass die Berechtigung<br />
des Schuldners nicht offensichtlich auszuschliessen ist.<br />
438. Was bezweckt das Widerspruchsverfahren?<br />
69
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Es bezweckt die Begründetheit des Drittanspruches für die laufende Vollstreckung zu klären.<br />
Wird der Anspruch geschützt, so bewirkt dies die Freigabe des umstrittenen<br />
Vermögenswertes oder, wo ein Pfandrecht geltend gemacht wird, dessen vorrangige<br />
Berücksichtigung. Wird er abgelehnt, kann die Vollstreckung ungehindert ihren Fortgang<br />
nehmen.<br />
439. Wie ist der Verfahrensgang im Widerspruchsverfahren?<br />
Es kommt immer von Amtes wegen in Gang, sobald das Betreibungsamt von einer<br />
Drittansprache an dem zu pfändenden oder schon gepfändeten Vermögenswert Kenntnis<br />
erhält. <strong>Der</strong> weitere Verlauf des Verfahrens hängt dann ganz von der Initiative der<br />
interessierten Personen ab. Es beginnt in jedem Fall mit einem administrativen Vorverfahren,<br />
das sich zum gerichtlichen Widerspruchsprozess ausweiten kann. Dabei ist der Gewahrsam<br />
am gepfändeten Vermögenswert für den Ablauf des Vorverfahrens bzw. für die Verteilung<br />
der Parteitollen entscheidend.<br />
440. Was ist Gegenstand des Widerspruchsverfahrens?<br />
„Rechte Dritter am gepfändeten Gegenstand“. Darunter ist jeder Anspruch zu verstehen, der<br />
dem vollstreckungsrechtlichen Zugriff des Pfändungsgläubigers vorgeht SchKG 106 I.<br />
Entweder er schliesst die Pfändung gänzlich aus (wie z.B. das Eigentum) oder er lässt sie<br />
zumindest zurücktreten (wie z.B. ein Pfandrecht). Immer muss es sich aber um einen<br />
Anspruch handeln, der materiellrechtlich begründet werden kann. Ist das geltend gemachte<br />
Recht nur betreibungsrechtlicher Natur so ist dies nur im Beschwerdeverfahren zu beurteilen.<br />
44<strong>1.</strong> Welche Ansprüche Dritter am Pfändungsgut können solche vorgehenden<br />
Ansprüche sein?<br />
- Das Eigentum oder ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache oder an einem<br />
Wertpapier SchKG 37<br />
- <strong>Der</strong> Eigentumsvorbehalt, der betreibungsrechtlich wie ein Pfandrecht behandelt wird !*<br />
(Es steht dem Verkäufer aber auch frei, sein vorbehaltenes Eigentum geltend zu<br />
machen; dann fällt die Sache aus dem Pfändungsnexus heraus, und es ist an ihrer Stelle<br />
der Anspruch des Käufers auf Rückerstattung des Kaufpreises zu pfänden)<br />
- Andere beschränkte dingliche bzw. realobligatorische Rechte an einem Grundstück<br />
SchKG 37<br />
- Das Gläubiger- oder Pfandrecht an der gepfändeten Forderung (ist nicht das<br />
Gläubigerrecht streitig, sondern der Bestand der Forderung an sich, so ist die Forderung<br />
als bestritten zu pfänden, und es kommt dann gar nicht zum Widerspruchsverfahren.<br />
Auch der Streit um die Zession einer gepfändeten Lohnforderung ist nicht im<br />
Widerspruchsverfahren, sondern im Prätendentenstreit (OR 168) zu beurteilen).<br />
- <strong>Der</strong> Rang eines Rechtes an der gepfändeten Sache<br />
- Obligatorische Ansprüche aus Sachrückgabe können Gegenstand des Widerspruches<br />
sein (von solchen Leuten, die nicht Eigentümer der Sache sind sonst wäre der Anspruch<br />
ja dinglich), Andere obligatorische Ansprüche, fallen hingegen ausser Betracht,<br />
- Wird fiduziarisches Vermögen des Schuldners (Fiduziars) gepfändet, so kann der Dritte<br />
(Fiduziant) seinen Widerspruch auf OR 401 stützen. Gleichgültig ob es sich um<br />
ursprüngliches oder erworbenes Treugut handelt.<br />
- Widerspruchsrechte aus dem Familienrecht<br />
o Das Recht des Ehegatten des Schuldners unter Errungenschaftsbeteiligung<br />
oder Gütertrennung, sich in der Betreibung für eine Schuld des anderen gegen<br />
die Pfändung des eigenen Eigengutes bew. der eigenen Errungenschaft zu<br />
widersetzen<br />
70
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
o Das Recht jedes Ehegatten unter Gütergemeinschaft, sich in der Betreibung des<br />
anderen der Pfändung von Objekten der Gesamtgutes oder des eigenen Gutes<br />
zu widersetzen SchKG 68e<br />
- <strong>Der</strong> Streit um die Begünstigung eines Dritten aus einer Lebensversicherung des<br />
Schuldners kann im Widerspruchsverfahren geklärt werden.<br />
442. Was ist ein fiduziarisches Rechtsgeschäft, was passiert da?<br />
Das ist die Treuhand, bei ihr überträgt die Treugeberin dem Treuhändler ein Recht (Eigentum,<br />
Forderung) mit der Abrede, im eigenen Namen, aber im Interesse und für Rechnung der<br />
Treugeberin tätig zu werden. Die Treuhand zerfällt in zwei Teile: das schuldrechtliche<br />
fiduziarische Grundgeschäft (Auftrag, Sicherungsabrede) und die fiduziarische Übertragung<br />
des Rechts als Verfügungsgeschäft.<br />
443. Was sind die Voraussetzungen des Widerspruchsverfahrens?<br />
- die Anmeldung des Drittanspruchs<br />
- der Zeitpunkt der Anmeldung<br />
- Regelung für Ansprüche auf gestohlen oder verlorene Sachen<br />
444. Von wem/in welcher Form/mit wlchem Inhalt ist die Anmeldung vorzunehmen?<br />
Die Anmeldung kann von einem Dritten oder vom Schuldner ausgehen SchKG 95 III und 106<br />
I und III; als anmeldender Dritter kommt der Drittansprecher selbst oder sonst ein Dritter in<br />
Betracht, der die Sache besitzt und die Berechtigung eines anderen daran behauptet.<br />
Die Anmeldung kann schriftlich oder mündlich erfolgen.<br />
Darin ist der Gegenstand, an dem der Anspruch geltend gemacht wird, genau zu bezeichnen<br />
und das behauptete Recht so wie der angeblich Berechtigte zu nennen.<br />
Wird ein Pfandrecht oder ein Eigentumsvorbehalt beansprucht, so muss ausserdem der Betrag<br />
angegeben werden, für den der Drittansprecher vom pfändenden Gläubiger Deckung verlangt.<br />
445. *In welchem Zeitpunkt muss der Drittanspruch angemeldet werden?<br />
Er kann grundsätzlich so lange angemeldet werden, als die Durchführung des<br />
Widerspruchsverfahrens im Rahmen der Betreibung überhaupt noch Sinn hat. Es gibt keine<br />
bestimmte gesetzliche Befristung. Praktisch verhält es sich aber so:<br />
- Die Anmeldung kann bereits anlässlich der Betreibung erfolgen SchKG 95 III<br />
- War der Dritte nicht in der Lage, seine Rechte bereits bei der Pfändung anzumelden, so<br />
kann er das jederzeit bis zur Verteilung nachholen. Nach der Verwertung bezieht sich<br />
der Drittanspruch auf den Erlös des verwerteten Gegenstandes SchKG 106 II.<br />
- Hat der Dritte von der Pfändung des von ihm beanspruchten Vermögenswertes Kenntnis<br />
erhalten und steht die Pfändung unanfechtbar fest SchKG 17ff, soll er sich binnen<br />
angemessener Frist melden. Jedenfalls darf er die Anmeldung nicht arglistig gegen Treu<br />
und Glauben hinauszögern. Bei dererlei Machenschaften wird der Dritte dem Gläubiger<br />
gegenüber nicht nur zivilrechtlich haftbar, sondern er verwirkt zudem das Recht auf<br />
Widerspruch im hängigen Verfahren (nicht aber seinen materiellrechtlichen Anspruch).<br />
<strong>Der</strong> gepfändete Vermögenswert kann dann ohne Rücksicht auf das Drittrecht verwertet<br />
und der Erlös verteilt werden, wodurch der Dritte zu Verlust kommt. Nur entschuldbare<br />
Gründe können von dieser Konsequenz bewahren.<br />
446. Darf der Verwertungserlös trotz Anmeldung eines Drittanspruchs verteilt<br />
werden?<br />
Sobald ein Anspruch eines Dritten angemeldet ist, und solange über ihn noch nicht endgültig<br />
entschieden ist, darf der Verwertungserlös nicht verteilt werden; denn nach der Versteigerung<br />
versagt das Widerspruchsverfahren, weil damit die Vollstreckung durchgeführt ist.<br />
71
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
447. *Was kann ein Dritter tun, wenn er es verpasst, sein Anspruch anzumelden und<br />
der Erlös aus seiner Sache schon verteilt wurde?<br />
Anstelle des ursprünglichen Anspruchs des Dritten tritt dann ein Bereicherungsanspruch<br />
gegen den Schuldner (? Prof. sagt gegen den Gläubiger). Unter Umständen kann der Dritte<br />
aber auch Schadenersatz fordern, sei es vom Schuldner, der den Anspruch bei der Pfändung<br />
nicht angemeldet hat, sei es von einem bösgläubigen Gläubiger, der vom Drittanspruch<br />
Kenntnis hatte oder haben musste. Auch die Staatshaftung kann er geltend machen SchKG<br />
5ff. wenn es der Betreibungsbeamte unterlassen haben sollte, das Widerspruchsverfahren<br />
einzuleiten.<br />
448. Welche Rechte kann der frühere Besitzer einer gestohlenen oder abhanden<br />
gekommenen Sache geltend machen, wenn diese beim Schuldner gepfändet wird?<br />
Dem Besitzer einer abhanden gekommenen oder gestohlenen Sache stehen die<br />
sachenrechtlichen Verfolgungsrechte zur Verfügung. Diese kann er nicht nur gegen den<br />
betriebenen Schuldner im Widerspruchsverfahren gegen den Pfändungsbeschlag geltend<br />
machen, sondern auch noch nach der Verwertung bzw. Verteilung des Erlöses gegenüber<br />
jedem späteren Erwerber der Sache SchKG 106 III. So kann die verwertete Sache sogar vom<br />
gutgläubigen Ersteigerer zurückverlangt werde, allerdings nur befristet und gegen volle<br />
Entschädigung. Dabei lässt das Betreibungsrecht erst noch den vollstreckungsrechtlichen<br />
Freihandverkauf als öffentliche Versteigerung i.S. von ZGB 934 II gelten SchKG 106 III.<br />
Gegenüber einem bösgläubigen Erwerber ist das Verfolgungsrecht unbefristet.<br />
Neben dieser zivilrechtlichen Sachverfolgung steht dem Dritten im betreibungsrechtlichen<br />
Widerspruchsverfahren immer noch der Anspruch auf den allenfalls noch nicht verteilten<br />
Verwertungserlös zu.<br />
449. Was muss das Betreibungsamt tun, wenn eine gültige Anmeldung vorliegt?<br />
Das Betreibungsamt muss nun von Amtes wegen das Widerspruchsverfahren eröffnen.<br />
Mittels Beschwerden wegen Rechtsverweigerung kann es dazu gezwungen werden.<br />
450. *Welche Bedeutung hat der Gewahrsam für das Vorverfahren?<br />
Einleitung und Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind verschieden, je nachdem ob<br />
sich die gepfändete Sache im Gewahrsam des Schuldners oder eins Drittansprechers oder in<br />
gemeinsamem Gewahrsam des Dritten und des Schuldners befindet SchKG 107 und 108.<br />
45<strong>1.</strong> Wieso wird für den Verfahrensverlauf an den Gewahrsam angeknüpft?<br />
Die Anknüpfung an den Gewahrsam geht von der Vermutung aus, dass dessen Inhaber auch<br />
das bessere Recht auf die Sache habe. Darum soll er in einem allfälligen Widerspruchsprozess<br />
die prozessual günstigere Rolle des Beklagten einnehmen dürfen.<br />
452. Nach welcher Regel bereitet das Vorverfahren die Parteirollenverteilung vor?<br />
- Bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners fällt die Klägerrolle im<br />
Widerspruchsprozess dem Dritten zu: Das Verfahren wird nach SchKG 107<br />
durchgeführt.<br />
- Gewahrsam des Dritten – sei es ausschliesslicher oder gemeinsamer mit dem Schuldner<br />
– bedeutet, dass der den Drittanspruch bestreitende Gläubiger oder der Schuldner klagen<br />
muss, niemals aber der Dritte: Verfahren nach SchKG 108.<br />
- Befindet sich die gepfändete Sache im Gewahrsam eines Vierten, kommt es darauf an,<br />
für wen diese Person den Gewahrsam innehat. Dem Drittansprecher darf auch hier die<br />
Klägerrolle nur zugewiesen werden, wenn der Vierte den Gewahrsam über die Sache<br />
ausschliesslich für den Schuldner ausübt.<br />
72
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
453. Was versteht man unter Gewahrsam?<br />
Darunter versteht man die unmittelbare faktische Herrschaft über eine Sache, verbunden mit<br />
der Möglichkeit, sie zu gebrauchen. Rechtliche Kriterien kommen nur insoweit in Betracht,<br />
als sie einen Rückschluss auf die tatsächliche Verfügungsmacht zulassen.<br />
Im Einzelnen ist zu unterscheiden:<br />
- Gewahrsam im dargelegten Sinne gibt es nur bezüglich beweglicher Sachen und<br />
Wertpapiere.<br />
- Grundstücke kann man nicht in Gewahrsam haben. Dessen Funktion übernimmt hier<br />
ersatzweise die Aussage des Grundbuches SchKG 107 I Ziff. 3; 108 I Ziff. 3.<br />
- Bei Forderungen, die nicht in einem Wertpapier verkörpert sind, und anderen Rechten<br />
wird ersatzweise (anstelle des Gewahrsams) auf die Berechtigung selbst abgestellt. Da<br />
aber diese ja bestritten ist kommt es nur auf die grössere Wahrscheinlichkeit der<br />
Berechtigung an SchKG 107 I Ziff. 2; 108 I Ziff. 2.<br />
- Bei Fahrzeugen wird der Gewahrsam zunächst anhand des Fahrzeigausweises<br />
festgestellt. Doch kann dem Dritten die Klägerrolle nur zugeschoben werden, wenn der<br />
Schuldner das Fahrzeug ausserdem tatsächlich in seiner Verfügungsmacht hat;<br />
andernfalls müsste der Gläubiger gegen den Dritten klagen.<br />
- Mitgewahrsam ist stets dann von Bedeutung, wenn der Dritte daran beteiligt ist. Dann<br />
hat der Schuldner die Klägerrolle.<br />
454. Welcher Zeitpunkt ist bei der Entscheidung über den Gewahrsam von<br />
Bedeutung?<br />
Die Frage des Gewahrsams oder seiner Ersatzformen beurteilt sich nach den Verhältnissen im<br />
Zeitpunkt der Pfändung. <strong>Der</strong> Entscheid des Betreibungsamtes darüber (gegebenenfalls der<br />
Beschwerdeentscheid der Aufsichtsbehörde), ist für den Richter verbindlich. Deshalb ist es<br />
wichtig Beanstandungen rechtzeitig mit Beschwerde vorzubringen.<br />
73
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Welche Möglichkeiten gibt es im Vorverfahren, wo der Schuldner Alleingewahrsam an<br />
der Sache hat?<br />
Hat ausschliesslich der Schuldner Gewahrsam so eröffnet das Betreibungsamt<br />
das Widerspruchsverfahren, indem es dem Gläubiger und dem Schuldner eine 10<br />
tägige Frist zur Bestreitung des angemeldeten Drittanspruchs setzt SchKG 107<br />
II.<br />
Anspruch nicht<br />
bestritten<br />
Anspruch<br />
anerkannt<br />
Widerspruchs-<br />
verfahren ist<br />
damit<br />
abgeschlossen<br />
SchKG 107 IV<br />
Verzicht auf<br />
Geltendmachung<br />
des<br />
Anspruches<br />
Damit ist das<br />
Widerspruchsverfahren<br />
abgeschlossen<br />
Anspruch<br />
bestritten hat<br />
Dritter die Wahl<br />
SchKG 107 V<br />
Einleitung des<br />
Widerspruchs-<br />
Prozesses<br />
20 Tage Zeit<br />
Damit ist das<br />
Vorverfahren<br />
abgeschlossen und der<br />
Widerspruchsprozess<br />
eingeleitet<br />
74
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
455. Wie läuft das Vorverfahren bei Allein- oder Mitgewahrsam des Dritten ab?<br />
Hier entfällt das Bestreitungsverfahren, was die weitere Abwicklung vereinfacht.<br />
Dem Gläubiger und dem Schuldner wird nämlich eine direkt die 20-tägige Frist zur<br />
Klage auf Aberkennung des angemeldeten Anspruchs gesetzt SchKG 108 II<br />
Klagen weder der Gläubiger<br />
noch der Schuldner binnen<br />
der Frist<br />
Anspruch des<br />
Dritten gilt als<br />
anerkannt<br />
Widerspruchsverfahr<br />
en abgeschlossen<br />
Rechtzeitig erhobene Klage<br />
Widerspruchsprozess<br />
456. Welche Phase des Widerspruchsverfahrens bildet der Widerspruchsprozess?<br />
Er bildet die Schlussphase des Widerspruchsverfahrens, sofern dieses nicht schon im<br />
Vorverfahren abgeschlossen werden konnte.<br />
457. Auf was zielt die Widerspruchsklage ab?<br />
Auf die richterliche Abklärung des Drittanspruchs, wobei nun auf den Sachverhalt zur Zeit<br />
der Urteilsfällung abzustellen ist.<br />
458. *Was für eine Klage Art ist die Widerspruchsklage?<br />
Zivilprozessual handelt es sich um eine Feststellungsklage:<br />
- eine positive, wenn nach SchKG 107 der Dritte als Kläger das von ihm behauptete<br />
Recht feststellen lassen will.<br />
- Eine negative, wenn nach SchKG 108 der Gläubiger oder der Schuldner gegen einen<br />
Dritten auf Aberkennung seines Anspruches klagt.<br />
459. *Welche Art Streitigkeit löst die Klage?<br />
Obwohl die Klage materiellrechtlich begründet werden muss, erfüllt sie einen rein<br />
betreibungsrechtlichen Zweck: Abklärung der Zusammensetzung des zur Verwertung<br />
bereitgestellten Vollstreckungssubstrates für die hängige Betreibung.<br />
Das zeigt sich an Fällen, wo z.B. der umstrittene Vermögenswert auf Beschwerde des<br />
Schuldners hin als unpfändbar erklärt wird. Eine derartige Entscheidung macht den<br />
Widerspruchsprozess gegenstandslos, weil die betreffende Sache in der laufenden Betreibung<br />
nicht mehr beansprucht wird.<br />
Das ganze Widerspruchsverfahren ist somit ein Zwischenverfahren, abhängig vom Schicksal<br />
der Betreibung. Fällt diese dahin, wird jenes gegenstandslos, selbst wenn der Drittanspruch<br />
materiell tatsächlich streitig sein sollte.<br />
75
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Die Widerspruchsklage charakterisiert sich als eine betreibungsrechtliche Klage mit<br />
Reflexwirkung auf das materielle Recht. Daher unterliegt das Urteil im Widerspruchsprozess<br />
bei gegebenen Voraussetzungen der Berufung oder der Nichtigkeitsbeschwerde ans BGer.<br />
- Tritt allerdings der Schuldner gegen den Dritten als Prozesspartei auf, kommt der Klage<br />
materiellrechtliche Natur zu, und das Urteil erlangt volle Rechtskraft.<br />
460. Wie werden die Parteirollen im Prozess vom Betreibungsamt verteilt?<br />
- Im Verfahren nach SchKG 107 tritt immer der Drittansprecher als Kläger auf. Beklagter<br />
ist der Bestreitende: Das ist in der Regel der Gläubiger, ausnahmsweise der Schuldner<br />
oder gar beide zusammen (als passive Streitgenossen) (Welche Natur hat die Klage<br />
hier?)<br />
- Im Verfahren nach SchKG 108 (Gewahrsam des Dritten) ist der Gläubiger der Kläger,<br />
der Dritte der Beklagte. Aber auch der Schuldner ist klageberechtigt, allein oder<br />
zusammen mit dem Gläubiger (als aktiver Streitgenosse).<br />
46<strong>1.</strong> Was kann der Gläubiger im Widerspruchsprozess alles benützen gegen den<br />
Dritten?<br />
Er kann unabhängig von der Parteirolle alle Rechte und Einreden geltend machen, die der<br />
Schuldner dem Dritten gegenüber besitzt. Er kann sich aber auch auf eigenes nicht vom<br />
Schuldner abgeleitetes Recht berufen so z.B. darauf, der Drittanspruch sei durch eine<br />
anfechtbare Handlung des Schuldners erworben worden.<br />
462. Treten immer alle Gläubiger, die an einer Pfändung beteiligt sind als<br />
Streitgenossen auf?<br />
Nein.<br />
463. Wie wird der Erlös auf die Gläubiger aufgeteilt, wenn ein Dritter mit seinem<br />
Anspruch abgewiesen wurde?<br />
Dann haben nur die siegreichen Prozessteilnehmer Anspruch auf den Erlös aus der streitigen<br />
Sache, und zwar bis zur vollen Deckung ihrer Forderung einschliesslich Zins und Kosten. Die<br />
Mitgläubiger, die sich vom Prozess ferngehalten haben, können nichts vom Prozessergebnis<br />
für sich beanspruchen. Ein allfälliger Überschuss bleibt folglich dem Dritten.<br />
464. Nach welchen Regeln wird der Widerspruchsprozess durchgeführt?<br />
Er wird nach den Regeln des ordentlichen aber des beschleunigten Zivilprozesses geführt<br />
SchKG 109 IV.<br />
465. Welche Besonderheiten sind bei der Durchführung des Widerspruchsprozesses<br />
zu beachten?<br />
- Gerichtsstand: er kann an 3 verschiedenen Orten sein<br />
o Am Betreibungsort, auf Klage des Drittansprechers hin, desgleichen auf gegen<br />
ihn gerichtete Klage, sofern er im Ausland wohnt SchKG 109 I Ziff. 1 und 2.<br />
o Am schweizerischen Wohnsitz des beklagten Drittansprechers SchKG 109 II<br />
o Am Ort der gelegenen Sache, wenn die Klage ein Recht an einem Grundstück<br />
betrifft SchKG 109 III<br />
- Streitwert: es ist immer der kleinere Wert massgebend<br />
o <strong>Der</strong> Schätzwert des Pfändungsgegenstandes<br />
o <strong>Der</strong> Betrag der in Betreibung gesetzten Forderung<br />
o Oder der Betrag der pfandgesicherten Forderung, wenn der Streit um die<br />
Gültigkeit eines Pfandrechts geht<br />
76
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Klagefrist von 20 Tagen ist wie die Bestreitungsfrist SchKG 107 II eine<br />
Verwirkungsfrist; beide sind ausnahmsweise verlänger- und wiederherstellbar SchKG<br />
33 II und IV.<br />
- Teileinstellung der Betreibung, damit der Widerspruchsprozess nicht durch den<br />
Fortgang der Betreibung bis zur Verteilung des Erlöses gegenstandslos wird. Die Fristen<br />
für das Verwertungsbegehren stehen still SchKG 109 IV. Einstellung ist auf den<br />
umstrittenen Pfändungsgegenstand beschränkt: Hinsichtlich des übrigen Pfändungsgutes<br />
kann die Betreibung ungehindert weiterlaufen.<br />
- Beweislast: die Verteilung der Parteirollen hat keinen Einfluss auf die Beweislast im<br />
Widerspruchsprozess. Es gilt immer die allgemeinen Beweislastregen von ZGB 8.<br />
- Verfahren bei konkurrierenden Drittansprüchen da Werden die Weichen für den<br />
Verfahrensgang so gestellt, wie es der Praktikabilität und der Prozessökonomie am<br />
besten entspricht.<br />
o Gleichzeitige Eigentumsansprachen verlangen, dass der bestreitende Gläubiger<br />
gegen beide Ansprecher prozediert. Selbst wenn zwischen diesen beiden der<br />
Eigentumsprozess bereits hängig ist, muss das Betreibungsamt die Klagefrist<br />
ansetzen<br />
o Macht ein Ansprecher Eigentum, der andere ein Pfandrecht geltend, so werden<br />
die Fristen zur Klageerhebung dem Gläubiger zwar auch gleichzeitig<br />
angesetzt, jedoch mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Frist zur Klage<br />
gegen den Pfandansprecher erst mit dem Tage zu laufen beginnt, an welchem<br />
das gegenüber dem Eigentumsansprecher erstrittene Urteil in Rechtskraft tritt.<br />
Wird der Eigentumsanspruch gutgeheissen, interessiert das behauptete<br />
Pfandrecht im Vollstreckungsverfahren nicht mehr.<br />
466. Welche Wirkungen hat das Widerspruchsverfahren?<br />
Es wirkt grundsätzlich immer nur in der hängigen Betreibung. Ausnahme, wenn sich das<br />
Widerspruchsverfahren zwischen dem Schuldner und dem Drittansprecher abspielt, ist der<br />
gerichtliche Entscheid über das Verfahren hinaus wirksam.<br />
Im Einzelnen gilt:<br />
- Ist das Recht des Dritten als bestehend anzusehen, so fällt, wenn es sich um ein die<br />
Pfändung ausschliessendes Recht handelt (z.B. Eigentum) der streitige Vermögenswert<br />
aus dem Pfändungsnexus und damit aus der Betreibung. Handelt es sich bloss um ein<br />
beschränktes dingliches Recht oder um ein anderes dem Pfändungsgläubiger<br />
vorgehendes Recht, so bleibt die Pfändung zwar in Kraft, doch muss dann das<br />
anerkannte Recht des Dritten bei der Verwertung der Sache und bei der Verteilung des<br />
Erlöses respektiert werden.<br />
- Erscheint das Recht des Dritten hingegen als nicht bestehend, so nimmt die Betreibung<br />
ohne Rücksicht auf den Dritten ihren Fortgang: Die Sache wird verwertet und ihr Erlös,<br />
nach Deckung der Kosten, dem obsiegenden Gläubiger ausgehändigt.<br />
Zu 10. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Verwertung und Verteilung<br />
2. Abschnitt: Die Verwertung<br />
§26 Allgemeine Grundsätze der Verwertung<br />
467. Wird von Amtes wegen verwertet?<br />
Generell wird das Vollstreckungssubstrat nicht verwertet, bis es ausdrücklich verlangt wird.<br />
Es braucht dazu ein Verwertungsbegehren, dieses darf nicht an Bedingungen geknüpft sein<br />
77
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
und es muss sich immer vorbehaltlos auf die ganze Forderung und auf sämtliche<br />
Pfändungsgegenstände beziehen.<br />
Es geschieht aber von Amtes wegen, wenn:<br />
- sich bei der gepfändeten Fahrnis einen Notverkauf aufdrängt SchKG 124 II<br />
- oder im Anschluss an eine Nachpfändung von Amtes wegen SchKG 145<br />
468. Wer ist legitimiert ein Verwertungsbegehren zu stellen?<br />
- Jeder Gläubiger, der definitiv an der Pfändung teilnimmt SchKG 117 I und 118.<br />
- An dessen Stelle seine Rechtsnachfolger<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner SchKG 124 I, 133 II<br />
- In der Betreibung auf Pfandverwertung der Dritteigentümer des Pfandes.<br />
469. Können Gläubiger mit bloss provisorischer Pfändung auch ein<br />
Verwertungsbegehren stellen?<br />
Nein, dafür gelten für sie auch die Fristen nicht, innert welcher die Verwertung sonst<br />
angeordnet werden müsste SchKG 118.<br />
470. Wann kommt ein Gläubiger bloss zu einer provisorischen Pfändung?<br />
- auf Grund provisorischer Rechtsöffnung<br />
- bei der Bestreitung eines privilegierten Pfändungsanschlusses<br />
- oder wenn eine Sache, auf die ein Arrest gelegt wurde gepfändet wird, da nimmt der<br />
Arrestgläubiger provisorisch an der Pfändung teil.<br />
47<strong>1.</strong> In welcher Form muss das Verwertungsbegehren sein?<br />
Es kann mündlich oder schriftlich erfolgen, es empfiehlt sich das amtliche Formular dafür zu<br />
verwenden. Adressat ist immer das Betreibungsamt, das die Pfändung angeordnet hat SchKG<br />
53; 32.<br />
472. Wie lang sind die zeitlichen Schranken für das Verwertungsbegehren?<br />
Sie sind je nach Art der des Pfändungsgegenstandes verschieden.<br />
- Die Verwertung von beweglichen Sachen, Forderungen und anderen Rechten SchKG<br />
132 kann frühestens einen Monat und muss spätestens ein Jahr nach Vollzug der<br />
Pfändung verlangt werden SchKG 116 I.<br />
- die Verwertung von Grundstücken frühestens 6 Monate und spätestens 2 Jahre danach<br />
SchKG 116 I.<br />
- die Verwertung von Ansprüchen aus einer Einkommenspfändung SchKG 93 innert 15<br />
Monaten nach der Pfändung<br />
473. Ab welchem Zeitpunkt beginnen die Fristen für das Verwertungsbegehren zu<br />
laufen, wenn mehrere Gläubiger teilnehmen?<br />
Von der letzten erfolgreichen Ergänzungspfändung an SchKG 116 III.<br />
474. Um welche Art Frist handelt es sich bei der Frist für das<br />
Verwertungsbegehren/kann sie verlängert werden?<br />
Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die weder verlänger- noch wiederherstellbar ist<br />
SchKG 12<strong>1.</strong> Ihr Lauf kann aber ex lege gehemmt sein: so während der Einstellung der<br />
Betreibung im Widerspruchsprozess SchKG 109 V, während der Dauer einer provisorischen<br />
Pfändung SchKG 118, während einer Nachlasstundung SchKG 297 I sowie während der<br />
Stundung für eine Schuldenbereinigung SchKG 334 III.<br />
78
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
475. Ist die Frist für das Verwertungsbegehren zwingend/kann von ihr abgewichen<br />
werden?<br />
Ausser in den Fällen, wo der Lauf der Frist ex lege gehemmt ist, sind die zeitlichen Schranken<br />
für das Verwertungsbegehren zwingend und nur ausnahmsweise darf eine vorzeitige<br />
Verwertung stattfinden, nämlich (Begehren auch nicht innert Frist? S. 210 SchKG):<br />
- im Falle eines Notverkaufs SchKG 124 II<br />
- bei Fahrnis, Forderungen und anderen Rechten auf Begehren des Schuldners SchKG<br />
124 I.<br />
- bei Grundstücken, wenn dem Begehren des Schuldners zudem sämtliche Pfändungs-<br />
und Pfandgläubiger ausdrücklich zustimmen SchKG 133 II.<br />
476. Was passiert mit einem verfrühten oder einem verspäteten<br />
Verwertungsbegehren?<br />
Es ist unwirksam. Ein vorzeitiges wird zwar nicht zurückgewiesen, doch darf ihm das Amt<br />
einstweilen keine Folge geben. Wird die Endfrist nicht eingehalten, so erlischt die Betreibung<br />
SchKG 12<strong>1.</strong> Die Pfändung fällt dahin und weitere Betreibungshandlungen wären nichtig.<br />
Gleich verhält es sich, wenn der Gläubiger das Begehren zurückzieht und nicht binnen der<br />
Frist erneuert; ein bedingter Rückzug hat die gleichen Folgen wie ein unbedingter SchKG<br />
12<strong>1.</strong> <strong>Der</strong> Schuldner erlangt mit dem Wegfall der Betreibung wieder die volle<br />
Verfügungsbefugnis über die gepfändet gewesenen Vermögenswerte.<br />
477. Welche Wirkungen entfaltet das Verwertungsbegehren?<br />
Ein gültiges Verwertungsbegehren verpflichtet das Betreibungsamt, zur Verwertung zu<br />
schreiten. Das Betreibungsamt benachrichtigt den Schuldner binnen der Ordnungsfrist von 3<br />
Tagen vom Eingang des Verwertungsbegehrens SchKG 120. <strong>Der</strong> Eingang des<br />
Verwertungsbegehrens löst die Verwertungsfristen aus: für Fahrnis und Forderungen nach<br />
SchKG 122, für Grundstücke nach SchKG 133.<br />
478. Wer ist für die Verwertung zuständig?<br />
Sie obliegt den Betreibungsamt, in dessen Kreis die zu verwertenden Gegenstände liegen,<br />
somit grundsätzlich dem Amt, das die Pfändung vollzogen hat SchKG 89. Zwingend ist dies<br />
aber nach SchKG 4 II nur für die Versteigerung. Ein Freihandverkauf oder eine<br />
Forderungsüberweisung SchKG 131 dagegen könnten mit Zustimmung des Amtes am Ort der<br />
gelegenen Sache auch vom Amt, das die Betreibung führt, vollzogen werden.<br />
479. *Prinzipien des Verwertungsverfahrens (nach der <strong>Vorlesung</strong>)<br />
- Das Versilberungsprinzip<br />
- Das Deckungsprinzip<br />
- (Umfang der Verwertung, Buch = Deckungsprinzip, was er in der <strong>Vorlesung</strong> meint)<br />
- (Deckungsprinzip, Buch: anders als das Deckungsprinzip von der <strong>Vorlesung</strong>)<br />
- (Überbindungsprinzip, Buch)<br />
- (Prinzip des doppelten Aufrufes, Buch)<br />
480. *Was beinhaltet das Versilberungsprinzip?<br />
Die Zuteilung von gepfändeten Vermögensgegenständen an die Gläubiger kommt nicht in<br />
Frage (= Verbot des Verfallpfandes). Das Pfändungsgut muss deshalb, soweit es sich nicht<br />
schon um Bargeld handelt, vorerst in Geld umgesetzt, versilbert, in diesem Sinne verwertet<br />
werden. Das geschieht durch Versteigerung oder durch Freihandverkauf. Nur ausnahmsweise<br />
darf das Betreibungsamt vom Versilberungsprinzip abweichen: wenn unter bestimmten<br />
Voraussetzungen die Überweisung gepfändeter Forderungen an einen oder mehrere Gläubiger<br />
verlangt wird.<br />
79
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
48<strong>1.</strong> *Was Beinhaltet das Deckungsprinzip (Buch: Prinzip des Umfanges der<br />
Verwertung)?<br />
Es darf nur so viel verwertet werden, als zur Deckung der Betreibungsforderung nötig ist.<br />
Hinsichtlich des Umfangs der Verwertung gilt somit die gleich Regel wie schon bei der<br />
Pfändung (Verbot der Überpfändung SchKG 97 II)(SchKG 119 II).<br />
War zu viel gepfändet worden, muss das Betreibungsamt die Verwertung einstellen, sobald<br />
der Erlös den Gesamtbetrag der Forderungen mut definitiver oder provisorischer Pfändung,<br />
einschliesslich der aufgelaufenen Verfahrenskosten erreicht SchKG 119 II. Bei<br />
ungenügendem Erlös wird von Amtes wegen nachgepfändet. SchKG 145. (Es müssen bei der<br />
Verwertung auch jene Forderungen, mit bloss provisorischer Pfändung gedeckt werden, auch<br />
wenn sie sich nachträglich noch als unbegründet erweisen können.<br />
482. *Welche Rechtsnatur hat der Verwertungsakt?<br />
Verwertungshandlungen im Vollstreckungsverfahren entspringen nie freier, privater<br />
Willensäusserung des Rechtinhabers der zu verwertenden Vermögensobjekte. Die<br />
betreibungsrechtliche Verwertung ist somit kein privates Rechtsgeschäft zwischen dem<br />
Schuldner und dem Erwerber; sie beruht auf einer amtlichen Verfügung des<br />
Vollstreckungsorgans, gehört folglich dem öffentlichen Recht an. Das gilt nicht nur für<br />
Steigerungszuschlag, sondern auch für den Abschluss eines Freihandverkaufs sowie für die<br />
Forderungsüberweisung bzw. die konkursrechtliche Abtretung.<br />
- Wird die Verwertung aber ausnahmsweise einem Privaten übertragen, ist der Verkauf<br />
oder die Versteigerung privatrechtlicher Natur, und zwar hinsichtlich der<br />
Rechtsbeziehungen zwischen dem privat Beauftragten als auch zwischen diesem und<br />
dem Erwerber.<br />
483. Wie ist der Verwertungsakt anfechtbar?<br />
- wird die Verwertung ausnahmsweise einem Privaten übertragen, so ist die Verwertung<br />
zivilrechtlich anfechtbar, da sie in diesem Fall privatrechtlicher Natur ist.<br />
- Die Verwertung, die öffentlich rechtlicher Natur ist, für die ist abgesehen von<br />
besonderen Zusicherungen oder von absichtlicher Täuschung, die Gewährleistung nach<br />
OR ausgeschlossen Art. 234 I OR und auch die privatrechtliche Anfechtung beim<br />
Zivilrichter. Die Verwertung kann somit nur mit betreibungsrechtlicher Beschwerde<br />
angefochten werden, wobei diese aber betreibungsrechtlich oder auch materiellrechtlich<br />
begründet werden kann SchKG 132a und 143a:<br />
484. In welcher Zeit muss die Beschwerde auf einen Verwertungsakt erfolgen?<br />
Die relative Beschwerdefrist beträgt 10 Tage seit Kenntnis von der Verwertungshandlung und<br />
vom Anfechtungsgrund SchKG 132a. Ein Jahr nach der Verwertung ist das Beschwerderecht<br />
absolut verwirkt SchKG 132a III; die relative Frist ist wiederherstellbar, die absolute<br />
hingegen nicht.<br />
§27 Die Verwertung von beweglichen Sachen, Forderungen und anderen Rechten<br />
485. Was umfasst der Begriff „bewegliche Sachen“ von Art. 122 SchKG?<br />
Er umfasst alle körperlichen Gegenstände, die nicht Grundstücke im Sinne von ZGB 655 sind.<br />
Auch das Zugehör ist eine bewegliche Sache, sie teilt ihr Schicksal mit der Hauptsache und<br />
wird deshalb mit ihr zusammen verwertet (ausnahmsweise kann Zugehör gesondert verwertet<br />
werden).<br />
80
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
486. Wann dürfen in der Regel gepfändete Sachen verwertet werden?<br />
Bewegliche Sachen und Forderungen dürfen frühstens 10 Tage und spätestens 2 Monate nach<br />
Eingang des Verwertungsbegehrens verwertet werden SchKG 122 I. Eine Verwertung<br />
ausserhalb dieser Ordnungsfrist wäre anfechtbar.<br />
Keine solche Rahmenfrist besteht für die Verwertung der anderen Recht SchKG 116 I und<br />
132.<br />
487. Welche Ausnahmen gibt es im Bezug auf den für die Verwertung von<br />
beweglichen Sachen und Forderungen zulässigen Zeitpunkt?<br />
- Die Verwertung kann vorverschoben werden:<br />
o Auf Begehren des Schuldners SchKG 124 I<br />
o Sowie im Falle eines Notverkaufs SchKG 124 II/<strong>Der</strong> Notverkauf ist eine<br />
dringliche Verwaltungshandlung, keine Betreibungshandlung. Infolge dessen<br />
muss er auch während den Betreibungsferien oder eines Rechtsstillstandes<br />
zulässig sein.<br />
- Die Verwertung kann aufgeschoben werden<br />
o Von Gesetztes wegen<br />
Hängende oder stehende Früchte dürfen erst verwertet werden, wenn sie reif sind<br />
SchKG 94; Verwertung vor der Reife ist nur mit Zustimmung des Schuldners<br />
erlaubt SchKG 122 II.<br />
o Durch Verfügung des Betreibungsamtes<br />
Möglichkeit des Verwertungsaufschubes SchKG 123. Da handelt es sich um eine<br />
Stundung.<br />
488. Wer befindet darüber, ob ein Notverkauf angezeigt ist?<br />
Das Betreibungsamt nach Ermessen.<br />
Läuft aber ein Prozess auf Herausgabe der gepfändeten Gegenstände, hat der Richter darüber<br />
zu befinden.<br />
489. Welche Voraussetzungen müssen für einen Aufschub nach SchKG 123 gegeben<br />
sein?<br />
Schuldner muss glaubhaft machen:<br />
- er könne die Schuld ratenweise tilgen, dass er sich zu regelmässigen und angemessenen<br />
Abschlagszahlungen an das Betreibungsamt verpflichtet und<br />
- bereits eine erste Telzahlung geleistet haben<br />
490. Wer ist für das Aufschubsverfahren zuständig?<br />
Dafür ist das Betreibungsamt zuständig SchKG 123 I. Es setzt die Höhe der<br />
Abschlagszahlungen und die Fälligkeit nach freiem Ermessen fest und bewilligt nach Eingang<br />
der ersten Zahlung den Aufschub SchkG 123 I/III.<br />
49<strong>1.</strong> Welche rechtliche Wirkung hat die Frage ob ein Aufschub zu gewähren ist und<br />
die Festsetzung der Rate in einer bestimmten Höhe?<br />
Die Frage ob ein Aufschub zu gewähren sei oder nicht, ist eine Rechtsfrage, die Festsetzung<br />
der Raten und deren Höhe hingegen eine Ermessensfrage SchKG 123 III. Das hat Bedeutung<br />
für den Beschwerdeweg.<br />
492. Ist die Verfügung über den Aufschub, die Höhe und die Fälligkeit Während der<br />
Dauer des Aufschubes abänderbar?<br />
81
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Ja, jederzeit. Das Betreibungsamt kann seine Verfügung auf Antrag des Gläubigers oder des<br />
Schuldners oder von Amts wegen jederzeit ändern, wenn es die Umstände erfordern SchKG<br />
123 V.<br />
493. Wie lange darf der Aufschub dauern?<br />
Die Verwertung darf höchstens auf 12 Monate hinausgeschoben werden, in der Betreibung<br />
auf Forderungen, die gemäss SchKG 219 IV in der ersten Klasse privilegiert sind, sogar nur<br />
bis zu 6 Monaten. Da der Verwertungsaufschub erst nach Zahlung der ersten Rate bewilligt<br />
wird, muss der Schuldner somit in der Lage sein, die Schuld in höchstens 13 bzw. 7 Raten zu<br />
tilgen.<br />
<strong>Der</strong> bewilligte Aufschub verlängert sich um die Dauer eines allfälligen Rechtsstillstandes;<br />
nach Ablauf desselben sind aber die Raten und deren Fälligkeit neu zu bestimmen SchKG 123<br />
IV.<br />
494. Wie fällt der Aufschub dahin?<br />
Von Gesetzes wegen, wenn auch nur eine einzige Rate nicht pünktlich geleistet wird SchKG<br />
123 V: Aus welchem Grund sich der Schuldner in Verzug befindet ist gleichgültig.<br />
Unzulässig wäre auch ein zweiter Aufschub in der gleichen Betreibung. Zahlungen auf<br />
Forderungen, die beim Schuldner gepfändet worden sind und vom Drittschuldner an das<br />
Betreibungsamt geleistet werden, sind jedoch auf die Abschlagszahlungen anzurechnen.<br />
495. Was ist die ordentliche Verwertungsart?<br />
Das ist die öffentliche Versteigerung. Sie ist ausschliesslich bundesrechtlich geregelt SchKG<br />
125 ff.<br />
496. Wie wird die Steigerung vorbereitet?<br />
- öffentliche Bekanntmachung von Ort, Tag und Stunde der Versteigerung. Das<br />
Betreibungsamt bestimmt die Art der Bekanntmachung, die Art und Weise der<br />
Steigerung, den Ort und den Tag der Steigerung nach seinem Ermessen SchKG 125 I<br />
und II. Anders als für die Grundstücksversteigerung bedarf es nicht unbedingt der<br />
Publikation um SHAB oder im kantonalen Amtsblatt i.S. SchKG 35<br />
- Das Betreibungsamt muss mindestens 3 Tage vor dem Termin eine individuelle<br />
Mitteilung von Zeit und Ort der Versteigerung an den Schuldner, die Gläubiger und<br />
beteiligte Dritte erlassen, sofern sie in der Schweiz wohnen oder hier vertreten sind<br />
SchKG 125 III.<br />
497. Was passiert, mit der Steigerung, wenn eine dieser Vorbereitungshandlungen<br />
nicht vorgenommen wurde?<br />
Auf Beschwerden des Betroffenen hin führt dies zur Aufhebung der Steigerung und des<br />
Zuschlags.<br />
498. Was kann der Schuldner oder Gläubiger machen, wenn er mit der Festsetzung<br />
der Versteigerungszeit oder des Tages…nicht einverstanden ist, weil er denkt<br />
diese sei ungünstig gelegen?<br />
Er kann sie mit Ermessensbeschwerden SchKG 17 anfechten.<br />
499. Wer ist berechtigt am Steigerungsverfahren teil zu nehmen?<br />
Weil es sich um einen öffentlichen Verwertungsakt handelt, dürfen alle an der Versteigerung<br />
teilnehmen.<br />
82
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
500. Wie läuft das Steigerungsverfahren ab?<br />
<strong>Der</strong> Steigerungsgegenstand wird nach dreimaligem Aufruf dem Meistbietenden zugeschlagen,<br />
sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:<br />
- Ganz allgemein ist das Deckungsprinzip (nach Buch so genannt) zu wahren SchKG 126.<br />
Danach müssen die im Rang vorgehenden Pfandgesicherten Forderungen, ob fällig oder<br />
nicht, durch das Angebot gedeckt sein. Betreffnisse auf nicht fälligen Pfandforderungen<br />
werden aber nicht ausgezahlt, sondern nach SchKG 9 hinterlegt. Wird kein dem<br />
Deckungsprinzip genügendes Angebot gemacht, fällt die Betreibung hinsichtlich des<br />
Pfandgegenstandes dahin SchKG 126 II. (Allein auf das Retentionsrecht findet das<br />
Deckungsprinzip keine Anwendung der Retentionsgläubiger wird wie ein, wenn auch<br />
bevorzugter Mitbetriebener behandelt).<br />
- Gegenstände aus Edelmetall dürfen nicht unter ihrem Metallwert zugeschlagen werden;<br />
erfolgt kein genügendes Angebot, darf man sie aber nicht zu diesem Preis später<br />
freihändig verkaufen SchKG 128 und 130.<br />
50<strong>1.</strong> *Gibt es in der Schweiz das Erfordernis eines Mindestgebotes?<br />
Nein, ausser wenn auf der Sache ein Pfandrecht ist, dann kann diese Sache nicht unter dem<br />
Pfandwert versteigert werden SchKG 126. Weiter dürfen Gegenstände aus Edelmetall nicht<br />
unter ihrem Metallwert zugeschlagen werden SchKG 128.<br />
502. Was kann das Betreibungsamt machen, wenn nicht anzunehmen ist, dass ein<br />
Zuschlag unter Wahrung des Deckungsprinzips gemacht werden kann?<br />
Es kann auf Antrag des betreibenden Gläubigers von der Verwertung absehen und ohne<br />
weiteres einen Verlustschein ausstellen (SchKG 127)<br />
503. Welcher Rechtsanspruch hat derjenige, nach dreimaligem Aufruf das höchste<br />
allen Anforderungen genügende Angebot macht?<br />
Er hat einen Rechtsanspruch auf Zuschlag. Er kann einen anderen Zuschlag mit Beschwerden<br />
anfechten und dessen Aufhebung verlangen. Nach der Verteilung des Steigerungserlöses ist<br />
die Anfechtung aber ausgeschlossen.<br />
504. Welche Wirkung hat der Zuschlag?<br />
Mit dem Zuschlag erwirbt der Bietende unmittelbar Eigentum am Steigerungsgegenstand OR<br />
235 I; Nutzen und Gefahr gehen in diesem Zeitpunkt auf ihn über.<br />
Die Sache wird dem Ersteigerer jedoch erst nach Bezahlung des Kaufpreises übergeben<br />
SchKG 129 II.<br />
<strong>Der</strong> Zuschlag verpflichtet den Erwerber zur Bahrzahlung des Steigerungspreises SchKG 129<br />
I. In der Regel hat er das sofort zu tun, ausser die Steigerungsbedingungen erwarten erwas<br />
anderes. <strong>Der</strong> Betreibungsbeamte kann ihm jedoch von sich aus einen Zahlungstermin von<br />
höchstens zwanzig Tagen einräumen. Zahlung mit Check gilt als Barzahlung.<br />
505. Was passiert, wenn der Ersteigerer nicht rechtzeitig zahlt?<br />
Dann hebt das Betreibungsamt den Zuschlag auf, womit der Eigentumsübergang ohne<br />
weiteres dahinfällt. Das Betreibungsamt muss dann von Amtes wegen eine neue Steigerung<br />
anordnen SchKG 129 III.<br />
<strong>Der</strong> säumige Ersteigerer und allenfalls sein Bürge haften für den Ausfall gegenüber dem<br />
Ergebnis der früheren Versteigerung und ausserdem für allen weiteren Schaden, insbesondere<br />
für die von ihm verursachten Mehrkosten; der Zinsverlust wird zu 5% berechnet SchKG 129<br />
IV. <strong>Der</strong> Schadenersatzanspruch verjährt innert 10 Jahren OR 127.<br />
83
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
506. *Was passier mit dem Verwertungserlös, der nach Befriedigung des Gläubigers<br />
übrig bleibt?<br />
Er wird an den Schuldner zurückgegeben.<br />
507. *Was macht man, wenn die Vermögenswerte des Schuldners nicht reichen, um<br />
den Gläubiger zu befriedigen?<br />
Dem Gläubiger wird ein Verlustschein ausgestellt.<br />
508. Welche ausserordentlichen Verwertungsarten gibt es?<br />
- den Freihandverkauf SchKG 130<br />
- die Forderungsüberweisung SchKG 131<br />
- ein besonderes Verwaltungsverfahren, das für Vermögensbestandteile anderer Art als<br />
Sachen und Forderungen vorgesehen ist SchKG 132.<br />
509. Wann kann ein Freihandverkauf vorgenommen werden?<br />
SchKG 130.:<br />
- Wenn alle Beteiligten damit ausdrücklich einverstanden sind<br />
Ohne Zustimmung der Beteiligten:<br />
- Wenn Wertpapiere oder anderes Pfändungsgut mit einem Markt- oder Börsenpreis zu,<br />
Tageskurs verkauft werden können<br />
- Wenn für Gegenstände aus Edelmetall, die an der Versteigerung den Metallwert nicht<br />
erreicht haben, nunmehr dieser Preis geboten wird.<br />
- Im Falle eines Notverkaufs SchKG 124<br />
510. Muss das Betreibungsamt, wenn SchKG 130 erfüllt ist, immer ein freihändiger<br />
Verkauf vornehmen?<br />
Nein, das Gesetz bestimmt nur unter welchen Umständen überhaupt ein Freihandverkauf<br />
zulässig wäre. Ob im Einzelfall einer gemacht wird, bleibt dem Ermessen des<br />
Betreibungsbeamten anheim gestellt. <strong>Der</strong> Entscheid des Betreibungsbeamten kann daher auch<br />
nur mit Ermessensbeschwerden angefochten werden.<br />
51<strong>1.</strong> Wann kann eine Rechtsbeschwerde gemacht werden, wenn ein<br />
Betreibungsbeamter einen Freihandverkauf vornimmt?<br />
Wenn freihändig verkauft wird, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht<br />
gegeben sind.<br />
512. Wann kommt die Überweisung der Forderung an Zahlungsstatt zur<br />
Anwendung?<br />
Bei illiquiden Geldforderungen, ohne Markt- oder Börsenpreis, die sich, weil sie bestritten<br />
oder noch nicht fällig sind, kaum einmal vorteilhaft versteigern oder verkaufen lassen.<br />
Sie kommt, weil mit ihr das Versilberungsprinzip durchbrochen wird nur in Frage, wenn<br />
sämtliche Gläubiger, für deren Gruppe die Forderung gepfändet ist, dies verlangen bzw. alle<br />
damit einverstanden sind (Einstimmigkeitsprinzip).<br />
513. Kann das Betreibungsamt nach Ermessen entscheiden, ob es dem einstimmigen<br />
Begehren der Gläubiger auf Forderungsüberweisung stattgeben will oder nicht?<br />
Nein, es muss dem Begehren stattgeben.<br />
514. Welche Arten der Forderungsüberweisung sieht das Gesetz vor?<br />
- die Abtretung einer Forderung zum Nennwert an Zahlungsstatt SchKG 131 I<br />
- und die Übernahme einer Forderung zur Eintreibung SchKG 131 II.<br />
84
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
515. Wie funktioniert die Zession?<br />
Sie ist die rechtsgeschäftliche Übertragung einer Forderung gegen den Schuldner vom alten<br />
Gläubiger (Zedent) auf einen neuen Gläubiger Zessionar. <strong>Der</strong> Schuldner der Forderung ist an<br />
der Abtretung nicht beteiligt, er braucht von dieser nicht einmal Kenntnis zu haben.<br />
516. Wer kommt alles als Abtretungsgläubiger bei der Abtretung einer Forderung<br />
zum Nennwert an Zahlungsstatt in Frage?<br />
Sämtliche an der Pfändung beteiligte Gläubiger kommen in Frage, aus allen<br />
Gläubigergruppen.<br />
517. Welche Wirkungen hat eine Solche Abtretung?<br />
Sie entsprechen weitgehend jenen, einer privatrechtlichen Zession, und zwar der Abtretung an<br />
Zahlungsstatt, ungeachtet dessen, dass die Abtretung als Verwertungsakt auf einer Verfügung<br />
des Betreibungsamtes beruht.<br />
518. *Welche Besonderheiten sind bei der Abtretung einer Forderung zum Nennwert<br />
an Zahlungsstatt zu berücksichtigen?<br />
Erfolgt die Abtretung an sämtliche beteiligten Gläubiger:<br />
- Die Gläubiger treten gemeinsam bis zum Nennwert der abgetretenen Forderung in die<br />
Rechte gegen den Drittschuldner ein. Weil die Abtretung an Zahlungsstatt erfolgt, sind<br />
die Betreibungsforderungen bis zur Höhe des Nennwertes der abgetretenen Forderung<br />
unmittelbar getilgt, unabhängig davon, ob der Drittschuldner dann auch zahlen wird<br />
oder nicht. Im Umfang der Abtretung erlöschen folglich die Betreibungen der<br />
Gruppengläubiger. (Je nach Höhe der Forderung kommt es nur zu einer Teil-Tilgung<br />
oder es bedarf nur einer Teil-Zession).<br />
<strong>Der</strong> Drittschuldner kann den Abtretungsgläubigern folgende Einreden entgegenhalten OR<br />
169:<br />
- aus dem Schuldverhältnis, das der abgetretenen Forderung zugrunde liegt<br />
- persönliche gegen den Zedenten<br />
- persönliche gegen den einzigen Zessionar; gegenüber mehreren Zessionaren aber nur<br />
solche, die alle Zessionare betreffen.<br />
Wird nur an einzelne Gläubiger abgetreten, so ist das für das Verhältnis zwischen Zessionar<br />
und Nichtzessionar bedeutsam:<br />
- Auch in diesem Fall erfolgt die Abtretung ausdrücklich auf gemeinschaftliche Rechnung<br />
aller beteiligter Gläubiger (Zessionare und nicht Zessionare). Aus Sicht der Letzteren<br />
sind die Abtretungsgläubiger deren Inkassomandatare. Materiell wirkt sich die die<br />
Abtretung aber auch auf die Betreibungsforderungen der Nichtzessionare aus – daher<br />
das Einstimmigkeitsprinzip. Als Mandatare handeln die Zessionare immer im Interesse<br />
sämtlicher, an der Pfändung beteiligten Gläubiger wie auch des Betriebenen. Zahlungen<br />
des Drittschuldners kommen letztlich gleichmässig allen Gläubigern zugute. Die<br />
Abtretung begründet somit kein Vorrecht der Zessionare.<br />
Dem Drittschuldner stehen auch hier die Einreden aus dem Schuldverhältnis sowie<br />
persönliche gegen den Zedenten zu. Persönliche Einreden gegen einen Zessionar kommen<br />
aber nur in Frage, wenn sie zugleich alle anderen Pfändungsgläubiger betreffen.<br />
519. In welchen Fällen wird eine Abtretung an Zahlungsstatt höchstens vorkommen?<br />
Sie ist einzig für Forderungen geeignet, mit deren sicheren Eingang nach Fälligkeit gerechnet<br />
werden kann.<br />
85
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
520. Was ist der Unterschied zischen Art. 131 I uns 131 II SchKG?<br />
Die Forderungseintreibung nach 131 II erfolgt im Gegensatz zu der nach 131 I nicht an<br />
Zahlungsstatt; es handelt sich bei II nicht um eine Zession wie bei I. Das Betreibungsamt<br />
ermächtigt in II den oder die Übernehmer bloss zur Eintreibung der Forderung.<br />
52<strong>1.</strong> Welche Wirkungen hat die Übernahme der Betreibung nach 131 II SchKG ?<br />
- Die Gläubigerrechte des Betriebenen gehen nicht auf die übernehmenden Gläubiger<br />
über.<br />
- <strong>Der</strong> Drittschuldner kann den Übernehmern keine Einreden entgegenhalten, die ihm nicht<br />
schon gegen den Betreibungsschuldner zustehen<br />
- Die Gläubiger übernehmen die Eintreibung der Forderung auf eigene Gefahr. Die<br />
Aufwendungen werden ihnen weder vom Betreibungsamt noch von den anderen<br />
Gläubigern ersetzt; sie gehen nicht auf gemeinsame Rechnung.<br />
- Zum Ausgleich dieses Risikos kommt dafür der Nutzten einer erfolgreichen Eintreibung<br />
in erster Linie den übernehmenden Gläubigern zugute. <strong>Der</strong> eingetriebene Betrag dient<br />
vorab dazu ihre Aufwendungen und Betreibungsforderungen samt Zins zu decken. Nur<br />
ein allfälliger Überschuss kommt den übrigen Gläubigern zugut oder fällt zuletzt an den<br />
Betriebenen zurück.<br />
522. Wann wird die Betreibungsübernahme angewendet?<br />
Vor allem, wenn die Erfüllung unsicher ist.<br />
523. Was fällt alles unter die ausserordentliche Verwertung bei der Verwertung<br />
„anderer Rechte“ nach SchKG 132?<br />
- die Nutzniessung<br />
- Anteile an einem Gemeinschaftsvermögen, wie:<br />
o An einer unverteilten Erbschaft<br />
o An einer Personengesellschaft<br />
o Gesamteigentum, Miteigentum<br />
- Immaterialgüterrechte<br />
524. In was besteht der Anteil des Schuldners an einem Gemeinschaftsvermögen?<br />
Er besteht indem dem Schuldner im Falle der Liquidation des Gemeinschaftsvermögens<br />
zufallenden Betrages, also in seinem Liquidationsbetreffnis.<br />
525. Wo ist das Verwertungsverfahren für die Verwertung von Anteilen am<br />
Gemeinschaftsvermögen geregelt?<br />
In einer Verordnung des BGer im VVAG: Die Aufsichtsbehörde bestimmt aber nur den Weg,<br />
der zur Verwertung führt, entscheidet somit keine materiellrechtlichen Fragen.<br />
526. Wo ist das Verwertungsverfahren für Immaterialgüterrechte geregelt?<br />
Es besteht dafür neben SchKG 132 keine besondere Regelung, man wendet aber das VVAG<br />
analog darauf an.<br />
527. Wie läuft das Verwertungsverfahren für Immaterialgüterrechte ab?<br />
Das Betreibungsamt ersucht die Aufsichtsbehörde, das Verfahren festzulegen SchKG 132 I<br />
und II: Diese hört die Beteiligten an und bestimmt sodann die Verwertungsart nach ihren<br />
Ermessen SchKG 132 III. In Frage kommt die Durchführung einer Versteigerung, ein<br />
Freihandverkauf, die Übertragung der Verwertung an einen Verwalter oder die Anordnung<br />
anderer geeigneter Vorkehren. Jedenfalls soll für ein möglichst günstiges Ergebnis Gewähr<br />
bestehen.<br />
86
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
§28 Die Verwertung von Grundstücken<br />
528. Was ist alles Gegenstand der Grundstückverwertung?<br />
Alles, das in ZGB 655 II als Grundstück bezeichnet wird, gleichgültig ob es bebaut oder<br />
unbebaut ist.<br />
529. Was ist ein Unterschied zwischen der Spezialexekution und der<br />
Generalexekution, der besondere Missbrauchsmassnahmen in der<br />
Spezialexekution erfordert?<br />
Dass bei der Spezialexekution im Unterschied zur Generalexekution nicht alle Gläubiger am<br />
Vollstreckungsverfahren teilnahmen.<br />
530. Wo ist die Grundstückverwertung umfassend geregelt?<br />
Da im SchKG nur einige wenige Grundsätze zu finden sind in der VZG und z.T. noch in<br />
anderen Gesetzen.<br />
53<strong>1.</strong> Wann sollen Grundstücke verwertet werden?<br />
Frühestens einen Monat und spätestens drei Monate nach Eingang des Verwertungsbegehrens<br />
SchKG 133 I. (Kommt es aber im Rahmen der Lastenbereinigung zu einem Prozess, muss<br />
unter Umständen die Verwertung ausgesetzt werden, so dass weder diese Ordnungsfrist noch<br />
der angekündigte Steigerungstermin eingehalten werden können).<br />
Vorzeitige Verwertung, bevor überhaupt die Gläubiger das Verwertungsbegehren stellen<br />
dürfen, kann nur auf Begehren des Schuldners und im ausdrücklichen Einverständnis der<br />
Pfändungs- und der Grundpfandgläubiger stattfinden SchKG 133 II.<br />
532. Kann die Grundstückverwertung gegen Leistung von Abschlagszahlungen<br />
aufgeschoben werden?<br />
Ja, SchKG 143a weist explizit auf SchKG 123. <strong>Der</strong> Aufschub ist jedoch nur zulässig, wenn<br />
der Schuldner ausser der festgesetzten ersten Abschlagszahlung auch die Kosten für die<br />
Vorbereitung und Verschiebung einer bereits angeordneten Versteigerung sofort entrichtet.<br />
533. Wer ist für die Verwertung von Grundstücken zuständig?<br />
Auch Grundstücke werden grundsätzlich vom Betreibungsamt des Ortes verwertet, wo sie<br />
oder ihr wertvollster Teil liegen. Befindet sich das Grundstück ausserhalb des Kreises des<br />
Amtes, das die Betreibung führt, bedarf es der Rechtshilfe des örtlich zuständigen Amtes.<br />
Eine öffentliche Versteigerung darf wie bei einer beweglichen Sache ausschliesslich das<br />
örtlich zuständige Amt durchführen.<br />
534. Wie wird Zugehör in der Verwertung behandelt?<br />
Mitgepfändetes Zugehör wird mit dem Grundstück zusammen verwertet. Nur mit<br />
Zustimmung sämtlicher Beteiligter darf sie gesondert verwertet werden. Fehlt diese<br />
Zustimmung, so können der Schuldner und jeder Gläubiger bei der Versteigerung immerhin<br />
verlangen, dass das Grundstück und die Zugehör je einmal getrennt und einmal zusammen<br />
aufgerufen werden (Doppelter Aufruf).<br />
535. Welche Vorbereitungshandlungen muss das Betreibungsamt treffen, wenn die<br />
Verwertung nicht aufgeschoben ist?<br />
- es muss die Steigerungspublikation erlassen (ausser es käme von Vornherein nur<br />
Freihandverkauf in Frage)<br />
- es muss das Lastenverzeichnis erstellen und das Lastenbereinigungsverfahren einleiten<br />
87
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- das Grundstück neu schätzen<br />
- und die Steigerungsbedingungen – im Falle eines Freihändigen Verkaufs die<br />
Verkaufsbedingungen – festsetzen.<br />
536. Mit welchem Rechtsmittel können Fehler bei der Vorbereitung gerügt werden?<br />
Mit Beschwerde.<br />
537. Wann muss die Steigerung bekannt gemacht werden?<br />
Mindestens einen Monat vor derVersteigerung SchKG 138 I.<br />
538. In welcher Form muss die Publikation der Steigerung bekannt gemacht werden?<br />
Nach den Vorschriften von SchKG 35.<br />
539. Welcher Zweck verfolgt die Steigerungspublikation?<br />
Sie dient der Vorbereitung der Verwertung (Ergänzung des Lastenverzeichnisses und der<br />
Lastenbereinigung), sodann vor allem auch der späteren Durchführung der Versteigerung.<br />
540. Welcher Mindestinhalt muss das Lastenverzeichnis haben?<br />
SchKG 138 II:<br />
- Ort, Tag, Stunde der Steigerung<br />
- Das Datum, von dem an die Steigerungsbedingungen samt dem Lastenverzeichnis<br />
aufliegen<br />
- Den Namen des Grundstückseigentümer<br />
- Die genaue Bezeichnung des Grundstücks mit seinem Schätzwert<br />
- Die Aufforderung an die Pfandgläubiger und weitere Berechtigte, ihre Ansprüche am<br />
Grundstück binnen 20 Tagen anzumelden, verbunden mit der Androhung, dass nicht<br />
angemeldete Ansprüche bei der Verwertung und Verteilung nicht berücksichtigt werden,<br />
soweit sie nicht aus dem Grundbuch hervorgehen.<br />
54<strong>1.</strong> Welch weitere Mitteilung neben der Steigerungspublikation muss das<br />
Betreibungsamt wenn möglich noch machen?<br />
Eine Spezialanzeige an die Beteiligten, sofern sie einen bekannten Wohnsitz oder einen<br />
Vertreter haben haben SchKG 139.<br />
542. Welche Rechte müssen im Lastenverzeichnis angemeldet werden?<br />
Empfohlen wird, alle Rechte, die an einem Grundstück bestehen anzumelden.<br />
Unbedingt anzumelden sind Rechte, die nicht aus dem Grundbuch hervorgehen, denn von<br />
Amtes wegen werden nur die darin belegten berücksichtigt SchKG 140 I.<br />
543. Welche Rechte bedürfen keiner Anmeldung im Lastenverzeichnis?<br />
Die sog. servitutes apparentes, die ohne Eintrag wirksam sind (ZGB 676 III und 691); für sie<br />
besteht natürliche Publizität. Auch öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen müssen<br />
nicht angemeldet werden.<br />
544. Wie lange ist die Anmeldefrist?<br />
Sie beträgt 20 Tage SchKG 138 II Ziff. 3. Es ist eine Verwirkungsfrist, sie kann aber<br />
verlängert oder wiederhergestellt werden.<br />
88
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
545. Was passiert mit Lasten, die nach Fristablauf angemeldet werden?<br />
Sie dürfen nicht mehr in das Verzeichnis aufgenommen werden, es sei denn sie gingen<br />
ohnehin aus dem Grundbuch hervor oder wären dem Betreibungsamt sonst wie vorher zur<br />
Kenntnis gekommen SchKG 138 II Ziff. 3.<br />
546. Was muss das Betreibungsamt machen, wenn es einen zu spät erhobenen<br />
Anspruch ausschliesst?<br />
Es muss den Ansprecher sofort benachrichtigen unter Hinweis auf sein Beschwerderecht.<br />
547. Welche Erfordernisse muss die öffentliche Anmeldung von Ansprüchen im Falle<br />
eines Freihandverkaufs haben?<br />
Es müssen etwa die gleichen Sachen bezeichnet werden, wie bei einer öffentlichen Steigerung<br />
SchKG 143b II verweist auf SchKG 135-138.<br />
548. Was muss gemacht werden, wenn ein Freihandverkauf letzten Endes trotzdem<br />
nicht zustande kommt?<br />
Es muss eine Steigerungspublikation nachgeholt werden, es braucht aber keine weitere<br />
Aufforderung zur Anmeldung der Ansprüche.<br />
549. Was für eine Funktion hat das Lastenverzeichnis?<br />
Es dient der Abklärung der auf dem Grundstück haftenden dinglichen und realobligatorischen<br />
Rechten. Es bildet die unerlässliche und sichere Grundlage für die Verwertung.<br />
550. Wieso ist die Abklärung dieser Lasten ist notwendig?<br />
- weil einzelne Lasten dem Erwerber des Grundstücks überbunden werden<br />
- weil nur absolute Klarheit über die bestehenden Lasten es erlaubt, an der Versteigerung<br />
das Deckungsprinzip bzw. der doppelte Aufruf zuverlässig einzuhalten<br />
- weil die konkrete Belastung des Verwertungserlös bzw. den Mindestpreis beeinflussen<br />
55<strong>1.</strong> Was passiert, wenn das Lastenverzeichnis an einem wesentlichen Mangel leidet?<br />
Dann kann keine gültige Verwertung zustande kommen; der Zuschlag wäre nichtig.<br />
552. Was ist der Inhalt des Lastenverzeichnisses?<br />
SchKG 140 und VZG:<br />
- die Bezeichnung des Grundstückes samt Zugehör und dessen Schätzung anlässlich der<br />
Pfändung<br />
- die auf dem Grundstück ruhenden Lasten nach ihrem Rang<br />
- Lasten die erst nach der Pfändung des Grundstücks in das Grundbuch eingetragen<br />
werden, sind unter Hinweis auf diesen Umstand und mit der Bemerkung aufzunehmen,<br />
dass sie nur Berücksichtigt werden sofern und soweit die Pfändungsgläubiger<br />
vollständig befriedigt sind.<br />
553. Welche Phasen gibt es im Verfahren zur Erstellung des Lastenverzeichnisses gibt<br />
es?<br />
Es gibt drei Phasen:<br />
- die Grundlegung<br />
- die Ergänzung<br />
- die Bereinigung<br />
554. Was beinhaltet die Grundlegung?<br />
89
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Da wird die Grundlage des Lastenverzeichnisses erstellt. Diese bildet der Grundbuchauszug<br />
SchKG 140 I. Ausser den im Grundbuch ausgewiesenen Lasten werden von Amtes wegen<br />
darin noch aufgenommen:<br />
- unmittelbare gesetzliche Pfandrechte<br />
- servitutes apparentes<br />
- gesetzliche Verfügungsbeschränkungen<br />
555. Was wird in der Phase der Ergänzung gemacht?<br />
Da werden die gestützt auf die öffentliche Aufforderung gemachten Eingaben berücksichtigt;<br />
das Lastenverzeichnis wird entsprechend ergänzt. Weicht eine Anmeldung vom Inhalt des<br />
Grundbuchauszuges ab, so ist der Anspruch dennoch gemäss Anmeldung in das<br />
Lastenverzeichnis aufzunehmen, ausserdem aber auch der Inhalt des Grundbuch Eintrages<br />
anzugeben. Das Betreibungsamt hat jede formell korrekte und rechtzeitige Anmeldung zu<br />
berücksichtigen, ohne irgendwelche materielle Prüfung.<br />
Das ergänzte Lastenverzeichnis wird danach allen Beteiligten mitgeteilt.<br />
556. Was muss man als Person alles machen, wenn man eine Eingabe bezüglich des<br />
Grundstücks auf die öffentliche Aufforderung hin macht?<br />
Man muss die 20 tägige Frist einhalten SchKG 138 II Ziff. 3.<br />
<strong>Der</strong> ein Recht anmeldende Gläubiger hat sich über seine Person und seine Berechtigung<br />
auszuweisen, sofern nicht schon das Grundbuch darüber Auskunft gibt.<br />
557. Was beinhaltet die Bereinigung?<br />
Da wird abgeklärt ob, und inwiefern die aufgenommenen Lasten bei der Verwertung als<br />
rechtmässig berücksichtigt werden dürfen. Dies geschieht in einem besonderen zweiteiligen<br />
Lastenbereinigungsverfahren, das nach den Regeln des Widerspruchverfahrens verläuft<br />
SchKG 140 II.<br />
558. Welches sind die zwei Teile des Lastenbereinigungsverfahrens?<br />
- Das Bestreitungsverfahren<br />
- <strong>Der</strong> Lastenbereinigungsprozess<br />
559. Was passiert zuerst im Bereinigungsverfahren?<br />
Das gestützt auf die Anmeldungen ergänzte Lastenverzeichnis wird allen Beteiligten<br />
mitgeteilt; gleichzeitig wird ihnen eine Frist von 10 Tagen gesetzt, um Bestand, Umfang,<br />
Rang oder Fälligkeit eines aufgenommenen Anspruchs zu bestreiten SchKG 140 II.<br />
560. Was passier, wenn das Lastenverzeichnis unbestritten bleibt?<br />
Bleibt das Verzeichnis unbestritten so gelten die darin enthaltenen Lasten für die hängige<br />
Betreibung als anerkannt.<br />
56<strong>1.</strong> *Was passiert im Bereinigungsverfahren, wenn ein in das Lastenverzeichnis<br />
aufgenommener oder ein nicht darin aufgenommener, jedoch behaupteter<br />
Anspruch bestritten wird?<br />
Dann muss nach SchKG 140 II das Widerspruchsverfahren durchgeführt werden.<br />
- Im Falle der Bestreitung des Bestandes oder des Ranges eines im Grundbuch<br />
eingetragenen oder eines unmittelbar kraft Gesetzes geltenden Rechts fordert das<br />
Betreibungsamt den Bestreitenden auf, binnen 20 Tagen auf Aberkennung des<br />
Anspruchs zu klagen SchKG 108<br />
90
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Ergibt sich hingegen das bestrittene Recht weder aus dem Grundbuch noch unmittelbar<br />
kraft Gesetzes, so wird der Ansprecher aufgefordert, binnen 20 Tagen auf Feststellung<br />
des von ihm behaupteten Rechts zu klagen SchKG 107.<br />
562. Was passiert, wenn nicht rechtzeitig geklagt wird?<br />
Das bedeutet verfahrensmässig:<br />
- dass der Bestreitende das im Grundbuch eingetragene oder gesetzliche Recht anerkennt<br />
SchKG 108 III<br />
- oder dass der Ansprecher auf das von ihm behauptete aber bestrittene Recht verzichtet<br />
SchKG 107 V.<br />
563. Was passiert, wenn die Klage rechtzeitig erhoben wurde?<br />
Dann kommt es zum Lastenbereinigungsprozess.<br />
564. Was ist der Zweck des Lastenbereinigungsprozesses/wo wird er<br />
Durchgeführt/sonstige Merkmale?<br />
<strong>Der</strong> streitige Anspruch wird im ordentlichen (beschleunigten) Verfahren abgeklärt.<br />
Es wird damit eine Änderung des Lastenverzeichnisses bezweckt.<br />
Die Klage ist am Ort der gelegenen Sache beim zuständigen Richter anzubringen SchKG 109<br />
III.<br />
Die Parteirollen werden wieder wie im Widerspruchsverfahren durch das Betreibungsamt<br />
verteilt, wobei der Grundbucheintrag die Funktion des „Gewahrsams“ übernimmt.<br />
565. Welche Rechtsnatur hat die Klage im Lastenbereinigungsprozess?<br />
Da es die gleiche ist wie beim Widerspruchsverfahren die gleiche Wirkung wie dort. Sie ist<br />
eine betreibungsrechtliche Klage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht. Ausser, wenn<br />
sie zwischen einem Gläubiger und dem Schuldner durchgeführt wird, dann entfaltet sie volle<br />
materielle Rechtswirkung.<br />
566. Wann kommt das Beschwerdeverfahren und nicht der<br />
Lastenbereinigungsprozess zum Zug?<br />
Wenn sich der Streit nicht um einen im Lastenverzeichnis aufgeführten Anspruch dreht,<br />
sondern um die Einhaltung der Verfahrensvorschriften bei dessen Grundlegung, Ergänzung<br />
und Bereinigung. Da ist nicht der Richter zuständig sonder die Aufsichtsbehörde.<br />
91
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
567. Welche Möglichkeiten gibt es, wie die dritte Phase der Erstellung des<br />
Lastenverzeichnisses (<strong>1.</strong> Grundlegung/2. Ergänzung/3. Bereinigung) alles<br />
ablaufen könnte?<br />
Lastenbereinigung<br />
Bestreitungsverfahren<br />
Das gestützt auf die Anmeldung ergänzte Lastenverzeichnis wird allen<br />
Beteiligten mitgeteilt. Sie haben 10 Tage, um Bestand, Umfang, Rang<br />
oder Fälligkeit eines aufgenommenen Anspruchs zu bestreiten SchKG<br />
140 II<br />
Unbestritten →die darin<br />
enthaltenen Lasten gelten als<br />
anerkannt<br />
Beschwerdeverfahren<br />
Wenn sich der Streit nicht um ein im<br />
Lastenverzeichnis aufgeführten<br />
Anspruch sondern um die Einhaltung<br />
der Verfahrensvorschriften bei der<br />
Grundlegung, Ergänzung und<br />
Bereinigung<br />
Anspruch bestritten, weil zu<br />
unrecht aufgenommen oder<br />
nicht aufgenommen<br />
Lastenbereinigungsprozess<br />
Analog Widerspruchsverfahren<br />
„Gewahrsam“ übernimmt hier<br />
GB-Eintrag<br />
568. Welche Wirkungen hat das Lastenverzeichnis?<br />
- Es hat nur Wirkung in der hängigen Betreibung<br />
- Das rechtskräftige Lastenverzeichnis bindet den Erwerber SchKG 135. Dieser<br />
übernimmt mit dem Zuschlag auch alle darin enthaltenen Lasten. Andererseits erlöschen<br />
gegenüber dem gutgläubigern Erwerber alle dinglichen und realobligatorischen Rechte,<br />
die nicht im Lastenverzeichnis aufgenommen sind, selbst die im Grundbuch<br />
eingetragenen. Ausgenommen von der Regel des Untergangs von im Lastenverzeichnis<br />
nicht verzeichneten Rechte sind nut die servitutes apparentes. Geht aufgrund dieser<br />
betreibungsrechtlichen Ordnung ein im Grundbucheingetragenes Recht verloren, weil es<br />
nicht ins Lastenverzeichnis aufgenommen wurde, stellt sich die Frage der Staatshaftung.<br />
569. Was muss nach Bereinigung des Lastenverzeichnisses weiter gemacht werden?¨<br />
Es muss neu geschätzt werden SchKG 140 III. Ergibt sich keine Abweichung von der<br />
Pfändungsschätzung wird diese einfach bestätigt. Die neue Schätzung wird allen Beteiligten<br />
mitgeteilt.<br />
570. Was macht man zuletzt, bevor das Grundstück versteigert wird?<br />
Man stellt die Steigerungsbedingungen auf. Das rechtskräftige Lastenverzeichnis wird ihnen<br />
als wesentlicher Bestandteil beigefügt.<br />
92
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
57<strong>1.</strong> Welchen Zweck erfüllen die Steigerungsbedingungen?<br />
Sie bilden die Grundlage der bevorstehenden Versteigerung. Sie bestimmen die Art und<br />
Weise derselben, insbesondere die Modalitäten des Zuschlags. Mindestens 10 Tage vor dem<br />
Steigerungstag werden sie auf dem Amt zur Allgemeinen Einsicht aufgelegt SchKG 134.<br />
572. Was kann gegen die aufgelegten Steigerungsbedingungen für ein Rechtsmittel<br />
ergriffen werden?<br />
Es kann Beschwerde erhoben werden. Das rechtskräftige Lastenverzeichnis ist dabei aber<br />
nicht mehr anfechtbar.<br />
573. Was passiert, wenn es durch Anfechtung mit Beschwerde zu einer Änderung der<br />
Bedingungen kommt?<br />
Dann sind die Steigerungsbedingungen neu aufzulegen, öffentlich bekannt zu machen und<br />
den Beteiligten einzeln mitzuteilen.<br />
574. Kann man die Steigerungsbedingungen auch nach erfolgtem Zuschlag noch<br />
anfechten?<br />
Nein.<br />
575. *Welche Ansprüche werden bei den Grundpfandforderungen dem Neuerwerber<br />
überbunden?<br />
Nur die, die nicht fällig sind. Die fälligen sind vorweg ad dem Steigerungserlös zu bezahlen.<br />
576. Welches Prinzip hilft das Lastenverzeichnis erfüllen?<br />
Nach <strong>Vorlesung</strong>: das Deckungsprinzip/Verbot der Überpfändung SchKG 97.<br />
577. Muss auch bei der Verwertung von Grundstücken das Deckungsprinzip (Begriff<br />
Buch) beachtet werden?<br />
Ja, das Deckungsprinzipgilt auch hier, Verweis in SchKG 142a und zwar für die Verwertung<br />
auf dem Weg der Versteigerung oder auf dem Weg des freihändigen Verkaufs. Die Rangfolge<br />
bestimmt sich nach dem Lastenverzeichnis.<br />
578. Was ist eine Besonderheit der Grundstücksversteigerung?<br />
<strong>Der</strong> Doppelaufruf.<br />
579. In welchen Fällen kommt der Doppelaufruf in Betracht?<br />
- Wenn das Grundstück ohne Zustimmung des im Range vorgehenden Grundpfandgläubigers<br />
nachträglich mit einer Dienstbarkeit, einer Grundlast oder mit einem vorgemerkten<br />
persönlichen Recht belastet wurde. <strong>Der</strong> Grundpfandgläubiger kann dann, sofern der Vorrang<br />
seines aus dem Lastenverzeichnis hervor geht, binnen 10 Tagen seit dessen Mitteilung den<br />
Aufruf sowohl mit als auch ohne die später begründete Last verlangen SchKG 142 I.<br />
SchKG 142 II kommt zur Anwendung, wenn sich der Vorrang des Pfandrechts nicht aus dem<br />
Lastenverzeichnis ergibt. Dann wird dem Begehren auf Doppelaufruf nur stattgegeben, wenn<br />
der Inhaber des betroffenen Rechts den Vorrang anerkannt hat oder der Grundpfandgläubiger<br />
nach Zustellung des Lastenverzeichnisses am Ort der gelegenen Sache Klage auf Feststellung<br />
des Vorranges einreicht (Anwendungsfall der Lastenbereinigungsklage).<br />
- <strong>Der</strong> Doppelaufruf kann auch von einem Ansprecher verlangt werden, dessen Recht von<br />
einem anderen Gläubiger im Lastenbereinigungsverfahren mit Erfolg bestritten, vom<br />
Schuldner jedoch durch Nichtbestreiten anerkannt wurde.<br />
- Schiesslich wird doppelt aufgerufen, wenn mit dem Grundstück gleichzeitig Zugehör<br />
gepfändet wurde.<br />
93
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
580. Wie läuft der Doppelaufruf im Fall von SchKG 142 I und II ab?<br />
Zuerst wird das Gunstück mit der Last ausgerufen (Erstaufruf). Bietet das Höchstangebot<br />
Deckung auch für die Forderung des vorgehenden Pfandgläubigers, so erübrigt sich ein<br />
zweiter Aufruf ohne die Last: das Grundstück wird dann mit der Last zugeschlagen.<br />
Nach einem ungenügenden Angebot erfolgt noch ein Aufruf ohne die Last (Zweitaufruf).<br />
Wird hierauf für das Grundstück ein höheres Angebot gemacht, so wird ohne die Last<br />
zugeschlagen. Andernfalls geht das Grundstück ohne die Last an den Meistbietenden<br />
anlässlich des Erstaufrufs. Wird ohne die Last zugeschlagen, so kann der<br />
Grundpfandgläubiger deren Löschung im Grundbuch verlangen, ein allfälliger Überschuss<br />
des Erlöses geht nach Befriedigung des vorgehenden Gläubigers bid zur Höhe des Wertes der<br />
Last an den Berechtigten SchKG 142 III.<br />
58<strong>1.</strong> Wie läuft der Doppelaufruf im Fall ab, wenn das Recht eines Ansprechers im<br />
Lastenbereinigungsverfahren von einem Gläubiger mit Erfolg bestritten wurde,<br />
vom Schuldner jeoch durch Nichtbestreiten anerkannt wurde?<br />
Ergibt da, der Erstaufruf mit der Last volle Deckung für den Anspruch des vorgehenden,<br />
bestreitenden Gläubigers, bleibt sie bestehen und wird dem Erwerber, obwohl an sich mit<br />
Erfolg bestritten überbunden.<br />
582. Wie läuft der Doppelaufruf im Fall ab, wo mit dem Grundstück gleichzeitig<br />
Zugehör gepfändet wurde?<br />
Da können die Beteiligten verlangen, dass Grundstücke und Zugehör vorerst getrennt, dann<br />
zusammen aufgerufen werden. Eigentlich ein dreifacher Aufruf!<br />
<strong>1.</strong> Grundstück<br />
2. Zubehör<br />
3. Grundstück mit Zubehör<br />
Übersteigt das Gesamtangebot die Summe der beiden Einzelangebote, so fallen diese dahin.<br />
583. In welchem Fall von "Lasten" wird der Doppelaufruf angewendet?<br />
Nur für solche Lasten, die dem betreibenden Gläubiger nicht vorgehen. Sind nämlich die dem<br />
betreibenden Gläubiger im Range vorgehenden Lasten nicht gedeckt, darf das Grundstück mit<br />
den Lasten nicht verkauft werden und die Betreibung fällt in Hinsicht auf diesen Gegenstand<br />
dahin SchKG 126 I und II.<br />
584. Wer kommt als Ersteigerer in Betracht?<br />
<strong>Der</strong> Zuschlag darf nur auf Angebote bezeichneter, bekannter Personen erteilt werden. Daher<br />
ist es üblich, vom Ersteigerer einen Ausweis zu verlangen.<br />
585. Wie geht in der Grudstücksversteigerung das Recht über?<br />
<strong>Der</strong> Zuschlag bewirkt den Eigentumsübergang. Wird der Zuschlag mit Beschwerde<br />
angefochten, so tritt diese Wirkung allerdinge erst ex nunc von der Eröffnung des<br />
bestätigenden Beschwerdeentscheides an ein. <strong>Der</strong> Steigerer erwirbt das Eigentum originär und<br />
ist damit unter Vorbehalt von SchKG 106 III gegen Entwehr geschützt. Mit dem Eigentum<br />
geht sofort Nutzen und Gefahr auf den Erwerber über.<br />
586. Ab wann kann der Erwerber über das Grunsdtück verfügen?<br />
Erst, wenn er als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist.<br />
Die Anmeldung dazu geschieht von Amtes wegen, gleich wie die Anmeldung zur Löschung<br />
nicht Überbundener Lasten SchKG 150 III.<br />
94
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
587. Wann wird der Eigentumsübergang zum Eintrag im Grundbuch angemeldet?<br />
Erst, wenn die Beschwerdefrist gegen den Zuschlag abgelaufen oder eine Beschwerde<br />
endgültig erledigt istsowie, wenn die Kosten der Eigentumsübertragung und der<br />
Steigerungspreis bezahlt oder wenigstens sichergestellt sind SchKG 137.<br />
588. Was passiert bei Zahlungsverzug des Ersteigerers?<br />
Das hat zur Folge, dass der Zuschlag widerrufen und der Eigentumsübergang rückgängig<br />
gemacht wird. Mit dem Widerruf fällt das Grundeigentum eo ipso an den Schuldner zurück.<br />
Naach dem Widerruf des Zuschlags ordnert das Betreibungsamt sofort eine neue Steigerung<br />
an SchKG 143 I.<br />
Auch bei der Grundstücksversteigerung haften der säumige Ersteigerer und seine Bürgen für<br />
den Ausfall und allen weiteren Schaden; der Zinsverlust wird zu 5% berechnet SchKG 143 II.<br />
589. Unter welchen Umständen kommt der Freihandverkauf zum Zug?<br />
Wenn 3 Bedingungen kummulativ erfüllt sind SchKG 143b und dann auch nur, wenn sich das<br />
Betreibungsamt dafür entscheidet (Ermessensfrage).<br />
<strong>1.</strong> Einverständnis aller Beteiligten<br />
2. die Lastenbereinigung muss durchgeführt worden sein /rechtskräftiges Lastenverzeichnis)<br />
3. der Schätzungspreis muss eingehalten werden<br />
590. Wer ist alles Beteiligter am Verfahren?<br />
Beteiligter ist, wer in der Vollstreckung als Partei auftritt oder wessen Rechte von der<br />
Verwertung des Grundstücks unmittelbar betroffen werden.<br />
59<strong>1.</strong> Muss das Einverständnis der Beteiligten in einer besonderen Form erfolgen?<br />
Nein. Es empfiehlt sich aber schriftliche Zustimmung zum "Verkaufsentwurf" einzuholen.<br />
Nichteinholen der Zustimmung ist ein Beschwerdegrund.<br />
592. Was gilt beim freihändigen Verkauf als Mindestpreis?<br />
<strong>Der</strong> Betrag der Neuschätzung nach Bereinigung des Lastenverzeichnisses SchKG 143b I.<br />
593. Wie wird der Feihandverkauf abgewickelt?<br />
- Form: er ist zu protokollieren SchKG 8; zudem bedarf es einer schriftlichen<br />
Verkaufsverfügung. Nicht erforderlich ist aber die öffentliche Beurkundung, da es sich<br />
hier nicht um einen privatrechtlichen Kaufvertrag handelt sondern um eine Verfügung<br />
des Betreibungsamtes. Dazu genügt einfache Schriftlichkeit.<br />
- Deckungsprinzip (i.S. des Buches): Dieses ist auch beim Freihandverkauf zu<br />
respektieren<br />
- Doppelter Aufruf, der kann auch beim Freihandverkauf in der Weise stattfinden, dass<br />
das Grundstück den Interessenten einmal mit und einmal ohne die nachgehende Last<br />
angeboten wird<br />
- Bezüglich Lastenüberbindung, Kaufpreis- und Kostenliquidation, Zahlungstermin,<br />
Gewährleistung sowie Verzug des Erwerbers gilt das gleiche wie bei der Steigerung.<br />
- Eigentumsübergang: Eigentum geht mit der zu protokollierenden amtlichen<br />
Verkaufsverfügung auf den Erwerber über.<br />
- Anfechtung: der Freihandverkauf kann mit Beschwerde angefochten werden SchKG<br />
132a und 143a. Über die Annahme bzw. verweigerte Annahme eines Angebotes kann,<br />
wie über den (nicht erteilten) Steigerungszuschlag im Beschwerdeverfahren gemäss<br />
SchKG 17 ff entschieden werden.<br />
95
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
3. Abschnitt: Die Verwertung<br />
§29 Voraussetzungen und Verfahren der Verteilung<br />
594. Was ist das materielle Ergebnis der Verwertung?<br />
<strong>Der</strong> Erlös.<br />
595. Was passiert mit dem Erlös?<br />
Er wird unter den beteiligten Gläubigern verteilt.<br />
596. Muss man einen Antrag auf Verteilung stellen?<br />
Nein, sie wird immer von Amtes wegen vorgenommen. Sie folgt zwangsläufig auf die<br />
Verwertung und führt so die Betreibung ans Ziel.<br />
597. Wann findet die Verteilung statt?<br />
Sie setzt grundsätzlich voraus, dass das gesamte Pfändungsgut verwertet ist, SchKG 144 I.<br />
598. Wann darf von der Regel abgewichen, dass erst nach gesamter Verwertung des<br />
Pfändungsgutes verteilt werden kann?<br />
Nur wenn es das Gesetz ausdrücklich gestattet:<br />
- Das Betreibungsamt kann jederzeit nach seinem Ermessen Abschlagszahlungen<br />
vornehmen, wenn es die Verhältnisse rechtfertigen und keine Beeinträchtigung des<br />
Endergebnisses der Verteilung zu befürchten ist SchKG 144 II. Wichtig ist dann nur,<br />
dass alle Gläubiger einer Pfändungsgruppe gleich behandelt werden.<br />
- Nach Eingang des Erlöses aus der Verwertung eines Grundstückes sollen die im<br />
rechtskräftigen Lastenverzeichnis enthaltenen fälligen Grundpfandforderungen sofort<br />
bezahlt werden, selbst wenn die Schlussverteilung an die Pfandgläubiger noch nicht<br />
möglich ist.<br />
- Unter Umständen kann es sogar zur Schlussverteilung kommen, bevor alles oder<br />
überhaupt etwas verwertet worden ist, nämlich wenn sonst schon hinreichende Mittel<br />
vorhanden sind. Die Verwertung muss dann weil sie zwecklos wäre eingestellt werden.<br />
599. Wird zuerst alles Verwertet und dann an die verschiedenen Gläubigergruppen<br />
verteilt?<br />
Nein, für jede Pfändungsgruppe wird gesondert verwertet und verteilt, wobei allfällige<br />
Ansprüche einer nachfolgenden Gruppe auf den Mehrerlös zu berücksichtigen sind SchKG<br />
110 III.<br />
600. Wie läuft das Verteilungsverfahren ab?<br />
<strong>1.</strong> Vorab sind aus dem Ergebnis die Kosten der Verwaltung, Verwertung und<br />
Verteilung zu decken SchKG 144 III. Von den Gläubigern daran geleistete<br />
Vorschüsse werden diesen zurückerstattet. Das ergibt dann den an die<br />
Gläubiger zu verteilenden Reinerlös.<br />
2. Erst der Reinerlös wird den darauf berechtigten Gläubigern zugewiesen<br />
und zwar bis zur Höhe ihrer Forderungen, einschliesslich Zins und<br />
Betreibungskosten SchKG 144 IV<br />
60<strong>1.</strong> Wer ist auf einen Anteil am Reinerlös berechtigt?<br />
- allgemein und in erster Linie die Pfandgläubiger fälliger Forderungen sowie<br />
Retentionsberechtigte<br />
96
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- bei der Grundstücksverwertung zudem allfällig Dienstbarkeitsberechtigte oder Inhaber<br />
vorgemerkter persönlicher Rechte, die dem doppelten Aufruf zum Opfer gefallen und<br />
aus einem möglichen Überschuss zu entschädigen sind<br />
- zuletzt die zur betreffenden Pfändungsgruppe gehörenden Betreibungsgläubiger<br />
602. *Wird der Erlös auch an die Gläubiger ausgezahlt, die provisorisch an der<br />
Pfändung beteiligt sind?<br />
Nein, die Auszahlung kommt nur an die Gläubiger in Betracht, die mit einer definitiven<br />
Pfändung am Verfahren teilnehmen. Beträge, die auf bloss provisorische Pfändungen<br />
entfallen, sind einstweilen bei der Depositenanstalt zu hinterlegen SchKG 144 V. Sie dürfen<br />
erst aufgezahlt werden, wenn die Pfändung definitiv geworden ist. Kommt es nicht dazu und<br />
fällt die Forderung des betroffenen Gläubigers infolgedessen aus der Betreibung heraus, so<br />
wird der hinterlegte Betrag unter die Gruppengläubiger mit definitiver Pfändung verteilt, oder<br />
falls sich ein Überschuss ergibt, dem Schuldner ausgehändigt.<br />
603. Sind Betreffnisse, die auf noch nicht fällige Forderungen von Faustpfand- und<br />
Retentionsgläubigern entfallen zuhinterlegen?<br />
Ja, sie werden im Unterschied zu den nichtfälligen Grundpfandforderungen nicht dem<br />
Erwerber überbunden. Sie werden erst bei Fälligkeit ausgezahlt.<br />
604. Was kann das Ergebnis des verteilbaren Reinerlöses bedeuten?<br />
- Im günstigsten Falle reicht der Reinerlös aus, um alle Forderungen der Pfändungsgruppe<br />
zu decken. Ein Überschuss fällt an die Gläubiger der folgenden Gruppe, in letzter Linie<br />
an den Schuldner<br />
- Genügt der Erlös hierzu nicht, muss das Betreibungsamt für die nichtbefriedigte<br />
Pfändungsgruppe unverzüglich eine Nachpfändung vollziehen<br />
- Schliesslich kann es sich ergeben, dass nichts nachgepfändet werden kann oder dass<br />
auch der Erlös aus einer Nachpfändung nicht ausreicht, um die Gruppengläubiger zu<br />
befriedigen. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich den unzureichenden<br />
Reinerlös zu teilen. Das geschieht nicht zu gleichen Teilen; es wird für jede vom Verlust<br />
betroffene Pfändungsgruppe ein Kollokationsplan erstellt, der die Reihenfolge der<br />
gruppeninternen Befriedigung festlegt SchKG 146 I.<br />
605. *Gibt es ein Mindestgebot, wenn der Grundpfandgläubiger im obersten Rang auf<br />
Pfandverwertung klagt?<br />
Nein, es gibt nur ein Mindestgebot, wenn jemand im Rang vorgehender da ist. Alle<br />
nachrangigen Pfandrechte werden, falls sie nicht gedeckt werden können gelöscht.<br />
606. *Was muss man im Steigerungsverfahren alles beachten?<br />
1 Das Deckungsprinzip SchKG 126 (→gibt es ein Mindestgebot)<br />
Gilt für den im Rang vorgehenden Gläubiger. Betreibt ein Aussenstehender, gehen alle<br />
Grundpfandgläubiger dem aussenstehenden Gläubiger vor. Daher kann es nur einen Zuschlag<br />
geben, wenn die Forderungen der Grundpfandgläubiger gedeckt sind.<br />
2. Doppelaufruf<br />
3. Zuschlag und Wirkung: Das Eigentum geht durch den Zuschlag über (ist man damit<br />
unzufrieden, muss man die betreibungsrechtliche Beschwerde ergreifen/OR bei Zusicherung?)<br />
97
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Zu 1<strong>1.</strong> der <strong>Vorlesung</strong>: Kollokationsplan und Verlustschein<br />
§30 <strong>Der</strong> Kollokationsplan<br />
607. Wird in jedem Fall ein Kollokationsplan errichtet?<br />
Nein, nur wenn der Reinerlös nicht reicht um die Gläubiger zu befriedigen.<br />
608. Was ist der Kollokationsplan?<br />
Ein Plan für die Rangordnung der Gläubiger SchKG 146 I. Gemeint ist damit die<br />
Reihenfolge, in der die Gläubiger einer Pfändungsgruppe bei ungenügendem Reinerlös<br />
befriedigt werden sollen. Für jede Pfändungsgruppe, die zu Verlust kommt, wird ein eigener<br />
Kollokationsplan erstellt.<br />
609. Wann wird der Kollokationsplan errichtet/von wem?<br />
Er wird vom Betreibungsamt errichtet, sobald alle gepfändeten und allenfalls<br />
Nachgepfändeten Gegenstände verwertet sind. Erst dann ist ersichtlich, ob, nach Befriedigung<br />
der Pfandgläubiger, die Pfändungsgläubiger einer Gruppe vollständig befriedigt werden<br />
können oder nicht. Wo volle Befriedigung ausser Frage steht, bedarf es keines<br />
Kollokationsplanes, dann genügt ein gewöhnlicher Verteilungsplan.<br />
610. Werden die Ansprüche der Pfandgläubiger in den Kollokationsplan<br />
aufgenommen?<br />
Nein, in der Betreibung auf Pfändung nicht (in der Betreibung auf Konkurs oder auf<br />
Pfandverwertung aber schon). <strong>Der</strong>en Befriedigung ist durch Wahrung des Deckungsprinzips<br />
sichergestellt. Für sie wird ein besonderer Verteilungsplan erstellt.<br />
61<strong>1.</strong> Wieso ist der Kollokationsplan für die Verteilung so wichtig?<br />
Weil er zugleich noch den Verteilungsplan enthält und so die Grundlage der Verteilung<br />
darstellt.<br />
612. Was ist der Inhalt des Kollokationsplanes?<br />
Man unterscheidet vier Bestandteile des Kollokationsplanes:<br />
<strong>1.</strong> Enthält er das Verzeichnis aller Gläubiger der betreffenden<br />
Pfändungsgruppe sowie ihre Forderungen, wie sie aus dem<br />
Einleitungsverfahren hervorgehen SchKG 144 IV (mit Zinsen…).<br />
2. Das Kernstück bildet die Rangordnung der Gläubiger. Sie beruht auf<br />
konkursrechtlichen Grundsätzen, was heisst dass die Gläubiger innnerhalb<br />
ihrer Gruppe den Rang erhalten, den sie im Konkurs des Schuldners<br />
einnehmen würden SchKG 146 II i.V.m. 219. Hinsichtlich des Rangs steht<br />
dem Betreibungsamtmaterielle Entscheidungsbefugnis zu.<br />
3. <strong>Der</strong> Verteilungsplan gibt im Rahmen des Kollokationsplans darüber<br />
Aufschluss, welche Beträge jeder Gläubiger erhalten sollte, um voll<br />
befriedigt zu werden, wieviel er tatsächlich erhalten wird (Dividende) und<br />
wie hoch sich sein Ausfall beläuft<br />
4. In den Kollokationsplan gehören schliesslich einige für das weitere<br />
Verfahren bedeutsame Mitteilungen: Angaben über den Schuldner, über<br />
die Auflage des Planes, über die Möglichkeit seiner Anfechtung und über<br />
sein Inkrafttreten.<br />
98
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
613. Welcher Zeitpunkt ist im Pfandbetreibungsverfahren beim Kollokationsplan in<br />
der Rangordnung dafür massgeblich, welche Forderungen noch angerechnet<br />
werden?<br />
Nach SchKG 146 II Satz 2 der Zeitpunkt des Fortsetzungsbegehrens. Dann ersetzt man in<br />
SchKG 219 „Konkurseröffnung“ durch „Fortsetzungsbegehren“.<br />
614. Welches Prinzip gilt zwischen den Klassen (=Rangordnungen der Gläubiger)?<br />
Es gilt das Prinzip der Ausschliesslichkeit.<br />
615. Was besagt das Prinzip der Ausschliesslichkeit?<br />
Es besagt, dass Gruppengläubiger einer nachgehenden Klasse erst dann etwas vom Erlös<br />
erhalten, wenn sämtliche vorrangigen Gläubiger voll befriedigt sind SchKG 220 II.<br />
616. Wie sind die Gläubiger innerhalb der Klasse berechtigt?<br />
Da sind die Gläubiger gleichberechtigt: ihre Forderungen werden anteilsmässig, nach ihrem<br />
Summenverhältnis gedeckt (sog. Dividende SchKG 220 I).<br />
617. Wo kann man Einsicht in den Kollokationsplan nehmen?<br />
Beim Betreibungsamt, er wird dort aufgelegt SchKG 147. Jeder Beteiligte wird davon<br />
benachrichtigt, der Gläubiger durch Mitteilung eines seine Forderung betreffenden Auszuges.<br />
Auflag und Mitteilung des Kollokationsplanes sind wichtig für seine Anfechtung; die<br />
Mitteilung löst die Frist dazu aus.<br />
618. Mit welchen Rechtsmitteln kann der Kollokationsplan angefochten werden?<br />
Mit der Betreibungsrechtlichen Beschwerden oder mit der gerichtlichen Klage.<br />
619. Wann wird der Kollokationsplan mit der Beschwerde angefochten?<br />
Wenn dem Betreibungsbeamten ein Verfahrensfehler bei der Aufstellung des<br />
Kollokationsplanes vorgeworfen wird.<br />
620. Welches ist eine der wichtigsten Beschwerdefälle beim Kollokationsplan?<br />
Es ist derjenige, wo ein Gläubiger seine eigene Kollokation anficht. Dabei rügt er nicht etwa<br />
unrichtige Anwendung des materiellen Rechts durch das Betreibungsamt, sondern ebenfalls<br />
nur eine Verletzung verfahrensrechtlicher Vorschriften. Beim Konkurs muss ein Gläubiger im<br />
gleichen Fall klagen.<br />
62<strong>1.</strong> *Welches sind die Unterschiede zwischen der Anfechtung des Kollokationsplans<br />
im Konkurs und in der Betreibung auf Pfändung?<br />
Art. 148 SchKG Art. 250 SchKG<br />
Anfechtung Anfechtung<br />
Betreibung Konkurs<br />
Gläubiger<br />
Gläubiger kann nur Gläubiger muss nach<br />
bemängelt seine mit der Beschwerde SchKG 250 I klagen<br />
Kollokation nach SchKG 17<br />
vorgehen<br />
Gläubiger bestreitet Gläubiger muss Gläubiger muss<br />
die Forderung eines<br />
anderen Gläubigers<br />
oder seinen Rang<br />
klagen SchKG 148 I klagen SchKG 250 II<br />
99
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
622. *Wieso muss bei der Betreibung der Gläubiger seine Kollokation nur mit<br />
Beschwerde anfechten?<br />
Weil anders als im Konkurs der Gläubiger schon ein ganzes „Verfahren“ durchgemacht hat,<br />
und eine gewisse Sicherheit besteht, dass die Forderung, wie sie der Gläubiger geltend macht<br />
bestehen könnte. Daher möchte man für den Gläubiger ein langwieriges und kostspieliges<br />
Gerichtsverfahren vermeiden.<br />
623. *Wer ist beim Kollokationsplan zur Anfechtung durch Beschwerde legitimiert?<br />
Alle die an der Verteilung interessierten Gläubiger, aber auch der Schuldner, der mit der<br />
Kollokation einer Forderung nicht einverstanden ist. <strong>Der</strong> Schuldner ist nur beschwerde- nicht<br />
klageberechtigt.<br />
624. *Für wen wirken Aufhebung oder Abänderung des Kollokationsplans im<br />
Beschwerdeverfahren?<br />
Sie wirken immer für alle Beteiligten.<br />
625. Welche Beanstandungen müssen mittels Klage durchgesetzt werden?<br />
Alle materiellrechtlichen Beanstandungen (mit der Kollokationsklage).<br />
626. Welche Voraussetzungen müssen für die Kollokationsklage vorliegen?<br />
Die Kollokationsklage ist gegeben, wenn ein Gläubiger die Kollokation der Forderung eines<br />
anderen Gläubigers nach Bestand,, Höhe oder Rang bestreiten will SchKG 148 I. Damit wird<br />
nicht die betreibungsrechtliche Richtigkeit der fremden Kollokation in Frage gestellt sondern<br />
ihre materiellrechtliche Grundlage.<br />
627. Welche Rechtsnatur hat die Kollokationsklage?<br />
Sie ist betreibungsrechtlicher Natur. Sie verfolgt einzig den betreibungsrechtlichen Zweck,<br />
dass die Kollokation eines anderen Gläubigers abgeändert wird; darum entfaltet das Urteil<br />
über sie nur für die laufende Betreibung Rechtskraft. Dabei muss aber materielles Recht<br />
angewendet werden, und das Urteil hat im Ergebnis Reflexwirkung darauf; denn letztlich<br />
bestimmt es die Dividende der Klageparteien und damit den Tilgungsgrad der Forderungen.<br />
628. Wann ist die Kollokationsklage grundsätzlich ausgeschlossen?<br />
Wenn die betreffende Forderung schon in einem früheren Verfahren gerichtlich abgeklärt<br />
oder in einem formalisierten Vorverfahren durch Parteidisposition anerkannt wurde.<br />
Gegenstand des Kollokationsprozesses kann in diesem Fall nur nach der betreibungsrechtliche<br />
Rang der Forderung sein.<br />
629. *Wer kann die Kollokationsklage erheben?<br />
Jeder Gläubiger einer Pfändungsgruppe gegen jeden anderen Gläubiger dieser Gruppe.<br />
Niemals kann hingegen der Schuldner klagen, ihm bleibt nur die Beschwerde.<br />
Nicht klageberechtigt sind nach herrschender Praxis die Gläubiger einer anderen Gruppe, und<br />
zwar selbst dann nicht, wenn zu ihren Gunsten der allfällige Mehrerlös gepfändet wurde.<br />
630. Wer ist jeweils bei der Kollokationsklage beklagt?<br />
<strong>Der</strong> einzelne Gläubiger, dessen Kollokation angefochten wird.<br />
63<strong>1.</strong> In welcher Zeitspanne und an welchem Ort ist die Kollokationsklage<br />
einzubringen?<br />
SchKG 148 I, binnen 20 Tagen seit der Mitteilung des Auszuges aus dem Kollokationsplan<br />
beim Gericht des Betreibungsortes. Die Einhaltung der Frist ist Klagevoraussetung.<br />
100
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
632. Wann wird der Kollokationsplan rechtskräftig?<br />
Wenn die Klagefrist unbenützt abgelaufen ist, vorbehältlich einer allfälligen Verlängerung<br />
bzw. Wiederherstellung.<br />
633. Wen trifft die Beweislast im Kollokationsprozess?<br />
Den Beklagten, er muss also seine Forderung und den von ihm beanspruchten Rang<br />
nachweisen.<br />
634. *Wie wirkt die Kollokationsklage?<br />
Sie wirkt wie alle Urteile in betreibungsrechtlichen Streitigkeiten mit Reflexwirkung nur in<br />
der hängigen Betreibung – und nur zwischen den steitenden Gläubigern (inter partes). Das<br />
bedeutet, dass selbst bei Gutheissung der Klage die angefochtene Kollokation gegenüber allen<br />
nicht klagenden Gläubigern bestehen bleibt. <strong>Der</strong> Prozessgewinn fällt somit ausschliesslich<br />
dem obsiegenden Kläger zu SchKG 148 III: Er kann daraus seine Forderung samt Zinsen,<br />
Betreibungskosten und Prozesskosten decken. Ein allfälliger Überschuss verbleibt dem<br />
beklagten Gläubiger SchKG 148 III →Lohn der Angst!<br />
635. Kann das Urteil aus dem Kollokationsprozess weiter gezogen werden?<br />
Ja, da es eine betreibungsrechtliche Streitigkeit mit Reflexwirkung auf das materielle Recht ist<br />
kann es bei gegebenen Voraussetzungen ans Bundesgericht weiter gezogen werden.<br />
636. *Was kann der Schuldner machen, wenn ihm zu Ohren kommt, dass ein<br />
Gläubiger erfolgreich die Forderung eines anderen Gläubigers im<br />
Kollokationsprozess bestritten hat?<br />
Er kann die Rückforderungsklage anstreben.<br />
§31 Quittung und Verlustschein<br />
637. Was stellt der Verlustschein im Betreibungsverfahren dar?<br />
<strong>Der</strong> formelle Abschluss. Dem Schuldner wird für den Tilgungsbetrag eine Quittung erteilt,<br />
und dem nicht voll befriedigten Gläubiger für seinen Ausfall ein Verlustschein ausgestellt.<br />
638. Wie sieht die Quittung des Schuldners aus?<br />
- Kann der Gläubiger voll befriedigt werden, muss er die Forderungsurkunde quittieren<br />
und dem Betreibungsamt zuhanden des Schuldners herausgeben SchKG 150 I. <strong>Der</strong><br />
Schuldner hat darüber hinaus Anspruch darauf, dass ihm auch jede andere<br />
Beweisurkunde ausgehändigt und die Tilgung der Forderung in den<br />
Betreibungsregistern festgestellt wird.<br />
- Wird die Forderung nur teilweise gedeckt, bleibt die Forderungsurkunde in den Händen<br />
des Gläubigers. Es ist aber darauf zu bescheinigen, für welchen Rechtbetrag die<br />
Forderung noch zu Recht besteht SchKG 150 II.<br />
639. Wozu dient der Verlustschein?<br />
Als amtlicher Ausweis für den in der Betreibung nicht gedeckten Teil seiner Forderung.<br />
640. Was ist das Wesen des Verlustscheines?<br />
Seinem Wesen nach ist der Verlustschein eine amtliche Bescheinigung darüber, dass der<br />
betreibende Gläubiger in der Vollstreckung, in deren Verlauf obwohl alles pfändbare<br />
Vermögen des Schuldners in der Schweiz erfasst werden konnte, nicht oder nicht voll<br />
befriedigt wurde, dass er folglich mit einem bestimmten Betrag zu Verlust gekommen ist.<br />
101
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Diese Bescheinigung ist eine öffentliche Urkunde. Sie ist ein Beweismittel und kein<br />
Wertpapier.<br />
64<strong>1.</strong> Was enthält der Verlustschein alles?<br />
Er enthält ausser der Bezeichnung des Gläubigers und des Schuldners, den Daten der<br />
Pfändung und der Verteilung insbesondere die Gesamthöhe der Forderung mit ihren<br />
gedeckten und ungedeckten Teil sowie Hinweise auf seine Rechtswirkung.<br />
642. *Wer erhält einen Verlustschein?<br />
Nur die betreibenden Pfändungsgläubiger SchKG 149 I.<br />
Keinen Verlustschein erhalten:<br />
- Gläubiger mit bloss provisorischer Pfändung<br />
- Pfandgläubiger<br />
- Pfändungsgläubiger in einem Arrestort, der nicht zugleichordentlicher Betreibungsort<br />
ist.<br />
643. *Wieso bekommen die Pfandgläubiger keinen Verlustschein?<br />
Denn, wenn bei der Pfandverwertung nicht so viel herauskommt, wie das Pfand wert ist, ist er<br />
noch nicht sicher zu Verlust gekommen. Er bekommt er einen Pfandausfallschein. Er kann<br />
dann die offene Forderung auf Pfändung betreiben. Erst wenn er dann immer noch nicht<br />
vollständig befriedigt wird bekommt er einen Pfandausfallschein.<br />
644. *Was sind die Voraussetzungen, dass ein Verlustschein gegeben wird?<br />
- Pfändungsgläubiger<br />
- Verlust des Pfändungsgläubigers muss eindeutig feststehen (das kann in verschiedenen<br />
Stadien des Verfahrens feststehen, i.d.R. nach der Verwertung, er kann aber auch schon<br />
während der Verwertung oder sogar schon vorher feststehen oder schon im<br />
Pfändungsverfahren)<br />
645. *Wann sind etwas ungewöhnliche Dokumente auch Verlustscheine?<br />
- Wenn es sich im Pfändungsverfahren erweist, dass kein Pfändbares Vermögen da ist,<br />
dann bildet die leere Pfändungsurkunde ex lege den definitiven Verlustschein SchKG<br />
115 I.<br />
- War nach der Schätzung des Betreibungsamtes nicht genügend pfändbares Vermögen<br />
greifbar, dann dient die Pfändungsurkunde dem Gläubiger zunächst als provisorischer<br />
Verlustschein SchKG 115 II.<br />
646. Wann wird der Verlustschein nicht von Amtes wegen ausgestellt?<br />
Im Falle von SchKG 127.<br />
<strong>Der</strong> Schuldner bekommt immer ein Doppel des Verlustscheines SchKG 149 I Satz 2.<br />
647. Wodurch unterscheidet sich der provisorische SchKG 115 vom definitiven<br />
Verlustschein SchKG 149?<br />
- dass er lediglich auf der Schätzung des Pfändungsgutes durch das Betreibungsamt<br />
beruht<br />
- dass er das Betreibungsverfahren, in dem sich ein Verlust erst anzeigt nicht schon<br />
abschliesst<br />
- und dass er dementsprechend wesentlich beschränktere Rechtswirkungen äussert als der<br />
definitive Verlustschein<br />
102
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
<strong>Der</strong> provisorische Verlustschein bleibt so lange in Kraft, bis das Verfahren vollständig<br />
durchgeführt ist. Kommt der Gläubiger dann tatsächlich zu Verlust, muss ihm ein definitiver<br />
Verlustschein ausgestellt werden.<br />
648. *Welche Wirkungen hat der definitive Verlustschein?<br />
Abgesehen von allfälligen öffentlichrechtlichen Folgen, die an eine fruchtlose Pfändung<br />
geknüpft werden können, äussert der definitive Verlustschein sowohl betreibungsrechtliche<br />
als auch zivilrechtliche und prozessrechtliche Wirkungen.<br />
649. *Welche betreibungsrechtichen Wirkungen hat der definitive Verlustschein?<br />
- Er bedeutet den formellen Abschluss der hängigen Pfändungsbetreibung<br />
- Er gilt von Gesetzeswegen als Schuldanerkennung i.S. SchKG 82 (SchKG 149 II).<br />
Folglich dient er dem Gläubiger in einer neuen Betreibung als provisorischer<br />
Rechtsöffnungstitel. Eine richtige Schuldanerkennung ist er nicht, weil er nicht vom<br />
Schuldner sonder vom Betreibungsamt ausgestellt wird.<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger kann gestützt auf den definitiven Verlustschein binnen 6 Monaten seit<br />
seiner Zustellung die Betreibung ohne neuen Zahlungsbefehl fortsetzen SchKG 149 III.<br />
Er braucht dazu nur das Fortsetzungsbegehren zu stellen, oder wenn der Schuldner<br />
inzwischen ins Handelsregister eingetragen worden ist, die Konkursandrohung zu<br />
beantragen. (Sollte aber die neue Betreibung wieder zu einem Verlustschein führen,<br />
müsst beim dritten Versuch wieder mit einem Einleitungsverfahren neu begonnen<br />
werden.<br />
- <strong>Der</strong> Verlustschein bildet für den Gläubiger einen Arrestgrund SchKG 149 II und SchKG<br />
271 I Ziff. 5<br />
- Schliesslich ist der Verlustscheinsgläubiger berechtigt, gegen eine vom Schuldner<br />
begünstigte Person mit der Anfechtungsklage vorzugehen SchKG 149 II und 285 II Ziff.<br />
1 (actio Pauliana).<br />
650. *Welches sind die zivilrechtlichen Wirkungen des definitiven Verlustscheines?<br />
- Vor allem ist die im Verlustschein verurkundete Forderung nicht mehr verzinslich<br />
SchKG 149 IV. Die Zinspflicht hört aber nur für den Schuldner persönlich auf.<br />
Allfällige Mitverpflichtete – wie Mitschuldnerund Bürgen – haben weiterhin Zinsen zu<br />
bezahlen, und zwar ohne Rückgriffsrecht gegenüber dem Schuldner.<br />
- Es gilt für die Verlustscheinsforderung eine jederzeit unterbrechbare, OR 135,<br />
Verjährungsfrist von 20 Jahren SchKG 149a I. Für Mitschuldner und Bürgen besteht<br />
aber die ordentliche Verjährungsfrist nach OR 127 ff. Gegenüber den Erben des<br />
Schuldners gilt wiederum eine betreibungsrechtliche Sonderregelung: Zu ihren Gunsten<br />
verjährt die Forderung spätestens ein Jahr nach Eröffnung des Erbganges SchKG 149a I.<br />
- Ausser diesen Vorschriften des SchKG knüpfen noch verschiedene Bestimmungen im<br />
ZGB, im OR und im VVG zivilrechtliche Wirkungen an die Ausstellung eines<br />
definitiven Verlustscheines. (Bsp. <strong>Der</strong> Stunde: Art. 480 I ZGB Verlustscheine<br />
→Teilenterbungsgrund (er bekommt nur die Hälfte des Pflichtteils/OR 250 II<br />
Schenkungsversprechen des Schuldners werden aufgehoben)<br />
65<strong>1.</strong> Welches sind die prozessrechtlichen Wirkungen des definitiven Verlustscheines?<br />
Gemäss ZPO 70 I Ziff. 2 hat ein Kläger seinem Gegner auf dessen Antrag hin für Kosten<br />
eines Prozesses Sicherheit zu leisten, wenn seine Zahlungsfähigkeit durch einen Verlustschein<br />
nachgewiesen ist.<br />
652. Welche Wirkungen hat der provisorische Verlustschein?<br />
Er hat prozessrechtliche und betreibungsrechtliche Wirkungen.<br />
103
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
653. Welche prozessrechtliche Wirkung hat der provisorische Verlustschein?<br />
Die gleiche wie ein definitiver Verlustschein. <strong>Der</strong> Kläger hat seinem Gegner auf dessen<br />
Antrag hin für die Kosten eines Prozesses Sicherheit zu leisten, wenn seine<br />
Zahlungsunfähigkeit durch einen Verlustschein nachgewiesen ist.<br />
654. Welche betreibungsrechtlichen Wirkungen hat der provisorische Verlustschein?<br />
- Er verleiht dem Gläubiger das Recht, eine Nachpfändung zu verlangen SchKG 115 III.<br />
- Er bildet für ihn einen Arrestgrund SchKG 271 I Ziff. 5.<br />
- Und er legitimiert zur Anfechtungsklage (paulinische Klage SchKG 285 II Ziff. 1)<br />
Anders als der definitive Verlustschein äussert der provisorische diese Wirkungen aber schon<br />
während des Betreibungsverfahrens, das ja ungeachtet seiner Ausstellung weiterläuft.<br />
655. Wann wird der Verlustschein gelöscht?<br />
Die Ausstellung des Verlustscheines wird in den Betreibungsregistern eingetragen, wo er<br />
Gegenstand des Einsichtsrechts ist SchKG 8a. Darum hat der Schuldner Anspruch darauf,<br />
dass nach Untergang der Verlustschiensforderung dies sofort in den Registern vermerkt, der<br />
Verlustschein gelöscht und die Löschung ihm bescheinigt wird SchKG 149 III. Über die<br />
gelöschten Einträge darf Dritten keine Auskunft mehr gegeben werden<br />
656. Welches Rechtsmittel kann der Schuldner ergreifen, wenn das Betreibungsamt<br />
sich weigert die Löschung vorzunehmen?<br />
Er kann die betreibungsrechtliche Beschwerde ergreifen SchKG 117ff.<br />
6. Kapitel: Die Durchführung der Betreibung auf Pfandverwertung<br />
Zu 12. der <strong>Vorlesung</strong>: die Pfandverwertung<br />
§32 Wesen und Voraussetzung der Betreibung auf Pfandverwertung<br />
657. *Was ist das Wesen der Betreibung auf Pfandverwertung?<br />
Sie ist eine reine Spezialexekution zu Gunsten eines Pfandgläubigers.<br />
658. *Was sind die Unterschiede zwischen der Betreibung auf Pfändung und der<br />
Betreibung auf Pfandverwertung?<br />
- Betreibung auf Pfandverwertung ist eine reine Spezialexekution, sie kennt im<br />
Unterschied zur Betreibung auf Pfandverwertung keine Konzession an das Prinzip<br />
möglichst gleicher Behandlung der Gläubiger, das die Generalexekution beherrscht. Sie<br />
erlaubt keine Gruppenbildung durch Pfändungsanschluss, wie die Betreibung auf<br />
Pfändung.<br />
- Von der Pfändungsbetreibung unterscheidet sie sich auch dadurch, dass hier das<br />
Vollstreckungssubstrat bereits im Voraus fixiert ist. Infolge dessen schliesst sich in der<br />
Betreibung auf Pfandverwertung an dass Einleitungsverfahren unmittelbar die<br />
Verwertung an.<br />
- Da in der Betreibung auf Pfandverwertung nur das Pfandobjekt verwertet werden darf,<br />
fällt eine Nachpfändung zur Vervollständigung einer ungenügenden Pfanddeckung<br />
ausser Betracht; der Gläubiger erhält einfach einen sog. èfandausfallschein.<br />
659. Was sind die Voraussetzungen für die Betreibung auf Pfandverwertung?<br />
- dass eine pfandgesicherte Forderung vorliegt (kann ein Faustpfand oder ein Grundpfand<br />
sein)<br />
104
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
660. Was wird im SchKG mit dem Begriff „Grundpfand“ alles umfasst?<br />
Gemäss SchKG 37 I:<br />
- Grundpfandverschreibung<br />
- Schuldbrief und Gült<br />
- Grundpfandrechte des kantonalen Rechts<br />
- Grundlast<br />
- jedes Vorzugsrecht auf bestimmten Grundstücken (z.B. des öffentlichen Rechts)<br />
- und das Pfandrecht an der Zugehör eines Grundstückes<br />
66<strong>1.</strong> Was wird im SchKG alles mit dem Begriff „Faustpfand“ umfasst?<br />
Nach SchKG 37 II:<br />
- das eigentliche Faustpfand<br />
- das Pfandrecht an Forderungen und anderen Rechten<br />
- die Viehverpfändung<br />
- und das Retentionsrecht<br />
662. Ist der Eigentumsvorbehalt ein Pfandrecht, für das auf Pfandverwertung<br />
betrieben werden dürfte?<br />
Nein, es wird zwar wie ein bei der Verwertung wie eine Pfandrecht behandelt, man kann in<br />
diesem Fall aber nicht auf Pfandverwertung betreiben.<br />
663. Ist, wenn ein Pfandrecht gegeben ist, die Vorausverwertung des Pfandes<br />
zwingend?<br />
Nein,<br />
- dem Schuldner steht es frei, sich einer Betreibung auf Pfändung oder auf Konkurs zu<br />
unterziehen. Er hat aber das Recht, sich zu widersetzen und vorab die Pfandverwertung<br />
zu verlangen (in bestimmten Fällen aber nicht).<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner kann auf die Vorverwertung des Pfandes schon im Voraus verzichten,<br />
indem er mit dem Gläubiger oder dem Dritteigentümer des Pfandes vereinbart, dass die<br />
Pfandhaft gegenüber seiner persönlichen Haftung nur subsidiär gelten soll. Diese<br />
Abrede wird vor allem ein Drittpfandbesteller treffen, er sichert sich auf diese Weise das<br />
ebenfalls mit Beschwerde geltend zu machende beneficium excussionis personalis.<br />
664. *Was steht dem Schuldner für eine Einrede zu, wenn der Gläubiger ihn auf<br />
Konkurs betreibt, kein Fall von SchKG 41 II vorliegt und der Gläubiger aber<br />
eine pfandgesicherte Forderung hätte?<br />
Er hat aber das Recht, sich zu widersetzen und vorab die Pfandverwertung zu verlangen. er<br />
geniesst das beneficium excussionis realis. Diese verfahrensrechtliche Einrede der<br />
Vorausverwertung des Pfandes ist mit Beschwerde gegen den Zahlungsbefehl geltend zu<br />
machen, nicht etwa mit Rechtsvorschlag SchKG 41 I bis.<br />
665. *In welchen Fällen darf der Gläubiger zwischen der Betreibung auf<br />
Pfandverwertung und einer anderen Betreibungsart frei wählen, ohne dass sich<br />
der Schuldner auf das beneficium nach SchKG 41 I bis berufen könnte?<br />
- Durch Grundpfand gesicherte Zinsen oder Annuitäten darf der Gläubiger auch auf dem<br />
Weg der ordentlichen Betreibung einfordern SchKG 41 II<br />
- Für pfandgesicherte Forderungen, die sich auf einen Wechsel oder einen Check<br />
gründen, darf der Gläubiger die Wechselbetreibung verlangen, sofern der Schuldner<br />
konkursfähig ist SchKG 41 II.<br />
105
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- <strong>Der</strong> Pfandgläubiger kann sich auch ganz allgemein dem Weg der ordentlichen<br />
Betreibung öffnen, indem er in gesetzlicher Form auf sein Pfandrecht verzichtet, was<br />
aber dem Schuldner spätestens im Zahlungsbefehl mitgeteilt werden muss<br />
- Hat sodann der Gläubiger mit dem Schuldner oder dem Dritteigentümer des Pfandes nur<br />
subsidiäre Pfandhaft vereinbart, steht ihm der Weg der ordentlichen Betreibung<br />
ebenfalls offen.<br />
- Schliesslich können die Parteien zugunsten des Pfandgläubigers auch ein<br />
Selbstverkaufsrecht vereinbart haben.<br />
§33 Das Verfahren der Betreibung auf Pfandverwertung<br />
666. Welche Besonderheiten weist das Verfahren der Betreibung auf<br />
Pfandverwertung im Gegensatz zur Betreibung auf Pfändung auf?<br />
Bezüglich des Betreibungsbegehrens, des Zahlungsbefehls und bezüglich den<br />
Rechtsvorschlags gibt es einige Abweichungen, im Grossen und Ganze ist es aber gleich.<br />
667. *Inwiefern ist das Betreibungsbegehren in der Betreibung auf Pfandverwertung<br />
anders als in der Betreibung auf Pfändung?<br />
Das Betreibungsbegehren muss die üblichen Angaben nach SchKG 67 enthalten, darüber<br />
hinaus aber noch den Pfandgegenstand bezeichnen und den Namen eines allfälligen<br />
Dritteigentümers desselben sowie die allfällige Verwendung eines verpfändeten Grundstücks<br />
als Familienwohnung angeben SchKG 151 I.<br />
668. *Inwiefern ist der Zahlungsbefehl in der Betreibung auf Pfandverwertung<br />
anders als in der Betreibung auf Pfändung?<br />
<strong>Der</strong> Zahlungsbefehl, entspricht im Wesentlichen dem gewöhnlichen nach SchKG 69<br />
abgesehen davon: SchKG 152<br />
<strong>1.</strong> Die Zahlungsfrist beträgt hier nicht nur 20 Tage, sondern 1 Monat, wenn<br />
ein Faustpfand, und 6 Monate, wenn ein Grundpfand zu verwerten ist<br />
2. Zudem lautet die Androhung an den Schuldner, dass das Pfand verwertet<br />
werden, wenn er weder Zahlung leiste noch Recht vorschlage<br />
3. Ausserdem wird der Zahlungsbefehl hier noch einem allfälligen<br />
Dritteigentümer eines Pfandes zugestellt. Weiter muss der Zahlungsbefehl<br />
dem Ehegatten des Schuldners oder des Dritteigentümers zugestellt<br />
werden, falls das verpfändete Grundstück als Familienwohnung dient<br />
SchKG 153<br />
4. Möglichkeit der Ausdehnung der Pfandhaft auf Miet- und<br />
Pachtzinsforderungen<br />
669. Was passiert, wenn sich erst im Laufe der Betreibung herausstellt, dass ein<br />
Grundstück einem Dritten gehört oder als Familienwohnung dient?<br />
Dann müssen die zusätzlichen Zahlungsbefehle noch nachträglich zugestellt werden; die<br />
Verwertung darf erst dann stattfinden, wenn auch diese Zahlungsbefehle rechtskräftig<br />
geworden und die Frist von 6 Monaten seit der Zustellung abgelaufen sind.<br />
670. Was kann der Grundpfandgläubiger machen, wenn am verpfändeten<br />
Grundstück Miet- oder Pachtverträge bestehen?<br />
Er kann mit dem Betreibungsbegehren aber auch noch später die Ausdehnung der Pfandhaft<br />
auf die Miet- und Pachtzinsforderungen nach ZGB 806 geltend machen SchKG 152 II.<br />
106
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
67<strong>1.</strong> *Inwiefern sind der Rechtsvorschlag und die Rechtsöffnung in der Betreibung<br />
auf Pfandverwertung anders als in der Betreibung auf Pfändung?<br />
- Nicht nur der Schuldner, sondern jeder Mitbetriebene kann Rechtsvorschlag erhaben<br />
SchKG 153 II.<br />
- Mit dem Rechtsvorschlag können sowohl Bestand, Umfang oder Fälligkeit der<br />
Forderung bestritten werden als auch Bestand und Umfang des Pfandrechts. Will man<br />
das Pfandrecht bestreiten, muss man Gründe angeben (analog VZV, das für<br />
Grundstücke eine explizite Regel enthält).<br />
- <strong>Der</strong> Ehegatte des Schuldners oder des Dritteigentümers kann überdies einwenden, die<br />
Verpfändung des Grundstücks habe gegen ZGB 169 verstossen<br />
- Dieser Erweiterung des Rechtsvorschlags entspricht auch das Rechtsöffnungsverfahren<br />
SchKG 153a. Jeder Rechtsvorschlag, gleichgültig wogegen er sich richtet muss durch<br />
Rechtsöffnung oder durch Klage auf Anerkennung der Forderung oder auf Feststellung<br />
des Pfandrechts überwunden werden. Die Rechtsöffnung ist zu erteilen, wenn der<br />
Gläubiger einen Rechtsöffnungstitel vorweist, der die bestrittene Forderung oder das<br />
bestrittene Pfandrecht belegt. Nach provisorischer Rechtsöffnung steht die<br />
Aberkennungsklage nicht nur dem Schuldner sonder auch dem mitbetriebenen<br />
Dritteigentümer des Pfandes und dem Ehegatten zu.<br />
- Ist der Zahlungsbefehl rechtskräftig geworden, darf der betreibende<br />
Grundpfandgläubiger verlangen, dass im Grundbuch eine Verfügungsbeschränkung<br />
gemäss ZGB 960 vorgemerkt wird.<br />
672. Wer kann alles ein Antrag auf Verwertung stellen?<br />
<strong>Der</strong> betreibende Gläubiger, der Schuldner oder ein Dritteigentümer des Pfandes.<br />
673. Wann darf Verwertung verlangt werden?<br />
Nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist. Andererseits muss das Verwertungsbegehren für ein<br />
Faustpfand spätestens 1 Jahr, für ein Grundpfand spätestens 2 Jahre nach diesem Zeitpunkt<br />
gestellt sein. Nach unbenütztem Ablauf dieser Frist erlischt die Betreibung, Desgleichen,<br />
wenn ein zurückgezogenes Begehren nicht innert derselben erneuert wird SchKG 154 II.<br />
674. Wie wird die Verwertung vorbereitet bei der Betreibung auf Pfandverwertung?<br />
Da entfällt ja der Abschnitt der Pfändung. Das Betreibungsamt geht dennoch ähnlich vor, wie<br />
bei der Verwertung auf Pfandbetreibung. Es schätzt den Wert des Pfandes und nimmt es zur<br />
Bewirtschaftung und Verwaltung in Verwahrung. Es leitet das Widerspruchsverfahren ein,<br />
wenn en Dritter am Pfandobjekt Eigentum oder ein vorgehendes Pfandrecht geltend macht<br />
SchKG 155 I. Ausserdem hat das Betreibungsamt von Amtes wegen eine<br />
Verfügungsbschränkung im Grundbuch vormerken zu lassen, sofern das nicht schon früher<br />
auf Antrag des Pfandgläubigers geschehen ist.<br />
675. Wie läuft das Verwertungsverfahren bei der Betreibung auf Pfandverwertung<br />
ab?<br />
Grundsätzlich wird das Pfand auf die gleiche Art und Weise, verwertet, wie ein gepfändeter<br />
Vermögensgegenstand. SchKG 156 I verweist einfach auf SchKG 122-143b. Insbesondere ist<br />
auch hier das Deckungsprinzip zu wahren. Dies gilt immer für den Gläubiger mit dem<br />
vorgehenden Pfandrecht (Bsp. Jemand hat ein Retentionsrecht an einer Sache, die aber noch<br />
einen Eigentumsvorbehalt auf sich trägt. In diesem Fall geht natürlich der Eigentumsvorbehalt<br />
vor). Es kommen auch hier der Verwertungsaufschub, die vorzeitige Verwertung und der<br />
Freihandverkauf in betracht. In der Betreibung auf Grundpfandverwertung sind einige<br />
Besonderheiten zu beachten.<br />
107
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
676. Welche Besonderheiten sind in der Betreibung auf Grundpfandverwertung zu<br />
beachten?<br />
- Die Steigerungsbedingungen müssen bestimmen, dass der dem betreibenden<br />
Pfandgläubiger zukommende Anteil am Zuschlagspreis bar zu bezahlen ist, wenn nichts<br />
anderes vereinbart wurde. Die Belastung des Grundstücks wird hierauf im Grundbuch<br />
gelöscht. Dass eine allfällige Grundpfandforderung ausgezahlt und nicht dem Erwerber<br />
überbunden wird, folgt indessen aus SchKG 135 I Satz 3.<br />
- Zum Schutz des Schuldners vor Missbrauch durch den Pfandgläubiger werden nach<br />
SchKG 156 II Eigentümer- und Inhaberschuldbriefe, die der Schuldner als Sicherheit zu<br />
Faustpfand begeben hat, bei besonderer Verwertung desselben auf den Betrag des<br />
Erlöses herabgesetzt.<br />
- Schliesslich regeln Sonderbestimmungen den Fall, wo mehrere Grundstücke für eine<br />
Forderung verpfändet sind,<br />
677. Wird eine Pfandsache auch verwertet, wenn bereits ihre Früchte und Erträgnisse<br />
ausreichen um die Betreibungsforderung und die Kosten zu decken?<br />
Nein.<br />
678. Was ist die Purgation?<br />
Die einseitige Ablösung von Grundpfandrechten. Sie ist in 828 ff ZGB geregelt.<br />
679. Wie sieht das Verteilungsverfahren aus?<br />
- Aus dem Pfanderlös sind vorab die Kosten der Verwaltung, Verwertung und Verteilung<br />
zu begleichen SchKG 157 I. (Gleich wie im Verwertungsverfahren auf Pfändung)<br />
- <strong>Der</strong> verbleibende Reinerlös wird dann den Pfandgläubigern bis zur Höhe ihrer<br />
Forderungen einschliesslich Zinsen und der Betreibungskosten ausgerichtet SchKG 157<br />
II. Dabei sind alle Pfandgläubiger zu berücksichtigen, deren Forderungen nicht dem<br />
Ersteigerer überbunden werden.<br />
- Genügt der Nettoerlös nicht, um alle Pfandgläubiger voll zu befriedigen, stelltdas<br />
Betreibungsamt für sie einen Kollokationsplan auf SchKG 157 III. Für den Betrag und<br />
den Rang der Grundpfandrechte ist das Lastenverzeichnis massgebend. Hinsichtlich<br />
Auflage und Anfechtung des Kollokationsplans gelten die gleichen Vorschriften wie in<br />
der Betreibung auf Pfändung SchKG 157 IV.<br />
680. Was passiert mit den ungedeckten Forderungen?<br />
Sie werden im Grundbuch entkräftet; ein ungedeckt gebliebener Betrag bleibt jedoch als<br />
ungesicherte Forderung bestehen.<br />
68<strong>1.</strong> Was ist das Wesen des Pfandausfallscheines?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger, der in der Betreibung auf Pfandverwertung nicht volle Befriedigung erlangt,<br />
erleidet noch keinen eigentlichen Verlust, sondern bloss einen Pfandausfall. Er hat noch die<br />
Möglichkeit den Schuldner auf dem ordentlichen Weg zu betreiben. Darum erhält der<br />
Gläubiger nur eine amtliche Bescheinigung darüber, dass seine Forderung aus dem Pfanderlös<br />
nicht oder nicht vollständig bezahlt werden konnte: einen Pfandausfallschein SchKG 158 I.<br />
682. Wer hat Anspruch auf Ausstellung eines Pfandausfallscheins?<br />
Einzig der betreibende Pfandgläubiger und zwar, wenn entweder das Pfand wegen<br />
ungenügenden Angebots gar nicht verwertet werden konnte SchKG 126/127 oder der Erlös<br />
nicht ausreicht, um seine Forderung zu tilgen SchKG 158 I. Alle übrigen Pfandgläubiger<br />
erhalten lediglich eine Bescheinigung darüber, dass sich die Forderung als ungedeckt<br />
108
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
erwiesen hat: einen Ausweis über mangelnde Deckung; diese Urkunde hat keine besonderen<br />
Wirkungen.<br />
683. *Welche Wirkungen hat der Pfandausfallschein?<br />
- Er löst keine öffentlichrechtliche Folgen aus<br />
- Dem bisherigen Pfandgläubiger gibt er aber das Recht, die Betreibung für die<br />
Ausfallforderung jetzt auf das übrige Vermögen des Schuldners zu richten. Da die<br />
Forderung nicht mehr pfandgesichert ist, kann das jetzt auf dem Wege der ordentlichen<br />
Betreibung auf Pfändung oder auf Konkurs geschehen SchKG 158 II. Binnen<br />
Monatsfrist seit Zustellung des Pfandausfallscheines darf der Gläubiger sogar ohne<br />
neues Einleitungsverfahren gegen den Schuldner vorgehen. Er braucht nur das<br />
Pfändungsbegehren oder das Begehren um Konkursandrohung zu stellen. Diese<br />
Wirkung setzt aber voraus, dass der Schuldner dem Gläubiger gegenüber persönlich<br />
haftet. Wo nur reine Sachhaftung besteht, wie bei der Gült oder bei der Grundlast, kann<br />
der Gläubiger ausschliesslich aus dem Wert des Grundstücks Befriedigung verlangen.<br />
Da besteht nach Durchführung der Zwangsvollstreckung mangels persönlicher Haftung<br />
keine Forderung mehr, so dass die weitere Betreibung ausgeschlossen ist.<br />
- Auch der Pfandausfallschein gilt als Schuldanerkennung i.S. von SchKG 82 und taugt<br />
folglich als provisorischer Rechtsöffnungstitel SchKG 158 III.<br />
§34 Das Retentionsrecht bei Miete und Pacht von Geschäftsräumen sowie bei<br />
Stockwerkeigentum<br />
684. Wem steht ein besonderes Retentionsrecht zur Verfügung?<br />
Dem Stockwerkeigentümern sowie den Vermietern und Verpächtern von Geschäftsräumen<br />
steht zur Sicherung ihrer Forderungen neben der gewöhnlichen Betreibung noch ein<br />
besonderes Retentionsrecht zur Verfügung OR 268 ff, 299c.<br />
685. Welche Bestimmungen kommen zur Anwendung, wenn das Retentionsrecht<br />
geltend gemacht werden soll?<br />
Die Bestimmungen von SchKG 283 und 284. Danach ist die Betreibung in diesem Fall auf<br />
dem Wege der Pfandverwertung durchzuführen; denn betreibungsrechtlich gilt das<br />
Retentionsrecht als Faustpfand SchKG 37 II.<br />
686. In welchem Zeitpunkt kann das Retentionsrecht ausgeübt werden?<br />
Es kann vor Anhebung der Betreibung oder gleichzeitig mit ihr ausgeübt werden.<br />
687. Muss ein Gläubiger, der ein Retentionsrecht hat, dieses Ausüben?<br />
Nein. <strong>Der</strong> Schuldner hat gegen die Ausübung der normalen Betreibung durch den Gläubiger<br />
auch kein beneficium excussionis realis. <strong>Der</strong> Gläubiger hat durch Wahl des ordentlichen<br />
Betreibungsweges auf Pfändung oder Konkurs das Retentionsrecht nicht verloren.<br />
688. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Retentionsrecht und dem Pfandrecht?<br />
Ja, im Unterschied zum Pfandrecht ist bei der Verwertung das Deckungsprinzip auf das<br />
Retentionsrecht nicht anwendbar.<br />
689. Was ist die Funktion des Retentionsverzeichnisses?<br />
Es bezweckt die autoritative Feststellung der dem Retentionsrecht unterworfenen<br />
Gegenstände.<br />
109
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
690. Was passiert mit einer Retentionsbetreibung, bei der dem Zahlungsbefehl keine<br />
Retentionsurkunde beigefügt wird?<br />
Die Betreibung ist nichtig.<br />
69<strong>1.</strong> Welche materiellen Voraussetzungen setzt das Retentionsverzeichnis voraus?<br />
- eine Retentionsforderung (z.B. Miet- oder Pachtzinsforderungen für die Überlassung<br />
von Geschäftsräumen OR 268)<br />
- einen Retentionsgegenstand<br />
- der Schuldner darf keine andere Sicherheit leisten (d.h. er kann die Retention durch<br />
andere Sicherheitsleistung abwenden. Das Retentionsrecht erfasst dann ersatzweise<br />
diese Sicherheit).<br />
692. Was kann alles Retentionsgegenstand sein?<br />
Jede bewegliche Sache im Eigentum des Schuldners, der sich in den gemieteten<br />
Geschäftsräumen oder in den Räumen des Stockwerkeigentums befindet und der Benützung<br />
oder Einrichtung derselben dient und pfändbar ist. Auch Sachen Dritter, die sich in den<br />
betreffenden Räumlichkeiten befinden können reteniert werden.<br />
693. Deckt sich die Retenierbarkeit einer Sache immer mit der Pfändbarkeit?<br />
Nein, kein Retentionsrecht besteht z.B. an persönlichen Effekten des Schuldners (Kleider,<br />
Schmuck, Sportgeräte…) selbst wenn diese pfändbar wären.<br />
694. Kann das Betreibungsamt die materiellen Voraussetzungen für die Retention<br />
prüfen?<br />
Es kann sie bloss summarisch prüfen und nur wenn das Retentionsrecht offensichtlich nicht<br />
besteht, darf es die Aufnahme des Verzeichnisses ausnahmsweise aus materiellrechtlichen<br />
Gründen ablehnen. Materiellrechtliche Streitigkeiten um das Retentionsrecht sind vielmehr<br />
vom Richter zu entscheiden.<br />
695. Mit welchem Rechtsmittel muss der Schuldner die Forderung und das<br />
Retentionsrecht bestreiten?<br />
Mit Rechtsvorschlag.<br />
696. Welches Rechtsmittel kann ein Dritter erfassen, wenn er geltend machen will,<br />
dass Gegenstände, die ihm gehören von der Retention erfasst werden?<br />
Ihm steht das Widerspruchsverfahren zur Verfügung.<br />
697. Wie macht man unpfändbarkeit eines Gegenstandes geltend?<br />
Sie ist von der Aufsichtsbehörde im Beschwerdeverfahren zu prüfen.<br />
698. Was muss der Gläubiger unternehmen damit ein Retentionsverzeichnis<br />
aufgenommen wird?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger muss beim Betreibungsamt ein Gesuch stellen.<br />
699. Wie Läuft das Verfahren zur Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses ab?<br />
- es ist immer vom Betreibungsamt am Ort der gelegenen Sache aufzunehmen SchKG 4<br />
II. ist Gefahr im Verzug, kann das Betreibungsamt die Hilfe der Polizei oder der<br />
Gemeindebehörde anfordern SchKG 283 II.<br />
- Wie der Arrest braucht auch die Aufnahme des Retentionsverzeichnisses dem Schuldner<br />
nicht vorher angekündigt zu werden<br />
110
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Die retenierten Gegenstände werden einzeln aufgezeichnet (Spezialitätsprinzip). Auch<br />
hier wird nur so viel in die Urkunde aufgenommen, als zur Sicherung der<br />
Retentionsforderung nötig ist; das verlangt eine Schätzung des Wertes der retinierten<br />
Gegenstände. Weiter ist die Pfändungsreihenfolge zu beachten SchKG 95<br />
- Ausgeschlossen von der Aufnahme in das Retentionsverzeichnisses sind die<br />
Kompetenzstücke OR 268 III<br />
- Angemeldete Drittansprüche, an den retinierten Gegenständen hindern dagegen die<br />
Inventarisierung ebenso wenig wie bei der Pfändung. Sie werden aber in der Urkunde<br />
für das Widerspruchsverfahren vorgemerkt.<br />
700. Welche Wirkung hat das Retentionsverzeichnis?<br />
Die Aufnahme einer Retentionsurkunde stellt keine Vollstreckungsmassnahme dar sondern<br />
bedeutet bloss Socherung der Vollstreckung. Darum äussert die Retentionsurkunde auch keine<br />
materiellrechtliichen Wirkungen.<br />
Die Wirkung des Verzeichnisses besteht vielmehr darin, dass der Schuldner die<br />
aufgezeichneten Gegenständezwar weiterhin gebrauchen, aber nicht mehr über sie verfügen<br />
darf, sofern er nicht als Ersatz anderweitige Sicherheit leistet.<br />
Die Aufnahme in das Verzeichnis begründet den Retentionsbeschlag, der wie Pfändung und<br />
Arrest strafrechtlich geschützt ist.<br />
Es verschafft dem Gläubiger die Befugnis, die Retentioonsgegenstände in einer Betreibung<br />
auf Pfandverwertung zu seinen Gunsten verwerten zu lassen.<br />
Die Wirkund ist befristet. Die Retention muss daher wie der Arrest rechtzeitig prosequiert<br />
werden SchKG 279.<br />
70<strong>1.</strong> Wie lange hat der Gläubiger Zeit um die Retention zu prosequieren/wie muss er<br />
es prosequieren?<br />
- Die Frist zur Prosekution beträgt 10 Tage seit Zustellung der Retentionsurkunde SchKG 283<br />
III und 279 I.<br />
- der Gläubiger muss die Betreibung auf Pfandverwertung einleiten, sofern das<br />
Betreibungsbegehren nicht schon zusammen mit dem Retentionsgesuch gestellt wurde<br />
(=Prosekution).<br />
702. In welchem Umfang muss prosequiert werden?<br />
<strong>Der</strong> Umfang der Prosekution bestimmt sich einerseits nach der Höhe der Forderung, für die<br />
das Retentionsverzeichnis aufgenommen wurde, und ist andererseits auf die aufgezeichneten<br />
Gegenstände beschränkt.<br />
703. Was muss der Gläubiger machen, wenn Rechtsvorschlag erhoben wird?<br />
Er muss binnen 10 Tagen Rechtsöffnung verlangen oder die Klage auf Anerkennung der<br />
Forderung oder des Retentionsrechts anheben SchKG 279 II per analogiam.<br />
704. Was passiert, wenn der Gläubiger die Fristen nicht einhält?<br />
Die Wirkung der Retentionsurkunde erlischt, womit der Retentionsbeschlag dahinfällt.<br />
Materiell bleibt das Retentionsrecht hingegen bestehen, sodass ein neues<br />
Retentionsverzeichnis aufgenommen und woederum prosequiert werden kann.<br />
705. Wann können Sachen bedingungslos und jederzeit wieder beigebracht werden?<br />
Wenn sie under amtlichem Beschlag liegen können sie, wenn sie widerrechtlich fortgeschafft<br />
werden jederzeit retourniert werden. Da müssen die Voraussetzungen von SchKG 284 und<br />
OR 268b nicht erfüllt zu sein brauchen. Vorbehalten bleibt dann nur gutgläubiger<br />
Rechtserwerb eines Dritten SchKG 96.<br />
111
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
706. In welchem Fall müssen dann überhaupt die Voraussetzungen von SchKG 284<br />
und 268b II OR vorliegen?<br />
Wenn Gegenstädne noch vor dem amtlichen Beschlag weggeschafft wurden.<br />
707. Welche Voraussetzungen müssen für eine Rückschaffung nach SchKG 284<br />
vorliegen?<br />
- die Sachen müssen heimlich oder gewaltsam fortgeschafft werden, in einer Art also, die dem<br />
Retentionsgläubiger erfolgreichen Wideratand unmöglich macht.<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger muss sich binnen 10 Tagen seit der Fortschaffung mit einem<br />
Rückschaffungsbegehren an das Betreibungsamt wenden. (Ablauf dieser Frist lässt das Recht<br />
verwirken/Wiederherstellung der Frist ist aber unter Umständen möglich SchKG 33 IV)<br />
708. Wann ist die Rückschaffung in jedem Fall ausgeschlossen?<br />
Sobald Dritte an den Retentionsgegenständen gutgläubig Rechte erworben haben.<br />
709. Wie läuft das Rückschaffungsverfahren ab?<br />
- die Rückschaffung wird auf Begehren des Retentionsgläubigers vom Betreibungsamt des<br />
Ortes, von wo die Gegenstände fortgeschafft wurden, angeordnet und vollzogen. Unter<br />
Umständen muss Hilfe (Polizei) beigezogen werden.<br />
- das Betreibungsamt präft summarisch, ob die Voraussetzungen des Retentionsrechts und der<br />
Rückschaffung gegeben sind; es genügt, dass das Retentionsrecht wahrschienlich gemacht ist.<br />
Meist wird mit der Rückschaffung auch die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses<br />
verbunden. Beides gilt als dringliche Sicherungsmassnahme.<br />
710. Was passiert, wenn ein Drittbesitzer an den fortgeschafften Gegenständen ein<br />
eigenes Recht geltend macht?<br />
Er darf nicht einfach auf das Widerspruchsverfahren vertröstet werden, sondern es kommt<br />
zum Retentionsstreit SchKG 284.<br />
71<strong>1.</strong> Welche Rechtsnatur hat der Retentionsstreit?<br />
Er ist materiellrechtlicher Natur.<br />
712. Welche Verfahrensart ist für den Retentionsstreit vorgesehen?<br />
Das beschleunigte Verfahren.<br />
713. Wer ist im Retentionsstreit Kläger?<br />
<strong>Der</strong> Retentionsgläubiger. Seine Klage richtet sich gegen den besitzenden Dritten, der sich der<br />
Rückschaffung widersetzt.<br />
714. Wer hat im Retentionsstreit die Beweislast?<br />
<strong>Der</strong> Kläger. Er muss den guten Glauben des Dritten zu widerlegen versuchen und muss das<br />
Retentionsrecht nachweisen.<br />
715. Kann der Retentionsstreit ans Bundersgericht weitergezogen werden?<br />
Bei gegebenen Voraussetzungen mit Nichtigkeitsbeschwerde oder mit Berufung.<br />
716. Wie wehrt sich der Schuldner gegen die Rückschaffung oder wie kann er die<br />
Herausgabe zurückgeschaffter Gegenstände verlangen?<br />
- Mit Beschwerde an das Betreibungsamt kann er geltend machen, dass die<br />
betreibungsrechtlichen Voraussetzungen der Rückschaffung nicht gegeben waren<br />
112
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- der Schuldner braucht nicht gegen den Gläubiger zu klagen, er kann ihn mit Rechtsvorschlag<br />
in der Prosequtionsbetreibung zwingen, das behauptete Retentionsrecht selber durch<br />
Rechtsöffnungsgesuch oder Feststellungsklage gerichtlich geltend zu machen.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong><br />
7. <strong>Der</strong> Konkurs<br />
§35 Allgemeine Grundlagen des Konkurses<br />
717. Wie viele Gläubiger braucht es um den Konkurs zu eröffnen?<br />
Schon ein einzelner Gläubiger genügt. Doch ist der Konkurs einmal eröffnet, so laufen immer<br />
alle Gläubiger zusammen und nehmen an diesem kollektiven Vollstreckungsverfahren teil.<br />
718. Wieso nennt man den Schuldner auch „Gemeinschuldner“?<br />
Weil alle Gläubiger vom gleichen Schuldner bezüglich allen ihren Forderungen befriedigt<br />
werden wollen.<br />
719. Was erfordert das Exekutionsziel: die Befriedigung aller Gläubiger?<br />
Es erfordert, dass das gesamte verwertbare Vermögen des Schuldners eingesetzt wird. <strong>Der</strong><br />
Konkurs bedeutet somit die vollständige Liquidation des Schuldnervermögens, sowohl aller<br />
Aktiven als auch aller Passiven.<br />
720. Wieso ist der Konkurs eine Generalexekution?<br />
Weil er zur Vollstreckung aller Gläubigerforderungen in das gesamte Schuldnervermögen<br />
führt.<br />
72<strong>1.</strong> Nach welchem Prinzip erfolgt die Befriedigung der Gläubiger?<br />
Grundsätzlich nach dem Prinzip der Gleichbehandlung. Nur zugunsten bestimmter<br />
Forderungskategorien bestehen gewisse Vorrechte.<br />
722. *Wie kann ein Konkurs ausgelöst werden?<br />
(Kein Konkurs ohne Gerichtsentscheid!). Nur durch Gerichtsentscheid, diesen nennt man die<br />
Konkurserkenntnis. Dieses setzt das Vorliegen eines besonderen gesetzlichen Tatbestandes<br />
voraus, einen Konkursgrund (causa concursus).<br />
723. *Welche Arten von Konkursgründen gibt es?<br />
Es gibt formelle und materielle Konkursgründe.<br />
724. Was gilt als formeller Konkursgrund?<br />
Als formeller Konkursgrund gilt die erfolgreiche Durchführung einer Betreibung, in deren<br />
Folge der Gläubiger die Konkurseröffnung verlangen kann. Das ist die Konkursbetreibung;<br />
sie ist der reguläre Weg zum Konkurs.<br />
Die Konkursbetreibung kann sich nur gegen einen konkursfähigen Schuldner richten;<br />
ausserdem darf die Betreibungsforderung keine Forderung im Sinne von SchKG 43 sein.<br />
725. *Welche zwei Arten von Konkursbetreibung sieht das Gesetz vor (bei Vorliegen<br />
eines formellen Konkursgrundes)?<br />
- die ordentliche Konkursbetreibung<br />
- und die Wechselbetreibung<br />
113
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
726. Was gilt als materieller Konkursgrund?<br />
Diese bestehen in einer besonders schlechten Vermögenslage oder einer unredlichen<br />
Handlungsweise des Schuldners, welche die Befriedigung der Gläubiger als zweifelhaft oder<br />
gefährdet erscheinen lassen. In einer solchen Situation darf der Konkurs ausnahmsweise<br />
sofort, d.h. ohne vorgängige Konkursbetreibung ausgesprochen werden.<br />
Die Konkurseröffnung ohne Betreibung, allein aus Anlass eines materiellen Konkursgrundes,<br />
ist in gewissen Fällen gegen jeden Schuldner, in anderen nur gegen einen konkursfähigen<br />
statthaft.<br />
727. *Was ist der Unterschied zwischen der Anordnung eines Konkurses bei<br />
Vorliegen von materiellen Konkursgründen und der bei Vorliegen von formellen<br />
Konkursgründen?<br />
Bei Vorliegen von materiellen Konkursgründen braucht es kein Einleitungsverfahren.<br />
Bei Vorliegen von formellen Konkursgründen schon.<br />
728. Wie sehen die Möglichkeiten der verschiedenen Konkursbetreibungsarten bei<br />
vorliegen formeller/materieller Konkursgründe vor?<br />
Ordentliche<br />
Konkursbetreibung<br />
Konkursgrund<br />
Formeller SchKG 39 Materieller<br />
Wechselbereibung<br />
Setzen ein Einleitungsverfahren<br />
voraus<br />
Kein Einleitungsverfahren<br />
→direkt zum Gericht<br />
729. Welche Wirkungen hat der Konkurs?<br />
Er hat materielle wie auch formelle Wirkungen. Sie bilden den Inhalt des materiellen bzw. des<br />
formellen Konkursrechts.<br />
730. *Was behandelt das materielle Konkursrecht?<br />
Es behandelt die materiellrechtlichen Auswirkungen des Konkurses auf das Vermögen des<br />
Schuldners einerseits und auf die Gläubigeransprüche sowie auf die Rechte Dritter<br />
andererseits.<br />
- Schuldner darf über verwertbares Vermögen nicht mehr verfügen. Dieser<br />
Vermögenskomplex bildet die Aktivmasse und dient der Befriedigung der Gläubiger.<br />
- Die Forderungen der Gläubiger verlieren ihre individuellen Vollstreckungsansprüche<br />
(=Konkursforderungen) sie bilden die Passivmasse.<br />
114
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
73<strong>1.</strong> *Was behandelt das formelle Konkursrecht?<br />
Formell wird mit dem gerichtlichen Konkurserkenntnis der Weg zur Durchführung der<br />
Generalexekution im Konkursverfahren freigegeben. Aufgab dieses im formellen<br />
Konkursrecht geregelten Verfahrens ist es, die Aktiven des Schuldners in einem Inventar und<br />
die Passiven im Kollokationsplan festzustellen, die Aktivmasse zu verwalten und zu<br />
verwerten und schliesslich den Erlös unter die Gläubiger zu verteilen. (Dazu sind alle<br />
Vorschriften im SchKG, wie das Verfahren abläuft, wer welche Kompetenzen hat).<br />
Zu 14. <strong>Der</strong> <strong>Vorlesung</strong>: Die Konkursgründe<br />
I. Abschnitt: Die Konkursgründe<br />
§36 Die ordentliche Konkursbetreibung<br />
732. *Wie verläuft die ordentliche Konkursbetreibung im Einleitungsverfahren?<br />
Sie verläuft genau gleich wie die Pfändungsbetreibung. Auch für das Fortsetzungsbegehren<br />
gilt nichts anderes: Wie in der Pfändungsbetreibung kann der Gläubiger nach Ablauf der 20tägigen<br />
Zahlungsfrist seit Zustellung des Zahlungsbefehls einfach die „Fortsetzung der<br />
Betreibung verlangen“. Das Betreibungsamt muss dann die Weichen für eine<br />
Konkursbetreibung stellen. Erst im Fortsetzungsverfahren unterscheiden sich Spezial- und<br />
Generalexekution.<br />
733. *In welchen Phasen läuft die ordentliche Konkursbetreibung ab?<br />
- In der Konkursandrohung<br />
- <strong>Der</strong> (fakultativen) Aufnahme eines Güterverzeichnisses<br />
- (Konkursbegehren SchKG 166) und der Konkurseröffnung<br />
734. *Ab wann ist das Konkursamt zuständig?<br />
Ab der gerichtlichen Konkursöffnung!<br />
735. Wann und in welcher Form wird dem Schuldner die Konkursandrohung<br />
zugestellt?<br />
Unverzüglich, nachdem das Betreibungsamt den Fortsetzugsbefehl erhalten hat. Sie erfolgt in<br />
gleicher Form wie der Zahlungsbefehl zugestellt wird. <strong>Der</strong> Gläubiger erhält ein Doppel<br />
SchKG 159 und 16<strong>1.</strong> Die Konkursandrohung entspricht der Pfändungsankündigung.<br />
736. *Welche Voraussetzungen müssen für eine Konkursandrohung gegeben sein?<br />
- Die Betreibung muss sich gegen einen im Zeitpunkt der Konkursandrohung<br />
konkursfähigen Schuldner richten, entscheidend ist, dass das Fortsetzungsbegehren noch<br />
während der Dauer der Konkursfähigkeit gestellt wurde SchKG 39 und 40.<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner muss in der Schweiz einen Konkursort haben<br />
- Die Betreibung auf Konkurs darf nicht durch eine gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen<br />
sein (wie bei einer Pfandgesicherten Forderung SchKG 41 oder einer Forderung nach<br />
SchKG 43)<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger muss das Einleitungsverfahren mit Erfolg durchgeführt haben d.h, einen<br />
rechtskräftigen Zahlungsbefehl erwirkt haben.<br />
- Weiter muss der Gläubiger ein Begehren auf Konkursbetreibung stellen (genügt, dass<br />
Fortsetzung verlangt wird).<br />
737. In welchen Fällen darf ein Gläubiger einen Antrag auf Konkursandrohung<br />
stellen?<br />
- Nach Abgeschlossenem Einleitungsverfahren<br />
115
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Gestützt auf einen Pfandausfallschein (während eines Monats ohne Einleitungsverfahren<br />
SchKG 158) z.B. wenn der Schuldner in der Zwischenzeit im Handelsregister<br />
eingetragen ist.<br />
- Gestützt auf einen Verlustschein ohne Einleitungsverfahren während 6 Monaten SchKg<br />
149 III. Z.B. wenn der Schuldner in der Zwischenzeit im Handelsregister eingetragen<br />
ist.<br />
738. Welchen Inhalt hat die Konkursandrohung?<br />
SchKG 160 fordert diesbezüglich:<br />
- die Angaben des Betreibungsbegehrens SchKG 67<br />
- das Datum des Zahlungsbefehls<br />
- die Anzeige, dass der Gläubiger nach 20 Tagen beim Gericht das Konkursbegehren<br />
stellen kann<br />
- die Mittelung, dass der Schuldner innert 10 Tagen mit Beschwerde an die<br />
Aufsichtsbehörde die Zulässigkeit der Konkursbetreibung bestreiten kann und dass er<br />
das Recht hat einen Nachlassvertrag vorzuschlagen<br />
739. Welche Funktion hat das Güterverzeichnis?<br />
Es ist eine bloss vorläufige Sicherungsmassnahme und folglich keine Betreibungshandlung. In<br />
der Form eines amtlichen Inventars des Schuldnervermögens wird festgestellt, was im Falle<br />
der Konkurseröffnung alles zur Aktivmasse gehören könnte. Es nimmt somit einstweilen das<br />
Konkursinventar vorweg. Wird später der Konkurs eröffnet bildet es dessen Grundlage.<br />
740. Wer muss das Güterverzeichnis anordnen?<br />
Nur das zuständige Konkursgericht SchKG 162.<br />
74<strong>1.</strong> Wie wird das Güterverzeichnis angeordnet?<br />
Durch einseitige Verfügung im summarischen Verfahren.<br />
742. Welche Anfechtungsmöglichkeiten gibt es auf die richterliche Verfügung?<br />
Die Rechtsmittel nach kantonalem Recht, ans BGer nur die StBE.<br />
743. *Welche Voraussetzungen müssen für die Erstellung eines Güterverzeichnisses<br />
vorliegen?<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger muss beim Konkursgericht ein entsprechendes Begehren erstellen<br />
- Die Gläubigerinteressen müssen gefährdet erscheinen<br />
- Die konkursandrohung muss zugestellt sein ausser in den Fällen von 83 I und 183.<br />
(Dem Gläubiger steht aber, wenn ein Arrestgrund vorliegt wahlweise der Arrest zu)<br />
744. Wie/vom wem wird das Güterverzeichnis vollzogen?<br />
SchKG 163.<br />
Das Betreibungsamt nimmt auf Grund der gerichtlichen Verfügung das Güterverzeichnis auf<br />
SchKG 163 I. Die Pfändungsvorschriften SchKG 90-92 sind darauf entsprechend anzuwenden<br />
SchKG 163 II. Wenn allerdings Gefahr im Verzug ist, unterbleibt die Ankündigung.<br />
116
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
745. Welche Wirkungen hat das Güterverzeichnis?<br />
Wirkungen der Pfändung<br />
SchKG 96<br />
Verfügungsverbot<br />
Verfügungen sind<br />
ungültig ausser gut<br />
gläubiger Erwerb<br />
Verletzung der Pflicht den<br />
Wert des Vermögens zu<br />
erhalten<br />
Strafe nach StGB 169<br />
Wirkungen des<br />
Güterverzeichnisses SchKG 164<br />
117<br />
Nur modifiziertes<br />
Verfügungsbeschränkung<br />
Er ist aber verpflichtet<br />
aufgezeichneten<br />
Vermögensbestandteilen zu<br />
erhalten/ darf sie aber<br />
gebrauchen und verbrauchen<br />
muss sie aber durch<br />
gleichwertige ersetzen.<br />
Veräusserungshandlungen sind<br />
also grundsätzlich erlaubt<br />
→nur Pflicht Wert des<br />
Vermögens zu bewahren<br />
Darf Notbedarf brauchen<br />
746. Wie lange darf ein Güterverzeichnis bestehen bleiben?<br />
SchKG 165.<br />
- Das Betreibungsamt kann es aufheben, wenn sämtliche Gläubiger, die das<br />
Einleitungsverfahren erfolgreich durchgeführt haben damit einverstanden sind<br />
- Die Wirkungen erlöschen von Gesetzes wegen 4 Monate nach Erstellung des<br />
Verzeichnisses SchKG 165 II. (Ausser während Anerkennungsprozess wirkt es weiter)<br />
d.h. Gläubiger muss innert angemessener Frist das Konkursbegehren stellten<br />
- Mit dem Entscheid des Konkursgerichtes über das Konkursbegehren fallen die<br />
Wirkungen des Güterverzeichnisses dahin. Abweisung des Konkursbegehrens macht das<br />
Verzeichnis gegenstandslos; nach Gutheissung bildet es die Grundlage für das<br />
Konkursinventar.<br />
747. *Was Nützt dem Gläubiger das Güterverzeichnis?<br />
Er kann überprüfen, ob noch alles da ist und wenn etwas fehlt kann er unter Umständen die<br />
actio pauliana ergreifen.<br />
748. Auf wessen Antrag wird der Konkurs eröffnet?<br />
Auf das Konkursbegehren des Gläubigers hin.<br />
749. Wo und mit welchen Dokumenten ist das Konkursbegehren einzureichen?<br />
SchKG 166 I. Es ist mit dem Doppel des Zahlungsbefehls und der Konkursandrohung beim<br />
Konkursgericht am Konkursort einzureichen.<br />
750. Wer kann das Konkursbegehren einreichen?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger, der die Konkursandrohung erwirkt hat.<br />
75<strong>1.</strong> Wo ist die Frist geregelt, in welcher das Konkursbegehren gestellt werden muss?
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
In SchKG 166. <strong>Der</strong> Richter muss die Einhaltung der Frist von Amtes wegen beachten.<br />
752. *Was bewirkt die Einreichung des Konkursbegehrens?<br />
- dass der Richter den Termin für die gerichtliche Verhandlung bestimmt und ihn<br />
wenigstens 3 Tage vorher den Parteien anzeigt SchKG 168<br />
- dass der Antragssteller von Gesetzes wegen für die Kosten bis zum Schuldenruf SchKG<br />
232 oder bis zur Einstellung des Konkurses mangels Aktiven SchKG 230 haftet; das<br />
Gericht kann einen entsprechenden Vorschuss verlangen SchKG 169<br />
- dass das Gericht zur Wahrung der Rechte der Gläubiger sofort vorsorgliche<br />
Massnahmen treffen kann SchKG 170 (z.B. *Anordnung eines Güterverzeichnisses,<br />
Vormerkung einer Verfügugnsbeschränkung im Grundbuch, Erlass von<br />
Zahlungsverboten, Beschlagnahme von Objekten, Siegelung von Räumen und<br />
Behältnisse…)<br />
753. *Welche Verfahrensart stellt das Konkurseröffnungsverfahren dar?<br />
Ein summarisches Verfahren nach kantonaler ZPO.<br />
754. *Wer sind die Parteien?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger, der den Antrag gestellt hat und der Schuldner.<br />
755. Welche Grundsätze stellt das Bundesrecht für das Konkurseröffnungsverfahren<br />
auf?<br />
- den Parteien steht es frei, an der ihnen angezeigten Konkursverhandlung persönlich zu<br />
erscheinen, sich vertreten zu lassen oder ihre Anliegen bloss schriftlich anzubringen<br />
SchKG 168 Satz 2). Am angezeigten Termin wird aber ohne Aufschub entschieden,<br />
selbst bei Abwesenheit der Parteien SchKG 171<br />
- <strong>Der</strong> Richter hat konkurshindernde Tatsachen von Amts wegen zu berücksichtigen.<br />
756. Zu welchen Entscheiden kann das Konkursgericht im im<br />
Konkursöffnungsverfahren kommen?<br />
Das Gericht kann vom Nichteintreten auf das Begehren wegen eines Verfahrensmangels<br />
abgesehen den Entscheid über das Konkursbegehren einstweilen aussetzen, das Begehren<br />
abweisen oder den Konkurs eröffnen.<br />
757. In welchen Fällen setzt das Gericht den Entscheid vorerst aus?<br />
Aussetzungsgründe in SchKG 173/173a<br />
a) Wenn noch Fragen offen sind, die in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde fallen:<br />
- wenn eine Beschwerde hängig ist, der aufschiebende Wirkung erteilt wurde<br />
- wenn keine Beschwerde hängig ist, das Konkursgericht aber der Ansicht ist die<br />
Konkursbetreibung leide an einem Nichtigkeitsfehler muss der Entscheid der<br />
Aufsichtsbehörde eingeholt werden. Liegt aber ein offensichtlicher Nichtigkeitsgrund vor, si<br />
kann sie das Konkursgericht selbst feststellen und das Konkursbegehren abweisen.<br />
b) <strong>Der</strong> Entscheid ist auszusetzen, wenn die Betreibung im Rahmen eines Verfahrens nach<br />
SchKG 85 oder 85a II vom Richter eingestellt worden ist. (Bei endgültiger Entscheidung nach<br />
SchKG 85a III ist der Konkursentscheid aber nicht einfach auszusetzen sondern das<br />
Konkursbegehren abzuweisen.)<br />
c) das Konkursgericht kann (nach seinem Ermessen) seinen Entscheid auch aussetzen, wenn<br />
der Schuldner oder ein Gläubiger ein Gesuch um Nachlass- (SchKG 293) oder Notstundung<br />
eingereicht hat; ohne dass ein Nachlassgesuch vorzuliegen braucht, kann es das sogar von<br />
Amtes wegen tun.<br />
118
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
d) <strong>Der</strong> Entscheid ist weiter auszusetzen, wenn der Schuldner ein Gesuch um Einräumung<br />
besonderer Zahlungsfristen anhängig gemacht hat.<br />
758. Wann nimmt das Konkursgericht in den Fällen, wo es den Entscheid aussetzt das<br />
Verfahren wieder auf?<br />
Nachdem die zuständige Behörde ihren endgültigen Entscheid mitgeteilt hat. Je nach dem<br />
weist es dann das Konkursbegehren ab oder spricht die Konkurseröffnung aus.<br />
759. In welchen Fällen wird das Konkursbegehren abgewiesen?<br />
- in den Fällen von SchKG 172 und zusätzlich, da dieser Artikel nicht abschliessend ist:<br />
- wenn der Richter die Betreibung nach SchKG 85a III durch Urteil eingestellt oder<br />
aufgehoben bzw, nach SchKG 85 aufgehoben hat<br />
- dem Schuldner eine besondere Zahlungsfrist bewilligt wurde<br />
- eine Nachlass oder Notstundung gewährt wurde<br />
760. Wann wird das Konkursbegehren gutgeheissen?<br />
Wenn weder ein Nichteintretensentscheid noch ein Aussetzungs- noch ein Abweisungsgrund<br />
vorliegt.<br />
76<strong>1.</strong> Wie wird der Konkurs eröffnet?<br />
Durch Gutheissen des Konkursbegehrens.<br />
762. Wann ist die Konkurseröffnung wirksam?<br />
Sofort. Es hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn es die Rechtsmittelinstanz so verfügt<br />
hat SchKG 174 III. Möglichkeit der Weiterziehung spricht aber dagegen(?) →nein, weil die<br />
Weiterziehung an eine obere kantonale Instanz keine aufschiebende Wirkung hat<br />
763. Wie nennt man den gutgeheissenen Entscheid?<br />
Das Konkurserkenntnis.<br />
764. *Wem wird das Konkurserkenntnis alles eröffnet?<br />
Den Parteien, dem Betreibungs-, dem Konkurs und dem Grundbuch- und dem<br />
Handelsregisteramt SchKG 176.<br />
765. *Ab wann ist das Betreibungsamt nicht mehr zuständig?<br />
Ab dem rechtskräftigen Konkurserkenntnis. Ab diesem Zeitpunkt ist das Konkursamt<br />
zuständig.<br />
766. *Welche Folgen hat die Konkurseröffnung?<br />
Ausser den konkursrechtlichen Folgen hat die Konkurseröffnung auch eine Reihe<br />
zivilrechtlicher Auswirkungen:<br />
Bsp. ZGB 188: Eintritt der Gütertrennung, OR 35 I Erlöschen einer Vollmacht, OR 83: das<br />
Recht des Vertragspartners die Gegenleistung zurückzubehalten, OR 250 II: Hinfall des<br />
Schenkungsversprechens…<br />
767. *Kann der Entscheid über das Konkursbegehren weiter gezogen werden?<br />
Ja, das SchKG schreibt zwingend die Möglichkeit der Weiterziehung an einoberes kantonales<br />
Gericht vor SchKG 174.<br />
768. Welche Grundsätze gelten bundesrechtlich für die Weiterziehung?<br />
- Die Eingabefrist beträgt 10 Tage. Sie ist aber verlänger- und wiederherstellbar<br />
119
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Legitimiert sind der Schuldner sowie der Gläubiger, der das Konkursbegehren gestellt<br />
hat<br />
- Anfechtungsobjekt ist der Entscheid des Konkursgerichtes. Blosse Aussetzung könnte<br />
aber nur mit einem kantonalen Rechtsmittel weiter gezogen werden<br />
- Die Weiterziehung hat grundsätzlich keine Aufschiebende Wirkung SchKG 174 III.<br />
- Die Rechtsmittelinstanz kann auch neue Tatsachen und Beweismittel (nova)<br />
berücksichtigen. Diese sind gleichzeitig mit der Einlegung des Rechtsmittels<br />
vorzubringen; die Gegenpartei muss Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten<br />
o Unechte nova, die schon vor erster Instanz bestanden haben können vor oberer<br />
Instanz unbeschränkt geltend gemacht werden<br />
o Echte nova, die erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind<br />
dürfen nur unter besonderen Voraussetzungen berücksichtigt werden SchKG<br />
174 II. Diese sind im Gesetz abschliessend aufgezählt. Die echten nova werden<br />
nicht von Amtes wegen berücksichtigt; vielmehr muss der Schuldner sie<br />
ausdrücklich geltend machen und überdies mit Urkunde beweisen, wozu er<br />
aber nur zugelassen wird, wenn er seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht<br />
769. Mit welchem Rechtsmittel kann der oberinstanzliche kantonale Entscheid vor<br />
Bundesgericht getragen werden?<br />
Nur mit staatsrechtlicher Beschwerde.<br />
§37 Die Wechselbetreibung<br />
770. Was ist kennzeichnend für die Wechselbetreibung?<br />
Sie ist eine besondere Art Konkursbetreibung für Forderungen, die sich auf einen Wechsel<br />
oder einen Check gründen.<br />
Die Wechselbetreibung ist auf die Bedürfnisse des Handelsverkehrs zugeschnitten und<br />
zeichnet sich daher durch die Raschheit ihres Verfahrens aus.<br />
77<strong>1.</strong> Wie wird die Beschleunigung in der Wechselbetreibung erzielt?<br />
- durch Verkürzung der Fristen<br />
- Ausschluss der Betreibungsferien<br />
- Erschwerung des Rechtsvorschlags<br />
- Verzicht auf die Konkursandrohung<br />
- Verzicht auf die zweitinstanzliche Beurteilung des Konkursbegehrens<br />
772. Welche Voraussetzungen müssen für eine Wechselbetreibung vorliegen?<br />
Materiellrechtlich:<br />
- Die Wechselbetreibung steht nur zur Verfügung für Forderungen, die auf einem<br />
Wechsel oder Check beruhen SchKG 177 I<br />
Betreibungsrechtlich:<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner muss konkursfähig sein<br />
- Es muss ein ausdrückliches Begehren um Durchführung der Wechselbetreibung SchKG<br />
177 I vorliegen. Wird die Wechselbetreibung nicht ausdrücklich verlangt, so kommt es<br />
zur ordentlichen Konkursbetreibung<br />
773. *Welche Wahlmöglichkeiten hätte ein Gläubiger, dessen Wechselforderung<br />
pfandgesichert ist?<br />
Er hat die Wahl zwischen der Wechselbetreibung, der ordentlichen Konkursbetreibung oder<br />
der Pfandverwertungsbetreibung.<br />
120
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
774. Wie unterscheidet sich die Wechselbetreibung beim Betreibungsbegehren im<br />
Einleitungsverfahren von den übrigen Betreibungen?<br />
Mit dem Betreibungsbegehren, das neben den üblichen Angaben SchKG 67 das<br />
Ausdrückliche Verlangen nach Wechselbetreibung enthalten muss, ist der Wechsel oder der<br />
Check dem Betreibungsamt zu übergeben SchKG 177 II.<br />
775. *Welche Besonderheiten weist der Zahlungsbefehl auf?<br />
Er enthält nach SchKG 178 II ausser den Angaben des Betreibungsbegehrens die<br />
Aufforderung an den Schuldner, binnen 5 Tagen den Gläubiger zu befriedigen. Er wird weiter<br />
darauf hingewiesen, dass er innert 5 Tagen schriftlich und begründet Rechtsvorschlag erheben<br />
kann oder wegen Verletzung betreibungsrechtlicher Vorschriften Beschwerde führen darf.<br />
Schliesslich wird noch mitgeteilt, dass der Gläubiger ohne weiteres das Konkursbegehren<br />
stellen kann, wenn der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommt und keinen<br />
Rechtsvorschlag erhoben hat oder dieser beseitigt worden ist.<br />
776. *Welche Abweichungen weist der Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung<br />
vom sonstigen Rechtsvorschlag auf?<br />
- der Rechtsvorschlag wird wesentlich erschwert, indem er von einem Richter bewilligt<br />
werden muss<br />
- dem Rechtsvorschlag kommt aber eine bedeutend stärkere Wirkung zu: er kann nicht<br />
mehr einfach durch gewöhnliche Rechtsöffnung, sondern nur noch durch Klage im<br />
ordentlichen Zivilprozess überwunden werden<br />
777. *Welche formalen Abeichungen weist der Rechtsvorschlag im<br />
Wechselbetreibungsverfahren auf?<br />
Er muss schriftlich eingegeben und begründet werden SchKG 179 I als Begründung kommen<br />
nur die im Gesetz abschliessend aufgezählten Einreden in Betracht. Nachträgliche Ergänzung<br />
oder Änderung der Begründung ist zulässig SchKG 179 II. Selbst ein zunächst unbegründeter<br />
Rechtsvorschlag wäre von den Behörden an die Hand zu nehmen; da das<br />
Begründungserfordernis nur Ordnungsvorschrift ist SchKG 32 IV.<br />
Die Wiederherstellung der 5-tägigen Bestreitungsfrist schliesst SchKG 179 III ausdrücklich<br />
aus. Hingegen wird ein nachträglicher Rechtsvorschlag i.S. SchKG 77 bei Gläubigerwechsel<br />
zugelassen.<br />
778. Wer behandelt in der Wechselbetreibung den Rechtsvorschlag?<br />
Er wird auch beim Betreibungsamt erhoben. Das Betreibungsamt oder auf Beschwerde hin die<br />
Aufsichtsbehörde entscheidet auch hier nur darüber, ob der Rechtsvorschlag form und<br />
zeitgerecht erfolgte. Hierauf wird er unverzüglich dem Gericht überwiesen SchKG 18<strong>1.</strong><br />
779. Wer entscheidet über die Bewilligung des Rechtsvorschlags?<br />
Das Gericht im summarischen Verfahren SchKG 25 Ziff. 2b.<br />
Zuständig ist das Gericht am Konkursort; es lädt die Parteien vor und entscheidet innert der<br />
Ordnungsfrist von 10 Tagen, selbst wenn die Parteien abwesend sind SchKG 18<strong>1.</strong> <strong>Der</strong><br />
Entscheid wird den Parteien sofort eröffnet SchkG 184 I.<br />
780. Kann der Entscheid des Gerichtes über die Bewilligung des Rechtsvorschlags<br />
weiter gezogen werden?<br />
Ja, innert 5 Tagen ans obere kantonale Gericht SchKG 185.<br />
78<strong>1.</strong> Kann der Entscheid ans BGer weiter gezogen werden?<br />
Nur mit StBE.<br />
121
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
782. Wann darf der Rechtsvorschlag bewilligt werden?<br />
Nur wenn einer der im Gesetz abschliessend aufgezählten Bewilligungsgründe vorliegt.<br />
783. *Welches sind die Bewilligungsgründe?<br />
wenn der<br />
Schuldner durch<br />
Urkunde<br />
beweist, dass die<br />
Schuld bezahlt,<br />
nachgelassen<br />
oder gestundet<br />
ist SchKG 182<br />
Ziff. 1<br />
Bewilligungsgründe:<br />
SchKG 182<br />
Wenn er die<br />
Fälschung des<br />
Titels<br />
glaubhaft<br />
macht. Sei es<br />
Fälschung<br />
seiner<br />
Unterschrift<br />
oder eines<br />
Inhaltes<br />
Unbedingte Bewilligung des<br />
Rechtsvorschlags<br />
Wenn er sonst eine<br />
wechselrechtliche<br />
Einrede, die sich<br />
gegen das<br />
Bestehen einer<br />
wechselmässigen<br />
Verpflichtung<br />
richtet begründet<br />
erscheint<br />
122<br />
Schliesslich kann<br />
der Schuldner<br />
noch andere<br />
nach OR 1007<br />
zulässige, aber<br />
nicht unmittelbar<br />
aus dem<br />
Wechselrecht<br />
hervorgehende<br />
Einreden<br />
Bedingte Bewilligung,<br />
weil da die<br />
wechselrechtliche<br />
Verbindlichkeit nicht in<br />
Frage steht
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
784. Welche Auswirkungen und Möglichkeiten stehen je nachdem offen, ob es sich um<br />
eine bedingte Bewilligung des Rechtsvorschlags handelt oder nicht?<br />
Gewinnt G:<br />
Betreibung<br />
fortsetzen und<br />
Konkursbegehren<br />
stellten<br />
Unbedingte Bewilligung Bedingte Bewilligung<br />
Betreibung wird<br />
eingestellt<br />
Will der G weiter<br />
machen<br />
G muss seinen Anspruch<br />
auf dem ordentlichen<br />
Prozessweg mit der<br />
Wechselklage geltend<br />
machen, SchKG 186,<br />
analog 79<br />
→es gibt kein RÖ-<br />
Verfahren<br />
Verliert G, so ist<br />
die Betreibung<br />
eingestellt<br />
G klagt nicht<br />
<strong>Der</strong> unbedingter<br />
Rechtsvorschalg wird<br />
dadurch bedingt!<br />
Betreibung wird eingestellt, wenn<br />
der S die Forderungssumme in<br />
Geld oder Wertschriften<br />
hinterlegt oder dem Gläubiger<br />
eine gleichwertige Sicherheit<br />
leistet. Das muss aber prosequiert<br />
werden<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger muss binnen 10<br />
Tagen die Wechselklage erheben<br />
SchKG 184 II<br />
Klagt G nicht<br />
rechtzeitig:<br />
S erhält die<br />
Hinterlage<br />
zurück und die<br />
Sicherheitsleistung<br />
wird<br />
frei<br />
G klagt<br />
rechtzeitig<br />
G kann jetzt trotz Rückgabe der<br />
Hinterlegung an den S noch die<br />
Wechselklage innerhab der<br />
Gültigkeitsdauer des<br />
Zahlungsbefehls auch nachher<br />
noch anheben<br />
Klage gutgeheissen<br />
→Konkursbegehren<br />
123<br />
Klage<br />
abgewiesen<br />
Betreibung fällt<br />
dahin
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
785. Was ist, wenn der Rechtsvorschlag nicht bewilligt wurde?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger kann dann das Konkursbegehren stellen (die Konkursandrohung fällt weg).<br />
<strong>Der</strong> Entscheid ist einer anders lautenden Verfügung der Rechtsmittelinstanz vorbehalten<br />
sofort vollstreckbar, selbst wenn er weiter gezogen würde SchKG 36.<br />
Dem Schuldner ist in der Wechselbetreibung die Aberkennungsklage verschlossen d.h. er<br />
kann nur eine Rückforderungsklage analog SchKG 86 machen.<br />
786. Wie wird die Wechselbetreibung fortgesetzt?<br />
Da die Konkursandrohung im Zahlungsbefehl bereits Vorweggenommen ist, wird die<br />
Wechselbetreibung nach erfolgreich durchgeführtem Einleitungsverfahren unmittelbar mit<br />
dem Konkursbegehren fortgesetzt.<br />
787. Wann kann der Gläubiger die Konkurseröffnung beantragen?<br />
Nach Ablauf der Zahlungsfrist und Eintritt der Rechtskraft des Zahlungsbefehls.<br />
788. Wann ist der Zahlungsbefehl rechtskräftig?<br />
Wenn der Schuldner keinen Rechtsvorschlag eingegeben hat oder dieser ihm nicht bewilligt<br />
worden ist oder wenn seine Wirkung nach erfolgreicher Wechselklage dahingefallen ist.<br />
789. Was braucht es damit das Konkursbegehren gültig ist?<br />
Ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl, weiter muss dem Konkursbegehren der Forderungstitel,<br />
das Doppel des Zahlungsbefehls sowie gegebenenfalls der rechtskräftige Entscheid über die<br />
Verweigerung des Rechtsvorschlages oder über die Gutheissung der Wechselklage beigelegt<br />
werden SchKG 188 I. Das Begehren muss während der einmonatigen Gültigkeitsdauer des<br />
Zahlungsbefehls gestellt werden. Hat der Schuldner Recht vorgeschlagen, so zählt die Dauer<br />
des Bewilligungsverfahrens oder des ordentlichen Wechselprozesses nicht mit SchKG 188 II.<br />
790. Inwiefern ist das Konkurseröffnungsverfahren in der Wechselbetreibung anders<br />
als in der ordentlichen Betreibung?<br />
Lediglich bezüglich zwei Bestimmungen SchKG 189:<br />
- das Konkursgericht soll, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind den Konkurs binnen 10<br />
Tagen aussprechen<br />
- Die Weiterziehung des Entscheides an eine obere Instanz ist ausgeschlossen SchKG 189<br />
verweist nicht auf SchKG 174. Es kommt allensfalls noch eine StBE in frage.<br />
Im Übrigen gelten durchwegs die gleichen Bestimmungen wie in der ordentlichen<br />
Konkursbetreibung.<br />
§38 Die Konkurseröffnung ohne Betreibung<br />
79<strong>1.</strong> *Wann kann der Konkurs ohne vorgängige Betreibung eröffnet werden?<br />
Wenn ein materieller Konkursgrund vorliegt.<br />
792. Was bildet den Anstoss zu einer Konkurseröffnung ohne Betreibung?<br />
Ein direktes Konkursbegehren an das Konkursgericht ohne vorgängige Konkursandrohung.<br />
793. *Von wem kann der Anstoss zu einer Konkurseröffnung ohne Betreibung<br />
ausgehen?<br />
Ein solches Begehren kann vom Gläubiger, vom Schuldner oder von einer Behörde ausgehen.<br />
124
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
794. Welche Arten von Tatbeständen gibt es, die den Gläubiger berechtigen, sofort die<br />
Konkurseröffnung über den Schuldner zu verlangen?<br />
Wenn eine Gefährdung der Eintreibbarkeit der Forderung vorliegt.<br />
- einerseits sind es Tatbestände, bei denen gegen jeden beliebigen, also auch gegen einen<br />
nicht konkursfähigen Schuldner das Konkursbegehren gestellt werden kann SchKG 190<br />
I Ziff. 1 und 3.<br />
- Andererseits ein Tatbestand, der nur gegen einen konkursfähigen Schuldner als<br />
Konkursgrund angerufen werden darf SchKG 190 I Ziff. 2<br />
795. *Welche Gründe kommen als sofortige Konkurseröffnungsgründe gegenüber<br />
jedem beliebigen Schuldner in Frage?<br />
SchKG 190 I Ziff. 1 und 3<br />
- Unbekannter Aufenthalt des Schuldners. Allein das Unbekanntsein des tatsächlichen<br />
Aufenthalts des Schuldners ist entscheidend. <strong>Der</strong> Aufenthaltsort muss trotz<br />
zweckmässiger und zumutbarer Nachforschung des Gläubigers, selbst mit behördlicher<br />
Hilfe unauffindbar sein.<br />
- Unredliches Verhalten des Schuldners gegenüber einem oder mehreren Gläubigern.<br />
Aber nur 3 Arten solchen Verhaltens lässt das Gesetz als Konkursgründe gelten:<br />
o Wenn der Schuldner die Flucht ergriffen hat, dazu genügt schon jeder<br />
ernsthafte Fluchtversuch. Doch Schuldnerflucht ist nur dann ein<br />
Konkursgrund, wenn sich der Schuldner ins Ausland absetzt.<br />
o Wenn der Schuldner betrügerische Handlungen zum Nachteil seiner Gläubiger<br />
begangen hat oder zu begehen versucht. Dazu genügt jedes Handeln in der<br />
Absicht, seine Gläubiger zu schädigen<br />
o Wenn der Schuldner in einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines<br />
Vermögens verheimlicht. Es ist keine Schädigungsabsicht erforderlich. <strong>Der</strong><br />
Schuldner muss seine Vermögensbestandteile nur verbergen wollen.<br />
Liegt solch unredliches Verhalten des Schuldners vor, darf nicht nur der unmittelbar<br />
betroffene Gläubiger, sondern auch jeder andere Gläubiger die Konkurseröffnung<br />
verlangen.<br />
- Wenn gegenüber dem Schuldner eine Nachlassstundung widerrufen oder ein<br />
Nachlassvertrag verworfen oder widerrufen wird. Dieser Konkursgrund ist allerdings<br />
befristet: das Konkursbegehren muss binnen 20 Tagen seit dem betreffenden Entscheid<br />
dem Nachlassrichter gestellt werden.<br />
796. Welche Gründe kommen als Konkursgründe nur gegenüber einem<br />
konkursfähigen Schuldner in Frage?<br />
Wenn der Schuldner die Zahlung eingestellt hat. Mit der Zahlungseinstellung manifestiert er<br />
nach aussen seine Zahlungsunfähigkeit.<br />
797. Wann liegt Zahlungseinstellung vor?<br />
Wenn der Schuldner unbestrittene fällige Schulden nicht mehr bezahlt oder mehrere<br />
Betreibungen auflaufen lässt, wenn er systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleine<br />
Beträge nicht mehr bezahlt. Er muss nicht sämtliche Zahlungen eingestellt haben, es genügt,<br />
wenn ein wesentlicher Teil des Geschäftsbetriebes betroffen ist. Es muss eine objektive<br />
Illiquität vorliegen die den Schuldner ausserstande setzt, seine Gläubiger bei Fälligkeit der<br />
Forderung zu befriedigen. <strong>Der</strong> Schuldner muss sich für unabsehbare Zeit in dieser Lage<br />
befinden. Es ist nicht das Gleiche wie Überschuldung.<br />
798. Wie läuft das Konkurseröffnungsverfahren ab?<br />
125
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
SchKG 194. <strong>Der</strong> Gläubiger braucht nur beim Konkursgericht das Konkursbegehren zu stellen.<br />
Legitimiert dazu ist jeder Gläubiger, gleichgültig, ob seine Forderung fällig ist oder nicht,<br />
gleichgültig auch, ob seine Forderung erst nach Eintritt des Konkursgrundes entstanden ist.<br />
<strong>Der</strong> Antragssteller muss sich nur als Gläubiger ausweisen und den angerufenen Konkursgrund<br />
glaubhaft machen.<br />
Wohnt der Schuldner in der Schweiz oder hat er hier einen Vertreter, wird er kurzfristig vor<br />
Gericht geladen und einvernommen, damit er seine Rechte gegenüber dem antragsstellenden<br />
Gläubiger wahrnehmen kann SchKG 190 II.<br />
799. Wann hat ein Schuldner ein Interesse daran über sich selbst einen Konkurs zu<br />
eröffnen?<br />
Vor allem der nicht konkursfähige Schuldner kann durch die Konkurseröffnung einer<br />
Häufung von Spezialexekutionen zu entrinnen, die sich gegen ihn härter auswirken können als<br />
der Konkurs. Das Interesse des Schuldners an der Konkurseröffnung kann aber auch darin<br />
bestehen, eine günstige Ausgangslage zum Abschluss eines Nachlassvertrages zu schaffen.<br />
Andererseits kann der Schuldner sogar verpflichtet sein, im Interesse seiner Gläubiger die<br />
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung herbeizuführen.<br />
800. Was muss vorliegen, dass der Schuldner die Konkurseröffnung beantragen<br />
kann?<br />
SchKG 191, er muss zahlungsunfähig sein. Das Recht auf diese Insolvenzerklärung steht<br />
jedem Schuldner zu, ob er konkursfähig ist oder nicht.<br />
80<strong>1.</strong> Welche Erleichterungen bietet die Konkurseröffnung dem der Spezialexekution<br />
unterliegenden Schuldner?<br />
Die bereits vollzogene Pfändung (auch die Lohnpfändung) fallen dahin. Ausserdem darf der<br />
Schuldner schon während des Konkurses wieder völlig frei über seinen Lohn verfügen.<br />
802. Was gibt es heute, dass die Konkurseröffnung wegen den Vorteilen, die sie dem<br />
Schuldner bringt nicht mehr missbräuchlich ausgenutzt wird?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner hat nach SchKG 191 nur noch das Recht den Konkurs zu beantragen nicht<br />
mehr wie früher einfach selbst bewirken. Beantragen heisst, dass der Richter abklären muss,<br />
ob der Konkurs eröffnet werden kann oder nicht. <strong>Der</strong> Schuldner muss dem Richter seine<br />
finanziellen Verhältnisse darlegen. <strong>Der</strong> Richter hat darauf hin ein offensichtlilch<br />
rechtsmissbräuchliches Konkursbegehren abzuweisen. Überdies muss geprüft werden, ob<br />
nicht Aussicht auf eine private Schuldbereinigung nach SchKG 333ff besteht. Nur wenn dies<br />
nicht zutrifft, darf der Konkurs eröffnet werden. Diese Voraussetzung kann aber nach SchKG<br />
333 I nur gegenüber einem nicht konkursfähigen Schuldner gelten. Konkurseröffnung soll nur<br />
als ultima ratio in Betracht gezogen werden.<br />
Schliesslich muss der Konkursrichter prüfen, ob kein Tatbestand nach SchKG 206 III oder<br />
SchKG 265b vorliegt.<br />
803. Wie läuft das Konkurseröffnungsverfahren auf Antrag des Schuldners ab?<br />
Antragsberechtigt ist der Schuldner. Anhörung der Gläubiger ist angezeigt zur Abklärung der<br />
Aussicht auf eine Schuldenbereinigung. Parteistellung kommt den Gläubigern aber nach h.L.<br />
in diesem Verfahren nicht zu; demzufolge können sie die Konkurseröffnung nicht<br />
weiterziehen. Sonst gilt das, was SchKG 194 sagt. Es kann aber insbesondere auch vom<br />
antragsstellenden Schuldner Kostenvorschuss verlangt werden.<br />
126
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
804. In welchen Fällen kann bei einer Gesellschaft der Konkurs ohne vorgängige<br />
Betreibung verhängt werden?<br />
Wenn sie Überschuldet ist. Die Gesellschaft muss in diesem Fall eine Zwischenbilanz<br />
erstellen und sie dem Richter vorlegen.<br />
805. Was bedeutet Überschuldung?<br />
Es bedeutet, dass das Fremdkapital einer Gesellschaft durch die Aktiven nicht mehr voll<br />
gedeckt ist. Wenn nur das Eigenkapital nicht mehr gedeckt ist liegt noch keine Überschuldung<br />
vor, erst wenn das Fremdkapital auch angegriffen wird.<br />
806. Wie wird der Konkurs bei einer überschuldeten Gesellschaft eröffnet?<br />
<strong>Der</strong> Richter überprüft die Überschuldung anhand der ihm vorgelegten Zwischenbilanz<br />
summarisch. Wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind, eröffnet er den Konkurs von Amtes<br />
wegen.<br />
Es kommt SchKG 194 zur Anwendung, ausser, dass von der überschuldeten Gesellschaft kein<br />
Kostenvorschuss verlangt werden darf.<br />
807. Unter welchen Voraussetzungen darf trotz Überschuldung vom Konkurs<br />
abgesehen werden?<br />
- wenn entweder ein Antrag auf Kostenaufschub gestellt wird und Aussicht auf Sanierung<br />
besteht<br />
- oder wenn Anhaltspunkte für das Zustandekommen eines Nachlassvertrages bestehen,<br />
sodass von Amtes wegen ein Nachlassverfahren einzuleiten ist SchKG 173a II.<br />
808. Wann wird der Konkurs auf behördliche Anordnung eröffnet?<br />
Im Falle des Erbschaftskonkurses. Dieser kann durchgeführt werden ungeachtet dessen, ob<br />
der Erblasser zur Zeit seines Todes konkursfähig war oder nicht.<br />
809. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, dass es zum Erbschaftskonkurs<br />
kommt?<br />
SchKG 193<br />
- wenn die gesetzlichen und die eingesetzten Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben<br />
oder wenn die Ausschlagung infolge amtlich festgestellter oder offenkundiger<br />
Zahlungsunfähigkeit zu vermuten ist<br />
- auch wenn die nächsten gesetzlichen Erben die Erbschaft vorbehaltlos ausschlagen ZGB<br />
573 und 575<br />
- oder wenn sich im Verlauf der amtlichen Liquidation die Erbschaft als überschuldet<br />
erweist.<br />
810. Wie läuft das Konkurseröffnungsverfahren im Falle des Erbschaftskonkurses?<br />
Auch der Erbschaftskonkurs wird durch einen Entscheid des Konkursrichters eröffnet,<br />
nachdem die Erbschaftsbehörde ihm die Akten von Amtes wegen überwiesen hat SchKG 193<br />
I. Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften von SchKG 194. Die Kosten<br />
sind aus dem Liquidationserlös vorweg zu bezahlen; den Erben dürfen sie nicht belastet<br />
werden.<br />
81<strong>1.</strong> Kann die Konkursamtliche Liquidation der Erbschaft auch von jemand anderem<br />
als von der Behörde beantragt werden?<br />
Ja, auch von einem Gläubiger oder einem Erben.<br />
In diesem Fall kann vom Antragssteller ein Kostenvorschuss für das Verfahren nach SchKG<br />
194 verlangt werden. Folgerichtig ist jener dann aber zur Weiterziehung befugt.<br />
127
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
812. Was ist charakteristisch für den Widerruf des Konkurses?<br />
Dass der Richter, der den Konkurs eröffnet hat, ihn noch vor seinem Abschluss durch einen<br />
neuen Entscheid wieder aufhebt. Das ist insbesondere dann geboten, wenn infolge echter nova<br />
Voraussetzungen dahinfallen, die zur Konkurseröffnung führten.<br />
813. Welche Arten des Konkurswiderrufs gibt es?<br />
Zwei:<br />
- den allgemeinen Widerruf des Konkurses nach SchKG 195<br />
- und die Einstellung der konkursamtlichen Erbschaftsliquidation nach SchKG 196.<br />
814. In welchen Fällen kommt der allgemeine Konkurswiderruf zum Zug?<br />
SchKG 195 I:<br />
- wen der Schuldner nachweist, dass sämtliche Forderungen getilgt sind<br />
- oder er die schriftliche Erklärung sämtlicher Gläubiger bringt, dass sie ihre<br />
Konkurseingabe vorbehaltlos zurückziehen<br />
- oder ein gerichtlicher Nachlassvertrag zustande gekommen ist<br />
815. In welcher Zeitspanne kann der allgemeine Konkurswiderruf geltend gemacht<br />
werden/warum?<br />
SchKG 195 II, er kann erst nach Ablauf der Eingabefrist SchKG 232 II Ziff. 2 widerrufen<br />
werden, muss aber spätestens vor seinem Abschluss widerrufen sein.<br />
Vorerst einmal muss bekannt sein, wer alles überhaupt als Gläubiger in Betracht kommt, und<br />
andererseits lässt sich ein zu Ende geführter Konkurs nicht mehr aufheben SchKG 195 II.<br />
816. Welche Wirkungen hat der allgemeine Konkurswiderruf?<br />
Er bewirkt den Hinfall sämtlicher Wirkungen des Konkurses, sowohl der materiell- als auch<br />
der formellrechtlichen. Aufgehoben wird damit der Konkurs selbst und mit ihm die<br />
Zwangsvollstreckung als Ganzes.<br />
Das bedeutet, dass alle bereits erfolgten Vorkehren wie z.B. das Konkursinventar dahinfallen.<br />
Bereits durchgeführte Verwertungen berührt der Widerruf dagegen nicht mehr.<br />
Vor allem werden auch die zivilrechtlichen Verhältnisse wiederhergestellt: die Verzinslichkeit<br />
der Forderung lebt wieder auf und zwar ex tunc, und es gelten auch wieder die ursprünglichen<br />
Fälligkeiten. Mit dem Widerruf des Konkurses gelten auch wieder die ursprünglichen<br />
Fälligkeiten. Mit dem Widerruf des Konkurses erlagt der Schuldner auch wieder das volle<br />
Verfügungsrecht über sein Vermögen.<br />
Andererseits können die Gläubiger den Schuldner auch wider von neuem betreiben. Frühere<br />
Betreibungen, die infolge des Konkurses dahingefallen sind, leben mit dem Widerruf aber<br />
nicht einfach wieder auf und können deshalb nicht fortgesetzt werden.<br />
Im Konkurs als Generalexekution sind die vorher eingeleiteten Spezialexekutionen<br />
aufgegangen, sodass mit seinem Wegfall überhaupt jede bisherige Zwangsvollstreckung<br />
aufhört. Auch öffentlichrechtliche Folgen des Konkurses sind nach dem Widerruf wieder<br />
aufzuheben.<br />
817. Wo ist der Widerruf einer konkursamtlichen Liquidation der Erbschaft<br />
geregelt?<br />
In SchKG 196.<br />
818. Wer ist für den Widerruf des Konkurses zuständig?<br />
Das Konkursgericht, das den Konkurs eröffnet hat. Entschieden wird im summarischen<br />
Verfahren SchKG 25 Ziff 2a.<br />
128
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
819. Von wem muss der Antrag auf Widerruf des Konkurses ausgehen?<br />
- in den Fällen von SchKG 195 Ziff. 1 und 2 geht der Antrag vom Schuldner aus<br />
- Im Falle von SchKG 195 Ziff. 3 teilt das Nachlassgericht die Bestätigung des<br />
Nachlassvertrages der Konkursverwaltung mit. Diese hat dann den Widerruf von Amtes<br />
wegen zu beantragen<br />
- Im Falle von SchKG 196 muss ein Erbe den Widerruf beantragen<br />
<strong>Der</strong> Antragsteller hat die Gerichtskosten vorzuschiessen.<br />
<strong>Der</strong> Widerruf des Konkurses wird öffentliche bekannt gemacht SchKG 195 III.<br />
820. Wie ist der Widerrufsentscheid anfechtbar?<br />
Nach der Praxis ist der Entscheid nur mit den im kantonalen Recht vorgesehenen<br />
Rechtsmitteln anfechtbar. Ans BGer führt nur die staatsrechtliche Beschwerde.<br />
Zu 15. der <strong>Vorlesung</strong>: Die Konkursmasse<br />
2. Abschnitt: Die materiellen Rechtsverhältnisse im Konkurs (materielles Konkursrecht)<br />
§40 Die Konkursmasse<br />
82<strong>1.</strong> Was bildet in der Betreibung auf Pfändung, was in der Betreibung auf<br />
Pfandverwertung und was im Konkurs das Vollstreckungssubstrat?<br />
In der Betreibung auf Pfändung bilden die einzelnen gepfändeten, in der Betreibung auf<br />
Pfandverwertung die einzelnen verpfändeten Vermögensgegenstände das<br />
Vollstreckungssubstrat. Im Konkurs ist es das gesamte verwertbare Vermögen des<br />
Schuldners. Dieses unterliegt von der Konkurseröffnung als Ganzes dem<br />
Vollstreckungsbeschlag.<br />
822. *Was ist der Umfang der Konkursmasse?<br />
SchKG 197 I: sämtliches pfändbares Vermögen das dem Schuldner<br />
gehört zur Zeit der Konkurseröffnung gleichviel, wo es sich befindet.<br />
Keine Kompetenzstücke…<br />
SchKG 92/ Austauschpfändung<br />
möglich<br />
Muss dem Schuldner gehören<br />
sonst Aussonderungsverfahren<br />
~ Widerspruchsverfahren<br />
Nicht seine<br />
Person/Persönlichkeitsrechte, sondern<br />
nur das Vermögen<br />
Und was vor Schluss des<br />
Konkursverfahrens anfällt →gilt nur für<br />
Vermögen nicht für den Lohn<br />
129
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
823. *Welcher Grundsatz gilt im SchKG um Einheit und Allgemeinheit des<br />
Konkurses zu wahren?<br />
<strong>Der</strong> Grundsatz der Universalität des Konkurses.<br />
824. *Was bedeutet der Grundsatz der Universalität des Konkurses?<br />
- dass der Konkurs in der Schweiz gleichzeitig nur an einem Ort eröffnet sein kann, dort<br />
nämlich, wo er zuerst erkannt wurde SchKG 55. Dies bezweckt, dass die<br />
Generalexekution unter einem rechtlich einheitlichen Regime durchgeführt wird und<br />
regelmässig auch nur ein Gericht zuständig ist. Das liegt im öffentlichen Interesse und<br />
ist deshalb zwingend.<br />
- <strong>Der</strong> einheitliche Konkurs erstreckt sich sodann auf sämtliches Vermögen des Schuldners<br />
gleichviel, wo es sich befindet SchKG 197 I. Doch der Gedanke der Universalität findet<br />
seine Grenzen an der staatlichen Souveränität. Darum gilt das dem Gesetz zu Grunde<br />
liegende Universalitätsprinzip zunächst nur für das Gebiet der Schweiz. Gegenteiliges<br />
Prinzip: Territorialität. Über die Landesgrenze hinaus kann deshalb die Universalität des<br />
schweizerischen Konkurses nur durch nachgiebiges Landesrecht des ausländischen<br />
Staates oder durch zwischenstaatliche Vereinbarungen verwirklicht werden. Nicht ganz<br />
auszuschliessen ist auch die Möglichkeit gesetzlich nicht geregelter freiwilliger<br />
Rechtshilfe eines ausländischen Staates.<br />
825. *Wie verhält es sich, wenn ein Konkurs im Ausland eröffnet wird?<br />
Im Falle eines im Ausland eröffneten Konkurses, wird dieser selbst bei Fehlen eines<br />
Staatsvertrages, in der Schweiz anerkannt, wenn die Voraussetzungen des IPRG erfüllt sind.<br />
In der Schweiz wird dann so ein „Minikonkurs“ in einem summarischen Verfahren<br />
durchgeführt vorweg werden die schweizerischen Pfandgläubiger und die privilegierten<br />
Gläubiger befriedigt, der Rest wird dem Land überwiesen, wo der Konkurs stattgefunden hat.<br />
826. Inwiefern ist die Konkursmasse zeitlich begrenzt?<br />
Zeitlich umfasst sie alles Vermögen, das dem Schuldner zwischen Beginn und Ende des<br />
Konkurses rechtlich zusteht. Das ist nicht allein sein Vermögensbestand im Zeitpunkt der<br />
Konkurseröffnung, sondern auch das Vermögen, das ihm seither bis zum Schluss des<br />
Konkursverfahrens noch anfällt, SchKG 197.<br />
827. Was gehört zum „anfallenden Vermögen“ in SchKG 197 II?<br />
Dazu gehören sachlich nur Werte, die der Schuldner nicht erarbeiten muss. Dabei kommt nur<br />
zugefallenes Reinvermögen in Betracht, der Betrag also, der nach Abzahlung allfälliger<br />
Aufwendungen übrig bleibt.<br />
Keinen Vermögensanfall in diesem Sinne bildet demnach das Erwerbseinkommen, das der<br />
Schuldner nach Konkurseröffnung erzielt(!). Nur was vorher erworben wurde fällt in die<br />
Konkursmasse. Dafür ist nicht massgebend in welchem Zeitpunkt der Einkommensbetrag<br />
beim Schuldner eingegangen ist; allein der Zeitpunkt der Entstehung der rechtsbegründenden<br />
Tatsachen ist massgebend.<br />
828. *Kann der Schuldner auch frei über seinen Arbeitserwerb verfügen, wenn er<br />
vorher gepfändet wurde?<br />
Ja.<br />
829. Welche Vorteile kann einem Schuldner, bei dem gepfändet wird die<br />
Konkurseröffnung bringen?<br />
130
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Sein gepfändeter Lohn wird freigegeben. Selbst Ersparnisse, die der Schuldner aus seinem<br />
Arbeitserwerb macht, stellen nicht anfallendes Vermögen dar sondern daraus kann höchstens<br />
neues Vermögen gebildet werden.<br />
830. Was fällt grundsätzlich in den sachlichen Umfang der Konkursmasse?<br />
Nur verwertbares Vermögen des Schuldners darum gilt, dass zur Konkursmasse alles gehört,<br />
was auch pfändbar wäre, SchKG 197. Unpfändbare Vermögensbestandteile, insbesondere<br />
Kompetenzstücke fallen nicht in die Konkursmasse. Sonst gehört alles in die Konkursmasse,<br />
was dem Schuldner zu Eigentum oder auf Grund eines anderen absoluten oder obligatorischen<br />
Rechts zusteht. Sogar eine vor Konkurseröffnung abgetretene künftige Forderung des<br />
Schuldners fällt in die Konkursmasse, wenn sie erst nach Konkurseröffnung entstanden ist.<br />
Auch erbrechtliche Ansprüche gehören dazu.<br />
83<strong>1.</strong> **Fallen Pfandgegenstände auch in die Konkursmasse?<br />
Pfandgegenstände (Sachen mit einem Pfandrecht darauf), die dem Schuldner gehören, fallen<br />
in die Konkursmasse; doch bleibt den Pfandgläubigern das Recht auf Vorhabbefriedigung aus<br />
deren Erlös erhalten (SchKG 198, 219 und 232 II Ziff. 4) Im Konkurs gilt aber das<br />
Deckungsprinzip nicht d.h. es ist kein Mindestgebot erforderlich, doch dürfen die<br />
verpfändeten Vermögensstücke nur mit Zustimmung der Pfandgläubiger anders als durch<br />
Verkauf an öffentlicher Steigerung verwertet werden SchKG 256 II. Infolgedessen werden im<br />
Konkurs die vom Schuldner bestellten Pfänder zusammen mit seinem übrigen Vermögen<br />
verwertet. Entsprechend ist der Pfandgläubiger zur Herausgabe des Pfandes verpflichtet, es<br />
werden ihm Konsequenzen angedroht, wenn er es nicht macht: Verlust des Vorzugsrechts und<br />
Straffolge SchKG 232 II Ziff. 4.<br />
832. *Fallen gepfändete oder arrestierte Vermögensgegenstände auch in die<br />
Konkursmasse?<br />
Gegenstände, die vor der Konkurseröffnung des Schuldners gepfändet oder arrestiert wurden,<br />
gehören ebenfalls zur Konkursmasse; denn frühere Spezialexekutionen sind mit der<br />
Konkurseröffnung aufgehoben SchKG 199 I.<br />
Ausnahme SchKG 199 II.<br />
833. *Wann interessiert ein Gläubiger die Eröffnung des Konkurses obwohl er mit<br />
seiner Betreibung so weit fortgeschritten ist, dass an ihn der Erlös verteilt wird?<br />
Wenn er noch einen Verlustschein erhalten hat, denn in diesem Fall, kann er jetzt seine<br />
Forderung im Konkurs eingeben.<br />
834. *Fallen betreibungsrechtliche Anfechtungsansprüche in die Konkursmasse?<br />
Ja, SchKG 200. Im Einzelnen kommen in Betracht:<br />
- die Anfechtung einer fraudulösen Verrechnung nach SchKG 214<br />
- die paulianische Anfechtung gemäss SchKG 285 ff.<br />
835. *Was passiert, wenn im Konkurs die Rechtszugehörigkeit eines<br />
Vermögenswertes streitig ist?<br />
Je nach dem Gewahrsam am streitigen Gegenstand kommt es zum Aussonderungs- oder zum<br />
Admassierungsverfahren SchKG 242.<br />
836. *Was bedeutet „Aussonderung“?<br />
Das bedeutet, dass der Dritte einen unter Konkursbeschlag gefallenen Gegenstand<br />
freibekommen will. Anders als das Widerspruchsverfahren im Rahmen einer<br />
Spezialexekution, das auch der Klärung von reinen Rangforderungen der angemeldeten<br />
131
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Drittrechte dient, hat die Aussonderung im Konkurs immer nur Herausgabeansprüche zum<br />
Gegenstand; andere Recht Dritter werden hier im Kollokationsverfahren geklärt.<br />
837. *Was will man mit der „Admassierung“ machen?<br />
Damit sucht die Konkursmasse einen bei einem Dritten befindlichen Gegenstand, an dem<br />
dieser eigene Rechte geltend macht, zur Masse zu ziehen, weil er nach Auffassung der<br />
Konkursorgane dem Schuldner gehört.<br />
838. Was berechtigt zum Aussonderungsbegehren?<br />
- Zivilrechtliche Aussonderungsgründe<br />
- Konkursrechtliche Aussonderungsgründe<br />
- (Aussonderung kraft Sonderrechts)<br />
839. *Welches sind die zivilrechtlichen Aussonderungsgründe?<br />
- Vindikation ZGB 641 II für das Eigentum<br />
Gilt auch für den Kauf unter Eigentumsvorbehalt! Wichtiger Unterschied zur Betreibung<br />
auf Pfändung, dort wird die Sacher versteigert und der Eigentumsvorbehalt kann wie ein<br />
Pfand geltend gemacht werden aber es ist keine Aussonderung der Sachen möglich!<br />
(Stunde/Lehrbuch hat dazu eine andere Meinung!)<br />
- Das Auftragsrecht gewährt dem Auftraggeber Anspruch auf Herausgabe des<br />
beweglichen Vermögens, das der Beauftragte für dessen Rechnung in eigenem Namen<br />
erworben hat.<br />
o S ist von D beauftragt von V etwas im Namen und auf Rechnung des D zu<br />
kaufen. S tut das. Als die Kaufsache bei S ist fällt dieser in Konkurs bevor er<br />
sie an D abliefern konnte. D hat ein Aussonderungsrecht nach OR 401 III.<br />
o S ist von D beauftragt etwas im Namen des S aber auf Rechnung des D zu<br />
verkaufen. S tut das und fällt nachdem er die Sache verkauft hat aber noch<br />
bevor er den Kaufpreis erhalten hat in Konkurs. D hat jetzt eine<br />
Kaufpreisforderung nach OR 401 I gegen K.<br />
- Es kommen noch einige dem Aussonderungsrecht des Auftraggebers nachgebildete<br />
Sonderfälle in Betracht<br />
o Anlagefonds<br />
o Depoturkunden<br />
840. *Was heisst Kaufskommission?<br />
(Kommission = Mittelbare Stellvertretung) A kauft etwas für B im eigenen Namen aber auf<br />
Rechnung des B. Zwischen A und B liegt ein Auftragsverhältnis vor.<br />
84<strong>1.</strong> *Kann der D Geld, das er dem S gegeben hat, damit er in seinem Auftrag etwas<br />
kaufen konnte aussondern, wenn S bevor er tätig werden kann in Konkurs fällt?<br />
Nein, D hat nur noch eine Konkursforderung, da das Auftragsverhältnis durch den Konkurs<br />
erlischt OR 405 I.<br />
842. Kann D eine Sache bei S aussondern, die S bevor er in Konkurs gefallen ist, in<br />
eigenem Namen aber aufgrund eines Auftrags gekauft hat, obwohl D sie noch<br />
nicht bezahlt hat?<br />
Ja, wenn D bezahlt OR 401 III.<br />
843. *Welches sind die konkursrechtlichen Aussonderungsgründe?<br />
- Wer dem Schuldner ein Inhaber- oder ein Ordrepapier bloss zum Einkassieren oder als<br />
Deckung für eine bestimmt bezeichnete künftige Zahlung übergeben und indossiert hat,<br />
132
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
darf die Rückgabe desselben verlangen (inkasso = „tu das für mich“ Inkassomandat und<br />
Sicherungsübereignung SchKG 201). (Auftragsgemäss einkassiertes Geld kann nach OR<br />
401 III ausgesondert werden, sofern es genügend individualisiert und segregiert ist).<br />
Dieser Artikel ist eng zu interpretieren gleiche Situationen dürfen trotzdem nicht<br />
darunter fallen (z.B. fällt nur die Übergabe eines Wertpapiers als Sicherheit in Betracht,<br />
alle anderen Situationen, in denen etwas als Sicherheit übergeben wurde z.B. bei der<br />
Sicherungszession fallen nicht unter dies Bestimmung)<br />
- Wenn der Schuldner ohne dazu beauftragt zu sein eine fremde Sache verkauft, jedoch<br />
im Zeitpunkt der Konkurseröffnung den Kaufpreis noch nicht erhalten hat, darf der<br />
bisher berechtigte die Abtretung der Kaufpreisforderung oder die Herausgabe der<br />
Kaufpreisforderung oder die Herausgabe des inzwischen von der Konkursverwaltung<br />
eingezogenen Geldbetrages verlangen, sofern er dem Schuldner seine Aufwendungen<br />
vergütet SchKG 202. Was vor der Konkurseröffnung an den Kaufpreis bezahlt wurde,<br />
fällt in die Konkursmasse. <strong>Der</strong> bisher Berechtigte kann dann nur noch eine<br />
Konkursforderung eingeben.<br />
- Eine konkursrechtliche Aussonderung kommt weiter in Frage, wenn bei einem<br />
Distanzkauf die vom Schuldner gekaufte, aber noch nicht bezahlte Ware zur Zeit der<br />
Konkurseröffnung zwar bereits an ihn abgesandt war, aber noch nicht bei ihm<br />
eingetroffen ist. Dann kann der Verkäufer die Rückgabe der Sache fordern, sofern die<br />
Konkursverwaltung es nicht vorzieht, den Kaufpreis zu bezahlen SchKG 203 I. Vor<br />
diesem Rücknahmerecht wird aber der gutgläubige Dritte geschützt SchKG 203 II.<br />
844. *S hat beauftragt von D eine Sache verkauft. S hat den Kaufpreis erhalten und<br />
fällt in den Konkurs bevor er es D geben kann. Kann D das Geld aussondern?<br />
Nein, nach OR 401 I können nur Forderungsrechte ausgesondert werden<br />
845. *Was ist der Unterschied zwischen SchKG 202 und OR 401 I<br />
SchKG 202 kommt zur Anwendung, wenn kein Auftrag vorliegt.<br />
Liegt ein Auftrag vor, kommt OR 401 I zur Anwendung. Bei 401 I gehen die<br />
Forderungsrechte von Gesetzes wegen über, bei 202 SchKG nur auf Verlangen.<br />
846. Was kann sich ausser den Aussonderungsrechten Dritter noch auf den Bestand<br />
des Konkurssubstrats auswirken?<br />
Die Verrechnungsansprüche von Gläubigern. Während aber durch Aussonderung bloss<br />
Vermögenswerte ausgeschieden werden, die nach Zivilrecht oder Konkursrecht gar nicht<br />
dazugehören, greift eine Verrechnung die Substanz selbst an: Die Konkursmasse wird<br />
vermindert, indem eine Forderung des Konkursiten (Bestandteil der Aktivmasse) durch<br />
Verrechnung mit der Gegenforderung eines Konkursgläubigers (Bestandteil der Passivmasse)<br />
untergeht. <strong>Der</strong> Vorteil für die kompensierende Partei liegt darin, dass Konkursforderungen<br />
dadurch unter Umständen vollständig getilgt werden. Wegen dieses Vorteils der Verrechnung<br />
bracht es einen Missbrauchsschutz. Darum wird das allgemeine Kompensationsrecht des OR<br />
durch das materielle Konkursrecht des SchKG modifiziert (OR 123 II).<br />
847. *Was braucht es, damit man überhaupt Verrechnen kann?<br />
Eine Verrechnungserklärung<br />
848. *Welche Voraussetzungen müssen nach OR für eine Verrechnung vorliegen?<br />
- Fällig<br />
- Gleiche Art Forderung<br />
- Gegenseitig<br />
133
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
849. *Inwiefern werden die Voraussetzungen für die Verrechnung im OR durch das<br />
SchKG modifiziert?<br />
- die im OR geforderte Gleichheit der zu verrechnenden Forderungen ist im Konkurs stets<br />
gegeben, wenn der Konkursit vom Gläubiger Geld zu fordern hat, denn gemäss SchKG<br />
211 I wandeln sich alle Konkursforderungen, die nicht auf Geldzahlungen lauten<br />
(Realforderungen), in Geldforderungen von entsprechendem Wert um. Verrechnung<br />
wäre also nur ausgeschlossen, wenn der Konkursforderung eine Realforderung des<br />
Konkursiten gegenüber steht<br />
- Weiter entfällt das Erfordernis der Fälligkeit der Forderung der Konkursgläubiger,<br />
ausgenommen der grundpfandgesicherten SchKG 208 I.<br />
- Die Gegenseitigkeit der Forderung ist in SChKG 213 I aufgeführt. SchKG 213 II-IV<br />
lässt aber Forderungen wo „Gegenseitigkeit“ zu spät eintritt nicht mehr Verrechnen<br />
- (Das BGer lässt die Verrechnung sogar zu, wenn die Gegenforderung des Konkursiten<br />
im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht fällig, jedoch erfüllbar ist.<br />
850. In welchem Fall ist die Verrechnung verboten?<br />
- SchKG 213 II Ziff. 1, wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der<br />
Konkurseröffnung auch dessen Gläubiger wird, indem er nachträglich eine<br />
Konkursforderung erwirbt.<br />
- Ausgeschlossen ist die Verrechnung im umgekehrten Fall, wenn ein Gläubiger den<br />
Konkkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Schuldner wird, SchKG 213 II<br />
Ziff. 2.<br />
- Weiter ist die Verrechnung verboten, wenn die Forderung des Gläubigers auf einem<br />
Inhaberpapier beruht und er nicht nachzuweisen vermag, dass er das Wertpapier in<br />
gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat SchKG 213 III<br />
- Es können im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Handelsgesellschaft oder<br />
einer Genossenschaft nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des<br />
Gesellschaftskapitals sowie rückständige statutarische Beiträge an die Genossenschaft<br />
nicht mit Konkursforderungen verrechnet werden SchKG 213 IV. Diese Vorschrift<br />
schützt das Gesellschaftskapital im Interesse der übrigen Gläubiger (da es ja bei diesen<br />
keine persönliche Haftung der Gesellschafter gibt).<br />
Mit Ausnahme des letzten Falls ist es immer massgebend, wann die rechtserheblichen<br />
Tatsachen, die zur Verrechnungslage führten, eingetreten sind. Unmassgeblich ist der<br />
Zeitpunkt der Fälligkeit oder den Eintritts der Gleichartigkeit.<br />
85<strong>1.</strong> Zu welchem Zweck gilt das Verrechnungsverbot in diesen Fällen?<br />
Um den Bestand des Vollstreckungssubstrats zu erhalten. Es gilt nur für die Konkursgläubiger<br />
nicht auch für die Konkursmasse. Die Konkursverwaltung darf also ohne weiteres eine<br />
Konkursforderung durch Verrechnung mit einer Gegenforderung des Konkursiten tilgen.<br />
852. Gibt es neben den Verboten der Verrechnung noch ein Tatbestand der bloss<br />
anfechtbaren Verrechnung?<br />
Ja, er ist in SchKG 214 geregelt.<br />
853. *In welchem Fall ist eine Verrechnung bloss anfechtbar?<br />
Wenn der Schuldner des Konkursiten noch vor der Konkurseröffnung eine Forderung gegen<br />
ihn erworben hat, so ist die Verrechung zivil- und konkursrechtlich zulässig. Sie kann jedoch<br />
angefochten werden, wenn der Erwerb mala fide erfolgte, nämlich in Kenntnis der<br />
Zahlungsunfähigkeit des späteren Konkursiten und mit der Absicht sich oder einem anderen<br />
einen Vorteil zu verschaffen. Dieser Artikel ist eng zu interpretieren. Die Kenntnis der<br />
Zalungsunfähigkeit sowie der resultierenden Begünstigung sind dem verrechnenden<br />
134
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Schuldner nachzuweisen, wobei aber nicht Arglist verlangt ist, sondern Erkennenmüssen<br />
genügt.<br />
854. Gehört der Anfechtungsanspruch wegen Verrechnung zur Konkursmasse?<br />
Ja, SchKG 200. Er ist wie eine paulianische Anfechtung geltend zu machen. Beklagter ist der<br />
verrechnende Schuldner des Konkursiten, niemals der einstige Gläubiger der durch die<br />
Abtretung seiner Forderung die Verrechung ermöglicht hat.<br />
855. Wie läuft die Verrechnung ab?<br />
Forderungen des Konkursiten gegen einen Konkursgläubiger werden mit dessen<br />
Konkursforderung verrechnet. Das geschieht regelmässig im Kollokationsverfahren, sofern es<br />
in diesem Zeitpunkt bereits möglich ist.<br />
856. Wie wird die Konkursforderung geltend gemacht?<br />
- entweder erklärt der Konkursgläubiger die Verrechnung, indem er z.B. nur noch einen<br />
Restbetrag seiner Konkursforderung eingibt<br />
- oder dann verrechnet die Konkursverwaltung ihrerseits, indem sie nur einen Restbetrag<br />
der angemeldeten Konkursforderung kolloziert oder – je nach Betragshöhe – die<br />
Kolloketion gänzlich abweist.<br />
- Lehnt die Konkursverwaltung die vom Konkursgläubiger erklärte Verrechnung ab, so<br />
bleibt sie zunächst dennoch daran gebunden und darf demzufolge einstweilen nur die<br />
eingegebenen Restforderungen kollozieren. Die verrechnete Gegenforderung des<br />
Konkursiten muss gerichtlich eingeklagt werden. (Dabei handelt es sich um eine<br />
materiellrechtliche Forderungsklage, Klägerin ist die Konkursmasse, wenn aber die 2,<br />
Gläubigerversammlung auf die Gegenforderung verzichtet, so kommt als Kläger ein<br />
Abtretungsgläubiger in Frage). Unterliegt der verrechnende Gläubiger in diesem<br />
Forderungsprozess, so kann er mit nachträglicher, korrigierter Konkurseingabe seine<br />
wiedererstandene ganze Konkursforderung anmelden, allerdings unter Kostenfolge<br />
- Massenforderungen können nur mit Masseschulden verrechnet werden, also erst bei der<br />
Verteilung.<br />
857. *Inwiefern ändert der Konkurs die Rechtslage des Schuldners?<br />
Die Änderung der Rechtsstellung des Konkursiten betrifft sein Verhältnis<br />
- zur Konkursmasse einerseits<br />
- zu seinen Gläubigern andererseits<br />
Vollkommen unberührt bleibt indessen seine Rechts- und Handlungsfähigkeit; so wenigstens,<br />
wenn er eine natürliche Person ist.<br />
Handelt es sich um eine juristische Person oder um eine betreibungsfähige<br />
Personengesellschaft, führt die Konkurseröffnung zwangsläufig zu ihrer Auflösung 736 OR<br />
(damit Verlust der Rechtsfähigkeit).<br />
858. *Wie ist die Stellung des Schuldners zur Konkursmasse?<br />
- <strong>Der</strong> Konkursit bleibt auch nach der Konkurseröffnung Rechtsträger seines Vermögens,<br />
insbesondere Eigentümer der zugehörigen Sachen und Gläubiger seiner Forderungen.<br />
Erst mit der Verwertung verliert er die Rechtsträgerschaft.<br />
- Er verliert aber das Verfügungsrecht über das Vermögen, es steht jetzt unter<br />
Konkursbeschlag<br />
859. *Über was kann der Konkursit noch frei verfügen?<br />
Er kann nur noch über das verfügen, was nicht zur Konkursmasse gehört: über die nach<br />
SchKG 92 unpfändbaren Vermögenswerte sowie über das Erwerbseinkommen und dessen<br />
135
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Surrogate. Im Übrigen gehen aber die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse auf die<br />
Konkursmasse über, die sie durch die Konkursverwaltung ausübt.<br />
860. Wird die rechtliche Verfügungsfähigkeit vom Konkursbeschlag betroffen?<br />
Nein, der Konkursit kann ohne weiteres noch Verpflichtungsgeschäfte abschliessen, sogar<br />
über Werte der Aktivmasse: Nur das darauf folgende Verfügungsgeschäft wäre ungültig.<br />
86<strong>1.</strong> *Wie äussert sich die Beschränkung des Verfügungsrechts im Einzelnen?<br />
a) b) c)<br />
Die Rechtshandlungen, die der<br />
Schuldner nach der<br />
Konkurseröffnung über Bestandteile<br />
der Konkursmasse vornimmt sind den<br />
Konkursgläubigern gegenüber<br />
ungültig, SchKG 204 I<br />
- auf die Ungültigkeit können<br />
sich nur Konk.G und<br />
Konk.Verw. berufen.<br />
Nachträgliche Genehmigung<br />
des Geschäftes möglich<br />
- kein Gutglaubensschutz<br />
Ausnahme Wechselinhaber<br />
204 II<br />
Bezahlt Schuldner z.B. eine Schuld,<br />
kann der Konkursverwalter über<br />
diese Rechtshandlung hinweggehen,<br />
wie wenn nichts geschehen wäre. Die<br />
entäusserten Werte können<br />
bedingungslos wider beigebracht<br />
werden<br />
<strong>Der</strong> Konkursit kann<br />
nach der<br />
Konkurseröffnung<br />
von seinen<br />
Schuldnern nicht<br />
mehr rechtsgültig<br />
Zahlungen entgegen<br />
nehmen. Zahlungen<br />
an ihn haben nur<br />
befreiende Wirkung,<br />
wenn sie in die<br />
Konkursmasse<br />
gelangen SchKG<br />
205 I. Dem<br />
Schuldner gegenüber<br />
gilt die Forderung<br />
aber stehts als getilgt<br />
Ausnahmsweiser Schutz<br />
des gutgläubigen<br />
Drittschuldners 205 II.<br />
862. *Welche Verfahren des Konkursiten werden nicht eingestellt?<br />
136<br />
Auswirkung auf Prozess-<br />
und Verwaltungsverfahren<br />
des Schuldners, da der<br />
Konkursit über die<br />
betreffenden<br />
Streitgegenstände, sofern sie<br />
den Bestand der<br />
Konkursmasse berühren<br />
nicht mehr verfügen kann.<br />
Daher werden hängige<br />
Verfahren eingestellt 207.<br />
Für den Zivilprozess ist die<br />
Einstellung zwingend<br />
(Ausnahmen) für<br />
Verwaltungsverfahren liegt<br />
sie im Ermessen der<br />
Behörde.<br />
Nach Ablauf der<br />
gesetzlichen<br />
Einstellungsfrist, kann<br />
der Prozessgegner des<br />
Konkursiten das<br />
Verfahren auf jeden Fall<br />
wieder aufnehmen<br />
Während der Dauer der<br />
Verfahrenseinstellung<br />
laufen die Verjährungs-<br />
und Verwirkungsfristen<br />
nicht 207 III.
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- von der Einstellung nicht betroffen sind dringliche Fälle. Da aber die Verjährungs- und<br />
die Verwirkungsfristen ruhen, kann es sich nur um Dringlichkeit handeln, die ihren<br />
Grund in der Streitsache selbst hat und nicht bloss um zeitliche Dringlichkeit<br />
- Ausgenommen von der Einstellung sind weiter alle Streitigkeiten, deren Ausgang<br />
für die<br />
Konkursgläubiger gleichgültig ist, weil sie weder einen Aktivwert der Masse noch eine<br />
Konkursforderung zum Gegenstand haben:<br />
o Nach SchKF 207 IV: Entschädigungsklagen<br />
wegen Ehr- und Körperverletzung<br />
oder familienrechtlichen Prozessen<br />
o Oder ein Prozess über konkursfreies Vermögen (z.B: Kompetenzstücke)<br />
863.<br />
Welche Rechtsnatur hat ein solcher Einstellungsentscheid?<br />
Er ist bloss ein Zwischenentscheid; deshalb kann er nur mit StBE ans BGer<br />
weiter gezogen<br />
werden, wenn die Einstellung der Gegenpartei einen irreparablen Nachteil verursacht.<br />
864.<br />
*Was ist der Sinn, dass ein Prozess unterbrochen wird?<br />
Bei der Konkurseröffnung gibt es der Schuldenruf. <strong>Der</strong> Gläubiger, der<br />
die Schuld eingeklagt<br />
hat, wird die Forderung eingeben. Die Konkursverwaltung prüft sie und sagt ob sie akzeptiert<br />
ist oder nicht. Falls die Forderung akzeptiert ist, ist der Zivilprozess unnötig geworden. Sonst<br />
kann er wieder aufgenommen werden.<br />
865.<br />
*Wieso kann der Prozess erst 10 Tage nach der Gläubigerversammlung wieder<br />
aufgenommen werden?<br />
Da diese endgültig über die Fortführung<br />
entscheidet.<br />
ddd<br />
866. *Was ist die Stellung des Schuldners zu seinen Gläubigern?<br />
- Betreibungsverbot<br />
bezüglich des Schuldners<br />
- Ausnahmen davon<br />
867.<br />
*Was umfasst das Betreibungsverbot alles?<br />
Alle gegen den Schuldner schon hängigen Betreibungen<br />
werden durch die Konkurseröffnung<br />
aufgehoben, und neue Betreibungen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung<br />
entstanden sind, dürfen während der Dauer des Konkurses gegen ihn nicht angehoben werden<br />
SchKG 206 I.<br />
Vom Verbot betroffen<br />
sind nur Betreibungen für Forderungen, die vor der Konkurseröffnung<br />
begründet worden sind, also für Konkursforderungen. Erst nachher entstandene Forderungen<br />
fallen von vornherein nicht darunter:<br />
- der Konkursit kann für Forderungen,<br />
die nach der Konkurseröffnung entstanden sind<br />
jeder zeit betrieben werden SchKG 206 II. In dieser Betreibung darf allerdings nur auf<br />
das Vermögen gegriffen werden, da alles Übrige schon in der Konkursmasse ist (z.B.<br />
der Lohn des Konkursiten kann noch gepfändet werden →das ist mithin ein Grund,<br />
warum der Lohn nicht in den Konkurs fällt).<br />
- Die Konkursmasse selbst darf auch auf Pfändung<br />
oder Pfandverwertung betrieben<br />
werden für Forderungen, die zu ihren Lasten begründet wurden.<br />
868.<br />
Mit welchem Rechtsmittel kann das Betreibungsverbot geltend gemacht werden?<br />
Mit Beschwerde und nicht mit Rechtsvorschlag. Das Betreibungsverbot ist zwingend und eine<br />
dagegen verstossende Betreibungshandlung ist nichtig.<br />
869.<br />
*Welche Ausnahmen gibt es vom Betreibungsverbot?<br />
In bestimmten Fällen rechtfertigt es sich, sogar für Konkursforderungen<br />
neben der<br />
Generalexekution ausnahmsweise noch eine Spezialexekution zuzulassen:<br />
137
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Eine hängige Betreibung, in der schon vor der Konkurseröffnung verwertet worden<br />
ist<br />
oder bei der sich eine Verwertung überhaupt erübrigt, wird nicht aufgehoben<br />
SchKG<br />
199 II.<br />
- Ohne dass es schon zur Verwertung gekommen sein muss, darf eine bereits hängige<br />
Betreibung<br />
für eine Konkursforderung weitergeführt werden oder sogar neu gegen den<br />
Konkursiten eingeleitet werden, wenn sie auf die Verwertung eines von einem Dritten<br />
bestellten Pfandes gerichtet ist SchKG 206 I. Das Konkurssubstrat wird dadurch nicht<br />
berührt (man kann ja die Sache nicht verkaufen, da sie einem Dritten gehört).<br />
- Ein Konkursit darf weiter auf Pfandverwertung betrieben werden, wenn es um die<br />
Verwertung einer Sache geht, an der er ein Miteigentums- oder Gesamteigentumsrecht<br />
besitzt. Dann fällt nur sein Gesamt- bzw. Miteigentumsanteil in die Konkursmasse, nicht<br />
die Sache selbst.<br />
870. Wie wirkt sich die Konkurseröffnung auf die Rechte des Gläubigers aus?<br />
- die Konkurseröffnung kann sich auf die vom Schuldner abgeschlossenen Verträge im<br />
Ganzen auswirken. Ein Vertragsrücktritt oder eine Kündigung steht aber immer unter<br />
dem Vorbehalt, dass die Konkursverwaltung nicht selbst in den Vertrag eintritt<br />
- Bei den einzelnen Forderungen, die aus den vertraglichen Beziehungen fliessen, hat der<br />
Konkurs Einfluss auf<br />
o <strong>Der</strong>en Verrechenbarkeit<br />
o Ihren Fälligkeit<br />
und Verzinslichkeit<br />
o Reihenfolge der Befriedigung<br />
der Gläubiger<br />
Die Ansprüche, für die aus dem Erlös des<br />
Konkurssubstrats Befriedigung verlangt<br />
werden kann, sind verschiedener Art.<br />
In erster Linie sind es Konkursforderungen<br />
Weiter sind es Massenverbindlichkeiten.<br />
Welcher Kategorie eine Forderung zuzuordnen<br />
sei, ist eine materiellrechtliche<br />
Frage, die, wenn sie streitig wird vom Zivilrichter<br />
behandelt wird.<br />
87<strong>1.</strong> Was<br />
sind Konkursforderungen?<br />
Das<br />
sind alle Gläubigeransprüche, die bereits um Zeitpunkt der Konkurseröffnung gegen den<br />
Konkursiten bestehen<br />
872. Was sind Masseverbindlichkeiten?<br />
Das<br />
sind die erst im Laufe des Konkursverfahrens entstehenden Forderungen, für welche aber<br />
nicht der Konkursit sonder die Masse als Sondervermögen<br />
gegenüber ihren eigenen<br />
Gläubigern, den Massengläubigern haftet (sie sind vorab voll aus der Masse zu befriedigen).<br />
873. *Wodurch wird der Bestand der Konkursforderung begrenzt?<br />
Zeitlich<br />
und sachlich.<br />
Es gibt aber für die Konkursforderungen – im Gegensatz zur Aktivmasse – keine territoriale<br />
Schranke: auch die Forderungen<br />
ausländischer Gläubiger sind in einem schweizerischen<br />
Konkurs zu berücksichtigen, sofern sie zeitlich und sachlich die Voraussetzungen einer<br />
Konkursforderung erfüllen.<br />
874. *Was umfasst der Grundsatz<br />
der zeitlichen Begrenzung der Konkursforderung?<br />
Konkursforderung<br />
kann nur eine Forderung sein, die zur Zeit der Konkurseröffnung bereits<br />
besteht, mithin schon vorher entstanden ist.<br />
<strong>Der</strong> Entstehungsgrund der Forderung muss vor der Konkurseröffnung eingetreten sein. Das<br />
allein genügt in zeitlicher Hinsicht: spätere Fälligkeit<br />
oder aufschiebende Bedingungen dürfen<br />
die Durchführung der Generalexekution nicht behindern.<br />
138
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
875. *Was passiert demzufolge mit den Konkursforderungen bei Konkurseröffnung?<br />
Sie werden von Gesetzes werden fällig SchKG 208 I.<br />
876. *Welche Forderungen werden trotz, dass sie vor Konkurseröffnung entstanden<br />
sind, nicht fällig?<br />
Die<br />
grundpfandgesicherten Forderungen SchKG 208 I. Nicht fällige Grundpfandforderungen<br />
werden dem Erwerber des Grundstücks als persönliche Schuldpflicht überbunden – wie in der<br />
Spezialexekution (SchKG 259<br />
i.V.m. 135 I). Sie brauchen, wie auch die Dienstbarkeiten im<br />
Konkurs nicht liquidiert zu werden. Faustpfandforderungen werden demgegenüber immer<br />
fällig.<br />
877. Was ist, wenn ein Grundpfand nicht genügend Deckung bietet?<br />
Dann wird<br />
die Forderung im Konkurs als ungesichert berücksichtigt und folglich nach den<br />
allgemeinen<br />
Regeln fällig. Massgebend für die Deckung ist die amtliche Schätzung.<br />
878. Wie wird eine Forderung behandelt, die durch ein Drittpfand gesichert ist?<br />
Sie wird ebenfalls wie eine ungesicherte behandelt, denn das Grundstück selbst kann im<br />
Rahmen<br />
dieses Konkurses nicht verwertet werden, weil es nicht Bestandteil der<br />
Konkursmasse ist. Zulässig ist aber eine parallele Betreibung auf Pfandverwertung SchKG<br />
206 I.<br />
879. *Können sich die Gläubiger auch gegenüber dem Schuldner auf die Fälligkeit<br />
der Forderung berufen?<br />
Nein,<br />
die sofortige Fälligkeit wirkt nur gegenüber der Konkursmasse. Gegenüber dem<br />
Schuldner persönlich können sich die Gläubiger nicht darauf berufen. Dies zeigt sich deutlich,<br />
wenn der Konkurs widerrufen wird; dann gelten nämlich die ordentlichen, zivilrechtlichen<br />
Fälligkeiten (die frühere Fälligkeit lebt wieder auf).<br />
880. *Werden Mitverpflichtete und Bürgen des Konkursiten sowie<br />
Drittpfandeigentümer von der konkursrechtlichen<br />
Fälligkeit betroffen?<br />
Nein,<br />
SchKG 208 „die Konkurseröffnung bewirkt gegenüber der Konkursmasse die Fälligkeit<br />
sämtlicher Schuldverpflichtungen…“.<br />
88<strong>1.</strong> Was gibt es, damit den Gläubigern aus der sofortigen Fälligkeit keinen Vorteil<br />
erwächst?<br />
Das<br />
wäre bei der vorzeitigen Erfüllung unverzinslicher Forderungen der Fall. Damit den<br />
Gläubigern daraus keinen Vorteil erwächst wird von solchen Forderungen ein Zwischenzins<br />
von 5% (Diskonto) abgezogen SchKG 208 II.<br />
882. *Wie werden bedingte Forderungen fällig, wann werden sie ausbezahlt?<br />
Forderungen unter aufschiebender Bedingung können wenn sie vor der Konkurseröffnung<br />
entstanden<br />
sind eingegeben werden auch wenn die Bedingung bei Konkurseröffnung noch<br />
nicht eingetreten<br />
ist. Bis zum Eintritt der Bedingung wird jedoch die Dividende des<br />
Gläubigers bei der Depositenanstalt hinterlegt SchKG 210 I und 264 III*.<br />
Forderungen unter auflösender Bedingung sind wie unbedingte zu behandeln, und die auf sie<br />
entfallende Dividende ist – unter Vorbehalt einer allfälligen Bereicherungsklage auszuzahlen.<br />
883. Können künftige periodische Verpflichtungen des Konkursiten im Konkurs<br />
liquidiert werden?<br />
139
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Wenn sie für die Zukunft unabänderlich feststehen, so können sie kapitalisiert und im<br />
Konkurs liquidiert werden. Soweit jedoch die künftigen Forderungen Änderungen<br />
unterworfen sein können, ist eine Kapitalisierung mangels sicherer Berechnungsgrundlage<br />
ausgeschlossen; dann gilt:<br />
- die bis zur Konkurseröffnung anfallenden periodischen Leistungen werden als<br />
Konkursforderungen behandelt<br />
- die während des Konkurses und danach fällig werdenden Beiträge sind gegen den<br />
Konkursiten persönlich zu vollstrecken<br />
(SchKG 206 II).<br />
(da somit die nach Konkurseröffnung anfallenden Leistungen weder Konkursforderungen<br />
noch Masseverbindlichkeiten darstellen, steht dem Konkursiten bei ihrer Vollstreckung nach<br />
Abschluss des Konkurses nicht die Einrede des mangelnden neuen Vermögens zu; bei<br />
Vollstreckung während des Konkurses ist ihm sodann eine neuerliche Insolvenzerklärung<br />
verschlossen SchKG 206 III.<br />
884. *Können Forderungen<br />
aus Bürgschaften des Konkursiten auch im Konkurs<br />
geltend gemacht werden?<br />
Ja, gleichgültig, ob sie fällig ist oder nicht.<br />
Gl<br />
fällig <strong>1.</strong><strong>1.</strong>05<br />
A<br />
(Schuldner)<br />
Bürge<br />
In Konkurs 7.12.04<br />
(*In einem solchen Fall kann der Gläubiger seine Forderung im Konkurs<br />
anmelden. Die Konkursmasse tritt in die Rechtsstellung des zahlenden Bürgen<br />
ein. Hat die Konkursmasse den Gl befriedigt, geht die Forderung des Gl gegen<br />
den Schuldner auf die Konkursmasse über, SchKG 215.)<br />
Anders als bei einer aufschiebenden Bedingung, kann der Bürgschaftsgläubiger<br />
seine Dividende sogar schon vor Fälligkeit der Bürgschaft beziehen. Die<br />
Bürgschaftsforderung wird so behandelt als wäre sie fällig und unbedingt SchKG<br />
208 II. Andererseits tritt aber dann die Konkursmasse bis zur Höhe des bezahlten<br />
Betrages in die Rechte des Bürgschaftsgläubigers gegen den Hauptschuldner und<br />
allfällige Mutbürgen ein.<br />
885. *Wie ist der Spezialfall von SchKG 218 II zu behandeln?<br />
Im Prinzip wie die Bürgschaft, der Gesellschafter ist hier der Bürge, da bei der<br />
Kollektivgesellschaft zuerst die Gesellschaft haftet und subsidiär die Gesellschafter. <strong>Der</strong><br />
Schuldner ist die Gesellschaft.<br />
886.<br />
Wie ist der sachliche Bestand der Konkursforderungen?<br />
140
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Sachlich kommen als Konkursforderungen alle vermögensrechtlichen Ansprüche, die im<br />
Zeitpunkt der Konkurseröffnung gegen den Schuldner bestehen in Betracht, gleichgültig aus<br />
welchem Rechtsgrund sie entstanden sind (Vertrag, Delikt, Gesetz). Ist der Konkurs einmal<br />
eröffnet worden, so fallen auch diejenigen Forderungen darunter, für die nach SchKG 43 eine<br />
Konkursbetreibung ausgeschlossen ist; dieses Verbot trifft nur die Betreibung.<br />
887.<br />
Was passiert mit Konkursforderungen, die auf eine fremde Währung lauten?<br />
Sie werden in Schweizerfranken umgerechnet und zwar zum Kurs am Tag der<br />
Konkurseröffnung. Ein betreibender Konkursgläubiger kann aber, wenn es für ihn<br />
günstiger<br />
ist, den Kurs am Tag des Betreibungsbegehrens beibehalten SchKG 88 IV.<br />
888.<br />
Aus was besteht die Konkursforderung betragsmässig?<br />
Aus dem Forderungskapital, den Zinsen bis zum Tag der Konkurseröffnung<br />
und den<br />
Betreibungskosten SchKG 208 I Satz 2.<br />
Im Übrigen gilt für die Konkursforderung auch für die nicht angemeldeten von der<br />
Konkurseröffnung an der Grundsatz der Unverzinslichkeit SchKG 209 I.<br />
889.<br />
Hört der Zinsenlauf nach der Konkurseröffnung gegen alle auf?<br />
<strong>Der</strong> Zinsenlauf hört ausschliesslich gegenüber dem Konkursiten auf; Mitverpflichtete<br />
und<br />
Bürgen haben weiter Zinsen zu zahlen, ohne dass sie dafür ein Rückgriffsrecht gegen den<br />
Gemeinschuldner besässen. Wird er Konkurs widerrufen, sind die Forderungen wieder ex<br />
tunc verzinslich. Endet der Konkurs überraschend mit einem Aktivüberschuss, so sind auch<br />
die Zinsen für die Zeit der Konkurseröffnung daraus zu decken.<br />
Für pfandgesicherte Forderungen (Grund- oder Faustpfand) läuft der Zins hingegen bis zur<br />
Verwertung des Pfandes weiter, soweit der Pfanderlös nach Begleichung des<br />
Forderungskapitals und der bis zur Konkurseröffnung aufgelaufene Zins ausreicht<br />
SchKG 209<br />
II. <strong>Der</strong> ungedeckte Zins seit Konkurseröffnung kann dann nicht etwa als ungesicherte<br />
Forderung eingegeben werden.<br />
890.<br />
Was passiert mit Realforderungen im Konkurs?<br />
Man kann zwar für Realforderungen keine Betreibung einleiten;<br />
ist aber einmal über den<br />
Leistungsschuldner der Konkurs eröffnet worden, unterlegen sie dennoch der<br />
Generalexekution, gleich wie alle anderen vermögensrechtlichen Ansprüche. Dieser<br />
Einbezug<br />
der Realforderungen wird dadurch möglich, dass sie von Gesetzes wegen umgewandelt<br />
werden SchKG 211 I.<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger rechnet seine Realforderung selbst um und gibt den beanspruchten Betrag als<br />
Konkursforderung ein. Massgebend ist sein Erfüllungsinteresse, das positive<br />
Vertragsinteresse.<br />
Die Umwandlung in<br />
eine Geldforderung ist zwingend für alle einseitigen Realschulden des<br />
Konkursiten. Bei zweiseitigen Verträgen findet sie nur statt, wenn der Konkursgläubiger seine<br />
eigene Leistung bereits erbracht hat. Sind zweiseitige Verträge dagegen beiderseits noch nicht<br />
erfüllt, hat die Konkursverwaltung das Recht, den Vertrag anstelle des Konkursiten realiter zu<br />
erfüllen, statt die Umwandlung hinzunehmen (Eintritts- oder Wahlrecht SchKG 211 II)<br />
89<strong>1.</strong><br />
Wann wird die Konkursverwaltung den Vertrag realiter erfüllen?<br />
Z.B. wenn für die vom Konkursiten zu liefernde Sache ein guter Preis vereibart ist, sodass sie<br />
im Interesse der Gläubiger liegt; ist der Kaufpreis aber bereits entrichtet, darf nicht mehr<br />
Realerfüllung angeboten werden.<br />
Entscheidet sich die Konkursverwaltung<br />
für Realerfüllung, kann der Konkkursgläubiger nicht<br />
mehr ohne weiteres vom Vertrag zurücktreten, sodass das gute Geschäft der Masse bewahrt<br />
bleibt.<br />
141
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger hat aber ein Recht auf Sicherstellung der ihm angebotenen Erfüllung zu<br />
verlangen 211 II.<br />
892. Was passiert mit der Forderung des Konkursgläubigers, wenn die<br />
Konkursverwaltung<br />
eine Realerfüllung wählt?<br />
Mit<br />
der Wahl der Realerfüllung wird die Forderung des Konkursgläubigers wie auch sein<br />
Sicherstellungsanspruch und eine allfällige Schadenersatzforderung wegen Nicht-<br />
oder<br />
Schlechterfüllung zur Masseverbindlichkeit; als solche ist sie vor allen Konkursforderungen<br />
zu erfüllen.<br />
893. *Was kann ein Gläubiger machen, wenn sich mehrere Solidarschuldner im<br />
Konkurs<br />
befinden?<br />
<strong>Der</strong><br />
Gläubiger kann seine Forderung in jedem Konkurs im vollen Betrag geltend machen<br />
SchKG 216 I.<br />
894. *Was macht ein Gläubiger, wenn nur ein Solidarschuldner von zweien in<br />
Konkurs<br />
fällt?<br />
Er<br />
hält sich an den Schuldner, der nicht im Konkurs ist.<br />
895. Was passiert, wenn<br />
ein Gläubiger, der seine Forderung in mehreren Konkursen<br />
der Solidarschuldner geltend macht mehr bekommt,<br />
als ihm im Ganzen<br />
zivilrechtlich zustehen würde?<br />
Ein allfälliger Überschuss der Zuteilung aus den verschiedenen Konkursen fällt nach<br />
Massga be der unter den Mitverpflichteten bestehenden Rückgriffsrechte an die Masse zurück<br />
216 II. <strong>Der</strong> Rückgriff unter den Massen setzt somit die volle Befriedigung des<br />
Konkursgläubigers voraus SchKG 216 III.<br />
Die Rückgriffsrechte unter den Solidarschuldnern, hier ihren Konkursmassen bestimmen sich<br />
nach dem OR (falls nichts intern vereinbart wurde, zahlt jeder der Solidarschuldner<br />
gleich<br />
viel). Die Regressforderung einer Masse gegen<br />
die andere ist für die Letztere eine<br />
Masseverbindlichkeit.<br />
896. Kann der A als Solidarschuldner im Konkurs, wenn der Gläubiger nicht<br />
vollständig befriedigt<br />
wurde auf den B, auch Solidarschuldner im Konkurs,<br />
Rückgriff nehmen, wenn sie vereinbart haben, dass B die ganze Forderung<br />
zahlen würde,?<br />
Nein, SchKG<br />
216 III.<br />
Das wäre<br />
nur möglich, wenn der Schuldner vollständig befriedigt worden wäre.<br />
897. Kann der Gläubiger<br />
seine Forderung immer noch voll im Konkurs eines<br />
Solidarschuldners eingeben, auch wenn der Gläubiger von einem anderen<br />
Solidarschuldner bereits eine Teilzahlung erhalten hat?<br />
Ja, SchKG217 I.<br />
898. Kann der Mitverpflichtete nach SchKG 217 II auch die Forderung<br />
eingeben, die<br />
ihm Kraft Regressanspruchs noch gegen den anderen Solidarschuldner zusteht,<br />
der im Konkurs ist?<br />
Nein, er kann nur die volle, dem Gläubiger ursprünglich zustehende Forderung eingeben.<br />
Die auf den ganzen Forderungsbetrag fallende Dividende kommt dann in erster Linie dem<br />
Gläubiger bis zu seiner vollen Befriedigung zu; erst aus dem Überschuss erhält der<br />
teilzahlende Solidarschuldner, soweit er rückgriffsberechtigt ist, den Betrag, den er bei<br />
selbständiger Geltendmachung des Rückgriffsrechts erhalten würde (also z.B. bei einer<br />
142
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Dividende von 15% würde er von seiner ursprünglichen Forderung von 4000, die er aus dem<br />
Regressverhältnis gegen den Solidarschuldner hat, noch 600 bekommen), und ein weiterer<br />
Überschuss verbleibt der Konkursmasse SchKG 217 III.<br />
899. Kann auch die Konkursmasse Rückgriffsrechte haben?<br />
Ja, wenn aus ihr an den Gläubiger mehr ausbezahlt wurde, als der Konkursit nach dem<br />
internen Verhältnis unter den Mitverpflichteten zu tragen hat.<br />
900. Welche Fälle sind bei der Gesellschafts- und Gesellschafterkonkurs<br />
bei der<br />
Kollektivgesellschaft oder der Kommanditgesellschaft zu unterscheiden?<br />
- gleichzeitiger Konkurs von Gesellschaft und Gesellschafter<br />
SchKG 218 I<br />
- Konkursit eines Gesellschafters allein SchKG 218 II<br />
- Ausschliesslicher<br />
Konkurs der Gesellschaft OR 570<br />
90<strong>1.</strong> *Wo und in welcher Höhe kann ein Gläubiger seine Forderungen bei<br />
gleichzeitigem Konkurs der Gesellschaft und der Gesellschafter eingeben?<br />
Die Subsidiäre Haftung der Gesellschafter verlangt dann, dass<br />
zuerst der<br />
Gesellschaftskonkurs<br />
abgewickelt wird SchKG 218 I (Gesellschaft und Gesellschafter sind<br />
keine Solidarschuldner, die Gesellschafter untereinander sind Solidarschuldner). In diesem<br />
Konkurs<br />
können die Gesellschaftsgläubiger ihre Forderungen voll eingeben. Im darauf<br />
folgenden Gesellschafter Konkurs dürfen dann die Gesellschaftsgläubiger nur noch den im<br />
Gesellschaftskonkurs erlittenen Verlust, d.h. die Restforderung geltend machen SchKG 218 I.<br />
Für diese Restschuld haften die Gesellschafter solidarisch; ihr Verhältnis untereinander<br />
bestimmt sich daher nach SchKG 216 und 217. Im Übrigen konkurrieren die<br />
Gesellschaftsgläubiger in diesem Konkurs nun mit den Privatgläubigern des Gesellschafters.<br />
902. *Wie und in welchem Umfang kann der Gläubiger seine Forderung im<br />
Gesellschafterkonkurs ohne gleichzeitigen Konkurs der Gesellschaft<br />
geltend<br />
machen?<br />
Hier<br />
wird der Grundsatz der subsidiären Haftung der Gesellschafter durchbrochen: der<br />
Gesellschaftsgläubiger kann seine Forderung an die Gesellschaft im vollen Betrag im<br />
Konkurs<br />
des Gesellschafters geltend machen SchKG 218 II. <strong>Der</strong> Konkursmasse des<br />
Gesellschafters stehen<br />
aber für die von ihr bezahlten Gesellschaftsschulden die<br />
Rückgriffsrechte nach SchKG 215 II zu; sie kann sich also an der Gesellschaft wie ein Bürge<br />
am Hauptschuldner schadlos halten SchKG 218 II Satz 2.<br />
Bei gleichzeitigem Konkurs mehrer Gesellschafter gelten die Regeln von SchKG 216 und<br />
217.<br />
903. Wie ist die Reihenfolge der Gläubigerbefriedigung<br />
im Konkurs geregelt?<br />
Die Gläubiger sollen für ihre Konkursforderungen aus dem Konkurserlös gleichzeitig und<br />
gleichmässig<br />
befriedigt werden (pars condictio creditorum). Bei ausreichendem Erlös gibt das<br />
keine<br />
Schwierigkeiten. Im fall des Verlustes bedeutet Gleichbehandlung, dass jeder Gläubiger<br />
verhältnismässig seinen Anteil daran tragen muss. Gleichmässigkeit wäre da nicht immer<br />
gerecht: schon das Zivilrecht begründet gewisse Vorrechte, und ausserdem kann der<br />
Gläubiger auf volle Befriedigung seiner Forderungen angewiesen sein. Darum stellt das<br />
SchKG eine bestimmte Rangordnung auf, indem es die Gläubiger bestimmter Forderungen<br />
privilegiert. Auf zivilrecht beruht das Privileg der Pfandgläubiger, sie sind sozusagen die<br />
Klasse 0, auf Konkursrecht dasjenige der verschiedenen Forderungsklassen nach SchKG<br />
219<br />
IV.<br />
904. *Wie werden die Pfandgläubiger im Konkurs befriedigt?<br />
143
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Auch die vom Konkursiten verpfändeten Vermögensobjekte werden zur Konkursmasse<br />
gezogen<br />
und zusammen mit dem übrigen Vermögen verwertet SchKG 198.<br />
Dem<br />
Pfandgläubiger bleibt jedoch ein Recht auf vorrangige Befriedigung aus dem Pfanderlös<br />
gewahrt SchKG 219 I. Das gilt uneingeschränkt für sämtliche Faustpfandforderungen<br />
und für<br />
die fälligen Grundpfandforderungen. Die nicht fälligen Grundpfandforderungen werden<br />
hingegen nicht ausgezahlt und liquidiert, sondern dem Erwerber des Grundstücks<br />
überbunden,<br />
SchKG 135!! Im Konkurs gilt das Deckungsprinzip nicht, sonst könnte man nie alles<br />
verwerten.<br />
(Wo für dieselbe Forderung mehrere Pfänder haften, werden die gelösten Beträge im<br />
Verhältnis ihrer Höhe zur Deckung der Forderung verwendet; das Pfand eines Dritten wird<br />
hievon nicht berührt SchKG 219 II. Die Forderung dürfte also nicht einfach aus dem Erlös<br />
eines der Pfänder<br />
allein bezahlt werden.<br />
Umgekehrt kann eine Pfandsache für mehrere Forderungen haften. Dann bestimmt sich<br />
der<br />
Rang der einzelnen Pfandgläubiger nach dem Zivilrecht.<br />
Ein Überschuss des Pfanderlöses, der nach Befriedigung der Pfandgläubiger noch verbleibt,<br />
wird zur Deckung der nicht pfandgesicherten<br />
Forderung herangezogen, er fällt also in die<br />
Konkursmasse. Das ist die logische Folge der Vorschrift, dass auch Pfandgegenstände in die<br />
Konkursmasse fallen SchKG 198.<br />
905. *Was kann ein Pfandgläubiger machen, wenn die Pfanddeckung nicht ausreicht?<br />
Dann kann der Pfandgläubiger nur noch eine ungesicherte Forderung geltend machen, SchKG<br />
219 IV. Auch für die Pfandgläubiger<br />
gilt dann ausschliesslich die konkursrechtliche<br />
Rangordnung.<br />
Voraussetzung für die weitere Teilnahme am Konkurs ist allerdings, dass dem<br />
Pfandgläubiger ausser der Pfandsache auch der Konkursit persönlich haftet, was bei einer<br />
Gült oder einer Grnudlast nicht zutrifft.<br />
906. Wie sieht die Konkursrechtliche Rangordnung aus? (Vor ihnen werden natürlich<br />
die Pfandgläubiger aus ihren Pfandsachen zuerst befriedigt)<br />
Die nicht oder nicht mehr pfandgesicherten<br />
Forderungen sind in drei Klassen eingereiht. Die<br />
ersten<br />
zwei Klassen sind voneinander privilegiert; die dritte Klasse umfasst die nicht<br />
privilegierten Forderungen, die so genannten Kurrentforderungen SchKG 219 IV.<br />
907. *Wie sind die Gläubiger innerhalb ihrer Klasse zu behandeln?<br />
Sie sind innerhalb ihrer Klasse gleichberechtigt, SchKG 220 I. Die Gläubiger einer<br />
nachfolgenden Klasse haben dagegen erst dann und nur soweit Anspruch auf den Erlös,<br />
als<br />
jene<br />
der vorgehenden Klasse voll befriedigt sind SchKG 220 II. Reicht der Erlös nicht ais, um<br />
die Gläubiger einer Klasse voll zu befriedigen, wird er nach dem Verhältnis ihrer<br />
Forderungsbeträge auf sie verteilt; diese Betreffnisse nennt man Konkursdividenden.<br />
908. Aus welchen Gründen rechtfertigen sich die Konkursprivilegien?<br />
Sie rechtfertigen sich nur aus sozialen Gründen. Privilegiert sind dementsprechend gewisse<br />
Forderungen natürlicher Personen, die zum Schuldner in einem besonderen<br />
Abhängigkeitsverhältnis<br />
stehen und die auf Befriedigung besonders angewiesen sind.<br />
909.<br />
*Ist nur der Gläubiger persönlich bezüglich einer privilegierten Forderung<br />
privilegiert?<br />
144
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Nein, NICHT DER GLÄUBIGER PERSÖNLICH IST PRIVILEGIERT, sondern die<br />
Forderung an sich: das Privileg haftet an der Forderung. Bei Abtretung der Forderung geht es<br />
somit auf den Zessionar über.<br />
910. Was fällt alles unter die<br />
erste Klasse?<br />
Siehe<br />
SchKG 219 IV lit.a, b, c:<br />
- Lit.<br />
a<br />
o Forderungen der Arbeitnehmer (v.a. Lohnforderungen, die in den letzten 6<br />
Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden sind). Wird das<br />
Arbeitsverhältnis weitergeführt, so bilden die nach der Konkurseröffnung<br />
geschuldeten Löhne sogar Masseverbindlichkeiten.<br />
o Forderungen wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge<br />
Konkurses des Arbeitgebers<br />
o Rückforderung von Kautionen<br />
Voraussetzung des Arbeitnehmerprivilegs<br />
ist jedoch immer das Bestehen eines<br />
rechtlichen und tatsächlichen Unterordnungsverhältnisses<br />
des Gläubigers zum<br />
Konkursiten<br />
- Lit. b<br />
o Ansprüche<br />
der Versicherten aus UVG (3. Säule)<br />
o Ansprüche aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge<br />
o Sämtliche Forderungen einer Personalforderungseinrichtung gemäss<br />
BVG (2.<br />
Säule)<br />
- Lit c<br />
o Die familienrechtlichen<br />
Unterhalts- und Unterstützungsansprüche, die in den<br />
letzten 6 Monaten vor Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlung zu<br />
erfüllen sind.<br />
91<strong>1.</strong> Welche Forderungen gehören in die zweite Klasse?<br />
- Lit. a<br />
o Kinderprivileg im Konkurs des Inhabers der elterlichen<br />
Gewalt. Noch<br />
vorhandenes Kindesvermögen kann natürlich ausgesondert werden<br />
- Lit. b<br />
o Jenste Beiträge aus AHV, IV…<br />
- Lit.c<br />
o Prämien und Kostenbeteiligungsforderungen<br />
der sozialen<br />
Krankenversicherung<br />
- Lit. d<br />
o Die Beiträge an die Familienausgleichskasse<br />
912. Was wird bei der Fristberechnung nicht mitgezählt,<br />
bei der ersten und zweiten<br />
Klasse, wenn ein Privileg befristet ist?<br />
SchKG 219 V.<br />
913. Welche Forderungen gehören zur dritten Klasse?<br />
Alle<br />
übrigen Forderungen, also die ungedeckten Pfandforderungen, wie auch konkursrechtlich<br />
nicht privilegierte Forderungen.<br />
914.<br />
Kann es noch eine weitere Klasse als diese drei Klassen und die Pfandgläubiger<br />
geben?<br />
145
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Es gibt noch eine Sonderklasse, die wird dann zwischen die zweite und die dritte Klasse<br />
eingeschoben. Dies ist der Fall, im Falle einer Bankinsolvenz sowie im Konkurs eines<br />
Ehemannes.<br />
17. <strong>Der</strong> Stunde:<br />
Das Konkursverfahren<br />
3. Abschnitt: Das Konkursverfahren (formelles<br />
Konkursrecht)<br />
§43 Gliederung und Organe des Konkursverfahrens<br />
915. Wie wird der Konkurs eröffnet und geschlossen?<br />
Mit<br />
einem gerichtlichen Entscheid.<br />
916. In welchen Stadien wickelt sich das Konkursverfahren zwischen den beiden<br />
Gerichtsentscheiden ab?<br />
- Feststellung<br />
und Sicherung der Konkursmasse<br />
- Verwaltung der Aktivmasse sowie<br />
der Abklärung von Drittansprüchen<br />
- Erwahrung der Konkursforderungen und Kollokation<br />
der Gläubiger<br />
- Verwertung des Konkurssubstrates und Verteilung des Erlöses unter die Gläubiger<br />
- Abschluss mit dem Schlusserkenntnis<br />
917. Innert welcher Frist sollte das Konkursverfahren<br />
abgeschlossen sein?<br />
Es<br />
sollte innert 12 Monaten seit Eröffnung durchgeführt worden sein; die Aufsichtsbehörde<br />
ist jedoch befugt, diese Ordnungsfrist zu verlängern (SchKG 270).<br />
918. Welches sind die Organe des Konkursverfahrens?<br />
Es<br />
gibt aussergerichtliche Organe:<br />
- das<br />
Konkursamt<br />
- die Gläubigerversammlungen<br />
- ein fakultativer Gläubigerausschuss<br />
- die Konkursverwaltung und<br />
- die Aufsichtsbehörden<br />
Es befassen sich auch gerichtliche Organe mit dem Konkurs:<br />
- das Konkursgericht und<br />
- die ordentlichen Zivilgerichte<br />
919. Was muss das Konkursamt machen, sobald es die Mitteilung des<br />
Konkurserkenntnisses erhalten hat?<br />
Es mus s das Vermögen des Konkursiten seine Aktiven und Passiven ermitteln.<br />
Zu diesem<br />
Zweck nimmt es sofort ein Inventar der vorhandenen<br />
Aktiven auf, trifft die notwendigen<br />
Sicherungsmassnahmen, macht den Konkurs öffentlich bekannt und verbindet damit einen<br />
Schuldenruf, SchKG 221, 223, 232.<br />
920. Was muss bei der Inventarisierung<br />
und Sicherung des Aktivvermögens gemacht<br />
werden, wenn sich Vermögensstücke in einem anderen Konkurskreis befinden?<br />
Es muss der Requisitionsweg beschritten werden SchKG 4.<br />
92<strong>1.</strong> *Was macht man mit einem schon vor der Konkurseröffnung<br />
aufgenommenen<br />
Güterverzeichnis?<br />
Es dient im Konkurs als Grundlage, es stellt dann das Inventar dar.<br />
146
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
922. *Welche Pflichten hat der Konkursit wie Dritte bei der Inventaraufnahme?<br />
- Dem Konkursit obliegt während dem gesamten Konkursverfahren eine allgemeine<br />
Präsenzpflicht SchKG 229 I, deren Missachtung steht unter Strafdrohung. Um sich zu<br />
entfernen braucht er eine besondere Erlaubnis; nötigenfalls wird er polizeilich<br />
Vorgeführt<br />
- <strong>Der</strong> Konkursit hat bei der Inventaraufnahme muss er mitwirken und ist insbesondere<br />
verpflichtet, dem Konkursamt alle Vermögenswerte anzugeben und zur Verfügung zu<br />
stellen, SchKG 122 I (Auskunfts- und Herausgabepflicht). Ist er gestorben oder<br />
geflohen, treffen diese Obliegenheiten seine erwachsenen Hausgenossen SchKG 222 II.<br />
Diese Pflichten treffen auch Dritte, bei denen Vermögen des Schuldners liegt, sofern<br />
sie<br />
nicht eigene Rechte daran geltend machen SchKG 222 IV. Diese Auskunfts- und<br />
Herausgabepflicht umfasst zugleich die Pflicht zur Duldung von Durchsuchungen, was<br />
nötigenfalls mit polizeilicher Hilfe erzwungen werden kann SchKG 222 III.<br />
- Auch die Behörden sind auskunftspflichtig SchKG 222 V.<br />
923. Welche Rechte hat der Konkursit<br />
<strong>Der</strong><br />
Konkursit hat einen Anspruch auf einen billigen Unterhaltsbeitrag aus der Konkursmasse,<br />
wenn er gehalten ist, zur Verfügung zu bleiben<br />
und wegen des Konkurses kein<br />
Erwerbseinkommen mehr erziehlt SchKG 229 II. Dieser Anspruch gilt als<br />
Masseverbindlichkeit.<br />
924. Was ist alles Inhalt<br />
des Inventars?<br />
In das Konkursinventar werden sämtliche Vermögensstücke des Schuldners mit ihrem<br />
Schätzwert aufgenommen SchKG 227. Selbst<br />
Kompetenzgut ist vorzumerken, jedoch<br />
auszuscheiden und dem Schuldner zur freien Verfügung zu überlassen SchKG 224.<br />
Sachen, die als Eigentum Dritter bezeichnet oder von Dritten als ihr Eigentum angesprochen<br />
werden, gehören ins Inventar, ausser es wäre offensichtlich Dritteigentum. Die behaupteten<br />
Rechte sind aber vorzumerken, jene an Grundstücken von Amtes wegen, sowie sie aus dem<br />
Grundbuch hervorgehen, SchKG 225, 226.<br />
Für die Inventarisierung spielt es noch keine Rolle wo sich die Vermögenswerte befinden.<br />
Vermögensstücke im Drittgewahrsam dürfen aber, wenn ein Dritter Eigentum daran geltend<br />
macht, nicht einfach beschlagnahmt und weggeführt werden, sondern nur mit „vindikation“<br />
(Klage) abmassiert werden SchKG 242 III.<br />
925. Was muss der Konkursit machen, wenn das Inventar abgeschlossen ist?<br />
Es<br />
wird dem Konkursiten vorgelegt; er muss sich zu dessen Vollständigkeit und Richtigkeit<br />
äussern und seine Erklärung darüber im Inventar unterzeichnen, SchKG 228. Von da an läuft<br />
für ihn die Beschwerdefrist, wenn er die Freigabe von Kompetenzgut beanspruchen will.<br />
Wegen Nichtaufnahme eines Vermögenswertes kann sich auch ein Gläubiger beschwerden;<br />
für ihn läuft die Beschwerdefrist von der Auflage des Inventars an.<br />
926. Wirkt sich das Inventar auf die Rechte Dritter aus?<br />
Nein,<br />
daher haben diese, sofern ihre Berechtigung nicht ausser Zweifel steht, keinen<br />
Beschwerdegrund. Sie wahren ihre Rechte im Aussonderungs- oder<br />
Admassierungsverfahren<br />
oder im Kollokationsverfahren.<br />
927. Wie werden die inventarisierten<br />
Vermögenswerte gesichert?<br />
Gleichzeitig<br />
mit der Inventaraufnahme hat das Konkursamt die zur Erhaltung der<br />
Vermögenswerte gebotenen Sicherungsmassnahmen zu treffen SchKG 22<strong>1.</strong><br />
Beispiele, was<br />
allen in Betracht kommt sind in SchKG 223 aufgeführt. Dazu gehören aber z.B. auch:<br />
147
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Schliessung des Betriebes oder eines Betriebsteiles (davon wird man aber absehen,<br />
wenn eine Sanierung möglich erscheint)<br />
- Sperrung von Bank- und Postcheckkonto<br />
- Anweisung an die Mieter und Pächter von Grundstücken des Konkursiten, Zinsen<br />
künftig an das Konkursamt zu bezahlen<br />
- Einleitung von Betreibungen für Forderungen<br />
des Konkursiten zur Unterbrechung der<br />
Verjährung.<br />
928. *Welche Bedeutung hat das Inventar?<br />
Nicht erst das Inventar bewirkt den Konkursbeschlag über die Vermögenswerte sondern<br />
bereits<br />
die Konkurseröffnung. Die Inventarisierung ist bloss eine darauf folgende<br />
Verwaltungshandlung des Konkursamtes, die keinerlei<br />
Wirkungen gegenüber Dritten<br />
entfaltet. Vom Ergebnis der Inventarisierung hängt jedoch der weitere Verlauf des Verfahrens<br />
ab. Dieses kann drei Wendungen nehmen:<br />
- Reicht der Erlös des inventarisierten Vermögens voraussichtlich zur Deckung der<br />
Kosten aus oder leistet ein Gläubiger für den mutmasslichen Fehlbetrag Sicherheit, wird<br />
das ordentliche Konkursverfahren durchgeführt<br />
SchKG 231 I Ziff. <strong>1.</strong><br />
- Andernfalls kann nur das summarische Konkursverfahren in Betracht kommen SchKG<br />
231<br />
- Wenn nicht genügend Aktiva für die Deckung der Kosten eines summarischen<br />
Verfahrens gefunden werden, so stellt sich die Frage der Einstellung des Konkurses<br />
mangels<br />
Aktiven SchKG 230.<br />
929. Ist eine Verfügung über die Einstellung des Konkurses mangels Aktiva<br />
anfechtbar?<br />
Ja,<br />
mit aber nur mit kantonalen Rechtsmitteln.<br />
930. Was macht das<br />
Konkursamt, nachdem es die Einstellung des Konkurses verfügt<br />
hat?<br />
Es<br />
macht das öffentlich bekannt SchKG 230 II.<br />
93<strong>1.</strong> Welche<br />
Möglichkeiten haben die Gläubiger nach der Einstellung des Konkurses?<br />
- die Einstellung des Konkurses lässt sämtliche<br />
Betreibungen, die durch die<br />
Konkurseröffnung dahingefallen sind, wieder aufleben SchKG 230 IV, sofern diese im<br />
Moment<br />
des Konkurses noch fortgesetzt werden konnten.<br />
- Nicht auf dieses Wiederaufleben der Spezialexekution angewiesen sind die<br />
Pfandgläubiger (Faust- und Grundpfandgläubiger) einer juristischen Person: sie können<br />
die Verwertung ihres Pfandes unmittelbar durch das Konkursamt<br />
verlangen, ohne erst<br />
eine separate Betreibung auf Pfandverwertung anheben oder eine wieder auflebende<br />
weiterführen zu müssen SchKG 230a.<br />
- Die Pfandgläubiger einer natürlichen Person müssen eine Betreibung auf<br />
Pfandverwertung wieder einleiten oder eine wiederauflebende weiterführen SchKG 230<br />
IV.<br />
- Gläubiger ohne Pfandsicherung können nach Einstellung des Konkurses jeden<br />
Schuldner, sei er konkursfähig oder nicht während 2 Jahren auf Pfändung betreiben<br />
SchKG<br />
230 III. *Es ist empfehlenswert so etwas zu machen, damit sie einen<br />
Verlustschein bekommen, denn wenn der Konkurs eingestellt wird, bekommen sie<br />
nichts. <strong>Der</strong> Verlustschein ist nötig um eine allfällige Anfechtung nach SchKG 285<br />
durchzuführen.<br />
932. Wann wird der Konkurs publiziert?<br />
148
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Wenn feststeht, dass das ordentliche oder das summarische Verfahren durchgeführt werden<br />
kann, macht das Konkursamt<br />
die Eröffnung des Konkurses öffentlich bekannt, SchKG 232 I.<br />
933. Was bezweckt die Publikation der Konkurseröffnung?<br />
Die Ergänzung und die Bereinigung des inventarisierten Konkurssubstrates, die Feststellung<br />
der Konkursforderungen sowie die Vorbereitung des weiteren Verfahrens.<br />
934. *Welchen Inhalt weist die Konkurspublikation auf?<br />
SchKG 232.<br />
- Bekanntgabe des Wohnorts und des Namens des Konkursiten sowie des<br />
Zeitpunkts der<br />
Konkurseröffnung SchKG 232 II Ziff. <strong>1.</strong><br />
- Schuldenruf, SchKG 232 II Ziff. 2 für Konkursgläubiger und<br />
Aussonderungsberechtigte.<br />
Ausländischen<br />
Gläubigern kann eine längere Frist eingeräumt werden oder die Frist<br />
verlängert werden. Spätere Eingaben sind noch bis zum Schluss des Verfahrens zu<br />
berücksichtigen; nur muss der Säumige dann<br />
die dadurch verursachten Kosten tragen<br />
und kann zu deren Vorschuss angehalten werden SchKG 251 I und II.<br />
- Aufforderung an die Schuldner des Konkursiten, SchKG 232 II Ziff. 3. Sie sollen sich<br />
binnen Eingabefrist als solche melden, bei Straffolge im Unterlassungsfall.<br />
- Aufforderung an die Besitzer von Sachen des Konkurses, SchKG 232 II Ziff. 4. Nicht<br />
anzumelden sind im Ausland gelegene Sachen, solange sie nicht zur Masse<br />
gezogen<br />
werden können.<br />
- Einladung zur ersten Gläubigerversammlung, SchKG 232 II Ziff. 5. Im summarischen<br />
Konkursverfahren, kann die Einladung der Gläubiger unterbleiben SchKG 231 III Ziff.<br />
<strong>1.</strong> Jeder bekannte Gläubiger erhält zudem eine Spezialanzeige der Konkurspublikation,<br />
sofern der Konkurs<br />
im ordentlichen Verfahren durchgeführt wird SchKG 233.<br />
- Hinweis für ausländische Beteiligte, dass das Konkursamt als Zustellungsdomizil gilt,<br />
solange kein anderes in der Schweiz bezeichnet wird, SchKG 232 II Ziff. 6.<br />
935. Welchen Organen obliegt die Verwaltung der Aktivmasse?<br />
- der Gläubigerversammlung<br />
- einem allfälligen eingesetzten Gläubigerausschuss<br />
- der Konkursverwaltung<br />
936. Wann ist die erste Gläubigerversammlung<br />
abzuhalten, wer leitet sie?<br />
Spätestens 20 Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung<br />
des Konkurses findet die erste<br />
Gläubigerversammlung statt SchKG<br />
232 II Ziff. 5. Sie wird immer im ordentlichen<br />
Konkursverfahren<br />
einberufen im summarischen ist die Einberufung fakultativ SchKG 231 III<br />
Ziff. 1 .<br />
Sie wird vom Konkursbeamten geleitet; er bildet mit zwei von ihm bezeichneten Gläubigern<br />
das „Büro“ SchKG 235 I und II.<br />
937. Über was<br />
entscheidet das „Büro“?<br />
Über die Zulassung von Personen, die ohne besonders eingeladen zu sein, an den<br />
Verhandlungen teilnehmen wollen,<br />
sowie über Anstände wegen Berechnung der Stimmen<br />
SchKG<br />
235 IV.<br />
938. Wie können die Entscheide des Büros angefochten werden?<br />
Mit Beschwerde.<br />
939.<br />
Wer ist an der ersten Gläubigerversammlung teilnahmeberechtigt?<br />
149
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Wer aus den Unterlagen des Konkursiten als dessen Gläubiger hervorgeht<br />
oder der sich sonst<br />
wie als Gläubiger, Mitschuldner, Bürge oder Gewährspflichtiger ausweist, SchKG 232 II Ziff.<br />
5.<br />
940. Wann ist die Gläubigerversammlung beschlussfähig?<br />
Wenn wenigstens ein Viertel der bekannten Gläubiger anwesend oder vertreten ist, SchKG<br />
235 II. Sind es weniger als fünf Gläubiger, müssen sie mindestens die Hälfte der bekannten<br />
Gläubiger<br />
ausmachen SchKG 235 III. Ein Gläubiger kann sich auch durch einen Nicht-<br />
Gläubiger vertreten lassen.<br />
94<strong>1.</strong> Was ist, wenn die Versammlung nicht beschlussfähig ist?<br />
Dann unterrichtet das Konkursamt die Anwesenden über den Bestand der Masse (Inventar)<br />
und stellt die Beschlussunfähigkeit<br />
fest SchKG 236. Das hat weiter zur Folge, dass das<br />
Konkursamt<br />
die Aktivmasse bis zur allfälligen zweiten Gläubigerversammlung alleine<br />
verwalten muss und dass nun für alle späteren Gläubigerbeschlüsse der<br />
Zirkularweg offen<br />
steht SchKG 255a.<br />
942. Wie werden die Beschlüsse der ersten Gläubigerversammlung gefasst?<br />
Immer mit dem absoluten Mehr der stimmenden Gläubiger, gleichgültig, ob es sich um einen<br />
Versammlungs- oder<br />
einen Zirkularbeschluss handelt. Dem Vorsitzenden kommt der<br />
Stichentscheid<br />
zu SchKG 235 IV. Zahl und Höhe der Forderungen spielen für die Stimmkraft<br />
keine Rolle (Kopfstimmrecht).<br />
943. Welche Aufgaben hat die erste Gläubigerversammlung?<br />
- Sie nimmt den Bericht des Konkursamtes über die Aufnahme des Inventars und den<br />
Bestand der Aktivmasse entgegen<br />
SchKG 237 I<br />
- Sie trifft erste organisatorische Entscheidungen:<br />
o Sie kann entweder das Konkursamt oder eine oder mehrere<br />
von ihr zu<br />
wählenden Personen als Konkursverwaltung einsetzen SchKG 237 II<br />
o Sie kann allenfalls noch einen Gläubigerausschuss<br />
als Hilfsorgan wählen<br />
SchKG 237 III.<br />
o Sie hat über eine Reihe dringlicher Verwaltungsmassnahmen zu beschliessen:<br />
� Die Fortführung des Betriebes des Konkursiten SchKG 238 I<br />
� Die Fortsetzung schwebender, ganz ausnahmsweise die Anhebung<br />
neuer, dringlicher<br />
Prozesse<br />
� Einen vorzeitigen Verkauf aus freier Hand<br />
- Sie kan n die Ver wertung einstellen, wenn der Konkursit einen Nachlassvertrag<br />
vorschlägt, SchKG 238 II<br />
944. Wieso hat die erste Gläubigerversammlung nur so wenig<br />
Kompetenzen?<br />
Wei l noch nicht sicher ist, ob da wirklich alle Gläubiger sind daher rechtfertigt es sich nicht<br />
ihnen weitgehendere Kompetenzen zu geben; erst die Zweite Gläubigerversammlung ist<br />
umfassend<br />
kompetent SchKG 253.<br />
945. Wie können die Beschlüsse der Gläubigerversammlung angefochten werden?<br />
Sie können sowohl wegen Rechtsverletzung als auch wegen Unangemessenheit mit<br />
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde<br />
angefochten werden SchKG 239. Legitimiert dazu ist<br />
jeder<br />
Gläubiger, der Schuldner sowie ein betroffener Dritter.<br />
Die Beschwerdefrist beträgt hier nur 5 statt 10 Tage SchKG 239 I.<br />
946. *Was ist der Gläubigerausschuss?<br />
150
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Er ist ein von der Gläubigerversammlung aus ihrer Mitte fakultativ eingesetztes Hilfs-<br />
und<br />
Kontrollorgan SchKG 237 III. Bestimmt der Einsetzungsbeschluss nichts anderes, stehen ihm<br />
einfach die im Gesetz aufgezählten Obliegenheiten zu. Diese sind teils von den Kompetenzen<br />
der Gläubigerversammlung abgeleitet, teils haben sie selbständigen Charakter. Ein<br />
Gläubigerausschuss<br />
kann unabhängig davon gewählt werden, ob die Gläubigerversammlung<br />
eine Konkursverwaltung einsetzt oder nicht SchKG<br />
237 II.<br />
947. *Welche Kompetenzen hat der Gläubigerausschuss?<br />
- abgeleitete Kompetenzen SchKG 237 III Ziff. 1-3:<br />
o Kontrolle der Geschäftsführung der Konkursverwaltung<br />
o Begutachtung der von dieser vorgelegten Fragen<br />
o Einspruch gegen jede den Interessen der Gläubiger<br />
zuwiderlaufende<br />
Massnahme der Konkursverwaltung<br />
o Ermächtigung, den Betrieb des Konkursiten fortzuführen<br />
o Genehmigung von Rechnungen zu Lasten der Masse<br />
o Ermächtigung, Prozesse zu führen sowie Vergleiche und Schiedsverträge<br />
abzuschliessen<br />
- Selbständige Kompetenzen SchKG 237 III Ziff. 4 und 5<br />
o Genehmigung des Kollokationsplans, SchKG 237 III Ziff. 4 (die<br />
Konkursverwaltung prüft die Forderungen, der Schuldner muss sagen, ob sie<br />
bestehen, darauf bestimmt die Konkursverwaltung ob die Forderung<br />
zugelassen wird, auch wenn eine Forderung zugelassen wird, kann der<br />
Gläubigerausschuss<br />
bestimmen, ob eine Forderung dazu genommen wird oder<br />
nicht)<br />
o Anordnung von AbschlagsverteilungenSchKG 237 III Ziff. 5<br />
o Einberufung weiterer Gläubigerversammlungen SchKG 255<br />
948. *Wer bestimmt,<br />
welche Kompetenzen der Gläubigerausschuss hat?<br />
Die erste Gläubigerversammlung.<br />
949. Wer<br />
kann in den Gläubigerausschuss gewählt werden?<br />
Jeder Gläubiger, der vom Schuldner nicht irgendwie abhängig ist.<br />
950. Welche Hierarchie herrscht unter den Mitgliedern innerhalb des Ausschusses?<br />
Innerhalb des Ausschusses herrscht das Kollegialitätsprinzip, das individuelles Handeln eines<br />
einzelnen<br />
Mitgliedes ausschliesst.<br />
95<strong>1.</strong> Wie sind Beschlüsse des Gläubigerausschusses anfechtbar?<br />
Mit<br />
Beschwerde, soweit sie betreibungsrechtliche Verfügungen und nicht nur<br />
rechtsgeschäftliche Handlungen darstellen.<br />
952. Wer kann der Gläubigerausschuss<br />
wieder abberufen?<br />
Die<br />
zweite Gläubigerversammlung SchKG 253 II.<br />
953. Was ist die Funktion der Konkursverwaltung?<br />
Sie<br />
ist das ausführende Organ im Konkursverfahren, sozusagen die „Exekutive“. Ihr obliegt<br />
die Durchführung des Konkurses im Einzelnen, namentlich der Vollzug<br />
der<br />
Gläubigerbeschlüsse. Sie übt öffentlich-rechtliche Funktionen<br />
aus.<br />
151
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
954. *Macht es einen Unterschied, ob die Konkursverwaltung<br />
durch Beschluss der<br />
Gläubigerversammlung gewählt wird oder ob die Befugnisse von Gesetzes wegen<br />
dem Konkursamt übertragen werden?<br />
Nein, wählt der Gläubigerausschuss keine Konkursverwaltung (die gewählte wäre die<br />
ausserordentliche<br />
Konkursverwaltung) wird das Konkursamt von Gesetzes wegen zur<br />
ordentlichen Konkursverwaltung. Es macht keinen Unterschied, ob die Konkursverwaltung<br />
eine ordentliche<br />
oder eine ausserordentliche ist, denn auch die Mitglieder einer<br />
aussera mtlichen Konkursverwaltung versehen ein öffentliches Amt.<br />
955. Wie wird eine eingesetzte Konkursverwaltung abberufen?<br />
Von der zweiten Gläubigerversammlung SchKG 253 II.<br />
956. *Welche Vorschriften gelten für die Konkursverwaltung ( gleiche Vorschriften,<br />
da kein Unterschied zwischen der ordentlichen und der ausserordentlichen<br />
Konkursverwaltung besteht)?<br />
ScKG 241<br />
- Sie unterstehen denselben positiven und negativen Amtspflichten und der gleichen<br />
Aufsicht<br />
SchKG 8-11<br />
- <strong>Der</strong><br />
Kanton ist für sie verantwortlich, SchKG 5<br />
- Ihre Mitglieder unterstehen der disziplinarischen Verantwortlichkeit, SchKG 14<br />
- Ihre Verfügungen<br />
unterliegen der Beschwerde<br />
- Entschädigungen dürfen ausschliesslich im Rahmen der GebV berechnet werden. H7<br />
957. *Welche Aufgaben obliegen der Konkursverwaltung?<br />
<strong>Der</strong> Konkursverwaltung obliegen im Rahmen der Verwaltung der Aktivmasse insbesondere<br />
folgende Aufgeben:<br />
- Sie besorgt alle zur Erhaltung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt die Masse<br />
vor Gericht SchKG 240 (*Partei ist nicht der Schuldner sondern die Masse, vertreten<br />
d urch die Konkursverwaltung. Wird die Klage verloren, sind die Prozesskosten und ev.<br />
die Anwaltskosten der anderen Partei, die je nach dem bezahlt werden müssen nicht<br />
Konkursforderung<br />
sondern Masseverbindlichkeit, da sie zur Zeit der Konkurseröffnung<br />
och nicht bestand, sondern von der Masse begründet wurde.)<br />
- Schulden, die sie im Rahmen dieser Tätigkeit eingeht, sind Masseverbindlichkeiten<br />
- Die Konkursverwaltung muss unbestrittene fällige Forderungen einziehen. Anders als in<br />
der Betreibung auf Pfändung ist im Konkurs die Eintreibung auf dem Betreibungswege<br />
möglich SchKG 243 I. Das gilt nach der Praxis solange die Forderung nicht ernsthaft<br />
bestritten ist. Schwer einbringliche Forderungen sollen hingegen,<br />
selbst wenn sie<br />
anerkannt sind, abgetreten oder verwertet werden<br />
- Zur Verwaltung der Aktivmasse gehört weiter die Behandlung der<br />
Aussonderungsansprüche, SchKG 242.<br />
- In den Fällen von SchKG 243 II kann die Konkursverwaltung schon bestimmt Sachen<br />
Verwerten (Notverkauf, Wertpapiere und Sachen, die einen Markt- oder Börsenpreis<br />
haben dürfen sofort veräussert werden). Sonst wird aber immer nach der Zweiten<br />
Gläubigerversammlung verwertet. Im Verwaltungsstadium des Konkurses<br />
sind sonst die<br />
Aktivwerte nur zu erhalten, das heisst vor<br />
Verlust zu bewahren.<br />
958. Was ist der Zweck eines Aussonderungs- und Admassierungsverfahrens?<br />
Es soll der Bestand des für die Verwertung bestimmten Konkurssubstrates definitiv abgeklärt<br />
werden.<br />
152
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
959. Wie bestimmt sich ob das Aussonderungs- oder das Admassierungsverfahren<br />
Anwendung findet?<br />
Nach dem Gewahrsam am streitigen Gegenstand. Es ist der Gewahrsam im Zeitpunkt der<br />
Konkurseröffnung<br />
entscheidend.<br />
960. Wann kommt das Admassierungsverfahren<br />
zum Zug?<br />
Wenn sich die umstrittene Sache bei der Konkurseröffnung im ausschliesslichen oder im<br />
Mitgewahrsam des Drittansprechers befand, denn dann ist sie vom Konkursbeschlag noch gar<br />
nicht<br />
betroffen. Dann muss die Konkursmasse sie vorerst noch an sich ziehen: „admassieren“.<br />
Zu diesem Zweck muss sie, wenn der Dritte widerstrebt, die Sache im<br />
Admassierungsverfahren mit einer Art Vindikationsklage von ihm herausverlangen, SchKG<br />
242 III.<br />
96<strong>1.</strong> Wer entscheidet darüber, ob mit einer Admassierungsklage gegen einen<br />
Dritten<br />
vorzugehen sei oder nicht?<br />
Im ordentlichen<br />
Konkursverfahren entscheiden die Gläubiger darüber, im Summarischen<br />
entscheidet<br />
die Konkursverwaltung. Auch die Abtretung des Prozessführungsrechts kann in<br />
Frage kommen SchKG 260.<br />
962. Wer ist Partei bei der Admassierungsklage?<br />
Die Konkursmasse und der Dritte.<br />
963.<br />
Wann kommt das Aussonderungsverfahren zum Zug?<br />
Wenn der Schuldner bei der Konkurseröffnung ausschliesslich<br />
den Gewahrsam der Sache<br />
innehatte, so fällt die Sache zuerst einmal<br />
in die Konkursmasse, ausser der Konkursgläubiger<br />
hätte<br />
offensichtlich zu Recht beanstandet. Nun muss der Drittansprecher im<br />
Aussonderungsverfahren mit der Aussonderungsklage gegen die Konkursmasse,<br />
die sich der<br />
Freigabe widersetzt, vorgehen, SchKG 242 I/II. Das Prozedere ist vergleichbar mit jenem<br />
nach SchKG 107 in der Spezialexekution.<br />
964. In welchen Stadien kann das Aussonderungsverfahren abwickeln?<br />
Es kann zwei Stadien durchlaufen:<br />
- ein Vorverfahren, dem unter Umständen<br />
- ein Aussonderungsprozess folgt<br />
- bevor es aber ins Vorverfahren geht muss überhaupt ein Aussonderungsbegehren<br />
vorliegen<br />
965. Muss die Aussonderung ausdrücklich<br />
verlangt werden/von wem?<br />
Sie m uss ausdrücklich verlangt werden. Verlangen kann sie der Rechtsansprecher selbst,<br />
der<br />
Schuldner oder eine andere Person.<br />
966. Wie lange können Aussonderungsansprüche geltend gemacht werden?<br />
In der Konkurspublikation werden allfällige Ansprecher aufgefordert, binnen Monatsfrist eine<br />
entsprechende Eingabe zu machen. Die<br />
Anmeldung ist jedoch noch bis zur Verteilung des<br />
Erlöses<br />
möglich SchKG 25<strong>1.</strong> Wurde die Sache inzwischen verwertet, so richtet sich der<br />
Anspruch auf Herausgabe des Erlöses.<br />
967. Wer muss das Vorverfahren durchführen?<br />
Die Konkursverwaltung; sie verfügt über die Herausgabe der von Dritten beanspruchten<br />
Sachen SchKG 242 I.<br />
153
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
968. *Wer ist Partei bei der Aussonderungsklage?<br />
<strong>Der</strong> Drittansprecher ist der Kläger, der Beklagte ist die Masse.<br />
969.<br />
*Wie läuft das Vorverfahren ab?<br />
- Bereitschaft<br />
die Sache herauszugeben<br />
o Im ordentlichen Verfahren: Ist die Konkursverwaltung<br />
bereit die Sache einem<br />
Dritten herauszugeben, muss sie zuerst noch die 2. Gläubigerversammlung um<br />
Erlaubnis fragen. Als oberstes<br />
Organ des Konkurses kann sie nämlich anders<br />
beschliessen oder das Bestreitungsrecht<br />
der Masse nach SchKG 260 einem<br />
oder einzelnen Gläubigern abtreten lassen. Nur wenn die 2.<br />
Gläubigerversammlung zustimmt und kein Gläubiger die Abtretung verlangt<br />
darf die Sache dem Dritten herausgegeben werden. (Die Konkursverwaltung<br />
entscheidet allein, wenn es sich nicht um Gegenstände von bedeutendem Wert<br />
handelt, sofern das Dritteigentum von vornherein als erwiesen<br />
gilt und die<br />
sofortige Herausgabe im Interesse der Masse liegt oder der Drittansprecher<br />
eine angemessene Kaution leistet)<br />
o Im summarischen Verfahren entscheidet darüber die Konkursverwaltung<br />
allein, nur in wichtigen Fällen ist den Gläubigern Gelegenheit zu geben,<br />
Abtretung zu verlangen.<br />
- Wird ein Drittanspruch abgelehnt, so setzt die<br />
Konkursverwaltung dem Dritten eine 20tägige<br />
Frist zur Aussonderungsklage, verbunden mit der Anordnung, dass der<br />
Herausga beanspruch als verwirkt gilt, wenn die Frist nicht eingehalten wird SchKG 242<br />
II.<br />
970. *Wieso fragt die Konkursverwaltung gerne den Gläubigerausschuss um Rat,<br />
bevor sie etwas macht?<br />
Damit sie sich<br />
nicht Schadenersatzpflichtig macht.<br />
97<strong>1.</strong> *Hat jemand der sich auf ein Pfandrecht beruft einen Aussonderungsanspruch?<br />
Nein, nur das Recht auf Vorhabbefriedigung, SchKG 219 I.<br />
972.<br />
Wo wird die Aussonderungsklage bei einem Aussonderungsprozess erhoben?<br />
Sie wird mit Begehren auf Herausgabe der Sache beim Gericht des Konkursortes angehoben,<br />
SchKG 242 II.<br />
973. Wer ist im Aussonderungsprozess Partei?<br />
Kläger ist immer der Drittansprecher, Beklagter die Masse oder ein Abtretungsgläubiger.<br />
974.<br />
Was ist der Unterschied bezüglich der Verfahrensart zum Widerspruchsprozess?<br />
Im Unterschied zum Widerspruchsverfahren sieht das SchKG keine Beschleunigung des<br />
Verfahrens vor; das kantonale Recht kann dies aber anordnen.<br />
975. Welche Konsequenzen kann das Urteil im Widerspruchsprozess haben?<br />
Wird die Klage gutgeheissen, muss die Streitsache dem Kläger herausgegeben werden; wird<br />
sie abgewiesen, bleibt sie endgültig in der Konkursmasse. Das Urteil<br />
hat nur für das hängige<br />
Konkursverfahren<br />
Bedeutung; denn das Aussonderungsverfahren will nur die<br />
Zusammensetzung der Aktivmasse feststellen, verfolgt also nur einen betreibungsrechtlichen<br />
Zweck.<br />
976. Welche Rechtsnatur hat die Aussonderungsklage und die Admassierungsklage?<br />
154
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Sie ist, wie die Widerspruchsklage eine betreibungsrechtliche Klage mit Reflexwirkung auf<br />
das materielle<br />
Recht. Gleiches gilt für die Admassierungsklage der Konkursmasse.<br />
Ein<br />
letztinstanzliches Urteil ist bei gegebenen Voraussetzungen berufungsfähig.<br />
977. Was bedeutet die Tatsache, dass die Aussonderungsklage betreibungsrechtlicher<br />
Natur mit Reflexwirkung auf das materielle Recht ist bei einem Widerruf<br />
des<br />
Konkurses?<br />
Das<br />
würde z.B. bedeuten:<br />
- hatte<br />
der Dritte obsiegt, so könnte der ehemalige Konkursit gegen ihn immer noch die<br />
Vindikationsklage<br />
anstrengen<br />
- hatte die Masse obsiegt, war aber die Sache bei Konkurswiderruf noch nicht verwertet,<br />
so kann der Dritte seinerseits<br />
gegen den ehemaligen Konkursiten vindizieren.<br />
§46 Die Erwahrung und Kollokation<br />
der Konkursforderungen<br />
978. Was ist der Zweck der Kollokation?<br />
Wie<br />
der Bestand der Aktivmasse muss auch derjenige der Passivmasse nach Ablauf der<br />
öffentlich bekannt gemachten Eingabefrist festgestellt werden, dazu dient die Kollokation.<br />
Beides,<br />
die Ermittlung verwertbaren Konkurssubstrates und der bei einer Liquidation zu<br />
berück sichtigenden Konkursforderungen laufen nebeneinander her. Beides ist zunächst<br />
Aufgabe der Konkursverwaltung. Über eine streitige materielle Rechtslage zu entscheiden<br />
steht jedoch allein den zuständigen Gerichten zu.<br />
979. Was macht die Konkursverwaltung nach Ablauf der Eingabefrist?<br />
Sie prüft die angemeldeten Forderungen und macht die zu ihrer Erwahrung nötigen<br />
Erhebungen SchKG 244. Sie hat dafür 60 Tage Zeit.<br />
980. Was ist Gegenstand der Prüfung der Konkursverwaltung?<br />
Zu prüfen sind vor allem sämtliche mündlich oder schriftlich, rechtzeitig oder verspätet<br />
(SchKG 251) angemeldete Konkursforderungen.<br />
Selbst<br />
nicht angemeldete Forderungen sind von Amtes wegen zu berücksichtigen:<br />
- So die, die aus dem Grundbuch ersichtlich sind (SchKG 246): Grundpfandforderungen,<br />
die eingetragenen Dienstbarkeiten und Grundlasten sowie vorgemerkte persönliche<br />
Rechte, die wegen der Publizität des Grundbuchs<br />
nicht noch besonders eingegeben<br />
werden müssen.<br />
- Forderungen, die durch verpfändete Grundpfandtitel gesichert sind<br />
- Unmittelbare gesetzliche Rechte, die servitutes apparentes, oder unmittelbare<br />
gesetzliche Verfügungsbeschränkungen<br />
98<strong>1.</strong> *Auf was ihn muss die Konkursverwaltung die Forderungen überprüfen?<br />
Die Konkursverwaltung muss untersuchen, ob die Forderungen überhaupt noch bestehen,<br />
wie<br />
hoch sie sind, ob Sicherheiten dafür gegeben sind<br />
und welchen Rang ihnen zivil- und<br />
konkursrechtlich<br />
zukommt. Dabei wird in erster Linie auf die eingelegten Beweismittel<br />
abgestellt. Zudem sind von Amtes wegen alle zweckdienlichen Erhebungen zu machen;<br />
vom<br />
Gläubiger können zu diesem Zweck weitere Belege eingefordert werden SchKG 244. Beruht<br />
jedoch die Eingabe auf einem gerichtlichen Entscheid oder auf einer Verwaltungsverfügung,<br />
darf die Konkursverwaltung die betreffenden Forderungen natürlich nicht mehr in Frage<br />
stellen, in seiner Stellungnahme kann der Konkursit nur noch echte nova vorbringen zudem<br />
kann er noch den Rang bestreiten.<br />
155
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
982. *Was ist die Aufgabe des Konkursiten im Prüfungsverfahren bezüglich der<br />
Forderungen der Gläubiger?<br />
<strong>Der</strong><br />
Schuldner muss zu jeder einzelnen Konkursforderung befragt werden; er soll sagen, ob er<br />
sie anerkennt oder nicht SchKG 244 Satz 2. *Die Konkursverwaltung ist aber nicht an seine<br />
Aussage<br />
gebunden SchKG 245.<br />
983. *Was bedeutet in SchKG 245 „Erklärung des Gemeinschuldners einholen“?<br />
Das heisst, dass der Gemeinschuldner<br />
jede Schuld, die er anerkennt unterschreiben muss.<br />
984. *Welche Bedeutung hat die Anerkennung der Schuld durch den Konkursiten?<br />
Die Erklärung des Gemeinschuldners ist also, obwohl sich die Konkursverwaltung über sie<br />
hinwegsetzen<br />
kann nicht irrelevant. Die unterschriftliche Anerkennung der Forderung durch<br />
den Konkursiten hat praktische Bedeutung für die Wirkung des Konkursverlustscheins; dieser<br />
gilt dann nämlich als Schuldanerkennung im Sinne von SchKG 82.<br />
985. *Wie entscheidet die Konkursverwaltung darüber, ob eine Forderung besteht?<br />
Gelangt die Konkursverwaltung zur Überzeugung, dass eine Konkursforderung<br />
an sich und<br />
ihrer<br />
Höhe nach besteht, dass sie dem betreffenden Gläubiger zusteht, dass gegen die<br />
angegebenen Sicherheiten und den beanspruchten Rang nichts einzuwenden ist, so anerkennt<br />
sie den Anspruch. Andernfalls weist sie ihn ganz oder teilweise ab oder verweist ihn in den<br />
ihr zuerkannten Rang. <strong>Der</strong> Entscheid erfolgt in der so genannten Kollokationsverfügung.<br />
(Anerkennung einer Forderung setzt voraus, dass sie hinreichend belegt ist, Abweisung setzt<br />
eine gründliche Prüfung voraus).<br />
986. Wie muss der Entscheid der Konkursverwaltung sein?<br />
Er muss eindeutig und unbedingt sein.<br />
Bedingte Kollokation ist einzig zulässig, wo ein<br />
Anfechtungsprozess<br />
hängig ist.<br />
987. Über welche Forderungen hat die Konkursverwaltung nicht zu entscheiden?<br />
Über solche, die im Zeitpunkt der<br />
Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Prozesses oder<br />
eines<br />
Verwaltungsverfahrens bilden, SchKG 207. Sie sind bis zur 2. Gläubigerversammlung<br />
einstweilen bloss pro memoria im Kollokationsplan vorzumerken.<br />
988. Wo kommt die Kollokationsverfügung zum Ausdruck, wie muss sie ausgestaltet<br />
sein?<br />
Sie<br />
kommt formell im Kollokationsplan zum Ausdruck.<br />
- Jede<br />
Abweisung eines Anspruchs muss kurz begründet werden<br />
- Nur die unveränderte Gutheissung einer Eingabe bedarf keiner Begründung<br />
989. Über was gibt der Kollokationsplan Auskunft?<br />
<strong>Der</strong> Kollokationsplan<br />
git gesamthaft darüber Auskunft, wie die einzelnen<br />
Konkursforderungen<br />
bestandes-, betrags- und rangmässig im Verfahren behandelt werden<br />
sollen. Er bringt deren Anerkennung oder Abweisung fomell<br />
zum Ausdruck. Ob eine<br />
Forderung privat- oder öffentlich-rechtlicher Natur ist, spielt keine Rolle.<br />
990. *Worin besteht der besondere Zweck des Kollokationsplans?<br />
Er ist die Basis der Zuteilung für die Verwertung, denn wird der Plan bestandskräftig<br />
ist er die<br />
bindende<br />
Grundlage für die Verteilung.<br />
99<strong>1.</strong> *Was ist in den Kollokationspan aufzunehmen?<br />
156
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- die grundpfandgesicherten Forderungen einschliesslich Dienstbarkeiten, Grundlasten<br />
und vorgemerkte persönliche Rechte ZGB 959, aber auch<br />
gesetzliche Vorkaufsrechte<br />
ZGB 68<strong>1.</strong> Überdies muss aus dem Plan hervorgehen, welche Lasten dem Erwerber des<br />
Grundstücks bei dessen Verwertung überbunden werden. (Auch im Konkurs wird für<br />
jedes einzelne Grundstück des Konkursiten bezüglich der dinglichen Lasten ein<br />
besonderes Lastenverzeichnis erstellt. Es bildet Bestandteil des Kollokationsplans. Im<br />
Konkurs werden die Lasten im Kollokationsverfahren bereinigt und nicht in einem<br />
eigenen Lastenbereinigungsverfahren wie in der Spezialexekution)<br />
- Die Faustpfandgesicherten Forderungen<br />
- Die ungesicherten Forderungen, rangmässig gegliedert nach den Konkursklassen,<br />
SchKG 219 IV: Als ungesichert gilt auch eine Forderung für die ein Drittpfand bestellt<br />
ist.<br />
(*also<br />
sonst alle eingegebenen Forderungen)<br />
9 92. *Was ist nicht in den Kollokationsplan aufzunehmen?<br />
Aussonderungeansprüche<br />
und Masseverbindlichkeiten. Jene werden im<br />
Aussonderungsverfahren abgeklärt, diese sind vorweg voll aus dem Bruttoerlös der Masse zu<br />
bezahlen.<br />
993. *Wer<br />
genehmigt den Kollokationsplan?<br />
Besteht<br />
ein Gläubigerausschuss muss der Kollokationsplan (samt den Lastenverzeichnissen)<br />
vorers t ihm zur Genehmigung unterbreitet werden, SchKG 247 III und IV.<br />
Ohne ausdrückliche Ermächtigung durch die Gläubigerversammlung darf der<br />
Gläubigerausschuss allerdings keine Rechte anerkennen, welche die Konkursverwaltung<br />
abgewiesen hat. Auf Grund seiner gesetzlichen Befugnisse kann allein er nur Widerspruch<br />
erheben gegen Zulassungsverfügungen SchKG 237 III Ziff. 4; er hat nur<br />
Abweisungskompetenz. Besteht kein Gläubigerausschuss kann der Kollokationsplan sofort<br />
nach seiner Erstellung aufgelegt und die Auflage öffentlich bekannt gemacht<br />
werden.<br />
994. Was wird alles mit dem Kollokationsplan öffentlich aufgelegt?<br />
Ausser<br />
dem abgeschlossenen Kollokationsplan werden die Belege sowie das Inventar der<br />
Konkursverwaltung beim Konkursamt aufgelegt.<br />
995. Wiso wird der Kollokationsplan mit allem<br />
aufgelegt?<br />
Damit<br />
jeder ihn einsehen kann und allenfalls eine Kollokationsklage vorbereiten kann,<br />
SchKG 249 I.<br />
996. Wieso muss<br />
das Inventar dem Kollokationsplan beigelegt werden?<br />
Damit<br />
die Gläubiger abschätzen können, ob sich angesichts des ausgewiesenen<br />
Konkurssubstrates ein Streit um die zu erwartenden Dividende überhaupt lohnt. Darum soll<br />
auch immer der vollständige Kollokationsplan aufgelegt werden.<br />
997. Wird die Auflegung bekanntgemacht?<br />
Ja,<br />
öffentlich, SchKG 249 II.<br />
998.<br />
*Erhalten die Gläubiger, deren Forderungen ganz oder teilweise abgewiesen<br />
wurden oder die nicht den beanspruchten Rang erhielten noch etwas<br />
Zusätzliches?<br />
157
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Ja, sie erhalten eine individuelle Anzeige der Auflage mit Angabe der Abweisung, des<br />
Abweisungsgrundes<br />
und der Anfechtungsfrist SchKG 249 III.<br />
999. Ab wann beginnt die Frist für die Anfechtung zu laufen?<br />
In dem Moment, wo der Kollokationsplan öffentlich aufgelegt wurde, SchKG 25<strong>1.</strong><br />
1000. Welche Möglichkeiten gibt es, um den Kollokationsplan zu ändern?<br />
- die Möglichkeit der Anfechtung des Plans mit Beschwerde oder Klage (steht nach<br />
Auflage des Plans offen)<br />
- Während der Anfechtungsfrist ist die Konkursverwaltung selbst befugt, ohne<br />
Anstoss<br />
der Betroffenen auf die im Kollokationsplan getroffenen Entscheidungen<br />
zurückzukommen (Selbstberichtigung).<br />
Liegt ein Beschwerdegrund vor, gelten hierfür<br />
die Regeln des Beschwerderechts. Handelt es sich um einen Klagegrund, besteht das<br />
Selbstberichtigungsrecht nur so lange, als noch keine Klage angehoben worden<br />
ist; nach<br />
Klageerhebung ist Selbstberichtigung nur noch zulässig, wenn die Konkursverwaltung<br />
den Willen zur Änderung schon vorher geäussert hat. <strong>Der</strong> Kollokationsplan ist nach<br />
einer solchen Änderung neu aufzulegen und die Auflage erneut zu publizieren.<br />
- Unabhängig von jeder Anfechtung kann bis zum Schluss des Konkursverfahrens eine<br />
verspätete Konkurseingabe die Abänderung des Kollokationsplans nötig machen; dabei<br />
muss es sich allerdings entweder um eine Erstmalige Eingabe handeln oder um einen<br />
Antrag auf Abänderung einer früheren, der auf echten nova beruht, SchKG 251 IV:<br />
- Darüber hinaus lässt schliesslich die Praxis zu, auf eine unangefochten gebliebene,<br />
rechtskräftig gewordene Kollokationsverfügung von Amtes wegen zurückzukommen<br />
o Wenn die Forderung offensichtlich zu unrecht oder falsch kolloziert worden<br />
ist<br />
o Wenn die Folgen einer Unterlassung wider gutzumachen sind<br />
o Oder wenn eine echte Nova die eine Revision erfordern<br />
100<strong>1.</strong> *Was stellt der Kollokationsplan dar (gemeint was beinhaltet er nicht<br />
inhaltlich<br />
sondern formell gesehen)/welche Möglichkeiten der Anfechtung<br />
des<br />
Kollokationsplans gibt es?<br />
<strong>Der</strong> Kollokationsplan stellt einen Komplex verfahrensrechtlicher Verfügungen der<br />
Konkursverwaltung dar, die zugleich die materiellen Rechte der Gläubiger und der<br />
Inhaber<br />
beschränkter dinglicher Rechte berühren. Deshalb unterliegt er der Anfechtung sowohl durch<br />
Beschwerde als auch durch gerichtliche Klage, je nach dem ob die Verletzung einer<br />
Verfahrensvorschrift gerügt oder der materiellrechtliche Inhalt einer Verfügung beanstandet<br />
wird.<br />
1002. Wann wird der Kollokationsplan rechtskräftig?<br />
Immer erst nach unbenütztem Ablauf der Anfechtungsfrist oder wenn über eine mittels<br />
Anfechtung<br />
beantragte Abänderung entgültig entschieden worden ist. *Werden z.B.<br />
verspätete Forderungen eingegeben, beginnt eine neue Frist nach Erstellung des neuen<br />
Kollokationsplans zu laufen. Beanstandungen bezügl. der neuen Forderungen sind dann<br />
möglich.<br />
1003. Wie lange beträgt die Anfechtungsfrist des Kollokationsplans für die Beschwerde<br />
und<br />
für die Klage?<br />
Für<br />
die Beschwerde beträgt sie 10 Tage, für die Klage 20 Tage. Beide Fristen laufen von der<br />
Veröffentlichung der Planauflage an.<br />
1004. Was sind die Gründe, bei welchen man den Kollokationsplan mit Beschwerde<br />
anfechten muss?<br />
158
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Ausschliesslich<br />
Verfahrensfehler bei der Erstellung des Plans, z.B. eine Forderung, die<br />
eingegeben wurde wird im Kollokationsplan einfach nicht aufgeführt (falls sie nicht<br />
zugelassen würde, müsste sie aber aufgeführt werden und begründet werden, wieso sie nicht<br />
zugelassen ist).<br />
1005. *Wer ist zur Beschwerde legitimiert?<br />
(Solche, die gerade<br />
nicht zur Klage legitimiert sind). Alle Beteiligten: die Gläubiger, der<br />
Konkursit,<br />
unter Umständen auch Dritte, insbesondere Aussonderungsberechtigte, z.B. ein<br />
Gläubiger, der ein Aussonderungsanspruch hat und<br />
sich als Konkursgläubiger wiederfindet.<br />
1006. Was muss mit dem Kollokationsplan gemacht werden, wenn er im<br />
Beschwerdeverfahren abgeändert werden muss?<br />
Er<br />
muss neu aufgelegt werden und die Neuauflage öffentlich bekannt gemacht werden.<br />
1007. Was bezweckt die Anfechtung des Kollokationsplans<br />
mit Klage?<br />
Es bezweckt immer die materiellrechtliche Überprüfung des Inhalts einer darin getroffenen<br />
Verfügung.<br />
Man beklagt sich über eine Verletzung des materiellen Rechts und verlangt, dass<br />
ihm bei der Kollokation Rechnung getragen werde.<br />
1008. *Was ist Gegenstand der Kollokationsklage?<br />
Mit der Klage wird die Frage zur Beurteilung gestellt,<br />
wie ein geltend gemachter Anspruch<br />
materiell<br />
richtig zu kollozieren sei und damit der Berechtigte im Verfahren einzustufen sei.<br />
Man verlangt die dem materiellen Recht entsprechende Teilnahme<br />
am Konkursergebnis.<br />
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Kollokation der eigenen oder einer fremden Forderung<br />
angefochten wird! Auch öffentlichrechtliche Forderungen werden mittels der<br />
Kollokationsklage bereinigt, sofern diese Klage nicht gesetzlich ausgeschlossen ist. In bereits<br />
hängigen Verwaltungsstreitverfahren kommt dagegen SchKG 207 II zur Anwendung.<br />
1009. *Was ist der wichtige Unterschied zur Anfechtung einer Forderung nach SchKG<br />
148 und SchKG 250?<br />
Nach<br />
SchKG 148 I kann nur die Forderung oder der Rang eines anderen Gläubigers mit<br />
Klage bestritten werden, die eigene Forderung des Gläubigers kann nur mit Beschwerde<br />
angefochten werden. Nach SchKG 250 muss sowohl der Gläubiger, der seine eigene<br />
Forderung anfechten will, sowie der Gläubiger, der die Forderung oder den Rang eines<br />
anderen anfechten will dies mittels Klage tun.<br />
1010. *Wer ist zur Klage legitimiert?<br />
Dem erweiterten Gegenstand der Kollokationsklage im Konkurs entsprechend ist die<br />
Legitimation<br />
anders geregelt als in der Pfändungsbetreibung:<br />
- Aktivlegitimation: Klageberechtigt ist<br />
jeder Inhaber eines Anspruchs, der im<br />
Kollokationsplan zu behandeln ist, also<br />
o Jeder Konkursgläubiger<br />
o Jeder Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechts oder eines vorgemerkten<br />
persönlichen Rechts, das nicht im beanspruchten Masse anerkannt worden ist.<br />
De m Konkursiten hingegen ist<br />
der Klageweg verschlossen! Er ist ausschliesslich<br />
auf die Beschwerde angewiesen.<br />
- Passivlegitimation:<br />
Die Klage richtet sich<br />
o entweder gegen die Konkursmasse, wenn der Kläger die Kollokation seiner<br />
eigenen Ansprüche beanstandet<br />
SchKG 250 I<br />
o oder gegen einen anderen Ansprecher,<br />
wenn der Kläger die Zulassung von<br />
dessen Ansprüchen anficht SchKG 250 II.<br />
159
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
101<strong>1.</strong> *W er ist Partei der Kollokationsklage/gleiche Frage,<br />
wie vorangehende?<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger,<br />
der gegen die Masse um seine eigene Kollokation kämpft oder<br />
- Bei d er W egweisungsklage der Gläubiger, der gegen einen anderen Gläubiger klagt, um<br />
diesen abzuweisen (beide Gkäubiger Parteien)<br />
1012. *Wofür ist der Streitwert einer Forderung wichtig?<br />
Hat jemand<br />
eine Forderung z.B. auf 10'000.- eingegeben und wurd dieser abgewiesenund<br />
klagt er, ist der Streitwert im Bezug auf das Rechtsmittel wichtig. Er kann<br />
schon für die erste<br />
Instanz<br />
eine Rolle spielen, aber vor allem ans Bger ist er wichtig: da die Kollokationsklage<br />
eine betreibungsrechtiche Klage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht ist, ist sie ans<br />
Bger berufungsfähig. Es sind aber nur solche Sachen berufungsfähig, die einen Streitwert von<br />
8000.- erreichen. Haben wir im vorliegenden Fall einen Streitwert in dieser Höhe? 10'000.kann<br />
weniger als 8000.- sein. Es kommt nicht auf diesen nominellen Betrag an, sondern beim<br />
Streitwert geht es um das, auf was ich hoffe: also um die zu erwartende Dividende. Z.B. also<br />
5% d.h. Streitwert sind nicht die 10'000.- sondern nur die 500.-, die man voraussichtlich als<br />
erwartende Dividende erlangen kann. Hier ist der Streitwert nichts formelles, sondern das,<br />
was man erhoffen kann.<br />
- bei der Anfechtung der eigenen Kollokation (SchKG 250 I) ist der Streitwert die<br />
Differenz der auf den Kläger entfallenden Dividende<br />
- bei der Anfechtung der Kollokation eines Konkurrenten berechnet sich diese Differenz<br />
auf der dem Beklagten<br />
zufallende Dividende<br />
1013. Was ist bezüglich eines Überschusses, wenn ein Gläubiger<br />
gegen Zulassung oder<br />
Rang des anderen Gläubigers klagt und gewinnt in der Spezialexekution anders<br />
als im Konkurs?<br />
Zwar<br />
wird bei beiden die Forderung aus dem Prozessgewinn getilgt (Lohn der Angst), doch<br />
im Konkurs fällt ein Überschuss, nach befriedigung des Klägers nicht wie in der<br />
Spezialexekution<br />
dem Beklagten zu, sonder er fällt zu Gunsten der übrigen Gläubiger in die<br />
Konkursmasse.<br />
1014. *In welchem Verfahren wird der Kollokationsprozess durchgeführt?<br />
<strong>Der</strong> Streit wird vor Gericht im beschleunigten Verfahren ausgetragen, SchKG 250 III.<br />
1015.<br />
In welcher Zeit muss die Klage eingereicht werden?<br />
Binnen 20 Tagen. Die Frist kann verlängert oder wiederhergestellt werden.<br />
1016.<br />
Wer hat im Kollokationsprozess die Beweislast?<br />
Sie obliegt immer der Partei, um deren Ansprüche es geht: bei der<br />
Klage nach SchKG 250 I<br />
trifft sie den Kläger, bei derjenigen nach SchKG 250 II den Beklagten.<br />
1017. Welche Wirkung hat das Urteil?<br />
Es wirkt nur im hängigen Verfahren. Einem Prozess ausserhalb des Konkursverfahrens stünde<br />
deshalb die Einrede der res iudicata nicht entgegen. Die Kollokationsklage<br />
ist demnach zwar<br />
eine<br />
konkursrechtliche Klage, aber mit Reflexwirkung auf das materielle Recht.<br />
1018. Wie wirkt sich ein Urteil aus, wenn die Klage gutgeheissen wird?<br />
Es wirkt sich verschieden aus, je nachdem, ob gegen die Masse oder gegen einen anderen<br />
Gläubiger geklagt wurde.<br />
- hat der Gläubiger nach SchKG 250 I wegen seiner eigenen Kollokation geklagt, so<br />
ändert das gutheissende Urteil den Kollokationsplan mit Wirkung für alle<br />
Gläubiger ab;<br />
160
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
die Mitgläubiger erleiden im Umfang des Prozessgewinns des Klägers<br />
verhältnismässige Kürzungen<br />
auf ihren Dividenden. Das Prozessergebnis wird im<br />
ursprünglichen Kollokationsplan vorgemerkt und bei der Verteilung berücksichtigt. <strong>Der</strong><br />
Plan muss neu aufgelegt werden. (Dem Mitgläubigern steht nur dann noch ein<br />
Bestreitungsrecht zu, auszuüben wiederum mit Beschwerde oder Kollokationsklage,<br />
wenn die Konkursverwaltung es nicht zum gerichtlichen Entscheid kommen lässt,<br />
sondern das Klagebegehren ganz oder z.T. anderkannt)<br />
- Hat hingegen ein Gläubiger nach SchKG 250 II wegen einer fremden Kollokation<br />
geklagt, so wirkt sich das gutheissende Urteil vorerst nur zwischen den Parteien aus. <strong>Der</strong><br />
obsiegende Kläger kann den Prozessgewinn – den Betrag, um den die Dividende des<br />
Beklagten herabgesetzt wird – bis zur vollen Deckung seiner<br />
Forderung und der<br />
Prozesskosten für sich beanspruchen. Erst ein allfälliger Überschuss wird dann,<br />
entsprechend dem berichtigten Kollokationsplan, unter die Gläubiger verteilt; er<br />
verbleibt also nicht dem Beklagten 250 III. Auch hier braucht der Kollokationsplan<br />
nicht noch einmal aufgelegt zu werden.<br />
1019. *Wann kann ein neuer Kollokationsplan grundsätzlich nur angefochten werden?<br />
Bei n achträglichen Eingaben einer Forderung. Die Kollokationsklage richtet sich ja gegen den<br />
von der Konkursverwaltung aufgestellten Kollokationsplan. Dieser wird darauf nicht formell<br />
vom<br />
Gericht, aber auf Grund von Anweisungen des Gerichtes abgeändert daher ist er<br />
gerichtlich abgesegnet und kann nicht mehr nach SchKG 250 angefochten werden. Das<br />
einzige, was man machen kann, wenn man mit dem Gerichtsentscheid nicht einverstanden ist,<br />
ein Rechtsmittel im Zivilprozess erreichen, natürlich muss dafür der Streitwert gegeben sein.<br />
1020. Kann das Urteil über die Kollokation ans BGer weiter gezogen werden?<br />
Da es eine betreibungsrechtliche Klage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht ist,<br />
unterliegt das letztinstanzliche Urteil bei gegebenen Voraussetzungen der Berufung und der<br />
Nichtigkeitsbeschwerde<br />
ans BGer.<br />
102<strong>1.</strong> *Was für eine Klageart ist die Kollokationsklage?<br />
Es ist eine Feststellungsklage (ich behaupte, ich habe eine Forderung, oder bestreite, dass der<br />
andere eine Forderung hat). Sie kann<br />
aber auch eine Gestaltungsklage sein, denn der<br />
Kollokationsplan<br />
wird geändert. (Nicht ganz typisch, da das Gericht den Plan nicht ändert<br />
sondern es Sache der Konkursverwaltung ist den Plan zu ändern).<br />
§47 Die Verwertung (von hier an, keine <strong>Vorlesung</strong>snotitzen mehr berücksichtigt)<br />
1022. Welche Rechtsnatur haben die vollstreckungsrechtlichen<br />
Verwertungsakte?<br />
Sie<br />
sind öffentlich-rechtliche Verfügungen. Daraus folgende Konsequenzen sind gleich wie<br />
bei der Spezialexekution:<br />
- wird die Verwertung ausnahmsweise Privaten übertragen, ist der Verkauf oder die<br />
Versteigerung privatrechtlicher Natur. Entsprechend währe hier die Verwertung nicht<br />
mit betreibungsrechtlicher Beschwerde sondern zivilrechtlich anfechtbar.<br />
- Abgesehen von besonderen<br />
Zusicherungen oder absichtlicher Täuschung, schliesst sie<br />
nicht nur die privatrechtliche Gewährleistung aus, sonder auch die privatrechtliche<br />
Anfechtung beim Zivilrichter. Die Verwertung kann somit nur mit<br />
betreibungsrechtlicher Beschwerde angefochten werden, wobei diese aber<br />
betreibungsrechtlich oder auch materiellrechtlich begründet sein kann<br />
1023.<br />
Wer ist für die Verwertung zuständig?<br />
161
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Die Konkursverwaltung,<br />
wie dabei vorzugehen ist bestimmt im ordentlichen<br />
Konkursverfahren<br />
in der Regel die Zweite Gläubigerversammlung.<br />
1024. In welchem Zeitpunkt darf verwertet werden?<br />
Grundsätzlich dürfen die Bestandteile der Aktivmasse erst verwertet werden, nachdem die<br />
zweite Gläubigerversammlung stattgefunden hat, da diese im Allgemeinen<br />
bestimmt wie zu<br />
verwerten<br />
ist. Dies gilt für bewegliche wie für unbewegliche Sachen.<br />
Vor dieser Versammlung dürfen vorgemommen werden:<br />
- Notverkauf, SchKG 243 III<br />
- Verwertung von Wertpapieren und Waren zum Börsen- oder Marktpreis<br />
1025. Was setzt die Verwertung von Grundstücken voraus?<br />
Die Verwertung von Grundstücken setzt voraus, dass die Lastenbereinigung im Rahmen des<br />
Kollokationsverfahrens durchgeführt worden ist und allfällige Kollokationsprozesse<br />
rechtskräftig<br />
erledigt sind (dies braucht es auch bei der dringlichen Verwertung, nur im Falle<br />
von „Überdringlichkeit“ (Ermessensfrage) kann die Aufsichtsbehörde<br />
die Verwertung ohne<br />
vorherige Lastenbereinigung bewilligen unter der Bedingung, dass dadurch keine berechtigten<br />
Interessen verletzt werden).<br />
1026. Muss bei der Verwertung von Fahrnis auch eine Bereinigung der Lasten<br />
vorgenommen werden?<br />
Nein, es kann auch verwertet werden, wenn daran bestehende Rechte (Pfandrechte) noch<br />
nicht<br />
bereinigt sein sollten, weil hier dem Erwerber keine Lasten überbunden werden, die auf<br />
die Bestimmung des Veräusserungswertes Einfluss haben könnten.<br />
1027. Wann wird die zweite Gläubigerversammlung einberufen?<br />
Sobald die Konkurseingaben geprüft sind, sowie der Kollokationsplan erstellt und aufgelegt<br />
SchKG 252.<br />
1028. Wie werden die Gläubiger zur zweiten Gläubigerversammlung<br />
einberufen?<br />
Von der Konkursverwaltung durch individuelle Einladung. Die Einladung muss mindestens<br />
20 Tage vor der<br />
Versammlung verschickt werden, SchKG 252 I.<br />
1029. Wer ist an der zweiten Gläubigerversammlung teilnahmeberechtigt?<br />
Alle Konkursgläubiger, deren Forderung nicht rechtskräftig abgewiesen ist, SchKG 252 I.<br />
Aussonderungsberechtigte und Massengläubiger werden dagegen nicht eingeladen.<br />
1030. Worin liegt der Unterschied zwischen erster und zweiter<br />
Gläubigerversammlung?<br />
- in der zeitlichen Folge<br />
- aber vor allem in ihrer Zusammensetzung, die 2. ist nun weniger zweifelhaft<br />
- in den Kompetenzen (wegen ihrer nun zuverlässigerer Zusammensetzung)<br />
- die Beschlüsse der ersten Gläubigerversammlung können mit Beschwerde innert 5<br />
Tagen bei der Aufsichtsbehörde<br />
geltend gemacht werden, SchKG 239. Die Beschlüsse<br />
der 2. Gläubigerversammlung können auch mit Beschwerde geltend gemacht werden,<br />
aber die Frist beträgt hier 10 Tage. Als Beschwerdegrund kann aber nur<br />
Rechtsverletzung, nicht auch Unangemessenheit angerufen werden.<br />
Jede weitere Versammlung nach der 2. Gläubigerversammlung stellt nichts weiter dar, als<br />
diese selbst, die erneut zu einer Verhandlung zusammentritt.<br />
103<strong>1.</strong> Wie kann die 2. Gläubigerversammlung wieder einberufen werden?<br />
162
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Siehe SchKG 255.<br />
1032. Wie ist die 2. Gläubigerversammlung strukturiert?<br />
Ein Mitglied der Konkursverwaltung führt in der Versammlung den Vorsitz; über<br />
Beschlussfähigkeit und Abstimmung gilt das Gleiche wie in der <strong>1.</strong> Gläubigerversammlung,<br />
SchKG<br />
252 III.<br />
1033. Was wird gemacht, wenn keine beschlussfähige Versammlung zustande<br />
kommt?<br />
Siehe SchKG 254.<br />
1034.<br />
Wie werden Beschlüsse, die der 2. Gläubigerversammlung vorbehalten sind<br />
gefasst, wenn diese nicht beschlussfähig ist?<br />
Sie müssen auf dem Zirkularweg gefasst werden, SchKG 255a. Ein Antrag gilt als<br />
angenommen,<br />
wenn die Mehrheit der mit Zirkularbeschwerde angesprochenen Gläubiger ihm<br />
innert der angesetzten Frist ausdrücklich oder stillschweigend zustimmt. Sind nicht alle<br />
Gläubiger bekannt, so kann die Konkursverwaltung ihre<br />
Anträge zudem öffentlich bekannt<br />
machen.<br />
1035. Welche Kompetenzen hat die 2. Gläubigerversammlung?<br />
Sie bestimmt das ganze Verfahren in einer die Konkursverwaltung bindenden Weise.<br />
Ihre Kompetenzen<br />
sind, SchKG 253:<br />
- einen umfassenden Bericht der Konkursverwaltung über den Gang der Verwaltung und<br />
über den Stand der Masse (Aktiven und Passiven) entgegenzunehmen<br />
- über die Bestätigung oder Neuwahl der Konkursverwaltung und des<br />
Gläubigerausschusses zu beschliessen oder ein solches Organ allenfalls<br />
erst einzusetzen<br />
- „unbeschränkt“ alles Weitere für die Durchführung des Konkurses anzuordnen<br />
- über einen vorgeschlagenen Nachlassvertrag zu verhandeln, muss schon<br />
in der<br />
Einladung angemerkt sein.<br />
1036. Was ist unter „unbeschränkt“ alles Weitere für die Durchführung des Konkurses<br />
in SchKG 253 II gemeint?<br />
z.B. die Vornahme eines Freihandverkaufs,<br />
der Verzicht auf die Geltendmachung von<br />
Rechtsansprüchen<br />
der Masse, Beschluss über die Weiterführung eines eingestellten<br />
Prozesses…<br />
1037. Wieso ist man im Konkurs bei der Wahl der Verwertungsarten viel freier als<br />
in<br />
der Spezialexekution?<br />
Weil alle Gläubiger<br />
gemeinsam über die ihnen gutscheinende Art der Verwertung befinden<br />
können.<br />
1038. Welche Verwertungsarten<br />
kommen im Konkurs zum Zug?<br />
- die öffentliche Versteigerung<br />
- der Freihandverkauf<br />
- die „Abtretung von Rechtsansprüchen“<br />
- die Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen sowie<br />
andere Rechte<br />
1039. Wann werden im Konkurs<br />
die Vermögenswerte öffentlich versteigert?<br />
Wen n die 2. Gläubigerversammlung nichts anderes<br />
beschliesst, SchKG 256 I.<br />
1040.<br />
Wie wird die Versteigerung im Konkurs vorbereitet und durchgeführt?<br />
163
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Vorbereitung: die Konkursverwaltung hat die Steigerung vorzubereiten. Sie<br />
setzt die<br />
Steigerungsbedingungen fest und erlässt die Steigerungspublikation, SchKG 257 I.<br />
Verwertung von Grundstücken muss mindestens einen Monat vorher bekannt gemacht<br />
werdenzudem werden die Steigerungsbedingungen samt Lastenverzeichnis auf dem<br />
Konkursamt zur Einsicht aufgelegt; dies auch, wo eine ausseramtliche<br />
Konkursverwaltung eingesetzt ist.<br />
Eine individuelle Mitteilung der Steigerung erhalten im Konkurs nur die<br />
Grundpfandgläubiger und diejenigen Gläubiger, denen die Grundpfandtitel<br />
verpfändet<br />
sind, SchKG 257 III, sowie Inhaber von<br />
gesetzlichen Vorkaufsrechten.<br />
- Durchführung:Weitgehend gleich wie in der Spezialexekution (Verweis in<br />
SchKG 258<br />
II und 259). Doch gilt im Konkurs das Deckungsprinzip nicht! Im Konkurs wird also<br />
immer nach dreimaligem Aufruf dem Meistbietenden zugeschlagen SchKG<br />
258 I.<br />
Es gilt aber auch im Konkurs im Interesse der Grundpfandgläubiger das Prinzip des<br />
doppelten Aufrufs, SchKG 258 II i.V.m. 142.<br />
Sonst ist es genau das Gleiche wie in der Spezialexekution, so hinsichtlich:<br />
o Lastenüberbindung bei Grundstücken, SchKG 135 (Beibehaltung des<br />
Konkursiten aber hier nicht möglich, wegen der Generalliquidation der<br />
Passiven)<br />
o Mindestzuschlagpreis von Edelmetallen, SchKG 128<br />
o Zahlungsmodalitäten (Zahlungstermin, Bahrzahlung, Zahlungsverzug, SchKG<br />
129, 136, 137<br />
und 143)<br />
o Bewilligung nach BewG oder BGBB für den Grundstückserwerb<br />
o Eigentumsübergang<br />
104<strong>1.</strong> Kann dennoch im Konkurs ein Mindestpreis für die Versteigerung festgelegt<br />
werde n?<br />
Ja, auf Grund eines Gläubigerbeschlusses, SchKG 258 II. Kommt aber nach gescheiterter<br />
Steigerung auch kein Freihandverkauf zu diesem Preis zustande, muss in einer folgenden,<br />
zweiten Steigerung ohne diese Beschränkung zugeschlagen werden. Somit ist das<br />
Mindestgebot hier nicht vergleichbar mit dem Mindestgebot nich der Spezialexekution.<br />
1042. Wieso gilt im Konkurs das Deckungsprinzip nicht?<br />
Weil da das ganze Vermögen des Schuldners liquidiert wird und es dem zuwiederlaufen<br />
würde,<br />
wenn man einzelne Gegenstände nicht verwerten könnte, nur weil das Mindestgebot<br />
nicht gemacht wurde.<br />
1043. In welchen Fällen kann im Konkurs ein Freihandverkauf vorgenommen werden?<br />
Er wird zugelassen:<br />
- als Notverkauf, SchKG 243 II<br />
- wenn Wertpapiere oder andere Sachen mit einem Markt- oder Börsenpreis sofort<br />
günstig verwertet<br />
werden können, SchKG 243 II<br />
- überdies und vor allem, wenn immer<br />
es die 2. Gläubigerversammlung beschliesst und<br />
die Pfandgläubiger hinsichtlich der Pfandgegenstände damit einverstanden sind, SchKG<br />
156 I/II.<br />
Selbst auf Beschluss der Gläubigerversammlung hin dürfen Gegenstände von bedeutendem<br />
Wert oder Grundstücke aber erst dann freihändig verkauft werden, wenn allen Gläubigern<br />
Gelegenheit geboten wurde, den in Aussicht genommenen Preis zu überbieten SchKG 256 III.<br />
1044. Wie wird der Freihandverkauf im Konkurs durchgeführt?<br />
164
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Soweit<br />
möglich sind die für die Versteigerung geltenden Regeln analog anzuwenden. <strong>Der</strong><br />
Eigentumserwerb erfolgt durch die zu protokollierende Verfügung des Konkursamtes oder der<br />
Konkursverwaltung, mit welcher das Grundstück dem Anbieter zugewiesen wird. Sonst wird<br />
er gleich abgewickelt wie in der Spezialexekution für bewegliche Sachen (! Dort braucht es<br />
dafür auch das Deckungsprinzip).<br />
1045. Wie wird die Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen sowie<br />
anderer Rechte durchgeführt?<br />
Gleich wie in der Pfändungsbetreibung.<br />
1046. *Welche Funktion hat die praktisch<br />
sehr relevante Verwertungsart: „die<br />
Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse“?<br />
(Wertpapiere, die an der Börse oder auf dem ausserbörslichen Markt gehandelt werden,<br />
sond<br />
zum Bö rsen- oder Marktpreis zu versilbern SchKG 243 II. Unbestrittene fällige Guthaben, die<br />
sich in der Konkursmasse befinden, hat die Konkursverwaltung beim Drittschuldner<br />
einzuziehen (SchKG 243 I); sie brauchen nicht andersweitig verwertet zu werden).<br />
Nichtfällige, streitige oder sonst nur schwer einbringliche Forderungen können nicht ohne<br />
weiteres eingezogen werden, da deren Eintreibung auf dem Rechtsweg oft mit beträchtlichem<br />
Aufwand und Risiken verbunden wäre.<br />
Solche illiquiden Ansprüche des Schuldners durch Versteigerung oder Verkauf zu verwerten,<br />
wäre meist unzweckmässig, weil kaum jemand<br />
so etwas kauft und daher kaum ein<br />
befriedigendes Ereignis erwartet werden könnte. Solchen Forderungen dient die „Abtretung“.<br />
1047. *Welches ist die Komponente zur „Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse“<br />
nach SchKG 260 I in der Spezialexekution?<br />
Die Übernahme einer gepfändeten Forderung zur Eintreibung nach SchKG 131 II. Die<br />
Abtretung spielt aber in der Generalexekution, wo das ganze<br />
Vermögen des Schuldners zu<br />
liquidieren ist eine viel grössere Rolle als in der Spezialexekution, wo die illiquiden<br />
Ansprüche ohne hin nur in letzter Linie gepfändet werden.<br />
1048. *Werden bei der Abtretung von Rechtsansprüchen<br />
nach SchKG 260 materielle<br />
Rechtsansprüche aus der Konkursmasse ausgeschieden und abgetreten, wie im<br />
Fall einer Zession?<br />
Nein! Es wird nur die Kompetenz, die Rechte geltend zu machen, auf einen Konkursgläubiger<br />
übertragen. Es handelt sich somit nicht um eine Zession im zivilrechtlichen Sinn, sondern um<br />
eine vollstreckungsrechtliche Liquidationsmassnahme, die anstelle der eigentlilchen<br />
Verwertung treten kann.<br />
1049. *Was ist Gegenstand<br />
der „Abtretung“?<br />
Eigentlich<br />
nur das Prozessführungsrecht, für den „abgetretenen Anspruch“. <strong>Der</strong><br />
Anspruchsgläubiger wird ermächtigt, anstelle der Masse<br />
einen allfälligen Prozess um den<br />
Anspruch zu führen.<br />
1050. Für welche Rechtsansprüche<br />
ist diese „Abtretung“ nach SchKG 260 möglich?<br />
Das<br />
können grundsätzlich sämtliche Vermögensrechte sein, die Bestandteil der Konkursmasse<br />
bilden, aber auch Ansprüche, die der Masse originär zustehen (z.B. Anfechtungsansprüche<br />
und Masseforderungen).<br />
Unter dem Begriff „Rechtsanspruch sind nicht nur zweifelhafte Aktiven zu verstehen, sondern<br />
auch blosse Bestreitungsrechte<br />
zur Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die<br />
Konkursmasse; in diesem Fall dient die Abtretung nicht eigentlich der Verwertung, sondern<br />
der Aktiven- oder Passivenbereinigung.<br />
165
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
105<strong>1.</strong> *Welches sind Beispiele für aktive<br />
Rechtsansprüche (zweifelhafte Aktiven), die<br />
mit der „Abtretung“ nach SchKG 260 geltend gemacht werden können?<br />
- vor allem bestrittene Forderungen und andere zivilrechtliche Ansprüche, die zur<br />
Konkursmasse<br />
gehören<br />
o Die Herabsetzungsklage im Erbrecht nach 524 ZGB, wenn der Schuldner<br />
diese<br />
nicht selbst auf Bitte der Gläubiger mit Verlustschein oder der<br />
Konkursverwaltung anstrebt<br />
- bestrittenen Admassierungsansprüche<br />
- alle zur Masse gehörenden Anfechtungsansprüche<br />
o Ansprüche aus der paulianischen<br />
Anfechtung, SchKG 285ff; für diese ist die<br />
Abtretung sogar die einzig zulässige Verwertungsart,<br />
SchKG 256 IV<br />
o Ansprüche aus Verrechnungsanfechtung, SchKG 214<br />
- Im öffentlichen Recht begründete Ansprüche<br />
- Forderungen des Konkursiten, die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung<br />
bereits<br />
Gegenstand eines Verfahrens bildeten SchKG 207, wenn die Gläubiger auf die<br />
Weiterführung des Verfahrens verzichten<br />
1052. *Welches sind Beispiele der passiven Ansprüche<br />
für eine „Abtretung“ nach<br />
SchKG 260?<br />
Diese umfassen alle auf Abwehr eines gegen die Konkursmasse erhobenen Anspruchs<br />
gerichteten Rechte, namentlich die Ablehnung<br />
- eines Aussonderungsanspruchs<br />
- einer bei Konkurseröffnung bereits im Prozess<br />
liegenden Konkursforderung, SchKG<br />
207, auch einer öffentlich. Rechtlichen;<br />
der Abtretungsgläubiger tritt dann als<br />
Prozesspartei in das hängige Verfahren ein<br />
- eine Msseverbindlichkeit<br />
Da is t dann nie die Masse Beklagt, sonder nur der Abtretungsgläubiger<br />
1053. * Welches sind die formellen Voraussetzungen für die „Abtretung“<br />
nach SchKG<br />
260?<br />
- (es muss materiell überhaupt ein abtretbarer Anspruch vorhanden sein)<br />
- Verzicht der Gesamtheit der Gläubiger auf Geltendmachung des Anspruchs<br />
- Ein Abtretungsbegehren (es kann an der Gläubigerversammlung selbst oder<br />
bis 10 Tage<br />
danach gestellt werden/Wird ein streitiger Anspruch erst später entdeckt kann das<br />
Abtretungsverfahren sogar noch nach Abschluss des Konkursverfahrens eingeleitet<br />
werden, SchKG 269)<br />
- Des legitimierten Gläubigers<br />
- Eine Abtretungsverfügung<br />
der Konkursverwaltung (wenn der Anspruch erst nach<br />
Schluss des Konkurses zum Vorschein<br />
kommt, verfügt das Konkursamt)<br />
1054. *Wie viele Gläubiger müssen zustimmen, dass das Erfordernis der „ Gesamtheit<br />
der Gläubiger“ gegeben ist, beim Verzicht auf die Geltendmachung des<br />
Anspruchs?<br />
Das erfordert nicht Einstimmigkeit; es genügt vielmehr schon ein Mehrheitsbeschluss<br />
der<br />
Zweiten Gläubigerversammlungoder durch Zirkular. Dabei ist unerlässlich, dass alle<br />
Gläubiger Gelegenheit erhalten, zur Frage des Verzichts Stellung zu nehmen; eine Abtretung<br />
währe sonst nichtig.<br />
1055. Wer ist zum<br />
Abtretungsbegehren legitimiert?<br />
166
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Jeder Konkursgläubiger, der im Kollokationsplan – sei es auch nur pro memoria, da seine<br />
Forderung Gegenstand eines Prozesses ist – berücksichtigt worden ist. Selbst einem<br />
abgewiesenen Gläubiger, darf wenigstens eine bedingte Abtretung nicht verwehrt werden,<br />
sofer er den Entscheid rechtzeitig mit Beschwerde oder Kollokationsklage angefochten hat.<br />
Wird seinem Begehren entsprochen, so wird die Abtretung unbedingt, wird es abgewiesen,<br />
fällt sie dahin. Auch ein Gläubiger, der seine Forderung verspätet angebracht hat, kann noch<br />
die Abtretung verlangen.<br />
1056.<br />
Wer ist nicht legitimiert die Abtretung zu verlangen?<br />
Ein Konkursgläubiger, gegen den sich der abzutretende Anspruch richtet.<br />
1057.<br />
*Können auch mehrere Gläubiger zusammen den Abtretungsantrag stellen?<br />
Ja.<br />
1058.<br />
*Müssen alle Gläubiger, die zusammen den Abtretungsantrag gestellt haben<br />
immer zusammen handeln?<br />
Nein, e s steht jedem einzelnen frei, ob er prozedieren will. Jedoch bilden die Prozesswilligen<br />
im Falle eines gerichtlichen Vorgehens nach Bundesrecht eine notwendige<br />
Streitgenossenschaft, in dem Sinne, dass sie den ihnen von der Masse abgetretenen<br />
Anspruch<br />
in einem einheitlichen Verfahren geltend machen müssen, das ein einheitliches Urteil erlaubt.<br />
(Notwendige Streitgenossen sind sie bei einheitlichem Sachentscheid, d.h. es muss<br />
notwendigerweise ein einheitlicher Sachentscheid ergehen/Unterschied zu einfache<br />
Streitgenossen).<br />
1059.<br />
Welchen Rechtsbehelf kann man gegen die Abtretungsverfügung machen?<br />
Eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Damit kann ein Gläubier beanstanden, dass die<br />
Voraussetzungen zur Abtretung fehlten.<br />
1060.<br />
Darf der Zivilrichter die betreibungsrechtliche Gültigkeit der Abtretung, wenn es<br />
zum Prozess um den abgetretenen Anspruch kommt überprüfen?<br />
Nein, Nichtigkeit<br />
vorbehalten.<br />
106<strong>1.</strong><br />
Was sind die unmittelbaren Wirkungen der „Abtretung“ nach SchKG 260?<br />
- Prozessführungsrecht (auf Eintreibung oder Abwehr) geht auf den Abtretungsgläubiger<br />
über, die Konkursverwaltung ist dazu nicht mehr befugt; ohne Zustummung des<br />
Abtretungsgläubigers dürfte die den Anspruch auch nicht mehr im wahren Sinn<br />
verwerten. Es ist ausschliesslich Sache des Abtretungsgläubigers, den streitigen<br />
Anspruch anstelle der Masse mit allen rechtlichen Mitteln, offensiv oder defensiv,<br />
geltend zu machen. Zu diesem Zweck muss die Konkursverwaltung ihm alle dienlichen<br />
Unterlagen aushändigen<br />
- Die Abtretung ändert an der<br />
materiellen Rechtslage nichts.<br />
o <strong>Der</strong> debitor cessus kann deshalb weiterhin befreiend<br />
an die Masse leisten,<br />
womit die Abtretung gegenstandslos wird<br />
o Für den Abtretungsgläubiger ändert sich materiellrechtlich<br />
nichts, er nimmt<br />
nach wie vor am Konkurs und am Verwertungsergebnis teil, bleiben seine<br />
Bemühungen erfolglos hat er dennoch Anspruch auf seine Konkursdividende<br />
- Debitor cessus<br />
ist gegenüber dem Abtretungsgläubiger auf bestimmte Einreden<br />
beschränkt, nämlich die gegenüber dem Konkursiten und die gegenüber der Masse<br />
1062.<br />
Auf welche Einreden ist der debitor cessus im Verfahren gegenüber dem<br />
Abtretungsgläubiger beschränkt?<br />
167
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Auf solche, die er gegenüber dem Konkursiten und der Masse besitzt. Er kann keine Einreden<br />
gegenüber dem Abtretungsgläubiger persönlich<br />
geltend machen, auch kann er die<br />
Konkursforderung desselben oder die Kollokationsverfügung darüber nicht in Frage stellen;<br />
auch die betreibungsrechtliche Gültigkeit der Abtretung selber kann er nicht bestreiten,<br />
da<br />
dies ja nur mit Beschwerde möglich war.<br />
1063. Kann das abgetretenen Verfolgungs-<br />
oder Verteidigungsrecht als selbständiges<br />
Recht von der Konkursforderung des Abtretungsgläubigers losgelöst und weiter<br />
übertragen werden?<br />
Nein, es<br />
ist an die Konkursforderung des Abtretungsgläubigers gebunden. Als Nebenrecht<br />
geht es aber mit der Konkursforderung auf einen Singular- oder<br />
Universalsukzessor über.<br />
1064. *Welche mittelbare Wirkung hat die „Abtretung“ eines Rechtsanspruchs nach<br />
SchKG 260?<br />
- <strong>Der</strong> Abtretungsgläubiger kann und muss nun handeln: d.h. den ihm abgetretenen<br />
Rechtsanspruch geltend machen. Vorgehensweise ist ihm freigestellt. Er kann z.B. auch<br />
auf die Prozessführung verzichten, die Klage zurückziehen und mit der Gegenpartei<br />
einen gerichtlichen oder aussergerichtlichen Vergleich abschliessen. Er ist nicht<br />
verpflichtet die Interessen der anderen Gläubiger zu wahren! Er kann das machen, was<br />
der Deckung seines individuellen Anspruchs am besten dient.<br />
- <strong>Der</strong> Abtretungsgläubiger handelt auf eigene Gefahr und in erster Linie auch zu eigenem<br />
Nutzen, darum auch in seinem eigenen Namen<br />
- Die Kosten eines verlorenen Prozesses gehen wie alle Kosten erfolgloser<br />
Rechtsverfolgung zu Lasten des Abtretungsgläubigers<br />
- <strong>Der</strong> Abtretungsgläubiger haftet der Masse für allen Schaden, den er verschuldet<br />
z.B,<br />
indem er den Anspruch, den er verfolgen soll verjähren lässt…, da dadurch die Masse<br />
das Recht verlöre, den Ansüruch allenfalls doch noch als bestrittenes Recht zu<br />
verwerten<br />
- <strong>Der</strong> Abtretungsgläubiger hat aber vor allen übrigen Gläubigern, die auf die<br />
Geltendmachung<br />
des abgetretenen Rechts verzichtet haben, Anspruch auf das positive<br />
Ergebnis, insbesondere auf den Prozessgewinn. Er kann das eingebrachte bis<br />
zur vollen<br />
Deckung der ihm erwachsenen Kosten und seiner eigenen Konkursforderung brauchen.<br />
Nur ein allfälliger Überschuss verbleibt der Masse.<br />
1065. Haben alle Abtretungsgläubiger (bei mehreren) Anspruch auf vorzugsweise<br />
Befriedigung aus einem positiven Ergebnis?<br />
Nein, nur die, die wirklich gehandelt haben; das Ergebnis wird dann nach dem unter ihnen<br />
bestehenden<br />
Rangverhältnis verteilt, SchKG 219.<br />
1066. Was passiert, wenn der Prozessgewinn der<br />
Abtretungsgläubiger in einer Sache<br />
besteht?<br />
Dann muss diese abgeliefert und vorerst von der Konkursverwaltung verwertet werden. Erst<br />
der daraus erziehlte Erlös wird daraufhin nach SchKG 260 II verteilt.<br />
1067. Ist das Recht zur Eintreibung der Forderung des Abtretungsgläubigers<br />
befristet?<br />
Da<br />
die Abtretung des Prozessführungsrechts eine konkursrechtliche Liquidationsmassnahme<br />
darstellt und somit einen Bestandteil des Vollstreckungsverfahrens bildet, das binnen<br />
absehbarer Zeit beendigt werden muss, kann sie nicht unbeschränkt lange dauern. Deshalb<br />
wird sie indirekt befristet, indem die Konkursverwaltung dem Abtretungsgläubiger eine<br />
angemessene Frist zur Anhebung der Klage ansetzt.<br />
168
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1068. Was ist, wenn der Abtretungsgläubiger die Frist, die ihm die Konkursverwaltung<br />
zur Geltendmachung seines Anspruchs setzt<br />
unbenützt verstreichen lässt?<br />
Dann<br />
ist die Konkursverwaltung befugt, die Abtretung zu wiederrufen. Solange sie das aber<br />
nicht ausdrücklich tut, gilt die Frist jeweils als stillschweigend verlängert.<br />
1069. Wann kann die Konkursverwaltung die Frist schon vor deren Ablauf<br />
widerrufen?<br />
Wenn<br />
der Dritte, den streitigen Anspruch erfüllt, bevor der Abtretungsgläubiger Schritte zur<br />
Eintreibung unternommen hat; da dadurch die Abtretung gegenstandslos wird. Erweise<br />
sich<br />
allerdings, dass die Tatsache der Abtretung für die Leistung kausal war, kann dem<br />
Abtretungsgläubiger nach Treu und Glauben seinen Gewinn nicht genommen werden.<br />
1070. Wann verliert die Abtretung ihre Wirkung weiter?<br />
Wenn der Konkurs widerrufen oder eingestellt wird.<br />
107<strong>1.</strong> *Was geschieht, wenn kein Gläubiger die Abtretung des Anspruchs verlangt, auf<br />
dessen Geltendmachung die Mehrheit der Gläubiger<br />
verzichtet hat, oder wenn<br />
die Abtretung widerrufen wird?<br />
Selber darf ja die Konkursverwaltung den Anspruch nicht geltend machen, weil die<br />
Gesamtgläubigerschaft<br />
gerade das Gegenteil beschlossen hat.<br />
Sie kann dann versuchen, den Anspruch doch noch zu versteigern oder freihändig zu<br />
verkaufen, SchKG 260 III; nur paulianische Anfechtungsansprüche dürfen nicht<br />
weiterveräussert werden, SchKG 256 IV.<br />
1072. *Was passiert, wenn die Verwertung des Anspruchs nicht gelingt?<br />
Dann fällt das Verfügungsrecht darüber von<br />
der Masse auf den Konkursiten zurück: der<br />
Konkursbeschlag<br />
an diesem Anspruch erlischt.<br />
1073. *Was kann nun ein Schuldner mit seiner bestrittenen Forderung machen, die<br />
an<br />
ihn zurückgefallen ist?<br />
Er<br />
kann eine Betreibung einleiten.<br />
Was macht er, wenn der Gläubiger Rechtsvorschlag erhebt und der Schuldner nichts in der<br />
Hand hat?<br />
Er muss eine Anerkennungsklage machen,<br />
er hat aber kein Geld, man muss aber einen<br />
Kostenvorschuss gewähren. Was macht er?<br />
Er stellt ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung.<br />
Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?<br />
- Armut<br />
- Erfolgsaussicht: fumus boni iuris<br />
Ist das gegeben, kann er seine Forderung geltend machen.<br />
§ 48 Die<br />
Verteilung<br />
1074.<br />
Wird die Verteilung auf Antrag eines Gläubigers vorgenommen?<br />
Nein, sie wird von der<br />
Konkursverwaltung von Amtes wegen durchgeführt.<br />
1075. Wann darf die Schlussverteilung stattfinden?<br />
Wenn sowohl die Aktiv- wie auch die Passivmasse bereinigt und rechtskräftig<br />
festgestellt<br />
sind,<br />
also nach rechtskräftiger Erledigung allfälliger Aussonderungs-, Admassierungs- oder<br />
Kollokationsstreitigkeiten, SchKG 26<strong>1.</strong> Zudem muss der<br />
Erlös der gesamten Aktivmasse<br />
eingegangen sein.<br />
169
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1076. Können gewisse Zahlungen trotzdem schon bevor die Erfordernisse von SchKG<br />
261 erfüllt sind stattfinden?<br />
Unter gewissen Bedingungen<br />
dürfen provisorische Abschlagszahlungen vorgenommen<br />
werden.<br />
1077. Was muss vom eingegangenen<br />
Gesamterlös (Bruttoergebnis) vorweg bezahlt<br />
werden?<br />
Die Masseverbindlichkeiten<br />
(Beispiele für Masseverbundlichkeiten, SchKG 262).<br />
1078. Was ist das Merkmal, das (fast alle) Masseverbindlichkeiten aufweisen?<br />
Sie haben ihren Entstehungsgrund nach der Konkurseröffnung und verpflichten nicht den<br />
Konkursiten, sondern die Konkursmasse selber. Die einzige Ausnahme davon sind<br />
Verbindlichkeiten,<br />
die zulässigerweise während einer Nachlassstundung eingegangen werden;<br />
kommt es da nachträglich trotzdem zum Konkurs, so sind sie in demselben (obwohl vor<br />
Konkurseröffnung begründet) als Masseverbindlichkeit zu berücksichtigen.<br />
1079. Was fällt alles unter die Masseverbindlichkeiten?<br />
- die Massekosten, d.h. die aus der Eröffnung und Durchführung des Konkurses<br />
erwachsenen Verfahrenskosten (glaube: die, die den am Verfahren direkt<br />
beteiligten<br />
zustehen: die Auslagen und Gebühren des Konkursamtes wie auch die Entschädigung<br />
einer ausseramtlichen Konkursverwaltung)<br />
- die Masseschulden, die während des Konkurses zu Lasten der Masse eingegangenen<br />
Verbindlichkeiten (z.B. Anwalts- und Expertenhonorare, Steuern (v.a. Mehrwertssteuer,<br />
die bei der Verwertung eines Grundstückes anfällt), Verpflichtungen des Konkursiten,<br />
die die Masse realiter erfüllen will sowie entsprechende<br />
Sicherheitsleistund, SchKG<br />
211)<br />
1080. Gehören die Masseverbindlichkeiten in den Kollokationsplan?<br />
Nein,<br />
da sie vorweg zu begleichen sind.<br />
108<strong>1.</strong><br />
Was macht man, wenn man merkt, dass mangels genügender Aktiven nicht<br />
einmal der Bruttoerlös die Masseverbindlichkeiten deckt?<br />
Dann ist der Konkurs rechtzeitig einzustellen,<br />
SchKG 230.<br />
1082. Was macht man, wenn sich erst nach der Verwertung ergibt, dass der<br />
Bruttoerlös nicht zur Deckung aller Masseverbindlichkeiten ausreicht?<br />
Dann wird der Bruttoerlös nach der Praxis in folgender Reihenfolge<br />
verwendet:<br />
- vorab für die Auslagen der Konkursverwaltung<br />
- dann zur Bezahlung der Masseschulden<br />
- zuletzt<br />
für die Gebühren sowie die Entschädigung der Konkursverwaltung<br />
1083. Dürfen aus dem Erlös der Pfandgegenstände,<br />
er ja auch zur Aktivmasse gehört<br />
auch alle Masseverbindlichkeiten abgezogen<br />
werden?<br />
Nein! Eine Sonderregelung. Mit Rücksicht auf den Deckungsanspruch (da es ja schon<br />
kein<br />
Deckungsprinzip<br />
gibt) dürfen auf den Pfanderlös nur die Kosten ihrer Inventur, Verwaltung<br />
und Verwertung verlangt werden, also keine Kosten, die das übrige Massevermögen betreffen<br />
und daher von den nicht pfandgesicherten Gläubigern zu tragen sind,<br />
SchKG 262 II.<br />
1084. Wer entscheidet im Streitfall, ob man es mit einer Masseverbindlichkeit oder mit<br />
einer Konkursforderung zu tun hat?<br />
170
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
<strong>Der</strong> Zivilrichter, oder für öffentlich – rechtliche Forderungen – die zuständige<br />
Verwaltungsjustizbehörde: der daran interessierte Gläubiger muss dann mit einer<br />
Leistungsklage<br />
(auf Zahlung) gegen die Konkursmasse vorgehen.<br />
1085. Was bildet am Schluss den zur Verteilung<br />
an die Konkursgläubiger bestimmten<br />
Reinerlös?<br />
Was nach Tilgung der Messeverbindlichkeiten noch übrig bleibt und nachdem noch<br />
die<br />
allgemeinen Kosten abgezogen wurden.<br />
1086. Wann stellt die Konkursverwaltung die Verteilungsliste und die Schlussrechnung<br />
auf?<br />
Nach Ermittlung des Reinerlöses.<br />
1087.<br />
Wie lange liegen die Verteilungsliste und die Schlussrechnung beim Konkursamt<br />
auf?<br />
Während 10 Tagen, SchKG 263.<br />
1088.<br />
Mit welchem Rechtsbehelf können die Verteilungsliste und die Schlussrechnung<br />
angefochten werden?<br />
Während der Auflagefrist mit Beschwerde.<br />
1089.<br />
Worauf basiert die Verteilungsliste, über was gibt sie Auskunft?<br />
Sie basiert auf dem rechtskräftigen Kollokationsplan. Sie gibt Aufschluss darüber, welche<br />
Anteile am Reinerlös auf jede einzelne<br />
Konkursforderung entfallen.<br />
1090.<br />
Was enthält die Schlussrechnung?<br />
Sie enthält die Gesamtabrechnung über den Konkurs, sie stellt alle Einnahmen<br />
und Ausgaben<br />
einander gegenüber.<br />
109<strong>1.</strong><br />
Wann wir die Verteilung durchgeführt?<br />
Nach unbenütztem Ablauf der Anfechtungsfrist<br />
oder nach rechtskräftiger Erledigung<br />
allfälliger Beschwerden, SchKG 264.<br />
1092.<br />
Was wird bei der Verteilung noch nicht ausgezahlt?<br />
Anteile, die auf Forderungen unter Aufschiebender Bedingung, OR 151, oder mit ungewisser<br />
Verfallzeit, sowie auf Sicherheitsleistung entfallen, diese werden bei der Depositenanstalt<br />
hinterlegt, SchKG 164 III.<br />
1093. Was ist eine Abschlagsverteilung?<br />
Das ist eine vorzeitige, wenn auch nur provisorische Verteilung.<br />
1094. Wer ist zur Anordnung<br />
einer solchen Abschlagsverteilung zuständig?<br />
<strong>Der</strong><br />
Gläubigerausschuss, wo ein solcher besteht, andernfalls entscheidet die<br />
Konkursverwaltung.<br />
1095.<br />
Unter welchen Voraussetzungen dürfen Abschlagsverteilungen nur<br />
vorgenommen werden?<br />
- Ganz allgemein muss Gewähr dafür bestehen, dass keine Beeinträchtigung<br />
des<br />
Endergebnisses zu befürchten ist. Man muss<br />
dem Deckungserfordernis für die<br />
Masseverbindlichkeiten und für die Konkursforderungen vorrangiger Gläubiger<br />
Rechnung tragen.<br />
171
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Die Frist zur Anfechtung des Kollokationsplans muss abgelaufen sein, SchKG<br />
266 I,<br />
denn Abschlagszahlungen dürfen nur auf rechtskräftig kollizierte Forderungen<br />
ausgezahlt werden<br />
- Die Konkursverwaltung muss noch eine provisorische Verteilungsliste beim<br />
Konkursamt auflegen, wer etwas zu beanstanden hat, muss sich schon über diese<br />
provisorische Liste beschweren, nicht erst über die definitive. Bevor diese provisorische<br />
Verteilungsliste in Rechtskraft tritt, darf nichts Verteilt werden.<br />
Auf verspätet<br />
angemeldete Forderungen werden früher vorgenommene<br />
Abschlagsverteilungen nicht<br />
nachgezahlt SchKG 251 III.<br />
1096. Wo sind Abschlagsverteilungen ausgeschlassen?<br />
Im Summarkonkurs.<br />
1097. Welche Regeln gelten für Quittierung und Urkundentilgung?<br />
Es gelten dafür dieselben Regeln wie in der Betreibung auf Pfändung SchKG 664 II mit<br />
Hinweis<br />
auf SchKG 150.<br />
1098. *Wer erhält im<br />
Konkurs alles einen Verlustschein?<br />
Wie<br />
in der Betreibung auf Pfändung erhält auch im Konkurs jeder Gläubiger nach der<br />
Verteilung für den ungedeckten Betrag seiner Forderungen einen Verlustschein.<br />
! Weil aber in der Gneralexekution immer auch die Pfänder ohne Rücksicht auf das<br />
Deckungsprinzip verwertet<br />
werden, können selbst Pfandgläubiger zu Verlust kommen. Allen<br />
nicht<br />
voll befriedigten Konkursgläubigern muss infolgedessen ein Verlustschein ausgestellt<br />
werden (die in der Betreibung auf Pfandverwertung erhalten nur<br />
einen Pfandausfallschein,<br />
d.h. eine amtliche Bescheinigung, dass seine Forderung aus dem Pfanderlös nicht oder nicht<br />
vollständig bezahlt werden konnte, SchKG 158. Anspruch auf diesen Schein hat einzig<br />
der<br />
betreibende Pfandgläubiger. Alle übrigen nicht betreibenden Pfandgläubiger erhalten einzig<br />
eine Bescheinigung darüber, dass sich die Forderung als ungedeckt erwiesen hat. Aufgrund<br />
des Pfandausfallscheins kann der betreibende Pfandgläubiger die Betreibung für die<br />
Ausfallforderung auf das übrige Vermögen des Schuldners richten. Weil die Forderung nicht<br />
mehr Pfandgesichert ist, kann das auf dem Weg der ordentlichen Betreibung auf Pfändung<br />
oder auf Konkurs geschehen, das setzt aber voraus, dass der Schuldner dem Gläubiger<br />
gegenüber persönlich haftet.)<br />
1099. *Welche Wirkungen hat der Konkursverlustschein?<br />
SchKG 265<br />
Übereinstimmende Wirkungen mit dem Pfändungsverlustschein:<br />
- in den zivilrechtlichlen Wirkungen der Unverzinslichkeit der Verlustscheinsforderung<br />
(SchKG 149 IV) und deren<br />
Verjährbarkeit, erst 20 Jahre nach der Ausstellung des<br />
Verlustscheins/Bestimmungen über Löschung, bei Tilgung durch den Schuldner<br />
(SchKG 149a )<br />
- in der betreibungsrechtlichen<br />
Wirkung als Arrestgrund, SchKG 271 I<br />
Die übrigen Wirkungen weichen von denjenigen eines Pfändungsverlustscheins<br />
ab:<br />
- <strong>Der</strong> Konkursverlustschein gilt nur dann als Schuldanerkennung i.S. SchKG 82, wenn<br />
der Konkursit die betreffende Forderung anerkannt hat, SchKG 244. Darum muss um<br />
Konkursverlustschein bemerkt verden ob er das getan hat.<br />
- Konkursverlustschein<br />
berechtigt den Gläubiger auch nicht ohne weiteres zur Anhebung<br />
einer Anfechtungsklage, SchKG 285 II Ziff. 2., da die Anfechtungsansprüche<br />
zur<br />
Konkursmasse gehören und sie nur zur Eintreibung an Gläubiger abgetreten werden<br />
können, SchKG 260.<br />
172
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Fortsetzung einer Betreibung ohne neues Einleitungsverfahren (wie bei<br />
Pfändungsverlustschein mögl. 149 III und auch beim Pfandausfallschein binnen<br />
Monatsfrist, 158 II, dieser ist auch Schuldanerkennung 158 III) kommt für eine<br />
Konkursforderung nicht in Betracht, weil die früheren Betreibungen mit der<br />
Konkurseröffnung dahingefallen 206 sind und demzufolge auch nicht mehr fortgesetzt<br />
werden können<br />
- Auch eine neue Betreibung<br />
kann gegen den Konkursiten erst wieder angehoben werden,<br />
wenn er seit seinem Konkurs zu neuem Vermögen gekommen ist<br />
1100. *Treffen die Wirkungen des Verlustscheins auch jene Gläubiger, die am<br />
Konkursverfahren nicht teilgenommen haben?<br />
Nach SchKG 267 treffen alle Wirkungen des Verlustscheins, die die Gläubigerrechte<br />
einschränken auch jene Gläubiger, die am Konkurs nicht teilgenommen haben.<br />
<strong>Der</strong> Vorteile<br />
wird er dagegen nicht teilhaftig.<br />
110<strong>1.</strong><br />
Wo ist das Vorhandensein neuen Vermögens überhaupt erforderlich?<br />
Es ist nur erforderlich für eine (neue) Betreibung gegen eine natürliche Person. Juristischen<br />
Personen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften gehen nach einem Konkurs unter: bei<br />
ihnen ist unter Vorbehalt eines Nachkonkurses – nach Schluss des Konkurses nichts mehr<br />
zu<br />
holen. Daher werden gegen sie auch meistens keine Verlustscheine ausgestellt.<br />
1102.<br />
*Was soll das Erfordernis des neuen Vermögens erfüllen?<br />
Dass natürliche Personen sich vom Zusammenbruch wirtschaftlich und sozial erholen<br />
können,<br />
was nicht möglich wäre, liesse man die Konkursgläubiger nach Abschluss des Konkurses<br />
sogleich wieder auf jeden Vermögenswert greifen, den der Konkursit seither erworben hat.<br />
1103. *Was ist unter „neuem Vermögen“ im Sinne von SchKG 265 II zu verstehen?<br />
Darunter<br />
ist, weil es ja zur Erholung des Schuldners erforderlich ist, nur neues<br />
„Nettovermögen“ zu verstehen, der Überschuss, der nach Beendigung des Konkurses<br />
erworbenen Aktiven, über die neuen Schulden. <strong>Der</strong> ehemalige Konkursit hat aber Anspruch<br />
auf eine standesgemässe Lebensführung, die es ihm erlauft eine neue Existenz aufzubauen. Er<br />
darf deshalb nicht einfach auf den Notbedarf, das betreibungsrechtliche Existenzminimum<br />
verwiesen<br />
werden.<br />
Das erfordernis des neuen Vermögens ist aber gegeben, auch wenn der Schuldner noch nichts<br />
beiseite gelegt hat, wenn der Schuldner allein oder mit seinem Ehegatten ein Einkommen<br />
erzielt, das ihm erlauben würde, Vermögen zu bilden; oder wenn er über neue<br />
Vermögenswerte, wenn auch nicht rechtlich, so doch zumindest wirtschaftlich verfügen kann.<br />
(Mit Einbezug der Vermögenswerte, die nur wirtschaftlich in der Verfügungsmacht des<br />
Schuldners stehen, soll missbräuchlichen Manipulationen begegnet werden/Trotzdem,<br />
Pfändung in letzter Linie, SchKG 95 III.)<br />
1104. Unerliegen Schulden, die vom Konkursiten nach der Konkurseröffnung<br />
eingegangen sind auch dieser Beschränkung?<br />
Nein, für die darf er immer voll betrieben werden.<br />
1105. Wie wird garantiert, dass dem Schuldner dieses Recht auf wirschaftliche und<br />
soziale Erholung bleibt?<br />
Erstens, indem der Begriff des neuen Vermögens<br />
sehr weit ausgelegt wird und zweitens,<br />
darin,<br />
dass der Richter entscheiden soll, ob und in welchem Umfang der ehemalige Konkursit<br />
neues Vermögen erreicht hat.<br />
173
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1106. In welchen Phasen erfolgt die Feststellung des Richters, ob und in welchem<br />
Umfang der ehemalige Konkursit<br />
neues Vermögen erreicht hat?<br />
- zunächst in einem summarischen Bewilligungsverfahren für den Rechtsvorschlag des<br />
Schuldners, SchKG 265a I-III.<br />
- dann allenfalls noch im Feststellungsprozess<br />
über das Vorhandensein neuen Vermögens<br />
SchKG 265a IV.<br />
1107. Wie kann der Schuldner die Einrede des mangelnden neuen Vermögens<br />
erheben?<br />
Mit Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl, SchKG 75 II. Dazu genügt die Erklärung:<br />
Kein<br />
neues Vermögen.<br />
1108.<br />
Kann der Schuldner, wenn er es verpasst, die Einrede des mangelnden neuen<br />
Vermögens einzubringen diese im Verfahren später nachholen?<br />
Nein.<br />
1109. Was wird mit der<br />
Einrede des mangelnden neuen Vermögens bestritten?<br />
Nicht<br />
die Forderung an sich, sondern bloss die derzeitige Eintreibbarkeit auf dem<br />
Betreibungsweg.<br />
1110. Was wird angenommen, wenn der Schuldner einfach nur Rechtsvorschlag<br />
erhebt?<br />
Dann wird angenommen, er bestreite nur die Schuld und verzichte auf die Einrede!<br />
Umgekehrt lässt die Praxis, einen Rechtsvorschlag, der nur die Einrede und sonst keine<br />
weitere Bestreitung<br />
enthält, auch als gegen die Forderung gerichtet gelten.<br />
111<strong>1.</strong> Kann der Schuldner, wenn er die Einrede des mangelnden neuen Vermögens<br />
erhebt während<br />
der Dauerder Betreibung erneut durch Insolvenzerklärung die<br />
Konkurseröffnung herbeiführen?<br />
Nein, SchKG 265b, das muss um Missbrauch zu vermeiden auch für einen Schuldner gelten,<br />
der die Einrede unterlassen hat. Es könnte aber wieder zum Konkurs kommen<br />
und zwar bei<br />
Konkursfähigkeit<br />
des Schuldners oder auf Grund eines anderen materiellen Konkursgrundes.<br />
1112. *Ist die Einrede des mangelnden neuen Vermögens an die<br />
Verlustscheinforderung geknüpft?<br />
Nein, sie steht nur dem Schuldner persönlich zu, so z.B. auch nicht seinen Erben. Doch bleibt<br />
die Einrede dem Schuldner sogar erhalten, wenn gegen ihn in der neuen Betreibung (auf<br />
Pfändung) einen Pfändungsverlustschein ausgestellt wird: Sie stünde ihm demzufolge auch<br />
beim<br />
dritten und allen weiteren Anläufen seines ehemaligen Konkursgläubigers zur<br />
Verfügung.<br />
1113. *Welche Wirkung hat der mit der konkursrechtlichen Einrede begründete<br />
Rechtsvorschlag/Unterschiede zum gewöhnlichen Rechtsvorschlag?<br />
Im Gegensatz zum gewöhnlichen Rechtsvorschlag bewirkt der mit der konkursrechtlichen<br />
Einrede begründete nicht unmittelbar die Einstellung der Betreibung. Vielmehr wird er, wie<br />
jener in der Wechselbetreibung,<br />
vom Betreibungsamt dem Richter am Betreibungsort zur<br />
Prüfung<br />
seiner Begründetheit überwiesen. Bei gewöhnlichem Rechtsvorschlag kommt es<br />
hingegen zum Rechtsöffnungsverfahren. (Würde ein Richter den Rechtsvorschlag bewilligen,<br />
würde es nicht zu einem Rechtsöffnungsverfahren kommen! Nur noch allenfalls zur Klage<br />
des Gläubigers)<br />
174
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1114. Was macht der Richter im Bewilligungsverfahren?<br />
<strong>Der</strong> Richter prüft summarisch, ob die Einrede begründet ist oder nicht. Er hört die Parteien an,<br />
SchKG 265a I.<br />
<strong>Der</strong> Schuldner soll da seine Vermögensverhältnisse darlegen und glaubhaft machen, dass er<br />
nicht zu neuem Vermögen<br />
gekommen ist, SchKG 265a II.<br />
Ist<br />
das Nichtvorhandensein neuen Vermögens glaubhaft gemacht, so wird dem Schuldner der<br />
Rechtsvorschlag bewilligt. Im umgekehrten Fall ist der Rechtsvorschlag<br />
abzuweisen.<br />
1115. Was muss<br />
der Schuldner gleichzeitig machen, wenn er den Rechtsvorschlag<br />
abweist?<br />
Dann muss er den rechnerischen Umfang des neuen Vermögens<br />
feststellen, SchKG 265a III.<br />
Dieser Wert bildet die Höchstgrenze für die Fortsetzung der Betreibung. Bei gegebenen<br />
Voraussetzungen werden dabei bestimmte dem Schuldner bloss wirtschaftlich zustehende<br />
Vermögenswerte<br />
als pfändbar erklärt.<br />
1116. Darf das Betreibungsamt<br />
von sich aus auf dem Schuldner bloss wirtschaftlich<br />
zustehendes Vermögen zugreifen?<br />
Nein! Davon dürfen nur diejenigen Werte gepfändet werden, welche die richterliche<br />
Pfändbarerklärung ausdrücklich anführt. Insoweit ist es gleich wie im Arrest, wo ja auch nur<br />
genaue im Arrestbefehl bezeichnete Gegenstände<br />
verarrestiert werden können.<br />
1117. Was kann der Dirtte machen, dessen Sachen vom Richter zur Pfändung frei<br />
gegeben wurden?<br />
Er kann sich im Widerspruchsverfahren verteidigen.<br />
1118. Was kann gegen einen Entscheid des Richters über den Rechtsvorschlag<br />
unternommen werden?<br />
- Feststellungsklage nach SchKG 265a III<br />
- StBE<br />
ans Bger<br />
1119.<br />
Welche Klageart handelt es sich bei SchKG 265a IV?<br />
Beides sind Feststellungsklagen:<br />
- Wird der Rechtsvorschlag gutgeheissen<br />
und will der Gläubiger nun geltend machen, der<br />
Schuldner sei zu neuem Vermögen gekommen<br />
so handelt es sich um eine positive<br />
Feststellungsklage<br />
- Wird der Rechtsvorschlag abgewiesen und will der Schuldner geltend machen, er sei<br />
nicht zu neuem Vermögen gekommen, handelt es sich um eine<br />
negative<br />
Feststellungsklage.<br />
Bei beiden<br />
Klagen handelt es sich um rein betreibungsrechtliche Streitigkeiten<br />
1120. Was muss der Gläubiger<br />
machen, wenn der Schuldner mit seinem<br />
Rechtsvorschlag neben der Einrede auch den Bestand und den Umfang der<br />
Verlustscheinforderung bestreitet?<br />
Gegenstand des Feststellungssverfahrens ist nur die Frage des Vorahndenseins oder<br />
Nichtvorhandenseins neuen Vermögens. Ist auch Bestand und Umfang der<br />
Verlustscheinsforderung<br />
bestritten, so muss der ehemalige Konkursgläubiger, wenn er die<br />
Betreibung fortsetzen will, ausserdem noch die Rechtsöffnung durch den dafür zuständigen<br />
Richter verlangen.<br />
<strong>Der</strong> Re chtsöffnungsrichter braucht aber seinen Entschei nicht auszusetzen, bis im<br />
Feststellungsverfahren das neue Vermögen und damit die zulässigkeit der neuen Betreibung<br />
rechtskräftig feststehen. Es kann schon nach Abweisung des Rechtsvorschlags<br />
im<br />
175
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Bewilligungsverfahren zumindest die provisorische Rechtsöffnung erteilt werden, selbst bei<br />
noch hängigem Feststellungsprozess (logisch, da ja z.B. der Titel, der einem Gläubiger aus<br />
der Anerkennungsklage<br />
zukommt auch in einer allenfalls späteren Betreibung gebraucht<br />
werden kann). Dies ermöglicht es dem Gläubiger, sich mit einer provisorischen Pfändung<br />
abzusichern. Diese wird definitiv, sobald die Zulässigkeit der neuen Betreibung entgültig<br />
feststeht.<br />
§49 Das summarische Konkursverfahren<br />
112<strong>1.</strong> Wodurch zeichnet sich das summarische Konkursverfahren aus?<br />
Dadurch, dass es einfach, rasch und weitgehend formlos ist. Daher lässt es sich leichter den<br />
besonderen<br />
Verhältnissen anpassen als das ordentliche.<br />
Es<br />
ist vor allem auch kostensparender, sein Ergebnis für die Gläubiger demzufolge meist<br />
günstiger.<br />
1122. Was trägt wesentlich zur Vereinfachung des Konkursverfahrens bei?<br />
Dass es in der Regel ganz in den Händen der Konkursverwaltung (hier grundsätzlich des<br />
Konkursamtes) liegt, was eine grosse Erleichterung bedeutet;<br />
Gläubigerversammlungen sind<br />
nur ausnahmsweise vorgesehen.<br />
1123.<br />
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ein Summarisches<br />
Verfahren stattfindet?<br />
- wenn die Kosten des ordentlichen Verfahrens voraussichtlich nicht gedeckt wären, oder<br />
- wenn die Verhältnisse einfach sind<br />
- (Anstoss zum Summarkonkurs<br />
gibt ein Antrag des Konkursamtes an das<br />
Konkursgericht, SchKG 231 I).<br />
1124. Wie entscheidet sich die Frage darüber, ob die Kosten gedeckt wären?<br />
Nac h dem Ergebnis des Inventars.<br />
1125. Wann ordnet das Konkursgericht das summarische Verfahren an?<br />
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind.<br />
1126. Was kann ein Gläubiger machen, der nicht zufrieden ist, dass ein summarisches<br />
Konkursverfahren angeordnet<br />
wurde?<br />
Er<br />
kann noch bis zur Verteilung die Durchführung des ordentlichen Konkursverfahrens<br />
verlangen, wenn er die mutmasslich ungedeckten Kosten dafür vorschiesst oder sicherstellt,<br />
SchKG 231 II.<br />
1127. Mit welchen Rechtsmitteln kann der Entscheid des Konkursgerichts über die<br />
Bestimmung der Verfahrensart angefochten<br />
werden?<br />
Nur mit kantonalen Rechtsmitteln oder mit staatsrechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht.<br />
1128. *Wie ist das summarische Konkursverfahren im Einzelnen ausgestaltet/Welche<br />
Übereinstimmungen, welche Unterschiede bestehen zum ordentlichen<br />
Verfahren?<br />
Gundsätzlich ist es gleich wie das ordentliche Verfahren, ausser den<br />
4 in SchKG 231 III ziff.<br />
1-4 aufgeführten Besonderheiten.<br />
- G: Wie das ordentliche beginnt auch das summarische Verfahren mit der<br />
Konkurspublikation, SchKG 232 ohne II Ziff. 5<br />
176
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- U: SchKG 231 III Ziff. 3, das Inventar mit der Ausscheidung der Kompetenzstücke wird<br />
ers zusammen mit dem Kollokationsplan aufgelegt, (Inventur und Kollokation,<br />
sowie<br />
deren Anfechtung, ist gleich wie im ordentlichen Verfahren)<br />
- U: SchKG 231 III Ziff. 1, Die Verwaltung der Liquidationsmasse obliegt dem<br />
Konkursamt, da Gläubigerversammlungen<br />
grundsätzlich nicht einberufen werden, auch<br />
keine ausseramtliche Konkursverwaltung und kein Gläubigerausschuss. Das<br />
Konkursamt hat aber die Möglichkeit eine Gläubigerversmmlung<br />
einzuberufen, sie muss<br />
es tun, wenn:<br />
o <strong>Der</strong> Schuldner einen Nachlassvertrag vorschlägt oder wenn über die<br />
Geltenmachung oder Bestreitung zweifelhafter Ansprüche,<br />
oder dessen<br />
Abtretung nach SchKG 260 zu entscheiden ist.<br />
o Zu Aussonderungsansprüchen Dritter braucht es aber nur in wichtigen Fällen<br />
Stellungnahme der Gläubiger<br />
- U: SchKG 231 III Ziff. 2, Die Verwertung kann nach Ablauf der Eingabefrist jederzeit<br />
stattfinden, d.h.<br />
es bestimmt die Verwertungsart nach freiem Ermessen ist aber an<br />
SchKG<br />
256 II-IV gebunden<br />
- U: SchKG<br />
231 III Ziff. 4, die Verteilungslist braucht nicht aufgelegt zu werden<br />
- U: Es gibt<br />
keine Abschlagszahlungen<br />
- G: Die<br />
Konkursgläubiger erhalten auch im summarischen Verfahren gewöhnliche<br />
Verlustscheine §50 Schluss<br />
des Konkursverfahrens und Nachkonkurs<br />
1129. Wie wird das Konkursverfahren geschlossen?<br />
Ob ordentlich oder summarisch, muss es durch<br />
einen Entscheid des Konkursgerichts formell<br />
als geschlossen erklärt werden.<br />
1130.<br />
Gestützt worauf ergeht das Schlusserkenntnis des Gerichts?<br />
Gestützt auf einen Schlussbericht über den Verlauf der Liquidation,<br />
den die<br />
Konkursverwaltung<br />
nach der Verteilung dem Konkursgericht erstattet, SchKG 268 I/II.<br />
113<strong>1.</strong> Wem alles muss das Gericht das Schlusserkenntnis mitteilen?<br />
Dem Konkursamt, dem Betreibungs-,<br />
dem Grundbuch- und dem Handelsregisteramt, SchKG<br />
176<br />
I Ziff. 3. Das Konkursamt macht hierauf den Schluss öffentlich bekannt, SchKG 268 IV.<br />
1132. Welche Wirkungen hat das Ende des Konkurses?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner wird wieder voll umfänglich verfügungsberechtigt. Juristische Personen,<br />
Kollektivgesellschaften<br />
und Kommanditgesellschaften werden nach durchgeführter<br />
Liquidation im Handelsregister gelöscht.<br />
1133. Was kann das Konkursgericht machen, wenn es mit der Geschäftsführung der<br />
Konkursverwaltung nicht einverstanden ist?<br />
Es kann die Aufsichtsbehörde benachtichtigen, diese kann allfällige<br />
Disziplinarmassnahmen<br />
treffen.<br />
1134. Kann ein formell abgeschlossener<br />
Konurs wieder aufgenommen werden?<br />
In beschränktem Mass.<br />
1135. Unter welchen Umständen kann ein formell abgeschlossener<br />
Konurs wieder<br />
aufgenommen werden?<br />
SchKG 269<br />
177
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- wenn nachträgliche Vermögenswerte des Konkursiten entdeckt werden, die eigentlilch<br />
zur Masse gehörten. Da kommen nur neu entdeckte Aktiven, niemals auch Passivenin<br />
Frage (Forderungen<br />
gegen den Konursiten könne nur bis zum Schluss des Konkurses<br />
eingegeben werden, SchKG 251, danach müssen sie auf dem Betreibungsweg… geltend<br />
gemacht werden)<br />
Die neu entdeckten Aktiven dürfen erst später für die Konkursverwaltung und die<br />
Konkursgläubiger<br />
feststellbar geworden sein. Das trifft nicht zu, wenn sie wegen einer<br />
Nachlässigkeit der Konkursorgane unerkannt geblieben war.<br />
1136. Wie kann ein Nachkonkurs ausgelöst werden?<br />
Von Amtes wegen durch das Konkursamt oder auf Antrag eines Gläubigers.<br />
1137. Wie wird der Nachkonkurs abgewickelt?<br />
Er wi rd am ursprünglichen Konkursort abgewickelt. Das Konkursamt soll da die nachträglich<br />
zum Vorschein gekommenen Vermögenswerte „ohne weitere Förmlichkeit“<br />
verwerten und<br />
den Erlös aus dieser Liquidation an die zu Verlust gekommenen Gläubiger nach ihrer<br />
Rangordnung verteilen, SchKG 269 I.<br />
Handelt es sich beim nachträglich entdeckten Aktivum um einen zweifelhaften<br />
Rechtsanspruch,<br />
so darf das Konkursamt nicht einfach zur Verwertung schreiten; es muss die<br />
Gläubiger benachrichtigen, damit sie entscheiden können,<br />
ob der Anspruch für die Masse<br />
geltend gemacht oder nach SchKG 260 einem Gläubiger abgetreten werden soll, SchKG 269<br />
III. Auch Beträge, die bei der ursprünglichen Verteilung zu hinterlegen waren und<br />
nachträglich frei werden, werden auf diese Weise verteilt, gleich wird es mit<br />
Konkursdividenden gemcht, die binnen 10 Jahren nicht bezogen werden, SchKG 269 II.<br />
8. Kapitel: Arrest und paulianische Anfechtung<br />
§51 <strong>Der</strong> Arrest<br />
1138. Wovon hängt der Erfolg der Schuldbetreibung vor allem ab?<br />
Davon , ob genügend Vollstreckungssubstrat beigebracht oder gesichert werden kann.<br />
1139. Welche Möglichkeiten gibt es um Vollstreckungssubstrat<br />
zu sichern?<br />
- (Privatrechtliche Verpfändung)<br />
- Pfändungsbeschlag<br />
- Konkursbeschlag<br />
Für Sicherung schon vor der Pfändung oder der Konkurseröffnung:<br />
- provisorische Pfändung<br />
- Güterverzeichnis<br />
Andere Rechtsbehelfe, die schon Schutz vor Beginn der Vollstreckung bieten, oder<br />
die<br />
Rückschaffung bereits beseitigter Vermögensobjekte<br />
ermöglichen:<br />
- Aufnahme eines Retentionsverzeichnis<br />
sowie die Rückschaffung heimlicher oder<br />
gewaltsam entfernter<br />
Retentionsgegenstände, SchKG 283 f.; diese Massnahmen sind<br />
aber auf Miet- und Pachtzinsforderungen für Geschäftsräume sowie<br />
auf Forderungen der<br />
Stockwerkeigentümergemeinschaft<br />
beschränkt<br />
- Allgemein einsetzbar<br />
sind demgegenüber der Arrest sowie die paulianische Anfechtung<br />
(zur Rückschaffung von Vollstreckungssubstrat)<br />
1140. *Was bedeutet der Begriff „Arrest“?<br />
Amtliche<br />
Beschlagnahmung von Vermögen des Schuldners.<br />
178
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Im Gegensatz<br />
zu z.B. Deutschland, wo es den Personenarrest gibt, d.h. dass man einen<br />
Schu ldner festhalten kann, wenn man denkt, er könne sich absetzen, gibt es in der Schweiz<br />
einzig den Vermögensarrest.<br />
114<strong>1.</strong><br />
*Was bezweckt der Arrest?<br />
Den Erfolg einer schon eingeleiteten oder erst noch<br />
bevorstehenden Vollstreckung, in der die<br />
Voraussetzungen einer (definitiven od. provisorischen) Pfändung<br />
oder die Aufnahme eines<br />
Güterverzeichnisses noch nicht gegeben sind, durch Beschränkung der Verfügungsbefugnis<br />
des Schuldners zu sichern.<br />
1142.<br />
*Um welche Art Handlung handelt es sich beim Arrest?<br />
Weder um eine Betreibungshandlung ( wie bei der Pfändung), da man betreibungsrechtlich<br />
noch garnicht in ein solches Stadium gelangt ist, wo man das machen könnte, noch um die<br />
Schaffung irgend eines materiellen Vorzugsrechts zugunsten des Gläubigers. <strong>Der</strong> Arrest sieht<br />
zwar aus wie eine Pfändung, ist aber keine!<br />
<strong>Der</strong> Arrest hat reine Sicherungsfunktion<br />
(!) und hat daher auch bloss provisorischen<br />
Charakter.<br />
Das Sicherungselement kommt aus SchKG 271 I „Forderung, soweit diese nicht<br />
durch ein Pfand gesichert ist“.<br />
1143. Was setzt die Arrestierung von Schuldvermögen voraus?<br />
SchKG 272, wenn der Schuldner glaubhaft macht:<br />
- dass eine Arrestforderung besteht<br />
- ein Arrestgrund vorliegt<br />
- ein Arrestgegenstand verfügbar ist<br />
1144.<br />
*Was muss gegeben sein, damit das Erfordernis der Arrestforderung gegeben<br />
ist?<br />
Dass es eine auf dem Betreibungsweg vollstreckbare<br />
Forderung ist: einen auf Geldzahlung<br />
oder auf Sicherheitsleistung in Geld gerichteter Anspruch, doch darf die Forderung nicht<br />
schon pfandgedeckt sein, SchKG 271 I.<br />
Die Forderung muss weiter in der Regel fällig<br />
sein. Zwei Arrestgründe erlauben aber die<br />
Arrestnahme<br />
auch für noch nicht fällige Forderungen:<br />
- wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat, oder wenn er sich durch Beseitigung<br />
von Vermögensgegenständen oder durch Flucht der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten<br />
zu entziehen sucht. In diesen Fällen bewirkt der Arrest sogar die Fälligkeit der<br />
Forderung gegenüber dem Schuldner, SchKG 271 I Ziff. 1 und 2 sowie 271 II.<br />
1145. *Wann ist ein Gegenstand ein Arrestgegenstand?<br />
Weil der Arrest die spätere Vollstreckung absichern soll,<br />
kann er nur realisierbare<br />
Vermögenswerte<br />
des Schuldners erfassen SchKG 272 I Ziff. 3. Arrestierbar ist somit alles,<br />
was pfändbar<br />
wäre. Zudem kann ein Arrst nur auf Sachen und Rechte gelegt werden, die<br />
zumindest nach glaubwürdigen Angaben des Gläubigers – rechtlich dem Schuldner gehören.<br />
(Was offensichtlich einem Dritten gehört darf mit Drohung der Nichtigkeit nicht mit Arrest<br />
belegt<br />
werden).<br />
Ob sich die mit Arrest zu belegenden Gegenstände im Gewahrsam<br />
des Schuldners oder eines<br />
Dritten befinden, ist wie beim Pfändungsvollzug – gleichgültig. Soweit pfändbarkeit<br />
besteht,<br />
kann auch Einkommen des Schuldners arrestiert werden, die eiinjährige Höchstdauer beginnt<br />
mit dem Arrestvollzug.<br />
1146. In welchem Fall könnte höchstens auch ein Gegenstand eines Dritten mit Arrest<br />
belegt werden?<br />
179
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Im Falle eines sog. „Durchgriffs“<br />
- Oder wenn es sich bei bei der Arrestforderung um eine Forderung aus einem<br />
Konkursverlustschein handelt und die besonderen Voraussetzungen von SchKG 265a II<br />
glaubhaft gemacht sind<br />
1147. *Was bedeutet Arrestgründe?<br />
Das sind die Gefährdungstatbestände, die den Arrest rechtfertigen. Arrest kommt nur in<br />
Frage, wenn die Erfüllung der Forderung in einer Weise gefährdet ist, dass ihre Vollstreckung<br />
fehls chlagen könnte. Diese Gefährdungstatbestände sind zum Teil die gleichen, wie die der<br />
materiellen<br />
Konkursgründe (da braucht es ja dann auch kein Einleitungsverfahren). Das<br />
Gesetz zählt die Gefährdungstatbestände, die den Arrest rechtfertigen abschliessend in SchKG<br />
271<br />
auf.<br />
1148. *Welche Arrestgründe gibt es?<br />
SchKG 271 I Ziff. 1-5:<br />
- SchKG 271 I Ziff. 1: Schuldner ohne festen Wohnsitz (weder in der Schweiz noch im<br />
Ausland)<br />
- SchKG 271 I Ziff. 2: Unredliches Verhalten des Schuldners, da wird sowohl das<br />
Vorliegen<br />
des objektiven Tatbestandes, wie auch die Absicht, sich der Zahlung zu<br />
entziehen vorausgesetzt<br />
- SchKG 271 I Ziff. 3: Schuldner auf Durchreise oder auf Markt- und Messebesuch<br />
- SchKG 271 I Ziff. 4:Schuldner im Ausland oder auch Ausländerarrest/praktisch relevant<br />
- SchKG 271 I Ziff. 5: Insolventer Schuldner/praktisch relevant/In Betracht kommen<br />
nicht nur Verlustscheine<br />
schweizerischen Rechts, sondern auch gleichwertige<br />
ausländische Bescheinigungen<br />
1149. *Welche Voraussetzungen<br />
müssen für den Ausländerarrest gegeben sein?<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner hat keinen Wohnsitz in der Schweiz (völlig egal, wo der Gläubiger<br />
wohnt!)<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner hat Vermögen in der Schweiz (er muss das hier aber auf eine gewisse<br />
Dauer haben)<br />
- Es darf gegenüber dem Schuldner<br />
kein anderer Arrestgrund gegeben sein<br />
- (der Schuldner darf in der Schweiz keinen Betreibungsort haben, wo er betrieben<br />
werden könnte, also weder eine Geschäftsniederlassung noch ein Wahldomiziel)<br />
- Die Arrestforderung muss durch ein vollstreckbares, gerichtliches Urteil oder eine<br />
Schuldanerkennung,<br />
also durch einen provisorischen oder definitiven<br />
Rechtsöffnungstitel ausgewiesen sein, das kann auch ein ausländischer<br />
Gerichtsentscheid<br />
sein oder die Forderung muss einen genügenden Bezug zur Schweiz,<br />
eine sog. Binnenbeziehung aufweisen.<br />
1150. *Wieso wurde das Erfordernis der Binnenbeziehung eingeführt?<br />
A uf diese Weise sollen Arrestverfahren, die mit der Schweiz wenig oder nichts zu tun haben,<br />
ferngehalten<br />
werden.<br />
115<strong>1.</strong> *Was muss vorliegen, damit ein genügender Binnenbezug gegeben ist?<br />
Ein genügender Binnenbezug wird z.B. angenommen:<br />
- wenn der Vertrag, auf dem die Forderung beruht, in der Schweiz abgeschlossen worden<br />
oder hier zu erfüllen ist<br />
- wenn die Parteien hier einen Gerichtsstand oder ein Schiedsgericht vereinbart haben<br />
- Wenn der Gläubiger<br />
in der Schweiz domiziliert ist<br />
180
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Bei zweiseitigen Verträgen, wenn der Erfüllungsort für die Leistung des<br />
Arrestgläubigers in der Schweiz liegt<br />
- !Ungenügend wäre aber der Umstand, dass der auswärtige Schuldner hierzulande<br />
Vermögen besitzt<br />
1152. Gibt es noch andere Arrestgründe?<br />
Es gibt noch ein paar in Spezialgesetzen, z.B. der Steuerarrest.<br />
1153. In welcher Art Verfahren wird der Arrest angeordnet?<br />
In einem gerichtlichen Verfahren,<br />
der Vollzug selbst obliegt dann aber dem Betreibungsamt.<br />
1154. In welche grobabschnitte lässt sich der<br />
Arrest einteilen?<br />
- Arresbegehren<br />
- Bewilligung des Arrests<br />
- Arrestvollzug<br />
1155.<br />
Was muss ein Gläubiger als erstes machen, wenn er einen Vermögensgegenstand<br />
des Schuldners arrestieren will?<br />
Er muss an den Richter<br />
am Ort, wo der Vermögensgegenstand liegt ein Arrestbegehren<br />
stellen, SchKG 272 I.<br />
1156.<br />
Was muss das Arrestbegehren enthalten/in welcher Form muss es sein?<br />
Es kann mündlich oder schriftlich sein.<br />
Darin muss der Gläubiger glaubhaft machen,<br />
dass die Voraussetzungen für einen Arrest<br />
(Forderung, Arrestgrund und Arrestgegenstand, SchKG 272 II) vorliegen.<br />
1157.<br />
Was muss der Gläubiger machen, um die gegebenen Voraussetzungen "glaubhaft<br />
zu machen"?<br />
Er muss den Richter anhand plausibler Darstellung<br />
und liquiden Beweisen von der<br />
Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens überzeugen.<br />
1158.<br />
*Auf was muss im Arrestbegehren bezüglich des/der zu arrestierenden<br />
Vermögenswerte/s geachtet werden?<br />
Die mit Arrest zu belegenden Vermögenswerte müssen bezeichnet und deren Standort<br />
angegeben werden; ohne das könnte der Richter gar keinen vollziehbaren Arrestbefehl<br />
erlassen. Handelt es sich um Vermögensgegenstände, die dem Anschein nach einem Dritten<br />
gehören<br />
könnten, muss der Gläubiger überdies die Gründe für die von ihm behauptete<br />
Berechtigung des Schuldners glaubhaft darlegen.<br />
1159. *Was ist, wenn die genaue Bezeichnung der Arrestgegenstände nicht möglich<br />
ist?<br />
Dann genügt immer noch eine allgemeine Umschreibung derselben ihrer Gattung nach, wenn<br />
dabei wenigstens der Standort und der Gewahrsamsinhaber glaubhaft dargetan sind. Es<br />
braucht aber auch für den Vollzug eines sog. Gattungsarrestes eine minimale Spezifikation<br />
der Arrestgegenstände: z.B: die im Lagerhaus X in Basel untergebrachten Möbel des<br />
Schuldners,<br />
Inhalt eines vom Schuldner gemieteten Schrankfachs...<br />
1160. *Wie wären Arrestgegenstände unzureichend spezifiziert?<br />
Wenn sie nur allgemein umschrieben würden, wie z.B. sämtliche dem Schuldner zustehende<br />
Vermögenswerte bei einer Bank (selbst wenn alle erdenklichen aufgezählt würden), da man<br />
hier nicht einmal weiss, welche Art Vermögen der Schuldner wirklich hat und man daher<br />
nicht weiss was man suchen muss.<br />
181
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Ein solcher Arrest, dem nicht der geringste konkrete Hinweis auf das tatsächliche<br />
Vorhandensein bestimmter Gegenstände an einem bestimmten Ort zugrunde liegt, nennt man<br />
Sucharrest.<br />
116<strong>1.</strong> Was macht ein Gläubiger vorzugsweise,<br />
wenn er im Ausland wohnt?<br />
Dann soll er mit seinem Arrestbegehren zugleich ein Zustellungsort in der Schweiz<br />
bezeichnen, sonst erfolgen Zustellungen an ihn beim Betreibungsamt, SchKG 272 II.<br />
1162.<br />
Wer ist für die Bewilligung des Arrestes örtlich zuständig?<br />
<strong>Der</strong> Richter, am Ort, wo sich der mit Arrest zu belegende Vermögenswert befindet,<br />
SchKG<br />
272 I. Schon deswegen muss im Arrestgesuch der Arrestgegenstand und sein Standort<br />
angegeben sein.<br />
1163. **Wo befinden sich Forderungen (wichtig um zu wissen, zu welchem Richter<br />
man gehen muss)<br />
Normalerweise sind Forderungen am Wohnsitz des Gläubigers der Forderung gelegen. Eine<br />
Ausnahme besteht<br />
für den Ausländerarrest, SchKG 271 Ziff. 4. Auch wenn ihr der Schuldner<br />
seinen<br />
Wohnsitz im Ausland hat, aber der Drittschuldner (z.B. sein Konto, in einer Bank in<br />
der Schweiz) in der Schweiz, kommt es für den Arrest auf dein Sitz des Drittschuldners an.<br />
1164. Unter welchen Umständen müsst ein Gläubiger mehrere Arrestbegehren stellen?<br />
Wenn mehrere in verschiedenen Amtskreisen liegende Gegenstände mit Arrest zu belegen<br />
sind. Denn dann muss der für jeden einzelnen örtlich zuständigen Richter den Arrest<br />
bewilligen.<br />
1165. Mit welchem Ort stimmt der Arrestort immer überein?<br />
Mit dem Pfändungsort, SchKG 4 II.<br />
1166. *In welcher<br />
Verfahrensart entscheidet der Arrestrichter über das<br />
Arrestgesuch/was ist das besondere an diesem Verfahren?<br />
Er entscheidet im summarischen Verfahren, SchKG 25 Ziff. 2 a. Das<br />
Besondere daran ist,<br />
dass dies auf Grund bloss einseitiger Prüfung, d.h. ohne den Schuldner zu benachrichtigen<br />
oder<br />
ihn gar anzuhören geschieht; dies widerspräche dem Arrest als einer überfallartigen,<br />
superprovisorischen Massnahme zum Schutz gefährdeter Gläubigerrechte.<br />
Ersche int die Darstellung des Gläubigers im Arrestbegehren glaubhaft, so entspricht der<br />
Richter dem Gesuch.<br />
1167. Was macht der Richter, nachdem er dem Gesuch des Gläubigers entsprochen<br />
hat?<br />
Er bewilligt den Arrest und erlässt den Arrestbefehl an das Betreibungsamt zum Vollzug,<br />
SchKG 272 I, 274 I.<br />
1168. Wann erhält der Schuldner davon Kenntnis, dass der Richter ein Arrestbefehl<br />
erlassen<br />
hat?<br />
Erst beim Vollzug.<br />
1169.<br />
Welchen Zweck erfüllt der Arrestbefehl?<br />
Es ist die Basis für den vollzug des Arrestes.<br />
1170. Was muss der<br />
Arrestbefehl alles enthalten?<br />
SchKG<br />
274 II:<br />
182
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- die Namen und Adressen des Gläubigers und des Schuldners<br />
- die Forderung, für die der Arrest verlangt wird<br />
- den Arrestgrund<br />
- die einzelnen mit Arrest zu belegenden Gegenstände und<br />
ihren Standort<br />
- den Hinweis auf<br />
die Schadenersatzpflicht des Gläubigers und auf die ihm allenfalls<br />
auferlegte Sicherheitsleistung<br />
117<strong>1.</strong> Wem stellt der Arrestrichter den Arrestbefehl zum Vollzug zu?<br />
Dem am Ort der gelegenen Sache zuständigen Betreibungsamt, SchKG 274<br />
I.<br />
1172. Was wäre, wenn ein örtlich<br />
nicht zuständiges Amt den Arrest vollziehen würde?<br />
<strong>Der</strong><br />
Vollzug wäre nichtig.<br />
1173. Wie wird der Arrest vollzogen?<br />
SchKG<br />
275 verweist auf SchKG 91-109, den Pfändungsvollzug, ausser natürlich nicht auf 90<br />
SchKG, da der Sinn ja hier darin besteht, dass der Schuldner nicht gewahrnt wird.<br />
Trotz des generellen Verweises<br />
auf die Pfändung, gibt es aber ein paar wesentliche<br />
Änderungen,<br />
auf die im Gesetz nicht hingewiesen wird.<br />
1174. **Welche Besonderheiten müssen beim Arrestbefehl beachtet werden?<br />
- Er muss sofort vollzogen werden, SchKG 274 I<br />
- Wichtige Unterschiede zwischen der Pfändung und dem Arrest:<br />
o Bei der Pfändung werden pfändbare Gegenstände<br />
gesucht/Beim Arrest ist<br />
genau das verboten, man darf nur beschlagnahmen, was im Arrestbefehl steht<br />
(Beschlagnahmt man etwas anderes als im Arrestbefehl steht ist das nichtig)<br />
o Gleich ist, dass bei beiden die Sache mit<br />
Beschlag belegt wird<br />
→Verfügungsverbot, Doch in der Pfändung lässt man die<br />
Sachen<br />
normalerweise beim Gläubiger, während man beim Arrest die Sache fast<br />
immer sichert, nach den Bsp. von SchKG 98-105, kommt e contrario aus<br />
SchKG 277.<br />
1175. Welch e Unterschiede gibt es zwischen dem Pfändungsvollzug und dem<br />
Arrestvollzug?<br />
- <strong>Der</strong> Arrestbe fehl ist mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Sache sofort zu vollziehen, auch<br />
während eines Betreibungsstillstandes,<br />
SchKG 56<br />
- Nur die im Arrestbefehl aufgeführten, im Betreibungskreis befindlichen Gegenstände dürfen<br />
sichergestellt werden; Requisition kommt nicht in Frage. <strong>Der</strong>Vollzugsbeamte darf auch<br />
nicht<br />
(beim Schuldner oder beim<br />
Dritten) nach weiteren Vermögenswerten forschen und diese - sei<br />
es auch nur ersatzweise - erfassen. Ein über den Befehl hinausgehender Arrest ist nichtig<br />
- die Anwendung behördlichen Zwangs ist ausgeschlossen<br />
- Dritte Gewahrsamsinnhaber sind zwar auskunftspflichtig, dürfen aber nicht durch<br />
Androhung von Strafsanktionen nach StGB 292 zu Auskunft oder zu sonstigen Mitwirkungen<br />
gezwungen werden - ausser die Arrestforderung beruht auf einem vollstreckbaren Titel: auf<br />
einem gerichtlichen Urteil, einem Urteilssurrogat oder einem rechtskräftigen Zahlungsbefehl.<br />
(Dritte können aber dem Arrestgläubiger gegenüber für aus ungerechtfertigter<br />
Auskunftsverweigerung erwachsenen Schaden zivielrechtlilch haftbar werden.<br />
- der Arrestschuldner kann sich das freie Verfügungsrecht über die Arrestgegenstände<br />
bewahren, indem er dem Betreibungsamt Sicherheit dafür leistet, dass im Falle der Pfändung<br />
oder der Konkurseröffnungdie Arrestgegenständeoder gleichwertiger Ersatz bis zur Höhe der<br />
Arrestforderung samt Zinsen und Kosten greifbar vorhanden sein werden, SchKG<br />
277. Ein<br />
Freigabegesuch kann bis spätestens zum Zeitpunkt der Pfändung gestellt werden.<br />
183
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1176. Was muss das Betreibungsamt prüfen, wenn es den Arrestbefehl des Richters<br />
erhält?<br />
Grundsätzlich hat das Betreibungsamt einen Arrestbefehl zu vollziehen, ohne ihn auf seine<br />
materielle Begründetheit hin zu überprüfen. Es wäre garnicht befugt dazu, z.B. die<br />
Glaubhaftigkeit<br />
der Arrestvoraussetzungen zu überprüfen. Nur wenn sich der Arrestbefehl als<br />
unzweifelhaf nichtig erwiese müsste der Vollzug verweigert werden; denn der Vollzug eines<br />
nichtigen Befehls wäre ebenfalls nichtig, SchKG 22.<br />
1177. In welchem Fall erwiese sich der Arrestbefehl als unzweifelhaft nichtig?<br />
- z.B. im Falle örtlicher Unzuständigkeit des Arrestrichters oder des angerufenen<br />
Betreibungsamtes<br />
1178.<br />
Was beinhaltet die Arresturkunde?<br />
<strong>Der</strong> Vollzug des Arrestes wir vom Vollzugsbeamten in der Arresturkunde, auf der Rückseite<br />
des Arrestbefehls, bescheinigt und sofort dem Betreibungsamt übermittelt, SchKG 276 I;<br />
darin sind alle unter<br />
Beschlag genommenen Gegenstände mit ihrer Schätzung einzeln<br />
vermerkt.<br />
1179. Was passiert nach Aufnahme der Arresturkunde?<br />
Eine Abschrift von ihr wird sofort vom Betreibungsamt dem Gläubiger und dem Schuldner<br />
zugestellt, und Dritte werden benachrichtigt, die durch den Arrest in ihren Rechten betroffen<br />
werden, SchKG<br />
276 II.<br />
1180. *Weshalb ist der Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunde<br />
wichtig?<br />
Da von diesem Zeitpunkt an die Frist zur Anfechtung des Arrestes mit Beschwerde oder<br />
Einsprache sowie zur Prosekution (SchKG 278 und 279) läuft. <strong>Der</strong> Gläubiger muss auf die<br />
Gefahr hin, dass der Arrest<br />
dahinfällt , diesen innert 10 Tagen vom Moment an, da er die<br />
Arresturkunde<br />
erhalten hat prosequieren; ob der Schuldner diese Urkunde ebenfalls erhalten<br />
hat, ist dabei nicht massgeblich.<br />
118<strong>1.</strong> Welche Wirkungen hat der Arrest für den Schuldner?<br />
Den Schuldner trifft den Arrest gleich wie eine Pfändung, sofern er sich nicht durch<br />
Sicherheitsleistung sein Verfügungsrecht bewahrt. Abgesehen hiervon sind die<br />
Bestimmungen des Pfändungsrechts<br />
über die Beschränkung der Verfügungsbefugnis und die<br />
Verwaltung<br />
der beschlagnahmten Vermögenswerte analog anwendbar, SchKG 96 und 98 ff.<br />
Professor liestet hier die Unterschiede zwischen der Pfändung und dem Konkurs auf.<br />
1182. Kann vor der Prosequtionsbetreibung schon ein Arrestgegenstand verwertet<br />
werden?<br />
Grundsätzlich nicht aber, es ist einzig möglich, wenn sich nach SchKG 124 II ein Notverkauf<br />
aufdrängt.<br />
1183. *Welche Wirkungen hat der Arrest für den Gläubiger?<br />
- <strong>Der</strong> Gläubiger erlangt vorerst nur die von ihm angestrebte Sicherung von<br />
Vollstreckungssubstrat für seine bereits hängige oder erst noch bevorstehende Betreibung. Die<br />
Exekution selbst<br />
ist nur im Rahmen einer solchen Betreibung möglich, in der sich der<br />
Schuldner<br />
durch Rechtsvorschlag gegen die Forderung des Gläubigers zur Wehr setzen kann.<br />
- der Arrest fällt dahin, wenn der Gläubiger die Prosequtionsfristen nicht einhält, 280.<br />
- <strong>Der</strong> Arrest gewährt dem Gläubiger im anschliessenden Zwangsvollstreckungsverfahren<br />
kein<br />
Vorrecht auf Befriedigung aus dem Erlös der Arrestgegenstände!<br />
184
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Alle anderen Gläubiger, die mit ihm in diesem Verfahren konkurrieren können - sei es als<br />
Konkursgläubiger oder als Gläubiger derselben Pfändungsgruppe -, haben gleiches Recht<br />
darauf, SchKG 281 III. Er hat aber 2 Vorrechte.<br />
1184. *Was bedeutet die Tatsache im Einzelnen, dass der Arrestgläubiger<br />
grundsätzlich kein Vorzugsrecht gegenüber den andern Gläubigern hat?<br />
- Die Vermögenswerte können trotz bereits bestehendem Arrestbeschlag später zugunsten<br />
eines anderen Gläubiger gepfändet werden<br />
- Das Arrestgut fällt, wenn später über den Schuldner der Konkurs eröffnet wird, in die<br />
Konkursmasse, SchKG 199 I<br />
- die O bjekte können auch Gegenstand eines nachfolgenden Arrestes für einen anderen<br />
Gläubiger sein<br />
1185. Welche Privilegien hat der Arrestgläubiger aber?<br />
SchKG 281:<br />
- Werden die Arrestgegenstände nach Ausstellung des Arrestbefehls für einen anderen<br />
Gläubiger gepfändet,<br />
bevor der Arrestgläubiger das Fortsetzungsbegehren stellen kann, so<br />
nimmt<br />
diser gleichwohl von Gesetzes wegen provisorisch an der Pfändung teil. (Dem<br />
Gläubiger soll durch diese Regelung ermöglicht werden, auch ausserhalb der üblichen<br />
Anschlussfristen<br />
an einer Pfändung teilzunehmen).<br />
- Ferner darf der Gläubiger die vom Arrest herrührenden Kosten aus dem Erlös der<br />
Arrestgegenstände vorweg decken, SchKG 281 II, d.h. er muss zwar die Beute mit den<br />
anderen Gläubigern teilen, doch bevor die ihren Teil bekommen darf der Arrestgläubiger<br />
seine Kosten abziehen.<br />
- Für die Geltendmachung der Arrestforderung begründet<br />
der Arrest schliesslich noch den<br />
besonderen Betreibungsort und Gerichtsstand des Arrestes<br />
1186. Was muss der Arrestgläubiger machen, wenn er provisorischen der Pfändung<br />
Teil nimmt um diese dann definitiv werden zu lassen?<br />
- Er muss alle Schritte bis zum Fortsetzungsbegehren innert Frist vornehmen<br />
1187.<br />
Wann entfällt die provisorische Anschlusspfändung, die der Gläubiger von<br />
Gesetzes wegen erhält, wenn ein anderer Gläubiger sein Arrestgegenstand<br />
pfändet?<br />
Wen n der Arrestgläubiger seinen Anspruch gegen den Schuldner nicht auf dem<br />
Betreibungsweg<br />
bis zum eigenen Fortsetzungsbegehren verfolgt; denn erst dieses führt zur<br />
endgültigen Teilnahme.<br />
1188. Welche Wirkungen<br />
hat der Arrest auf einen Dritten?<br />
Drittschuldner und Drittgewahrsamsinhaber müssen die mit dem Arrestbeschlag verbundene<br />
Zahlungs- und Verfügungssperre beachten, um sich vor Schaden zu bewahren. Dritte, welche<br />
an Arrestgegenständen eigene,<br />
dem Deckungsanspruch des Arrestgläubigers vorgehende<br />
Rechte<br />
geltend machen, müssen diese rechtzeitig anmelden.<br />
1189. Welche Mittel stehen den von einem Arrest betroffenen zur Wahrung ihrer<br />
Rechte zur Verfügung (da sie ja bei der Arrestbewilligung keine Stellung nehmen<br />
können und im Normalfall erst beim Vollzug davon erfahren)?<br />
- Die Einsprache gegen den Arrestbefehl, sowie die Weiterziehung<br />
des<br />
Einspracheentscheides,<br />
SchKG 278<br />
- die betreibungsrechtliche Beschwerde gegen den Arrestvollzug<br />
- dem Dritten zudem das Widerspruchsverfahren nach SchKG 106 ff (schKG 275)<br />
185
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- die Arrest-Schadenersatzklage (SchKG 273)<br />
1190. Welche Funktion hat die Einsprache gegen den Arrestbefehl?<br />
Sie soll den vom Arrest betroffenen nachträglich rechtlliches Gehör verschaffen.<br />
Sie gibt<br />
ihnen nun Gelegenheit, zur Frage der Arrestbewilligung Stellung zu nehmen, diese ihrerseits<br />
wieder aufzugreifen und so dem Richter Wiedererwägung zu beantragen.<br />
119<strong>1.</strong> Wer ist zur Einsprache legitimiert?<br />
SchKG<br />
278: "wer durch den Arrest in seinen Rechten betroffen ist".<br />
Dies können sein: der Arrestschuldner, dann Drittansprecher, Drittverwahrer<br />
von<br />
Arrestgegenständen, sowie Drittschuldner.<br />
Nicht legitimiert wäre dagegen der Arrestgläubiger, dessen Arrestbegehren der Richter ganz<br />
oder teilweise abgewiesen oder nur gegen Kaution bewilligt hat; er ist auf Kantonale<br />
Rechtsmittel<br />
beschränkt.<br />
1192. Was kann mit der Einsprache gerügt werden?<br />
Mit der Einsprache werden nachträglich die Voraussetzungen des Verfahrens und<br />
insbesondere des Arrestes an sich bestritten. Dementsprechend können sämtliche Einwände,<br />
die vorgebracht werden, die gegen die Arrestbewilligung sprechen. Im Einzelnen können in<br />
Frage kommen:<br />
- fehlende Prozessvoraussetzungen,<br />
Nichtigkeit des Arrestes; obwohl Nichtigkeitsgrände von<br />
Amtes<br />
wegen berücksichtigt werden müssen, ist es sinnvoll sie in der Einsprache darzulegen<br />
- Unglaubhaftigkeit der vorgebrachten Arrestvoraussetzungen<br />
(Forderung, Arrestgrund,<br />
Arrestgegenstand des Schuldners)<br />
- Einrede der Pfandsicherheit<br />
- Bestreibung neuen Vermögens, sofern die Arrestforderung auf einem Konkursverlustschein<br />
beruht<br />
- der Arrestrichter habe vom Arrestgläubiger keine oder zu wenig Kaution verlangt, SchKG<br />
273<br />
- auch völkerrechtliche Einwände gegen den Arrest dürfen vorgebracht werden<br />
1193. In welcher Form muss<br />
die Einsprache erhoben werden?<br />
Sie kann mündlich oder schriftlich erhoben werden.<br />
1194. Bei wem/in welcher Zeitspanne muss die Einsprache erhoben werden?<br />
Beim Arrestrichter, SchKG 278.<br />
Sie muss binnen der (wiederherstellbaren bzw. verlängerbaren) Frist von 10 Tagen<br />
nach<br />
Kenntnisnahme<br />
seiner Anordnung erhoben werden (das ist regelmässig der Zeitpunkt der<br />
Zustellung der Arresturkunde oder der allfälligen Benachrichtigung eines Dritten).<br />
1195.<br />
Welche Wirkung hat die Einsprache?<br />
Sie hat keine Aufschiebende Wirkung, SchKG 278 IV; der Arrest bleibt also bis zu ihrer<br />
Erledigung bestehen, SchKG 278 IV. Immerhin laufen während des Einspracheverfahrens die<br />
Prosequtionsfristen nicht, SchKG 278 V.<br />
1196. Wem gibt der Richter im Einspracheverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme<br />
(da ja der Schuldner... dies anzetteln können)?<br />
SchKG 278 II: den Beteiligten -dem Arrestgläubiger,<br />
aber unter Umständen auch dem<br />
Betreibungsamt.<br />
1197. Können im Einspracheverfahren<br />
auch nova vorgebracht werden?<br />
186
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Ja,<br />
da es dabei im Kern um Wiedererwägung der Arrestbewilligung handelt. Nötigenfalls<br />
kann der Arrestgläubiger sogar einen anderen Arrestgrund anrufen. Nötigenfalls kann der<br />
Arrestgläubiger sogar einen anderen Arrestgrund anrufen. Doch muss der Einsprecher zu den<br />
nova selbstverständlich seinerseits Stellung nehmen können.<br />
1198.<br />
Welche Verfahrensart ist das Einspracheverfahren?<br />
Ein summarisches Verfahren, SchKG 278 II.<br />
1199. Welche Arten von Entscheide sind möglich bei der Einsprache?<br />
- Bei fehlender Legitimation wird er nicht darauf eintreten<br />
- erscheint ihm nach wie vor wahrscheinlich (!), dass die Arrestvoraussetzungen<br />
erfüllt sind,<br />
weist<br />
er die Einsprache ab und bestätigt den Arrest<br />
- andernfalls wird die Einsprache gutgeheissen und der Arrest aufgehoben<br />
oder modifiziert<br />
(Die Kosten der Einsprache bemessen sich nach<br />
GebV)<br />
1200. Was kann eine Person (kann das jetzt auch der Arrestgläubiger wahrscheinlich<br />
nicht, da der Arrest ja, wenn der Richter die geltendmachung des Schuldners<br />
wahrscheinlich findet der Arrest sonst aufgehoben wird?), die mit dem<br />
Einspracheentscheid nicht einverstanden ist machen?<br />
<strong>Der</strong> Einspracheentschei kann an die obere Gerichtsinstanz weitergezogen werden, SchKG 278<br />
III. Dies muss innerhalb von 10 Tagen geschehen. Wie schon<br />
der Einsprache kommt auch<br />
dieser<br />
Weiterziehung kein Suspensiveffekt zu, SchKG 278 IV. Sie hemmt aber ebenfalls den<br />
Lauf der Prosequtionsfristen, SchKG 278 V.<br />
Es geht auch hier nach wie vor um die Glaubhaftigkeit der Arrestvoraussetzungen. Ausserdem<br />
dürfen auch hier neue Tatsachen vorgetragen werden. Wo bundesrechtliche<br />
Verfahrensvorschriften fehlen, ist kantonales Prozessrecht anzuwenden.<br />
120<strong>1.</strong> Welcher Rechtsbehelf kann gegen den Entscheid im Weiterziehungsverfahren<br />
ergriffen werden?<br />
Gegen den letzinstanzlichen kantonalen Entscheid<br />
kann staatsrechtliche Beschwerde an das<br />
BGer erhoben werden.<br />
1202. Was kann mit Beschwerde gegen den Arrestbefehl geltend gemacht<br />
werden?<br />
Fehler<br />
des Betreibungsamts beim Arrestvollzug.<br />
Die Gültigkeit des Arrestbefehls darf hingegen nicht von der Aufsichtsbehörde überprüft<br />
werden, ausser es läge Nichtigkeit vor.<br />
Grund zur Beschwerde bietet z.B.<br />
- Ein nichtiger Arrestvollzug:<br />
• sei es, dass der Arrestbefehl nichtig ist (örtliche Unzuständigkeit des<br />
Arrestrichters, z.B. bei Rechtsmissbrauch u.A. angenommen beim Sucharrest, bei<br />
unzureichernder Spezifikation der Arrestgegenstände...)<br />
• oder das Betreibungsamt nicht zuständig war<br />
• wenn ein im Arrestbefehl nicht<br />
genannter Gegenstand oder bedeutend mehr<br />
Vermögen arrestiert wurde,<br />
als zur Sicherung der Arrestforderung nötig wäre<br />
- ein anfechtbarer Arrestvollzug,<br />
wie die Arrestierung eines unpfändbaren Vermögensstückes,<br />
der Entscheid des Betreibungsamtes über die Art und Angemessenheit der Sicherheit,<br />
die der<br />
Schuldner zu leisten hat um sich das Verfügungsrecht über die Arrestgegenstände zu<br />
bewahren<br />
1203.<br />
Wer kann alles Beschwerde führen?<br />
187
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Jeder, der durch eine Verfügung des Betreibungsamts beschwert wird, insbesondere auch ein<br />
Dritter.<br />
1204. Welche<br />
Möglichkeit hat ein Dritter, der am Arrestgegenstand Rechte geltend<br />
macht, vor denen der Vollstreckungsanspruch des Gläubigers zurücktreten<br />
müsste?<br />
Er hat die Möglichkeit, schon bevor er das Widerspruchsverfahren starten muss, sich mit<br />
Einsprache<br />
gegen den Arrestbefehl oder mit Beschwerde gegen den Arrestvollzug für seine<br />
Rechte<br />
einzusetzen.<br />
Hat er damit Erfolg, erübrigt sich das Widerspruchsverfahren.<br />
Gelingt es ihm aber nicht, die von ihm beanspruchten Gegenstände auf diesem Weg frei zu<br />
bekommen, oder hat er überhaupt davon abgesehen, so dass der Arrestbefehl und Vollzug<br />
rechtskräftig geworden sind, ist er auf die Durchführung des Widerspruchsverfahrens<br />
angewiesen.<br />
1205. Wie lange kann ein Dritter mit dem Widerspruchsverfahren<br />
zuwarten?<br />
Er darf damit nicht zuwarten, bis es im Rahmen der Prosekutionsbetreibung dann tatsächlich<br />
zur Pfändung der strittigen Gegenstände kommt. Ist der Arrest einmal rechtskräftig verfügt<br />
und vollzogen, muss sich der Drittansprecher binnen angemessener Frist melden; denn wie<br />
bei der Pfändung<br />
wird auch hier im Falle offensichtlich rechtsmissbräuchlicher Verzögerung<br />
der<br />
Anmeldung Verwirkung des Widerspruchsrechts angenommen. Immerhin darf der Dritte,<br />
den Ausgang einer Arresteinsprache bzw. einer Weiterziehung oder den Ausgang einer<br />
Beschwerde gegen den Arrestvollzug abwarten.<br />
1206. Wer kann was mit der Arrest-Schadenersatzklage geltend machen?<br />
Mit der Schadenersatzklage macht der Schuldner oder ein Dritter die gesetzliche Haftung des<br />
Gläubigers nach SchKG 273 I für den Schaden geltend, den dieser durch einen<br />
ungerechtfertigten Arrest verursacht hat. Z.B. Nachteile zufolge behinderter<br />
Verfügungsmacht.<br />
1207. Wonach richtet sich die Berechung des Schadens sowie die Bemessung<br />
der<br />
Ersatzpflicht?<br />
Nach OR.<br />
1208. Unter welchen<br />
Umständen ist ein Arrest nicht gerechtfertigt, nach SchKG 273 I<br />
und löst somit die Schadenersatzpflicht des Gläubigers aus?<br />
Wenn keine eintreibbare Forderung besteht oder kein Arrestgrund.<br />
Erfolgreiche Abwehr des Arrests belegt dessen Widerrechtlichkeit.<br />
1209.<br />
Ist bei der Arrest-Schadenersatzklage Verschulden erforderlich?<br />
Nein, es ist eine Kausalhaftung.<br />
1210. Was kann der Geschädigte bei Vorliegen der Voraussetzungen<br />
von OR 41 ff<br />
ausser Schadenersatz unter Umständen noch geltend machen?<br />
Genugtuung.<br />
121<strong>1.</strong> Was kann gemacht werden,<br />
damit einen erfolgreichen Schadenersatzanspruch<br />
des Schuldners oder Dritten entsprochen werden kann?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger darf im Hinblick auf seine Schadenersatzpflicht zu Sicherheitsleistungen<br />
verhalten<br />
werden, SchKG 273 I.<br />
188
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Dies<br />
kann schon im Arrestbefehl geschehen, dann ist der Vollzug von deren Leistung<br />
abhängig. Die Sicherheit kann aber auch erst nachträglich verfügt oder allenfalls noch erhöt<br />
werden.<br />
1212. Wie bestimmt man, in welcher<br />
Höhe der Gläubiger für eine allfällige<br />
Schadenersatzpflicht Sicherheit leisten soll?<br />
Zur Festsetzung der Sicherheitsleistung ist der allfällige Schaden, den der Arrest verursachen<br />
kann, abzuschätzen.<br />
Abzustellen<br />
ist dabei nicht auf die Höhe der Arrestforderung, sondern auf die<br />
Schadenersatzforderung des Arrestschuldners.<br />
(<strong>Der</strong> Schuldner muss daher, weil er die Grundlage zur Beurteilung<br />
hat glaubhaft machen z.B.<br />
ob es zu einer Blockierung seines Vermögens gekommen ist und wenn ja in welchem<br />
Umfang, da dies ein wesentliches<br />
Element des Schadens, den der Arrest dem Schuldner<br />
verursachen kann ist).<br />
1213. Wann verjährt die Schadenersatzpflicht nach SchKG 273?<br />
Nach einem Jahr seit Feststehen der Rechtswidrigkeit des Arrestes und Kenntnis vom<br />
Schaden. Absolut tritt die Verjährung nach 10 Jahren ein. Solange der Arrest noch hängig ist,<br />
laufen dies Fristen nicht.<br />
1214. Wer ist für den Schadenersatzprozess nach SchKG 273 Zuständig?<br />
Nach Wahl des Klägers: der Richter am Arrestort, SchKG 273 II; am Wohnsitz oder Sitz<br />
des<br />
Geschädigten oder Beklagten, am Handlungs- oder Erfolgsort.<br />
1215.<br />
In welcher Art Verfahren wird die Klage beurteilt?<br />
Weil sie eine materiellrechtliche Streitigkeit betrifft, wird sie im ordentlichen Zivilprozess<br />
beurteilt.<br />
<strong>Der</strong> Schadenersatzanspruch kann aber auch einrede- oder widerklageweise<br />
geltend gemacht<br />
werden,<br />
insbesondere gegen die Arrestprosekutionsklage, SchKG 279.<br />
1216. Kann die Schadenersatzklage ans Bundesgericht weitergezogen werden?<br />
Ja, bei genügendem<br />
Streitwert ist die Berunfung ans BGer gegeben.<br />
1217. Wer trägt bei der Arrest-Schadenersatzklage die Beweislast?<br />
<strong>Der</strong><br />
Kläger.<br />
1218. Welche Voraussetzungen müssen bei der Arrest-Schadenersatzklage<br />
alles<br />
vorliegen?<br />
- (ungerechtfertigter Arrest)<br />
- Schaden<br />
- Widerrechtlichkeit<br />
- Kausalität (zwischen Arrest und Schaden)<br />
1219. Was passiert, wenn die<br />
Arrest-Schadenersatzklage gutgeheissen wird, wenn der<br />
Gläubiger<br />
eine Sicherheit geleistet hat?<br />
Ihm verfällt die vom beklagten Arrestgläubiger<br />
geleistete Sicherheit bis zur Höhe des<br />
zugesprochenen Schadenersatzes samt Kosten.<br />
1220. Was ist der Zweck der Arrestprosektion?<br />
Verfolgung der Forderung auf dem Vollstreckungsweg.<br />
Im Rahmen der Arrestprosekution<br />
soll der Arrestschuldner auch Gelegenheit haben, sich gegen die bis dahin nur - im<br />
189
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
summarischen Verfahren - glaubhaft gemachte und deshalb noch ungewisse Forderung<br />
verteidigen.<br />
190<br />
voll zu<br />
122<strong>1.</strong> Welche Prosekutionswege gibt es?<br />
<strong>Der</strong> Arrestgläubiger muss, wenn er seinen Sicherungsbeschlag nicht verlieren will, entweder<br />
mit Klage und anschliessender Betreibung oder direkt mit Betreibung gegen den Schuldner<br />
vorgehen, SchKG 279 I.<br />
1222.<br />
Aus welchem Grund schlägt der Gläubiger den Prosekutionsweg ein?<br />
Damit er seinen Sicherungsbeschlag nicht verliert.<br />
1223. Welche Fristen gelten im Prosekutionsverfahren?<br />
Es muss jeweils binnen 10<br />
Tagen eingeleitet und weitergeführt werden, wenn immer dessen<br />
Fortgang<br />
von der Initiative des Gläubigers abhängt und sobald dieser verfahrensrechtlich zum<br />
nächsten Schritt in der Lage ist. Eine verpasste Prosekutionsfrist wäre aber - obwohl<br />
Verwirkungsfrist - wiederherstellbar.<br />
1224. Wann beginnt die Frist zur Prosekution zu laufen?<br />
Die Frist zum ersten Schritt beginnt mit der Zustellung der Arresturkunde; während eines<br />
Einsprache- und Weiterziehungsverfahren laufen die Prosekutionsfristen jedoch nicht (SchKG<br />
279 I und 278 V). Erst ein rechtskräftiger Arrest bedarf der Prosekution. Das muss auch<br />
während eines gegen den Arrestvollzug<br />
gerichteten Beschwerdeverfahrens gelten.<br />
1225. Was passiert, wenn die anhaltende Prosekution unterbleibt?<br />
Dann fällt der Arrest ohne weiteres dahin (SchKG 280 Ziff. 1/2).<br />
1226. Wie läuft die Proseqution auf dem Betreibungsweg ab?<br />
SchKG 279:<br />
- Binnen 10 Tagen seit Zustellung der Arresturkunde muss das Betreibungsbegehren gestellt<br />
sein (SchKG 279 I), hatter der Gläubiger aber schon vor der Bewilligung des Arrestes<br />
Betreibung eingeleitet, so gilt diese nun als Prosekutionsbetreibung.<br />
Das trifft auch zu, wo der<br />
Arrest<br />
auf einem provisorischen Verlustschein beruht. (Liegtdem Arrest ein definitiver<br />
Verlustschein zugrunde, so kann der Gläubiger direkt das Fortsetzungsbegehren<br />
stellen, falls<br />
die 6-monatige<br />
Frist, SchKG 149 II noch nicht abgelaufen ist)<br />
- Erklärt der Schuldner in der Prosekutionsbetreibung Rechtsvorschlag, muss der Gläubiger<br />
binnen 10 Tage seit dessen Mitteilung Rechtsöffnung verlangen oder die Klage auf<br />
Anerkennung seiner Forderung einreichen; wird ihm dann die Rechtsöffnung verweigert,<br />
muss er wieder innert 10 Tagen nach Eröffnung des rechtskräftigen Entscheides klagen.<br />
Rechtskräftige Abweisung der Klage bewirkt den Hinfall des Arrestes, SchKG 280 Ziff. 2 und<br />
3.<br />
- Wurde kein Rechtsvorschlag erhoben oder sind dessen Wirkungen rechtskräftig beseitigt<br />
worden, muss die Prosekutionsbetreibung noch fortgesetzt werden, SchKG 279 III. Dies<br />
geschieht je nach Person des Schuldners auf dem Wege der Pfändung oder des Konkurses.<br />
Die Arrestgegenstände werden dann gepfändet oder in das Güterverzeichnis oder das<br />
Konkursinventar aufgenommen. <strong>Der</strong> Arrest ist Beendet, an seine Stelle tritt der Pfändungs<br />
oder<br />
der Konkursbeschlag.<br />
Für das Fortsetzungsbegehren gelten an sich die ordentlichen Fristen nach SchKG 88, doch<br />
muss es soll der Arrestbeschlag aufrecht erhalten werden auch innerhalb der 10-tägigen Frist<br />
gestellt werden.<br />
1227. In welchem Moment ist der Arrest beendet?
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Wenn die Arrestgegenstände gepfändet oder in das Güterverzeichnis oder das<br />
Konkursinventar aufgenommen<br />
werden. Das Provisorium des Sicherungsbeschlags ist damit<br />
beendet; der Arrest hat seinen Zweck erreicht, an seine Stelle tritt der Pfändungs oder<br />
Konkursbeschlag.<br />
1228.<br />
Wie ist es, wenn die Prosekution mittels Klage durchgeführt wird?<br />
Die Klage muss auch, wie die Betreibung binnen der Prosekutionsfrist<br />
anhängig gemacht<br />
werden und eine bereits hängige Klage gilt als Prosekutionsklage<br />
Wir die Klage gutgeheissen muss der Gläubiger binnen 10 Tagen seit Eröffnung des<br />
rechtskräftigen Urteils die Prosekutionsbetreibung anheben und jeweils nach SchKG 279<br />
II<br />
und III rechtzeitig weiterführen,<br />
SchKG IV.<br />
Rechtskräftige<br />
Abweisung der Klage, wie auch Rückzug derselben lässt den Arrest<br />
dahinfallen, SchKG 280 Ziff. 2/3.<br />
1229. Wo ist der Prosekutionsort für die Betreibung?<br />
<strong>Der</strong> Gläubiger hat die Wahl, den Schuldner am Arrestort oder am ordentlichen Betreibungsort<br />
zu betreiben, SchKG 52.<br />
1230. Wo würdest du vorschlagen soll ein Gläubiger die Prosequtionsbetreibung<br />
anheben?<br />
Am<br />
ordentlichen Betreibungsort.<br />
Da am Arrestort die Vollstreckung auf die Arrestgegenstände<br />
beschränkt ist. Die Pfändung<br />
weiteren Vermögens (Ergänzungs- oder Nachpfändung) sowie die Konkursbetreibung sind<br />
dort ausgeschlossen - es sei<br />
denn, der Arrestort stimme zufällig mit dem ordentlichen<br />
Betreibungsort<br />
überein.<br />
123<strong>1.</strong> Wo muss die<br />
Arrestprosekutionsklage erhoben werden?<br />
Gemäss GestG dort, wo sie anzuheben<br />
wäre, wenn kein Arrest gelegt worden wäre. Das<br />
GestG kennt keinen Gerichtsstand des Arrestortes.<br />
§ Die paulianische Anfechtung<br />
1232.<br />
Welche Funktion hat die paulianische Anfechtung?<br />
Sie dient dazu, der Vollstreckung entzogene Vermögenswerte dieser wieder zuzuführen,<br />
SchKG 285 I. Es geht also darum, einen früheren Vermögensstand des Schuldners wieder<br />
herzustellen.<br />
Die<br />
Anfechtung zielt demnach auf die Wiederbeschaffung entäusserter Vermögenswerte zur<br />
Befriedigung der Gläubiger: die Wiederherstellung<br />
der Exekutionsrechte (geht hier um<br />
Handlungen,<br />
die zu einem Zeipunkt ausgeführt wurden, indem der Schuldner noch frei<br />
verfügen konnte).<br />
1233. *Beseitigt die paulianische Anfechtung auch die zivilrechtliche Wirkung der<br />
angefochtetenen<br />
Handlung?<br />
Nein, sie macht diese nur insoweit betreibungsrechtlich unbeachtlich, als die Gläubiger einen<br />
Verlust erlitten haben oder sehr wahrscheinlich noch erleiden werden. In diesem Sinn ist die<br />
Anfechtung (= paulianische Anfechtung) ein subjektiver Rechtsbehelf des Betreibungsrechts.<br />
1234.<br />
Woher merkt man, dass die Anfechtung ein subsidiärer Rechtsbehelf ist?<br />
Aus SchKG 285 II. Die gesetzliche Regelung der Aktivlegitimation in SchKG 285 II bringt<br />
deutlich zum Ausdruck, dass sie erst in Betracht zu ziehen ist, wenn mit an Sicherheit<br />
grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass das vorhandene Schuldnervermögen zur<br />
191
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Befriedigung der Gläubiger nicht ausreichen wird. Darin zeigt sich der funktionellbetreibungsrechtliche<br />
Zusammenhang zwischen Anfechung und Exekution.<br />
1235.<br />
Was kann Gegenstand der Anfechtung sein?<br />
Grundsätzlich nur vermögensvermindernde Rechtshandlungen, die der Schuldner selbest,<br />
oder ein von ihm bestellter Vertreter, vor der Pfändung oder vor der Konkurseröffnung<br />
vorgenommen hat, in einem Zeitpunkt also, in dem er an sich über sein Vermögen noch frei<br />
verfügen konnte, SchKG 286-288. Denn über bereits dem Pfändungs- oder Konkursbeschlag<br />
unterworfene Vermögenswerte könnte er überhaupt nicht mehr rechtsgültig verfügen,<br />
so dass<br />
eine Schmälerung der Exekutionsrechte von vornherein ausgeschlossen ist.<br />
1236. Ist jede Vermögensverminderung vor der Exekution<br />
anfechtbar?<br />
Nein, die Rechtshandlung muss in einer Zeitspanne erfolgt sein, in der Verdacht besteht, der<br />
Schuldner habe den finanziellen Zusammenbruch voraussehend oder zumindes ahnend, seine<br />
Gläubiger schädigen oder einzelne von ihnen begünstigen wollen.<br />
Diese Frist, die aus Gründen der Rechtssicherheit begrenzt ist, wird Verdachtsfrist genannt.<br />
1237. Wie lange dauert die Verdachtsfrist?<br />
Sie<br />
erfasst den Zeitraum eines Jahres vor der Pfändung bzw. vor der Konkurseröffnung oder<br />
vor der Bewilligung eiiner Nachlassstundung (SchKG 286 und 287, 331 II); im Falle<br />
fraudulöser Konspiration greift sie sogar 5 Jahre in die Vergangenheit zurück, SchKG 288.<br />
Um Missbrauch auszuschliessen, werden diese Fristen um die Dauer eines<br />
Nachlassverfahrens, eines Konkursaufschubs, einer Notstundung und<br />
eines Rechtsstillstandes<br />
verlängert.<br />
1238. *Welche Tatbestände sind anzufechten?<br />
(<strong>Vorlesung</strong>: es gibt drei Gruppen) Drei Tatbestandsgruppen sind zu unterscheiden:<br />
- Freigiebigkeitsakte des Schuldners verschiedenster Art; man nennt die Anfechtung<br />
die<br />
Schenkungsanfechtung, SchKG 286<br />
- Handlungen eines bereits überschuldeten Schulnders zugunsten einzelner<br />
Gläubiger; sie<br />
bilden Gegenstand der sogenannten Überschuldungs- oder Begünstigungsanfechtung,<br />
gelegentlich<br />
auch Deckungsanfechtung genannt, weil es sich durchwegs um Fälle<br />
aussergewöhnlicher Forderungsdeckung handelt, SchKG 287<br />
- Ganz allgemein unredliche Handlungen des Schuldners,<br />
mit denen er beabsichtigt, seine<br />
Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne zum Nachteil anderer zu begünstigen;<br />
da<br />
handelt es sich um die Absichts- oder die Deliktsanfechtung, SchKG 288<br />
(Auffangtatbestand).<br />
1239. Können weitere Tatbestände angefochten werden?<br />
Nein, das ist aus Gründen des Vertrauensschutzes Dritter im Geschäftsverkehr nicht zulässig.<br />
1240. Welche praktische Bedeutung hat die Einteilung der Anfechtungstatbestände?<br />
Die Anforderungen<br />
der Anfechtungsmöglichkeit steigen von Gruppe zu Gruppe.<br />
124<strong>1.</strong> Was kann mit der Schenkungspauliana erreicht werden?<br />
Da<br />
können bereits vollzogene Schenkungen im Sinne des Zivilrechts sowie andere<br />
unentgeltliche Verfügungen des Schuldners angefochten werden,<br />
SchKG 286 I.<br />
Auch gemischte Schenkungen unterliegen der Anfechtung; die Klage lautet dann auf<br />
Erstattung<br />
des Wertunterschiedes, SchKG 286 II Ziff. <strong>1.</strong><br />
192
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Von<br />
der Anfechtung ausgenommen sind die gebräuchlilchen Gelegenheitsgeschenke. Nicht<br />
nur der Anlass zu schenken muss aber gebräuchlich sein, sondern auch<br />
das Mass der<br />
Schenkung, was nach den Vermögensverhältnissen des Schuldners zu beurteilen ist.<br />
Den Schenkungen stellt das Gesetz Rechtsgeschäfte gleich, mit denen der Schuldner<br />
für sich<br />
selbst oder für einen Dritten eine Leibrente, eine Pfrund oder eine Nutzniessung oder ein<br />
Wohnrecht erworben hat, SchKG 286 II Ziff. 2.<br />
1242. *Wann sind diese genannten Rechtsgeschäfte in der Schenkungspauliana<br />
anfechtbar?<br />
Nur, wenn der Schuldner sie während der einjährigen Verdachtsfrist vorgenommen hat. Man<br />
rechnet also von der Konkurseröffnung oder der Pfändung ein Jahr zurück und alles, was in<br />
dieser Zeitspanne vorgenommen wurde fällt darunter.<br />
1243. Was stellt die Verdachtsfrist dar?<br />
<strong>Der</strong> objektive Tatbestand der Schenkungspauliana (Wahrscheinlich muss ja doch noch eine<br />
Schenkung oder sonst etwas, was in diesem Titel aufgezählt wird vorliegen). Diese muss der<br />
Anfechtungskläger beweisen. Auf die subjektiven Beweggründe der Beteiligten kommt es<br />
nicht an.<br />
Darum<br />
wird auch bei einer gemischten Schenkung weder die Absicht unentgeltlicher<br />
Zuwendung, noch die Erkennbarkeit des Missverhältnisses<br />
zwischen Leistung und<br />
Gegenleistung verlangt.<br />
1244. Was kann man machen, wenn die objektiven Voraussetzungen der<br />
Schenkungspauliana<br />
nicht erfüllt sind?<br />
Dann kann nur noch eine andere, an strengere Voraussetzungen geknüpfte Anfechtung in<br />
Frage kommen: die Überschuldungs- oder Deliktspauliana.<br />
1245.<br />
Ist erheblich, ob der Schuldner im Zeitpunkt des Schenkungsaktes bereits<br />
zahlungsunfähig oder gar überschuldet war?<br />
Nein. Das Gesetz geht aber von der unwiderlegbaren<br />
Vermutung aus, dass ein derartiges<br />
Rechtsgeschäft den kurz darauf folgenden finanziellen Zusammenbruch des Schuldners<br />
zumindest mitverursacht hat.<br />
1246. Wieso bedürfen noch nicht vollzogene Schenkungen der Schenkungsanfechtung<br />
nicht?<br />
Weil die Ausstellung eines Verlustscheins oder die Konkurseröffnung jedes<br />
Schenkungsversprechen von Gesetzes wegen aufhebt, OR 250 II.<br />
1247.<br />
Welche Rechtshandlungen trifft die Überschuldungspauliana?<br />
Sie trifft bestimmte Rechtshandlungen, mit denen ein überschuldeter Schuldner einzelne<br />
Gläubiger bevorzugt hat. Die Begünstigung besteht regelmässig darin, dass ein Gläubiger<br />
vom Schuldner eine Sicherheit oder sogar Befriedigung erhält, auf die er überhaupt<br />
nicht oder<br />
nicht in der gewählten Art oder doch nicht zu der betreffenden Zeit<br />
hatte.<br />
1248. Welche Tatbestände formuliert das Gesetz für die Überschuldnungspauliana?<br />
SchKG 287:<br />
- Nachträgliche Bestellung einer Sicherheit für eine bestehende Verbindlichkeit des<br />
Schuldners, die sicherzustellen er nicht schon früher rechtlich verpflichtet war, SchKG<br />
287 I Ziff.<strong>1.</strong> Dazu gehört z.B. die nachträgliche Bestellung eines Pfandrechts.<br />
193
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Tilgung einer Geldschuld auf ungewohnte Weise, z.B. durch Hingabe einer Sache, oder<br />
durch Übernahme einer Forderung gegen den Gläubiger, um diesem die Verrechung<br />
zu<br />
ermöglichen…<br />
- Bezahlung einer noch nicht fälligen Schuld<br />
1249. Können auch rechtliche Verpflichtungen zur Sicherstellung ein<br />
Anfechtungstatbestand<br />
nach SchKG 287 I Ziff. 1 bilden?<br />
Nein, sie schliessen diese Anfechtung aus. Da kann<br />
höchstens noch eine Deliktspauliana nach<br />
SchKG<br />
288 in Frage kommen.<br />
1250. Kann die Sicherstellung einer fremden Schuld als Anfechtungstatbestand<br />
der<br />
Überschuldungspauliana in Frage kommen?<br />
Nein. Sie könnte höchstens wenn<br />
sie ohne entsprechende Gegenleistung und ohne<br />
Verpflichtung<br />
erfolgte, gegebenenfalls gestützt auf SchKG 286 mit der Schenkungspauliana<br />
angefochten werden.<br />
125<strong>1.</strong> Welche Tatbestandsvoraussetzungen setzt die Überschuldenspauliana voraus?<br />
- Vorliegen einer der 3 im Gesetz aufgezählten Handlungen, SchKG 287 I Ziff. 1-3<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner muss<br />
die anfechtbare Handlung innerhalb der einjährigen Frist<br />
vorgenommen haben<br />
- Er muss zur Zeit der Fornahme der anfechtbaren Handlung effektiv überschuldet<br />
gewesen sein (die Passiven müssen also seine Aktiven schon damals überstiegen haben)<br />
→Dies muss alles der Anfechtende beweisen<br />
- Misslingen der Entlastungsmöglichkeit<br />
des Begünstigten (anders als bei der<br />
Schenkungspauliana steht dem Begünstigten eine Entlastungsmöglichkeit offen. Er<br />
wird<br />
zum Nachweis zugelassen, dass er die kritische Vermögenslage des Schuldners nicht<br />
gekannt hat und – bei der im Geschäftsverkehr<br />
üblichen Sorgfalt – auch nicht hätte<br />
erkennen können. Gelingt ihm der Beweis, ist die gegenteilige Vermutung (Kenntnis<br />
der<br />
Überschuldung) widerlegt und die Überschuldungsanfechtung ausgeschlossen, dann<br />
kann höchstens die Deliktspauliana in Frage kommen).<br />
1252. Was versteht man bei der Deliktspauliana unter der Benachteiligungs- bzw.<br />
Begünstigungsabsicht des Schuldners?<br />
Damit das gegeben ist, genügt es schon, dass sich der Schuldner<br />
über die schädigende Folge<br />
seines<br />
Handelns hat Rechenschaft geben müssen oder können; auch dolus eventualis kann in<br />
Frage kommen, womit der Schuldner zwar einen anderen, durchaus legitimen Zweck verfolgt,<br />
gleichz eitig aber eine Schädigung der Gläubiger in Kauf nimmt.<br />
1253. Was versteht man in SchKG 288 darunter, dass die „böse Absicht“ des<br />
Schuldners für den Gläubiger erkennbar war?<br />
Das heisst, dass der Empfänger nicht bestimmt gewusst haben muss,<br />
dass der Schuldner die<br />
Handlung<br />
(auch) vornimmt, weil er einzelne Gläubiger schädigen, andere begünstigen will.<br />
Es genügt, wenn der Empfänger der Sache bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte<br />
erkennen können und müssen, was der Schuldner im Schilde<br />
führt. Dem Vertragspartner wird<br />
damit eine gewisse Erkundigungspflicht auferlegt.<br />
1254. Welche Tatbestandsvoraussetzungen müssen bei der Deliktspauliana vorliegen,<br />
wer hat sie zu beweisen?<br />
Es obliegt dem Anfechtenden, sämtliche Tatbestandselemente<br />
nachzuweisen:<br />
- die vermögensschädigende Rechtshandlung des Schuldners<br />
- ihre Vornahme in der Verdachtsperiode<br />
194
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- die Schädigungsabsicht des Schuldners<br />
- deren Erkennbarkeit für den Vertragspartner<br />
1255. Wann greift man im Normalfall zur Deliktspauliana?<br />
Wen n die leichteren Anfechtungsmöglichkeiten<br />
versagen.<br />
1256. *Wie kann die Anfechtung geltend gemacht<br />
werden?<br />
- Die Anfechtungsansprüche werden regelmässig durch selbständige Klage<br />
(Anfechtungsklage) geltend gemacht<br />
- Man kann sie aber auch in einem anderen berteibungsrechtlichen Prozess einem Kläger<br />
einredeweise entgegenhalten: so gegenüber einer vom Begünstigten erhobenen<br />
Widerspruchs-, Aussonderungs- oder Kollokationsklage oder<br />
gegenüber der Klage eines<br />
Gläubigers auf Anerkennung seines privilegierten Pfändungsanschlusses. Wie sieht es<br />
da mit dem Erfordernis der Aktivlegitimation aus?<br />
- Sogar zur Begründung einer Klage, namentlich einer Widerspruchs- oder<br />
Kollokationsklage gegen den Begünstigten, kann die Einrede der Anfechtbarkeit<br />
herangezogen werden, vorausgesetzt, dass die Legitimation zur Anfechtung gegeben ist<br />
1257. Was kann gemacht werden, wenn ein Begünstigter<br />
Kollokationsklage führt, weil<br />
er geltend macht, er habe ein Pfandrecht, man aber denkt, diese Sicherstellung<br />
seiner Forderung sei anfechtbar?<br />
Dann kann ihm die Kollokation wegen der anfechtbaren Sicherstellung verweigert werden,<br />
sofern<br />
die betreffende Einrede erhoben wird. Die Forderung wird dann im 3. Rang kolloziert.<br />
Wurde die Forderung an sich schon in anfechtbarer Weise begründet, so kann sie sogar ganz<br />
abgewiesen<br />
werden.<br />
1258. Was kann man machen, wenn sich das gepfändete Objekt im Gewahrsam des<br />
begünstigten Dritten befand, und dieser seinen Anspruch darauf geltend macht,<br />
man aber denkt, dass das Obiekt der paulianischen Anfechtung unterliegt?<br />
Die Widerspruchsklage<br />
des Gläubigers (auf Aberkennung des Drittanspruchs, SchKG 108)<br />
kann<br />
mit der Anfechtbarkeit des Erwerbs begründet werden. Dasselbe gilt für den Fall einer<br />
Admassierungsklage der Konkursverwaltung, SchKG 242 III (muss begründender legitimiert<br />
sein).<br />
1259. Kann die Anfechtungsklage auch ausserhalb eines gerichtlichen Verfahrens<br />
geltedn gemacht werden?<br />
Ja, nämlich von der Konkursverwaltung oder – im Falle eines Liquidationsvergleichs – von<br />
den Liquidatoren<br />
im Rahmen der Feststellung der Aktiv- uns Passivmasse. Das ist praktisch<br />
bedeutsam,<br />
wenn die Verwirkungsfrist nach SchKG 292 abzulaufen droht.<br />
1260. Wovon hängt die Aktivlegitimation<br />
ab?<br />
Sie hängt davon ab, ob die Anfechtung infolge eines Konkurses oder einer Spezialexekution<br />
geltend gemacht wird.<br />
126<strong>1.</strong><br />
Wer ist in der Spezialexekution zur Anfechtung legitimiert?<br />
In einer Spezialexekution ist jeder Gläubiger legitimiert,<br />
der einen provisorischen oder einen<br />
definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat, SchKG 285 II Ziff. <strong>1.</strong> Auf Grund eines<br />
provisorischen Verlustscheins<br />
kann eine Klage des Gläubigers allerdings nur in dem Sinne<br />
gutgeheissen<br />
werden, dass das Anfechtungsobjekt erst verwertet werden darf, wenn in der<br />
hängigen Betreibung ein endgültiger Verlustschein ausgestellt wird.<br />
195
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1262. Wo zeigt sich die Subsidiarität der Anfechtung in der Spezialexekution deutlich?<br />
<strong>Der</strong> Angriff auf Drittvermögen ist erst erlaubt, wenn feststeht, dass das Schuldnervermögen<br />
zur Befriedigung der Pfändungsgläubiger nicht ausreicht.<br />
1263. Wer ist im Konkurs zur Anfechtung legitimiert?<br />
Im und nach dem Konkurs stehen die Anfechtungsansprüche der Masse zu, SchKG 200 und<br />
269. Darum ist hier ausschliesslich die Konkursverwaltung namens der Masse zur Anfechtung<br />
befugt. Ein Konkursgläubiger lann es nur dann sein, wenn ihm diese Recht nach SchKG 260<br />
abgetreten worden ist, SchKG 285 II Ziff. 2. Die Anfechtung<br />
ist hier aber schon von der<br />
Konkurseröffnung<br />
an zulässig, weil bei jedem Konkurs die Vermutung besteht, dass die<br />
Gläubiger zu Verlust kommen werden<br />
1264. Wer ist im Falle eines Liquidationsvergleichs zur Anfechtung legitimiert?<br />
Da wird das Anfechtungsrecht von den Liquidatoren ausgeübt, sofern es nicht an einzelne<br />
Gläubiger abgetreten worden is, SchKG 325! Steht bei 285 nicht im Gesetz.<br />
1265. Wer ist bei der Anfechtung passivlegitimiert?<br />
SchKG<br />
290:<br />
- in erster Linie einmal derjenige, der das anfechtbare Rechtsgeschäft mit dem Schuldner<br />
abgeschlossen hat, oder von diesem in anfechtbarer Weise befriedigt worden ist: der<br />
Vertragspartner des Schuldners oder der von ihm begünstigte<br />
- deren Gesamtnachfolger (insbesondere ihre Erben), gleichgültig ob sie gut- oder<br />
bösgläubig sind<br />
- ihre singularsukzessoren<br />
(Käufer, Zessionare), sofern sie bösgläubig sind; die Rechte<br />
gutgläubiger Einzelnachfolger des Begünstigten sind somit geschützt<br />
1266. *Wie lange beträgt die Anfechtungsfrist?<br />
Sie ist auf 2 Jahre befristet seit der Zustellung des Pfändungsverlustscheins oder seit der<br />
Konkurseröffnung, oder beim Liquidationsvergleich seit der Bewilligung der<br />
Nachlasstundung. Nach Ablauf der Fristen ist es verwirkt, SchKG 292 und 33<strong>1.</strong><br />
**Ja nicht die Anfechtungsfrist mit der materiellen Voraussetzung nämlich der Verdachtsfrist<br />
verwechseln<br />
oder die beiden gleichsetzen. Das eine ist eine materielle Voraussetzung und die<br />
Anfechtungsfrist ist eine Prozessvoraussetzung. Das Gericht weist, wenn eine<br />
Prozessvoraussetzung fehlt die Klage zurück ohne darauf einzutreten, wenn eine materielle<br />
Voraussetzung fehlt wird die Klage abgewiesen.<br />
1267. Was ist die Überschuldungsanfechtung für eine Klageart?<br />
Eine Leistungsklage auf Rückzahlung.<br />
1268. Bei wem muss man die Anfechtungsklage einreichen?<br />
Örtlich zuständug ist der Richter am schweizerischen<br />
Wohnsitz des Beklagten; bei<br />
ausländischem<br />
Wohnsitz kann in der Schweiz am Betreibungs- oder am Konkursort geklagt<br />
werden, SchKG 289.<br />
1269.<br />
Wonach bemisst sich der Streitwert?<br />
<strong>Der</strong> Streiwert bemisst sich nach dem Betrag, den die erfolgreiche Anfechtung dem Klager<br />
einbringen könnte. Das Ergebnis ist somit verschieden, je nach dem, ob im Zusammenhang<br />
mit einem Konkurs oder ausserhalb eines solchen geklagt wird:<br />
- Im Konkurs ergibt<br />
die erfolgreiche Anfechtung meist den vollen Wert des durch die<br />
anfechtbare Handlung entzogenen Vermögensteils; denn die Generalexekution erfasst<br />
stets das gesamte Vermögen des Schuldners<br />
196
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- In der Pfändungsbetreibung gilt als Streitwert entweder der Wert des entzogenen<br />
Vermögensteils oder der noch zu deckende kleinere Forderungsbetrag des<br />
Anfechtungsgläubigers.<br />
1270. Nach welchem Recht richtet sich das Prozessverfahren für die<br />
Anfechtungsklage?<br />
D as Prozessverfahren<br />
richtet sich nach kantonalem Recht.<br />
127<strong>1.</strong> Welche Wirkung hat die nicht erfolgreiche Anfechtung?<br />
Keine.<br />
1272. Welche Wirkung hat<br />
die Gutheissung der Anfechtungsklage?<br />
Sie ermöglicht das vollstreckungsrechtliche Beschlagsrecht an den seinerzeit entäusserten<br />
oder<br />
aufgegebenen Vermögensteilen und verschafft so den Anspruch auf amtliche<br />
Verwertung derselben sowie auf Befriedigung aus dem Erlös, SchKG 285 I. Kurzum das<br />
Vollstreckungssubstrat<br />
wird wieder hergestellt, so wie es sich ohne die angefochtene<br />
Rechtshandlung<br />
dargeboten hätte.<br />
Die Wiederherstellung geht jedoch – ihrem vollstreckungsrechtlichen Zweck entsprechend<br />
immer nur so weit, als die Befriedigung der beteiligten Gläubiger es erfordert; das sind<br />
sämtliche Konkurs- bzw. Nachlassgläubiger oder – in der Spezialexekution – der anfechtende<br />
Pfändungsgläubiger.<br />
1273. Was passiert, wenn der entzogene<br />
Vermögenswert grösser ist als der Betrag, den<br />
die volle Befriedigung des klagenden Pfändungsgläubigers erfordert?<br />
<strong>Der</strong> Mehrwert verbleibt stehts dem Dritten. <strong>Der</strong> Schuldner aber erhält nichts zurück, ihm wird<br />
nichts zurückgegeben, SchKG 29<strong>1.</strong> Das Urteil im Anfechtungsprozess hat somit nie<br />
materiellrechtliche Wirkungen.<br />
Das sieht man schon daraus, dass der Überschuss nicht an den<br />
Schuldner<br />
geht daraus zeigt sich, dass durch die Anfechtung das Rechtsverhältnis zwischen<br />
dem Schuldner und dem Dritten nicht aufgehoben ist.<br />
1274. Was für eine Wirkung hat das Urteil im Anfechtungsprozess?<br />
Es hat nich materiellrechtliche Wirkung. <strong>Der</strong> beklagte Dritte bleibt Eigentümer bzw.<br />
Gläubiger (Rechtsträger) einer anfechtbar erworbenen Sache, einer Forderung oder eines<br />
anderen Rechts: die erfolgreich angefochtenen Rechtshandlungen bleiben also zivilrechtlich<br />
gültig. Doch hat das Urteil insofern Reflexwirkung auf das materelle Recht des beklagten<br />
Dritten,<br />
als dieser die Beschlagnahme und Verwertung dulden muss und dadurch faktisch und<br />
wertmässig sein Recht verliert.<br />
1275. Ist ein letztinstanzliches Urteil berufungsfähig?<br />
Ja, bei gegebenem Streitwert.<br />
1276. Welche Wirkung hat das Urteil für den Beklagten?<br />
Er ist nach SchKG 291 I zur Rückgabe<br />
des anfechtbar Erworbenen verpflichtet. Damit ist<br />
gemeint,<br />
dass er die Pfändung oder Admassierung und die darauf folgende Verwertung der<br />
betreffenden Gegenstände dulden muss.<br />
Im Einzelnen gelten für diese Rückgabepflicht<br />
folgende Grundsätze:<br />
- Soweit noch vorhanden, sind die Vermögenswerte in natura beizubringen, samt den<br />
zivilen und natürlichen Früchten, dies selbst bei gutgläubigem<br />
Nutzen und Gebrauch des<br />
betreffenden Gegenstandes durch den Beklagten. Das folgt aus dem Grundsatz, dass die<br />
Vollstreckungsmasse so wiederherzustellen ist, als habe die anfechtbare Handlung nie<br />
stattgefunden. Die entäusserten Werte<br />
werden ohne weiteres zur Konkursmasse gezogen<br />
197
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
oder, wenn der Kläger auf Grund eines Pfändungsverlustscheines<br />
vorgegangen war,<br />
sofort gepfändet. Es bedarf somit keiner Realvollstreckung dieses Anfechtungsurteils<br />
nach kantonalem Prozessrecht, ebenso wenig der Rückübertragung des Eigentums an<br />
den Schuldner durch Grundbuchberichtigung oder Retrozession.<br />
- Ist Naturalerstattung nicht mehr oder nur noch zum Teil möglich, so hat der Beklagte<br />
nach den allgemeinen Regeln von OR 97 ff. Wertersatz zu leisten. Von dieser<br />
Ersatzpflicht kann er sich nur durch den Nachweis befreien, dass ihn an der<br />
Unmöglichkeit der Rückerstattung kein Verschulden trifft. Die Exkulpation ist ihm aber<br />
verwehrt, wenn er im Zeitpunkt des Untergangs oder der Wertverminderung der Sache<br />
bereits in Verzug gesetzt war; dann haftet er auch für Zufall OR 103.<br />
Befindet sich der<br />
Beklagte selbst im Konkurs, so kann der Anspruch auf Wertersatz gegen ihn nur als<br />
gewöhnliche Konkursforderung geltend gemacht werden.<br />
- Von dieser sehr umfassenden Einlieferungspflicht ist einzig der gutgläubige Empfänger<br />
einer Schenkung wenigstens teilweise befreit; er braucht nur die bei ihm noch<br />
vorhandene Bereicherung herauszugeben, 291 III.<br />
1277. Welche Art Urteil ist das Urteil, dass der Beklagte Wertersatz zu leisten hat?<br />
Es ist ein auf dem Betreibungswege vollstreckbares Leistungsurteil.<br />
1278. Haftet der Beklagte für verschuldete Wertverminderung an der Sache?<br />
Er haftet für verschuldete Wertverminderung bzw. Untergang<br />
der Sache. Für zufälligen<br />
Wertverlust<br />
bzw. Untergang braucht er dagegen nicht einzustehen; dafür kommen ihm aber<br />
auch zufällige Wertsteigerungen nicht zugut.<br />
1279.<br />
Muss der Beklagte auch den notwendigen Aufwand den ihn die Sache gekostet<br />
hat abgeben?<br />
<strong>Der</strong> notwendige Aufwand wird der Beklagte – als Masseverbindlichkeit – in Rechnung stellen<br />
dürfen, denn solcher wäre auch beim Schuldner angefallen. Auch wertvermehrende<br />
Investitionen müssten entschädigt werden.<br />
1280. Welche Wirkung hat die Erfüllung der „Rückgabepflicht“ der Beklagten auf die<br />
Rechte der Beklagten?<br />
- <strong>Der</strong> Beklagte hat Rückleistungs- und Ersatzansprüche<br />
- Weiter würde ein einst vom Schuldner getilgte Forderung wieder aufleben<br />
128<strong>1.</strong><br />
Welche Rückleistungsansprüche hat der Beklagte?<br />
Hatte der Beklagte für die angefochtene Rechtshandlung eine Gegenleistung erbracht (z.B. bei<br />
einer g emischten Schenkung), so hat er Anspruch darauf, dass sie ihm zurückerstattet wird<br />
(SchKG 291 I Satz 2 und 3).<br />
1282.<br />
Welche Rückleistungsansprüche hat der Beklagte im Konkurs des Schuldners?<br />
Im Konkurs des Schuldners hat der Beklagte in erster Linie Anspruch<br />
auf Rückerstattung der<br />
in der Konkursmasse noch vorhandenen Gegenleistungen; er kann gegebenenfalls deren<br />
Aussonderung verlangen. Ist seine Leistung nicht mehr effektiv vorhanden, steht ihm das<br />
Recht auf Herausgabe der vorhandenen<br />
Bereicherung zu. Wenn aber in der Konkursmasse<br />
überhaupt<br />
nichts mehr von der Gegenleistung des Beklagten vorhanden ist – also wenn weder<br />
faktisch noch wertmässig – kann nur noch eine Ersatzforderung gegen den Schuldner<br />
persönlich geltend gemacht werden.<br />
1283. Gegen wen richtet sich der Herausgabeanspruch (Rückleistungsanspruch) auf<br />
die Sache (im Konkurs)?<br />
198
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
<strong>Der</strong> Herausgabeanspruch auf die Sache oder auf die Bereicherung richtet sich gegen die<br />
Masse. Es handelt sich dabei, wie beim Ersatz für notwendigen Aufwand, um eine<br />
Masseverbindlichkeit. Mit dieser könnte<br />
der Beklagte seine eigene Pflicht zur Leistung von<br />
Wertersatz<br />
verrechnen.<br />
1284. Gegen wen richtet sich die gegen den Schuldner persönlich gerichtete<br />
Ersatzforderung?<br />
Dies muss der Beklagte als Konkursforderung eingeben. Seine Pflicht zu Wertersatz könnt er<br />
dann nicht mit derselben, sondern nur mit der ihm zufallenden Konkursdividende verrechnen.<br />
1285.<br />
Gegen wen richten sich die Gegenansprüche (auf Herausgabe bzw. auf Ersatz) in<br />
der Spezialexekution?<br />
Sie richten sich durchwegs gegen den Schuldner. Besteht die Gegenleistung des Beklagten in<br />
einer Sache, die für den klagenden Pfändungsgläubiger bereits gepfändet wurde, so kann der<br />
Beklagte sie oder ihren Erlös im Widerspruchsverfahren herausverlangen. Hat der<br />
Pfändungsgläubiger<br />
daraus schon Befriedigung erlangt, so kann der Beklagte die eigene<br />
Leistung entsprechend kürzen.<br />
1286. Was passiert, wenn nach erfolgreicher Anfechtung die Tilgung einer Forderung<br />
des Beklagten dahinfällt?<br />
Dann lebt diese mit der Rückerstattung des Empfangenen wieder auf, SchKG 291 II.<br />
- Im Konkurs nimmt die wiedererstandene Forderung als Konkursforderung teil; sie wird<br />
vom Amtes wegen entsprechend<br />
kolloziert. Mit der darauf entfallenden<br />
Konkursdividende kann der Anfechtungsbeklagte die ihm nach SchKG 291 I obliegende<br />
Rückleistung der Zahlung verrechnen (Verrechnung mit der wiedererstandenen<br />
Forderung wäre hingegen ausgeschlossen)<br />
- In der Pfändungsbetreibung ist die wiederauflebende Forderung durch<br />
Pfändungsanschluss geltend zu machen<br />
9. Kapitel:<br />
<strong>Der</strong> Nachlassvertrag<br />
§ 53 Wesen, Rechtsnatur und Arten des Nachlassvertrages<br />
1287. Welche Typen des Nachlassvertrages gibt es?<br />
Es<br />
gibt der gerichtliche Nachlssvertrag, davon spricht man, wenn er unter Mitwirkung des<br />
Gerichts zu stande kommt, andernfalls<br />
gibt es noch der aussergerichtliche Nachlassvertrag.<br />
1288. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem gerichtlichen<br />
und dem<br />
aussergerichtlichen Nachlassvertrag?<br />
Beide Typen sind wesensverschieden, und zwar nicht nur in ihrem Zustandekommen, sondern<br />
auch ihren Voraussetungen und Wirkungen nach. Allein ihr Zweck bleibt immer derselbe:<br />
dem Schuldner soll das Durchstehen einer Zwangsvollstreckung erspart bleiben, die<br />
Danierung<br />
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse ermöglicht und das wirtschaftliche<br />
Fortkommen erleichter werden.<br />
1289. Welches Interesse könnten die Gläubiger an einem Nachlassvertrag haben?<br />
Oft wird ihnen der Nachlass ein besseres Ergebnis bringen als die strenge Zwangsexekution.<br />
<strong>Der</strong> Schuldner kann duch Fortsetzung seiner Erwerbstätigkeit zur besseren Befriedigung<br />
seiner Gläubiger beitragen, und wo Verwertungen nötig sind, kann eher die günstigste<br />
Gelegenheit abgewartet werden als<br />
in der formstrengeren Zwangsverwertung.<br />
199
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1290. Worauf beruht der aussergerichtliche Nachlassvertrag?<br />
Er beruht auf rein privaten Rechtsgeschäften, die der Schuldner mit jedem Gläubiger einzeln<br />
abschliesst. Er besteht somit aus einer Summe von individuellen Schulderlassverträgen, deren<br />
Inhalt nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit bestimmt werden kann, OR 19. Infolgedessen<br />
bietet er keine Gewähr für gleiche Behandlung aller Gläubiger.<br />
129<strong>1.</strong> Bindet der aussergerichtliche Nachlassvertrag alle Personen?<br />
Nein, seiner privatrechtlichen Natur nach bindet er nur jene Personen, die ihm zugestimmt<br />
haben. Sofern also jeder Gläubiger seine Zustimmung vom Mitziehen aller übrigen Gläubiger<br />
abhängig macht, kann der Nachlassvertrag nur im Einverständnis aller Gläubiger zustande<br />
kommen.<br />
Besteht<br />
eine grosse Gläubigeruahl sieht das aussergerichtliche Nachlasskonzepr wegen der<br />
Unübersichtlichkeit deshalb oft vor, die Kleingläubiger vorweg zu befriedigen,<br />
so dass hierauf<br />
der Vertrag unter den (wenigen) Hauptgläubigern ausgehandelt werden kann.<br />
1292. Was kann der nicht konkursfähige Schuldner/eine überschuldete<br />
Kapitalgesellschaft<br />
oder Genossenschaft, im aussergerichtlichen<br />
Nachlassverfahren machen um sich vom grössten Druck zu befreien?<br />
Damit das Verfahren ohne Betreibungsdruck abläuft, kann der kleine, nicht konkursfähige<br />
Schuldner um Stundung zwecks einvernehmlicher Schuldenbereinigung nachsuchen,<br />
SchKG<br />
333<br />
ff.<br />
Eine überschuldete Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft kann um Konkursaufschub,<br />
OR<br />
725a ersuchen.<br />
Anders als das eigentliche Nachlassverfahren nach SchKG 293 ff bezwecken diese beiden<br />
Stundungsverfahren in erster Linie eine aussergerichtliche Regelung der Schulderverhältnisse.<br />
1293. Was kann der Schuldner machen, wenn<br />
die aussergerichtliche Regelung der<br />
Schuldverhältnisse scheitert?<br />
Dann steht dem Schuldner immer<br />
noch das gerichtliche Nachlassverfahren offen, SchKG 336;<br />
dort ist zwar die Vertragsfreiheit eingeschränkt, dafür ist keine Einstimmigkeit erforderlich.<br />
1294.<br />
Was ist die Definition des gerichtichen Nachlassvertrages?<br />
Man kann den gerichtlichen Nachlassvertrag umschreiben als das Ergebnis eines gesetzlich<br />
geregelten Verfahrens, in welchem der Schuldner<br />
mit Zustimmung einer bestimmten<br />
Mehrheit seiner Gläubiger sowie unter Mitwirkung und Aufsicht seine Schulden auf eine für<br />
alle Gläubiger verbindliche Weise tilgen kann.<br />
1295. Ist der gerichtliche Nachlassvertrag ein Vertrag?<br />
Nein, denn übereinstimmende Willensäusserungen zwischen dem Schuldner und seinen<br />
Gläubigern bilden nicht durchwegs und jedenfalls nicht ausschliesslich seinen<br />
Entstehungsgrund.<br />
Vielmehr kommt er durch ein Zusammenwirken des Schuldners, der Gläubigermehrheit und<br />
staatlich<br />
bestellter Organe zustande.<br />
1296. Was ist der Nachlassvertrag dann?<br />
Die Voraussetzungen seines Zustandekommens, genügendes Angebot des Schuldners,<br />
Zustimmung der Gläubigermehrheit,<br />
Mitwirkung des Gerichts, sowie seine Funktion<br />
qualifizieren den gerichtlichen Nachlassvertrag als ein Surrogat der Zwangsvollstreckung.<br />
Er tritt als besonderes öffentlich-rechtliches<br />
Institut an deren Stelle und schliesst sie für die<br />
von<br />
ihm betroffenen Forderungen schlechthin aus. Nachlassvertrag und Zwangsvollstreckung<br />
200
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
unterscheiden sich im Wesentlilchen nur durch ihre Verfahren, die Art und Weise, wie die<br />
Gläubiger vom Schuldner zufrieden gestellt werden.<br />
Das Ergebnis eines Nachlassvertrages ist gleich, wie dasjenige der Zwangsvollstreckung, für<br />
sämtliche Gläubiger verbindlich. Für die zustimmenden beruht es auf Erlass und Vergleich;<br />
für die nicht zustimmenden bedeutet es Zwangserlass und Zwangsvergleich.<br />
1297. Welche Arten gerichticher Nachlssverträge gibt es?<br />
Das Vergleichsangebot des Schuldners an seine Gläubiger, das die Zwangsvollstreckung<br />
gegen ihn ausschalten soll, kann verschiedenen Inhalts sein. Danach unterscheidet man drei<br />
Grundtypen von Nachlassverträgen:<br />
- <strong>Der</strong> Stundungsvergleich<br />
- <strong>Der</strong> Prozent- oder Dividendenvergleich<br />
- <strong>Der</strong> Liquidationsvergleich<br />
1298. Was wird mit dem Stundungsvergleich<br />
bezweckt?<br />
Damit bietet der Schuldner seinen Gläubigern<br />
die vollständige Tilgung ihrer Forderungen<br />
n ach einem bestimmten Zeitplan an.<br />
1299.<br />
Was versteht man unter dem Prozent- oder Dividendenvergleich?<br />
<strong>Der</strong> zielt auf die Bezahlung nur noch eines Teils der Forderung<br />
in gleichem Verhältnis für alle<br />
Gläubiger und auf Erlass des Restes.<br />
1300.<br />
Was verstht man unter dem Liquidationsvergleich=Nachlassvertrag mit<br />
Vermögensabtretung?<br />
Dazu führt das Angebot des Schuldners, den Gläubigern sein gesamtes Vermögen oder<br />
wenigstens einen Teil davon zur Verfügung<br />
zu stellen auf dass sie sich selbst aus dessen Erlös<br />
Befriedigung<br />
verschaffen.<br />
Ein solcher Nachlassvertrag nähert sich schon stark dem Konkurs: eine in der Art des<br />
Konkurses durchzuführende, jedoch von manchen formellen Vorschriften des Konkurses<br />
befreite Vermögensliquidation.<br />
130<strong>1.</strong> Unter welchem Titel<br />
des SchKG stehen der Stundungs- und der<br />
Prozentvergleich?<br />
Sie stehen unter dem Titel „Ordentlicher Nachlassvertrag“, SchKG 314 ff.<br />
1302.<br />
Wo steht der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung?<br />
In SchKG 3177 ff.<br />
1303. Worauf zielt der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung im Vergleich<br />
zum<br />
Stundungs- und der Prozentvergleich ab?<br />
Bei den ordentlichen Nachlassverträgen steht die Sanierung des Schuldner<br />
im Vordergrund,<br />
beim Nachlassvertrag<br />
mit Vermögensabtretung (wie beim Konkurs) die wirtschaftliche<br />
Liquidation.<br />
201
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
§ 54 Das Nachlassverfahren<br />
1304. Welche Standien gibt es im Nachlassverfahren, bis der Nachlassvertrag zustande<br />
kommt?<br />
Drei Stadien:<br />
Bewilligung der Nachlasstundung (Bewilligungsverfahren)<br />
Die Zustimmung der Gläubiger zum Vergleichsangebot<br />
(Zustimmungsverfahren)<br />
Die gerichtliche Bestätigung des Nachlassvertrages<br />
(Bestätigungsverfahren)<br />
Danach kommt es zum Vollzug bzw. zur<br />
Durchführung des Nachlassvertrages<br />
1305. Welche Organe sind im Nachlassverfahren tätig?<br />
- das Nachlassgericht<br />
- der Sachwalter<br />
- die Gläubigerversammlung oder ein Gläubigerausschuss<br />
- die Liquidatoren<br />
1306. Von wem kann das Nachlassverfahren eingeleitet werden?<br />
Es kann von Amtes wegen oder auf Gesuch des Schuldners oder eines Gläubigers eingeleitet<br />
werden.<br />
1307. Wann kommt es zur Einleitung von Amtes wegen?<br />
Wenn der Konkursrichter anlässlich der Prüfung eines Konkursbegehrens seinen Entscheid<br />
aussetzt und die Akten von sich aus dem Nachlassgericht überweist, weil „Anhaltspunkte“ für<br />
das Zustandekommen eines Nachlassvertrages bestehen, SchKG 173a II. Dadurch soll der<br />
Konkurs über sanierbare Unternehmen vermieden werden.<br />
1308. Welcher Schuldner kann die Bewilligung für eine Nachlasstundung stellen?<br />
Jeder Schldner, sei er eine natürliche oder eine juristische Person, kann beim Nachlassgericht<br />
ein Gesuch um Bewilligung der Nachlasstundung stellen, SchKG 293 I. Für den<br />
Konstenvorschuss gilt GebV 49.<br />
1309. Was muss das Gesuch des Schuldners um Bewilligung einer Nachlassstundung<br />
enthalten?<br />
Das Gesuch muss eine Begründung und den Entwurf eines Nachlassvertrages enthalten. Dazu<br />
genügt, dass der Schuldner erst einmal allgemein seine Vorstellungen von der Art und Weise<br />
202
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
der<br />
Bereinigung seiner Schuldverhältnisse bekannt gibt; ein konkreter Entwurf gibt es oft erst<br />
im Verlauf des Verfahrens.<br />
Das<br />
Gesuch muss weiter von sämtlilchen Unterlagen begleitet sein, aus denen die<br />
Vermögens- Ertrags- und Einkommenslage ersichtlich ist (Bilanz, Erfolgsrechnung,<br />
Anhänge); Buchführungspflichtige haben noch ein Verzeichnis ihrer Geschäftsbücher<br />
beizulegen.<br />
1310. Kann ein diesen Anforderungen nicht genügendes Gesuch nachträglich noch<br />
ergänzt werden?<br />
Ja, SchKG 32 IV.<br />
131<strong>1.</strong> Welche Konsequenzen hat ein Schuldner zu tragen, wenn er seine<br />
Vermögenslage zu günstig oder zu ungünstig darlegt, so dass sich die Gläubiger<br />
kein zuverlässiges Bild machen können?<br />
In diesem Fall wird er nach StGB 170 strafbar.<br />
1312. Wann kann der Gläubiger mit einem Gesuch die Einleitung eines<br />
Nachlassverfahrens verlangen, was muss er dem Gesuch beilegen?<br />
Wenn er vor der Alternative steht, das Konkursbegehren zu stellen, kann er mit einem<br />
begründeten Gesuch die Einleitung des Nachlassverfahrens verlangen, SchKG 293 II.<br />
1313. Von wem wird das Nachlassgesuch geprüft?<br />
Es wird von dem am ordentlichen Betreibungsort zuständigen Nachlassgericht geprüft,<br />
SchKG 293 III. Den Kantonen steht es frei, ein unteres und ein oberes Nachlassgericht<br />
vorzusehen, SchKG 294 III.<br />
1314. Wie läuft das Verfahren ab, in dem das Nachlassgesuch<br />
behandelt wird?<br />
<strong>Der</strong> Nachlassrichter prüft die Voraussetzungen der Nachlassstundung von Amtes wegen<br />
(Untersuchungsmaxime). Er trifft seinen Entschei im Summarverfahren.<br />
- Er muss unverzüglich nach Eingang des Gesuchs oder der vom Konkursrichter<br />
überwiesenen Akten,<br />
die zur Erhaltung des Vermögens des Schuldners notwendigen<br />
vorsorglichen Massnahmen treffen, SchKG 293 III.<br />
- Er kann die Nachlassstundung einstweilen für höchstens 2 Monate provisorisch<br />
bewilligen, um drohenden Betreibungsdruck abzuwenden, soweie einen provisorischen<br />
Sachwalter<br />
ernennen und diesen mit der Präfung der wirtschaftlichen Lage des<br />
Schuldners und der Sanierungsaussicht zu betrauen<br />
- Die provisorische Stundung wird publiziert und im Grundbuch angemerkt, SchKG 293<br />
IV i.V.m. 296.<br />
- <strong>Der</strong> Sachwalter soll die für den definitiven Stundungsentscheid erforderlichen<br />
Beurteilungsgrundlagen beschaffen; im Übrigen stehen ihm schon die einem definitiven<br />
Sachwalter in SchKG 298 eingeräumten befugnisse zu.<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner und gegebenenfalls der antragsstellende Gläubiger ist unverzüglich zur<br />
Verhandlung vorzuladen. <strong>Der</strong> Nachlassrichter kann auch andere Gläubiger anhören,<br />
SchKG 294 I.<br />
- Namentlich, wenn das Verfahren von Amtes wegen in Gang gekommen ist oder ein<br />
Gläubiger das Gesuch gestellt<br />
hat, kann der Schuldner aufgefordert werden, die<br />
erforderlichen Unterlagen vorzulegen, SchKG 294 I.<br />
Innert welc<br />
1315. her Zeitspanne muss ein Nachlassrichter entscheiden, ob er die<br />
Nachlasstundung bewilligt?<br />
203
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Sobald der Nachlassrichter im Besitz der erforderlichen Unterlagen ist, entscheidet er so rasch<br />
als möglich, SchKG 294 II.<br />
1316. Wie kann der Nachlassrichter entscheiden?<br />
Indem er entweder die Nachlssstundung bewilligt oder das Gesuch abweist oder aus formellen<br />
Gründen gar nicht darauf eintritt.<br />
Vom<br />
Konkursrichter überwiesene Akten sendet er diesem zurück, wenn er die<br />
Nachlasstundung nocht bewilligen kann.<br />
1317. Ist die Rückweisung<br />
selbständig anfechtbar?<br />
Nein,<br />
erst der nachfolgende Entscheid des Konkursrichters (insb. die Konkurseröffnung) wäre<br />
anfechtbar.<br />
1318. Was setzt die Bewilligung der Stundung materiell<br />
voraus?<br />
Dass Aussicht auf das Zustandekommen eines Nachlassvertrages<br />
besteht, SchKG 294 II, 295<br />
I. Das ist der Fall, wenn nach den gegebenen Verhältnissen mit einiger Wahrscheinlichkeit<br />
erwartet werden darf, dass die Gläubiger dem Angebot zustimmen werden und der<br />
Nachlassvertrag<br />
dann bestätigt werden kann.<br />
Entscheidend für diese Beurteilung sind vor allem die Vermögens-, Ertrags- und<br />
Einkommenslage des Schuldners, die hinreichende Sicherstellung bestimmter Gläubiger<br />
sowie<br />
der Durchführung des Vertrages und der Kosten, SchKG 306.<br />
Bis zu einem gewissen Grad dürfen auch öffentliche Interessen<br />
berücksichtigt werden.<br />
1319. Wie kann der Entscheid des Nachlassrichters weitergezogen werden?<br />
Wo ein oberes kantonales Nachlassgericht<br />
besteht, kann der Entscheid binnen 10 Tagen nach<br />
dessen<br />
Eröffnung weitergezogen werden, SchKG 294 III.<br />
1320. Wer kann den Entscheid des Nachlassrichters weiterziehen?<br />
- der Schuldner sowie der gesuchstellende Gläubiger, SchKG 194 III<br />
- von den anderen Gläubigern nur, soweit er die Ernennung eines Sachwalters betrifft<br />
(SchKG 294 IV, z.B. weil er nicht unabhängig oder weil er zu teuer sei)<br />
132<strong>1.</strong> Wie kann der Entscheid des oberen oder einzigen Nachlassgerichts<br />
weitergezogen werden?<br />
Er ka nn als Vollstreckungssache nur noch mit StBE beim Bundesgericht angefochten werden.<br />
1322. Wie läuft das Bewilligungsverfahren ab, wenn der Kokurs schon über dem<br />
Schuldner verhängt<br />
ist?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner kann nach SchKG 332 einen Nachlassvertrag selbst dann noch vorschlagen,<br />
wenn über ihn bereits der Konkurs eröffnet ist.<br />
- Dann erübrigt sich das Bewilligungsverfahren, denn der Konkurs verschafft dem<br />
Schuldner schon eine umfassende Stundung (SchKG 206).<br />
- Es bedarf auch keiner weiteren Organe<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner gelangt mit seinem Vorschlag an die Konkursverwaltung, welche ihn<br />
zuhanden der 2. Gläubigerversammlung begutachtet.<br />
- Die Aufgaben des Sachwalters übernimmt soweit erforderlich, die Konkursverwaltung<br />
,<br />
SchKG 332 II. <strong>Der</strong>en Antrag an die Gläubigerversammlung<br />
führt direkt zum<br />
Zustimmungsverfahren<br />
- <strong>Der</strong> Lauf des Konkursverfahrens wird durch Einreichung des Nachlassvorschlages nicht<br />
beeinträchtigt. Erreicht es das Stadium<br />
der Verwertung wird diese aber, wenn der<br />
204
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Voschlag nicht verzögernd erscheint bis zum Entscheid des Nachlassrichters über die<br />
Bestätigung von der Konkursverwaltung<br />
eingestellt.<br />
1323. Was passiert, wenn der Nachlassrichter dem Gesuch zur Bewilligung des<br />
Nachlassverfahrens entspricht?<br />
Dann gewährt der Nachlassrichter dem Schuldner die Nachlassstundung und ernennt einen<br />
oder mehrere Sachwalter.<br />
1324.<br />
Welches ist die Rechtsstellung des Sachwalters?<br />
<strong>Der</strong> Sachwalter braucht nicht Beamter zu sein, es kommen<br />
selbst juristische Personen in<br />
Betracht.<br />
<strong>Der</strong> Sachwalter<br />
nimmt aber als Vollstreckungsorgan stehts eine öffentlich-rechtliche Stellung<br />
ein(SchKG<br />
295 III); deshalb untersteht er der Protokollpflicht, SchKG 8, der<br />
Ausstandspflicht, SchKG 10, dem Selbstkontrahierungsverbot, SchKG 11, der<br />
Disziplinaraufsicht der Aufsichtsbehörde, SchKG 14, und seine Verfügungen können mit<br />
Beschwerde bei der kantonalen Aufsichtsbehörde angefochten werden (SchKG 17 ff);<br />
schliesslich haftet der Kanton auch für widerrechtliche Handlungen des Sachwalters (SchKG<br />
5). Seine Rechtsstellung ist daher mit derjenigen<br />
einer ausseramtlichen Konkursverwaltung<br />
vergleichbar.<br />
1325. Welche Wirkung hat die Bestätigung des Nachlassverfahrens<br />
durch das<br />
Nachlassgericht?<br />
Damit<br />
hören die amtilchen Funktionen des Sachwalters im Allgemeinen auf, ausser er wird<br />
mit dem Vollzug eines ordentlichen Nachlassvertrages beauftragt, SchKG 314 II oder<br />
bei<br />
einem Liquidationsvergleich als Liquidator eingesetzt, SchKG 317 II.<br />
1326.<br />
Welche Aufgaben hat der Sachwalter generell?<br />
<strong>Der</strong> Sachwalter führt das Nachlassverfahren während der Stundungsphase<br />
nach den<br />
gesetzlichen Vorschriften durch und wahrt dabei die Interessen des Schuldners<br />
und der<br />
Gläubiger<br />
unparteiisch.<br />
1327.<br />
Welche Aufgaben hat der Sachwalter im Einzelnen?<br />
Im Einzelnen überträgt ihm das Gesetz in SchKG 295 II:<br />
- Die Überwachung der Handlungen des Schuldners, wobei dem Sachwalter ein<br />
Weisungsrecht zukommt (SchKG 298 I)<br />
- Vorbereitung und Leitung des Zustimmungsverfahrens, insbesondere durch Feststellung<br />
der Aktiven und Passiven (Verweis auf SchKG 298 – 302 und 304) Inventarisierung<br />
und<br />
Schätzung des Schuldnervermögens, Schuldenruf, Zusammenstellung der Eingaben,<br />
Vorbereitung und Leitung der Gläubigerversammlung und schliessich durch<br />
Ausarbeiten des konkreten Nachlassvertrages<br />
und Berichterstattung an die Gläubiger<br />
(SchKG 302)<br />
- Instruktion des Bestätigungsverfahrens durch Berichterstattung<br />
an das Nachlassgericht<br />
mit der Empfehlung zur Bestätigung oder<br />
Verwerfung des Nachlassvertrages, SchKG<br />
304<br />
- Anzeigepflicht bei unzulässigem (oder weisungswidrigem)<br />
Verhalten des Schuldners,<br />
SchKG 298 III<br />
- Und die Pflicht zu Periodischer Berichterstattung, SchKG 295 II Lit.c<br />
Damit der Sachwalter diese Aufgaben<br />
richtig erfüllen kann, ist ihm der Schuldner<br />
auskunftspflichtig. Ausser diesen gesetzlichen Obliegenheiten kann der Nachlassrichter dem Sachwalter noch<br />
besondere Aufgaben auftragen.<br />
205
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1328. Wie wird der Sachwalter für seine Tätigkeit entschädigt?<br />
<strong>Der</strong><br />
Nachlassrichter setzt die Entschädigung des Sachwalters pauschal fest; den Gesuchsteller<br />
kann er zur Sicherstellung anhalten. Mit Vorteil wird der Sachwalter periodisch Vorschuss<br />
verlangen.<br />
1329. Wie kann der Sachwalter<br />
seine Lohnforderung geltend machen, wenn die<br />
Sanierungen scheitern und es trotzdem zum Konkurs oder zu einem<br />
Liquidationsvergleich kommt?<br />
Dann wird die Honorarforderung des Sachwalters in deisem Verfahren als<br />
Masseverbindlichkeit<br />
behandelt, SchKG 310 II.<br />
1330. Während welcher Zeit/zu welchem Zweck bewilligt der Nachlassrichter<br />
die<br />
Nachlassstundung?<br />
<strong>Der</strong> Weg bis zum Zustandekommen des Nachlassvertrages ist mehr oder weniger lang; es<br />
braucht Zeit, das Zustimmungsverfahren vorzubereiten und durchzuführen. Hiefür bewilligt<br />
der Nachlassrichter dem Schuldner Stundung, während deren Dauer zwischen ihm und einen<br />
Gläubigern weitgehend Waffenstillstand herrscht.<br />
Ob die Beteiligten<br />
einen ordentlichen Nachlassvertrag oder einen Liquidationsvergleich<br />
anstreben<br />
spielt noch keine Rolle.<br />
133<strong>1.</strong> Wem wird die Nachlassstundung<br />
im Hinblick auf ihre Wirkung mitgeteilt?<br />
Im Hinblick auf ihre Wirkung – insbesondere das Betreibungsverbot und die<br />
Verfügungsbeschränkung – wird die Bewilligung der Nachlassstundung öffentlich bekannt<br />
gemacht sowie dem Betreibungsamt und dem Grundbuchamt unverzüglich<br />
mitgeteilt, SchKG<br />
296.<br />
1332. Wann beginnt die Stundung zu wirken?<br />
Die Stundung wirkt nicht erst von ihrer Publikation an, sondern – wie die Konkurseröffnung<br />
–<br />
unmittelbar mit dem Bewilligungsentscheid;<br />
infolgedessen braucht sie im Grundbuch nur<br />
noch<br />
deklaratorisch angemerkt zu werden. Wird die Bekanntmachung nicht schon vom<br />
Nachlassrichter veranlasst, besorgt sie der Sachwalter, der damit gleich den Schuldenruf<br />
verbinden kann, SchKG 300 I.<br />
1333. Wie lange dauert die Stundung?<br />
Die Stundung<br />
wird zunächst für 4 – 6 Monate gewährt, SchKG 295 I. Reicht die angesetzte<br />
Frist nicht aus, kann sie auf Antrag des Sachwalters insgesamt auf 12 Monate verlängert<br />
werden,<br />
SchKG 295 IV. In komplexen Fällen ist Verlängerung sogar bis auf 24 Monate<br />
zulässig. Soll die Stundung mehr als 12 Monate betragen, müssen allerdings die Gläubiger<br />
angehört<br />
werden, SchKG 295 IV Satz 2.<br />
Die Dauer einer provisorisch gewährten Stundung wird an die definitive nicht angerechnet,<br />
SchKG<br />
295 I.<br />
1334. Was<br />
muss man machen, wenn man die Stundung verlängert?<br />
Je de Verlängerung der Stundung ist wie die erste zu publizieren und den interessierten<br />
Ämtern<br />
mitzuteilen.<br />
1335. Bis wann erstrecken sich die Wirkungen der Nachlassstundung?<br />
Sie erstrecken sich über<br />
die eingeräumte Dauer hinaus bis zur Publikation der Bestätigung des<br />
Nachlassvertrages durch das Nachlassgericht; dies allerdings nur, wenn der Sachwalter die<br />
206
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Akten<br />
dem Gericht noch vor Ablauf der Stundung einreicht, SchKG 304 I, sonst fallen ihre<br />
Wirkungen bereits mit dem Ablauf der Stundungsfrist dahin.<br />
1336. Inwiefern ist der Schuldner während der Stundung vor<br />
Vollstreckungshandlungen<br />
geschützt?<br />
Bereits<br />
hängige Betreibungen dürfen nicht fortgesetzt werden und neue nicht mehr eingeleitet<br />
werden, SchKG 297 I.<br />
Früher vollzogene Handlungen (z.B. eine Pfändung)bleiben dagegen wirksam, bis<br />
über das<br />
Zustandekommen des Nachlassvertrages entschieden ist.<br />
Gepfändetes, abgeliefertes oder eingelöstes Bargeld darf sogar noch verteilt werden, Verweis<br />
auf SchKG 199 II.<br />
1337. Welche Wirkungen hat die Nachlassstundung?<br />
- Betreibungsverbot<br />
- Hemmung des Fristenlaufs<br />
- Zinsen und Fälligkeit<br />
- Verrechnung<br />
- Verfügung und Geschäftsführung<br />
1338. Welche Handlungen sind vom Betreibungsverbot ausgenommen?<br />
SchKG<br />
297 II:<br />
- die Betreibung auf Pfändung für Forderungen der ersten Klasse, selbst bei<br />
Konkursfähigkeit des Schuldners, SchKG 297 II Ziff. 1<br />
- die Betreibung auf Grundpfandverwertung für grundpfandgesicherte Forderungen, die<br />
Verwertung bleibt aber ausgeschlossen<br />
- die Betreibung auf Pfändung für Forderungen, die im Falle eines nachfolgenden<br />
Konkurses oder eines Liquidationsvergleiches Masseverbindlichkeit wären (! Steht nicht<br />
im Gesetz)<br />
Möglich sind auch der Arrest und andere unaufschiebbare Sicherungsmassnahmen, die aber<br />
schon ihrem Wesen nach eigentlich keine Betreibungshandlungen darstellen<br />
1339. Was muss das Betreibungsamt machen, wenn während hängiger<br />
Nachlassstundung das Betreibungsbegehren gestellt wird?<br />
Es<br />
ist vom Betreibungsamt gegebenenfalls zu protokollieren und gegebenenfalls nach dem<br />
Wegfall der Stundung zu vollziehen.<br />
1340. Welche Wirkung hat die Nachlassstundung auf die Fristen?<br />
Soweit der Schuldner nicht mehr betrieben werden darf, wird der Lauf jeder Verjährungs-<br />
oder Verwirkungsfrist gehemmt (SchKG 297 I)<br />
134<strong>1.</strong> Welche Wirkung hat die Nachlassstundung auf die Zinsen?<br />
Mit der Bewilligung<br />
der Stundung werden die vorher entstandenen nicht pfandgesicherten<br />
Forderungen<br />
gegenüber dem Schuldner unverzinslich, sofern der (ordentliche Nachlassvertrag<br />
nichts anderes bestimmt, SchKG 297 III.<br />
1342. Was passiert mit den Zinsen, wenn die Nachlassstundung wieder aufgehoben<br />
wird?<br />
Dann tritt wie beim Konkurswiderruf Verzinslichkeit ex tunc wieder ein.<br />
1343. Welche Wirkung hat die Nachlassstundung auf die Fälligkeit der Forderungen?<br />
207
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Auf die Fälligkeit der Forderungen hat die Nachlassstundung keinen Einfluss; sie verfallen<br />
normal. Nur wenn ein Liquidationsvergleich zustande kommt, werden sämtliche<br />
Nachlassforderungen,<br />
die grundpfandgesicherten ausgenommen, wie im Konurs füllig.<br />
1344. Welche Wirkung hat die Nachlassstundung<br />
auf die Verrechenbarkeit von<br />
Forderungen?<br />
Für die Verrechenbarkeit<br />
einer Nachlassforderung mit einer Forderung gegen den Gläubiger<br />
während der Stundung gelten die konkursrechtlichen Regeln; nur tritt als Stichtag an die<br />
Stelle der Konkurseröffnung die Bekanntmachung der Stundung<br />
oder gegebenenfalls des<br />
vorausgegangenen Konkursaufschubes, SchKG 297 IV.<br />
1345.<br />
Welche Wirkung hat die Nachlassstundung auf das Verfügungsrecht des<br />
Schuldners allgemein?<br />
Zum Schutz der Gläubiger ist während der Stundung das Verfügungsrecht des Schuldners<br />
ü ber sein Vermögen eingeschränkt<br />
– nicht aber, wie im Konkurs, völlig aufgehoben.<br />
Das gilt auch wenn von Anfang an ein Liquidationsvergleich angestrebt wird; der Schuldner<br />
verliert sein Verfügungsrecht hier erst mit der rechtskräftigen Bestätigung des Vertrages<br />
vollständig, SchKG 319 I. also nicht schon<br />
von der Stundungsbewilligung an!<br />
Dem<br />
Schuldner werden wegen dem sonst allgemeinen Ziel der Sanierung nur bestimmte<br />
Rechtshandlungen verboten; im Übrigen darf aber – allerdings vom Sachwalter<br />
überwacht,<br />
der ihm Weisungen<br />
erteilen darf – frei verfügen, SchKG 298 und 295 II.<br />
1346. Welches Handeln bleibt dem Schuldner trotz Nachlssstundung<br />
erlaubt?<br />
Grundsätzlich soll der Schuldner sein Geschäft, unter Aufsicht des Sachwalters, selbst<br />
weiterführen. Er darf die dadurch bedingten geschäftsüblichen<br />
Verträge selbst abschliessen<br />
und erfüllen,<br />
SchKG 298 I.<br />
1347. In welche Kategorien kann man die dem Schuldner verbotenen Handlungen<br />
einteilen?<br />
Hier ist zu unterscheiden zwischen Handlungen:<br />
- die das Gesetz,<br />
- der Nachlassrichter oder<br />
- der<br />
Sachverwalter<br />
dem Schuldner verbieten<br />
1348.<br />
Welches sind gesetzlich verbotene Handlungen des Schuldners?<br />
Gesetzlich verboten sind dem Schuldner (wie auch dem Sachverwalter) während der<br />
Stundung nur die in SchKG 298 II abschliessend aufgezählten Rechtshandlungen. Die<br />
Verfügungsbefugnis des Schuldners ist entsprechend<br />
aufgehoben. So kann er nicht mehr<br />
rechtsgültig:<br />
- Teile des Anlagevermögens (insbesondere Grundstücke, Tochtergesellschaften<br />
oder<br />
eigenständige Betriebsteile) veräussern oder belasten<br />
- Pfänder bestellen<br />
- Bürgschaften eingehen<br />
- Unentgeltliche Verfügungen treffen<br />
Das Verbot gilt aber insofern nicht absolut, als der Nachlassrichter ausnahmsweise zur<br />
Vornahme solcher<br />
Handlungen ermächtigen kann.<br />
1349.<br />
In welchen Fällen wird der Nachlassrichter den Schuldner zur Vornahme ansich<br />
gesetzlich verbotenen Handlungen ermächtigen?<br />
208
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Das wird der Richter auf entsprechenden Antrag des Schuldners oder des Sachverwalters tun,<br />
wenn es die Weiterführung des Geschäfts erfordert<br />
1350.<br />
Welche Wirkungen haben gesetzlich verbotene Geschäfte, die der Schuldner oder<br />
der Sachverwalter ohne Ermächtigung des Richters vornehmen?<br />
Sie sind nicht rechtswirksam, d.h. den Nachlassgläubigern gegenüber betreibungrechtlich<br />
unbeachtlich: Veräusserte Objekte können, wie im Konkurs, bedingungslos wieder<br />
beigebracht werden; Verpflichtungsgeschäfte berechtigen den Gläubiger weder zu einer<br />
Nachlassdividende, noch werden sie im Falle eines nach folgenden Konkurses oder eines<br />
Liquidationsvergleiches überhaupt kolloziert. Es handelt sich also um eine nmfassende<br />
betreibungsrechtliche<br />
Ungültigkeit.<br />
135<strong>1.</strong> Welche Anordnungen kann<br />
der Nachlassrichter bezüglich den Handlungen des<br />
Schuldners machen?<br />
Über das gesetzliche Verfügungsverbot hinaus kann der Nachlassrichter anordnen, dass<br />
gewisse Handlungen nur unter Mitwirkung des Sachwalters vorgenommen werden dürfen,<br />
oder er kann den Sachwalter sogar dazu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des<br />
Schuldners ganz zu übernehmen, SchKG 298 I. Dann ist dem Schuldner entweder<br />
nur<br />
selbständuges Handeln oder überhaupt jegliches Handeln verboten.<br />
1352. Was passiert mit den vom Schuldner abgeschlossenen Rechtsgeschäften<br />
und<br />
Verfügungen, wenn er den Anordnungen des Nachlassrichters zuwieder handelt?<br />
Hält der Schuldner sich nicht an die Anordnungen des Nachlassrichters, sind die von ihm<br />
ohne Mitwirkung des Sachverwalters abgeschlossenen Rechtsgeschäfte und Verfügungen<br />
nicht rechtsgültig, wie im Falle der Nichtbeachtung des gesetzlichen Verbotes. Die<br />
betreffenden Forderungen wären<br />
somit nicht einmal als gewöhnliche Nachlassforderungen zu<br />
berücksichtigen.<br />
1353. Was ist der Grund, dass der Nachlassrichter genau bestimmen kann, welche<br />
Handlungen der Schuldner ausführen kann?<br />
Dass der Nachlassrichter die Geschäftsführungsbefugnis auf die Bedürfnisse des Einzelfalls<br />
zuschneiden kann.<br />
1354. Welche Anordnungen<br />
kann der Sachverwalter bezüglich den<br />
Handlungsbefugnissen des Schuldners machen?<br />
Er kann im Rahmen seiner Weisungsbefugnis von sich aus dem Schuldner Rechtshandlungen<br />
verbieten. Er mag sich seine Zustimmung generell oder für einzelne Geschäfte vorbehalten<br />
oder den Abschluss und die Abwicklung bestimmter Geschäfte überhaupt untersagen.<br />
1355. Welche<br />
Konsequenzen bringen Widerhandlungen des Schuldners gegen die<br />
Weisungen des Sachwalters mit sich?<br />
Wide rhandlungen des Schuldners gegen die Weisungen des Sachwalters machen solche<br />
Geschäfte weder zivil- noch betreibungsrechtlich ungültig. Einzige Rechtsfolge wäre, dass<br />
Verpflichtungen daraus keine Masseverbindlichkeiten, sondern nur gewöhnliche<br />
Nachlassforderungen begründen. Verbote des Sachwalters sind daher weniger strikt.<br />
1356. Mit welchem Rechtsbehelf können Weisungen<br />
des Sachwalters angefochten<br />
werden?<br />
Sie könne mit betreibungsrechtlicher Beschwerde an die Aufsichtsbehörde angefochten<br />
werden.<br />
209
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1357. Welche Verpflichtungen werden im Falle eines Liquidationsvergleichs oder in<br />
einem späteren Konkurs als Masseverbindlichkeit<br />
angesehen?<br />
Verpflichtungen,<br />
die der Schuldner bzw. der Sachverwalter während der Stundung im<br />
Rahmen der ihm zustehenden Verfügungs- bzw. Vertretungsbefugnis eingeht, werden nach<br />
Abschluss<br />
eines Liquidationsvergleichs oder in einem späteren Konkurs als<br />
Masseverbindlichkeiten anerkannt, SchKG 310 II. Weil diese nicht unter den Nachlassvertrag<br />
fallen, dürfen sie vorab und voll bezahlt werden.<br />
1358. Wieso ist es wichtig, dass Verpflichtungen, die der Schuldner oder Sachverwalter<br />
erlaubterweise während einer Stundung eingehen Masseverbindlichkeiten sind?<br />
Nur so lässt sich überhaupt noch jemand<br />
finden, der bereit ist, mit dem angeschlagenen<br />
Unternehmen<br />
Geschäftsbeziehunen zu unterhalten.<br />
1359. Welche Pflicht hat der Sachwalter, wenn der Schuldner gegen das gesetzliche<br />
Verbot, gegen Anordnungen des Nachlassrichters oder gegen die eigenen<br />
Weisungen verstösst?<br />
Das muss der Sachverwalter dem Nachlassrichter anzeigen, SchKG 298 III.<br />
1360. Welche Konsequenzen kann der Richter anordnen, wenn sich der Schuldner<br />
nicht an seine Verfügungsbefugnisse hält?<br />
Dieser kann nach Anhörung des Schuldners und der Gläubiger, dem Schuldner die<br />
Verfügungsbefugnis<br />
über sein Vermögen ganz entziehen oder soger die Stundung widerrufen,<br />
SchKG 298 III.<br />
136<strong>1.</strong> In welchen Fällen kann die Stundung widerrufen werden?<br />
- wenn der Schuldner sich nicht an seine Verfügungsbefugnisse hält, SchKG 298 III<br />
- auf Antrag des<br />
Sachwalters vom Nachlassgericht wenn es zur Erhaltung des Vermögens<br />
erforderlich ist oder<br />
- wenn der Nachlassvertrag offensichtlich nicht zustande kommen wird, SchKG 295 V.<br />
Vor diesem folgeschweren Entscheid müssen der Schuldner<br />
und der Gläubiger angehört<br />
werden.<br />
1362.<br />
Wann erhalten die Gläubiger Gelegenheit, zum Vergleichsangebot des<br />
Schuldners förmlich Stellung zu nehmen?<br />
Erst im Zustimmungsverfahren erhalten die Gläubiger Gelegenheit,<br />
zum Vergleichsangebot<br />
des Schuldners förmlich Stellung zu nehmen.<br />
1363. Welche Vorbereitungsmassnahmen trifft der Sachwalter für die Durchführung<br />
des Zustimmungsverfahrens?<br />
- Inventar<br />
- Schuldenruf<br />
- Einberufung der Gläubigerversammlung<br />
1364. Was gehört alles zur Inventaraufnahme?<br />
<strong>Der</strong> Sachwalter nimmt das Inventar des gesamten Schuldnervermögens auf; er schätzt den<br />
Verkehrswert<br />
der einzelnen Bestandteile, SchKG 299, scheidet Kompetenzgut aus und merkt<br />
Drittansprüche vor.<br />
Bedeut sam ist vor allem die Schätzung der Pfandgegenstände, SchKG 299 II und III.<br />
Pfandgesicherte Forderungen fallen nämlich nicht unter den Nachlassvertrag, weshalb sie<br />
bei<br />
der Ermittlung<br />
der zustimmenden Summenmehrheit nur in dem nach der Schätzung<br />
ungedeckten<br />
Betrag mitzählen, SchKG 305 II.<br />
210
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Auch ausländisches Vermögen des Schuldners ist in das Inventar aufzunehmen, obwohl im<br />
Nachlassverfahren – gleich wie im Konkurs – zwischenstaatlich das Territorialitätsprinzip<br />
vorherrscht. <strong>Der</strong> Einbezug von im Ausland gelegenen Vermögensteilen ist vor allem wichtig<br />
für die Beurteilung des Vergleichsangebots des Schuldners unter dem Gesichtspunkt seiner<br />
Leistungsfähigkeit.<br />
1365. Wie erfolgt der Schuldenruf/was bringt er mit sich?<br />
SchKG<br />
300, durch öffentlilche Bekanntmachung. Die Gläubiger werden aufgefordert ihre<br />
Forderung binnen 20 Tagen einzugeben, mit der Androhung, dass sie sonst bei den<br />
Verhandlungen<br />
über den Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt wären. Wer mitentscheiden<br />
will, muss also seinen Anspruch rechtzeitig anmelden. Nicht oder zu spät angemeldete<br />
Forderungen sind aber dem Nachlassvertrag ebenfalls<br />
unterworfen. <strong>Der</strong> Schuldenruf wird<br />
jedem<br />
bekannten Gläubiger zudem brieflich mitgeteilt.<br />
Aus den Geschäftsbüchern des Schuldners ersichtlilche Forderungen gelten als angemeldet.<br />
Beim Liquidationsvergleich sind – analog zum Konkurs – verspätete Eingaben noch bis<br />
zum<br />
Schluss der Liquidation entgegen zu nehmen.<br />
Wie im Konkurs wird zu jeder Forderungseingabe die Erklärung des Schuldners<br />
darüber<br />
eingeholt,<br />
ob er sie anerkennt oder bestreitet, SchKG 300 II.<br />
1366. Welche Bedeutung hat die Bestreitung einer<br />
Forderung im weiteren Verlauf des<br />
Verfahrens?<br />
- vorerst muss das Nachlassgericht entscheiden, inwiefern eine bestrittene Forderung<br />
stimmrechtsmässig<br />
zu berücksichtigen ist, SchKG 305 III und<br />
- bei Bestätigung eines ordentlichen Nachlassvertrages setzt der Nachlassrichter dem<br />
Gläubiger eine Frist von 20 Tagen zur gerichtlichen Geltendmachung<br />
seiner Forderung,<br />
SchKG 315.<br />
1367. Zu welchem Zeitpunkt<br />
und in welcher Form wird die Gläubigerversammlung<br />
einberufen?<br />
Sobald ein verhandlungsreifer Vorentwurf vorliegt, lädt der Sachverwalter die Gläubiger<br />
durch öffentliche<br />
Bekanntmachung zur Gläubigerversammlung ein, mit dem Hinweis, dass<br />
die<br />
Akten wärend 20 Tagen vor der Versammlung eingesehen werden können; die<br />
Bekanntmachung muss mindestens einen Monat vor der Versammlung erfolgen, SchKG<br />
301<br />
I. Jedem bekannten Gläubiger wird diese Publikation zudem einzeln mitgeteilt.<br />
1368. Kommt der Gläubigerversammlung im Nachlassverfahren die gleiche Bedeutung<br />
zu wie im Konkurs/welche Funktionen hat sie?<br />
Nein, ihr kommt zudem eine andere Rechtsstellung zu. Vor allem bildet die Versammlung<br />
hier kein eigentliches Vollstreckungsorgan.<br />
Sie kann namentlich keine Beschlüsse fassen.<br />
Sie stellt eine blosse Zusammenkunft der Gläubiger dar;<br />
Sie dient einzig dem Zweck der Meinungsbildung m Hinblick auf die spätere individuelle<br />
Stellungnahme der Gläubiger zum Vorschlag des<br />
Schuldners. Jeder Gläubiger stimmt einzeln<br />
zu,<br />
sei es an der Versammlung oder später, SchKG 305 I.<br />
1369. Kann die Tätigkeit der Gläubigerversammlung mit Beschwerde angefochten<br />
werden (richtig/falsch)?<br />
Falsch, da sie auch keine<br />
Beschlüsse fassen kann.<br />
1370. Wieso werden im Nachlassverfahren sämtliche Gläubiger zugelassen, gleigültig<br />
ob sie „stimmberechtigt“ sind oder nicht?<br />
211
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Weil die Gläubigerversammlung nur eine beschränkte rechtliche Bedeutung hat. Auch<br />
säumige Gläubiger, die ihr Stimmrecht verwirkt haben, sowie diejenigen, deren Stimmen bei<br />
der Emittlung des Zustimmungsergebnisses gar nicht mitzählen, dürfen aber deshalb der<br />
Versammlung beiwohnen.<br />
137<strong>1.</strong><br />
Wie läuft die Verhandlung in der Gläubigerversammlung ab?<br />
SchKG 302:<br />
<strong>Der</strong> Sachwalter leitet die Verhandlung. Er erstattet vorerst Bericht über die Vermögens-,<br />
Ertrags- und Einkommenslage des Schuldners, SchKG 302 I.<br />
<strong>Der</strong> Schuldner hat persönlch zu erscheinen, um auf Verlangen weitere Aufschlüsse zu geben,<br />
SchKG 302 II. Er soll da aber auch noch Gelegenheit haben seinen Vorschlag zu begründen<br />
oder allenfalls noch abzuändern.<br />
Schliesslich wird den Gläubigern der Entwurf des Nachlassvertrages<br />
zur unterschriftlichen<br />
Genehmigung unterbreitet, SchKG 302 III.<br />
1372. Kann die Gläubigerversammlung auch<br />
bei Abwesenheit des Schuldners<br />
durchgeführt werden?<br />
Ja.<br />
1373. Wann gilt der Nachlassvertrag als angenommen?<br />
Wenn bis zum Bestätigungsentscheid die Mehrheit der Gläubiger, die zugleich mindestens<br />
zwei Drittel des Gesamtbetrages der Forderung vertreten, oder ein Viertel der Gläubiger, die<br />
aber mindestens drei Viertel des Gesamtbetrags der Forderung vertreten<br />
zugestimmt haben<br />
(SchKG 305 I).<br />
Unter<br />
beiden Voraussetzungen braucht es somit einer bestimmten Zahl von Kopfstimmen und<br />
dazu noch einer bestimmten Summenmehrheit.<br />
1374. Welche Stimmen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses nicht<br />
mitgezählt/warum nicht?<br />
SchKG 305 II:<br />
- weder für ihre Person noch für ihre Forderung die konkursrechtlich privilegierten<br />
Gläubiger, soweit sie nicht auf ihr Privileg verzichteten. Ihre Forderungen müssen<br />
ja<br />
sichergestellt sein, dass der Nachlassvertrag überhaupt bestätigt werden kann, SchKG<br />
306 II Ziff.2.<br />
- der Ehegatte des Schuldners, ebenfalls weder für seine Person noch für seine Forderung<br />
(er soll, weil möglicherweise voreingenommen, das Ergebnis nicht beeinflussen können)<br />
- die Gläubiger pfandgesicherter Forderungen, soweit diese nach der Schätzung des<br />
Sachwalters durch das Pfand gedeckt sind (sie sind in diesem Umfang dem<br />
Nachlassvertrag nicht unterworfen, SchkG 310 I)<br />
- Ob und inwieweit bedingte und bestrittene Forderungen<br />
mitzuzählen sind, entscheidet<br />
das Nachlassgericht im Bestätigungsverfahren, ohne indessen damit deren<br />
Rechtsbestand zu präjudizieren, SchKG 305 III. Über bestrittene Forderungen hat der<br />
ordentliche Richter am Ort des Nachlassverfahrens zu<br />
urteilen, SchKG 315; im<br />
Liquidationsvergleich werden sie im Kollokationsverfahren bereinigt, SchKG 32<strong>1.</strong><br />
1375. Ist bei der Genehmigung des Nachlassvertrages auch eine konkludente<br />
Zustimmung möglich?<br />
Nein,<br />
jeder Gläubiger muss den Vertragsentwurf einzeln mit seier Unterschrift genehmigen<br />
(SchKG 302 III); konkludente Zustimmung ist ausgeschlossen.<br />
1376. Wann muss die Zustimmung zum Nachlassvertrag erteilt werden?<br />
212
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Sie braucht nicht schon an der Gläubigerversammlung selbst erteilt zu werden; zustimmen<br />
kann man bis zum Bestätigungsentscheid (SchKG 305 I). Bis zu diesem Zeitpunkt darf man<br />
seine Zustimmung auch wieder zurückziehen. Das Stimmrecht ist ein Zustimmungsrecht, wer<br />
von den Stimmberechtigten nicht zustimmt, hat abgelehnt.<br />
1377. Wie läuft das Zustimmungsverfahren im Konkurs ab?<br />
In einem hängigen<br />
Konkurs berschränkt sich das ganze Zustimmungsverfahren auf den<br />
Bericht der Konkursverwaltung über den vom Schuldner unterbreiteten<br />
Nachlassvertragsentwurf an die Zweite Gläubigerversammlung und auf die Stellungnahme<br />
der einzelnen Gläubiger dazu (SchKG 332 I und II). Inventar, Schuldenruf und Erklärungen<br />
des Schuldners zu den Forderungseingaben sind in diesem Stadium des Konkursverfahrens<br />
schon vorhanden.<br />
1378. Was passiert ganz allgemein im Bestätigungsverfahren?<br />
Da<br />
überprüft das Nachlassgericht den von den Gläubigern mehrheitlich angenommenen<br />
Nachlassvertrag und erklärt ihn durch Entscheid für alle Gläubiger verbindlich oder verwirft<br />
ihn.<br />
<strong>Der</strong> Bestätigungsentscheid stempelt den Nachlassvertrag als „gerichtlichen“ ab, den Vergleich<br />
als<br />
„Zwangsvergleich“.<br />
1379. Wie wird das Bestätigungsverfahren eingeleitet/wie läuft es ab?<br />
- <strong>Der</strong> unterbreitet Sachwalter vor Ablauf der Stundung alle Akten mit seinem Bericht dem<br />
Nachlassgericht (SchKG 304 I).Im Bericht orientiert er über bereits erfolgte<br />
Zustimmungen<br />
und empfielt, den Vertrag zu bestätigen oder zu verwerfen (SchKG 304<br />
I).<br />
- Das Nachlassgericht macht hierauf den Verhandlungstermin<br />
öffentlich bekannt, lädt die<br />
Gläubiger und den Schuldner dazu ein und teilt ihnen mit, dass sie Einwendungen gegen<br />
den Nachlassvertrag in der Verhandlung vorbringen können (SchKG 304 III); sie dürgen<br />
aber auch schriftlich Stellung nehmen<br />
- Das Gericht<br />
entscheidet „befürderlich“ am Termin selbst. Im Übringen kommt<br />
kantonales Recht zur Anwendung.<br />
1380. Welche Art Entscheid ist der Entscheid über die Bestätigung oder Verwerfung<br />
des Nachlassvertrags?<br />
Ein Sachentscheis.<br />
138<strong>1.</strong> Wie kann der Sachentscheid lauten?<br />
Entweder auf Bestätigung oder auf Verwerfung des Nachlassvertrages. Dabei ist das<br />
Nachlassgericht nicht an die Genehmigung durch die Gläubigermehrheit<br />
gebunden. <strong>Der</strong>en<br />
Zustummung ist aber erste Voraussetzung der Bestätigung; ohne sie kann auch ein<br />
gerichtlichener<br />
Nachlassvertrag nicht zustande kommen.<br />
1382. Wann ist bei der Bestätigung ein Sachentscheid ausgeschlossen?<br />
Aus rein<br />
formellem Grund, wenn der Sachwalter die Akten und sein Gutachten erst nach<br />
Ablauf<br />
der Stundungsfrist überweist; denn damit ist das Nachlassverfahren bereits erfolglos<br />
ausgelaufen.<br />
<strong>Der</strong> Entscheid kann dann nur noch auf Nichteintreten lauten.<br />
1383. Welche materiellen Voraussetzungen müssen für eine Bestätigung gegeben sein?<br />
SchKG<br />
306 II:<br />
213
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- Das Angebot des Schuldners muss vor allem „in richtigem Verhältnis“ zu seinen<br />
Möglichkeiten stehen, SchKG 306 II Ziff. <strong>1.</strong> Bei der Beurteilung dieser Frage dürfen<br />
auch Anwartschften und im Ausland liegendes Vermögen des Schuldners berücksichtigt<br />
werden.<br />
- Für den Liquidationsvergleich wird diese Voraussetzung noch un der Weise präzisiert,<br />
dass das Verwertungsergebnis oder die von einem Dritten angebotene Summe<br />
insgesamt<br />
höher erscheinen muss als der voraussichtliche Erläs, der in einem Konkurs erzielt<br />
würde. Massgebend für diese Prognose ist die Dividendenerwartung<br />
der<br />
Kurrentgläubiger; denn die angemeldeten privilegierten Gläubiger (sowie die<br />
Massegläubiger) müssen ohnehin vollständig befriedigt werden können<br />
- <strong>Der</strong> Vollzug des Nachlassvertrages und die vollständige Befriedigung der angemelgeten<br />
privilegierten Gläubiger sowie die Erfüllung der Masseverbindlichkeiten müssen<br />
sichergestellt sein, es sei denn, die begreffenden Gläubiger verzichten ausdrücklich<br />
darauf. In Analogie zu SchKG 305 III sind dabei nur diejenigen<br />
privilegierten<br />
Forderungen sicherzustellen, welche vom Nachlassrichter auch zur Teilnahme an der<br />
Abstimmung zugelassen wurden.<br />
Im Übrigen stellt sich die Frage der Sicherstellung nur beim ordentlichen<br />
Nachlassvertrag; beim Liquidationsvergleich geht das Verfügungsrecht über das<br />
Vermögen mit der Bestätigung auf die Gläubiger über, SchKG 317. Im Falle der<br />
Abtretung des Vermögens an einen Dritten muss allerdings der Verkaufserlös<br />
sichergestellt werden, aber nicht vom Schuldner sondern vom Dritten, SchKG 318 I<br />
Ziff. 3.<br />
1384. Kann der Nachlassvertrag im Bestätigungsverfahren noch abgeändert werden?<br />
Im Interesse der Gläubiger, der zustimmenden wie der ablehnenden, darf das Nachlassgericht<br />
einzelne Bestimmungen des Nachlassvertrages abändern oder aufheben oder den Vertrag<br />
sogar ergänzen, SchKG 306 III. Das kann auf Antrag eines Beteiligten geschehen, oder von<br />
Amtes<br />
wegen. Auf diese Weise kann unter Umständen eine ungenügende Regelung korrigiert,<br />
insbesondere auch den Interessen einer Gläubigerminderheit<br />
Rechnung getragen werden.<br />
1385. Wie kann der Entscheid des Nachlassgerichtes<br />
angefochten werden?<br />
- Wo ein oberes kantonales Nachlassgericht besteht, kann der Entscheid binnen 10 Tagen<br />
nach seiner Eröffnung an deses weitergezogen werden (SchKG 307)<br />
1386. Wer ist dazu<br />
legitimiert den Entscheid weiterzuziehen?<br />
- gegen einen Verwerfungsentscheid der Schuldner sowie jeder Gläubiger, der dem<br />
Nachlassvertrag zugestimmt hat;<br />
- gegen einen Bestätigungsentscheid ebenfalls der Schuldner und jeder Gläubiger, der<br />
dem Nachlassvertrag nicht zugestimmt hat; ein zustimmender Gläubiger kann nur<br />
anfechten, wenn das Nachlassgericht ihm durch Abänderung des Bertrages nachträglich<br />
weitere Opfer auferlegt hat<br />
1387. Wie kann ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid ans BGer weiter gezogen<br />
werden?<br />
Nur mit StBE.<br />
1388. Was muss gemacht werden, sobald der Entscheid rechtskräftig ist?<br />
Er muss öffentlich bekannt gemacht werden, SchKG 308 I. und dem Betreibungs- sowie<br />
Grundbuchamt mitgeteilt.<br />
Wird einem konkursfähigen Schuldner ein Liquidationsvergleich bestätigt, so muss auch das<br />
Handelsregisteramt benachrichtigt werden.<br />
214
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1389. Welche Wirkungen hat der Entscheid des Nachlassgerichts über die Bestätigung<br />
des Nachlassvertrags unabhängig davon, wie er ausfällt?<br />
Er schliesst in jedem Fall das Nachlassverfahren ab. Die Stundung die bis dahin angedauert<br />
hat, verliert mit der Publikation des Entscheides jede weitere Wirkung, SchKG 308 II.<br />
1390. Welche Wirkungen hat der Verwerfungsentscheid im Besonderen?<br />
Er gestattet allen Gläubigern, ihre Forderungen wieder auf dem Wege der<br />
Zwangsvollstreckung geltend zu machen, sei es durch Fortsetzung einer schon früher<br />
eingeleiteten Betreibung oder durch Anhebung einer neuen. Wie ein Stundungswiderruf wirkt<br />
der Verwerfungsentscheid zudem vorübergehend als materieller Konkursgrund(!): jeder<br />
Gläubiger ist dann berechtigt, binnen 20 Tagen seit der Publikation des Entscheides sofort die<br />
Konkurseröffnung zu verlangen, und zwar gegen jden Schuldner, nicht nur gegen einen<br />
konkursfähigen, SchKG 309 i.V.m. 190 I Ziff. 3.<br />
139<strong>1.</strong> Welche Wirkungen hat ein rechtskräftiger Bestätigungsentscheid?<br />
Damit erwächst auch der Nachlassvertrag selbst – der Vergleich – in Rechtskraft. Seiner<br />
Durchführung und Erfüllung steht nichts mehr im Wege, sofern ihn das Nachlassgericht<br />
nachher wieder (teilweise) aufhebt oder (ganz) widerruft.<br />
Ausserdem bewirkt die Bestätigung:<br />
- Alle hängigen Betreibungen, aber auch der Arrest, die wegen der Nachlassstundung<br />
nicht weiterverfolgt werden konnten, fallen dahin; ausgenommen sind die<br />
Pfandverwertungsbetreibung, SchKG 31<strong>1.</strong> Für Bargeld gilt wiederum SchKG 199 II<br />
- Ein hängiger Konkurs, in dessen Verlauf der Nachlassvertrag zustande kam, ist auf<br />
Antrag der Konkursverwaltung vom Konkursgericht zu widerrufen, SchKG 332 III und<br />
195 I<br />
- <strong>Der</strong> Schuldner kann für alle nicht dem Nachlassvertrag unterworfenen Schulden wieder<br />
voll betriegen werden, SchKG 319 II.<br />
§55 Die Durchführung des Nachlassvertrages<br />
1392. Was muss nun mit dem rechtskräftigen Nachlassvertrag noch passieren?<br />
Er muss noch vollzogen werden. Die Art und Weise dieser Durchführung bestimmt sich nach<br />
dem materiellen Inhalt des Nachlasses.<br />
1393. Wo ist der materielle Inhalt des Nachlasses geregelt?<br />
Im Vertrag. Er gibt Auskunft darüber, ob dem Nachlassschuldner Stundung oder Erlass (z.B.<br />
teilweiser oder vollständiger Erlass von Kapital oder Zinsen, mit oder ohne<br />
Nachforderungsrechte, Teilerlass in Verbindung mit Stundung der Restforderung) gewährt<br />
wird sowie – beim Liquidationsvergleich – über den Umfang der Vermögensabtretung<br />
(SchKG 314 I bzw. 317 und 318).<br />
1394. Was hat das Gesetz mit dem materiellen Inhalt des Vertrages zu tun?<br />
Es umschreibt die Auswirkungen des materiellen Nachlasses.<br />
1395. Welche Auswirkungen hat der materielle Inhalt des Vertrages?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner braucht die Nachlassgläubiger nur noch in dem Masse (Dividende), zu der Zeit<br />
(Stundung) und auf die Art zu befriedigen, wie es der Nachlassvertrag festlegt. Hält er sich<br />
daran, sind seine Schulden entsprechend den Vertragsbestimmungen getilgt.<br />
Deshalb werden im Nachlassverfahren auch keine Verlustscheine ausgestellt (!).<br />
215
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Umgekehrt kommt bei Nichterfüllung oder Schlechterfüllung des Nachlassvertrages dessen<br />
Aufhebung oder gar dessen Widerruf in Frage, SchKG 313, 316.<br />
1396. (Auswirkungen des Nachlassvertrages): Ist der Nachlassvertrag für alle<br />
Nachlassgläubiger verbindlich?<br />
Ja, er ist für alle Nachlassgläubiger verbindlich, ungeachtet dessen, ob der einzelne<br />
zugestimmt hat oder am Verfahren teilgenommen hatAuch säumige Gläubiger und solche, die<br />
ihre Forderung überhaupt nich t angemeldet haben, sind ihm unterworfen (SchKG 310 I).<br />
Die Allgemeinverbindlichkeit des Nachlassvertrages wird durch das Verbot von<br />
Nebenversprechen bekräftigt. Jede Zusicherung des Schuldners an einen Gläubiger, ihm mehr<br />
zu leisten als ihm nach dem Vertrag gebührt, ist nichtig, SchKG 312.<br />
1397. Was bedeutet anderseits die Verbindlichkeit des Nachlassvertrages für alle<br />
Gläubiger, für den Schuldner?<br />
Das bedeutet, dass alle Nachlassforderungen, ob angemeldet oder nicht – im vertraglich<br />
bestimmten Umfang zu erfüllen sind. Nur beim Liquidationsvergleich geht das<br />
Teilnahmerecht mit dem Abschluss der Liquidation unter; wie im Konkurs können<br />
Forderungseingaben nach abgeschlossener Verteilung nicht mehr berücksichtigt werden,<br />
SchKG 25<strong>1.</strong><br />
1398. Wer gilt alles als Nachlassgläubiger?<br />
Als Nachlassgläubiger gelten nach SchKG 310 I:<br />
- Alle Gläubiger, deren Forderungen vor Bekanntmachung der Stundung entstanden sind<br />
- Die Gläubiger, deren Forderungen seither ohne Zustimmung des Sachwalters entstanden<br />
sind<br />
- Pfandgläubiger, für den durch das Pfand nicht gedeckten Forderungsbetrag, SchKG 310<br />
I<br />
- Die Gläubiger privilegierter Forderungen, sofern sie auf ihr Sicherstellungsrecht<br />
verzichtet oder ihre Forderung gar nicht angemeldet haben.<br />
1399. Welche Gläubiger sind der Allgemeinverbindlichkeit des Nachlassvertrages nicht<br />
unterworfen?<br />
- die Pfandgläubiger, soweit ihre Forderung durch das Pfand gedeckt sind; sie behalten ihr<br />
Einzelverfolgungsrecht und können nach Ablauf der Nachlassstundung ohne weiteres<br />
zur Pfandverwertung schreiten. Nur ein allfälliger Pfandausfallschein unterliegt dem<br />
Nachlassvertrag (gleich verhält es sich, wo ein Eigentumsvorbehalt vereinbart ist)<br />
- Die Gläubiger konkursrechtlich privilegierter Forderungen, sofern sie ihre Forderung<br />
angemeldet und auf ihr Sicherstllungsrecht nicht verzichtet haben, SchKG 306 II Ziff. 2<br />
- Die Gläubiger von Masseforderungen. Ihre vollständuge Erfüllung muss sichergestellt<br />
sein, sofern sie nicht ausdrücklich darauf verzichten, SchKG 306 II Ziff. 2.<br />
1400. In welchem Fall wirkt sich der Nachlassvertrag auch auf Grundpfandgläubiger<br />
aus?<br />
Wenn der Nachlassrichter dem Schuldner im Bestätigungsentscheid eine sog. Pfandstundung<br />
gewährt. Um die Sanierung zu erleichtern kann er nämlich auf Antrag des Schuldners die<br />
Verwertung eines Grundpfandes unter bestimmten Voraussetzungen und Vorbehalten auf<br />
höchstens ein Jahr nach Bestätigung des Nachlassvertrages einstellen.<br />
140<strong>1.</strong> Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass eine Pfandstundung<br />
gewährleistet werden kann?<br />
SchKG 306a:<br />
216
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
- die betreffende Grundpfandforderung muss vor Einleitung des Nachlassverfahrens<br />
entstanden sein<br />
- es darf nicht mehr als ein Jahreszins ausstehen<br />
- der Schuldner muss glaubhaft machen, dass er das Grundstück zum Betrieb seines<br />
Gewerbes benötigt und dass die Verwertung seine wirtschaftliche Existenz gefährden<br />
würde.<br />
Alle weiteren Regeln, ins. Welche Stellungnahmen man den Grundpfandgläubigern geben<br />
muss und unter welchen Voraussetzungen eine solche Pfandstundung dahinfällt ist in SchKG<br />
306a ausdrücklich geregelt.<br />
1402. Kommt eine Pfandstundung auch für Fahrnis in Frage?<br />
Nach Gesetz nicht.<br />
1403. Wie werden die vom Schuldner bestrittenen Nachlassforderungen behandelt?<br />
Auch die unterliegen dem Vertrag, sie werden wie folgt behandelt:<br />
- bei einem ordentlichen Nachlassvertrag hat der Schuldner auf Anordnung des<br />
Nachlassrichters die auf bestrittene Forderungen entfallenden Beträge bei der<br />
Depositenanstalt zu hinterlegen. Den betreffenden Gläubigern wird dann im<br />
Bestätigungsentscheid eine 20-tägige Frist zur gerichtlichen Geltendmachung der<br />
Forderung am Ort des Nachlassverfahrens angesetzt unter Androhung, dass im<br />
Unterlassungsfall die Sicherstellung der Dividende verloren gehe, SchKG 315.<br />
- Beim Liquidationsvergleich hingegen werden bestrittene Nachlassforderungen – wie im<br />
Konkurs – im Kollokationsplan behandelt.<br />
1404. Welche Auswirkungen hat das Zustandekommen des Nachlassvertrages auf die<br />
Rechte der Nachlassgläubiger gegenüber den Mitverpflichteten des Schuldners?<br />
- Gegenüber den zustimmenden Nachlassgläubigern werden die Mitverpflichteten im<br />
Ausmass des Nachlasses grundsätzlich ebenfalls frei; sie können also nicht mehr für den<br />
vollen Forderungsbetrag belangt werden, SchKG 303<br />
- Nur der nichtzustimmende Gläubiger verliert seine Rechte gegen sie nicht; diese<br />
erlöschen ihm nur insoweit, als er durch den Nachlassvertrag befriedigt wird, SchKG<br />
303 I.<br />
1405. Wie kann sich auch ein dem Nachlassvertrag zustimmender das volle Recht<br />
bewahren gegen die Mitverpflichteten des Schuldners?<br />
Indem er:<br />
- den Mitverpflichteten mindestens 10 Tage vor der Gläubigerversammlung deren Ort und<br />
Zeit bekannt gibt und ihnen die Abtretung seiner Forderung gegen Zahlung anbietet<br />
(?Was ist wenn sie das nicht annehmen)<br />
- oder die Mitverpflichteten ermächtigt, an seiner Stelle über die Genehmigung des<br />
Nachlassvertrages zu entscheiden, SchKG 303 III.<br />
1406. Wird der ordentliche Nachlassvertrag und der Liquidationsvergleich geich<br />
vollzogen/haben beide die gleichen Organe?<br />
Nein, der Vollzug läuft verschieden und es sind auch eigene Organe damit betraut.<br />
1407. Von wem wird der ordentlilche Nachlassvertrag abgewickelt?<br />
Er kann an sich vom Schuldner selbst abgewickelt werden: Verlangt ist im Wesentilchen nur<br />
pünktliche Zahlung der Dividenden. Doch kann es sich als zweckmässig erweisen, den<br />
bisherigen Sachwalter oder einen Dritten mit der Durchführung zu beauftragen, ihm gewisse<br />
217
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Befugnisse zu übertragen, SchKG 314 II. Meist empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit dem<br />
Schuldner.<br />
1408. Mit welchem Rechtsmittel können die Anordnungen des vollziehenden<br />
Sachwalters angefochten werden?<br />
Mit betreibungsrechtlicher Beschwerde.<br />
1409. Von wem wird der Liquidationsvergleich abgewickelt?<br />
Bei der Durchführung eines Liquidationsvergleichs handeln immer besondere Organe: ein<br />
ider mehrere Liquidatoren und ein Gläubigerausschuss, die von der Gläubigerversammlung<br />
ernannt werden und der Mitglieder im Nachlassvertrag einzeln bezeichnet sein müssen,<br />
SchkG 317 II und 318 I Ziff. 2.<br />
1410. Was ist der Zweck des Liquidationsvergleichs?<br />
Er bezweckt das abgetretene Schuldnervermögen (Aktiven und Passiven) zwecks<br />
Gläubigerbefriedigung zu liquidieren.<br />
141<strong>1.</strong> Was ist mit „Abtretung“ in SchKG 317 gemeint?<br />
Dass der Schuldner sein Vermögen oder einen – im Nachlassvertrag genau auszuscheidenen –<br />
Teil davon (SchKG 318 II) der Liquidation zur Verfügung stellt.<br />
1412. Auf welche Arten kann ein Liquidationsvergleich entstehen?<br />
- Zum einen, kann den Gläubigern das Verfügungsrecht über die Aktiven des Schuldners<br />
eingeräumt und die Verwertung derselben überlassen werden<br />
- Zum anderen kann der Nachlassvertrag bestimmen, dass das Aktivvermögen ganz oder<br />
teilweise einem vertraglich bestimmten Dritten abgetreten wird, SchKG 217 I.<br />
1413. Was passiert beim Liquidationsvergleich im Falle, dass den Gläubigern das<br />
Verfügungsrecht eingeräumt wird durchgeführt?<br />
Hier wird das Schuldnervermögen wie im Konkurs verselbständigt: es bildet die<br />
Nachlassmasse. Um diese Verselbständigung nach aussen zum Ausdruck zu bringen, erhält<br />
die Firma eines im Handelsregister eingtragenen Schuldners den Zusatz „in<br />
Nachlassliquidation“; als solche kann sie – vertreten durch die Liquidatoren – klagen und<br />
betreiben sowie beklagt und betrieben werden, SchKG 319 II und IV.<br />
Das Verfügungsrecht geht mit Eintritt der Rechtskraft des Nachlassvertrages von Gesetzes<br />
wegen, ohne dass es noch eines amtlichen Beschlages bedürfte, auf die Nachlassgläubiger<br />
über, SchKG 319 I; gleichzeitig erlöschen das Verfügungsrecht des Schuldners und die<br />
bisherigen Zeichnungsberechtigungen. Erst die nachfolgende Verwertung bewirkt dann den<br />
materiellen Rechtsübergang auf den Erwerber.<br />
In der Regel erfasst diese Form der Abtretung das gesamte Aktivvermögen des Schuldners.<br />
1414. Wie ist es beim Liquidationsvergleich, wenn das Schuldnervermögen ganz oder<br />
teilweise einem Dritten abgetreten wird?<br />
Dann wird der vom Dritten bezahlte Preis unter die Gläubiger verteilt. Damit erübrigt sich die<br />
eigentliche Verwertung durch die Liquidatoren.<br />
1415. Bleibt bei beiden Arten der Vermögensliquidation dem Schuldner eine<br />
Restschuld?<br />
Nein es bleibt dem Schuldner bei keiner der beiden Arten der Vermögensliquidation eine<br />
Restschuld, ausser es wäre vertraglich abweichend vereinbart.<br />
218
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1416. Welches sind die Liquidationsorgane beim Nachlassvertrag mit<br />
Vermögensabtretung?<br />
Liquidiert wird durch einen oder mehrere Liquidatoren, die der Aufsicht des<br />
Gläubigerausschusses unterstehen, SchKG 320 I. Beide Organe üben öffentlich-rechtliche<br />
Funktionen aus.<br />
1417. Mit welchem Rechtsmittel können Verfügungen der Liquidatoren angefochten<br />
werden?<br />
Mit Beschwerde und zwar bei der Aufsichtsbehörde.<br />
1418. Worauf muss man bei der Wahl des Rechtsmittels aufpassen, wenn man eine<br />
Verfügung der Liquidatoren anficht?<br />
Gegen Anordnungen der Liquidatoren über die Verwertung von Aktiven – nicht hingegen bei<br />
anderen Verfügungen – ist vorerst binnen 10 Tagen beim Gläubigerausschuss Einsprache zu<br />
erheben; erst dessen Entschei unterliegt dann der Beschwerde, SchKG 320 II.<br />
1419. Wer kann als Liquidator eingesetzt werden?<br />
Auch der frühere Sachwalter, SchKG 317 II. Seine Rechtsstellung entspricht denn auch<br />
derjenigen eines Sachwalters, SchKG 320 III.<br />
1420. Welche Art Aufgaben hat der Liquidator?<br />
Etwa die Gleichen, wie die Konkursverwaltung.<br />
Er hat alle zur Erhaltung, Verwaltung und Verwertung der Nachlassmasse sowie die zur<br />
allfälligen Übertragung des abgetretenen Vermögens gehörenden Geschäfte zu besorgen;<br />
dabei vertritt er die Masse auch vor Gericht, SchKG 319 III und IV.<br />
Dauert die Liquidation länger als ein Jahr, so muss auf Ende jedes Kalenderjahres ein<br />
Rechenschaftsbericht erstellt, dem Nachlassgericht eingereicht und zur Einsicht der Gläubiger<br />
aufgelgt werden, SchKG 330 II.<br />
142<strong>1.</strong> Wer haftet für rechtswidriges Handeln des Liquidators?<br />
<strong>Der</strong> Kanton, SchKG 5.<br />
1422. Wer haftet für schuldhaft verursachten Schaden des Gläubigerausschusses?<br />
Die Gläubiger persönlich, OR 4<strong>1.</strong><br />
1423. Welche allgemeinen Regeln gelten im Liquidationsverfahren?<br />
<strong>Der</strong> Liquidationsvergleich wird im Wesentlichen gleich wie ein Konkurs abgewickelt. Doch<br />
herrscht hier grössere Freiheit. Zunächts bestimmt der Nachlassvertrag die Art und Weise der<br />
Liquidation, soweit das Gesetz nichts Besonderes anordnet, SchKG 318 I Ziff. 3.<br />
Wesentlich ist, dass der Grundsatz der Gleibehandlung der Gläubiger gewahrt bleibt.<br />
1424. Wie werden im Liquidationsverfahren die Aktiven bereinigt?<br />
Ist die Rechtszugehörigkeit eines in der Nachlassmasse befindlichen oder von dieser<br />
beanspruchten Vermögensbestandteils umstritten, müssen unter Umständen die erforderlichen<br />
Aussonderungs- und Admassierungsverfahren durchgeführt werden, SchKG 319 IV Satz 2.<br />
1425. Wie verläuft die Rangzuteilung der Gläubiger im Liquidationsverfahren?<br />
Durch Kollokation. Auf Grund der Geschäftsbücher des Schuldners sowie der Eingaben der<br />
Gläubiger im vorangegangenen Nachlassstundungs- oder Konkursverfahren word von den<br />
Liquidatoren – ohne nochmaligen Schuldenruf – ein Kollokationsplan erstellt mit gleicher<br />
Rechtswirkung wie im Konkurs, SchKG 32<strong>1.</strong> Darin werden sämtliche Forderungen<br />
219
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
aufgenommen, die aus dem Liquidationserlös zu begleichen sind. (Nur<br />
Masseverbindlichkeiten nicht)<br />
1426. Wann werden die zu kollozierenden Forderungen im Liquidationsverfahren<br />
fällig/welche Wirkung auf die Forderungen gibt es sonst noch?<br />
Sie werden mit der rechtskräftigen Bestätigung des Liquidationsvergleichs fällig, dies im<br />
Unterschied zum ordentlichen Nachlassvertrag. <strong>Der</strong> Zinslauf hört mit Bewilligung der<br />
Stundung auf, SchKG 297. Forderungen in fremder Währung werden auf den Tag in<br />
Landeswärung umgerechnet, an dem der Nachlassvertrag rechtskräftig geworden ist. Die<br />
Umwandlung von Realforderungen in Geldforderungen sowie die Verrechnungsmöglichkeit<br />
richtet sich nach konkursrechtlilchen Grundsätzen, SchKG 297 IV.<br />
1427. Kann die paulianisch Anfechtung auch in einem Liquidationsverfahren<br />
durchgeführt werden?<br />
Ja, zu den Aufgaben des Liquidators gehört auch zu prüfen, ob der Schuldner vor der<br />
Bestätigung des Nachlassvertrages anfechtbare Rechtshandlungen im Sinne von SchKG 185<br />
ff vorgenommen hat. Massgebend für die Berechnung der Fristen ist anstelle der Pfändung<br />
oder der Konkurseröffnung die Bewilligung der Nachlassstundung; für die Geltendmachung<br />
kann die Verwirkungsfrist von SchKG 292 erst mit der rechtskräftigen Bestätigung des<br />
Liquidationsvergleichs zu laufen beginnen.<br />
1428. Kann die paulianisch Anfechtung auch beim ordentlichen Nachlassvertrag<br />
geltend gemacht werden?<br />
Nein, da besteht mangels einer verselbständigten Liquidationsmasse kene<br />
Anfechtungsmöglichkeit.<br />
1429. Inwiefern ist die Verwertung im Liquidationsverfahren anders als die<br />
Verwertung im Konkurs?<br />
In der Anpassungsfähigkeit des Verwertungsverfahrens an gegebene Verhältnisse liegt der<br />
entscheidene Vorteil des Liquidationsverfahrens gegenüber dem Konkurs. Hier können die<br />
Liquidatoren im Einverständnis mit dem Gläubigerasschuss, die Art und dem Zeitpunkt der<br />
Verwertung weitgehend frei bestimmen (SchKG 322).<br />
Auch hier kommen die öffentliche Versteigerung, der Freihandverkauf und die Abtretung von<br />
Rechtsansprüchen der Nachlassmasse in Frage, SchKG 325.<br />
Obwohl die Pfandforderungen nicht unter den Nachlassvertrag fallen, können die Pfänder<br />
unter Umständen doch auch im Rahmen der Durchführung des Liquidationsvergleichs<br />
verwertet werden.<br />
1430. Unter welchen Umständen können die Pfänder doch auch im Rahmen der<br />
Durchführung des Liquidationsvergleichs verwertet werden?<br />
- Grundpfänder kann der Liquidator verwerten, solange der Grundpfandgläubiger keine<br />
eigene Betreibung auf Pfandverwertung einleitet. Dann muss ein Lastenverzeichnis<br />
erstellt und die Kollokation des Grundpfandgläubigers vorgenommen werden – wie im<br />
Konkurs, SchKG 323.<br />
Im Falle einer bereits laufenden selbständigen Betreibung des Grundpfandgläubigers<br />
verwertet hingegen das zuständige Betreibungsamt, und der Grundpfandgläubiger wird<br />
dann bei der Abwicklung des Liquidationsvergleichs nur noch mit dem geschätzten oder<br />
bereits feststehenden Pfandausfall in der 3. Klasse kolloziert; in diesem Umfang hat er<br />
auch Anspruch auf Abschlagszahlungen (SchKG 327).<br />
Auch im Liquidationsverfahren darf ein Grundstück nur dann freihändig verkauft<br />
werden, wenn die Pfandgläubiger, deren Forderungen durch den Kaufpreis nicht gedeckt<br />
220
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
sind, zustimmen (SchKG 323); von der Zustimmung kann abgesehen werden, wenn das<br />
Grundstück im Rahmen einer direkten Vermögensabtretung an einen Dritten die Hand<br />
wechseln soll<br />
- Selbst die Faustpfandgläubiger können die Pfandverwertung den Liquidatoren<br />
überlassen, indem sie das Pfand freiwillig abliefern. Liegt die baldige Verwertung im<br />
Interesse der Nachlassmasse, können sie sogar zur Ablieferung zwecks Verwertung im<br />
Rahmen des Liquidationsvergleichs gezwungen werden, SchKG 324 II. Erleidet der<br />
Pfandgläubiger in seiner eigenen Betreibung einen Ausfall, so wird er – gleich wie der<br />
Grundpfandgläubiger – für diesen Betrag im Liquidationsverfahren in der 3. Klasse<br />
kolloziert und kann auch an Abschlagszahlungen teilhaben.<br />
143<strong>1.</strong> Wie ist die Verteilung im Liquidationsverfahren geregelt?<br />
Verteilungsliste, Verteilung und Schlussrechnung richten sich weitgehend nach<br />
konkursrechtlichen Grundsätzen. Insbesondere dürfen auch hier Abschlagszahlungen nur auf<br />
Grund einer provisorischen Verteilungsliste ausgerichtet werden (SchKG 326). Gleichzeitig<br />
mit der definitiven Verteilungsliste ist auch eine Schlussrechnung aufzulegen.<br />
1432. Unter welchen Umständen wird im Liquidationsverfahren die Schlussdividende<br />
bezahlt?<br />
Sie erfolgt nur gegen Quittung und Herausgabe des Forderungstitels, SchKG 264 II und 150.<br />
1433. Bekommen die Gläubiger für den Rest ihrer Forderungen im<br />
Liquidationsverfahren Verlustscheine?<br />
Nein, räumt aber der Nachlassvertrag den Gläubigern ein Nachforderungsrecht gegen den<br />
Schuldner oder gegen Dritte ein, so erhalten sie entsprechende Ausfallbescheinigungen,<br />
SchKG 318 I Ziff. <strong>1.</strong><br />
1434. Was müssen die Liquidatoren nach Abschluss des Verfahrens noch machen?<br />
Nach Abschluss des Verfahrens haben die Liquidatoren einen Schlussbericht zu verfassen, der<br />
vom Gläubigerausschuss genehmigt, dem Nachlassrichter eingereicht und zuhanden der<br />
Gläubiger aufgelegt werden muss, SchkG 330.<br />
1435. Was passiert mit nicht bezogenen Dividendenbeträgen?<br />
Sie werden vorerst bei der Depositenanstalt hinterlegt und nach Ablauf von 10 Jahren vom<br />
Konkursamt verteilt, SchKG 329 und 269.<br />
§56 Aufhebung und Widerruf des Nachlassvertrages<br />
1436. Wie kann ein Nachlassvertrag beendet werden?<br />
Durch Aufhebung und Widerruf, SchKG 313, 316 (Erfüllung)<br />
1437. Welches Verhältnis trifft die Aufhebung?<br />
- Die Aufhebung betrifft nur das Verhältnis des einzelnen Gläubigers zum<br />
Nachlassschuldner, es handelt sich bloss um eine individuelle Massnahme, SchKG 316<br />
1438. Welche Wirkung hat der Widerruf des Nachlassvertrages?<br />
Er bringt den Nachlassvertrag als Ganzen zu Fall; er bedeutet daher eine kollektive<br />
Massnahme, SchKG 313<br />
1439. Von wem und auf welchen Anstoss hin können der Widerruf und die Aufhebung<br />
geltend gemacht werden?<br />
221
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Beide Massnahmen können nur vom Nachlassgericht, welches den Vertrag ursprünglich<br />
bestätigt hatte, und nur auf Gesuch eines betroffenen Gläubigers hin verfügt werden.<br />
Auf das Verfahren und eine allfällige Weiterziehung des Entscheids sind die Bestimmungen<br />
für das Bestätigungsverfahren analog anwendbar, SchKG 313 II und 316 II.<br />
1440. Wann kommt die Aufhebung in Frage/wieso?<br />
Die Aufhebung kommt nur beim ordentlichen Nachlassvertrag in Frage, nicht aber bei einem<br />
Liquidationsvergleich, weil hier das Vermögen des Schuldners mit der Bestätigung des<br />
Nachlassvertrages in die Liquidationsmasse fällt, womit der Nachlassvertrag, soweit am<br />
Schuldner gelegen, erfüllt ist.<br />
144<strong>1.</strong> Wer kann die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen?<br />
Jeder Gläubiger, dem gegenüber die Bedingungen des Vertrages nicht erfüllt werden, SchKG<br />
316 I. Voraussetzung ist somit, dass der Schuldner mit der Erfüllung seiner<br />
Nachlassvertraglichen Verpflichtungen dem gesuchstellenden Gläubiger gegenüber in Verzug<br />
ist.<br />
1442. Muss der Gläubiger es dem Schuldner mitteilen, bevor er die Aufhebung des<br />
Nachlassvertrages beanträgt?<br />
Ja, der Gläubiger soll den Schuldner mahnen, bevor er ein Aufhebungsbegehren stellt, denn<br />
nachlassvertragliche Termine sind Fälligkeitstermine, nicht Verfalltage, OR 102. Dem<br />
Gläubiger wird im Einzelfall sogar die Einräumung einer kurzen Nachfrist zumutbar sein.<br />
1443. Werden die anderen Gläubigern von der Aufhebung betroffen/wenn ja,<br />
inwiefern?<br />
Weil die Aufhebung des Nachlassvertrages als individuelle Massnahme einzig die Forderung<br />
des gesuchstellenden Gläubigers betrifft, wirkt sie auch nur zu seinen Gunsten, und betrifft<br />
die anderen Gläubiger nicht. Die nachlassvertraglichen Rechte bleiben dabei erst noch<br />
bestehen: <strong>Der</strong> Gläubiger kann also jetzt seinen Schuldner wieder für die ganze Forderung<br />
betreiben, ohne indessen das Recht auf Dividende oder auf privilegierte Behandlung zu<br />
verlieren, SchKG 316 I. Für die übrigen Gläubiger ändert sich nichts.<br />
1444. Kann sowohl ein ordentlicher als auch ein Liquidationsvergleich widerrufen<br />
werden?<br />
Ja.<br />
1445. Was ist der Gund zum Widerruf eines Nachlassvertrages?<br />
Das ist der Umstand, dass schon der Nachlass selbst auf unredliche Weise zustande<br />
gekommen ist, SchKG 313.<br />
Jedes Treu und Glauben verletzende Verhalten, durch welches der Schuldner auf das<br />
Zustandekommen des Nachlassvertrages hingewirkt hat, bildet einen Widerrufsgrund. Immer<br />
muss er sich aber um einen Sachverhalt handeln, der erst nach Bestätigung des Vertrages<br />
zutage getreten ist.<br />
1446. Wie wirkt sich der Widerruf des Nachlassvertrages aus?<br />
Als kollektive Massnahme wirkt sich der Widerruf auf den Schuldner und auf alle Gläubiger<br />
aus: er beseitigt sämtliche durch den Nachlassvertrag begründete Rechte und Pflichten. Alle<br />
Nachlassgläubiger können den Schuldner wieder betreiben, wie wenn der Nachlassvertrag gar<br />
nicht bestätigt worden wäre.<br />
<strong>Der</strong> Widerruf wird öffentlich bekanntgemacht.<br />
222
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Er bildet einen materiellen Konkursgrund, SchKG 313 II. An diesem Konkurs nehmen dann<br />
nicht nur die bisherigen Nachlassgläubiger, sondern auch allfällige Neigläubiger teil.<br />
§57 Alternative zum Nachlassvertrag<br />
1447. Welche Alternativen gibt es zum Nachlassvertrag?<br />
Die einvernehmliche private Schuldbereinigung und der Konkursaufschub.<br />
1448. Wem steht die einvernehmliche private Schuldbereinigung zur Verfügung?<br />
Die Durchführung des Verfahrens steht nur einem nicht der Konkursbetreibung unterliegenen<br />
Schuldner zur Verfügung.<br />
1449. Wie kann der Schuldern zur einvernehmlichen privaten Schuldbereinigung<br />
gelangen?<br />
<strong>Der</strong> Schuldner muss sich mit einem Gesuch an den Nachlassrichter wenden, worin er seine<br />
finanzielle Lage (Schulden, Einkommens- und Vermögensverhältnisse) darzulegen hat.<br />
1450. In welcher Art von Verfahren entscheidet der Richter über die einvernehmliche<br />
private Schuldbereinigung?<br />
<strong>Der</strong> Richter entscheidet darüber im summarischen Verfahren.<br />
145<strong>1.</strong> Unter welchen Umständen gewährt der Richter Stundung und ernennt einen<br />
Sachwalter?<br />
SchKG 334 I:<br />
Wenn die beantragte Schuldbereinigung nicht von vornherein als ausgeschlossen erscheint<br />
und die Kosten des Verfahrens (Gerichtsgebüren und Sachwalterkosten) sichergestellt sind.<br />
1452. Kann die Stundung widerrufen/verlängert werden?<br />
Die Stundung kann sowohl widerrufen als auch verlängert werden.<br />
Die Stundung kann bei Bedarf auf höchstens 6 Monate verlängert werden, aber andererseits<br />
auch vorzeitig widerrufen werden, wenn die Schuldenbereinigung offensichtlich nicht<br />
zustande kommen kann, SchKG 334 I und II.<br />
1453. Wann kann „Aussicht auf Schuldenbereinigung“ angenommen werden?<br />
Wenn der Schuldner über geügend eigene Mittel (vor allem auch Einkommen) verfügt, die er<br />
zur Tilgung seiner Schulden einsetzen kann. Dann soll er sich nicht einfach insolvent erklären<br />
und in den Konkurs flüchten können, SchKG 191 II. Vielmehr darf ihm zugemutet werden,<br />
nach Möglichkeit für seine Schulden aufzukommen. <strong>Der</strong> Umfang des ihm zumutbaren<br />
Einsatzes wird mit den Gläubigern nach Billigkeit frei vereinbart.<br />
<strong>Der</strong> Entschei des Nachlassrichters wird den Gläubigern mitgeteilt; für die Weiterziehung<br />
gelten die Bestimmungen des ordentlichen Nachlassverfahrens, SchKG 334 IV, 294 III und<br />
IV.<br />
1454. Was ist der Zweck der Stundung in der einvernehmlichen privaten<br />
Schuldbereinigung?<br />
Die Stundung soll es dem Schuldner erleichtern, ohne Betreibungsdruck mit seinen<br />
Gläubigern zu einem Einvernehmen zu gelangen. Darum darf er während der Dauer nur für<br />
periodische familienrechtiche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge betrieben werden und<br />
stehen die Fristen für Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren sowie für die Dauer einer<br />
Lohnpfändung still, SchKG 334 III.<br />
223
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1455. Ist die Verfügungsbefugnis des Schuldners während der Stundung<br />
eingeschränkt?<br />
Nein. <strong>Der</strong> Sachwalter soll ihn in seinen Bemühungen um einen Bereinigungsvorschlag nur<br />
unterstützen, er ist anders als in der ordentlichen Nachlassstundung kein autoritärer Begleiter<br />
des Schuldners.<br />
1456. Was wird im Bereinigungsvorschlag vereinbart, wer hilft dem Schuldner?<br />
Im Bereinigungsvorschlag kann der Schuldner seinen Gläubigern z.B. auch nur eine<br />
Dividende anbieten…SchKG 335 I.<br />
<strong>Der</strong> Sachwalter verhandelt mit den Gläubigern darüber.<br />
1457. Wie läuft es ab, wenn die private Schuldbereinigung (=aussergerichtlicher<br />
Vergleich) zustande kommt?<br />
Dann kann der Nachlassrichter dem Sachverwalter noch beauftragen, den Schuldner bei der<br />
Erfüllung der Vereinbarung zu überwachen.<br />
1458. Wirkt sich die private Schuldbereinigung auch auf die ablehnenden Gläubiger<br />
aus?<br />
Weil nur eine „einvernehmliche“ Lösung angestrebt wird, wirkt sich die<br />
Schuldenbereinigung, anders als im Nachlassverfahren, auf ablehnende Gläubiger nicht aus:<br />
die Vereinbarung gilt nur für diejenigen Gläubiger, die zugestimmt haben.<br />
1459. Was passiert, wenn die Einigung misslingt?<br />
Dann bleibt dem Schuldner nichts anderes übrig, als die Insolvenzerklärung oder das<br />
gerichtliche Nachlassverfahren. In diesem wird ihm dann die Dauer der Nachlasstundung<br />
angerechnet, SchkG 336.<br />
1460. Was ist der Konkursaufschub?<br />
Kein allgemeines Prinzip sondern nur eine Sanierungshilfe für Kapitalgesellschaften<br />
(Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft, GmbH) und Genossenschaften.<br />
146<strong>1.</strong> Wer entscheidet darüber, ob der Konkursaufschub zu gewähren sei?<br />
<strong>Der</strong> Konkursrichter, der, auf Grund einer Überschuldungsanzeige, eigentlich über die<br />
Gesellschaft den Konkurs eröffnen sollte (SchKG 192, OR 725a I).<br />
Stattdessen kann er aber auf Antrag des Verwaltungsrates oder eines Gläubigers, nicht aber<br />
schon von Amtes wegen den Konkurs aufschieben, wenn Aussichten auf Sanierung besteht,<br />
OR 725a.<br />
1462. Kann der Entscheid des Konkursrichters über den Konkursaufschub<br />
weitergezogen werden?<br />
Ja, SchKG 174.<br />
1463. Wann besteht eine solche Sanierungsaussicht?<br />
Wenn einerseits der Bilanzverlust durch entsprechende Massnahmen beseitigt und die<br />
Rentabilität des Unternehmens wiederhergestellt werden kann und zudem eine<br />
aussergerichtiche Verständigungslösung mit den Gläubigern (falls von ihnen Opfer gefordert<br />
werden) möglich scheint.<br />
Sonst müsste die Sanierung in einem Nachlassverfahren gesucht werden (da wäre ein<br />
Zwangsvergleich möglich).<br />
1464. Was geschieht, wenn der Konkursrichter dem Gesuch entspricht?<br />
224
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Er gewährt einen befristeten Konkursaufschub und trifft die zur Erhaltung des Vernögens<br />
erforderlichen Massnahmen, z.B. kann er einen Sachwalter einsetzen und dem Verwaltungsrat<br />
die Verfügungsbefugnis entziehen oder dessen Beschlüsse von der Zustimmung des<br />
Sachwalters abhängig machen; dann muss aber auch die Aufgaben, die der Sachwalter im<br />
konkreten Fall besorgen soll, umschreiben, OR 725a II.<br />
Erweist es sich als zweckmässig, kann der Sachwalter von sich aus oder auf Anordnung des<br />
Richters eine Gläubigerversammlung einberufen oder einen Gläubigerausschuss beiziehen.<br />
1465. Kann der Konkursrichter die Frist des Aufschubs verändern?<br />
Ja, er kann sie entweder nachträglich verlängern oder vorzeitig widerrufen.<br />
1466. Was ist der Hauptzweck des Konkursaufschubs?<br />
Das ist, dass ohne Druck eines laufenden Zwangsvollstreckungsverfahrens die Möglichkeit<br />
einer Sanierung der an sich konkursreifen Gesellschaft geprüft werden kann. Darum steht es<br />
auch im Ermessen des Richters bereits hängige Betreibungen einzustellen und die Einleitung<br />
neuer Betreibungen zu verhindern. Entsprechend stehen dann aber auch die Verjährungs- und<br />
Verwirkungsfristen still.<br />
1467. Hat der Konkursaufschub Auswirkungen auf den Zinsenlauf?<br />
Nein. Ebensowenig vermöchte er die Fälligkeiten zu beeinflussen.<br />
1468. Wird der Konkursaufschub veröffentlicht?<br />
Nur, wenn des zum Schutz Dritter erforderlilch ist (OR 725a). Das ist vor allem der Fall,<br />
wenn der Aufschub laänger dauert oder wenn der Richter ein generelles Betreibungsverbot<br />
berhängt. Diskretion dient aber der Sanierung besser als Publizität.<br />
1469. Was muss der Konkursrichter tun, wenn diese Sanierung nicht fristgerecht<br />
zustande kommt?<br />
Dann muss der den Konkurseröffnen, SchKG 192, sofern die überschuldete Gesellschaft oder<br />
ein Gläubiger nicht doch noch an das Nachlassgericht gelangen und um Bewilligung einer<br />
Nachlassstundung nachsuchen oder der Richter seltbst Anhaltspunkte für das<br />
Zustandekommen eines Nachlassvertrages sieht, SchKG 173a.<br />
Zu letzt bleibt noch der Vorschlag eines Nachlassvertrages im Konkurs.<br />
1470. Worauf kann der Konkursaufschub in einem späteren Liquidationsverfahren<br />
nachwirken?<br />
- die zeitliche Begrenzung der Konkursprivilegien (SchKG 219 V Ziff. 2)<br />
- die Berechnung der Verdachtsfrist bei der Anfechtung (SchKG 288a Ziff. 2)<br />
- die Bestimmung des kritischen Zeipunkts für die Zulässigkeit der Verrechnung, SchKG<br />
297 IV.<br />
- Masseverbindlichkeiten hiterlässt er hingegen nicht<br />
§58 Notstundung (keine praktische Relevanz)<br />
147<strong>1.</strong> Sind die Bestimmungen der Notstundung direkt anwendbar?<br />
Nein, sie müssen durch Beschluss der Kantonsregierung und (konstitutiver) Zustimmung des<br />
Bundesrates erst noch anwendbar erklärt werden.<br />
Anhang: Einige für das SchKG relevante Aspekte der ZPO:<br />
1472. Inwiefern muss das Gericht Prozessvoraussetzungen prüfen?<br />
225
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
Von Amtes wegen.<br />
1473. Was bestimmt das Gericht, wenn eine Prozessvoraussetzung nicht vorliegt?<br />
Auf die Klage ist nicht einzutreten.<br />
1474. Was ist die Definition der Leistungsklage?<br />
Sie ist auf die Durchsetzung eines behaupteten Anspruchs auf Leistung, Unterlassung oder<br />
Duldung gerichtet.<br />
1475. Was ist die Definition der Feststellungsklage?<br />
Sie ist auf Feststellung des Bestehens (positive) oder Nichtbestehens (negative<br />
Feststellungsklage) eines Rechts oder eines Rechtsverhältnisses gerichtet.<br />
1476. Bsp. für Feststellungsklagen im SchKG?<br />
SchKG 83 II, die Aberkennungsklage; SchKG 85a, jederzeitige Klage auf Feststellung, dass<br />
die in Betreibung gesetzte Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist.<br />
1477. Wann ist die Feststellungsklage generell unzulässig?<br />
- zum Entscheid blosser Rechtsfragen<br />
- zur Feststellung von Tatsachen<br />
- wenn eine Leistungsklage möglich ist (gibt ein paar Ausnahmen)<br />
1478. Was ist die Definition der Gestaltungsklage?<br />
Sie ist auf die Begründung, Abänderung oder Aufhebung eines Rechtsverhältnisses gerichtet.<br />
Eine Gestaltungsklage muss dort erhoben werden, wo ein Gestaltungsrecht ausschliesslich<br />
durch KKlage ausgeübt werden kann.<br />
1479. Bsp. von prozessualen Gestaltungsklagen?<br />
SchKG 77; 80…<br />
1480. Was ist die Definition von Prozessvoraussetzungen?<br />
Das sind Bedingungen des Eintretens auf die Sache. Bei ihrem Fehlen darf nicht (weiterhin<br />
zur Sache verhandelt und es darf kein Sachurteil gefällt werden.<br />
148<strong>1.</strong> Was ist auf Seiten des Gerichtes Prozessvoraussetzung?<br />
- Zulässigkeit des Rechtsweges<br />
- Zuständigkeit<br />
1482. Was ist keine Prozessvoraussetzung?<br />
- Fehlen von Verjährung und Verwirkung: ob der eingeklagte Anspruch noch klagbar ist,<br />
muss durch Sachurteil entschieden werden<br />
- Die Sachlegitimation<br />
1483. Auf wessen Anstoss hin sind Prozessvoraussetzungen zu prüfen?<br />
Da bei Fehlen ein Sachurteil nicht ergehen darf, sollten die Prozessvoraussetzungen<br />
grundsätzlich von Amtes wegen geprüft werden.<br />
1484. Welche Form des Entscheides hat er, bei Fehlen einer Prozessvoraussetzung?<br />
Er lautet auf Nichteintreten (Synonyme: Rückweisung, Unzuständigerklärung)<br />
226
Zusammenfassung in Frageform chronologisch nach der <strong>Vorlesung</strong> gegliedert von<br />
Grundrisse des SchKG Fridolin Walther 7. Auflage<br />
1485. Wie lautet der Entscheid (Zwischenentscheid) bei Vorhandensein der<br />
Prozessvoraussetzung)<br />
Auf Eintreten auf die Klage.<br />
1486. Was bedeutet Sachlegitimation?<br />
Ist die Berechtigung des Klägers, das eingeklagte Recht oder Rechtsverhältnis geltend zu<br />
machen (Aktivlegitimation) und zwar gegen den ins Recht gefassten Beklagten, der bezüglich<br />
des strittigen Rechts in der Pflichtstellung steht und damit passivlegitimiert ist. Die Prüfung<br />
der Legitimation erfolgt frei und von Amtes wegen.<br />
1487. Wann fehlt die Sachlegitimation?<br />
Wenn der Anspruch nicht dem Kläger zusteht oder nicht dem Beklagten gegenüber besteht.<br />
1488. Wie erfolgt der Entscheid über fehlende Sachlegitimation?<br />
Er erfolgt durch Sachurteil (Sachentscheid) und lautet auf Abweisung der klage.<br />
1489. Was bedeutet „Glaubhaftmachung“?<br />
Wenn der Richter von der Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr<br />
hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.<br />
1490. Wer hat Rechtserzeugende, rechtsbegründende Tatsachen zu beweisen?<br />
Wer im Prozess ein Recht oder Rechtsverhältnis geltend macht.<br />
149<strong>1.</strong> Wer hat Rechtshindernde, rechtsaufhebende Tatsachen zu beweisen?<br />
Wer sie behauptet.<br />
227