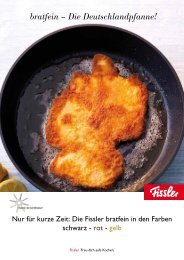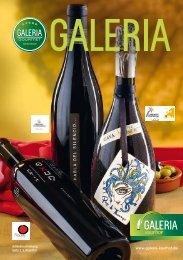Wir sind Berlin! - Hackescher Markt
Wir sind Berlin! - Hackescher Markt
Wir sind Berlin! - Hackescher Markt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 | Galeria Kaufhof am Alexanderplatz<br />
Immer wieder<br />
anders und jedes Mal<br />
schick, <strong>sind</strong> die …<br />
Schaut man von der Weltzeituhr am Alexanderplatz<br />
in Richtung Galeria, blickt ein Zebra<br />
freundlich zurück. Der mächtige Löwe hingegen<br />
macht den Eindruck, einem gleich entgegen<br />
springen zu wollen – so gestochen scharf <strong>sind</strong> die<br />
Fotos in den riesigen Schaufenstern, selbst auf diese<br />
weite Entfernung.<br />
Die Ausmaße der Schaufenster – elf Meter beträgt<br />
die Gesamthöhe, allein die oberen messen<br />
6,50 Meter – <strong>sind</strong> ein Traum für jeden Schaufensterdekorateur,<br />
dessen korrekte Berufsbezeichnung<br />
übrigens „Gestalter für visuelles Marketing“ lautet.<br />
Doch sie <strong>sind</strong> auch eine kreative Herausforderung,<br />
schließlich hat die Galeria den Anspruch,<br />
sich mit seinem Konzept deutlich von anderen Warenhäusern<br />
abzuheben. Deutschlandweit lautet die<br />
Maßgabe: klare Linien, eine reduzierte Optik und<br />
moderne Anmutung. Mit Erfolg. Der Anblick der<br />
Schaufenster, die jeweils von 30 Strahlern in Szene<br />
gesetzt werden, ist ein ästhetisches Erlebnis,<br />
besonders inmitten des Trubels auf dem Alexanderplatz.<br />
Das wird auch wieder bei der Premiere des<br />
neuen Dufts BOSS bottled night ab 30. Juni zum<br />
Tragen kommen.<br />
Eine der drei Fronten neu zu gestalten, dauert<br />
eine Woche, die Planung erfolgt lange im Voraus.<br />
Da werden Böden ausgetauscht, Rückwände gewechselt<br />
und Figuren – nein, sie heißen nicht Puppen<br />
– angezogen. Die Fenster spiegeln Jahreszeiten<br />
wider, saisonale Höhepunkte oder Feiertage wie<br />
Ostern und Weihnachten Aber sie <strong>sind</strong> auch Schauorte<br />
mit aktuellem Bezug zum <strong>Berlin</strong>er Geschehen.<br />
…19 großen<br />
Schaufenster<br />
der Galeria<br />
Das wird während der <strong>Berlin</strong>ale deutlich und erst<br />
recht, wenn angesagte Modemessen wie die Bread<br />
& Butter oder die Fashion Week in der Hauptstadt<br />
stattfinden. Auch zur kommenden Fashion Week<br />
am 7. Juli werden wieder fünf Fenster mit den Stücken<br />
von fünf vielversprechenden Designern gestaltet<br />
sein. Anlässlich der Bread & Butter, die<br />
zeitgleich in <strong>Berlin</strong> läuft, werden sechs Fenster<br />
analog zum Levis-Stand auf der Modemesse dekoriert.<br />
Und alles was ausgestellt ist, gibt es drinnen<br />
zu kaufen.<br />
Die Art des Dekorierens hat sich im Laufe der<br />
letzten beiden Jahrzehnte stark verändert: „Während<br />
vor 15 Jahren noch fünf bis sechs Figuren in einem<br />
Fenster standen, <strong>sind</strong> es heute lediglich zwei bis<br />
drei“, sagt Chefdekorateur Klaus Wenzel. Früher<br />
Fotos: Pavel Sverdlov (2)<br />
trugen sie Mütze, Jacke, Schal, Schuhe und Tasche<br />
auf einmal, heute <strong>sind</strong> sie mit wenigen ausgewählten<br />
Objekten dekoriert. Dank neuer Materialien und<br />
Techniken ist es etwa möglich, Fotos in grandioser<br />
Qualität auf riesig große Leinwände zu bringen, so<br />
wie zur Leichtathletik-WM 2009 in <strong>Berlin</strong>.<br />
Besonders spektakulär war die Weihnachtsdekoration<br />
2009. Statt Kitsch in Rot-Grün-Weiß hatte<br />
der <strong>Berlin</strong>er Graffiti-Künstler Lake Wahle die Rückwände<br />
der Fenster mit typischen <strong>Berlin</strong>-Motiven<br />
wie Brandenburger Tor oder Potsdamer Platz gestaltet.<br />
Darin ausgestellt waren charakterstarke<br />
Plüschfiguren, die von einem Spezialisten beweglich<br />
gemacht worden waren und kleine Choreografien<br />
in <strong>Berlin</strong>er Kulisse vorführten – ein Blickfang,<br />
der staunende kleine und große Besucher anlockte.<br />
Mit einem<br />
Wollgeschäft fing 18 79 alles an<br />
Feste Preise, Barzahlung und Umtauschrecht – Leonhard Tietz revolutionierte den Einzelhandel<br />
Geklöppelte Decken, Betttücher<br />
und andere Weiß- und <strong>Wir</strong>kwaren<br />
führte Leonhard Tietz in<br />
seinem 25 Quadratmeter großen Geschäft,<br />
das er als 30-jähriger Mann 1879<br />
in Stralsund eröffnete. Es war der<br />
Grundstein der deutschen Kaufhauskultur.<br />
Feste Preise gab es noch nicht, es<br />
wurde gefeilscht. „Einfach gucken und<br />
bummeln – so etwas gab es damals<br />
nicht“, sagt Nils Busch-Petersen, der<br />
Geschäftsführer des Handelsverbandes<br />
<strong>Berlin</strong>-Brandenburg, der seit Jahren zur<br />
Geschichte der Waren- und Kaufhäuser<br />
forscht. Wer den Laden betrat, der kaufte<br />
auch – das galt als Verpflichtung. Zumindest<br />
bis Leonhard und Oskar Tietz<br />
Ende des 19. Jahrhunderts den deutschen<br />
Einzelhandel revolutionierten.<br />
Doch der Reihe nach. Die Tietz-Brüder<br />
stammten aus einer jüdischen Familie,<br />
die in einfachen, aber liberalen<br />
Verhältnissen in Birnbaum an der Warthe<br />
(heute: Miedzychód) lebte. Der Vater<br />
war Fuhrmann, kulturell interessiert<br />
und weltoffen, dennoch konnte Leonhard<br />
die Schule nur bis zur achten Klasse<br />
besuchen. Die Brüder gingen bei ihren<br />
Verwandten in Prenzlau in die Lehre.<br />
In deren Schrott- und Lumpenhandel<br />
mussten beide hart arbeiten. Sie hatten<br />
mit vielen verschiedenen Gütern und<br />
Materialien zu tun, deren Qualität sie<br />
schnell einzuschätzen lernten. Eine Fertigkeit,<br />
die beiden in ihrer beruflichen<br />
Laufbahn viel nützen würde.<br />
Während in Deutschland noch in<br />
Krämerläden gefeilscht wurde, existierten<br />
in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
bereits erste Vorläufer der heutigen Warenhäuser.<br />
Dort sicherte der „Entrée libre“<br />
freien Zugang für jedermann ohne<br />
den üblichen Kaufzwang. Fixe Preise<br />
waren für alle sichtbar an den Waren<br />
angebracht. Mit dem Prinzip „gleicher Preis für alle“<br />
wurde das Wesen des Einzelhandels demokratisiert.<br />
Nun spielte es keine Rolle, ob es die Baronin persönlich<br />
war, die sich ein Tischtuch aussuchte oder eine<br />
einfache Köchin – beide mussten dasselbe zahlen.<br />
Außerdem gewährten diese Kaufhäuser ihren Kunden<br />
ein Umtausch- und Rückgaberecht. Dafür war<br />
es mit dem „Anschreiben-Lassen“ vorbei. Fortan<br />
mussten Kunden ihre Waren sofort und bar bezahlen<br />
– das verschaffte den Inhabern Liquidität. In<br />
» Dann gangk<br />
nohm<br />
Tietze Leinhad<br />
un kauf<br />
«<br />
däm Jung<br />
dat Päht<br />
Galeria Kaufhof am Alexanderplatz | 5<br />
London entwickelten sich fast zur gleichen<br />
Zeit ganz ähnliche Geschäfte, die<br />
sogenannten Offiziers- und Beamtenwarenhäuser.<br />
Allerdings boten sie eine<br />
größere Warenvielfalt als ihre französischen<br />
Pendants – samt umfassenden<br />
Dienstleistungen wie Haareschneiden<br />
oder dem Verkauf von Versicherungen.<br />
Die Industrialisierung hatte auch<br />
Deutschland verändert: Breitere Schichten<br />
verfügten über eine höhere Kaufkraft,<br />
Konsumgüter wurden in Massenproduktionen<br />
gefertigt, Rohstoffe konnten<br />
dank schnellerer Transportwege<br />
zügig geliefert werden. Diese Entwicklung<br />
und die Kenntnis von den Kaufhäusern<br />
in London und Paris wussten<br />
die Tietz-Brüder zu nutzen. Drei Jahre<br />
nach der Eröffnung seines Geschäfts in<br />
Stralsund, gründetet Leonhard 1882 ein<br />
ähnliches in Barmen-Elberfeld, dem<br />
heutigen Wuppertal. Schon bald wurde<br />
daraus ein Warenhaus nach französischem<br />
Vorbild. Wenige Jahre später eröffnete<br />
„Warenhaus Leonhard Tietz“,<br />
die heutige Galeria Kaufhof, auf der Hohen<br />
Straße in Köln, dorthin wurde auch<br />
der Firmensitz verlegt.<br />
Inzwischen hatte Oskar Tietz – nach<br />
Thüringen und Sachsen – auch am<br />
<strong>Berlin</strong>er Alexanderplatz ein Warenhaus<br />
eröffnet. Zeit ihres Lebens standen<br />
sich Leonhard und Oskar sehr<br />
nahe. Sie achteten genau darauf, sich<br />
geschäftlich nicht in die Quere zu kommen.<br />
Dennoch kooperierten beide beim<br />
Einkauf von Waren und entwickelten<br />
Tietz’sche Eigenmarken, die sie günstig<br />
in ihren Kaufhäusern anboten.<br />
Das rege soziale Gewissen, das sowohl<br />
Oskar als auch Leonhard auszeichnete<br />
war wohl auch ihrer einfachen<br />
Herkunft zuzuschreiben. „Beide<br />
waren beliebt bei ihren Angestellten“,<br />
erklärt Handelsexperte Busch-Petersen.<br />
Die Brüder führten in ihren Kaufhäusern<br />
eine eigene Pensions- und Betriebskrankenkasse<br />
ein. Leonhardt Tietz wurde sogar in<br />
dem Kölner Gassenhauer „„Schöckelpädche“<br />
(Schaukelpferdchen) aus dem Jahr 1902 besungen:<br />
„Mama, Mama – unse Heinemann dä well zom<br />
Namensdag e Schöckelpädche han. Mama, Mama,<br />
wenn es Freud ihm mäht, dann gangk nohm Tietze<br />
Leinhad un kauf däm Jung dat Päht!“