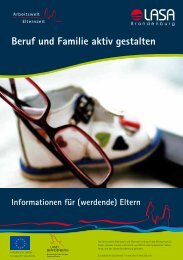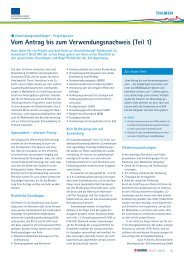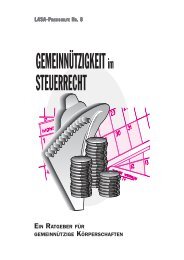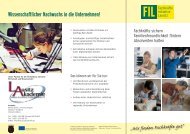Benachteiligte fördern - LASA Brandenburg GmbH
Benachteiligte fördern - LASA Brandenburg GmbH
Benachteiligte fördern - LASA Brandenburg GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Friedel Schier<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn<br />
<strong>Benachteiligte</strong> <strong>fördern</strong> –<br />
Anregungen für die berufliche Bildung<br />
95
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen:<br />
1. In Deutschland gab es im Jahr 2004 knapp 574.000 neue Ausbildungsabschlüsse und<br />
2. trotz aller Maßnahmen bleiben ca. 13% aller Jugendlichen unter 30 Jahren dauerhaft<br />
ohne Berufsabschluss.<br />
Nun stellt sich die Situation für den Facharbeitermarkt in Deutschland so dar, dass es Verschiebungen<br />
in der Alterstruktur der Bevölkerung sowie strukturelle Veränderung in den und<br />
zwischen den Wirtschaftszweigen geben wird. Längerfristig – bis 2050 – wird es gut ein Drittel<br />
beziehungsweise 4,4 Mio. Personen weniger im erwerbsfähigen Alter geben.<br />
Neben diesen statistischen Eckdaten gibt es noch „weiche Faktoren“, die für die Situation<br />
prägend sind: Herr Professor van Buer, Humboldt-Universität Berlin, hat eine repräsentative<br />
Umfrage unter Berliner Jugendlichen vorgenommen, die in unterschiedlichsten Maßnahmen<br />
beheimatet waren. Es handelte sich hier nicht um die Jugendlichen, die in einer regulären<br />
Ausbildung standen, sondern um Jugendliche, die sich über einen gewissen Zeitraum hin in<br />
berufsvorbereitenden Maßnahmen befanden.<br />
Er hat meines Erachtens einige besorgniserregende Tatsachen aufgedeckt:<br />
3. Von den befragten Berliner Jugendlichen (keine <strong>Brandenburg</strong>er Jugendlichen) in den<br />
untersuchten Maßnahmen hätte keiner das Zertifikat eines einfachen Hauptschulabschluss<br />
nach den von ihm formulierten Standards erhalten können, wobei diese Standards nur 50%<br />
des PISA – Standards entsprechen.<br />
4. Der größte Teil der Jugendlichen in allen Maßnahmen und Bildungsgängen zeigt Rechtschreibeleistungen,<br />
die noch in der Primarstufe, maximal in der ersten Hälfte des 7. Schuljahres,<br />
einzuordnen sind. Das heißt, sie liegen zwei, drei, zum Teil vier Jahre in der Rechtschreibung<br />
hinter dem Leistungsstand zurück, der eigentlich am Ende der Schulzeit vorhanden<br />
sein sollte.<br />
5. Der größte Teil der befragten Jugendlichen verfügt nicht über die Informationen und das<br />
erforderliche Wissen, um in der Berufsausbildung zu bestehen. Das heißt, sie bedürfen einer<br />
dauerhaften Unterstützung in der Berufsausbildung, damit diese Kenntnislücken nicht den<br />
Berufsabschluss verhindern.<br />
6. Der vierte Punkt erhärtet diese Einschätzung noch: notwendige Kompetenz und Wissensstrukturen<br />
für erfolgreiches Lernen wurden nicht erworben.<br />
96
Das Schlussresümee für Herrn van Buer ist, dass der allgemeine sowie der erweiterte<br />
Hauptschulabschluss keine hinreichenden Kriterien zur Bestimmung der Ausbildungsreife<br />
darstellen. Das heißt, ob jemand einen Hauptschulabschluss hat oder nicht, mag zwar ein<br />
formales Kriterium sein, ermöglicht aber keine ausreichende Aussage darüber, ob der Betreffende<br />
auch wirklich für eine Ausbildung geeignet ist.<br />
Mich hat diese Einschätzung stark bewegt, weil ich bislang davon ausgegangen bin, dass<br />
sich nach einer möglicherweise schwachen Schulzeit für die Jugendlichen in der Ausbildung<br />
und beruflichen Praxis doch neue Chancen, Zugänge und Motivationsschübe erschließen<br />
können. Die Möglichkeit besteht. Aber wie die Studie aussagt, kommen Schüler mit schlechten<br />
schulischen Leistungen gar nicht erst in den Vorteil eines Ausbildungsplatzes.<br />
Zum 1. April ist nun die Reform der Berufsbildung in Kraft getreten; das Berufsbildungsgesetz<br />
hat für Jugendliche mit schlechteren Startchancen einige Verbesserungen gebracht:<br />
Es gibt neue Regelungen zur Durchführung von Prüfungen, die jetzt gestreckt werden<br />
können;<br />
es soll mehr Stufenausbildungen geben;<br />
es gibt andere und verbesserte Möglichkeiten für Absolventen von zweijährigen Ausbildungen,<br />
um ein drittes Ausbildungsjahr anzuschließen.<br />
In Ihren Tagungsunterlagen finden Sie eine Übersicht, in der die wesentlichen Veränderungen<br />
aufgelistet sind. Frau Pahl hat auch heute Morgen die neuen Möglichkeiten deutlich genannt.<br />
Zu beachten ist aber, dass Sie diese Möglichkeiten im Gesetz nicht im Wortlaut finden werden,<br />
sondern eher in den Erläuterungen.<br />
Im Gesetz werden vor allem die neuen Rahmenbedingungen aufgeführt; es bestehen aber<br />
seitens der Kammern deutliche Spielräume im Umgang mit der neuen Gesetzlichkeit:<br />
Die Möglichkeiten im Gesetz sind vorhanden, die regionale Ausgestaltung hängt dann von<br />
den Kammern ab.<br />
Ein Beispiel: ein wichtiges Anliegen der Reform war, dass die Anrechnung von Vorqualifikationen<br />
und die Durchlässigkeit erhöht werden sollen, damit die Warteschleifen wegfallen.<br />
Das ist auch heute Morgen noch einmal sehr deutlich sowohl von Frau Pahl wie auch von<br />
Frau Ministerin Ziegler hervorgehoben worden.<br />
Aber die Anrechnung ist nicht zwingend verpflichtend, sondern die Entscheidung wird immer<br />
abhängig von dem ganz konkreten Fall, dem ganz konkreten Antrag bei der jeweiligen<br />
Kammer sein.<br />
97
Für sehr interessant und zukunftsweisend halte ich einen weiteren Punkt, nämlich den möglichen<br />
Wechsel von der schulischen in die betriebliche Berufsausbildung und vielleicht auch<br />
wieder zurück. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich für das deutsche System aber optional<br />
jetzt möglich und wird hier im Land <strong>Brandenburg</strong> ja auch bereits praktiziert.<br />
Zum Abschluss noch zwei Anregungen:<br />
7. Ich glaube, das A und O ist die Integration betrieblicher Praxisphasen.<br />
Das ist entscheidend für die Anschlussfähigkeit der Jugendlichen und für die Anschlussfähigkeit<br />
der Qualifikation, die sie erhalten.<br />
8. Das halte ich regional gesehen für entscheidend: ich habe den Eindruck, es gibt immer<br />
wieder Partner, die gut zusammenarbeiten, aber auch viele, die nicht zusammenarbeiten.<br />
Mit Partnern meine ich die Wirtschaft, das Handwerk, die Arbeitsämter, die Bildungseinrichtungen<br />
und natürlich auch die Schulen. Häufig wird leider einer dieser Partner in den Ausbildungsverbünden<br />
vergessen und dementsprechend hakt es dann an dieser Stelle.<br />
Heute Morgen wurde als „frommer Wunsch“ geäußert, dass man mehr gemeinsam „an einem<br />
Strick ziehen“ müsste. Ich sehe es im Moment eher so, dass eine wilde Förderlandschaft<br />
existiert und die Eigeninteressen der Förderer, wohl gemerkt der Förderer, nicht der<br />
Geförderten, so stark sind, dass es wohl auch in Zukunft noch eine ganze Reihe parallele<br />
Strukturen geben wird.<br />
Deshalb sehe ich es als zwingend notwendig und wichtig an, die Abstimmungsprozesse zu<br />
intensivieren.<br />
Das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Vorbedingung für mehr regionale Vernetzung<br />
und Zusammenarbeit.<br />
Vielen Dank.<br />
Quelle: Jürgen van Buer: Empirische Untersuchung bei Schulabgängern nach PISA-<br />
Kriterien. In: Fachtagung "Fit für die Ausbildung", (Hg.) KAUSA, Bielefeld o.J. (2004). Seite<br />
34-52.<br />
98
Heinz-Wilhelm Müller<br />
Agentur für Arbeit Eberswalde<br />
99<br />
Gedanken zum Thema
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
mein Name ist Müller; ich bin seit dem 3.Januar 2005 Leiter der Agentur für Arbeit Eberswalde<br />
in den Landkreisen Barnim und Uckermark und damit auch verantwortlich für den gesamten<br />
Bereich arbeitsloser Jugendlicher; in Barnim auch für langzeitarbeitslose Jugendliche,<br />
Berufsberatung, berufsvorbereitende Maßnahmen und so weiter. Ich habe die Diskussion<br />
heute morgen leider nicht verfolgen können, aber sehr interessante Ansätze hier in diesem<br />
Raum eben hören dürfen.<br />
Jetzt kurz einige Gedanken zum heutigen Thema:<br />
Der 1. Punkt ist für mich: Hier im Land <strong>Brandenburg</strong> ist das Problem, Fachkräfte und motivierte<br />
Mitarbeiter für Betriebe zu finden, von einer großen Heterogenität geprägt. Zum einen<br />
haben viele Unternehmen dieses Problem noch gar nicht erkannt. Es ist eben bereits gesagt<br />
worden, dass viele Betriebe es gewohnt sind, die Bewerber sozusagen auf dem Silbertablett<br />
gereicht zu bekommen und sich im Grunde genommen gegenwärtig noch gar keine Gedanken<br />
darüber machen, ob sich das irgendwann einmal ändern wird.<br />
Andererseits stellen unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater fest: viele junge Leute<br />
haben resigniert und glauben gar nicht daran, dass, wenn sie jetzt als Bewerber bei uns vorgemerkt<br />
sind, sie im Herbst eine Ausbildungsstelle bekommen. Und sie glauben schon gar<br />
nicht daran, dass sie hier in der heimischen Region eine Ausbildungsstelle finden. Vor dem<br />
Hintergrund einer Zeitachse betrachtet, lässt sich feststellen: viele Betriebe und viele Jugendlichen<br />
sehen nicht, dass die Gegenwart, wie sie sich bei uns im Augenblick darstellt,<br />
schon in wenigen Jahren Vergangenheit ist und zwar eine ganz andere Vergangenheit, als<br />
die Gegenwart dann sein wird.<br />
Der 2. Punkt ist: Wir brauchen – und es wird sehr schwierig sein, das zu erreichen – eine<br />
Vorteilsübersetzung für die Betriebe in unserer Region, was Fachkräfte und Ausbildung betrifft.<br />
Personal, Ausbildung und Fachkräfte sind keine Themen der Volkswirtschaft.<br />
Die Betriebe interessieren sich in aller Regel nicht für volkswirtschaftliche Größen, Kennziffern<br />
oder Argumentationsstränge, sondern diese Thematik ist rein betriebswirtschaftlicher<br />
Art. „Ihr sägt euch den eigenen Ast ab, auf dem ihr sitzt, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass ihr<br />
in wenigen Jahren geeignetes Fachkräftepersonal habt !“ Einzelne Betriebe bei uns in der<br />
Region haben diese Argumentation erkannt; zumeist größere aber zunehmend auch kleinere<br />
Unternehmen, zum Beispiel Handwerksbetriebe, die sich jetzt überlegen, was denn passieren<br />
wird, wenn irgendwann einmal der Inhaber ausscheidet, es einen Gesellen möglicherweise<br />
nicht gibt und das ganze Unternehmen, das eigentlich auf relativ gesunden Füßen<br />
steht, vor die Existenzfrage gestellt wird.<br />
100
Diese Vorteilsübersetzung scheint mir ganz wesentlich zu sein.<br />
Das kann die Agentur für Arbeit allein sicher nicht leisten, hier ist vor allem der Ausbildungskonsens<br />
bundesweit gefragt. Ich habe persönlich schon an Veranstaltungen des Landes<br />
<strong>Brandenburg</strong> teilgenommen, wo auch der Ministerpräsident und Vertreter verschiedener Ministerien<br />
in die gleiche Richtung argumentierten. Allerdings finden derartige Argumentationen<br />
im Augenblick noch zu wenig Widerhall.<br />
Der 3. Punkt: Wir brauchen natürlich eine ebensolche Vorteilsübersetzung für die jungen<br />
Leute. Wir haben soeben gehört, wie viel Prozent der jungen Arbeitslosen keine Ausbildung<br />
haben und dass das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit steigt. Nun ist das eine Allerweltsweisheit,<br />
aber trotzdem richtig. Ich nenne hier ein nicht repräsentatives, aber mich sehr bewegendes<br />
Beispiel:<br />
Am vergangenen Montag fand bundesweit der Tag des Ausbildungsplatzes statt, natürlich<br />
auch in der Agentur für Arbeit in Eberswalde. Die Kollegen und Kolleginnen unseres zu diesem<br />
Zeitpunkt noch zuständigen Bereichs SGB II, (mittlerweile sind das Jobcenter und die<br />
ARGE dafür verantwortlich), hatten sich überlegt, nicht nur am Tag des Ausbildungsplatzes<br />
für das Thema Ausbildung, Fachkräfte und Wirtschaft der Zukunft zu werben, sondern die<br />
Jugendlichen direkt mit in die Betriebe zu nehmen. Wir haben diese Idee natürlich mit den<br />
Betrieben abgestimmt und hatten etwa 70 junge Leute angesprochen.<br />
Das Ergebnis war, dass ein gutes Drittel der Langzeitarbeitslosen, ALG 2- oder Sozialgeldempfänger<br />
und Bewerber um Ausbildungsstellen, gar nicht erst gekommen ist. Das kann ich,<br />
offen gesagt, nicht verstehen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die persönlichen Ansprechpartner,<br />
Fallmanager und Berufsberater, haben noch am selben beziehungsweise am nächsten<br />
Tag nachgefragt: ,,Was war denn los?“. Die Antworten lauteten: „ich habe verschlafen“,<br />
“ich wollte ausschlafen“, „hab den Termin vergessen“, „hatte keine Lust“ und so weiter.<br />
Nun ist dieser Fall sicher nicht repräsentativ, aber ganz offensichtlich müssen wir eben alles<br />
daran setzen, auch für diesen Personenkreis – unsere Fachkräfte der Zukunft – eine Vorteilsübersetzung<br />
zu erreichen.<br />
Der 4. Punkt ist: Es hat natürlich generell in der Gesellschaft ein Umdenken gegeben.<br />
Wir haben, und das ist nichts Neues, jahrelang sehr stark in sozialpolitischen Komponenten<br />
gedacht unter der Rubrik: „besser eine Förderung als gar nichts“.<br />
Heute sagen wir, „eine gute Förderung gern, a) wenn der junge Mensch zu dieser Zielgruppe<br />
gehört und b) wenn am Ende auch die beabsichtigte arbeitsmarktliche Wirkung entsteht“.<br />
Und die beste Sozialpolitik in diesem Sinne ist natürlich – Integration in eine Ausbildung, das<br />
ist das Zwischenziel – die Integration in den Arbeitsmarkt als das letztlich eigentliche Ziel.<br />
101
Uns ist häufig vorgeworfen worden: „Ihr wollt ja a) die Berufsberatung platt machen, euch b)<br />
aus den Schulen herausziehen, c) keine berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen unterstützen<br />
und d) keine <strong>Benachteiligte</strong>nausbildung mehr anbieten“. Das ist falsch. Ich kann das<br />
für die Agentur Eberswalde sagen aber auch für die Regionaldirektion und für die gesamte<br />
Bundesagentur.<br />
Wir haben uns mit der Bundesregierung sowie mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen<br />
im Rahmen des nationalen Paktes für Ausbildung darauf geeinigt, die Teilnehmerzahlen<br />
der Maßnahmen in den ausbildungs<strong>fördern</strong>den Instrumenten auf dem Stand von<br />
2003 zu halten und das werden wir auch tun.<br />
Also: Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ausbildungen plus ausbildungsbegleitende<br />
Hilfen plus berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen plus einige Sonderinstrumente.<br />
In Summe werden wir auch in diesem Jahr den Stand von 2003 halten.<br />
Wir achten natürlich darauf, dass möglichst viele positive Wirkungen entstehen. Eine besondere<br />
Zielgruppe sind auch für uns junge Frauen mit kleinen Kindern, die es ja ganz besonders<br />
schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Wenn für diese Personengruppen eine Integrationsquote<br />
von 50% angestrebt wird, wie im Beispiel meiner Vorrednerin soeben mitgeteilt<br />
wurde, so ist das ein sehr ambitioniertes Ziel und, wenn es erreicht werden kann, sicherlich<br />
ein gutes Ergebnis. Die Unterstützung eines solchen Projekts könnte ich mir auch in unserer<br />
Agentur gut vorstellen.<br />
Mein letzter Punkt ist: Wir sind als Bundesagentur selbstverständlich nach wie vor auch im<br />
Bereich der optierenden Kommunen durchaus noch am Markt präsent, was die langzeitarbeitslosen<br />
Jugendlichen betrifft. Es ist wohl wahr, dass zunächst einmal der optierende<br />
Kreis für die Ausbildungsvermittlung und für die Berufsausbildung und außerbetriebliche<br />
Ausbildung verantwortlich ist.<br />
Aber für Berufsorientierung, berufliche Beratung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen<br />
ist es auch im Fall der Option die Bundesagentur für Arbeit; und wir werden uns aus<br />
diesem Geschäft unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht zurückziehen, weil es ein<br />
wichtiges Geschäft ist und weil es aus meiner Sicht einen ganz wesentlichen Aspekt des<br />
Arbeitsmarktes darstellt.<br />
Soweit einige wenige Punkte, die mir durch den Kopf gegangen sind und über die wir möglicherweise<br />
später noch diskutieren können.<br />
Ich danke für die Aufmerksamkeit.<br />
102
Thomas Enkelmann<br />
Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum g<strong>GmbH</strong><br />
Erfahrungen aus der Bildungsarbeit<br />
für benachteiligte Jugendliche<br />
103
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
wie Sie den ausliegenden Prospekten entnehmen können, hat das Fürstenwalder Ausbildungswerk<br />
ein breites Leistungsspektrum und verfügt über langjährige vielfältige Erfahrungen<br />
in Bezug auf Bildungsmaßnahmen für Schüler allgemein sowie für benachteiligte Schüler<br />
im Besonderen.<br />
Im Folgenden einige Überlegungen und Schlussfolgerungen daraus.<br />
Zuerst möchte ich eine zentrale Aussage treffen:<br />
um Begabungen bei Schülern zu entdecken, diese zu <strong>fördern</strong> und sie sinnvoll für die Wirtschaft<br />
zu erschließen, sind Veränderungen im allgemeinbildenden Bildungswesen sowie im<br />
beruflichen Bildungswesen notwendig; beziehungsweise sind die formalen Möglichkeiten, die<br />
sich per Gesetz bieten, umfassender anzuwenden.<br />
Da sich die Bevölkerung in Deutschland nicht von selbst reproduziert, ist es um so wichtiger,<br />
alle zur Verfügung stehenden Potentiale zu nutzen. Das heißt, alle Möglichkeiten der Bildung<br />
anzuwenden und auch alle jene Menschen intensiv einzubeziehen, die formal weniger<br />
Chancen am Arbeitsmarkt haben, sofern ihnen nicht besondere Unterstützung gewährt wird.<br />
Gegenwärtig wird erneut darüber debattiert, die Vorschule zu einer obligatorischen Institution<br />
zu entwickeln. Momentan gibt es die Entscheidung, dass eine solche Institution nicht eingerichtet<br />
werden soll.<br />
Es ist vielfach seitens der Wissenschaft darauf verwiesen worden, dass Kinder im Alter von<br />
3-6 Jahren eine ganz wesentliche und für die zukünftige Entwicklung entscheidende Phase<br />
des Lernens durchleben. Sich dem Thema Bildung in dieser Zeit gezielt zu widmen, halte ich<br />
deshalb für eine erste Aufgabe, wenn man über Begabungsreserven und deren Erschließung<br />
spricht. Das frühzeitliche Fördern und Fordern der Kinder prägt sie für die künftige Schule.<br />
Kinder müssen in dieser Phase für das Lernen weiter begeistert werden. Maria Montessori,<br />
eine der bekanntesten Reformpädagoginnen des letzten Jahrhunderts, forderte, dass die<br />
„hungrige Intelligenz“ der Kinder befriedigt werden muss. Der Drang der Kinder auf Neues,<br />
auf das Erkennen der sie umgebenden Welt, muss weiter geweckt und gefördert werden.<br />
Dabei ist ihnen die Freude am Lernen nicht zu nehmen sondern bewusst zu <strong>fördern</strong>. Meines<br />
Erachtens beginnt spätestens hier der Weg zu einer erfolgreichen Erschließung von Begabungsreserven.<br />
Über das schulische Bildungswesen ist in den vergangenen Jahren hinlänglich gesprochen<br />
worden und wird auch weiterhin gesprochen werden.<br />
Wer erwartet, dass sich Veränderungen in wenigen Wochen einstellen, wenn veränderte<br />
Rahmenbedingungen entstehen – siehe auch das Thema Ganztagsschule – der wird ent-<br />
104
täuscht sein. Nach unseren bisherigen Erfahrungen als Bildungsträger wie auch als Träger<br />
einer freien Grundschule gehen doch mehrere Jahre ins Land, bis spürbare Veränderungen<br />
eintreten. Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle betonen, dass das Ganztagsschulprojekt<br />
ein ganz wesentliches Mittel sein kann, das uns als Gesellschaft hilft, den Anforderungen der<br />
Zeit besser gerecht zu werden; insbesondere wenn es darum geht, unseren Schülern ihre<br />
Begabungsreserven zu „entlocken“.<br />
Die Ganztagsschule hat ja nicht allein den Vorteil, dass die Kinder und Jugendlichen länger<br />
in der Schule sind. Nein, auch die Pädagogen sind länger an der Schule und deren Potential<br />
kann noch umfassender für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden. Deshalb kann<br />
ich als freier Träger dem zur Zeit diskutierten Vorschlag über eine längere Präsenszeit der<br />
Lehrer an den Schulen nur zustimmen. Den Kindern und Jugendliche interessante Angebote<br />
zu machen und sie über die Vielfalt von Möglichkeiten des Lernens wieder zur Freude am<br />
Lernen zu führen wird nicht nur dazu beitragen, dass die Schüler wieder bessere Leistungen<br />
erzielen, sondern auch Möglichkeiten eröffnen, die Begabungsreserven der Schüler zu entdecken<br />
und zu <strong>fördern</strong>. Wir sprechen aber hier und heute nicht über die Ganztagsschule<br />
allein, sondern stellen die Frage nach den Möglichkeiten, wie Begabungsreserven in den<br />
verschiedenen Lebens- und Lernabschnitten der Schüler und Jugendlichen erkannt, gefördert<br />
und genutzt werden können.<br />
Wie sieht der derzeitige Stand aus:<br />
Ich bin nicht in der Lage, fundierte wissenschaftliche Erhebungen vorzulegen. Unsere<br />
Kenntnis beruht auf den Erfahrungen als Träger der Bildung, der sich dazu noch in einem<br />
kleineren Territorium in Ostbrandenburg bewegt. Unsere Erfahrungen sind also eher empirisch<br />
begründet. Wir können bestätigen, dass grundsätzlich Schulabgänger der letzten Jahre<br />
– und hier sprechen wir über Schüler ohne beziehungsweise mit Berufsbildungsreife sowie<br />
erweiterter Berufsbildungsreife – in ihren Leistungen nachgelassen haben. Nicht zuletzt sind<br />
dies auch jene Schüler, die zum Teil über geförderte Maßnahmen wie Berufsvorbereitung<br />
oder überbetriebliche Berufsausbildung, in Einrichtungen wie der unsrigen ankommen.<br />
Um es gleich von vornherein zu sagen: es wäre vollkommen falsch zu behaupten, dass diese<br />
Schüler alles „dumme“ Schüler sind. Diese Aussage ist meines Erachtens wichtig, denn<br />
wenn wir eine andere Aussage zulassen würden, brauchten wir nicht über die Erschließung<br />
von Begabungsreserven bei dieser Klientel sprechen. Für uns spiegelt sich dies in der täglichen<br />
Arbeit darin wieder, dass wir immer vom Kompetenz- und nicht vom Defizitansatz ausgehen<br />
und auf dieser Grundlage unsere Aufgabe wahrnehmen, um die uns anvertrauten<br />
Menschen zu der ihnen möglichen Handlungskompetenz zu führen.<br />
105
Wie können wir im Sinne der Handlungskompetenzentwicklung die Begabungsreserven<br />
unserer benachteiligten Jugendlichen erkennen und erschließen und welche Voraussetzungen<br />
müssten dazu vorhanden sein?<br />
Zunächst zu den Voraussetzungen:<br />
Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die materiellen Voraussetzungen – auch wenn<br />
wir sicherlich nicht immer zufrieden sind und natürlich ständig Modernisierungs- und Erneuerungsbedarf<br />
besteht – vorhanden sind. Dies trifft sowohl für die allgemeinbildenden Schulen<br />
als auch für die Zentren der beruflichen Bildung zu. An der Verbesserung dieser Bedingungen<br />
wird gearbeitet.<br />
Aus meiner Sicht ist der Focus eher stärker auf die personellen Voraussetzungen zu richten.<br />
Um eine wirksame Vermittlung von Kompetenzen beziehungsweise eine wirksame Aufarbeitung<br />
von Begabungsreserven zu sichern, müssen die an diesem Prozess Beteiligten – die<br />
Lehrer/innen, Ausbilder/innen, Sozialpädagog/innen – auf diese Aufgabe durch eine gezielte<br />
Aus- und Weiterbildung entsprechend vorbereitet und befähigt werden.<br />
Die Qualifizierung des pädagogischen Personals, das an den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen<br />
die Bewältigung der 1. Schwelle unterstützen soll, stellt angesichts der<br />
durchgängig schlechteren Bildungsvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern eine<br />
zentrale Aufgabe dar.<br />
Begabungsreserven bei unseren Jugendlichen zu erkennen und zu erschließen ist eine Aufgabe,<br />
die eigentlich nicht neu ist. Seitdem es die Förderung von Jugendlichen mit Benachteiligen<br />
gibt (wobei hier die Benachteiligen sehr breit gesehen werden sollen), war man darum<br />
bemüht, letztlich diese Personen so zu unterstützen, dass sie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt<br />
haben – hier in erster Linie durch das Ablegen eines Berufsabschlusses.<br />
Nunmehr bestimmt der Markt immer mehr, dass wir, um die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft<br />
zu entwickeln, keine Möglichkeiten vergeben, keine vorhandenen Leistungspotentiale<br />
verschenken oder vergeuden dürfen. Das bedeutet, auch jene Potentiale zu erschließen, die<br />
in <strong>Benachteiligte</strong>n „schlummern“.<br />
Als Ausgangspunkt muss ich wiederum darauf verweisen, dass es zunächst darauf ankommt,<br />
das „Potential Schule“ besser zu nutzen. In diesem Zusammenhang hatte ich die<br />
Ganztagesschule erwähnt. Hier müsste neben dem bereits Beschriebenen auch Zusätzliches<br />
geschaffen werden. So sind für Schulen angesichts der zunehmend schwieriger werdenden<br />
sozialen Situation Sozialpädagogen eine wichtige Ergänzung, um Schüler rechtzeitiger<br />
zu begleiten. Als weitere wichtige Einrichtungen könnten Jobscouts an Schulen wirken,<br />
die im Zusammenwirken von Lehrerschaft und Sozialpädagogen das Thema Schule – Wirtschaft<br />
inhaltlich begleiten und die Brücke zu den Unternehmen herstellen. Die effektive Aus-<br />
106
gestaltung dieses Ansatzes „Schule – Wirtschaft“ kann ganz wesentlich zur Motivation bei<br />
den Schülern beitragen und abstraktem Lernen einen realen Hintergrund liefern.<br />
Eine dieser Umsetzungsmöglichkeiten sind Schülerfirmen, aber auch das Fach WAT könnte<br />
hier eine umfassendere Rolle spielen.<br />
Die Realisierung solcher Vorhaben bedarf des Aufbaus funktionierender Netze.<br />
Ich möchte hier nicht weiter ins Detail zu Netzwerken gehen, aber doch darauf hinweisen,<br />
dass es auch hier wichtig ist, Qualifizierung zu den Fragen Netzwerkbildung und Netzwerkmanagement<br />
anzubieten, um die Arbeit zu professionalisieren. Unsere benachteiligten Jugendlichen,<br />
wenn sie nicht den Sprung über die erste Schwelle schaffen, finden sich zu<br />
einem großen Teil in den verschiedensten Formen der geförderten Ausbildung oder Berufsvorbereitung<br />
wieder.<br />
Aber: Unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass es nie zu spät ist, wenn es<br />
darum geht, Potentiale bei Jugendlichen zu entdecken und diese zielführend zu entwickeln.<br />
Dabei stoßen wir immer wieder auf die Tatsache, dass die Breite der Ausbildungsmöglichkeiten<br />
nicht ausreichend ist.<br />
Wir sind der Meinung, dass es erweiterte Möglichkeiten geben muss, damit Jugendliche ihren<br />
Fähigkeiten entsprechend ausgebildet werden können. Das heißt unter anderem, dass<br />
es mehr Möglichkeiten geben sollte, Ausbildungen bereits nach zwei Jahren auf einem<br />
Grundniveau abzuschließen. Das novellierte Berufsbildungsgesetz orientiert auf diese Möglichkeit<br />
genauso wie auf das Thema „gestreckte Ausbildungen“.<br />
Denkbar könnte es auch sein, dass Jugendliche ihre Ausbildung in mehreren Teilschritten<br />
absolvieren; das heißt, Abschnitte oder Module werden absolviert und zertifiziert und weitere<br />
Abschnitte werden nach einer Phase des Arbeitens abgeschlossen.<br />
Dabei können auch Module international absolviert werden. Hierfür fehlt aber derzeit noch<br />
die Vergleichbarkeit und damit eine Grundlage für die Anerkennung dieser Abschnitte. Ob es<br />
dann zu einer Prüfung kommt, in deren Vorfeld alle den Rahmenplan umfassenden Inhalte<br />
absolviert wurden oder zu einer Externenprüfung, die nach dem neuen BBiG bereits nach<br />
4,5 Jahren einschlägiger Tätigkeit möglich ist, ist dann nicht so entscheidend.<br />
Die inhaltliche Arbeit im Rahmen von geförderten Ausbildungen braucht an dieser Stelle<br />
nicht weiter im Detail dargelegt werden. Hier sind wir der Meinung, dass es doch sehr ausgereifte<br />
Konzepte und Beispiele gibt, die meist gleiche oder ähnliche Komponenten beinhalten.<br />
Hervorheben möchte ich aber, dass die Realisierung dieser Maßnahmen nur dann wirklich<br />
erfolgreich ist, wenn effektive Netzwerkstrukturen bestehen. Dabei muss unseres Erachtens<br />
der Partner Unternehmen / Wirtschaft noch intensiver und effektiver einbezogen werden.<br />
107
Das Zusammenwirken mit den Unternehmen ist für die Zeit nach der Ausbildung der Jugendlichen,<br />
wenn es um die Überwindung der 2. Schwelle geht, von immenser Bedeutung.<br />
Deshalb ist die Herangehensweise, die das neue Berufsvorbereitungskonzept vorsieht –<br />
nämlich bereits in Form von zertifizierbaren Qualifizierungsbausteinen berufliche Inhalte zu<br />
vermitteln, dies bei einem Träger oder in einem Unternehmen zu tun und diese eventuell auf<br />
zukünftige Ausbildungen anzurechnen – eine richtige und wichtige Chance, Potentiale der<br />
Jugendlichen früher zu entwickeln beziehungsweise hervorzubringen.<br />
Zum Schluss möchte ich auf eine weitere Aufgabe verweisen, die unseres Erachtens<br />
stärker in den Mittelpunkt rücken sollte: die Frage der Vermittlung der Absolventen.<br />
Aus unseren Erfahrungen mit dem Projekt „Jugend - Coaching - Center“, das im Rahmen<br />
des Programms „Aktionen für Jugend und Arbeit“ im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales,<br />
Gesundheit und Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong> erfolgreich durchgeführt wurde,<br />
können wir feststellen, dass es trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage möglich ist, Jugendliche<br />
in eine berufliche Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, wenn – begleitet<br />
durch individuelle Beratung und Betreuung – ein Matchingprozeß zwischen Jugendlichen<br />
und Unternehmen durchgeführt wird.<br />
Auch diese Erkenntnis ist sicherlich nicht ganz neu. Aber deren Umsetzung erfordert unseres<br />
Erachtens ein Umdenken und letztlich Mittel, die aber durch Einsparungen durch die Vermittlungen<br />
wieder wett zu machen sind.<br />
Als besonderes Beispiel kann ich heute vorstellen, wie der Landkreis Oder-Spree diese Frage<br />
handhabt:<br />
Im Laufe der vergangenen drei Jahre hat sich das Projekt in die Netzwerkstrukturen des<br />
Landkreises eingebracht und sie im Sinne der Aufgabe effektiviert.<br />
Der Landkreis Oder/Spree steht derzeit als optierende Kommune auch vor der Aufgabe, die<br />
Vermittlungstätigkeit aufzubauen. Seitens des Landkreises wurde das Modell des „Jugend -<br />
Coaching - Center“ als so effektiv erkannt, dass es mit dem Tag seiner Beendigung als Form<br />
der Beratung, Betreuung und Vermittlung insbesondere für das Klientel der Jugendlichen<br />
unter 25 Jahren aber auch für andere in die Strukturen des Landkreises übergegangen ist.<br />
Damit konnte eine dauerhafte Nachhaltigkeit für den Modellansatz des Projektes gesichert<br />
werden.<br />
Dem Landkreis danke ich für diesen Schritt an dieser Stelle sehr herzlich.<br />
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
108
Bodo Teubert, Astrid Haupt<br />
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) <strong>GmbH</strong><br />
„Berufsabschluss für junge Mütter“<br />
– ein Modellprojekt für<br />
benachteiligte junge Frauen<br />
109
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
vielen Dank für die Möglichkeit, unser Projekt für junge Mütter vorstellen zu können.<br />
Wir haben ja heute bereits von Frau Ministerin Ziegler gehört, dass wir Jugendliche ab einem<br />
bestimmten Punkt abholen sollen und wir tun das auch.<br />
Ganz einfach deshalb, weil wir vermeiden müssen, dass diese Jugendlichen sonst letztlich<br />
irgendwann auf der Strecke bleiben. Mit welchen Konsequenzen, weiß jeder von Ihnen.<br />
Wir haben uns in dem genannten Pilotprojekt ganz eindeutig auf eine Zielgruppe konzentriert:<br />
auf junge Mütter, die aufgrund ihrer individuellen Problemlage am schwierigsten in den<br />
Arbeitsmarkt zu integrieren sind, weil sie aus ihrer familiären Situation heraus besonders<br />
benachteiligt sind.<br />
Die Vorgeschichte des Projekts verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Aber nach mehreren Versuchen<br />
und Gesprächen in verschiedenen Ämtern und Einrichtungen ist es dann doch gelungen,<br />
im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie ein offenes Ohr für die<br />
Probleme dieser Zielgruppe zu finden. Dafür möchte ich mich bei Herrn Zaske hier auch<br />
noch einmal besonders bedanken.<br />
Was soll mit dem Projekt erreicht werden:<br />
Wir bieten seit dem 1.03.2005 im Bildungszentrum Frankfurt/Oder eine Ausbildung für junge<br />
Frauen mit abgeschlossener Schulausbildung, aber ohne Berufsabschluss, die bereits eine<br />
kleine Familie haben, an. Die Altersstruktur der Teilnehmerinnen reicht von Anfang 20 bis<br />
Anfang 30 und die jungen Frauen haben in der Regel ein Kind bis sechs Kinder. Meistens<br />
sind die Frauen allein erziehend, haben sich entweder nach der 10. Klasse oder nach dem<br />
Abitur für die kleine Familie entschieden anstatt für die berufliche Ausbildung, oder sie haben<br />
eine Ausbildung begonnen und diese dann aufgrund der frühen Mutterschaft nicht beendet.<br />
Als wir dieses Projekt beantragt und uns über das Konzept Gedanken gemacht hatten, wussten<br />
wir noch nicht, wie kompliziert die familiären Situationen der jungen Frauen oft sind.<br />
Die Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am Projekt ist eine abgeschlossene Schulausbildung<br />
ohne Berufsabschluss. Die meisten Teilnehmerinnen besitzen eine erweiterte<br />
Berufsbildungsreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Viele haben<br />
auch eine Ausbildung oder das Gymnasium begonnen aber nicht beendet, weil sie es sich<br />
aus finanziellen Gründen nicht leisten konnten. Viele müssen noch die Eltern unterstützen,<br />
die Alkoholiker oder arbeitslos sind; aufgrund dessen haben sie sich entschieden, lieber Arbeitslosenhilfe<br />
in Anspruch zu nehmen, als eine Ausbildung abzuschließen.<br />
110
Von der Teilnehmerzahl her ist das Projekt für 20 Teilnehmerinnen konzipiert, die über eine<br />
Trainingsmaßnahme ausgewählt wurden. Getestet wurde vor allem die Motivation, denn die<br />
jungen Frauen müssen es schaffen, in 2 Jahren eine Ausbildung mit IHK - Abschluss zur<br />
Kauffrau für Bürokommunikation, die sonst 3 Jahre umfasst, zu absolvieren.<br />
Die Ausbildung wird in Teilzeitform angeboten. Das heißt, sie haben nur 7 Stunden Unterricht<br />
täglich anstatt 8 Stunden. Das haben wir deshalb so gemacht, weil wir sagen, wir können<br />
auf der einen Seite nicht Frauen qualifizieren aber dann gleichzeitig die kleinen Familien<br />
kaputt machen. Dadurch bleibt auch noch etwas Zeit für die Beschäftigung mit den Kindern,<br />
die ja ohne Zweifel auch darauf Anspruch haben, nachdem sie den ganzen Tag in der Kindereinrichtung<br />
waren. Aber wenn auch die Ausbildung nur 7 Stunden am Tag umfasst und<br />
nur zwei Jahre anstatt wie sonst drei Jahre dauert; die Prüfungsbedingungen sind genau die<br />
gleichen wie in der regulären Ausbildung.<br />
Die gesamte Ausbildung ist in modularer Form aufgebaut.<br />
Natürlich ist die Grundlage der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kauffrau für Bürokommunikation.<br />
Die modulare Form ermöglicht, zu Beginn eines jeden Moduls immer ein<br />
Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wenn die eine oder andere es möglicherweise doch<br />
nicht bis zur Abschlussprüfung schafft, so haben die Frauen zumindest die Möglichkeit, nach<br />
jedem Modul eine Teilnahmebescheinigung zu bekommen. Wenn sie also aus familiären<br />
oder persönlichen Gründen doch abbrechen müssen, dann besteht zumindest die Möglichkeit,<br />
später noch einmal den Anschluss zu finden.<br />
Wir bieten eine ganzzeitige sozialpädagogische Betreuung an, die auch dringend notwendig<br />
ist. Die jungen Frauen kommen zur Ausbilderin oder oft auch zu mir mit all ihren<br />
Problemen und freuen sich, dass sie endlich einmal angehört werden.<br />
Zu den Vermittlungsaktivitäten ist zu sagen, dass sich das sicher sehr schwierig gestalten<br />
wird. Wir wollen vor allem die Möglichkeiten der Einstiegsteilzeit nutzen und wir haben uns<br />
natürlich auch vorgenommen, die Teilnehmerinnen nach der Ausbildung weiter zu betreuen.<br />
Das sieht das Projekt auch so vor. Die Ausbildung in nur 87,5% der Normalzeit zu schaffen,<br />
ist schon hart. Hinzu kommt noch, dass die Frauen nicht mehr als 6 Wochen in einem Ausbildungsjahr<br />
fehlen dürfen, sonst werden sie nicht zur Kammerprüfung zugelassen. Erstaunlicherweise<br />
ist der Krankheits- und Fehlstand sehr gering. Die jungen Mütter schaffen es<br />
wirklich, wenn die Kinder krank werden, nur maximal zwei Stunden zu fehlen. Dann haben<br />
sie die Kinder irgendwo untergebracht und sind nach der dritten Stunde wieder anwesend.<br />
Das ist schon sehr bewunderungswert.<br />
111
Die Entscheidung für die Ausbildung in modularer Form haben wir natürlich in unserem Projektantrag<br />
wissenschaftlich begründet. Es geht zum einen um die Steigerung von Flexibilität<br />
und Rationalisierung der Ausbildungsprozesse, zum anderen geht es um eine stärkere Motivation<br />
der Lernenden und ganz konkrete abrechenbare Schritte und natürlich um eine größere<br />
Transparenz der Ausbildungsprozesse.<br />
Wir haben geplant, gegen Ende des Projektes für die Vermittlung einen Betriebskontakter<br />
einzusetzen. Das Ausbildungsprogramm beinhaltet ja neben der theoretischen auch eine<br />
betriebliche Ausbildung. Das heißt, die Frauen werden auch die Gelegenheit haben, theoretisches<br />
Wissen unter betrieblichen Bedingungen anwenden zu lernen. Aber auch hier gibt es<br />
Schwierigkeiten:<br />
Zum Einen sind Unternehmen Praktikanten gegenüber zu Beginn der Ausbildung meist erst<br />
einmal aufgeschlossen. Wenn sie dann aber den Rahmenlehrplan für die betriebliche Praxis<br />
sehen, heißt es oft: „Das können wir denn doch nicht leisten“. Dennoch haben zwei Drittel<br />
der Frauen schon ein gesichertes Praktikum und wir rechnen mit dem Verständnis und dem<br />
sozialen Engagement von weiteren Unternehmen auch für das letzte Drittel.<br />
Zweitens sind die Frauen, und das will ich hier an dieser Stelle noch einmal betonen, zur<br />
Sicherung ihres Lebensunterhaltes ausschließlich auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Sie<br />
bekommen keinen Cent mehr für Fahrtkosten in die Bildungseinrichtung oder in das Unternehmen,<br />
wo sie ihr Praktikum absolvieren. Sie müssen alles von dieser Arbeitslosenunterstützung<br />
bestreiten. Kinderbetreuungskosten sind frei, aber das Essengeld für die Kinder<br />
muss natürlich bezahlt werden. Aus diesem Grund können wir Unternehmen, die sich nicht<br />
im unmittelbaren Wohnumfeld der jungen Frauen befinden – auch wenn sie ihre Unterstützung<br />
bereits signalisiert haben, vielleicht sogar über das Praktikum hinaus für eine spätere<br />
Perspektive – gar nicht auswählen. Einfach, weil die jungen Frauen es sich finanziell nicht<br />
leisten können, die Fahrtkosten für den Weg ins Betriebspraktikum zu finanzieren. Also<br />
kommen nur Unternehmen in Frage, die zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar<br />
sind.<br />
Wir hatten gehofft, für dieses Problem bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobzentrum Unterstützung<br />
zu finden, aber das ist uns an dieser Stelle leider nicht gelungen. Die Frauen<br />
wussten das von Anfang an und dennoch haben sie sich für dieses Projekt entschieden; das<br />
unterstreicht meines Erachtens noch einmal mehr die sehr hohe Motivation, um zu einem<br />
Berufsabschluss zu kommen.<br />
Unterstützung erhalten wir von mehreren Kooperationspartnern; vor allem seitens der IHK<br />
Frankfurt/Oder. Trotz anfänglicher Bedenken wegen der verkürzten Ausbildungszeit und der<br />
komplizierten Zielgruppe streben wir jetzt gemeinsam an, dass 80 % der Teilnehmerinnen<br />
einen Kammerabschluß schaffen.<br />
112
Auch die Unternehmensverbände und Unternehmensvereinigungen unterstützen uns mit<br />
Kontakten. Hier sehen wir vor allem Möglichkeiten für spätere Vermittlungen und für die Einstiegsteilzeit<br />
für Jugendliche. Wir haben uns auch deshalb für den Beruf der Kauffrau für<br />
Bürokommunikation entschieden, weil hier die Möglichkeit besteht, auch in Teilzeit, von zu<br />
Hause aus, zu arbeiten. Und das ist natürlich für die jungen Frauen nach der meist relativ<br />
langen Pause seit der Schulzeit besser zu bewältigen.<br />
Unser Haus würde gern auch eine gewerbliche Ausbildung anbieten. Wir haben im Vorfeld<br />
des Beginns der Ausbildung auch einen Berufsfeldtest durchgeführt. Die Frauen hatten die<br />
Möglichkeit, sich selbst zu testen, ob sie im gewerblichen, im kaufmännischen oder im IT-<br />
Bereich ihre Stärken und Interessen wieder finden. Die Mehrheit hat sich aber für den kaufmännischen<br />
Bereich entschieden, weil die meisten jungen Frauen dazu einfach eine bessere<br />
Beziehung hatten.<br />
Unser Ziel ist es, von 20 Teilnehmern mindestens 50 % in Arbeit zu bringen. Ich bin überzeugt<br />
davon, dass wir es schaffen, obwohl es nicht leicht sein wird.<br />
Nach Projektende beziehungsweise in der Endphase des Projektes werden mit allen Frauen<br />
Eingliederungs- und Berufswegpläne erarbeitet und ganz konkret ihre Stärken herausgefiltert,<br />
um sie bestmöglichst für die Vermittlung in Unternehmen vorzubereiten.<br />
Und wir werden den jungen Frauen auch nach der Ausbildung noch zur Verfügung stehen,<br />
wenn sie es wünschen.<br />
Parallel zu diesem Projekt haben wir eine weitere Idee im Hinblick auf die Möglichkeiten<br />
der Mehraufwandsentschädigung in den 1-Euro-Jobs:<br />
Wir denken, dass man dieses Instrument dazu nutzen könnte, Pädagogen, vielleicht ehemalige<br />
Kindergärtnerinnen, Krippenerzieherinnen, Unterstufenlehrerinnen oder medizinisches<br />
Personal für die Kinderbetreuung zu gewinnen.<br />
So könnten zum Beispiel, wenn die Kinder krank sind und Prüfungen anstehen, die jungen<br />
Frauen in Ruhe an der Prüfung teilnehmen.<br />
Hier stehen wir aber mit unseren Überlegungen noch am Anfang.<br />
Vielen Dank.<br />
113
Karin Smettan<br />
SSI am Alex, Institut für Tourismus und Marketing, Berlin<br />
Das Ausbildungsmodellprojekt<br />
„Fit for Future“: bedarfsgerecht ausbilden<br />
für den Gesundheitsmarkt im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
115
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
das Institut für Tourismus und Marketing existiert in Berlin und im Land <strong>Brandenburg</strong> seit 15<br />
Jahren, ist ein Spezialist für die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Tourismus, Sport<br />
und Freizeit und kann mittlerweile auf knapp 3000 Absolventen verweisen. Gemeinsam mit<br />
dem <strong>Brandenburg</strong>ischen Kurorte- und Bäderverband und mit großer Unterstützung des Ministeriums<br />
für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Familie (damals unter der Leitung von Frau<br />
Regine Hildebrandt) haben wir in einem Modellversuch 1998/1999 das neue Berufsbild „Referent<br />
für Gesundheitstourismus“ entwickelt.<br />
Als qualifizierte Fachkraft und moderner Dienstleister wird der Referent für Gesundheitstourismus<br />
in Hotels, Gesundheits- und Kurzentren, aber auch bei Reiseveranstaltern und in<br />
Tourismusorganisationen eingesetzt. Auf der Grundlage fundierter sportlicher Kenntnisse<br />
und kommunikativer Fähigkeiten ist er maßgeblich an der Erarbeitung, Vermarktung und<br />
Umsetzung zeitgemäßer Konzepte im Wellness- und gesundheitstouristischen Bereich tätig.<br />
Aber auch die aktive Arbeit mit dem Gast im Hinblick auf Bewegung, Ernährung, Entspannung<br />
und Ganzheitlichkeit sind Bestandteil seiner Ausbildung. Wirkungsfelder des Referenten<br />
für Gesundheitstourismus liegen somit vor allem in Thermen und Erlebnisbädern, Wellness-<br />
und Kurhotels, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kur- und Rehabilitationskliniken sowie<br />
Tourismusämtern und -verbänden<br />
Voraussetzungen für eine Ausbildung zum Referenten für Gesundheitstourismus sind<br />
mindestens ein Realabschluss, Stressfähigkeit, Mobilität und Einsatzfreude. Flexibilität in<br />
den Arbeitszeiten, Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie Einsatz auch in späten Abendstunden<br />
muss gewährleistet sein. Weitere wichtige Voraussetzungen sind Kommunikationsfähigkeit,<br />
sportliche Ambitionen und großes Interesse in den Bereichen Ernährung, Entspannung<br />
und Bewegung.<br />
Angeregt wurde die Entwicklung des neuen Berufsfeldes durch den Tatbestand, dass in<br />
den Kurorten die klassischen Kassenpatienten durch die gesundheitsbewußten Selbstzahler<br />
ersetzt wurden. So standen im Jahre 2000 bereits 1,5 Mio. Kassenpatienten 6 Mio. Selbstzahlern<br />
gegenüber. Bei der Betrachtung dieser Entwicklung und den Beschäftigten mit diesem<br />
Klientel “Selbstzahler“ wurde deutlich, dass auch neue Anforderungen an das Personal,<br />
also diejenigen, die die Erwartungen und Wünsche der Kunden/ Gäste erfüllen, entstanden<br />
sind.<br />
Zunächst möchte ich Ihnen aufzeigen, wie ein Gesundheitsurlauber ausschaut und welche<br />
Erwartungen er hat: Der Gesundheitsurlauber von heute ist ein dynamischer und gesund<br />
lebender Mensch. Er will durch bewusste Ernährung, Bewegung und durch innere Ausge-<br />
116
wogenheit an Lebensqualität gewinnen. Statistiken zeigen, dass der Gesundheitsgast von<br />
heute in seine Gesundheit investiert und nicht seine Krankheit repariert.<br />
Die im Jahre 2005 veröffentlichte Studie “Wellness Destination Usedom“ präsentiert den<br />
durchschnittlichen Gesundheitstouristen folgendermaßen:<br />
Nahezu ausgeglichene Geschlechterverteilung<br />
die 40 - 49jährigen haben den größten Anteil (24%)<br />
72% haben eine akademische Vorbildung<br />
67%iger Anteil an 2 - Personen - Haushalten<br />
50% der Gäste sind Angestellte.<br />
Der Gast erwartet freundlichen und persönlichen Service sowie erfahrenes, kompetentes<br />
Personal. Nur so ist der Gast in Zukunft als Stammgast zu empfangen.<br />
Der deutsche Urlauber legt immer mehr Wert auf eine intakte Natur und eine natürlich gesunde<br />
Umgebung, was Kurorten und Heilbädern entspricht, die die vorhandene Infrastruktur<br />
und zielgruppenorientierte Angebote nutzen müssen. Das Bewegungs- und Ernährungsprogramm<br />
muss auf die Vitalität des Gastes individuell abgestimmt werden. Die Gesundheitsurlauber,<br />
die ihren Urlaub selbst bezahlen, erwarten immer mehr Pauschalangebote mit einem<br />
guten Preis-Leistungs-Verhältnis und möchten mehr kulturelle Angebote am Urlaubsort vorfinden.<br />
Wir vom SSI haben mit unserer Ausbildung auf die neuen Trends reagiert.<br />
Zunächst haben wir uns mit den sich wandelnden Freizeit- und Urlaubsbedürfnissen auseinandergesetzt<br />
und die neuen Trends und Tendenzen analysiert. Es stellte sich heraus, dass<br />
die Bereiche<br />
Sport/ Bewegung/ Fitness<br />
Ernährung<br />
Entspannung/ Stressmanagement<br />
Rhetorik/ Kommunikation<br />
einen besonderen Stellenwert in der Ausbildung einnehmen müssen.<br />
Das Curriculum trug dem Rechnung.<br />
Welche Erfahrungen haben wir nun in den letzten 6 Jahren mit der Ausbildung von Referenten<br />
für Gesundheitstourismus und Wellnesstrainern gemacht (gemessen vor allem an der<br />
Vermittlung in Jobs), wie werden diese Erfahrungen in innovative Ausbildungsinhalte umgesetzt<br />
und was unterscheidet die Ausbildung von bereits bestehenden Bildungsangeboten in<br />
diesem Markt: Im Rahmen des aktuellen Modellprojektes „Fit for Future – Bedarfsgerecht<br />
ausbilden für den Gesundheitsmarkt im Land <strong>Brandenburg</strong>“ unterstützt durch das MASGF<br />
und der <strong>LASA</strong> werden verschiedene neue Ansätze in die Ausbildung aufgenommen.<br />
117
1. Die Vermittlung von Wissen und Können in den Bereichen Sport und Fitness allein reicht<br />
nicht aus, um in den dafür angesagten Einrichtungen wie zum Beispiel Fitnessstudios tätig<br />
zu werden. Vielmehr sind Lizenzen gefragt. Aus diesem Grunde haben wir mit dem Landessportbund<br />
eine Kooperation abgeschlossen und führen die Ausbildung für Übungsleiter Breitensport<br />
und weitere Aufbaustufen durch.<br />
2. Die Fragen der Ernährung haben einen völlig neuen Stellenwert erhalten. Begnügten wir<br />
uns anfangs noch mit der Vermittlung der Ernährungspyramide, der Zusammensetzung von<br />
Lebensmitteln und einfachen Übungsprogrammen, so sind heute vor allem auch Empfehlungen<br />
zur Gewichtskontrolle, Gewichtsreduzierung und das Zusammenspiel der Komponenten<br />
Bewegung und Ernährung Gegenstand unseres Unterrichts. Durch unseren Netzwerkpartner,<br />
das Institut für Getreideverarbeitung in Potsdam Rehbrücke, werden jetzt zum Beispiel<br />
Themen wie:<br />
Roggenbackwaren - Trend zu gesunder Ernährung<br />
Ernährungsphysiologie der Senioren<br />
Mikroalgen in Human- und Tiernahrung<br />
Diätwahn und die Folgen oder<br />
Bio- Nahrung: Zusammensetzung und Vorteile<br />
behandelt.<br />
Die Kombination aus prägnantem modularen Unterricht mit parallelen praktischen Anwendungen<br />
in Form der Herstellung von speziellen Backwaren für Diabetiker oder Senioren erzielt<br />
einen wirtschaftsnahen Wissenszuwachs.<br />
3. Nahmen die Bereiche Psychoregulation, Stressmanagement und Programmerstellung für<br />
Prävention bisher einen sehr kleinen Raum in der Ausbildung ein, so ist die Nachfrage bei<br />
potentiellen Arbeitgebern mittlerweile sprunghaft gewachsen. Das Beherrschen der Techniken<br />
für Entspannungsmassagen ist fast ein „Muss“, um einen Praktikumsplatz beziehungsweise<br />
eine Anstellung zu erhalten. Also haben wir hier „nachgesattelt“ und spezielle Module<br />
mit stufenweise abschließenden Zertifikaten entwickelt.<br />
4. Zeitgemäße erlebbare Rahmenbedingungen während der Ausbildung, zum Beispiel in<br />
Form eines „fahrenden Klassenzimmers“, um die touristischen Potenziale direkt kennen zu<br />
lernen, sind ebenso wichtig wie die Einbindung aktueller Themen (Fußball WM), um sich mit<br />
dem Berufsfeld und dem breiten Einsatzspektrum identifizieren zu können.<br />
5. Selbständige Projektarbeiten und Ideenwettbewerbe im Laufe der Ausbildung zu relevanten<br />
Themen, wie „Fit Kids in <strong>Brandenburg</strong>“ oder „Urlaubsangebote für Diabetiker“ in Kooperation<br />
mit touristischen Leistungsträgern und Verbänden können als Impulse für neue<br />
118
Produktgestaltung dienen und stellen für die Auszubildenden konkrete Aufgaben im Praktikum<br />
dar, die den ersten Schritt in Richtung Job darstellen können.<br />
6. Mit dem Modellprojekt wird erstmals eine Verbundausbildung mit der IHK angestrebt, die<br />
als Best - Practice - Beispiel dienen kann. Im Anschluss an die staatlich anerkannte Ausbildung<br />
zum Referenten für Gesundheitstourismus wird die Möglichkeit bestehen, ein weiteres<br />
Jahr die Ausbildung im dualen System fortzuführen und den neuen Abschluss zum Kaufmann<br />
für Freizeit und Tourismus (IHK) „draufzusatteln“. Die Unternehmen haben im dritten<br />
Jahr somit bereits sehr gut qualifizierte Auszubildende und innerhalb kürzester Zeit können<br />
zwei Abschlüsse erworben werden.<br />
Dem demographisch bedingten Fachkräftemangel wird durch solche neuen Ausbildungsmodelle<br />
entgegengewirkt, neue Berufsperspektiven werden geschaffen, Abwanderungen junger<br />
Menschen verringert und die gesamte Lebensqualität erhöht.<br />
Gleichzeitig stoßen wir hier immer wieder auf Diskussionen und Probleme, die zukünftig einer<br />
noch saubereren Klärung bei Leistungsanbietern bedürfen.<br />
Worum geht es?<br />
Die Wellnessberatung ist juristisch gesehen an keine besondere Fach- oder Sachkenntnis<br />
gebunden und daher zunächst jedem erlaubt. Das Stellen einer Diagnose und das Unterbreiten<br />
eines Therapievorschlags obliegen ausschließlich Ärzten, Psychotherapeuten und Heilpraktikern<br />
mit Heilkundeerlaubnis. Aber was, wenn der Gast (gefragt oder nicht gefragt) vorgibt,<br />
gesundheitliche Probleme zu haben – und welcher Gast ist schon kerngesund? Oder<br />
was, wenn der Gast zwar vorgibt, gesundheitlich in Ordnung zu sein und tatsächlich aber<br />
krank ist? Die Versuchung der Grenzüberschreitung liegt hier nahe, da die im Wellness- und<br />
Fitnessbereich Tätigen nicht selten über mehr oder weniger medizinisch fundierte Zusatzkenntnisse<br />
verfügen und diese gern an Mann oder Frau bringen.<br />
Ziel muss es von Anbieterseite sein, sein Angebot klar zu positionieren und dementsprechend<br />
das Fachpersonal vorzuhalten. Für uns als Bildungsanbieter heißt es, die Grenzen<br />
zwischen Heilkunde und Wellness- oder Lebensberatung klar zu vermitteln.<br />
Für zukünftige neue Berufsfelder beziehungsweise Module der Weiterbildung liegt hier noch<br />
Potential zum Tätigwerden. Ebenso wie in der Vernetzung bestehender Konzepte und der<br />
Bearbeitung der Themen moderne Prävention und Vitalität.<br />
Dazu wird unser Modellprojekt neue Impulse einbringen.<br />
119
Elke Swolinski<br />
Qualifizierungsförderwerk Chemie <strong>GmbH</strong>, Merseburg<br />
„trans-fer“– ein Modellprojekt<br />
zur Förderung von Bildungsmobilität<br />
121
Meine Damen und Herren,<br />
Bildung und Ausbildung um internationale Elemente zu erweitern, war und ist im Hinblick auf<br />
das Zusammenwachsen in Europa und die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft<br />
ein Qualifikationsgewinn für Auszubildende und Lehrende.<br />
Vor einem Erfahrungshintergrund persönlicher Mobilität und mit reflektierten persönlichen<br />
Erfahrungen werden Jugendliche sicherlich eher in der Lage sein, Zuwanderung und das<br />
Umfeld und Arbeitszusammenhängen zu akzeptieren.<br />
Ausgangspunkt aller Maßnahmen von trans-fer war die individuelle und gesellschaftliche Erfahrungswelt<br />
der Teilnehmenden. Sie wurden darin unterstützt, persönliche, soziale und daraus<br />
resultierend auch berufliche Handlungsspielräume zu erkennen und zu erweitern. Durch<br />
nachhaltige Förderung von Toleranz und Weltoffenheit stärkte das Projekt die Beschäftigungsfähigkeit<br />
junger Menschen und unterstützte ihre mentale und berufliche Mobilität und<br />
Flexibilität. Jugendliche erlebten bereits während ihrer Ausbildung unterschiedliche kulturelle<br />
Lebens- und Arbeitswelten. Diese Erfahrungen wurden zum festen Bestandteil ihrer individuellen<br />
Berufswegeplanung und eine Art europäisches „Curriculum vitae“.<br />
Das Projektlogo „Rad schlagendes Männchen“ ist<br />
zum Sinnbild für den Perspektivwechsel durch<br />
Fortbewegung geworden<br />
Projektdesign<br />
Die Qualifizierungsförderwerk Chemie <strong>GmbH</strong> (QFC) ist ein Tochterunternehmen der Industriegewerkschaft<br />
Bergbau, Chemie, Energie und führte in Sachsen-Anhalt das Modellprojekt<br />
zur Förderung von Bildungsmobilität trans-fer im Zeitraum 17.09.2001 bis zum 16.09.2004<br />
durch. Der Europäische Sozialfonds und das Land Sachsen-Anhalt förderten das Projekt.<br />
122
Dieses Bildungsangebot schaffte für Auszubildende Möglichkeiten, während der Berufsausbildung<br />
zusätzliche Qualifikationen zu erwerben, die über eine enge Spezialisierung hinaus<br />
gingen. Jugendliche lernten Europa kennen, lernten Sprachen und befassten sich mit interkultureller<br />
Kommunikation. Sie wurden auf neue Lernformen und auf ihre Aufenthalte im Ausland<br />
vorbereitet und beschäftigten sich mit landeskundlichen Fragestellungen.<br />
Unternehmen, Ausbilder/innen, Berufsschullehrer/innen und die Teilnehmer/innen betrachten<br />
Mobilitätsförderung in der Ausbildung als wichtige Aufgabe der europäischen Bildungszusammenarbeit<br />
und der nationalen Bildungspolitik. Denn sie ist eine wesentliche Voraussetzung<br />
zur Schaffung des europäischen Bildungsraumes. Unternehmen in Sachsen-Anhalt<br />
unterstützten dieses Projekt.<br />
trans-fer war ein Bildungsprojekt, das der beruflichen Bildung in Sachsen-Anhalt internationale<br />
Impulse verliehen hat, neue Methoden in der beruflichen Bildung umsetzte und Praxisaufenthalte<br />
deutscher Jugendlicher im Ausland ermöglichte.<br />
Das gesamte Projekt gliederte sich in fünf verschiedene Module für Auszubildende: Seminare<br />
im In- und Ausland, Praktika sowie Sprachkurse in Englisch, Italienisch oder Französisch.<br />
Für Ausbilder/innen und Berufsschullehrer/innen wurden so genannte Multiplikatorenseminare<br />
durchgeführt (siehe Grafik).<br />
Zielgruppen<br />
Auf europäischer Ebene durchgeführte Studien dokumentieren, dass sich die Chancen für<br />
Auszubildende, nach Beendigung der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu erhalten, erhöhen,<br />
wenn sie durch Auslandsaufenthalte und -praktika auf den Einstieg in ein von kultureller Vielfalt<br />
geprägtes Berufsleben vorbereitet sind. Erfahrungen in der Alltags- und Berufswelt anderer<br />
Kulturzusammenhänge zu sammeln, war und ist für junge Menschen in Sachsen-Anhalt<br />
aufgrund der dortigen Bevölkerungszusammensetzung nur schwer möglich.<br />
123
Vor diesem Hintergrund richtete sich das Maßnahmenangebot des Modellprojekts vornehmlich<br />
an Auszubildende, an junge Arbeitnehmer/innen sowie an von Arbeitslosigkeit bedrohte<br />
Jugendliche in Sachsen-Anhalt. Die Definition der Zielgruppe war so weit gefasst, um auch<br />
diejenigen Jugendlichen in Sachsen-Anhalt in das Projekt einbeziehen zu können, die sich in<br />
geförderten Maßnahmen der beruflichen Ausbildung befanden und von daher einen relativ<br />
gering ausgeprägten Bezug zur betrieblichen Praxis hatten. Der Grundgedanke des Projekts<br />
war von Offenheit geprägt, es gab keine Festlegung auf bestimmte Berufsbilder oder Schulabschlüsse.<br />
Die Ausbilder/innen und Berufsschullehrer/innen wurden im Rahmen von trans-fer als eigene<br />
Zielgruppe definiert, da sie sich durch die strukturellen Veränderungen in Gesellschaft und<br />
Wirtschaft beruflich vor neue Aufgaben gestellt sehen und von ihnen – als erste Bezugs- und<br />
Ansprechpartner der Jugendlichen – erwartet wird, dass sie die Auszubildenden ausreichend<br />
auf die Anforderungen des europäischen Arbeitsmarktes vorbereiten. Der Europäische Rat<br />
hat im Dezember 2000 die Mobilität in Europa zum vorrangigen politischen Ziel erklärt und<br />
somit den Auftrag an alle im Bildungsbereich Tätigen formuliert, sich dieser Herausforderung<br />
zu stellen. Das Projekt trans-fer ermöglichte erste Schritte zur Umsetzung.<br />
Projektziele<br />
Die Seminare in trans-fer vermittelten Schlüsselqualifikationen. Sie setzten an der individuellen<br />
und gesellschaftlichen Erfahrungswelt der Teilnehmenden mit dem Ziel an, Jugendliche<br />
darin zu unterstützen, ihre persönlichen und sozialen – und daraus resultierend auch mögliche<br />
berufliche – Handlungsspielräume zu erkennen und zu erweitern. Insgesamt sollte die<br />
Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen in Sachsen-Anhalt verbessert werden. Entsprechend<br />
waren die Seminarinhalte nicht auf die speziellen Anforderungen eines bestimmten<br />
Berufsbildes ausgerichtet.<br />
Zusammengefasst lagen die Schwerpunkte in der<br />
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Team-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit<br />
im internationalen Kontext<br />
Vermittlung, Durchführung und Auswertung internationaler Praktika für Auszubildende<br />
Schaffung und Etablierung von Rahmenbedingungen in Unternehmen und Berufsschulen,<br />
um ausbildungsbegleitend in internationalen Zusammenhängen zu lernen,<br />
zu arbeiten und zu leben.<br />
Langfristig sollten Grundlagen in den Unternehmen, den Berufsschulen und bei den Bildungsträgern<br />
dafür geschaffen werden, Auslandsaufenthalte in der beruflichen Aus- und<br />
Weiterbildung dauerhaft zu verankern.<br />
124
Umsetzung<br />
Um die Auszubildenden zu erreichen und ihr Interesse für eine Teilnahme am Projekt zu wecken,<br />
verfolgten die Projektmitarbeiter/innen des QFC zwei Strategien: mit den Leiter/innen<br />
und Lehrer/innen der Berufsschulen in Sachsen-Anhalt wurden Gespräche geführt und parallel<br />
dazu wurde die Projektkonzeption Ausbildungsverantwortlichen in den Unternehmen vorgestellt.<br />
Gemeinsam mit den jeweiligen Betriebsräten, Personalverantwortlichen und Ausbilder/innen<br />
wurden die Ziele und Inhalte der einzelnen Module erörtert und ausführlich über<br />
die Vorteile für die Unternehmen diskutiert, wenn sie die Auszubildenden für die Projektteilnahme<br />
freistellen würden. Da die Teilnahme am Projekt für Auszubildende und Unternehmen<br />
kostenfrei war, wurde häufiger die inhaltliche Qualität in Frage gestellt: „Das ist ja ein Urlaubsgeschenk,<br />
kann denn das überhaupt gut sein? Was sollen die Auszubildenden in Polen<br />
oder Frankreich lernen, was sie nicht auch hier lernen können?“<br />
Die Zweifel konnten weitestgehend entkräftet werden, da es sich um ein vom Land Sachsen-<br />
Anhalt gefördertes Projekt handelte, welches das Landesinteresse verfolgte, möglichst vielen<br />
anhaltinischen Jugendlichen europäische Erfahrungen zu ermöglichen. In diesem Kontext<br />
betonten die Mitarbeiter/innen des QFC in allen Gesprächen, dass die Projektteilnahme nicht<br />
von den bisherigen Lernleistungen der Auszubildenden abhängig gemacht werden sollte.<br />
Ein weiteres Argument war der Verweis auf das Berufsbildungsgesetz (BBiG, Erster Teil,<br />
allgemeine Vorschriften, § 1. Abs. 2). Die Reformanstrengungen, die im Rahmen des BBiG<br />
bundesweit diskutiert wurden und schließlich im Juli 2004 als Gesetzentwurf des BMBF zum<br />
neuen Berufsbildungsreformgesetz vom Bundeskabinett auf den Weg durch das parlamentarische<br />
Gesetzgebungsverfahren gebracht wurden, unterstützten das Projektvorhaben, internationale<br />
Lerninhalte und Lernorte in die Berufsausbildung zu integrieren.<br />
Auch die modularisierte Projektstruktur, die vorsah, dass die Auszubildenden möglichst zu<br />
Beginn ihrer Ausbildung ein so genanntes Grundseminar besuchen sollten und erst danach<br />
gemeinsam, auch mit den Jugendlichen, entschieden werden kann, ob und mit welcher Intensität<br />
die Seminarteilnahme weiter verfolgt wird, war überzeugend.<br />
So dienten die Grundseminare der sensiblen Anleitung und Einstimmung im Hinblick auf die<br />
individuelle Verortung der Jugendlichen als Auszubildende. Fragestellungen zu ihrer aktuellen<br />
Lebenssituation sowie zu ihren Zukunftsvorstellungen in beruflicher und persönlicher<br />
Hinsicht wurden anhand verschiedener, die Lebenssituation der Jugendlichen direkt betreffender<br />
und sie interessierender Themen erörtert. Die Leitidee hierfür war die Festigung von<br />
Bildungsprozessen im Hinblick auf einen multiperspektivisch und internationalen Horizont.<br />
Insgesamt hat die inhaltliche Vielfalt zur Entwicklung und Stärkung der Ich-Identität beigetragen.<br />
Darauf aufbauend wurden die Jugendlichen für kulturelle Reize aus anderen Zusammenhängen<br />
sensibilisiert und in ihrer Interaktionsfähigkeit gestärkt.<br />
125
Kennzeichnend für alle Lernangebote war die Unmittelbarkeit und Ganzheitlichkeit des Lernens<br />
sowie eine auf die jeweiligen Teilnehmer/innen abgestimmte Variation verschiedener<br />
Methoden: Simulationen, Rollenspiele, Interaktionsübungen, Erkundungen, Übungen zur<br />
Selbsteinschätzung und -wahrnehmung sowie folienunterstützte Präsentationen.<br />
Zu Beginn des Projektes existierten trotz der ausgiebigen Gespräche Vorbehalte, ob denn<br />
durch die Projektteilnahme die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung gefährdet<br />
werden würde. Um diesen Befürchtungen zu begegnen, wurde mit den Unternehmen und<br />
Berufsschulen eine Absprache getroffen, die vorsah, dass eine Person aus dem Betrieb,<br />
vom jeweiligen Bildungsträger und/oder der Berufsschule am Seminar teilnehmen kann und<br />
wir nach dem Seminar die Ergebnisse gemeinsam auswerten. Diese direkte und Institutionen<br />
übergreifende Form der Zusammenarbeit stellte die Basis für den von allen Beteiligten abschließend<br />
als positiv bewerteten Projektverlauf dar. Zusätzlich wurden die Ausbilder/innen,<br />
Berufsschullehrer/innen und Betriebsräte in das Projekt durch besondere Fortbildungen eingebunden,<br />
was ein weiterer Grundstein für die erfolgreiche Projektgestaltung war.<br />
Nach den Grundseminaren bereiteten sich die Jugendlichen in den dreitägigen Aufbauseminaren<br />
auf den jeweiligen Auslandsaufenthalt vor. Dies war insofern sinnvoll, da zwar über 80<br />
Prozent von ihnen noch nie im Ausland waren, aber trotzdem große Vorbehalte insbesondere<br />
gegenüber osteuropäischen Ländern hegten. Angeleitet erstellten die Jugendlichen eigene<br />
Länderporträts, bauten so ihre Schwellenängste ab und entwickelten Interesse am Lebens-<br />
und Arbeitsumfeld des zu besuchenden Landes. Wesentliche Bestandteile der meisten<br />
Auslandsaufenthalte waren Werksbesichtigungen und Gespräche mit Jugendlichen in vergleichbaren<br />
Situationen. So hatten die zukünftigen Arbeitnehmer/innen die Möglichkeit, einen<br />
Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt in der Tschechischen Republik, Polen, Frankreich,<br />
Italien, Irland und England zu erhalten. Die Jugendlichen konkretisierten so ihre Vorstellung<br />
von einem europäischen Arbeitsmarkt. Insbesondere konnten sie die Situation nach dem<br />
politischen und wirtschaftlichen Umbruch in Deutschland mit denen in der Tschechischen<br />
Republik und Polen vergleichen.<br />
Das Projekt hatte eine Dynamik entwickelt. Die große Kooperationsbereitschaft und Flexibilität<br />
aller am Projekt Beteiligten war bemerkenswert. Etwa in der Mitte der Projektlaufzeit<br />
zeigte sich jedoch eine geringere Nachfrage, was die Möglichkeiten von Auslandsseminaren<br />
in den – zu dem Zeitpunkt noch Beitrittskandidatenländern – betraf, aber gleichzeitig eine<br />
erhöhte Nachfrage nach Seminaren im englischsprachigen Raum, was mit der Förderung<br />
des Fremdsprachenlernens zusammen hing. Nach ausführlichen Gesprächen mit Vertreter/innen<br />
der Unternehmen, Berufsschulen und Bildungsträger haben wir mit den Verantwortlichen<br />
im Land Sachsen-Anhalt eine nachfrageorientierte Umwidmung der Seminarkontingente<br />
erwirkt.<br />
126
Ergebnisse<br />
Im Projektzeitraum von September 2001 bis September 2004 haben 1.272 Jugendliche, davon<br />
661 weiblich und 611 männlich, am Projekt teilgenommen. Es fanden 50 Seminare im<br />
Ausland statt und 59 Jugendliche absolvierten ihre Praktika in Irland, England, Polen, Frankreich,<br />
Österreich und Spanien. Zwei Praktikantinnen führten ihr Praktikum in Deutschland<br />
durch. Es wurde kein Praktikum abgebrochen, im Gegenteil, mehrfach wurde die Praktikumsdauer<br />
von ursprünglich vier auf acht Wochen verlängert.<br />
Vor Beginn der Praktika im In- und Ausland wurden gemeinsam mit dem ausbildenden Betrieb<br />
oder der entsprechenden Bildungseinrichtung für die Praktikant/innen die Lernziele des<br />
Praktikums entsprechend der Ausbildungsverordnung des jeweiligen Berufsbildes festgelegt<br />
und eine sachlich-zeitliche Gliederung des Praktikums mit dem jeweiligen Gastbetrieb abgesprochen.<br />
Die Praktika waren als Bestandteil der Ausbildung von den beteiligten Partnern<br />
akzeptiert (Kammern, Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungsbetriebe in Deutschland<br />
und im Ausland).<br />
Alle Praktikant/innen erhielten einen Eintrag in ihrem persönlichen „Europass Berufsbildung“,<br />
einer EU-einheitlichen Bescheinigung strukturierter Ausbildungsabschnitte, in dem die Rahmenbedingungen<br />
für die Bescheinigung dieser „europäischen Berufsabschnitte" geregelt<br />
sind. In diesem Dokument kann der jeweilige Arbeitgeber beziehungsweise die Bildungseinrichtung<br />
Berufsausbildungsabschnitte beziehungsweise Praktika bestätigen, die im Ausland<br />
absolviert wurden. Diese mehrsprachige Bescheinigung (Herkunfts-/Gastlandsprache) beinhaltet<br />
einen genauen Überblick über die Dauer internationaler Erfahrungen, über die Fachinhalte<br />
und über die konkreten Ergebnisse der praktischen Ausbildung. Eine Vereinbarung der<br />
entsendenden und der aufnehmenden Ausbildungseinrichtungen/Unternehmen über den<br />
Ausbildungsinhalt und die Betreuung der Praktikant/innen während des Praktikums durch<br />
eine Ausbildungsperson wurde vorausgesetzt.<br />
Zur Umsetzung der Europass-Aktivitäten im Rahmen des Modellprojekts standen Mitarbeiter/innen<br />
der damaligen Carl-Duisberg-Gesellschaft (heute InWent) beratend zur Seite, was<br />
sich auch nachhaltig positiv auf die Multiplikatorinnenfortbildungen ausgewirkt hat.<br />
Es wurden 53 verschiedene Berufsbilder aus kaufmännischen, handwerklichen und gastgewerblichen<br />
Bereichen sowie aus dem Dienstleistungssektor angesprochen, darunter Chemielaborant/innen,<br />
Prozessleitelektroniker, Mechatroniker, Industrieschlosser, Energieelektroniker,<br />
Teilezurichter, Maurer, Köche und Köchinnen, Büro- und Verwaltungskaufleute, Arzthelfer/innen<br />
und Touristikassistent/innen, Kinderpfleger/innen, Rechtsanwaltsgehilfen, Filmund<br />
Videodreheditor/innen.<br />
127
Die im Projekt definierten Ziele (Förderung von Bildungsmobilität, Europäisierung der Berufsausbildung,<br />
Zugang zum Prozess des lebenslangen Lernens) haben beide Zielgruppen –<br />
Auszubildende und Multiplikator/innen – angenommen. Die frühzeitige Förderung grenzüberschreitender<br />
Mobilität während der beruflichen Erstausbildung hat für beide Gruppen die individuelle<br />
Anpassungsfähigkeit an internationale Anforderungen gesteigert.<br />
Noch zu Projektbeginn, im Frühjahr 2002, belegte eine Untersuchung von Infratest Sozialforschung<br />
München, dass deutlich weniger junge Menschen aus den neuen Bundesländern<br />
Auslandserfahrungen sammeln können als Gleichaltrige aus den alten Ländern. Das Bildungsniveau<br />
der „Auslandserfahrenen“ wurde zusammenfassend so beschrieben: „jede/r<br />
Dritte mit Abitur gegenüber 10 % mit niedrigerem Bildungsniveau“. Vor diesem Hintergrund<br />
betrachtet, hatte und hat das Projekt trans-fer an Bedeutung gewonnen, da es in der Mehrzahl<br />
Teilnehmer/innen, die über einen mittleren Bildungsabschluss verfügten, im Rahmen<br />
einer kaufmännischen oder gewerblich-technischen Ausbildung einen angeleiteten Auslandsaufenthalt<br />
ermöglichte.<br />
Die projektbegleitende Beratung des Ausbildungspersonals hat Grundlagen zur langfristigen<br />
Verankerung von Auslandsaufenthalten in die berufliche Aus- und Weiterbildung geschaffen<br />
sowie Interesse für international orientierte Qualifikationen von Mitarbeiter/innen der Bildungsträger,<br />
Berufsschulen und Unternehmen initiiert.<br />
Mit dem auf die Zielgruppe der Multiplikator/innen zugeschnittenen Seminarangebot wurden<br />
Ausbilder/innen und Berufsschullehrer/innen darin bestärkt, Kontakte zu ausländischen Einrichtungen<br />
aufzunehmen, um zukünftig eigenständig die Vermittlung interkultureller Kompetenz<br />
in ihren Arbeitskontext zu integrieren und selbstständig europaweite Netzwerke zu<br />
knüpfen. Es gab bereits während der Projektlaufzeit mehrere Antragstellungen für Auslandsprojekte<br />
im Rahmen von Comenius - Programmen.<br />
Die Multiplikator/innen wurden befähigt, in ihren Einrichtungen Rahmenbedingungen zu<br />
schaffen und zu etablieren, die es ermöglichen, ausbildungsbegleitend in internationalen Zusammenhängen<br />
zu lernen, zu arbeiten und zu leben. Langfristig sollten Grundlagen mit dem<br />
Ziel erarbeitet werden, Auslandsaufenthalte in die berufliche Aus-und Weiterbildung dauerhaft<br />
zu verankern, um auf die Anforderungen des europäischen Arbeitsmarktes flexibel reagieren<br />
zu können.<br />
Diese kollegiale Zusammenarbeit von Betriebsräten, Jugendvertreter/innen, Personalverantwortlichen<br />
in Unternehmen, Ausbilder/innen und Berufsschullehrer/innen sowie den Projektverantwortlichen<br />
im Land Sachsen-Anhalt mit den Mitarbeiter/innen des QFC hat wesentlich<br />
zum Erfolg des Projekts beigetragen.<br />
128
Das Modellprojekt schuf damit den Rahmen für den Erwerb sozialer und sprachlicher Kompetenzen<br />
ebenso wie für Lernkompetenz allgemein und gab wesentliche Impulse für die Internationalisierung<br />
der Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt. Bei allen Maßnahmen stand das<br />
interkulturelle Lernen bei der Entwicklung und Erweiterung individueller Fähigkeiten im Mittelpunkt<br />
Mit diesem Projekt leistete das QFC, unterstützt von „Arbeit und Leben Sachsen/Anhalt e.V.“<br />
einen Beitrag zum Zusammenwachsen Europas, zur gegenseitigen Durchlässigkeit nationaler<br />
Bildungssysteme und zur Förderung der Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung<br />
in Deutschland.<br />
129
Dr. Jürgen Smettan<br />
Konwips e. V., Dresden<br />
Fachkräftebedarf<br />
und Kooperationsentwicklung<br />
131
Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung.<br />
Im Rahmen unseres Themas möchte ich auf zwei Punkte eingehen: auf den Bedarf der Unternehmen<br />
und die Kooperationen mit Schulen in Sachsen.<br />
Zunächst zum Bedarf der Unternehmen.<br />
Unternehmen brauchen eine passende Anzahl von Mitarbeitern, die die richtige Menge an<br />
Arbeit in der richtigen Qualität am richtigen Ort und in der richtigen Zeit erledigen. Doch dieser<br />
Bedarf schwankt sehr stark. Der Bedarf der Unternehmen hängt stark von der aktuellen<br />
Auftragslage ab. Der Bestand in den Auftragsbüchern schwankt. Und die starken Schwankungen<br />
verlangen eine flexible Anpassung des Mitarbeiterbestandes. Die Unternehmen<br />
müssen atmen, müssen bei steigenden Auftragslagen expandieren können und bei zurückgehender<br />
Auftragslage auch wieder kontrahieren. Unternehmen müssen sich der aktuellen<br />
Wirtschaftslage anpassen können. Dieser Anpassungsdruck wurde in den letzten Jahren<br />
immer stärker, wie auch der Kampf um die Aufträge insgesamt. Sächsische Unternehmen<br />
berichten regelmäßig von fast als tragisch zu bezeichnenden Fällen. Aufträge lagen bereits<br />
vor, aber die für diese speziellen Aufträge erforderlichen Fachkräfte waren im Unternehmen<br />
nicht vorhanden und konnten in der Kürze der Zeit auch nicht akquiriert werden. Die Aufträge<br />
mussten zurückgegeben werden.<br />
Eine Folge des sich verschärfenden Kampfes um die Aufträge und der kurzfristigen Reaktionen<br />
ist, dass die Unternehmen häufig erst dann mit Personalentscheidungen reagieren,<br />
wenn Aufträge vorhanden sind. Der Fachkräftebedarf steigt plötzlich von einem Tag auf den<br />
anderen. Mit der Unterschrift unter einen Vertrag beginnt dann häufig eine unkoordinierte<br />
Suche nach Personal. Um neue Fachkräfte für auftragsspezifische Tätigkeiten zu qualifizieren,<br />
ist nun in der Regel ein größerer Aufwand erforderlich als vorausgesehen wurde und die<br />
Risiken der schnellen Entscheidungen sind oft höher als bei einer langfristigen Personalplanung.<br />
Meist ist die Einstellung von Fachkräften mit einem hohen spezifischen Einarbeitungsaufwand<br />
verbunden. Auch bei Lehrlingen ist der Zeitaufwand beträchtlich und die Zeit, die für<br />
die Einführung von Lehrlingen in einen neuen Betrieb erforderlich ist, kann selten produktiv<br />
genutzt werden. Das Problem verschärft sich vor allem dann, wenn nun unter hektischen<br />
Bedingungen eingestellt wird, wenn keine passgenauen Profile erstellt werden und die Personen<br />
nur in geringem Maße mit den Anforderungen der Stellen und Anforderungen übereinstimmen.<br />
Unternehmen hegen, und das stellt sich in vielen Diskussionen immer wieder auf die gleiche<br />
Weise heraus, Befürchtungen bei der Einstellung von Lehrlingen. Sie haben Angst, in<br />
„den/die Falsche/n“ zu investieren. Aber: Wer ist der „Falsche“? Als Fehlbesetzungen kön-<br />
132
nen Lehrlinge angesehen werden, die keine richtige Motivation für den gewählten Lehrberuf<br />
mitbringen, deren Ziele schwanken oder sehr unklar sind. Die Betriebe möchten nicht in<br />
Lehrlinge investieren, die schon nach kurzer Zeit wieder gehen, ihre Interessen ständig<br />
wechseln oder nicht zuverlässig sind. Viele Unternehmer in den kleinen und mittleren Unternehmen<br />
tragen die Angst mit sich herum, dass im Produktionsprozess Schwierigkeiten auftauchen,<br />
die nicht berechenbar oder planbar sind. Sie befürchten, dass „irgend etwas<br />
kommt“, was nicht im Plan vorgesehen war und im Vorfeld nicht kalkuliert werden konnte.<br />
Dann wird erwartet, dass die neuen Mitarbeiter mitdenken, ihre Aufgaben möglichst schnell<br />
erfassen, flexibel reagieren und eventuelle Probleme und Unwägbarkeiten mittragen.<br />
Gegenwärtig ist festzustellen, dass der Druck auf die mittelständischen Unternehmen, die<br />
von kurzfristigen Schwankungen in der Auftragslage viel stärker betroffen sind als große Betriebe,<br />
extrem zunimmt. Gegenüber den DAX-Unternehmen, die langfristigere Perspektiven<br />
verfolgen, ist es vor allem der Mittelstand, der gerade in Sachsen häufig von heute auf morgen<br />
denkt. Dabei werden gravierende Fehler gemacht.<br />
Fehler geschehen vor allem im Bereich der Bewerberauswahl, weil unter den beschriebenen<br />
hektischen Bedingungen, wenn es schnell gehen muss, häufig intuitiv entschieden wird. Viele<br />
Personalleiter und Geschäftsführer entscheiden spontan nach Sympathie oder Antipathie.<br />
Vor diesem Hintergrund, ohne systematisch analysierte Anforderungsprofile, wählen die Geschäftsführer<br />
oder die zuständigen Entscheidungsträger vielfach nach „Ähnlichkeit“ aus. Das<br />
heißt, es werden Personen eingestellt, bei denen „die Chemie" zu stimmen scheint. Die Unternehmer<br />
wollen negative Erfahrungen vermeiden, die eher im Unbekannten vermutet werden.<br />
Oft bestehen aus Sicht der Betriebe überhaupt keine eindeutigen Vorstellungen zum<br />
erforderlichen Qualifikationsprofil benötigter Fachkräfte. Solche unpräzisen Erwartungen der<br />
Geschäftsführung, ungenaue Zielstellungen wie auch unklare Strukturen bei der Einarbeitung<br />
tragen häufig zu wenig transparenten Entscheidungen bei.<br />
Welche Lösungen können an dieser Stelle helfen?<br />
Sachsen, und hier speziell das Wirtschaftsministerium, hat einen Ideenwettbewerb ins Leben<br />
gerufen. In diesem Ideenwettbewerb waren die sächsischen Betriebe aufgefordert, Projektskizzen<br />
einzureichen aus denen hervorging, wie die anstehenden Probleme bewältigt werden<br />
könnten. Ausgangspunkte waren zum einen die beschriebene Kurzfristigkeit der Auftragslage<br />
in mittelständischen Betrieben aber auch die oft kurzsichtige Denkweise beim Einstellen<br />
und Entlassen von Fachkräften und Mitarbeitern. Angestrebt werden eine langfristige,<br />
strategisch in die Zukunft weisende Vorgehensweise und Lösungsvorschläge, wie die vorhandenen<br />
Ressourcen nachhaltig gesichert werden können. Ich möchte zu den Lösungsansätzen<br />
eine typische Projektskizze herausgreifen: die Projektskizze des Jugendnetzwerkes<br />
Sachsens, das sich mit Berufsorientierung, dem Thema dieser Veranstaltung, befasst.<br />
133
Zusammenarbeit in der Region<br />
Das Jugendnetzwerk Sachsen beschäftigt sich speziell mit der Frage, wie Jugendliche mit<br />
den Betrieben langfristig in Verbindung bleiben können, so dass die kurzfristigen Schwankungen<br />
etwas gedämpft und ausgeglichen werden und die mittelständischen Betriebe sich<br />
im Bedarfsfall schnell mit Fachkräften und Lehrlingen versorgen können und nicht darauf<br />
angewiesen sind, kurzfristig Strategien zu entwickeln, die falsch oder Fehler behaftet sind.<br />
Das Jugendnetzwerk Sachsen will durch die Installation eines zentralen Netzwerkmanagements<br />
Schulen und Unternehmen aus der Region zusammenbringen.<br />
Das Netzwerkmanagement übernimmt die Organisation und Koordinierung der Zusammenführung.<br />
In einer Pilotphase wurde die Zusammenarbeit von acht Schulen mit 80 Schülern im<br />
Technikunterricht begonnen. Es werden Praktika in den Betrieben organisiert und die Schüler<br />
haben die Möglichkeit, in mehreren Betrieben der Region diese Praktika kurzfristig zu<br />
absolvieren. Die Schüler lernen den Betrieb kennen, Betriebe lernen die Schüler kennen.<br />
Dadurch entsteht bereits eine gewisse Vertrautheit. Die Identifikation mit der Aufgabe wächst<br />
und auch der Informationsgrad der Schüler über die in der Region vorhandenen Angebote<br />
steigt. Beteiligt sind mehrere Institutionen der Region: Ämter, Vereine und weitere Netzwerke,<br />
die das Netzwerkmanagement mittragen.<br />
Aber der zentrale Punkt ist, dass es eine verantwortliche Instanz geben muss, die durchgängig<br />
die Koordination gewährleistet. Ohne Koordination bleiben oft nötige Aktivitäten aus, es<br />
bleibt bei den üblichen Appellen an Unternehmen und Schulen, einer verlässt sich auf den<br />
anderen und Initiativen verlaufen im Sande. Wenn aber als Koordinationsstelle zwischen<br />
beiden Partnern, Schulen und Unternehmen, das Netzwerkmanagement agiert, dann wird<br />
dauerhaft Verbindung und Kontakt zwischen den Beteiligten aufrechterhalten. Das ist entscheidend.<br />
Die ersten Schritte sind mittlerweile gemacht. Das Netzwerkmanagement wird vom Freistaat<br />
Sachsen für zwei Jahre gefördert und soll langfristig vom Unternehmensverbund Jugendnetzwerk<br />
Sachsen getragen werden.<br />
Es bestehen in Sachsen auch noch anderweitige Strukturansätze und Ideen, die in ähnlicher<br />
Weise regional oder überregional verankert sind. Aber das hier vorgestellte Netzwerk ist<br />
meines Erachtens ein besonders gutes Beispiel dafür, wie die Kommunikationslücke zwischen<br />
den Betrieben und den Schulen effizient geschlossen werden kann.<br />
Weitere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Ideenwettbewerb Fachkräftenetzwerke<br />
für die sächsische Wirtschaft" entnehmen entnehmen. (Herausgeber: Sächsisches<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden)<br />
Vielen Dank.<br />
134
Prof. Dr. Günter Albrecht<br />
GEBIFO-Berlin Gesellschaft zur Förderung von Bildungsforschung<br />
und Qualifizierung mbH<br />
Das BMBF-Projekt<br />
„Regio-Kompetenz-Ausbildung“<br />
im Kontext von Ausbildung und<br />
135<br />
Regionalentwicklung
Das Land <strong>Brandenburg</strong> ist mit dem IHK-Bildungszentrum Frankfurt (Oder) und weiteren<br />
Partnern aus Wittenberge, Perleberg, Angermünde, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Cottbus<br />
und Lauchhammer an einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)<br />
geförderten Ausbildungsnetzwerk beteiligt.<br />
Das BMBF-Projekt „Regionalberatung zur Sicherung und Weiterentwicklung des Ausbildungsplatzangebotes<br />
in den neuen Ländern“ ist unter den Kürzeln „Regio-Kompetenz-Ausbildung“<br />
oder „Regiokom“ eingeführt. Dieses Ende 1999 gestartete und bis 2005 laufende<br />
Projekt wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und der Gesellschaft zur Förderung<br />
von Bildungsforschung und Qualifizierung mbH (GEBIFO-Berlin) durchgeführt.<br />
Abb. 1: Projektpräsentation in Potsdam<br />
„Regio-Kompetenz-Ausbildung“ ist Bestandteil der Ausbildungsoffensive des BMBF und ge-<br />
hört zu den fünf innovativen Ausbildungsstrukturprojekten. Entsprechend der Zielstellung<br />
„Ausbilden jetzt – Erfolg braucht alle“ orientiert es auf die Generierung zusätzlicher, insbesondere<br />
betrieblicher Ausbildungsplätze, die Gewinnung neuer Ausbildungsbetriebe und die<br />
Wiedergewinnung nicht mehr ausbildender Betriebe.<br />
Ziele des BMBF-Projektes<br />
In vielen Regionen, Arbeitsagentur- und Kammerbezirken der neuen Länder und Berlin haben<br />
Lehrstelleninitiativen, regionale Ausbildungspartnerschaften und betriebliche Ausbil-<br />
136
dungsverbünde zu good-practice Beispielen geführt. Diese Initiativen wirken über den Kreis<br />
der Netzwerkpartner des BMBF-Projektes „Regio-Kompetenz-Ausbildung“ hinaus beziehungsweise<br />
erleichtern die Nutzung/Ausdehnung erfolgreicher Kooperationen auch auf den<br />
Bereich Ausbildung. Die Ziele und Gründe für eine regionale Kooperation sind in Abb. 2 dargestellt.<br />
Am Beispiel des hier dargestellten BMBF-Projektes hat sich gezeigt, wie wichtig für regionale<br />
Initiativen, in Sonderheit für Netzwerke, ein spezifisches Management ist.<br />
Abb. 2: Projektziele<br />
Die aktuelle Bildungsdiskussion wird durch eine Vielzahl von Begrifflichkeiten, wie Globalisierung,<br />
Wissensmanagement, Networking und Netzwerkstrategien, zusätzlich belebt. Natürlich<br />
tangieren moderne Begriffe einen gewissen Hauch von Innovation. Die Vision vom Netzwerk<br />
wird heute vielfach sofort mit einem Erfolgsrezept verbunden. In vielen gesellschaftlichen<br />
Bereichen haben die Begriffe Netz und Netzwerk eine steile Karriere gemacht. Sie werden<br />
sehr unterschiedlich benutzt beziehungsweise gebraucht und sind in ihrer Vision für Erfolgsrezepte<br />
oft noch defizitär.<br />
In diesem Beitrag wird die Begrifflichkeit positiv gesehen und deshalb sind die Begriffe Netzwerke<br />
und Networking keine „Modethemen“. Netzwerke, Netzwerkansätze beziehungsweise<br />
Netzwerkanalysen haben in zahlreichen natur-, wirtschafts- und geisteswissenschaftlichen<br />
Disziplinen bereits ihre Anwendung und Bewährung erfahren. In der Berufsbildung dominieren<br />
Begriffe wie Verbünde, Netzwerke und Kooperationen.<br />
Im Weiteren werden die Betrachtungen auf „Ausbildungsnetzwerke“ konzentriert.<br />
137
In der Projektdefinition sind „Ausbildungsnetzwerke“ lockere, flexible Zusammenschlüsse,<br />
Arrangements von unterschiedlichen individuellen oder organisationalen Akteuren im Interesse<br />
einer regionalen Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung. Die Interaktion der<br />
Akteure, die Netzwerkstrukturen und Netzwerkdimensionen werden immer spezifisch sein<br />
und bedürfen eines gegenseitigen Grundverständnisses und eines Mindestmaßes von allgemein<br />
akzeptierten Vereinbarungen.<br />
Netzwerkaspekte<br />
Im Rahmen des BMBF-Projektes wurde in allen neuen Ländern und Berlin ein faktisch flächendeckendes<br />
„Ausbildungsnetzwerk“ aufgebaut. Für die neuen Länder und Berlin existiert<br />
mittlerweile ein breit gefächertes und stabiles Netz von rund 60 Kooperationspartnern, die in<br />
den Regionen sowie auf lokaler Ebene verankert sind.<br />
Abb. 3: Netzwerkschwerpunkte<br />
138
Sie haben eine Vielzahl von Kooperationsprozessen initiiert, um neue Potentiale für zusätzliche<br />
betriebliche Ausbildungsplätze zu erschließen. Jährlich werden die Netzwerkpartner und<br />
-schwerpunkte überprüft, akzentuiert und aktualisiert.<br />
Die Struktur und Schwerpunkte (einschließlich der bereits erschlossenen Branchenschwerpunkte)<br />
dieses Netzwerkes sind aus der Abb. 3 ersichtlich.<br />
Für die Netzwerkaspekte und das erforderliche Management ergab sich bereits mit dem Projektstart<br />
die günstige Möglichkeit, Good-Practice-Beispiele aus Branchen, Berufsgruppen<br />
beziehungsweise Berufen zu Netzwerken „zu verknüpfen“.<br />
Beispielhaft wurde ein solches Vorgehen beim Aufbau des Netzwerks Mechatronik erprobt.<br />
Diese Projektaufgabe zielt in zwei Richtungen:<br />
Einerseits sollen die Einführung eines neuen Berufes und die gleichzeitige Schaffung zusätzlicher<br />
betrieblicher Ausbildungsplätze begleitet werden.<br />
Andererseits wird durch ein spezifisches Netzwerkmanagement der Projektschwerpunkt<br />
„Sicherung und Stabilisierung bestehender und die Initiierung neuer Netzwerke und Ausbildungsverbünde<br />
zur Gewinnung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze unter besonderer<br />
Berücksichtigung der jeweiligen regionalwirtschaftlichen Strukturen und Gegebenheiten“<br />
umgesetzt. Ausgewählte Instrumentarien zur Unterstützung eines Ergebnis orientierten<br />
Netzwerkmanagements werden erprobt (siehe Abb. 4).<br />
Abb. 4: Instrumentarien der Ausbildungsoffensive<br />
139
Unter Beachtung der vergleichsweise schwierigen und sehr differenzierten wirtschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen in den neuen Ländern ist es mit den Ansätzen und Instrumenten des<br />
BMBF-Projektes „Regio-Kompetenz-Ausbildung“ insbesondere durch<br />
<br />
<br />
die Ausrichtung auf thematische Schwerpunkte,<br />
den regionalisierten Ansatz und<br />
die enge Kooperation mit anderen vom BMBF geförderten Programmen (z.B. Ausbildungsplatzentwickler/innen)<br />
gelungen, positive Entwicklungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt in Gang zu setzen, die<br />
sich seit Jahren auch quantitativ niederschlagen.<br />
Zwar ist es vergleichsweise schwierig, den Abschluss eines einzelnen Ausbildungsvertrages<br />
monokausal auf die Wirksamkeit des Projektes zurückzuführen. Dennoch gibt es Hinweise<br />
darauf, dass der Aufbau von Verbünden und Netzwerkstrukturen einen großen Einfluss auf<br />
die Schaffung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze in den neuen Ländern gehabt hat.<br />
Die Auswertung der BIBB-Statistik über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2004<br />
zeigt, dass – wie schon in den Vorjahren – mit Blick auf einige Ausbildungsberufe die neuen<br />
Länder zum Ende des Ausbildungsjahres 2004 wieder erfreuliche Ergebnisse vorweisen<br />
können. Während der Anteil der neuen Länder über alle neu abgeschlossenen Ausbildungsberufe<br />
hinweg bei rund 22 % liegt, gab es in einzelnen Ausbildungsberufen fast durchweg<br />
eine höhere Ausbildungsbeteiligung der neuen Länder, wie die folgende Übersicht deutlich<br />
macht:<br />
Neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse in ausgewählten Berufen 2004<br />
Sport- und Fitness-<br />
Kaufleute<br />
Kaufleute im<br />
Gesundheitswesen<br />
Veranstaltungs-<br />
Kaufleute<br />
Fachkraft für Kreislauf- und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Fachkraft für<br />
Lebensmitteltechnik<br />
Fachkraft für Schutz<br />
und Sicherheit<br />
Gesamtes<br />
Bundesgebiet<br />
neue<br />
Bundesländer<br />
1.316 369 28,0<br />
839 167 19,9<br />
1.378 327 23,7<br />
187 76 40,6<br />
812 269 33,1<br />
736 226 30,7<br />
Mechatronik 6.366 1.364 21,4<br />
Mikrotechnologie 255 169 66,3<br />
alle Berufe 21,6<br />
prozentualer Anteil der<br />
neuen Bundesländer<br />
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September 2004, eigene Berechnungen<br />
140
Das Positive an diesen Ergebnissen ist, dass in Regionen und Branchen beziehungsweise<br />
Ausbildungsberufen zusätzliche Ausbildungspotentiale zu verzeichnen sind, in denen sich<br />
die Netzwerkpartner von „Regio-Kompetenz-Ausbildung“ in besonderer Weise für die jeweiligen<br />
Ausbildungsberufe engagierten.<br />
Netzwerkmanagement<br />
Ein Schwerpunkt des BMBF-Projektes „Regio-Kompetenz-Ausbildung“ ist die Nutzung der<br />
Management-Kompetenzen bei der Konzeptentwicklung, Vorbereitung, Durchführung und<br />
Dokumentation von BMBF-Events, bundesweiten Fachtagungen, internationalen Expertentreffen,<br />
nationalen und regionalen Workshops sowie „Unternehmerstammtischen“. Während<br />
des Projektverlaufs wird auf aktuelle Entwicklungen schnell reagiert und neue Anforderungen<br />
werden aktiv aufgegriffen. Diese Flexibilität kann auch künftig aufgegriffen und umgesetzt<br />
werden. Der Fundus an Netzwerkpartnerschaften und die „vor Ort Akzeptanz“ bieten eine<br />
gute, ausbaufähige Grundlage für die Umsetzung neuer BMBF-Projekte. Dazu gehören gute<br />
Arbeitskontakte zu den Landesministerien, Agenturen für Arbeit, zuständigen Stellen, Sozialpartnern<br />
sowie regionalen Institutionen und Akteuren (Landräte, Bürgermeister, Unternehmer).<br />
Diese Potenzen sind auszubauen, denn es existiert bereits eine Vielzahl von guten<br />
lokalen beziehungsweise regionalen Konzepten und Netzwerken, die jedoch außerhalb des<br />
jeweiligen Standortes häufig kaum bekannt sind.<br />
Eine Besonderheit für das Netzwerkmanagement und gleichzeitig eine Herausforderung für<br />
die beteiligten Akteure ist die Vision im Projektkonzept mit dem GEBIFO-Copyright „Vernetzung<br />
der Netze“. Die Ziele dieser Vision sind Synergieeffekte „vor Ort“ zwischen unterschiedlichen<br />
BMBF-Projekten im Zusammenwirken mit den regionalen Akteuren in Wachstumsregionen<br />
und auch in Problembereichen. In Übereinstimmung mit der Landesregierung<br />
Mecklenburg-Vorpommern (Wirtschaftsministerium) konnten Modellbeispiele für eine „Vernetzung<br />
der Netze“ vorbereitet und auf einer BMBF-Tagung im Juni 2002 in Rostock vorgestellt<br />
werden. Die Tagungsdokumentation mit CD-ROM liegt vor.<br />
Die inhaltliche Zusammenarbeit konnte von zunächst fünf Partnerschaften:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
dem Programm „Ausbildungsplatzentwickler/innen“,<br />
dem Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“,<br />
dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“,<br />
dem Programm „InnoRegio“ und<br />
den vom BMBF geförderten Wirtschaftsmodellvorhaben<br />
auf weitere Projekte/Programme übertragen werden.<br />
Die inhaltlichen Ansatzpunkte und die Struktur des BMBF-Projektes „Regio-Kompetenz-Ausbildung“<br />
stellen in der Breite und Vielfalt hohe Anforderungen an das Netzwerkmanagement.<br />
141
Das erfordert die gezielte Nutzung der vier „strategischen“ Förderinstrumente: Ausbildungsverbünde,<br />
Ausbildungs-Netzwerke, externes Ausbildungsmanagement und regionale Ausbildungspotenzialanalysen.<br />
Dadurch wird ein spezifischer Beitrag zur perspektivischen Fachkräftesicherung<br />
und Regionalentwicklung an der Nahtstelle zwischen Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-,<br />
Bildungs- und insbesondere der Schulpolitik geleistet.<br />
Die sich abzeichnende demografische Entwicklung in den neuen Ländern erfordert gleichzeitig<br />
und „in Einheit“ Konzeptentwicklung, Netzwerkmanagement und Netzwerkevaluation, Beratung,<br />
Begleitung und Coaching sowie Transfer- und Nachhaltigkeitssicherung für innovative<br />
Modelle der perspektivischen Fachkräftesicherung in ausgewählten Regionen (Problemund<br />
Modellregionen). Die Abb. 5 soll dieses Zusammenwirken, die Netzwerkebenen und<br />
Anforderungen stark vereinfacht darstellen:<br />
Abb. 5: Anforderungen und Netzwerkebenen<br />
In vielen Regionen, Arbeitsagentur- und Kammerbezirken der neuen Länder und Berlin haben<br />
Lehrstelleninitiativen, regionale Ausbildungspartnerschaften und betriebliche Ausbildungsverbünde<br />
zu Good Practice-Beispielen geführt, die auch über den Kreis der Netzwerkpartner<br />
des BMBF-Projektes „Regio-Kompetenz-Ausbildung“ wirken beziehungsweise die<br />
Nutzung/Ausdehnung erfolgreicher Kooperationen auch auf den Bereich Ausbildung erleichtern.<br />
Ausgewählte Ergebnisse sind im „Handbuch zum Coaching von Ausbildungsplatzinitiativen“<br />
veröffentlicht (siehe Abb. 6).<br />
142
Abb. 6: Coaching-Handbuch<br />
Zu diesen Beispielen gehören:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Unterstützung von Maßnahmen zur engeren Verzahnung von Berufsausbildung und Regionalentwicklung;<br />
Beteiligung an der Weiterentwicklung, Verstetigung und regionalen Bündelung der Ausbildungsplatzinitiativen<br />
von Wirtschaftsverbänden, Kammern, Agenturen für Arbeit, Kreisämtern<br />
und Kommunen;<br />
Organisation des Erfahrungsaustausches zum Ausbau innovativer Modelle der Verbundausbildung<br />
mit betrieblichem Ausbildungsvertrag bei Förderung des „Verbundmanagements“;<br />
Einflussnahme auf die bessere Abstimmung und Arbeitsmarktorientierung der Ausbildungsprogramme<br />
und anderer Qualifizierungsmaßnahmen;<br />
Förderung der öffentlichkeitswirksamen Darstellung und der Verallgemeinerung guter<br />
Beispiele (best practice) bei der Gewinnung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze<br />
Nachhaltigkeit und Transfer<br />
Für die Perspektive ist zu beachten, dass in den Regionen unterschiedliche Netzwerke und<br />
Informationsströme bestehen, die bislang kaum miteinander kommunizieren. Die Integration<br />
unterschiedlicher Zuständigkeiten und Förderpolitiken auf regionaler und lokaler Ebene lässt<br />
erhebliche Synergien erwarten, so zum Beispiel auf Gebieten wie Berufsinformation, Ressourcen-Nutzung,<br />
regionaler Potentialentwicklung und Erschließung zukunftsorientierter<br />
Branchen.<br />
143
Aus dieser Sicht werden Nachhaltigkeit, Transfer und Evaluation abschließend in ihrer<br />
Wechselbeziehung kurz skizziert:<br />
Im Projekt konnte die Regionalisierung der Netzwerkarbeit durch Kooperationsvereinbarungen<br />
mit regionalen Stützpunkten in der Fläche stark ausgeweitet werden. Dabei offenbarte<br />
sich eine Informationsfülle an Kooperationsformen und thematischen Schwerpunkten, die<br />
sich einer flächendeckenden Beschreibung entzieht.<br />
Exemplarisch sollten auch künftig solche Beispiele „guter Kooperation“ in regionalen und<br />
überregionalen Veranstaltungen vorgestellt werden, weil eine solche Schrittfolge auch zur<br />
Nachhaltigkeit beiträgt.<br />
Durch „neutrale Moderation“ werden im Zusammenwirken mit den zuständigen Institutionen<br />
und regionalen Akteuren die regional-, sektoral-, branchen- beziehungsweise berufsgruppenspezifischen<br />
Qualifizierungserfordernisse ermittelt und unter dem Aspekt „Vernetzung<br />
der Netze“ der vom BMBF geförderten Projekte Beispiellösungen in der Region entwickelt.<br />
Das erfordert Transfer und das Engagement der Netzwerkpartner vom Tatendrang bis zur<br />
Einhaltung von Regeln (siehe Abb.7).<br />
Abb. 7: Transfer-Komplexität<br />
Für die Nachhaltigkeit von Evaluationsbefunden haben die Rückmeldung, Verbreitung und<br />
Weiterverarbeitung – und damit insgesamt der Transfer – eine zunehmende Bedeutung.<br />
Deshalb wird im Netzwerkmanagement auf eine gute Dissemination (Übermittlung) und Diffusion<br />
(ohne äußere Einwirkung ablaufende Verbreitung) der Evaluationsergebnisse gesetzt.<br />
144
Positive Evaluationsbefunde hinsichtlich der Gewinnung betrieblicher Ausbildungsplätze liefert<br />
nun bereits seit 1999 der Firmenausbildungsring Oberland e.V. aus Neugersdorf. Die<br />
Botschaft lautet schlicht, aber überzeugend – „Besser miteinander erfolgreich, als aufeinander<br />
neidisch“.<br />
Die Maxime der Unternehmen aus Sachsen ist verallgemeinerungswürdig. Der Transfer wird<br />
gesichert; und auch Beispiele für Modelle zur grenzüberschreitenden Ausbildungskooperation<br />
mit Polen und Tschechien werden begleitet und ein eigenständiges Teilnetzwerk „Chance<br />
Grenzregion“ ist im Projekt entstanden.<br />
Die Qualifizierung von polnischen „Multiplikatoren für Mechatronik“ wird von GEBIFO-Berlin<br />
und dem QCW Eisenhüttenstadt in Kooperation mit dem polnischen Ministerium für nationale<br />
Bildung und Sport erfolgreich fortgesetzt und Synergieeffekte zum „Transnationalen Netzwerk<br />
E2-VET“ mit der IHK Frankfurt/Oder werden ergebnisorientiert genutzt. Die Breite und<br />
Vielfalt des internationalen Transfers kann nur angedeutet werden (siehe Abb. 8).<br />
Abb. 8: Transfer-Impressionen<br />
145
Das Konzept des hier vorgestellten BMBF-Projektes „Regio-Kompetenz-Ausbildung“ sichert<br />
ein spezifisches Wissensmanagement, eine formative Selbstevaluation und ergebnisorientierte<br />
nationale und internationale Transfermaßnahmen.<br />
Dazu gehören die Erarbeitung (Autorenschaft) und Herstellung von Projektinfos, Handlungsanleitungen,<br />
Sonderdrucken, Beiträgen des Info-Dienstes „Kompetenz“ und Publikation von<br />
Büchern und Broschüren im Bertelsmann Verlag sowie weitere Projektdarstellungen, zur Zeit<br />
unter www.regiokom.de.<br />
Als bewährte Instrumente, Formen und Methoden zur Sicherung und Verbreitung der Ergebnisse<br />
haben sich außerdem<br />
<br />
<br />
<br />
regionale „Unternehmerstammtische“,<br />
Workshops und Expertentreffen (branchen- beziehungsweise berufsgruppenorientiert),<br />
regionale Netzwerkberatungen,<br />
nationale und internationale Fachkonferenzen<br />
erwiesen.<br />
146
Dr. Karsten Schuldt<br />
PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung <strong>GmbH</strong>, Teltow<br />
Betriebliche Erstausbildung –<br />
Status quo, Trends, Rahmenbedingungen<br />
und Handlungsperspektiven<br />
147
1. Betriebliche Erstausbildung in <strong>Brandenburg</strong> – status quo und Trends<br />
Wie die folgende Übersicht zeigt, ist der Anteil der ausbildenden Betriebe an allen Betrieben<br />
im Land <strong>Brandenburg</strong> seit vielen Jahren außerordentlich stabil – und liegt bei etwa einem<br />
Viertel. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur circa die Hälfte aller Betriebe über eine Ausbildungsberechtigung<br />
verfügt. Alle bisherigen Bemühungen, den Anteil der ausbildenden<br />
Betriebe substanziell zu erhöhen, haben bislang nicht zu diesem Ziel geführt.<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
in % aller Betriebe<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Abbildung 1 Anteil der ausbildenden Betriebe im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
IAB-Betriebspanel<br />
Im Unterschied zu dieser vergleichsweise stabilen Ausbildungsbeteiligung der Betriebe ist<br />
die Zahl der betrieblichen Auszubildenden kontinuierlich zurück gegangen. Gegenwärtig befinden<br />
sich somit gut 30.000 Jugendliche in einer betrieblichen Ausbildung – dies sind etwa<br />
drei Viertel aller Auszubildenden im Land <strong>Brandenburg</strong>.<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
am Ende des Jahres (31.12.)<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
BA, BIBB, LDS<br />
Abbildung 2 : Anzahl der betrieblichen Auszubildenden im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
148
2. Rahmenbedingungen betrieblicher Erstausbildung<br />
Hintergrund dieser Entwicklung der betrieblichen Auszubildendenzahl sind das jeweilige Gewicht<br />
von diesbezüglich förderlichen Faktoren einerseits:<br />
langfristiger Trend zur Höherqualifizierung;<br />
demographische Entwicklung – Wettbewerb um knapper werdende Nachwuchskräfte;<br />
und hemmenden Faktoren andererseits:<br />
gesamtwirtschaftliche Wachstums- und Beschäftigungsschwäche;<br />
Trend zu unstandardisierten Beschäftigungsverhältnissen und Selbständigkeit;<br />
nachlassende Ausbildungsbefähigung der Schulabgänger/-innen.<br />
Offenbar überwiegen, zumindest im Land <strong>Brandenburg</strong>, die hemmenden Einflussfaktoren.<br />
Vor allem die nunmehr seit Ende der 90er Jahre anhaltende Wachstums- und Beschäftigungsschwäche<br />
dürfte sich diesbezüglich negativ auswirken.<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
Wachstum des realen BIP (in %)<br />
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Abbildung 3: Wirtschaftswachstum im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
149<br />
LDS
950.000<br />
900.000<br />
850.000<br />
800.000<br />
750.000<br />
700.000<br />
650.000<br />
600.000<br />
am Arbeitsort per 30.6.<br />
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Abbildung 4: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
0<br />
Erwerbstätige (im Jahresdurchschnitt)<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Abbildung 5: Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen im Land <strong>Brandenburg</strong><br />
3. Handlungsperspektiven betrieblicher Erstausbildung<br />
Anknüpfend an die wesentlichen Ursachen der schwachen betrieblichen Ausbildungsperformance<br />
im Land müssen zunächst einige grundsätzliche Handlungsempfehlungen gegeben<br />
werden.<br />
Dazu zählen insbesondere:<br />
die Unterstützung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum durch eine konsistente<br />
Finanz-, Steuer-, Struktur- und Regionalpolitik;<br />
die Verbesserung in den der Berufsbildungspolitik vor gelagerten (Bildungs-) Bereichen,<br />
wie etwa<br />
150<br />
LDS<br />
BA
- Bildungsqualität an den allgemeinbildenden Schulen;<br />
- Arbeitswelt- und Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen;<br />
- Berufsorientierung durch die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit, der<br />
Arbeitsgemeinschaften aus Arbeitsagenturen und Kommunen sowie der Optionskommunen<br />
und<br />
die Entwicklung eines konsistenten Förderkonzeptes zugunsten situationsadäquater betrieblicher,<br />
betriebsnaher und kooperativer Modelle der beruflichen Erstausbildung.<br />
Bezogen auf die Konturierung eines neuen INNOPUNKT-Wettbewerbs mit dem Ziel der<br />
Erhöhung der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung können nunmehr folgende Orientierungen<br />
gegeben werden:<br />
Abkehr von Träger fokussierten Modellen bei der Umsetzung des Wettbewerbs;<br />
Orientierung auf zwei, maximal drei regional konzentrierte Vorhaben;<br />
Ausrichtung der geförderten Vorhaben auf das Zusammenspiel unterschiedlicher landespolitischer<br />
( Verbundausbildung, betriebsnahe Ausbildung, Kooperatives Modell<br />
usw.), bundespolitischer (BvB, EQJ usw.) sowie – sofern vorhanden – kommunalpolitischer<br />
Förderansätze;<br />
Optimierung der Lernortkooperation Betrieb-Schule- Bildungsdienstleister;<br />
Ziel der Vorhaben sollte die relevante Steigerung der regionalen Ausbildungsplatzzahl<br />
und die Erhöhung der Ausbildungszeiten im Betrieb sein.<br />
151
Reiner Heinze<br />
TÜV Akademie <strong>GmbH</strong>, Cottbus<br />
Voraussetzungen schaffen für mehr<br />
Ausbildungsangebote und Ausbildungsqualität –<br />
Stärkung und Ausweitung der betrieblichen Praxis<br />
153
1. Unser Leistungsspektrum :<br />
Erstausbildung im Verbund:<br />
• Überbetriebliche Ausbildung von jungen Leuten<br />
In kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen<br />
Modulsystem mit Zusatzqualifikation<br />
Berufe in der Erstausbildung<br />
Kaufmännische Berufe<br />
Metall / CNC<br />
Kraftfahrzeugmechatroniker<br />
Elektronik / Elektrotechnik<br />
Lager und Logistik<br />
Verkehr<br />
Baugeräteführer<br />
Baustoffproduktion<br />
Umwelt<br />
Informations-/ Telekommunikationstechnik<br />
Kunststoffe<br />
2. Der Ausbildungsverbund Südbrandenburg<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Entwicklung der Teilnehmerzahlen – gesamt<br />
140<br />
275<br />
140<br />
295<br />
138<br />
285<br />
144<br />
300<br />
148<br />
345<br />
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05<br />
Unternehmen Teilnehmer<br />
154
Zusammensetzung Verbund 04/05 – Einteilung nach Berufsfeldern<br />
Elektron.<br />
3%<br />
Kfm.<br />
8%<br />
3. Kernprobleme:<br />
Kunststoff/<br />
Chemie<br />
19%<br />
Mechatroniker<br />
12%<br />
Sonstige<br />
2%<br />
IT<br />
6%<br />
BKF<br />
5%<br />
Metallberufe<br />
34%<br />
BGF<br />
6%<br />
Fehlende Kontinuität in der Ausbildungsakquisition und in der<br />
Unternehmensbetreuung durch Wegfall der Personalförderung<br />
- SGB III – Paragraph 10<br />
VM/AM<br />
5%<br />
Divergenz von Ausbildungsanforderungen der Unternehmen im Verhältnis zum<br />
Qualitätspotenzial der Schulabgänger<br />
- Zunahme von Ausbildungsabbrüchen<br />
Zunahme der Nichtbesetzung von betrieblichen Ausbildungsplätzen<br />
- ungenügende Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern<br />
- fehlende Kenntnisse über Profil des jeweiligen Ausbildungsberufes<br />
4. Lösungsmöglichkeiten:<br />
4.1. INNOPUNKT 11 – Vollstart statt Fehlstart<br />
gibt Starthilfe ins Berufsleben für Jugendliche mit ungünstigen beziehungsweise<br />
problematischen Voraussetzungen<br />
ist ein Projekt der TÜV Akademie – angelegt bis 2006<br />
beinhaltet „Bildung auf Rädern“ – Erprobungswerkstätten vor Ort<br />
155
- gibt Hilfe bei der Berufsfindung und Ausbildungsplatzsuche durch<br />
Beratungsgespräche<br />
Eignungstests<br />
Bewerbungstrainings<br />
Praktika<br />
- ermöglicht mehr Ausbildungserfolg in den Unternehmen durch<br />
Sorgfältige Eignungsfeststellung<br />
Professionelle pädagogische Begleitung<br />
Günstige Qualifizierungsangebote<br />
4.2. Schüleragentur – Agentur zur beruflichen Frühorientierung –<br />
von Schülern für Schüler<br />
Schüler aus Real-, Gesamt-, Förderschule und Gymnasium leiten selbständig<br />
eine Agentur, die wie eine Firma aufgebaut ist<br />
Ziele:<br />
Besetzung aller Ausbildungsstellen<br />
Prävention bei Ausbildungsabbruch<br />
Perspektiven für leistungsbereite Jugendliche<br />
Zusammenführung Schule-Wirtschaft<br />
Angebote:<br />
Orientierungswochen<br />
Praxistage<br />
Neigungsfeststellung, Bewerbungstraining<br />
Berufswahlpass<br />
4.3. Personenkonkrete Zusatzqualifikation als integraler Bestandteil der<br />
Berufserstausbildung<br />
Ziel: Allrounder mit universeller und flexibler Einsetzbarkeit<br />
Sicherung der Nachhaltigkeit der Berufsausbildung<br />
Erhöhung der Übernahmechancen nach der Ausbildung<br />
Zusatzqualifikationsangebote (Auswahl):<br />
Bedienberechtigung für Gabelstapler; Radlader/Bagger; Auto- und Mobilkran;<br />
Brückenportal- und Turmdrehkran<br />
TÜV-Prüfungen: MAG-Schweißen; WIG-Schweißen (DIN EN 287-1o.2)<br />
Programmierung/Zerspanung mit CNC-Technik; Vorrichten nach Isometrie<br />
Verarbeitung von thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen in der<br />
Metalltechnik<br />
156
4.4. Zusätzliche Aktivitäten der Unternehmen:<br />
Erhöhung der Ausbildungsquote,<br />
auch Ausbildung über Bedarf<br />
Bereitstellung von Schüler-Praktikumsplätzen<br />
Durchführung von Informationstagen („Tag der offenen Tür“)<br />
Positive Beispiele:<br />
Fränkische Rohrwerke, Schwarzheide<br />
BASF, Schwarzheide<br />
Impuls Verschleißtechnik, Senftenberg<br />
Drahtwerk u. Stahlhandel, Finsterwalde<br />
Negativ:<br />
Ca. 75 % der Unternehmen im Kammerbezirk Cottbus bilden nicht aus.<br />
Deshalb: Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Verbundrichtlinie zur Stärkung<br />
der Ausbildungsbereitschaft!<br />
5. Offene Probleme:<br />
Schwierigkeiten bei Zusammenarbeit und Vernetzung von Netzwerken<br />
Fehlende Synergieeffekte<br />
Geographische Hindernisse bei der Berufsausbildung durch Landespolitik<br />
Unterschiedliche Verbundrichtlinien in <strong>Brandenburg</strong> und Sachsen<br />
(Unternehmen in <strong>Brandenburg</strong> – Auszubildender aus Sachsen)<br />
Budgetbeschränkungen von Fördermittelgebern<br />
Bewährte innovative Ausbildungsprojekte (18 + 18) bleiben ein Einzelfall<br />
Harmonisierung der Berufsausbildung in der Europäischen Union<br />
Abflachung von hochwertigen Qualitätsstandards in der Berufsausbildung in<br />
Deutschland<br />
Zuständigkeitsdivergenz in der beruflichen Bildung<br />
157
Dr. Fritz Wegner<br />
Ausbildungsring Potsdam <strong>Brandenburg</strong> e. V., Potsdam<br />
Betriebsnahe Ausbildung in <strong>Brandenburg</strong>:<br />
zusätzliche Ausbildungsplätze durch<br />
geförderte Ausbildung im dualen System<br />
159
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Zu wenig Ausbildungsplätze! heißt es regelmäßig in den Schlagzeilen der Medien.<br />
Dennoch gibt es eine ganze Reihe von freien Ausbildungsplätzen, die noch erschlossen<br />
werden können.<br />
Motivierte und qualifizierte Arbeitskräfte sind für die meisten Unternehmen Erfolgsfaktor<br />
Nummer eins. Es ist eine lohnende Investition, die zukünftigen Mitarbeiter selbst auszubilden.<br />
Die Ausbildung ist ein aktives Instrument der Unternehmensentwicklung. Die circa 360<br />
Berufsbilder mit vielen Ausgestaltungsmöglichkeiten bieten für jedes Unternehmen die passenden<br />
Ansatzpunkte. In Zukunft werden Aus- und Weiterbildung im eigenen Unternehmen<br />
noch wichtiger, denn der Fachkräftemangel gefährdet schon heute die Leistungsfähigkeit<br />
vieler Betriebe. Nicht jedes Unternehmen hat die Bedeutung dieser Problematik für sich bereits<br />
erkannt.<br />
Die Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen des Landes <strong>Brandenburg</strong> zu<br />
thematisieren erfordert, den Begriff „Ausbildungsbereitschaft“ selbst zu betrachten.<br />
Die Ausbildungsbereitschaft eines Unternehmens wird durch zwei Seiten gekennzeichnet:<br />
die Ausbildungsfähigkeit und die Ausbildungswilligkeit des Unternehmens beziehungsweise<br />
der Entscheidungsträger im Unternehmen.<br />
Dabei stellt die Ausbildungsfähigkeit die eher objektiv bedingte Seite der Ausbildungsbereitschaft<br />
dar. Zu ihr gehören:<br />
materielle Bedingungen<br />
- der Ausbildungsplatz selbst<br />
- das für die Ausbildung notwendige Material, die Energie,<br />
- die betriebliche Auftragslage<br />
personelle Bedingungen der Ausbilder<br />
finanzielle Bedingungen (tatsächliche Finanzlage des Unternehmens).<br />
Die Ausbildungswilligkeit als subjektive Seite der Ausbildungsbereitschaft ist wesentlich bedingt<br />
durch die Erfahrungen der Entscheidungsträger im Unternehmen mit Auszubildenden<br />
beziehungsweise mit der grundsätzlichen Einstellung des Unternehmers oder seiner Mitarbeiter<br />
zur Ausbildung.<br />
Sind beide Seiten der Ausbildungsbereitschaft positiv vorhanden, wird es, stehen entsprechende<br />
Bewerber zur Verfügung, zu einer betrieblichen Ausbildung kommen.<br />
Ist die Ausbildungsfähigkeit gegeben, die Ausbildungswilligkeit aus unterschiedlichen Gründen<br />
nicht vorhanden, eröffnet sich hier ein Feld für die aktive Beratung mit den Entschei-<br />
160
dungsträgern des Unternehmens. Vorrangig sind die Ausbildungsberater der jeweils zuständigen<br />
Stelle gefordert, nicht zu vergessen jedoch die differenzierten Aktivitäten der unterschiedlichen<br />
Seiten der sich für die Berufsausbildung engagierenden Kräfte.<br />
In einer Vielzahl von Unternehmen des Landes <strong>Brandenburg</strong> ist jedoch vorrangig zu verzeichnen,<br />
dass die finanziellen Bedingungen im Unternehmen eine seriöse vertragliche Verpflichtung<br />
zur Ausbildung einer größeren Anzahl Jugendlicher über einen Zeitraum von drei<br />
oder mehr Jahren nicht zulassen. In vielen Fällen kann nur ein Teil der potenziell vorhandenen<br />
Ausbildungsplätze durch betriebliche Auszubildende besetzt werden.<br />
Überlagert sich diese Situation mit der seit Jahren in <strong>Brandenburg</strong> zu verzeichnenden Unterversorgung<br />
der Schulabgänger mit betrieblichen Ausbildungsplätzen, zeichnet sich hier eine<br />
Möglichkeit zur Lösung des Problems ab.<br />
Unter Nutzung der potenziell vorhandenen Ausbildungsplätze und der Ausbildungswilligkeit<br />
der Unternehmer ist man in der Lage, eine Vielzahl zusätzlicher Ausbildungsplätze zu schaffen,<br />
wenn man die notwendigen finanziellen Mittel auf eine geeignete Art und Weise zuführt.<br />
Seit 1996 wird im Land <strong>Brandenburg</strong> auf der Grundlage dieses Ansatzes die so genannte<br />
„Betriebsnahe Ausbildung“ realisiert, durch die seitdem jährlich mehr als 2.400 zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze geschaffen wurden.<br />
Realisiert wird die betriebsnahe Ausbildung durch die Ausbildungsvereine der Industrie- und<br />
Handelskammern und Handwerkskammern des Landes <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Die Ausbildungsvereine<br />
erfassen die von den Unternehmen zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze;<br />
lassen diese durch die zuständigen Stellen prüfen (Qualität der Ausbildung, Zahl der<br />
betrieblichen Auszubildenden);<br />
überreichen die Liste mit den zusätzlichen Ausbildungsplätzen der Agentur für Arbeit,<br />
den Argen oder den optierenden Kommunen und lassen auf diese Ausbildungsplätze<br />
Bewerber vermitteln;<br />
erfassen die vermittelten Bewerber und veranlassen die Vorstellung der Bewerber in<br />
den Unternehmen vor Ort. Dort entscheiden die Ausbilder, ob der Bewerber für die<br />
Ausbildung geeignet ist und in das Team passt. Bei positiver Entscheidung meldet<br />
sich der Bewerber beim Ausbildungsverein zurück.<br />
Der Ausbildungsverein schließt mit dem Bewerber und gegebenenfalls mit seinen Eltern<br />
einen normalen Berufsausbildungsvertrag ab.<br />
Die Ausbildung beginnt mit dem vereinbarten Termin in dem Unternehmen vor Ort.<br />
161
Das Unternehmen stellt den notwendigen Ausbildungsplatz inclusive der für die Ausbildung<br />
erforderlichen Materialen und Werkstoffe, Ausrüstungen, der durch den Ausbildungsplatz<br />
bedingten spezifischen Arbeitsschutzbekleidung, die erforderliche Energie und so weiter zur<br />
Verfügung. Es finanziert den Personalkostenaufwand, den es anteilig für die Ausbildung des<br />
Auszubildenden des Ausbildungsvereins hat.<br />
Damit trägt das Unternehmen einen großen Teil der Kosten der Ausbildung.<br />
Der Ausbildungsverein finanziert<br />
die Ausbildungsvergütung,<br />
die Beiträge zur Sozialversicherung zu 100%,<br />
die Prüfungsgebühren und<br />
die Kosten der überbetrieblichen Lehrunterweisungen (ÜLU).<br />
Diese Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds des<br />
Landes <strong>Brandenburg</strong> und wird möglich durch Sonderprogramme des Landes <strong>Brandenburg</strong>,<br />
die durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie ausgearbeitet werden.<br />
Im Einstellungsjahr 2005 stehen für jeden Jugendlichen für die gesamte Dauer einer 36monatigen<br />
Ausbildung im Rahmen einer vollzeitig geförderten Maßnahme circa 13.150 € zur<br />
Verfügung.<br />
Die betriebsnahe Ausbildung<br />
unterscheidet sich nicht von einer „normalen“ betrieblichen Ausbildung, nur befindet sich<br />
beispielsweise beim Ausbildungsring Potsdam-<strong>Brandenburg</strong> e.V. die Personalabteilung des<br />
Ausbildungsbetriebes „Ausbildungsring“ in Potsdam oder der Außenstelle in Neuruppin und<br />
der Ausbildungsplatz befindet sich in einem von etwa 1200 Unternehmen im Kammerbezirk<br />
Potsdam. Das Argument, dass die Partnerfirmen der Ausbildungsvereine sich durch die Realisierung<br />
geförderter Ausbildung von der betrieblichen Ausbildung zurückziehen beziehungsweise<br />
nur die minimale Zahl betrieblicher Ausbildungsplätze finanzieren, die als Zugangsvoraussetzung<br />
für geförderte Auszubildende vorgesehen ist, hat sich bisher nicht bestätigt.<br />
Als Zugangsvoraussetzung gelten:<br />
Erfahrungen in der Erstausbildung (erstmals ausbildende Unternehmen können keine<br />
geförderten Auszubildenden erhalten),<br />
in folgenden Relationen müssen mindestens betriebliche Auszubildende vorhanden<br />
sein (Zusätzlichkeitskriterien) :<br />
- bis 10 Mitarbeiter : mindestens 1 betrieblicher AZUBI<br />
- 10 - 50 Mitarbeiter : mindestens 8% betriebliche. AZUBI<br />
- über 50 Mitarbeiter : mindestens. 6% betriebliche AZUBI<br />
162
Weiterhin gilt:<br />
Die Zahl der Auszubildenden (betrieblich und gefördert) darf die Zahl der<br />
Fachkräfte nicht übersteigen;<br />
Die Zahl der geförderten Auszubildenden darf die Zahl der betrieblichen<br />
nicht übersteigen.<br />
Die tatsächliche Ausbildungsquote sieht folgendermaßen aus:<br />
Ausbildungsquote der IHK-Unternehmen - Partnerfirmen des<br />
Ausbildungsringes Potsdam-<strong>Brandenburg</strong> e.V.<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
43%<br />
26%<br />
1
Wolf-Dietrich Greinert<br />
Technische Universität Berlin<br />
Vollschulische Angebote<br />
in der Berufsausbildung nach<br />
dem neuen Berufsbildungsreformgesetz<br />
165
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
die Berufsbildungspolitik in <strong>Brandenburg</strong> wird sich künftig zwischen den bislang gewachsenen<br />
Beständen und dem am 1. April dieses Jahres in Kraft getretenen Berufsbildungsreformgesetz<br />
bewegen. Zu den Beständen gehört vor allem das seit 1997 als öffentlich<br />
finanziertes Programm durchgeführte „Kooperative Modell“, eine brandenburgische<br />
Spezialität, über deren Struktur und Erfolg der folgende Referent berichten wird. Mir obliegt<br />
es, den rechtlichen Rahmen darzustellen, in dem sich derartige berufspädagogische Unternehmungen<br />
künftig bewegen müssen. Bevor ich das versuche, möchte ich zur Unterstützung<br />
des Verständnisses des eigentlichen Grundproblems ein gedrängtes Szenario der „Krisensituation“<br />
des Berufsbildungswesens der Bundesrepublik entwerfen.<br />
1. Die so genannte „Krise“ des Dualen Systems, die sowohl Politik wie Öffentlichkeit seit<br />
einigen Jahren beschäftigt, wird in erster Linie als Mangel an betrieblichen Ausbildungsplätzen<br />
wahrgenommen beziehungsweise als kontinuierlicher Abbau betrieblicher Ausbildungskapazität.<br />
Aktuell bilden gerade noch 23 Prozent der Betriebe in der Bundesrepublik<br />
aus. Die eigentliche Ursache für diesen Rückzug bilden weniger konjunkturelle als globale<br />
ökonomische Entwicklungstrends, die seit den 90er Jahren eine deutliche Zuspitzung erfahren<br />
haben. Es handelt sich dabei hauptsächlich um den Wandel von Managementstrukturen<br />
und betrieblicher Arbeitsgestaltung unter den Zwängen globaler Konkurrenz, um den Übergang<br />
von einer Produktions- zu einer Dienstleistungsökonomie und um den Strukturwandel<br />
von Produktion, Dienstleistung und Verwaltung durch das Vordringen der neuen Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien (vgl. Baethge 2003).<br />
2. Der Rückgang an betrieblichen Ausbildungsplätzen hat gravierende Folgen für die Mehrzahl<br />
der Schulabgänger, die sich traditionellerweise um eine Ausbildung im Dualen System<br />
bewerben. Als zentrale Fehlfunktion kann ein scharfer Verdrängungswettbewerb bei der Besetzung<br />
von Ausbildungsstellen festgestellt werden, bei dem die Ausbildungsstellen je nach<br />
Qualität und Arbeitsmarktchancen der Rangordnung allgemeiner Schulabschlüsse entsprechend<br />
zur Verteilung kommen. Ein erheblicher Teil der Bewerber mit niedrig eingestuften<br />
Schulabschlüssen wird dabei in so genannten „Warteschleifen“ – das heißt, Maßnahmen der<br />
Länder und der Agentur für Arbeit zur „Berufsvorbereitung“ – abgedrängt und blockiert als<br />
„Altbewerber“ aus früheren Entlassjahren (aktuell über 400.000) hohe Anteile der Ausbildungskapazität.<br />
3. Dieser fatale Mechanismus schiebt Ausbildungsbeginn und Berufseintritt immer weiter<br />
hinaus. Das durchschnittliche Eintrittsalter in die duale Berufsausbildung beträgt inzwischen<br />
166
19,3 Jahre. 59 Prozent aller Ausbildungsverträge wurden 2002 mit jungen Erwachsenen abgeschlossen,<br />
die vorher bereits andere Ausbildungsgänge in der Sekundarstufe II durchlaufen<br />
hatten. Im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten – z.B. Österreich – beginnt die Berufsausbildung<br />
in der Bundesrepublik im Schnitt drei Jahre zu spät; nach OECD-Standard<br />
(ISCO) eigentlich als postsekundäre Erziehung, die normalerweise zur Weiterbildung zählt<br />
(Berechnungen nach Berufsbildungsbericht 2003 von Friedemann Stooß). Diese offensichtliche<br />
Fehlsteuerung hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Sozialkassen, sie verschleiert<br />
auch den wahren Umfang der Jugendarbeitslosigkeit, die sich bekanntlich im Kontext dualer<br />
Ausbildungssysteme im internationalen Vergleich stets als besonders niedrig erweist.<br />
Unter Berücksichtigung der skizzierten „Verspätung“ ist sie in Wirklichkeit doppelt so hoch<br />
wie dies die offiziellen Zahlen glauben machen wollen.<br />
4. Die Bilanz der Ausbildungsanfänger im beruflichen Bereich stellte sich im Jahre 2002 folgendermaßen<br />
dar:<br />
Duales System<br />
1. Betriebliche Ausbildungsverträge 515.000<br />
2. Außerbetriebliche Ausbildungsverträge 57.000<br />
Summe 572.000<br />
Vollschulische Ausbildungsgänge<br />
1. Berufsfachschule in Berufen nach BBiG/HWO 12.000<br />
2. Berufsfachschule vollqualifizierend außerhalb BBiG/HWO 101.000<br />
3. Schüler/innen in Schulen des Gesundheitswesens (1.Lj.) 45.000<br />
4. Berufsfachschule (1.LJ.) und Berufsgrundbildungsjahr 161.000<br />
5. Berufsvorbereitungsjahr an beruflichen Schulen 79.000<br />
6. Berufsvorbereitende Maßnahmen der BA 124.000<br />
7. Schüler/innen in der Fachoberschule 51.000<br />
Summe 573.000<br />
Diese Zahlen zeigen, welche Marktstellung schulische Berufsausbildung in der Bundesrepublik<br />
bereits eingenommen hat. Das Problem ist indes, dass die schulische Berufsausbildung<br />
in der öffentlichen Meinung gegenüber der Ausbildung im Dualen System deutlich abgewertet<br />
und von den Arbeitgeberverbänden sowie von den Gewerkschaften aus interessenpolitischen<br />
Gründen ganz offen diskriminiert wird.<br />
5. Entsprechend verlagert hat sich auch die Finanzierung der beruflichen Erstausbildung.<br />
Für diesen Bereich musste die öffentliche Hand (Bund, Länder und BA) im Jahre 2003 bereits<br />
12,3 Mrd. Euro aufwenden, womit sie den Finanzierungsanteil der privaten Betriebe fast<br />
167
erreicht hat. Diese Verschiebung hat indes nicht eine Vermehrung der Mitbestimmungsrechte,<br />
beispielsweise der Länder, in der beruflichen Bildung zur Folge gehabt. Vor allem verfügen<br />
diese bislang über keinen Einfluß auf ein zentrales Element des Dualen Systems, nämlich<br />
die Entwicklung neuer und die Modernisierung bestehender Ausbildungsberufe, müssen<br />
sich jedoch in den Berufsschulen mit deren ausbildungspolitischen Folgen auseinandersetzen.<br />
6. Dieser zweite Lernort des Dualen Systems sieht seine Arbeit nicht nur durch eine permanente<br />
Unterfinanzierung beeinträchtigt, sein konkreter Ausbildungsbeitrag zum erfolgreichen<br />
Lernen im Dualen System wird vom Gesetzgeber bislang mit beispielloser Mißachtung beantwortet.<br />
Die Zeugnisse der Berufsschule finden bei den Berufsabschlußprüfungen der<br />
Kammern aus vorgeschobenen verfassungsrechtlichen Gründen keine Beachtung. Aus gleichen<br />
Gründen wird eine gesetzliche Verpflichtung von Betrieben und Berufsschulen zur Koordinierung<br />
ihrer Ausbildung unter der Perspektive eines beruflichen Gesamtcurriculums<br />
verweigert, was den von den Bewunderern dualer Ausbildung stets hoch gelobten „Lernortverbund“,<br />
die didaktische Integration von Theorie und Praxis, als schlichte Fiktion entlarvt.<br />
7. Die rechtliche Zuordnung der beruflichen Bildung einerseits zur „Wirtschaft“, andererseits<br />
zur „Bildung“ hat in Deutschland nicht nur den traditionellen Graben zwischen „Berufsbildung“<br />
und „Allgemeinbildung“ zementiert (vgl. Greinert 2003), sie beeinträchtigt heute massiv<br />
den Anschluß der Bundesrepublik an die Entwicklung eines wissensbasierten dynamischen<br />
Wirtschaftsraums, wie ihn die europäischen Gremien seit der Erklärung von Lissabon<br />
anstreben. Die fehlende Anschlußfähigkeit des „deutschen Systems“ an die weitgehend<br />
unregulierten oder schulisch organisierten Berufsausbildungssysteme der übrigen europäischen<br />
Staaten ergibt sich unmittelbar aus seiner grundlegenden, international einmaligen<br />
Verfassung, deren Kern seine korporatistische und föderalistisch organisierte Steuerung ist.<br />
8. Den Beleg für diese Einschätzung bilden einige nüchterne Zahlen, die das Zurückliegen<br />
des deutschen Bildungssystems im Bemühen um die Schaffung einer „Wissensgesellschaft“<br />
zeigen: die Studienanfängerquote liegt in der Bundesrepublik lediglich bei 36 Prozent einer<br />
Jahrgangskohorte, während sie Im OECD-Mittel 51 Prozent beträgt. Die deutsche Studienerfolgsquote<br />
dümpelt bei mageren 19 Prozent; der Durchschnitt in den OECD-Staaten beläuft<br />
sich dagegen auf 32 Prozent. Die Abiturientenquote in der Bundesrepublik stagniert seit Jahren;<br />
sie betrug 1994 34,5 Prozent, im Jahre 2003 38,9 Prozent eines Schulentlassjahrgangs.<br />
Eine wesentliche Ursache für diesen geringen Zuwachs und das deutliche Zurückliegen<br />
im internationalen Vergleich ist die Abschottung des beruflichen Bildungssektors vom<br />
allgemeinbildenden, insbesondere vom Bereich der „höheren“ Bildung in Gymnasien und<br />
168
Hochschulen. Ohne Ausschöpfung der Begabungsreserven in den beruflichen Bildungseinrichtungen,<br />
das zeigt die Situation in unseren Nachbarstaaten Frankreich, Österreich und der<br />
Schweiz, wird in der Bundesrepublik keine weitere Bildungsexpansion mehr stattfinden.<br />
In Erwartung der noch für die laufende Legislaturperiode von der Bundesregierung angekündigten<br />
grundlegenden Novellierung des BBiG von 1969 hatten sich die Kultusministerien der<br />
Bundesländer schon frühzeitig formiert und mit einem Beschluß ihrer ständigen Konferenz<br />
(KMK) vom 4.12. 2003 ihre Forderungen bezüglich der Gesetzesnovellierung artikuliert. Ihrer<br />
gewachsenen Marktstellung auf dem Ausbildungsmarkt entsprechend ging es bei den<br />
Forderungen vor allem um:<br />
- die uneingeschränkte Zulassung von Absolventen einschlägiger vollzeitschulischer Bildungsgänge<br />
zur (Kammer-) Abschlussprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen;<br />
- die volle Anrechnung einschlägiger beruflicher Qualifizierung in Vollzeitschulen auf die<br />
Ausbildungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen;<br />
- die Einbeziehung der berufsschulischen Leistungsfeststellung oder materiell gleichwertiger<br />
länderspezifischer Regelungen in das Gesamtergebnis der Abschlußprüfung der<br />
Kammern;<br />
- die volle Stimmberechtigung von Lehrkräften an berufsbildenden Schulen in den Berufsbildungsausschüssen<br />
der Kammern;<br />
- die angemessene Vergütung der Lehrkräfte für ihre Tätigkeit bei Kammerprüfungen sowie<br />
- die Einbeziehung der Bundesländer in den Entwicklungsprozeß von Vorgaben für Neuordnungsverfahren<br />
und in das bislang im wesentlichen auf die Sozialpartner beschränkte<br />
Konsensprinzip bei der Entwicklung von Ausbildungsordnungen.<br />
Überprüft man, was von diesem Forderungskatalog im inzwischen in Kraft getretenen „Berufsbildungsreformgesetz“<br />
in einschlägige Bestimmungen umgesetzt worden ist, so müssen<br />
sich die Länder – deren Zustimmung das Gesetz im Bundesrat immerhin benötigte – enttäuscht<br />
zeigen. Nahezu alle Forderungen wurden mit Hinweis auf die herrschende Verfassungsinterpretation<br />
der getrennten Ordnungskompetenz für die betriebliche und schulische<br />
Berufsausbildung von der Bundesregierung zurückgewiesen oder aber im Gesetz durch unverbindliche<br />
Bestimmungen relativiert – beispielsweise die verpflichtende Lernortkooperation<br />
(§ 2,2), die Mitwirkung der Kultusseite bei der Entwicklung von Ausbildungsberufen (§ 4,5)<br />
oder die Berücksichtigung des Berufsschulzeugnisses bei den Kammerprüfungen ((§ 39,3).<br />
Die qualifikations- und bildungspolitisch entscheidende Frage, wie künftig die bislang eher<br />
unverbindliche Beziehung zwischen dual organisierter und (voll)schulischer Berufsausbildung<br />
geregelt sein soll, wird im Gesetz aufgrund der verfassungsmäßig gegebenen Situa-<br />
169
tion mit zwei Anrechnungs- bzw. Zulassungsparagraphen beantwortet, die zum einen die nur<br />
mühsam durchgesetzte Regelung im Rahmen des alten BBiG aufheben, zum anderen die so<br />
nun fixierte schlechtere Lösung auch noch zeitlich begrenzen .<br />
Der „Anrechnungsparagraph“ (§ 7) im Berufsbildungsreformgesetz bestimmt<br />
„(1) Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesausschusses für Berufsbildung<br />
durch Rechtsverordnung bestimmen, daß der Besuch eines Bildungsganges berufsbildender<br />
Schulen oder die Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung ganz oder teilweise<br />
auf die Ausbildungszeit angerechnet wird. (...) Die Rechtsverordnung kann vorsehen, dass<br />
die Anrechnung eines gemeinsamen Antrags der Auszubildenden und Ausbildenden bedarf.<br />
(2) Die Anrechnung nach Absatz 1 bedarf des gemeinsamen Antrags der Auszubildenden<br />
und Ausbildenden. Der Antrag ist an die zuständige Stelle zu richten. Er kann sich<br />
auf Teile des höchstzulässigen Anrechnungszeitraums beschränken.“<br />
Hinter dieser merkwürdigen Doppelung abweichender Anerkennungsregeln verbirgt sich eine<br />
so genannte Befristungsbestimmung. Die Absätze 1 und 2 sind so gestaltet, daß sie ein gestuftes<br />
Inkrafttreten der in ihnen enthaltenen Regelungen ermöglichen. Nach den Bestimmungen<br />
des Artikels 8 bleiben die bislang geltenden Anrechnungsverordnungen für das Berufsgrundbildungsjahr<br />
und die Berufsfachschulen bis zum Juli 2006 in Kraft. Ab 1. April 2005,<br />
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes, können die Länder – unter Beachtung<br />
von Geltungsbereich und -dauer der noch gültigen Anrechnungsverordnungen – eigene Anrechnungsverordnungen<br />
in Kraft setzen, die bis zum 31. Juli 2009 den Bestimmungen von §<br />
7, Abs. 1 folgen. Am 1. August 2009 tritt dann § 7, Abs. 2 in Kraft; das heißt, über die Anrechnung<br />
schulischer Ausbildungsleistungen entscheiden dann vorzugsweise die Betriebe<br />
und die Kammern.<br />
Der am meisten umstrittene § 43, Abs. 2 des Gesetzentwurfs, der von Arbeitgebern und Gewerkschaften<br />
gleichermaßen als systemgefährdend abgelehnt wurde, erhielt in seiner endgültigen<br />
Fassung folgende Form:<br />
„(2) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden Schule oder<br />
einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang<br />
der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein<br />
Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannnten Ausbildungsberuf,<br />
wenn er<br />
1. nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsordnung<br />
gleichwertig ist,<br />
2. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung<br />
durchgeführt wird, und<br />
170
3. durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an praktischer Ausbildung<br />
gewährleistet.<br />
Die Landesregierungen werden ermächtigt, im Benehmen mit dem Landesausschuss für<br />
Berufsbildung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Bildungsgänge die Voraussetzungen<br />
der Sätze 1 und 2 erfüllen. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung<br />
auf oberste Landesbehörden weiter übertragen werden.“<br />
Diese gegenüber dem Gesetzentwurf wesentlich präzisierte Bestimmung zeigt nun mit wünschenswerter<br />
Deutlichkeit die zentrale Absicht des Gesetzgebers, nämlich dass das „Ziel der<br />
Gesetzesänderung nicht die Etablierung eines neuen schulischen Berufsbildungssystems ist,<br />
sondern die Heranführung des bestehenden schulischen Berufsbildungssystems an das Berufsbildungssystem<br />
nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung“ ( Änderungsantrag,<br />
Drucksache 15/4752, S. 9). Um die länderspezifischen Rechtsakte auch verläßlich kontrollieren<br />
zu können, werden sie „an das Benehmen“ mit den Landesausschüssen für Berufsbildung<br />
geknüpft, wo Arbeitgeber und Gewerkschaften die Mehrheit der stimmberechtigten<br />
Mitglieder stellen.<br />
Artikel 8 des Gesetzes garantiert dann endgültig die Rückkehr zu den alten Verhältnissen:<br />
er bestimmt, daß § 43 Abs.2, Satz 3 und 4 – also die Ermächtigung der Länder zu bestimmen,<br />
welche schulischen Bildungsgänge die Voraussetzung für die Zulassung zur Kammerprüfung<br />
erfüllen – zum 1. August 2011 – also ein Jahr früher als die Bundesregierung in<br />
ihrem Entwurf vorgesehen hatte – außer Kraft gesetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt bestimmen<br />
also wieder allein die Kammern über die Zulassung.<br />
Spätestens hier werden nun Motivation und Funktion des neuen „Berufsbildungsreformgesetzes“<br />
ganz deutlich: § 7 und § 43 Abs.2 zielen in ihrer gewundenen Endfassung ausschließlich<br />
auf die Beseitigung oder zumindest die Verringerung der im Augenblick das Duale<br />
System der Berufsausbildung so schwer diskriminierenden „Warteschleifen“ – das heißt,<br />
Maßnahmen der Länder und der Agentur für Arbeit zur „Berufsvorbereitung“. Dabei wird der<br />
„Schwarze Peter“ in der Aushandlung von Kompromissen mit den Sozialpartnern den Landesregierungen<br />
zugeschoben, was bedeutet, dass es in den einzelnen Bundesländern sehr<br />
unterschiedliche „Lösungen“ geben wird. Die schwerer einzuschätzende Wirkung dieser Paragraphen<br />
besteht indes darin, ob die Länder angesichts dieser Terminierung der Anerkennungsregelungen<br />
vollschulischer Berufsausbildung und angesichts der Ebbe in ihren Haushalten<br />
den Bereich beruflicher Vollzeitschulen in den nächsten Jahren trotz noch steigender<br />
Nachfrage überhaupt weiter ausbauen werden.<br />
171
Das neue, ab 1. April 2005 gültige, Berufsbildungsgesetz läßt sich kaum als ein „Reformgesetz“<br />
bezeichnen, obwohl eine ganze Reihe neuer technischer Bestimmungen die unmittelbare<br />
Durchführung der Berufsausbildung zu verbessern versprechen. Das Gesetz bietet nur<br />
begrenzt neue Antworten auf die „alten Probleme“ der dualen Ausbildung, beispielsweise<br />
zur Lernortkooperation oder zur Berücksichtigung der Berufsschulleistungen in den Kammerprüfungen.<br />
Vor allem aber ignoriert das Gesetz den unbestreitbaren Tatbestand, dass<br />
der dual organisierten Berufsausbildung inzwischen in der schulischen Vollausbildung ein<br />
ernst zu nehmender Konkurrent erwachsen ist, den man nicht einfach mit ein paar schlichten<br />
Gesetzesbestimmungen ins Abseits drängen kann. Die vorgesehenen Befristungsregelungen,<br />
die Verankerung der Betriebsausbildung als verbindliche Norm auch für schulische Berufsqualifizierung<br />
im § 43, 2 sowie die Ausschaltung der Länder im Zulassungsverfahren zur<br />
Kammerprüfung im Jahre 2011 gehen im Grunde von der Erwartung aus, daß sich nach dem<br />
Abflauen der hohen Ausbildungsplatz-Nachfrage jenseits des Jahres 2007 die alte heile Bildungswelt<br />
des Industrialismus in Deutschland mit ihrer charakteristischen Trennung von Allgemein-<br />
und Berufsbildung wieder herstellen wird.<br />
Nichts ist unwahrscheinlicher: die heute schon erkennbaren qualifikatorischen und bildungspolitischen<br />
Entwicklungstrends, vor allem aber die vorhersehbare weitere Erosion des Dualen<br />
Systems, werden den Bund und die Länder schon bald dazu zwingen, sich auf ein offenflexibles,<br />
zukunftsfähiges und europataugliches gemeinsam verantwortetes Berufsausbildungsmodell<br />
zu einigen.<br />
Literatur: Baethge, M., 2003: Das berufliche Bildungswesen in Deutschland am Beginn des 21. Jahrhunderts.<br />
S. 525 – 580 in: Cortina, K. S. u.a. (Hrsg): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Reinbek: Rowohlt; Greinert, W.-D., 2003: Realistische Bildung in Deutschland. Ihre<br />
Geschichte und ihre aktuelle Bedeutung. Hohengehren: Schneider; Greinert, W.-D./ Schur, I. R.,<br />
2004: Zwischen Markt und Staat. Berufsbildungsreform in Deutschland und in der Schweiz. Berlin:<br />
Overall; Stooß, F., 2004: Eckdaten zur Berufsausbildung – Situation und Entwicklung. S. 84 – 91 in:<br />
G. Rothe: Alternanz – die EU-Konzeption für die Berufsausbildung. Karlsruhe: Universitätsverlag<br />
172
Rainer Pietsch<br />
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport<br />
des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Das <strong>Brandenburg</strong>er<br />
„Kooperative Modell“–<br />
Zielsetzungen und Ergebnisse<br />
173
1. Zur Geschichte<br />
Im August 1997 wurde die Vereinbarung zum Kooperativen Modell zwischen der damaligen<br />
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Frau Peter, und den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern<br />
der Industrie und Handelskammern beziehungsweise der Handwerkskammern<br />
unterzeichnet. Damit konnten im Schuljahr 1997 erstmals Klassen in diesem Berufsfachschulbildungsgang<br />
eingerichtet werden, in dem die Schülerinnen und Schüler in Kooperation<br />
zwischen den Oberstufenzentren (OSZ) und fachpraktischen Ausbildungsstätten in<br />
einem Beruf ausgebildet und zur Kammerprüfung geführt wurden.<br />
Allerdings begann die Ausbildung zweigeteilt. Für 736 Schüler/innen begann die Ausbildung<br />
in Handwerks- und Bauberufen am 1.10.1997. Die IHK hatten sich ausbedungen, zum Jahresende<br />
zu entscheiden, ob in ihrem Bereich die Ausbildung im Kooperativen Modell beginnen<br />
sollte. Voraussetzung dafür war unter anderem, dass die betriebsnahen Plätze besetzt<br />
waren. So wurden dann 1200 Plätze im Bereich der IHK angeboten, deren Ausbildung zwischen<br />
dem 1.12.1997 und dem 1.02.1998 begann. Die Prüfung für diese Schüler/innen wurde<br />
dadurch folgerichtig um eine halbes Jahr verschoben.<br />
Der erste Jahrgang war durch eine relativ hohe Abbrecherquote geprägt. So waren zum<br />
8.12.1998 nur noch 70% der Plätze besetzt.<br />
Im Schuljahr 1998/99 wurde für Schüler/innen im Kooperativen Modell, die mit 3178 Schüler/innen<br />
einheitlich am 1.10.1998 begann, zusätzlich zur BAföG-Förderung der Mobilitätszuschuss<br />
in Höhe von 180,- DM pro Monat eingeführt. Das trug erheblich zur Stabilisierung<br />
dieses Bildungsganges bei. Da die Schüler/innen des Jahrganges 1997 aber nicht nachträglich<br />
davon profitieren konnten, löste das natürlich bei diesen Schülern eine große Protestwelle<br />
aus, so dass circa 900 Beschwerden auf unterschiedlichen Wegen zu uns gelangten und<br />
zu beantworten waren. Da die Schreiben in Argumentation und Begründung sehr unterschiedlich<br />
gehalten waren, mussten sie auch individuell bearbeitet werden, was einen ernormen<br />
Arbeitsaufwand bedeutete.<br />
2. Entwicklung<br />
Schritt für Schritt gelang es, die Kinderkrankheiten zu überwinden und die Rahmenbedingungen<br />
zu verbessern. Auch die Besetzungsstabilität verbesserte sich deutlich. Die Prüfungsergebnisse<br />
in den Kammerprüfungen wurden ebenfalls spürbar verbessert und unterschieden<br />
sich bald nicht mehr wesentlich von den Ergebnissen im dualen System. Das belegt<br />
der Abschlussbericht einer Evaluation, die von 2000 bis 2003 durchgeführt wurde.<br />
Natürlich gab und gibt es auch immer wieder Probleme einzelner Klassen mit dem OSZ oder<br />
dem Träger der Fachpraxis, bei denen wir eingreifen mussten. Es stellte sich aber heraus,<br />
174
dass die Ausbildung immer dann erfolgreich war, wenn OSZ und Träger engagiert ihre Aufgaben<br />
erfüllten, es verstanden, die Schüler/innen zu motivieren und – besonders wichtig –<br />
eng zusammen arbeiteten. In zunehmendem Maße stellten und stellen auch Träger der fachpraktischen<br />
Ausbildung stolz ihre eindrucksvollen Ergebnisse der Ausbildung im Kooperativen<br />
Modell vor.<br />
In Sachsen/Anhalt versuchte man das Modell zu kopieren, stellte es aber schon nach einem<br />
Durchgang wieder ein. Ein entscheidender Vorteil des Kooperativen Modells in <strong>Brandenburg</strong><br />
gegenüber Sachsen/Anhalt war die Vereinbarung mit den Kammern, denen auch wesentliche<br />
Regularien übertragen worden waren.<br />
Dennoch gab und gibt es immer wieder Änderungsbedarfe in diesem Bildungsgang. Das<br />
wird auch dadurch verdeutlicht, dass wir gegenwärtig schon die vierte Änderungsverordnung<br />
zur Bildungsgangverordnung auf den Weg gebracht haben.<br />
Einige Probleme sind aber nach wie vor nicht gelöst. Hier versuchen wir im heftigen Ringen<br />
mit den Schulrechtlern Lösungen zu finden.<br />
Ein Beispiel:<br />
Wenn eine fachpraktische Ausbildungsstätte die Ausbildung einer Schülerin oder eines<br />
Schülers nicht fortsetzen will oder kann (Diebstahl, Verletzung von Sicherheitsbestimmungen<br />
und so weiter), so bleibt die Schülerin oder der Schüler weiterhin Schüler/in des OSZ, das<br />
auch weiterhin die Verpflichtung hat, die Ausbildung fortzusetzen.<br />
Die Schülerin oder der Schüler steht unter dem Schutz des Schulgesetzes und kann nur<br />
nach den Bestimmungen der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmeverordnung aus dem<br />
Bildungsgang entfernt werden. Zeigt sich die Schülerin oder der Schüler in dem zu führenden<br />
Gespräch einsichtig, so besteht für die Schule aber kaum eine Chance dafür.<br />
3. Vermittlungsaussichten<br />
Für die Veranstaltung heute war auch die Teilnahme von Herrn Professor Liepmann geplant.<br />
Er sollte zum Abschlussbericht der Evaluation des Kooperativen Modells Ausführungen machen.<br />
Leider war ihm und seinem Mitarbeiter die Teilnahme nicht möglich, so dass wir auf<br />
diesen Teil verzichten müssen. Interessierten kann ich aber sehr die Lektüre des Abschlussberichts<br />
empfehlen, der mit vielen Vorbehalten gegenüber dem Kooperativen Modell aufräumt.<br />
Ich will deshalb nur auf einige Kernaussagen eingehen:<br />
175
Erstaunlicherweise kommt die Verbleibsanalyse zu der Erkenntnis, dass für Absolventen des<br />
Kooperativen Modells sechs Monate nach Abschluss der Ausbildung eine vergleichsweise<br />
befriedigende Beschäftigungsquote vorliegt, die sich nicht wesentlich von der dualen Ausbildungsgruppe<br />
unterscheidet.<br />
Vor dem Hintergrund, dass die Schüler/innen im Kooperativen Modell in der Regel über niedrigere<br />
Bildungsabschlüsse verfügen und die absolvierte Berufsausbildung auch selten dem<br />
Wunschberuf entspricht, ist es verblüffend, dass die Ergebnisse bei den Kammerprüfungen<br />
im Kooperativen Modell geringfügig schlechter ausfallen als in der dualen Vergleichsgruppe.<br />
Schlechter sind allerdings die Rahmenbedingungen der Arbeitsverhältnisse (befristete Arbeitsverhältnisse,<br />
Leiharbeit und so weiter) für die Absolventen des Kooperativen Modells.<br />
4. Zukunft und Fortführung<br />
Über die Fortführung oder Verstetigung des Kooperativen Modells gibt es verschiedene Vorstellungen.<br />
Am interessantesten finde ich dabei folgende Variante:<br />
Im Schuljahr 2011/12 wird die Anzahl der Ausbildungsplatzbewerber auf das niedrigste Niveau<br />
sinken. Schreibt man das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen bis dahin fort,<br />
so würden zwar immer noch mehr Bewerber für diese Plätze bereit stehen, es könnten aber<br />
nicht alle Plätze besetzt werden, da es nicht genügend geeignete und qualifizierte Bewerber<br />
für diese Ausbildung geben wird.<br />
Hier könnte das Kooperative Modell eine wichtige Verbindungsrolle spielen:<br />
Die Jugendlichen würden im Kooperativen Modell durch Ausbildung in einem Beruf auf die<br />
Ausbildung in diesem Beruf über einen bestimmten Zeitraum vorbereitet.<br />
Durch intensivere Praktika bekämen Betriebe ein Bild davon, über welche Kenntnisse und<br />
Fähigkeiten die Schüler/innen verfügen und würden so angeregt, die Schüler/innen direkt zu<br />
übernehmen und die Ausbildung fortzuführen.<br />
Dabei sollten die Berufe gewählt werden, für die in den Regionen auch ein Bedarf vorhanden<br />
ist. Die Jugendlichen würden dann auch noch eine höhere Motivation bekommen, wenn die<br />
Übernahme in die betriebliche Ausbildung von ihren Leistungen abhängig gemacht würde.<br />
Allerdings bleibt das Problem der Finanzierbarkeit bestehen.<br />
Möglich wäre auch, mit diesem Modell regionalen Verwerfungen entgegenzusteuern.<br />
Das heißt, dass in den Regionen mit Ausbildungsplatzproblemen (wie zum Beispiel Uckermark,<br />
Prignitz, Elbe-Elster) mit entsprechenden Angeboten für die Jugendlichen einer Abwanderung<br />
entgegen gesteuert werden könnte.<br />
176
Solvay Knopf<br />
Ausbildungsverbund Teltow e. V. – Bildungszentrum der IHK Potsdam<br />
Erfahrungen mit dem Kooperativen Modell<br />
im Ausbildungsverbund Teltow e.V.<br />
177
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
darf ich mich Ihnen kurz vorstellen: mein Name ist Solvay Knopf, stellvertretende Geschäftsführerin<br />
des Ausbildungsverbundes Teltow e. V. (AVT), mehr bekannt als Projektverantwortliche<br />
der Umsetzungsstelle des Kooperativen Modells.<br />
Der Ausbildungsverbund Teltow e. V.– Bildungszentrum der IHK Potsdam wurde am 8. März<br />
1991 als gemeinnütziger Verein gegründet und arbeitet jährlich mit über 200 klein- und mittelständigen<br />
Firmen auf der Basis von Kooperationsverträgen zusammen. Die fachliche Beratung<br />
obliegt unter anderem dem Beirat unseres Ausbildungsverbundes mit 22 Mitgliedsfirmen<br />
aus den Kammerbezirken der IHK Potsdam.<br />
Die wichtigsten Bildungsbereiche des AVT sind:<br />
kaufmännische und gewerbliche Erstausbildung<br />
Aus- und Weiterbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe<br />
Fortbildung und Weiterbildung, zum Beispiel in 13 Meisterfachrichtungen, Fachwirten,<br />
AEVO<br />
sowie das duale Studium an der Wirtschaftsakademie der IHK Potsdam nach dem Hamburger<br />
Modell.<br />
Zum AVT gehört eine Unterkunft mit einem Freizeitbereich inklusive Fitnessraum und Sauna.<br />
Eine Cafeteria befindet sich ebenfalls im Haus.<br />
Seit 1998 bildet der AVT im Kooperativen Modell im kaufmännischen Bereich aus :<br />
Übersicht Koop.-Klassen AVT-e. V. Stichtag: 31.12.2004<br />
Reg.-Nr. Anzahl TN Ausbildungsberuf<br />
33-63076 20* Bürokaufmann/-frau<br />
33-63095 18* Bürokaufmann/-frau<br />
Teilnehmerzahl im Prüfungsmonat<br />
Teilnehmerzahl im Prüfungsmonat<br />
AUSB-08/00-25 16* Kaufmann/-frau für Bürokommunikation<br />
Teilnehmerzahl im Prüfungsmonat<br />
AUSB-08/01-25 16* Kaufmann/-frau für Bürokommunikation<br />
Teilnehmerzahl im Prüfungsmonat<br />
AUSB-08/02-25 20** Kaufmann/-frau für Bürokommunikation<br />
Teilnehmerzahl zum 31.12.2004<br />
AUSB-16/02-25 14** Veranstaltungskaufmann/-frau<br />
*) Teilnehmerzahl im Prüfungsmonat<br />
AUSB-08/03-15 11 + 7 Abbrecher.** Kaufmann/-frau für Bürokommunikation<br />
Teilnehmerzahl zum 31.12.2004<br />
AUSB-16/03-15 10 + 1 Abbrecher** Veranstaltungskaufmann/-frau<br />
Teilnehmerzahl zum 31.12.2004<br />
AUSB-08/04-15 22** Kaufmann/-frau für Bürokommunikation<br />
Teilnehmerzahl zum 31.12.2004<br />
JBF-09/04-15 6** Fachmann/-frau für Systemgastronomie<br />
Teilnehmerzahl zum 31.12.2004<br />
178
Für die Ausbilder in unserem Haus war die damals neue Form der Ausbildung eine Herausforderung,<br />
da die Schüler im Kooperativen Modell Berufsfachschüler im Sinne der Berufsfachschulordnung<br />
einen Berufsabschluss nach Berufsbildungsgesetz oder HWO-BBHwFFV<br />
erwerben.<br />
Einen Schüler ohne Firmenbindung zum Berufsabschluss zu führen, erfordert neue Ausbildungsmethoden.<br />
Der AVT hat trotz bundesweitem Rückgang an der Mitgliedschaft in der<br />
ZÜF Zentralstelle des Deutschen Übungsfirmenringes Essen festgehalten und führt seine<br />
„Teltower Schreibgeräte <strong>GmbH</strong>“ weiter. Für die fiktive <strong>GmbH</strong> steht der Angebotskatalog im<br />
Internet www.avt-ev.de zur Verfügung. Dieses Angebot haben die Schüler selbst erstellt.<br />
Probleme beim Einsatz in ein betriebliches Praktikum stellten sich uns bisher nur als Schwierigkeit<br />
dar, die Schüler zu weiteren Anfahrtswegen beziehungsweise „stressintensiven Tätigkeiten“<br />
zu bewegen.<br />
Ausbildungsabbrüche hat es in unserem Hause nur gleich zu Beginn der Ausbildung oder<br />
auf Grund des Einschlagens anderer Bildungswege gegeben.<br />
Ein Übergang in die duale Ausbildung ist uns bisher nur im Übergang zwischen dem 1. und<br />
2. Lehrjahr in 8 Fällen gelungen.<br />
Eine zentrale Problemstellung ist immer wieder: Wie können wir die Motivation der Schüler<br />
erhöhen?<br />
Dazu sind wir auch für uns neue Wege gegangen wie:<br />
- Elternsprechtage,<br />
- Zwischentests,<br />
- Teilnahme an fiktiven IHK-Zwischenprüfungen,<br />
- öffentliche Auswertung der Fehlzeiten (jeder Schüler erhielt eine datengeschützte<br />
Teilnehmernummer),<br />
- enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Oberstufenzentren,<br />
- Gruppenteilung – Team und Projektarbeit,<br />
- verschiedene Ausbilder als Ansprechpartner.<br />
In unserem aktuellen Projekt der Durchführung der Regionalkonferenz „Region macht Schule“,<br />
haben die Schüler im Beruf Veranstaltungskaufmann/-frau 2. Lehrjahr die konkrete Projektplanung<br />
und Projektdurchführung übernommen. Vom ersten Konzept bis zur Auswertung<br />
dieser Konferenz sind die Schüler beteiligt und eigenverantwortlich.<br />
Solche konkreten Projekte führen zu mehr Eigenständigkeit der Schüler und zeigen auch die<br />
unmittelbaren Tätigkeiten des Berufes.<br />
179
Wir stellen immer wieder fest, dass sich die Schüler zwar mit dem Berufsbild beschäftigen,<br />
aber zu wenig mit der eigentlichen beruflichen Tätigkeit.<br />
Es ist zu überlegen, wie man schon Schüler der 7. – 10. Klassen in der Berufsorientierung<br />
darauf verweisen kann, wozu sie zum Beispiel ein bestimmtes mathematisches Wissen benötigen,<br />
wie im Beruf Koch, der ja im vergangenen Jahr der beliebteste Beruf für junge Männer<br />
war. Beispielsweise dass – wenn man für 30 Personen kalkulieren muss – man auch<br />
betriebswirtschaftlich einkaufen sollte und zwar so, dass nicht nur 3 Personen oder 300 Personen<br />
satt werden, sondern genau 30!<br />
In der Tagung der kaufmännischen Ausbildungsleiter „Die duale Ausbildung im erweiterten<br />
Europa“ in Dresden am 2. und 3. Juni 2005 kam noch einmal deutlich zum Ausdruck, wie<br />
wichtig die Sprachkommunikation in Zukunft sein wird. Die Mittelsächsische Sparkasse hat in<br />
Bad Schandau einen jugendlichen tschechischen Staatsbürger als Auszubildenden beschäftigt.<br />
Diese Entscheidung hat sich für das dortige Unternehmen als betriebswirtschaftlich<br />
günstig erwiesen.<br />
Angesichts der sich verändernden Bedingungen, der Diskussion zum Master und Bachelor,<br />
der schulischen Ausbildung sowie der demografischen Entwicklung, ist die Novellierung des<br />
Kooperativen Modells des Landes <strong>Brandenburg</strong> zu durchdenken, zum Beispiel bei der Forderung<br />
im Hinblick auf die Dauer der Firmenpraktika.<br />
Um nicht wieder Problemstellungen im Sinne förderrechtlicher Aspekte zu erzeugen, müssen<br />
aber alle Beteiligten rechtzeitige Absprachen treffen.<br />
Es ist einzuschätzen, dass besonders in den letzten 2 Jahren das Kooperative Modell ein<br />
fester Bestandteil in der Bildungslandschaft des Landes <strong>Brandenburg</strong> geworden ist.<br />
Aber wir sollten beim „Abholen“ der Schüler nicht die Eltern vergessen, die sich oft allein gelassen<br />
fühlen.<br />
Bildungsanforderungen und Leistungsanforderungen sind praxisnah darzustellen und jedem<br />
Schüler seine berufliche Perspektive aufzuzeigen.<br />
180
Übersicht Berufe Kooperatives Modell<br />
Bereich IHK 2000 – 2004<br />
1 0531<br />
Gartenbauer<br />
Florist<br />
Kunststoffverarbeiter<br />
2 1510a<br />
Verf.-Mechaniker Kunst- u. Kautschuk<br />
Drucker<br />
3 1710b<br />
Mediengestaltung;Digital-u.Printmedien FR.Medienberatung<br />
Metallberufe<br />
4 2211 Zerspanungsmechaniker FR Drehtechnik<br />
5 2410 Anlagenmechaniker Schweißtechnik<br />
6 2410c Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik<br />
7 2610 Konstruktionsmechaniker FR Ausrüstungstechnik<br />
8 2740 Industriemechaniker FR Instandhaltung<br />
9 2740a Industriemechaniker FR: Betriebstechnik<br />
10 2740d Industriemechaniker FR Produktionstechnik<br />
11 2750 Konstruktionsmechaniker FR Metall-u.Schiffsbau<br />
12 2750d Konst.-Mechaniker FR Konst.-Technik<br />
13 2856 Fertigungsmechaniker<br />
14 2858<br />
Teilezurichter<br />
Elektroberufe<br />
15 3111 Industrieelektroniker FR Prod.-Technik<br />
16 3113 Elektroanlagenmonteur<br />
17 3113d Elektroniker FR Automatisierungstechnik<br />
18 3141a Mechatroniker<br />
19 3143<br />
Industrieelektroniker FR Gerätetechnik<br />
Speisenbereiter<br />
20 4110<br />
Koch<br />
Bauberufe<br />
21 4410d Maurer<br />
22 4411 Fassadenmonteur<br />
23 4510 Ausbaufacharbeiter FR Trockenbau<br />
24 4510 Ausbaufacharbeiter FR Zimmerarb.<br />
25 4510 Zimmerer<br />
26 4510a Ausbaufacharb. FR Wärme-,Kälte-, Schallschutzisol.<br />
27 4660 Spezialtiefbauer<br />
28 4810c Stuckateur<br />
29 4821 Trockenbaumonteur<br />
30 4830<br />
Fliesen-Platten-und Mosaikleger<br />
Warenprüfer, Versandfertigmacher<br />
31 5221 Handelfachpacker<br />
Fachlagerist<br />
32 5221a<br />
181
Maschinisten und zugehörige Berufe<br />
33 5460 Baugeräteführer<br />
34 6350<br />
Technische Sonderkräfte<br />
Technischer Zeichner<br />
35 6352 Bauzeichner<br />
36 6811 Kauffrau Groß-und Außenhandel<br />
37 6812 Kaufmann/-frau im Einzelhandel<br />
38 6819 Automobilkaufmann<br />
39 6820 Verkäufer<br />
40 6930 Kaufmann im Gesundheitswesen<br />
41 7010 Speditionskaufmann<br />
42 7031 Werbekaufmann<br />
43 7034<br />
Mediengestalter FR: Digital-und.Printmed.Medienberater<br />
Berufe des Landverkehrs<br />
44 7123 Kaufmann Verkehrsservice<br />
Berufskraftfahrer<br />
45 7140<br />
Bürofach- und -Hilfskräfte<br />
46 7810b Bürokaufmann<br />
47 7810c Kaufmann Bürokommunikation<br />
48 7813 Industriekaufmann<br />
49 7816 Kaufmann Grundst- u. Wohnungswirtschaft<br />
50 7911a<br />
Fachkraft für Schutz u. Sicherheit<br />
Künstler und zugeordnete Berufe<br />
51 8354 Mediengestalter FR Bild undTon<br />
52 8361 Schauwerbegestalter<br />
53 8361b<br />
Gestalter für visuelles Marketing<br />
Gästebetreuer<br />
54 9114 Hotelfachmann<br />
55 9122 Restaurantfachmann<br />
56 9134a Fachkraft im Gastgewerbe<br />
Ausbildung in 15 Berufsgruppen beziehungsweise Komplexen<br />
mit 56 Berufen<br />
182
Übersicht Berufe Kooperatives Modell<br />
Bereich HWK Potsdam 2000 – 2004<br />
Metallberufe<br />
1 2613 Karosserie- u.Fahrzeugbauer<br />
2 2613e Karosserie-u. Fahrzeugmechaniker/-in<br />
3 2613g Mechaniker FR: Karosseriebau<br />
4 2621 Gas- u. Wasserinstallateur/ -in<br />
5 2622 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer<br />
6 2710b Metallbauer, FR: Konstruktionstechnik<br />
7 2810 Kraftfahrzeugmechaniker<br />
8 2810e Kraftfahrzeugmechatroniker FR: PKW-Technik<br />
Elektroberufe<br />
10 3110c Elektroniker: Energie-und Gebäudetechnik<br />
11 4410<br />
Bauberufe<br />
Maurer<br />
12 4420 Beton- u.Stahlbetonbauer/ -in<br />
13 4510 Ausbaufacharbeiter FR Fliesenleger<br />
14 4510 Ausbaufacharbeiter FR Zimmerer<br />
15 4510 Zimmerer<br />
16 4520 Dachdecker/-in<br />
17 4620 Tiefbaufacharbeiter FR Straßenbau<br />
18 4830 Fliesen-, Platten- u.Mosaikleger<br />
19 4910 Raumausstatter/-in<br />
20 5010<br />
Tischler<br />
Maler/Lackierer<br />
21 5110<br />
Maler/Lackierer<br />
Körperpflege<br />
22 9021b Kosmetiker/-in<br />
Ausbildung in 4 Berufsgruppen beziehungsweise Komplexen mit 22 Berufen<br />
183
Ute Tenkhof<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie<br />
des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
185<br />
Resümee
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich danke der <strong>LASA</strong> und insbesondere Frau Schöne für diese wunderbare Veranstaltung.<br />
Dann möchte ich den Jugendlichen danken, die heute erheblich dazu beigetragen haben,<br />
dass wir uns hier wohl fühlten und dass sie sich an den Diskussionen in den Foren beteiligt<br />
haben. Ich möchte auch ganz herzlich den Referentinnen und Referenten danken, die mit<br />
ihren Beiträgen der beruflichen Bildung hier in <strong>Brandenburg</strong> neue Impulse gegeben haben,<br />
indem sie auswerteten, was in den letzten Jahren gemacht wurde und darauf aufbauend<br />
Perspektiven entwickelten.<br />
Fasst man jetzt die Diskussion in den Foren zusammen, dann ergibt sich folgende Zielstellung<br />
für die Erstausbildung:<br />
dass ein Beitrag zu liefern ist zur Fachkräftesicherung für die heimische Wirtschaft,<br />
dass die Chancen für die jungen <strong>Brandenburg</strong>erinnen und <strong>Brandenburg</strong>er auf dem<br />
Arbeitsmarkt und<br />
vor allem die Qualität der Erstausbildung zu verbessern ist.<br />
Dabei hat die Zielerreichung gegenüber der vergangenen Legislaturperiode unter zum Teil<br />
veränderten Rahmenbedingungen stattzufinden, die da sind:<br />
die demografische Entwicklung,<br />
der sich abzeichnende branchenspezifische Fachkräftebedarf<br />
und das sich abzeichnende Auslaufen des Ausbildungsprogramms Ost, wobei wir<br />
nicht wissen, ob es das Programm nächstes Jahr oder 2007 noch geben wird.<br />
Gleichzeitig sind der Qualifizierung und Erstausbildung durch die wirtschaftliche Situation,<br />
das strukturelle Arbeits- und Ausbildungsplatzdefizit, die sehr kleinteilige Wirtschaftsstruktur<br />
und den Landeshaushalt Grenzen gesetzt.<br />
Dagegen bietet die seit dem 01.04.2005 in Kraft getretene Berufsbildungsreform die Chance,<br />
mit neuen Verbundausbildungen der Erstausbildung neue Impulse zu geben hinsichtlich<br />
Quantität und Qualität des betrieblichen Ausbildungsangebotes.<br />
Was ist jetzt zu tun?<br />
Die Erkenntnisse aus den Foren ergeben fünf Impulse:<br />
Impuls Nummer 1: Fachkräftesicherung beginnt im Betrieb.<br />
Mehr Betriebe für mehr Ausbildung zu gewinnen, indem Verbundmöglichkeiten genutzt werden,<br />
die das neue Gesetz bietet, angepasst an die spezielle Wirtschaftsstruktur in <strong>Brandenburg</strong>.<br />
Die Weiterentwicklung der betriebsnahen Ausbildung und Aufschließung von Betrieben<br />
186
durch Beratung. Es ist gleichzeitig sehr wichtig, aus dem Korsett der hergebrachten betrieblichen<br />
Ausbildungsstruktur heraus zu denken und sich neue Lernortkooperationen vorstellen<br />
zu können. Ich möchte dazu noch einmal Werbung in eigener Sache machen: Einmal beginnen<br />
wir einen Inno-Punkt Mitte Juni zum Thema „Mehr Betriebe für mehr Ausbildung gewinnen“;<br />
und dann möchte ich Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass im Rahmen<br />
des Ausbildungskonsenses ein Ausbildungspreis ausgelobt worden ist. Ich bitte Sie, dafür zu<br />
werben, dass sich Betriebe dafür interessieren und sich melden.<br />
Zum Thema Berufsorientierung:<br />
Der Übergang Schule – Beruf bedeutet für viele junge Menschen noch eine schwer zu überwindende<br />
Schwelle und manifestiert sich ja auch in den Zahlen bei der BA, wir haben sehr<br />
viele junge Arbeitslose ohne Berufsabschluss. Ohne entsprechende Förderung und Maßnahmen<br />
im vorberuflichen und schulischen Bereich kann es bei künftiger, rechnerischer<br />
Ausgeglichenheit des Ausbildungsmarktes zu einer regional ausgeprägten qualitativen Verknappung<br />
des Fachkräftenachwuchses kommen. Die Betriebe werden perspektivisch vor<br />
einem Wettbewerb um die klügsten Köpfe stehen. Diese Erkenntnis führt zum<br />
Impuls Nummer 2: Berufliche Bildung beginnt in der Schule.<br />
Dazu die Thesen aus dem Forum:<br />
Jedem Schüler in <strong>Brandenburg</strong> sollte die Chance zu einer kontinuierlichen Praxis bezogenen<br />
Berufswahlorientierung geboten werden. Zur Erhöhung der Verwertungschancen der Erstausbildung<br />
sollten mehr übergreifend verwertbare Qualifikationen vermittelt werden, um die<br />
Bildungsentscheidung bei Bedarf schneller und besser anpassen zu können.<br />
Bildung allgemein und die berufliche Orientierung als ihr integraler Bestandteil muss in gesellschaftlicher<br />
Verantwortung stattfinden.<br />
Der Themenkomplex Schule-Wirtschaft sollte durch gemeinsam entwickelte Zielvorstellungen<br />
aller Beteiligten jenseits von Aktionismus als Gesamtstrategie in der Region und dem<br />
Bundesland umgesetzt werden. Schulen müssen stabile Beziehungen zu Wirtschaftspartnern<br />
herstellen, dazu sind Netzwerke unverzichtbar. Um die Eigenverantwortung der Schulen<br />
für fachlich übergreifende Wirtschaftsarbeit zu verstärken, müssen Lehrer durch Weiterbildung<br />
motiviert und unterstützt werden. Es wird vom Forum vorgeschlagen, dieses Thema<br />
in einem weiteren Fachgespräch mit ähnlicher Zusammenstellung zu vertiefen.<br />
Verbesserung der Ausbildungsqualität und damit der betrieblichen Kompetenzentwicklung.<br />
Die Förderung von qualifizierten, gut ausgebildeten und anpassungsfähigen Arbeitskräften,<br />
die Förderung der Chancengleichheit aller beim Zugang zu Qualifizierung und Ausbildung,<br />
die Förderung und Verbesserung der beruflichen und allgemeinen Bildung sowie der Beratung<br />
in einer Politik des lebenslangen Lernens sind unabdingbare Bausteine für die Stabilisierung<br />
und Weiterentwicklung des Standortes <strong>Brandenburg</strong>.<br />
187
Impuls Nummer 3: Eine Qualitätsoffensive für die Erstausbildung,<br />
um eine solide Basis zu schaffen für ein Erwerbsleben, das sich den oftmals schnell wechselnden<br />
Anforderungen des Wirtschaftslebens an die Qualifizierung von Arbeitskräften anpassen<br />
kann. Wir haben eine Gleichzeitigkeit von Arbeitslosigkeit und Fachkräftebedarf zu<br />
konstatieren.<br />
Impuls Nummer 4: Einerseits darf die soziale Herkunft nicht zur bestimmenden Determinante<br />
der Lebenschancen des Einzelnen werden oder bleiben. Andererseits brauchen arbeitslose<br />
Jugendliche ohne Berufsabschluss eine zweite Chance, wenn sie denn nicht ein risikoreiches<br />
Erwerbsleben vor sich haben sollen.<br />
Deshalb sind vor allem die kommunalen Träger nach SGB 2 gefordert, Jugendlichen Ausbildung<br />
und Qualifizierung anzubieten.<br />
Impuls Nummer 5: Innovative Wirtschaft braucht flexible, passgenaue Ausbildung und<br />
Qualifizierungsangebote.<br />
Zu prüfen sind Ausbildungsgänge, die das duale Angebot ergänzen und an einer verbesserten<br />
Lernortkooperation ansetzen.<br />
Nach Auffassung des Forums wären – unter Auswertung der in <strong>Brandenburg</strong> gesammelten<br />
Erfahrungen zum Kooperativen Modell und nach weiterzuführenden Diskussionen und weitreichenden<br />
Reformen – auch modellhafte, branchen- und regionalspezifische schulische<br />
Ausbildungsgänge getrennt nach IHK- und HWK- Bereichen zu prüfen.<br />
Diese Impulse spiegeln zusammengefasst die Eindrücke wider, die in den Foren gewonnen<br />
wurden. Die Diskussionen waren sehr lebhaft und was den Impuls Nummer 5 betrifft, so gab<br />
es dazu eine sehr kontroverse Diskussion. Deshalb habe ich auch versucht, das sehr vorsichtig<br />
zusammenzufassen. Ich hoffe, dass ich insgesamt getroffen habe, was mir aus den<br />
einzelnen Foren als Quintessenz übermittelt wurde.<br />
Ich möchte Sie jetzt einladen, bei einem kleinen Imbiss die Diskussion untereinander weiterzuführen.<br />
Während des Imbisses wird Ihnen der wichtigste Impuls des heutigen Tages vermittelt<br />
werden: eine Vorführung von Jugendlichen. Sie zeigen „Capoeira“, eine ursprünglich<br />
in Brasilien entstandene tänzerische Verbindung von Kampfsport und Musik, die Jugendlichen<br />
einen Kick für ein positives Selbstwertgefühl gibt.<br />
188
Prof. Dr. Albrecht, Günter<br />
Anton, Torsten<br />
Dr. Appelius, Claudia<br />
Aßmann, Susen-Arian<br />
Babatz, Monika<br />
Bachmann, Dirk<br />
Ball, Elke<br />
Beikirch, Petra<br />
Beinroth, Karin<br />
Bindheim, Jörg<br />
Blume, Reinhard<br />
Boldt, Britta<br />
Brack, Martin<br />
Brestrich, Claudia<br />
Bubbich, Joachim<br />
Buchholz, Petra<br />
Dr. Cantner, Ernst-Walter<br />
Dr. Czerny, Ernst<br />
Teilnehmer/innen der Fachtagung<br />
„Berufliche Erstausbildung in <strong>Brandenburg</strong> –<br />
Bilanz und Perspektiven“<br />
Potsdam, 06.06.2005<br />
GEBIFO-Berlin Gesellschaft zur Förderung von<br />
Bildungsforschung und Qualifizierung <strong>GmbH</strong><br />
Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat Team 41,<br />
Berlin<br />
Fachhochschule <strong>Brandenburg</strong> (FHB),<br />
<strong>Brandenburg</strong>/Havel<br />
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche<br />
Weiterbildung <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
SOWI-Lehrinstitut Berufsausbildungs-<strong>GmbH</strong>,<br />
Neubrandenburg<br />
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und<br />
Arbeit, Dresden<br />
Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland<br />
e.V., Friesack<br />
Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz <strong>GmbH</strong><br />
(EEPL), Finsterwalde<br />
Berufsbildungsverein Eberswalde e.V.<br />
Potsdamer Arbeitsgemeinschaft zur Grundsicherung<br />
für Arbeitssuchende<br />
Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin, Neuruppin<br />
Berufsbildungsverein Eberswalde e.V.<br />
Berufsförderungswerk e.V., Überbetriebliches<br />
Ausbildungszentrum <strong>Brandenburg</strong>/H.-Friesack<br />
Regionaldirektion Berlin-<strong>Brandenburg</strong> der<br />
Bundesagentur für Arbeit, Berlin<br />
Bildungswerk Futura e.V., Luckenwalde<br />
Amt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende,<br />
Prenzlau<br />
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und<br />
Verbraucherschutz des Landes <strong>Brandenburg</strong>,<br />
Potsdam<br />
bbw Bildungszentrum Straußberg <strong>GmbH</strong><br />
189
Dietrich, Rolf<br />
Dr. Dreßler, Gunter<br />
Drews, Klaus<br />
Effing, Ulrich<br />
Eichhorn, Alfred<br />
Enkelmann, Thomas<br />
Erdner, Dieter<br />
Farwer, Heiko<br />
Fernow, Harald<br />
Fiebig, Achim<br />
Fiedler, Hagen<br />
Finn, Rita<br />
Prof. Dr. Fischer, Dietrich<br />
Freimann, Horst<br />
Fritzsche, Hilmar<br />
Gädicke, Frank<br />
Gatzky, Eva<br />
Georgi, Fritz<br />
Gerhold, Elisabeth<br />
Gericke, Birgit<br />
Dr. Girke, Gabriele<br />
Industrie- und Handelskammer Cottbus<br />
Handwerkskammer Südthüringen, Suhl<br />
Berufsbildungsverein Prenzlau e.V.<br />
Heinrich Deichmann Schuhe <strong>GmbH</strong> und Co. KG,<br />
Essen<br />
rbb - InfoRadio, Berlin<br />
Fürstenwalder Aus- u. Weiterbildungszentrum g<strong>GmbH</strong><br />
(FAW)<br />
Angermünder Bildungsverein e.V.<br />
Fachhochschule <strong>Brandenburg</strong> (FHB),<br />
<strong>Brandenburg</strong>/Havel<br />
Lehr- und Ökobauhof, Oranienburg Niederbarnim e.V.<br />
Berufsförderungswerk e.V., Überbetriebliches<br />
Ausbildungszentrum Bauwirtschaft Frankfurt (Oder)-<br />
Wriezen<br />
Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
g<strong>GmbH</strong> (FAW)<br />
Bildungsinstitut für Umweltschutz und Wasser-<br />
wirtschaft Neubrandenburg e.V.<br />
Arbeitslosenverband Bildungswerk <strong>Brandenburg</strong> e.V.<br />
(ALV), Potsdam/Golm<br />
Handwerkskammer Cottbus<br />
Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)<br />
Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
g<strong>GmbH</strong> (FAW)<br />
Handwerkskammer Potsdam<br />
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) <strong>GmbH</strong><br />
Oberstufenzentrum "Johanna Just", Potsdam<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
RKW Berlin <strong>GmbH</strong> Rationalisierungs- und<br />
Innovationszentrum<br />
190
Gohr, Jürgen<br />
Goldammer, Steffen<br />
Götze, Elfi<br />
Prof. Dr. Greinert, Wolf-Dietrich<br />
Griese-Pelikan, Andrea<br />
Grundmann, Dieter<br />
Günther, Beate<br />
Haag, Astrid<br />
Hartisch, Hans-Joachim<br />
Hauptvogel, Manfred<br />
Hegemann, Jürgen<br />
Dr. Heinrich, Andreas<br />
Heinze, Reiner<br />
Hinze, Monika<br />
Hölterhoff, Dieter<br />
Horn, Kerstin<br />
Hübner, Sabine<br />
Dr. Jahnke, Gabriele<br />
Johnson, Carsten<br />
Jurkeit, Jörg<br />
Kabus, David<br />
Aus- und Fortbildungsgesellschaft Lauta <strong>GmbH</strong> (AFL)<br />
3B gemeinnützige Bildungs <strong>GmbH</strong>, Zehdenick<br />
Ausbildungsgemeinschaft Frankfurt (Oder)<br />
Technische Universität Berlin, Institut für Berufliche<br />
Bildung und Arbeitslehre<br />
Projektverbund "Praxislernen", Potsdam<br />
Bildungsinstitut für Umweltschutz und Wasser-<br />
wirtschaft Neubrandenburg e.V.<br />
Netzwerk Zukunft. Schule + Wirtschaft für<br />
<strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
Gesellschaft für berufliche Bildung KALKA mbH & Co.<br />
KG, Hohenbucko<br />
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes<br />
<strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Stadtverwaltung Prenzlau<br />
TÜV Akademie <strong>GmbH</strong>, Niederlassung Cottbus<br />
Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt e.V.,<br />
Magdeburg<br />
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes<br />
<strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
SOWI-Lehrinstitut Berufsausbildungs-<strong>GmbH</strong>,<br />
Neubrandenburg<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und<br />
Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
LAB Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände<br />
<strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Teltow<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
DGB Bildungswerk Berlin-<strong>Brandenburg</strong> e.V., Berlin<br />
Auszubildender<br />
191
Kaltbach, Simone<br />
Klitzing, Jörn<br />
Klitzke, Burkhard<br />
Knopf, Solvay<br />
Dr. Knuppe, Christel<br />
Koeppel, Tobias<br />
Konrad, Edda<br />
Kraus, Anja<br />
Kreklow, Wolfram<br />
Krell, Sylvia<br />
Krüger, Ulrich<br />
Prof. Dr. Kubiczek, Wolfgang<br />
Dr. Kühnert, Uwe<br />
Kurz, Irene<br />
Landsmann, Klaus-Dieter<br />
Lehmann, Werner<br />
Lemme, Agnes<br />
Leupold, Gunther<br />
Lutz, Mannigel<br />
Maertan-Hinrichs, Viola<br />
Meißner, Eva-Marie<br />
GFAW Gesellsellschaft für Arbeits- u. Wirtschafts-<br />
förderung Thüringen mbH, Erfurt<br />
Angermünder Bildungsverein e.V.<br />
isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und<br />
Dienstleistung mbH, Halle<br />
Ausbildungsverbund Teltow e.V. - Bildungszentrum<br />
der IHK Potsdam<br />
Landkreis Teltow-Fläming Oberstufenzentrum<br />
Abteilung II, Luckenwalde<br />
Qualifizierungsförderwerk Chemie <strong>GmbH</strong>, Senftenberg<br />
Bildungszentrum des Handels <strong>GmbH</strong>, Frankfurt (Oder)<br />
Fortbildungsakademie der Wirtschaft g<strong>GmbH</strong><br />
Akademie Cottbus, Groß Gaglow<br />
Bildungsgesellschaft mbH - Gemeinnützige<br />
Gesellschaft, Pritzwalk<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
Zentrum Aus- und Weiterbildung Ludwigsfelde <strong>GmbH</strong><br />
(ZAL)<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
BBJ Consult AG, Potsdam<br />
Berufsfortbildungswerk <strong>GmbH</strong> (bfw), Neubrandenburg<br />
PCK Raffinerie <strong>GmbH</strong>, Schwedt<br />
Handwerkskammer Potsdam<br />
Ausbildungsring Cottbus e.V.<br />
Europäisches Bildungswerk für Berufe und<br />
Gesellschaft e.V., <strong>Brandenburg</strong>/Havel<br />
Bildungsgesellschaft mbH - Gemeinnützige<br />
Gesellschaft, Pritzwalk<br />
BIAW <strong>Brandenburg</strong>isches Institut <strong>GmbH</strong> Aus und<br />
Weiterbildung von Zielgruppen, Potsdam<br />
192
Meyer, Andreas<br />
Michalak, Christiane<br />
Mitzloff, Volker<br />
Dr. Müller, Peter<br />
Müller, Heinz-Wilhelm<br />
Muschter, Bettina<br />
Nagel, Erich<br />
Neiser, Grit<br />
Neumann, Eberhard<br />
Neums, Manuela<br />
Dr. Nussbaum, Barbara<br />
Osterloh, Hans-Udo<br />
Ostermann, Ute<br />
Pahl, Veronika<br />
Pfister, Hildegard<br />
Pietsch, Rainer<br />
Pilarski, Grit<br />
Poeschel, Kerstin<br />
Pohl, Marion<br />
Pursche, Jens<br />
Rabe, Reiner<br />
LAB Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände<br />
<strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Teltow<br />
Ausbildungsring Potsdam-<strong>Brandenburg</strong> e.V., Potsdam<br />
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)<br />
Oberstufenzentrum Oberhavel 2, Hennigsdorf<br />
Agentur für Arbeit Eberswalde<br />
Fortbildungsakademie der Wirtschaft g<strong>GmbH</strong><br />
Akademie Cottbus, Groß Gaglow<br />
Staatliches Schulamt Perleberg<br />
Internationaler Bund e.V., Förder- und<br />
Integrationszentrum <strong>Brandenburg</strong>, Frankfurt (Oder)<br />
Initiative Südwest Sachsen e.V., Chemnitz<br />
Regionaler Förderverein e.V., Pinnow<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und<br />
Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Berufsförderungswerk <strong>Brandenburg</strong>, Mühlenbeck<br />
Amt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende,<br />
Prenzlau<br />
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin<br />
VHS- Bildungswerk für <strong>Brandenburg</strong> und Berlin<br />
<strong>GmbH</strong>, Eberswalde<br />
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes<br />
<strong>Brandenburg</strong>,Potsdam<br />
Ausbildungsverbund Teltow e.V. - Bildungszentrum<br />
der IHK Potsdam<br />
Technische Fachhochschule Wildau<br />
Sozialpädagogisches Institut Berlin- Walter May,<br />
Cottbus<br />
Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)<br />
Zentrum Aus- und Weiterbildung Ludwigsfelde <strong>GmbH</strong><br />
(ZAL)<br />
193
Ramcke-Lämmert, Dieter<br />
Rath, Ralf-Michael<br />
Reichel, Birgit<br />
Richter, Antje<br />
Ringel, Heidemarie<br />
Ritter, Volkmar<br />
Röder, Frank<br />
Rogalski, Steffen<br />
Rose, Jana<br />
Rose, Peter<br />
Rosenbaum, Ralf<br />
Sandner, Burgunde<br />
Schäfer-Schuttig, Irmgard<br />
Schallenberg, Renate<br />
Dr. Schaller, Rainer<br />
Scheschonk, Monika<br />
Dr. Schier, Friedel<br />
Schiller, Dieter<br />
Schmidt, Rainer<br />
Schnabel, Renate<br />
Scholz, Marina<br />
BBJ Consult AG, Potsdam<br />
Vereinigung der Unternemensverbände in Berlin und<br />
<strong>Brandenburg</strong> e.V., Berlin<br />
Berufliches Bildungszentrum der Prignitzer Wirtschaft<br />
e.V., Wittenberge<br />
Ausbildungsverbund Teltow e.V. Bildungszentrum der<br />
IHK Potsdam<br />
Ministerium für Wirtschaft des Landes <strong>Brandenburg</strong>,<br />
Potsdam<br />
Regionaler Förderverein e.V., Pinnow<br />
Qualifizierungs-Centrum der Wirtschaft <strong>GmbH</strong>,<br />
Eisenhüttenstadt<br />
Qualifizierungsförderwerk Chemie <strong>GmbH</strong>, Senftenberg<br />
Industrie- und Handelskammer Cottbus<br />
Straußberger Bildungs- und Sozialwerk e.V.<br />
E.ON edis AG Bildungszentrum <strong>Brandenburg</strong>/Havel<br />
Bildungszentrum des Handels <strong>GmbH</strong>, Frankfurt (Oder)<br />
Berufsbildungswerk im Oberlinhaus g<strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
ZAH Zukunftsbündnis Aus- und Weiterbildung im<br />
Handwerk e.V., Potsdam<br />
Z.E.I.T. <strong>GmbH</strong> Schwarzheide<br />
Ausbildungsring Cottbus e.V.<br />
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn<br />
Gewerbliche Aus- und Weiterbildungs <strong>GmbH</strong>,<br />
Premnitz<br />
Heidelberger Druckmaschinen AG,<br />
<strong>Brandenburg</strong>/Havel<br />
Zeuthener Akademie für Weiterbildung, Wildau<br />
194
Schöne, Sylvia<br />
Schühlein, Antje<br />
Schuldt, Anke<br />
Dr. Schuldt, Karsten<br />
Schüler, Uwe<br />
Schulz, Corinna<br />
Schulz, Vera<br />
Schulze, Werner<br />
Schulze, Ursula<br />
Schulze, Hans-Hermann<br />
Schur, Ilse<br />
Dr. Seibert, Holger<br />
Siebert, Jens<br />
Dr. Silbermann, Uwe<br />
Simon, Gabriela<br />
Dr. Smettan, Jürgen<br />
Smettan, Karin<br />
Spieß, Wolfgang<br />
Staack, Christiane<br />
Dr. Straube, Rainer<br />
Supp, Günter<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
Technologie und Gründerzentrum "Fläming <strong>GmbH</strong>",<br />
Belzig<br />
Industrie- und Handelskammer Cottbus<br />
PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung <strong>GmbH</strong>,<br />
Teltow<br />
Produktentwicklungs- , Initiativ- und Lehrzentrum<br />
Finsterwalde (PILZ) <strong>GmbH</strong><br />
Amt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende,<br />
Prenzlau<br />
VHS- Bildungswerk für <strong>Brandenburg</strong> und Berlin<br />
<strong>GmbH</strong>, Weiterbildungszentrum <strong>Brandenburg</strong><br />
Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk Gemeinnützige<br />
Gesellschaft<br />
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche<br />
Weiterbildung <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
Qualifizierungscentrum der Wirtschaft <strong>GmbH</strong>,<br />
Eisenhüttenstadt<br />
Verein zur Förderung von Bildung, Arbeit und sozialer<br />
Teilhabe (BAST e.V.), Berlin<br />
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Berlin-<br />
<strong>Brandenburg</strong>, Berlin<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
VHS- Bildungswerk für <strong>Brandenburg</strong> und Berlin<br />
<strong>GmbH</strong>, Weiterbildungszentrum <strong>Brandenburg</strong><br />
Konwips e.V., Dresden<br />
SSI Institut für Tourismusforschung und Marketing<br />
Berlin<br />
Industrie- und Handelskammer Potsdam<br />
Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft<br />
mbH (WEQUA), Lauchhammer<br />
Technologie und Berufsbildungszentrum (tbz)<br />
Königswusterhausen g<strong>GmbH</strong>, Bestensee<br />
Handwerkskammer Südthüringen, Suhl<br />
195
Swolinski, Elke<br />
Szczotko, Danuta<br />
Tenkhof, Ute<br />
Tessmann, Christine<br />
Teubert, Bodo<br />
Teuscher, Horst<br />
Umbsen, Peter<br />
Vogel, Matthias<br />
Vogelsang, Siegfried<br />
Wagner, Ulrich<br />
Dr. Wegner, Fritz<br />
Wendt, Thomas<br />
Weyer, Torsten<br />
Wiekert, Ingo<br />
Dr. Wonneberger, Magdalena<br />
Worrack, Christine<br />
Zaske, Michael<br />
Ziebarth, Hans-Joachim<br />
Ziegler, Dagmar<br />
Ziether, Wolfgang<br />
Zinnow, Frank<br />
Qualifizierungsförderwerk Chemie <strong>GmbH</strong>, Merseburg<br />
Qualifizierungscentrum der Wirtschaft <strong>GmbH</strong>,<br />
Eisenhüttenstadt<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und<br />
Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Landkreis Oder Spree, Amt für Grundsicherung und<br />
Beschäftigung, Beeskow<br />
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) <strong>GmbH</strong><br />
Kreishandwerkerschaft Cottbus/Spree Neiße, Cottbus<br />
u.bus <strong>GmbH</strong>, Berlin<br />
<strong>LASA</strong> <strong>Brandenburg</strong> <strong>GmbH</strong>, Potsdam<br />
Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen e.V.,<br />
Berlin<br />
Wirtschaftsforum Sächsisches Elbland e.V., Meißen<br />
Ausbildungsring Potsdam-<strong>Brandenburg</strong> e.V., Potsdam<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und<br />
Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)<br />
Zentrum für Sozialforschung Halle (Saale)<br />
EUROPANORAT Wirtschaftsakademie <strong>GmbH</strong>,<br />
Senftenberg<br />
Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft<br />
mbH (WEQUA), Lauchhammer<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und<br />
Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Landesverband der Lehrer an berufsbildenden<br />
Schulen <strong>Brandenburg</strong> e.V., Teltow<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und<br />
Familie des Landes <strong>Brandenburg</strong>, Potsdam<br />
Handwerkskammer Frankfurt/Oder<br />
EFA Bildungsakademie <strong>GmbH</strong>, Herzberg<br />
196