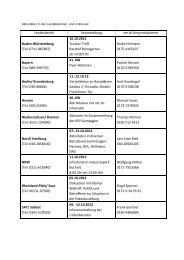Glossar zum Arbeitsrecht in Kirchen Arbeitgeberverbände ... - Ver.di
Glossar zum Arbeitsrecht in Kirchen Arbeitgeberverbände ... - Ver.di
Glossar zum Arbeitsrecht in Kirchen Arbeitgeberverbände ... - Ver.di
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Glossar</strong> <strong>zum</strong> <strong>Arbeitsrecht</strong> <strong>in</strong> <strong>Kirchen</strong><br />
<strong>Arbeitgeberverbände</strong>/„Dienstgeberverbände“<br />
E<strong>in</strong> Arbeitgeberverband ist e<strong>in</strong> freiwilliger Zusammenschluss von Arbeitgebern. Die<br />
durch das Grundgesetz geschützte Koalitionsfreiheit für <strong>di</strong>e Beschäftigten, sich <strong>in</strong><br />
Gewerkschaften zu organisieren, f<strong>in</strong>det im Zusammenschluss von Arbeitgebern zu<br />
eigenen <strong>Ver</strong>bänden ihre Entsprechung. Beide stellen e<strong>in</strong>en Ordnungsfaktor bei der<br />
Durchsetzung der jeweiligen Interessen dar, <strong>in</strong> dem sie Interessen formulieren und<br />
organisieren.<br />
Der <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) gründete sich im Jahr<br />
1996. Vorausgegangen war e<strong>in</strong> Arbeitskreis der „Top Ten“, <strong>di</strong>e Runde der Leitungen<br />
der zehn größten <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen der Bundesrepublik. Als <strong>Ver</strong>band der<br />
<strong>di</strong>akonischen Träger steht der VdDD außerhalb der Strukturen der Diakonie. Als<br />
Berufsverband ist er nicht geme<strong>in</strong>nützig und kann daher nicht Mitglied des DW der EKD<br />
werden, ohne dessen Geme<strong>in</strong>nützigkeit zu gefährden. Deshalb gründete der VdDD e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>nützige Tochter, den Bundesverband <strong>di</strong>akonischer E<strong>in</strong>richtungsträger V3D<br />
gGmbH, der als e<strong>in</strong> so genannter Fachverband Mitglied im Diakonischen Werk ist.<br />
Mit dem VdDD hat sich nach eigenem <strong>Ver</strong>ständnis e<strong>in</strong>e „Unternehmens<strong>di</strong>akonie“<br />
gegründet, <strong>di</strong>e sich durch <strong>di</strong>e offizielle <strong>Ver</strong>bandspolitik des DW der EKD nicht mehr<br />
vertreten gefühlt hat, nun ihre eigenen unternehmerischen Ziele besser organisieren und<br />
auch <strong>in</strong>nerhalb des DW der EKD vertreten will. Der VdDD trat der Bundesvere<strong>in</strong>igung<br />
der deutschen <strong>Arbeitgeberverbände</strong> (BdA) bei.<br />
Nach eigenen Angaben vertritt der VdDD <strong>in</strong>zwischen rund 130 E<strong>in</strong>richtungen und<br />
Träger sowie regionale Dienstgeberverbände mit etwa 250.000 Beschäftigten. Der<br />
VdDD als Bundesverband begreift sich nach eigenem Bekunden als „<strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igung von<br />
Unternehmen, <strong>di</strong>e sich als handelnde Kirche verstehen“. Für den VdDD ist dabei der so
genannte „Dritte Weg“ ohne Streikrecht und Koalitionsfreiheit für Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
und Arbeitnehmer e<strong>in</strong> Wettbewerbsvorteil.<br />
Die <strong>in</strong>haltlichen Vorstellungen des VdDD zur „Reform“ des kirchlichen <strong>Arbeitsrecht</strong>s<br />
stützen sich auf demnach auf <strong>di</strong>e Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit nahezu<br />
ausschließlich durch Senkung der Personalkosten, auf <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>führung der<br />
leistungsbezogenen <strong>Ver</strong>gütung mit Modellen e<strong>in</strong>er subjektiven Leistungsbeurteilung<br />
durch <strong>di</strong>e Vorgesetzten sowie auf <strong>di</strong>e Flexibilisierung des <strong>Arbeitsrecht</strong>s durch betriebliche<br />
Öffnungsklauseln. Desweiteren schweben dem VdDD Branchenregelungen und<br />
regionale Differenzierungen statt Flächentarife vor, e<strong>in</strong>Wahlrecht für <strong>di</strong>akonische<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Bezug auf <strong>di</strong>e anzuwendenden Tarife sowie <strong>di</strong>e „Dienstgeme<strong>in</strong>schaft“<br />
als handlungsleitendes Bild für alle Mitarbeiter. Das <strong>in</strong>haltliche Profil des VdDD<br />
entspricht damit dem alten Vorsteherpr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>er <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtung, der <strong>in</strong><br />
patriarchalischer Art entscheidet, was für se<strong>in</strong>e Mitarbeiter gut ist und was nicht.<br />
Seit se<strong>in</strong>er Gründung übt der VdDD zudem gezielt E<strong>in</strong>fluss auf <strong>di</strong>e <strong>Arbeitsrecht</strong>lichen<br />
Kommissionen (ARK) aus, etwa <strong>in</strong> dem versucht wurde, durch e<strong>in</strong>e Änderung der der<br />
Wahlordnung für <strong>di</strong>e Arbeitnehmervertreter ihm genehme <strong>Ver</strong>treter <strong>in</strong> der Kommission<br />
zu <strong>in</strong>stallieren.<br />
Die Arbeitnehmervertreter <strong>in</strong> den ARKen erfahren <strong>di</strong>e VdDD-<strong>Ver</strong>treter zunehmend als<br />
Hardl<strong>in</strong>er. Das Diakonische Werk gehört unter den Wohlfahrtsverbänden zu den<br />
Organisationen, <strong>di</strong>e das Niveau des TVöD und der Sozialbranche flächenmäßig am<br />
meisten unterschritten haben. Zunehmend s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>treter des Diakonischen Werkes<br />
dem Vorwurf des Lohndump<strong>in</strong>gs ausgesetzt. Bei der E<strong>in</strong>führung des Pflegem<strong>in</strong>destlohns<br />
etwa verh<strong>in</strong>derte der VdDD als e<strong>in</strong>ziger Wohlfahrtsverband zusammen mit dem<br />
privaten Arbeitgeberverband höhere M<strong>in</strong>destentgelte. Auch wird vom VdDD das Urteil<br />
des <strong>Kirchen</strong>gerichtshofs vom 9.Oktober 2006 <strong>zum</strong> <strong>Ver</strong>bot des auf Dauer angelegten<br />
E<strong>in</strong>satzes von Leiharbeitnehmern scharf kritisiert. Zeitarbeit sei demnach e<strong>in</strong><br />
„notwen<strong>di</strong>ger Bestandteil <strong>di</strong>akonischer Personalwirtschaft“. Dabei erwarten <strong>di</strong>e VdDD-<br />
E<strong>in</strong>richtungsleitungen, dass ihnen auch <strong>di</strong>e Mitarbeiter von (privaten)
Personalservicefirmen Loyalität schuldeten, da <strong>di</strong>e Dienstgeme<strong>in</strong>schaft ke<strong>in</strong><br />
arbeitsrechtliches sondern e<strong>in</strong> theologisches Pr<strong>in</strong>zip sei.<br />
Trotz des Auftretens als Arbeitgeberverband lehnt der VdDD nicht nur Tarifverträge ab,<br />
sondern bestreitet auch Koalitionsfreiheit und Streikrecht für <strong>di</strong>e Diakonie-Beschäftigten.<br />
Folgte man der Argumentation des VdDD würden <strong>in</strong> Deutschland 1,5 Millionen<br />
Beschäftigten der <strong>Kirchen</strong> maßgebliche Grundrechte vorenthalten.<br />
<strong>Arbeitsrecht</strong>liche Kommission (ARK)<br />
Die Richtl<strong>in</strong>ien für e<strong>in</strong> <strong>Arbeitsrecht</strong>sregelungsgesetz, das <strong>di</strong>e Aufgaben der ARK festlegt,<br />
wurden am 8. Oktober 1976 von der <strong>Kirchen</strong>konferenz der EKD beschlossen. Den<br />
Kerngedanken bildet <strong>di</strong>e paritätische Besetzung <strong>di</strong>eser Kommission aus Arbeitnehmern<br />
und Arbeitgebern. Diesem so genannten Dritten Weg, der auf dem Gedanken e<strong>in</strong>er<br />
konsensbetonten „Dienstgeme<strong>in</strong>schaft“ beruht, wird der Vorzug vor Tarifverträgen<br />
gegeben. Tarifverträge beruhten demnach auf den Pr<strong>in</strong>zipien von Kampf und<br />
Konfrontation, während <strong>di</strong>e ARKen nach dem Pr<strong>in</strong>zip der „<strong>Ver</strong>söhnung“ entsprechend<br />
dem <strong>Kirchen</strong>auftrag agierten. Der ursprüngliche Musterentwurf der EKD empfahl <strong>di</strong>e<br />
sogenannte „<strong>Ver</strong>bändelösung“, wonach <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>bände der Mitarbeiter und <strong>di</strong>e<br />
Gewerkschaften <strong>Ver</strong>treter <strong>in</strong> <strong>di</strong>e ARK senden sollten. Diese Regelung wurde von den<br />
Landeskirchen später sehr unterschiedlich umgesetzt. Hessen-Nassau hielt sich<br />
beispielsweise sehr eng an <strong>di</strong>ese Regelung und sah <strong>di</strong>e Besetzung der Arbeitnehmerseite<br />
ausschließlich durch Mitarbeiterverbände vor. Württemberg besetzte dagegen <strong>di</strong>e<br />
Arbeitnehmerseite ausschließlich durch <strong>di</strong>e Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der<br />
Mitarbeitervertretungen. E<strong>in</strong>e Ausnahme bildet <strong>di</strong>e Nordelbische Kirche, <strong>di</strong>e 1979<br />
Tarifverträge mit der Gewerkschaft abschloss.<br />
Mittlerweile gestalten sich <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>handlungen <strong>in</strong> den ARK immer schwieriger. Die<br />
<strong>Ver</strong>treter des Arbeitgeberverbands VdDD versuchen seit Jahren <strong>di</strong>e ARK zu dom<strong>in</strong>ieren.<br />
Nachdem es seit 2004 mehrere Jahre ke<strong>in</strong>e tabellenwirksamen Entgelterhöhungen gab,<br />
stellte <strong>di</strong>e Arbeitnehmerseite ihre Mitarbeit <strong>in</strong> der ARK befristet e<strong>in</strong>. In der Folgezeit kam
es zu zahlreichen betrieblichen Aktionen, Demonstrationen und im Mai sowie im<br />
Oktober 2009 sogar zu Streiks <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen. Gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>igten sich <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>treter der Arbeitnehmer <strong>in</strong> der ARK des DW der EKD und<br />
Arbeitnehmervertreter aus fast allen anderen regionalen ARK <strong>in</strong> der so genannten<br />
Gött<strong>in</strong>ger Erklärung (29. Oktober 2009) auf e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Vorgehen, erklärten<br />
e<strong>in</strong>vernehmlich den „Dritten Weg“ als gescheitert und forderten <strong>di</strong>e kirchlich-<br />
<strong>di</strong>akonischen Arbeitgeber auf, mit der Gewerkschaft ver.<strong>di</strong> Tarifverhandlungen<br />
aufzunehmen. Die Arbeitgeberseite konterte <strong>di</strong>esen Vorstoß auf Beschluss der<br />
Diakonischen Konferenz (16. Juni 2010) mit e<strong>in</strong>er Änderung der Wahlordnung zur ARK.<br />
Danach sollten Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften der Mitarbeitervertretungen (AGMAV) und<br />
<strong>Ver</strong>bände nur dann wählbar se<strong>in</strong>, wenn sie vorher erklärten, am „Dritten Weg“<br />
festhalten zu wollen. Unterdessen hat sich <strong>di</strong>e Arbeitgeberseite e<strong>in</strong>e als „Kommission<br />
der Willigen“ bezeichnete ARK selbst zusammengestellt. Die auf Basis der geänderten<br />
Wahlordnung neu gebildete ARK wird von Arbeitnehmern besetzt, <strong>di</strong>e überwiegend<br />
nicht unter den Geltungsbereich der Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien (AVR) des DW der EKD<br />
fallen. ver.<strong>di</strong> kommentierte <strong>di</strong>ese Entwicklung als Schritt „vom <strong>di</strong>akonischen <strong>zum</strong><br />
drakonischen <strong>Arbeitsrecht</strong>.“<br />
„Dienstgeme<strong>in</strong>schaft“<br />
Der Begriff der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft taucht <strong>zum</strong> ersten Mal <strong>in</strong> den fünfziger Jahren auf,<br />
um <strong>di</strong>e Sonderstellung der kirchlichen Arbeitsverhältnisse zu begründen. <strong>Ver</strong>störend ist,<br />
dass der Begriff der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft der „Allgeme<strong>in</strong>en Tarifordnung“ der<br />
Nationalsozialisten von 1938 entnommen wurde, ohne sich davon explizit abzugrenzen.<br />
Ziel der <strong>Kirchen</strong>juristen war, sich von der Betriebsverfassung und Tarifverträgen sowie<br />
von unabhängigen Gewerkschaften und e<strong>in</strong>em wirksamen Pr<strong>in</strong>zip der betrieblichen<br />
Interessensvertretung abzugrenzen. In der Folge wurden von der damaligen Adenauer-<br />
Regierung <strong>di</strong>e <strong>Kirchen</strong> vom Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes<br />
ausgenommen. Bis 1985 existierte <strong>in</strong> der theologischen Wissenschaft ke<strong>in</strong>e selbstän<strong>di</strong>ge<br />
Ausarbeitung zur kirchlichen Dienstgeme<strong>in</strong>schaft. Über den von Nicht-Theologen<br />
gebildeten Begriff der kirchlichen Dienstgeme<strong>in</strong>schaft besteht bis heute ke<strong>in</strong>
theologischer Konsens. <strong>Kirchen</strong><strong>in</strong>terne Kritiker bezeichnen <strong>di</strong>e Dienstgeme<strong>in</strong>schaft sogar<br />
als e<strong>in</strong> Phantom, sie sei als e<strong>in</strong>e „<strong>Ver</strong>mischung religiöser und arbeitsrechtlicher<br />
Dimensionen glaubenspraktisch unzulässig“.<br />
Im Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) heißt es: „Die geme<strong>in</strong>same <strong>Ver</strong>antwortung für<br />
den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verb<strong>in</strong>det Dienststellenleitungen und<br />
Mitarbeiter zu e<strong>in</strong>er Dienstgeme<strong>in</strong>schaft und verpflichtet sie zur vertrauensvollen<br />
Zusammenarbeit“. Dem entsprechen <strong>di</strong>e Begriffe „Dienstgeber“ und „Dienstnehmer“.<br />
Aus dem juristischen Begriff wurde nun e<strong>in</strong> religiöses Symbol, das auch <strong>di</strong>e Mitarbeiter<br />
und <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretungen verpflichten und gleichzeitig Gestaltungsansprüche der<br />
Gewerkschaften <strong>in</strong> kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen zurückweisen soll.<br />
Wie une<strong>in</strong>heitlich der Begriff Dienstgeme<strong>in</strong>schaft im Übrigen ausgelegt wird, zeigt <strong>di</strong>e<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung um den E<strong>in</strong>satz von Leiharbeitnehmern <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonischen<br />
E<strong>in</strong>richtungen. Während der <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD)<br />
ke<strong>in</strong>e Probleme mit dem umfangreichen E<strong>in</strong>satz von Leiharbeitnehmern hat, sieht der<br />
<strong>Kirchen</strong>gerichtshof der EKD <strong>di</strong>es ganz anders. In e<strong>in</strong>em Grundsatzurteil von 2006 führt<br />
er aus, <strong>di</strong>e Leiharbeit widerspreche durch <strong>di</strong>e stän<strong>di</strong>ge Spaltung <strong>in</strong> Kernbelegschaft und<br />
Leiharbeitnehmern den Pr<strong>in</strong>zipien der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft.<br />
Erster, Zweiter und „Dritter Weg“<br />
Der sogenannte Erste Weg bezeichnet <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>seitige Festlegung des <strong>Arbeitsrecht</strong>s durch den<br />
kirchlichen Arbeitgeber und wurde noch <strong>in</strong> den siebziger Jahren praktiziert. Dabei beschließt<br />
alle<strong>in</strong> <strong>di</strong>e Synode über das für <strong>di</strong>e kirchlichen Mitarbeiter geltende <strong>Arbeitsrecht</strong>.<br />
Der Zweite Weg ist das Modell des Tarifvertrags. Zwischen zwei autonomen und vone<strong>in</strong>ander<br />
unabhängigen Tarifparteien wird e<strong>in</strong> Tarifvertrag abgeschlossen, der unmittelbar und zw<strong>in</strong>gend<br />
für den vere<strong>in</strong>barten Geltungsbereich anzuwenden ist. Hauptstreitpunkt beim Zweiten Weg ist<br />
das Streikrecht. Gewerkschaften und Arbeitnehmer können aus ihrem Selbstverständnis heraus<br />
darauf nicht verzichten. Umgekehrt tut sich <strong>di</strong>e Kirche ebenso schwer mit der Anerkennung des
Rechtes auf Arbeitskampf für ihren Bereich. Kompromisse wie bei dem Tarifvertrag <strong>in</strong> der<br />
Nordelbischen Kirche s<strong>in</strong>d aber möglich.<br />
Der Dritte Weg ist <strong>di</strong>e <strong>Arbeitsrecht</strong>ssetzung durch→ <strong>Arbeitsrecht</strong>liche Kommissionen (ARK), <strong>di</strong>e<br />
paritätisch besetzt s<strong>in</strong>d. Im Falle e<strong>in</strong>er Nichte<strong>in</strong>igung ist e<strong>in</strong>e Schlichtung b<strong>in</strong>dend.<br />
Über das <strong>Arbeitsrecht</strong>setzungsverfahren beschließt für den Bereich der EKD <strong>di</strong>e Synode als<br />
gesetzgebendes Organ, das sich aus gewählten <strong>Kirchen</strong>mitgliedern zusammensetzt. Für den<br />
Bereich der Diakonie wird das <strong>Ver</strong>fahren durch deren oberste Leitungsorgane festgelegt, <strong>di</strong>e<br />
zwangsläufig fast ausschließlich aus Leitungspersonen von E<strong>in</strong>richtungen oder des <strong>Ver</strong>bands<br />
bestehen.<br />
Es gibt jedoch auch <strong>Kirchen</strong>gemäße Tarifverträge wie sie bereits 1961 von der Evangelisch-<br />
Lutherischen Landeskirche mit den Gewerkschaften abgeschlossen wurden. Die Nordelbische<br />
Kirche setzte <strong>di</strong>esen Weg 1979 fort und vere<strong>in</strong>barte mit den Gewerkschaften e<strong>in</strong>en<br />
Tarifvertrag, aus dem später der Kirchliche Tarifvertrag der Diakonie (KTD) wurde. Der KTD wird<br />
zu großen Teilen als Vorlage für e<strong>in</strong>en überarbeiteten und modernisierten Tarifvertrag für den<br />
kirchlich/<strong>di</strong>akonischen Bereich angesehen.<br />
Nach kontroversen Diskussionen <strong>in</strong>nerhalb der Kirche über den möglichen Abschluss von<br />
Tarifverträgen organisierten sich <strong>di</strong>akonischen Arbeitgeber <strong>in</strong> <strong>Arbeitgeberverbände</strong>n (-><br />
<strong>Arbeitgeberverbände</strong>) und vertreten zunehmend entschiedener re<strong>in</strong> wirtschaftliche Interessen <strong>in</strong><br />
den <strong>Arbeitsrecht</strong>lichen Kommissionen. Die 1978 von der EKD formulierten Anforderungen an<br />
den Dritten Weg verschw<strong>in</strong>den damit <strong>in</strong> der Praxis.<br />
Nach dem Scheitern des Dritten Weges auf Bundesebene der ARK des DW der EKD<br />
(<strong>Arbeitsrecht</strong>liche Kommission) fordern ver.<strong>di</strong> und fast alle Arbeitnehmervertreter <strong>in</strong> der ARK <strong>di</strong>e<br />
Kirche und Diakonie auf, mit der Gewerkschaft Tarifverhandlungen aufzunehmen. Begleitet<br />
wird <strong>di</strong>ese Entwicklung von zunehmenden Streiks <strong>in</strong> den <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen.
Nach aktuellen Schätzungen arbeiten heute 1,5 Millionen Mitarbeiter bei den <strong>Kirchen</strong> <strong>in</strong><br />
Deutschland. Dabei bef<strong>in</strong>den sich etwa im <strong>Ver</strong>gleich zu den 20er Jahren nur noch sehr wenige<br />
Ordensschwestern <strong>in</strong> kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen. Der Großteil der Mitarbeiter <strong>in</strong> der Diakonie<br />
und Caritas sehen <strong>in</strong> ihrem „kirchlichen Dienstgeber“ e<strong>in</strong>en Arbeitgeber wie jeden anderen<br />
auch. Besonders <strong>in</strong> Großstädten s<strong>in</strong>d viele Beschäftigte <strong>in</strong> den Krankenhäusern konfessionslos.<br />
Noch problematischer für den Gedanken der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft ist <strong>di</strong>e Situation <strong>in</strong> vielen<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Ostdeutschland, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e <strong>Kirchen</strong> vom Staat übernommen haben, <strong>in</strong> denen der<br />
Anteil der <strong>Kirchen</strong>mitglieder nicht selten weniger als 50 Prozent beträgt.<br />
Ohneh<strong>in</strong> unterscheiden sich <strong>di</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen und <strong>di</strong>e äußeren Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zur<br />
F<strong>in</strong>anzierung <strong>in</strong> den konfessionellen Krankenhäusern, Altenheimen, E<strong>in</strong>richtungen der K<strong>in</strong>der-,<br />
Jugend- und Beh<strong>in</strong>dertenhilfe nicht vom öffentlichen Bereich. Die früher <strong>in</strong> konfessionellen<br />
E<strong>in</strong>richtungen möglicherweise vorhandenen Begründungen für den Sonderweg des Dritten<br />
Wegs treffen heute <strong>in</strong> den allermeisten E<strong>in</strong>richtungen nicht mehr zu.<br />
Die Gewerkschaften kritisieren den Dritten Weg als ungeeignet, um Tarifverträge als kollektive<br />
<strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>barungen zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften zu ersetzen.<br />
Tarifverträge gelten für den vere<strong>in</strong>barten Bereich zw<strong>in</strong>gend und s<strong>in</strong>d rechtlich e<strong>in</strong>klagbar<br />
(Tarifvertrag). Die Regelungen des Dritten Weges gelten dagegen nur, wenn sie ausdrücklich im<br />
Arbeitsvertrag vere<strong>in</strong>bart werden.<br />
Zudem zeigt der Beschluss der Diakonischen Konferenz vom Juni 2010 <strong>di</strong>e Ungleichheit der<br />
<strong>Ver</strong>handlungspartner. Die Arbeitgeberseite hatte se<strong>in</strong>erzeit e<strong>in</strong>seitig <strong>di</strong>e Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
geändert und <strong>di</strong>e unliebsamen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften der Mitarbeitervertretungen (AGMAV)<br />
aus der ARK ausgeschlossen. Im Übrigen wird auch <strong>in</strong> der Evangelischen und der Katholischen<br />
Kirche <strong>di</strong>e zweifelhafte Rolle des „Dritten Wegs“ zunehmend kontrovers <strong>di</strong>skutiert.<br />
Insbesondere <strong>di</strong>e aktuellen Entwicklungen <strong>in</strong> den <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen machen den<br />
Dritten Weg unglaubwür<strong>di</strong>g. Der <strong>di</strong>akonische Arbeitgeberverband VdDD möchte <strong>di</strong>e Gehälter<br />
unter das branchenübliche Niveau absenken. Dazu benutzt er gezielt das Instrumentarium des<br />
Dritten Weges.
<strong>Kirchen</strong>autonomie<br />
Die <strong>Kirchen</strong>autonomie bzw. das kirchliche Selbstbestimmungsrecht leiten sich ab aus<br />
Art. 140 GG, der wiederum auf <strong>di</strong>e Art. 136 - 139 und 141 der Weimarer<br />
Reichsverfassung (WRV) verweist. In Art. 137 WRV ist ausgeführt: „Es besteht ke<strong>in</strong>e<br />
Staatskirche (…) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten<br />
selbstän<strong>di</strong>g <strong>in</strong>nerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes.“ Das Grundgesetz<br />
br<strong>in</strong>gt damit e<strong>in</strong>erseits <strong>di</strong>e Trennung von Staat und Kirche <strong>zum</strong> Ausdruck, betont aber<br />
auch, dass Staat und Kirche ke<strong>in</strong>e zwei vone<strong>in</strong>ander unabhängige Bereiche s<strong>in</strong>d.<br />
Die <strong>in</strong> Art. 4 GG garantierte Religionsfreiheit geht nach herrschender Rechtsme<strong>in</strong>ung<br />
über <strong>di</strong>e <strong>in</strong><strong>di</strong>viduelle Religionsfreiheit h<strong>in</strong>aus. Sie gewährleistet auch, dass <strong>di</strong>e <strong>Kirchen</strong><br />
über ihr religiöses Leben und Wirken frei entscheiden können. Zur Religionsausübung<br />
gehöre auch das Recht auf eigene Festlegung von Organisation und <strong>Ver</strong>waltung der<br />
<strong>Kirchen</strong>. Wie weit sich <strong>di</strong>eses Recht auch auf <strong>di</strong>e eigene Ausgestaltung des kirchlichen<br />
<strong>Arbeitsrecht</strong>s erstreckt, ist strittig.<br />
Historisch betrachtet s<strong>in</strong>d Staat und Kirche <strong>in</strong> Deutschland erst mit der E<strong>in</strong>führung der<br />
Weimarer <strong>Ver</strong>fassung von 1919 getrennt worden. Das dort verankerte<br />
Selbstbestimmungsrecht beschränkte sich dabei auf <strong>di</strong>e Unabhängigkeit vom Staat. So<br />
gab es im Betriebsrätegesetz von 1920 ke<strong>in</strong>e Ausnahmen für <strong>di</strong>e <strong>Kirchen</strong>, für <strong>di</strong>e<br />
kirchlich Beschäftigten galt das Streikrecht wie für alle anderen Arbeitnehmer auch. So<br />
streikten etwa im Jahr 1920 <strong>di</strong>e Friedhofsarbeiter <strong>in</strong> Hamburg für 22 Tage und im selben<br />
Jahr wurde <strong>in</strong> Bethel e<strong>in</strong> Betriebsrat gewählt.<br />
In der Nachkriegszeit gelang es den <strong>Kirchen</strong>, <strong>in</strong>folge <strong>in</strong>tensiver Lobbyarbeit bei der<br />
Adenauer-Regierung nicht unter das Betriebsverfassungsgesetz und das<br />
Bundespersonalvertretungsgesetz zu fallen.<br />
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes erstreckt sich der Begriff der<br />
Religionsgeme<strong>in</strong>schaft nach Artikel 137 WRV auch auf E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie und<br />
der Caritas. Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht bezieht sich „auf alle der Kirche <strong>in</strong><br />
bestimmter Weise zugeordneten E<strong>in</strong>richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,
wenn sie nach kirchlichem Selbstverständnis ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe<br />
entsprechend berufen s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong> Stück Auftrag der Kirche <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Welt wahrzunehmen<br />
und zu erfüllen“ (B<strong>Ver</strong>fGE 46,73). Unterdessen untergräbt <strong>di</strong>e Bildung des<br />
Arbeitgeberverbandes VdDD zunehmend <strong>di</strong>e Rechtfertigung für Ausnahmeregelungen<br />
zugunsten der Diakonie. Bei vielen Mitarbeitern <strong>in</strong> der „Unternehmens<strong>di</strong>akonie“<br />
entsteht der E<strong>in</strong>druck, dass ihre E<strong>in</strong>richtungen nur noch deshalb Mitglied im<br />
Diakonischen Werk s<strong>in</strong>d, damit <strong>di</strong>e Arbeitgeber das für sie sehr günstige kirchliche<br />
<strong>Arbeitsrecht</strong> zur Personalkostensenkung nutzen können. Letztendlich macht <strong>di</strong>e<br />
Unternehmens<strong>di</strong>akonie den ursprünglichen Gedanken der Diakonie als Wesensäußerung<br />
der Kirche unglaubwür<strong>di</strong>g.<br />
Auch hat das Geme<strong>in</strong>schaftsrecht der Europäischen Union <strong>in</strong> den letzten Jahren immer<br />
mehr an Bedeutung gewonnen für <strong>di</strong>e kirchlichen Arbeitnehmer. Die<br />
verfassungsrechtliche Sonderstellung der <strong>Kirchen</strong> <strong>in</strong> Deutschland ist <strong>in</strong>nerhalb Europas<br />
e<strong>in</strong>malig. Die <strong>Kirchen</strong> <strong>in</strong> Deutschland kommen <strong>in</strong> zwei wesentlichen Bereichen immer<br />
mehr <strong>in</strong> Bedrängnis. E<strong>in</strong>erseits ist es unbestritten, dass <strong>di</strong>e Richtl<strong>in</strong>ien der EU, soweit <strong>in</strong><br />
<strong>di</strong>esen ke<strong>in</strong>e explizite Ausnahmeregelung vorgesehen ist, auch <strong>in</strong> den <strong>Kirchen</strong> und ihren<br />
E<strong>in</strong>richtungen Anwendung f<strong>in</strong>den. Als Beispiel sei nur <strong>di</strong>e Richtl<strong>in</strong>ie der EU <strong>zum</strong><br />
Betriebsübergang erwähnt, <strong>di</strong>e den Arbeitnehmervertretungen weitgehende<br />
Informations- und Konsultationsrechte e<strong>in</strong>räumt. Andererseits sehen sich <strong>di</strong>e großen<br />
E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie und Caritas verstärkt kritischen Fragen der privaten <strong>in</strong>- und<br />
auslän<strong>di</strong>schen Konkurrenz <strong>in</strong> ihren jeweiligen Betätigungsbereichen ausgesetzt, <strong>di</strong>e<br />
argwöhnt, <strong>di</strong>e kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen verschaffen sich durch ihre <strong>in</strong> Deutschland<br />
verfassungsrechtlich geregelte Sonderstellung e<strong>in</strong>en unlauteren Konkurrenzvorteil.<br />
Streikrecht <strong>in</strong> der Kirche<br />
Das Selbstbestimmungsrecht der <strong>Kirchen</strong> wurde 1919 mit der Weimarer<br />
Reichsverfassung e<strong>in</strong>geführt und zielte gemäß Artikel 135 - 141 auf <strong>di</strong>e Unabhängigkeit<br />
vom Staat. Im Betriebsrätegesetz von 1920 existierte ke<strong>in</strong>e Sonderregelung für <strong>di</strong>e<br />
<strong>Kirchen</strong>, für <strong>di</strong>e kirchlich Beschäftigten galt das Streikrecht wie für alle anderen
Arbeitnehmer auch. So streikten etwa im Jahr 1920 <strong>di</strong>e Friedhofsarbeiter <strong>in</strong> Hamburg<br />
für 22 Tage, und für 2.000 Berl<strong>in</strong>er Friedhofsarbeiter wurde ebenfalls e<strong>in</strong> Tarifvertrag<br />
abgeschlossen. Das Selbstbestimmungsrecht der <strong>Kirchen</strong> wurde im Grundgesetz der<br />
Bundesrepublik Deutschland erneut festgeschrieben, <strong>in</strong>dem <strong>di</strong>e Artikel 136 - 139 und<br />
141 der Weimarer Reichsverfassung <strong>in</strong> Artikel 140 des Grundgesetzes aufgenommen<br />
wurden. In der aktuellen Ause<strong>in</strong>andersetzung um das Streikrecht beruft sich <strong>di</strong>e Kirche<br />
auf <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>schlägigen Artikel der Weimarer <strong>Ver</strong>fassung, obwohl <strong>di</strong>ese <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen<br />
Kontext entstanden s<strong>in</strong>d (<strong>Kirchen</strong>autonomie)<br />
In der Ause<strong>in</strong>andersetzung um <strong>di</strong>e Absenkung der Tarife (<strong>Arbeitsrecht</strong>liche Kommission)<br />
hatte ver.<strong>di</strong> <strong>in</strong> den letzten Jahren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen zu (Warn-<br />
)Streiks aufgerufen. Ungeachtet ihres Ausmaßes stellten <strong>di</strong>ese Streiks für <strong>di</strong>e<br />
<strong>di</strong>akonischen Arbeitnehmer ebenso wie für <strong>di</strong>e <strong>di</strong>akonischen Arbeitgeber e<strong>in</strong> Novum<br />
dar. In der Folge riefen <strong>di</strong>e Arbeitgeber <strong>di</strong>e Arbeitsgerichte an und wollten ver.<strong>di</strong><br />
Streikaufrufe <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen verbieten lassen.<br />
In e<strong>in</strong>em erst<strong>in</strong>stanzlichen Urteil vom kam das Arbeitsgericht Bielefeld am 3. März 2010<br />
zu dem Ergebnis, dass <strong>di</strong>e Gewerkschaft ver.<strong>di</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen nicht <strong>zum</strong><br />
Streik aufrufen dürfe. Das Arbeitsgericht g<strong>in</strong>g davon aus, dass dem<br />
Selbstbestimmungsrecht der Kirche gegenüber dem Streikrecht aus Artikel 9 Abs. 3 GG<br />
der Vorrang e<strong>in</strong>zuräumen sei. Entscheidend sei das Gebot der Wahrung der<br />
Arbeitskampfparität. Die Kirche verzichte aus ihrem Selbstverständnis heraus auf<br />
Aussperrungen, dadurch sei im Falle e<strong>in</strong>es Streiks ke<strong>in</strong>e Kampfparität gewährleistet.<br />
Im Fall der Klage des Marburger Bundes kam das Arbeitsgericht Hamburg am 2.<br />
September 2010 zu e<strong>in</strong>em gegenteiligen Ergebnis. Das gesetzlich garantierte Streikrecht<br />
sei höher zu bewerten als das kirchliche Selbstbestimmungsrecht. Streik sei e<strong>in</strong><br />
anerkanntes Kampfmittel. Erst dadurch sei es den Arbeitnehmern möglich, mit den<br />
Arbeitgebern auf Augenhöhe zu verhandeln. Selbst wenn <strong>di</strong>e Kirche auf <strong>di</strong>e<br />
Aussperrung verzichte, könne sie den Streik „aussitzen“, Streikbrecher e<strong>in</strong>setzen oder
estreikte Arbeitsbereiche stilllegen. Im Übrigen könne im E<strong>in</strong>zelfall e<strong>in</strong> unangemessener<br />
Streik untersagt werden.<br />
Mittlerweile hat auch das Landesarbeitsgericht Hamm <strong>in</strong> dem oben beschriebenen<br />
Bielefelder Fall, der sich auf Streiks <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonischen E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen und Niedersachsen bezog, e<strong>in</strong> bemerkenswertes Urteil gefällt: Danach sei der<br />
von den <strong>Kirchen</strong> beschrittene "Dritte Weg" ke<strong>in</strong> Äquivalent zu<br />
Tarifvertragsverhandlungen. Damit sei <strong>di</strong>e Klage abzuweisen, heißt es <strong>in</strong> der<br />
Begründung unter anderem.<br />
Gewerkschaftsnahe Positionen weisen außerdem darauf h<strong>in</strong>, dass sich <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren <strong>di</strong>e Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft besonders <strong>in</strong> der Diakonie und der<br />
Caritas erheblich qualitativ verändert habe. Nachdem heute <strong>di</strong>e <strong>Kirchen</strong> fast e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb<br />
Millionen Mitarbeiter beschäftigen und <strong>in</strong>sbesondere im Osten ehemalige staatliche<br />
E<strong>in</strong>richtungen übernommen haben, <strong>in</strong> denen der Anteil der <strong>Kirchen</strong>mitglieder sehr<br />
ger<strong>in</strong>g ist, sei m<strong>in</strong>destens zwischen der verfassten Kirche und der Diakonie bzw. Caritas<br />
zu <strong>di</strong>fferenzieren. Auch <strong>di</strong>e äußeren Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen gleichen sich denen im<br />
kommunalen Bereich immer mehr an, wenn sie nicht sogar durch e<strong>in</strong>e<br />
Schlechterstellung der Beschäftigten <strong>in</strong> Diakonie und Caritas gekennzeichnet sei. Die<br />
Erwerbsorientierung der Mitarbeiter dom<strong>in</strong>iere, der leitende Gedanke der<br />
„Dienstgeme<strong>in</strong>schaft“ im S<strong>in</strong>ne der christlichen Unterweisung <strong>in</strong> der verfassten Kirche<br />
sei im Arbeitsalltag nicht mehr erfahrbar. Wenn sich <strong>di</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> Diakonie<br />
und Caritas denen vergleichbarer E<strong>in</strong>richtungen im öffentlichen Dienst und im privaten<br />
Bereich immer mehr anpassen, ist <strong>di</strong>e rechtliche Schlechterstellung der Beschäftigten <strong>in</strong><br />
Diakonie und Caritas, <strong>in</strong>sbesondere <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>weigerung des auch das Streikrecht<br />
umfassenden Grundrechts auf Koalitionsfreiheit nicht mehr zu rechtfertigen.<br />
Nicht zuletzt hat auch <strong>di</strong>e Gründung des Arbeitgeberverbandes VdDD zu e<strong>in</strong>er<br />
<strong>Ver</strong>selbstän<strong>di</strong>gung der sich selbst so nennenden Unternehmens<strong>di</strong>akonie geführt. Große<br />
<strong>di</strong>akonische E<strong>in</strong>richtungen agieren wie Sozialkonzerne, weigern sich aber nach wie vor<br />
mit den Gewerkschaften Tarifverträge abzuschließen, weil <strong>di</strong>es angeblich gegen <strong>di</strong>e
Pr<strong>in</strong>zipien der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft verstoße. Aus Sicht von ver.<strong>di</strong> geht es dem<br />
Arbeitgeberverband VdDD nur darum, sich mit Hilfe des kirchlichen <strong>Arbeitsrecht</strong>s<br />
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.<br />
E<strong>in</strong>en Kompromiss <strong>in</strong> der Frage „Tarifrecht oder nicht“ hatten <strong>di</strong>e Nordelbische Kirche<br />
und <strong>di</strong>e Gewerkschaften bereits 1979 im Abschluss von kirchengemäßen Tarifverträgen<br />
erzielt. In e<strong>in</strong>em Grundlagentarifvertrag versicherten <strong>di</strong>e Gewerkschaften und <strong>di</strong>e<br />
<strong>Kirchen</strong>, dass sie gegenseitig ihre jeweiligen Besonderheiten anerkennen, e<strong>in</strong>e<br />
dauerhafte (aber kündbare) Friedenspflicht vere<strong>in</strong>baren und gleichzeitig auch <strong>di</strong>e für das<br />
gewerkschaftliche Selbstverständnis unannehmbare Institution der Zwangsschlichtung<br />
ausschließen würden. Allerd<strong>in</strong>gs hatte <strong>di</strong>eser Kompromiss ke<strong>in</strong>e Signalwirkung. Das<br />
Diakonische Werk der EKD, das unter zunehmenden E<strong>in</strong>fluss des Arbeitgeberverbands<br />
VdDD steht, lehnt heute den Abschluss von kirchengemäßen Tarifverträgen<br />
entschiedener ab als noch <strong>in</strong> den neunziger Jahren. Bei ver.<strong>di</strong> hat <strong>di</strong>ese Entwicklung zu<br />
e<strong>in</strong>er Rückbes<strong>in</strong>nung auf gewerkschaftliche Grundpositionen geführt, so dass der<br />
freiwillige befristete Streikverzicht heute als sehr problematisch angesehen wird.<br />
Erhard Schleitzer/Jan Jurczyk (red. Bearbeitung)<br />
Literatur: Praxis der Mitarbeitervertretung von A bis Z, Erhard Schleitzer u.a.,<br />
Frankfurt/M., 3. Auflage, 2011