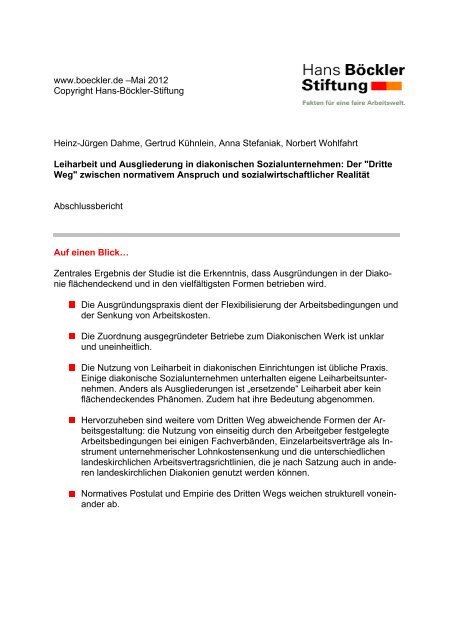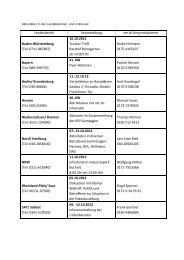Studie: Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen ... - Ver.di
Studie: Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen ... - Ver.di
Studie: Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen ... - Ver.di
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.boeckler.de –Mai 2012<br />
Copyright Hans-Böckler-Stiftung<br />
He<strong>in</strong>z-Jürgen Dahme, Gertrud Kühnle<strong>in</strong>, Anna Stefaniak, Norbert Wohlfahrt<br />
<strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ausgliederung</strong> <strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialunternehmen: Der "Dritte<br />
Weg" zwischen normativem Anspruch <strong>und</strong> sozialwirtschaftlicher Realität<br />
Abschlussbericht<br />
Auf e<strong>in</strong>en Blick…<br />
Zentrales Ergebnis der <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> ist <strong>di</strong>e Erkenntnis, dass Ausgründungen <strong>in</strong> der Diakonie<br />
flächendeckend <strong>und</strong> <strong>in</strong> den vielfältigsten Formen betrieben wird.<br />
Die Ausgründungspraxis <strong>di</strong>ent der Flexibilisierung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />
der Senkung von Arbeitskosten.<br />
Die Zuordnung ausgegründeter Betriebe zum Diakonischen Werk ist unklar<br />
<strong>und</strong> une<strong>in</strong>heitlich.<br />
Die Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> <strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen ist übliche Praxis.<br />
E<strong>in</strong>ige <strong>di</strong>akonische Sozialunternehmen unterhalten eigene <strong>Leiharbeit</strong>sunternehmen.<br />
Anders als <strong>Ausgliederung</strong>en ist „ersetzende“ <strong>Leiharbeit</strong> aber ke<strong>in</strong><br />
flächendeckendes Phänomen. Zudem hat ihre Bedeutung abgenommen.<br />
Hervorzuheben s<strong>in</strong>d weitere vom Dritten Weg abweichende Formen der Arbeitsgestaltung:<br />
<strong>di</strong>e Nutzung von e<strong>in</strong>seitig durch den Arbeitgeber festgelegte<br />
Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen bei e<strong>in</strong>igen Fachverbänden, E<strong>in</strong>zelarbeitsverträge als Instrument<br />
unternehmerischer Lohnkostensenkung <strong>und</strong> <strong>di</strong>e unterschiedlichen<br />
landeskirchlichen Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien, <strong>di</strong>e je nach Satzung auch <strong>in</strong> anderen<br />
landeskirchlichen Diakonien genutzt werden können.<br />
Normatives Postulat <strong>und</strong> Empirie des Dritten Wegs weichen strukturell vone<strong>in</strong>ander<br />
ab.
<strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ausgliederung</strong><br />
<strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialunternehmen:<br />
Der "Dritte Weg" zwischen normativem Anspruch <strong>und</strong><br />
He<strong>in</strong>z-Jürgen Dahme<br />
Gertrud Kühnle<strong>in</strong><br />
Anna Stefaniak<br />
Norbert Wohlfahrt<br />
sozialwirtschaftlicher Realität<br />
Abschlussbericht e<strong>in</strong>es Forschungsprojektes im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf<br />
Bochum-Dortm<strong>und</strong>-Magdeburg, Mai 2012<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorbemerkung<br />
1. Der "Dritte Weg": Konzept <strong>und</strong> Entwicklung 7<br />
1.1 Besonderheiten des Arbeitsrechts <strong>in</strong> kirchlichen Sozialverbänden: Der "Dritte Weg" 7<br />
1.2 Zur theologischen Legitimierung der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" 8<br />
1.3 Die Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts: der <strong>Ver</strong>such, der Erosion des<br />
"Dritten Weges" entgegen zu wirken<br />
14<br />
1.4 Die AVR Diakonie im Überblick 17<br />
2. Die Ökonomisierung des Sozialsektors <strong>und</strong> ihre Folgen für <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>heit des "Dritten Wegs 21<br />
2.1 Satzungen landeskirchlicher Diakonien im Überblick 21<br />
2.2 Die Ökonomisierung des Sozialsektors: Folgen für <strong>di</strong>akonische Sozialunternehmen 24<br />
2.2.1 Geschäftsfeldpolitik 25<br />
2.2.2 Trägerkonzentration <strong>und</strong> Aufgabe des Territorialpr<strong>in</strong>zips 25<br />
2.2.3 <strong>Ausgliederung</strong> 26<br />
2.2.4 Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> 27<br />
3. Zur gegenwärtigen Situation <strong>in</strong> den Diakonischen Werken der Landeskirchen –<br />
Ergebnisse empirischer Erhebungen<br />
33<br />
3.1 Diakonisches Werk Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe 33<br />
3.2 Diakonie <strong>in</strong> Niedersachsen 35<br />
3.3 Diakonie Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz 38<br />
3.4 Diakonisches Werk Schleswig-Holste<strong>in</strong> 40<br />
3.5 Diakonisches Werk Württemberg (DWW) 43<br />
3.6 Das Diakonische Werk Bayern 49<br />
3.7 Die Anwendung des Ersten Weges bei <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Fachverbänden: das Beispiel<br />
Christliches Jugenddorf Deutschland (CJD)<br />
52<br />
4. Fallstu<strong>di</strong>e: Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland . Durch Personalkostenmanagement <strong>und</strong><br />
Ausgründungen auf dem Weg zum Sozialwirtschafts-Champion<br />
56<br />
4.1 Zur Lage der Kirche <strong>und</strong> Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland 56<br />
4.2 Zur Lage der Diakonie <strong>in</strong> der DDR <strong>und</strong> zum Zeitpunkt der Wiedervere<strong>in</strong>igung 60<br />
4.3 Sozialwirtschaftliche Bedeutung der Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland 63<br />
4.4 Ausgründungen <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>: Instrumente der Kostenmanagements 72<br />
4.4.1 Ausgründungen: Servicegesellschaften <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> 72<br />
4.4.2 Die AVR als Instrument des Kostenmanagements 80<br />
4.4.3 Schlussbemerkung 85<br />
2
5. Argumentationen gegen e<strong>in</strong>en „Tarifvertrag Soziales“ 86<br />
6. Fazit <strong>und</strong> Ausblick 89<br />
7. Forschungsperspektiven 97<br />
Anhang 99<br />
I. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Befragung von Mitarbeitervertretungen zu <strong>Ausgliederung</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong><br />
II. Lohndump<strong>in</strong>g <strong>in</strong> der Diakonie? Zur Bezahlung der Mitarbeitenden.<br />
Ergebnisse e<strong>in</strong>er Umfrage<br />
III. Beispiel: Arbeitsvertrag<br />
IV. Übersichtskarte: Tarife <strong>in</strong> der Diakonie<br />
3
Vorbemerkung<br />
Die Durchsetzung e<strong>in</strong>er Sozialwirtschaft im tra<strong>di</strong>tionell subsi<strong>di</strong>är-korporatistisch ausgestalteten<br />
Sozialsystem <strong>in</strong> Deutschland hat seit Anfang der 1990er Jahre zu e<strong>in</strong>er gr<strong>und</strong>legenden<br />
<strong>Ver</strong>änderung der Produktion sozialer Dienste geführt. In Folge dessen haben sich aus geme<strong>in</strong>nützigen<br />
Hilfsorganisationen Sozialunternehmen entwickelt, <strong>di</strong>e nach betriebswirtschaftlich<br />
def<strong>in</strong>ierten Zielsetzungen ihre Leistungen erstellen <strong>und</strong> dabei Rationalitätskriterien folgen, <strong>di</strong>e<br />
sich <strong>in</strong> immer stärkerem Maße angleichen.“ Structure follows function“ - so hat es e<strong>in</strong> katholischer<br />
Geschäftsführer e<strong>in</strong>es Diözesan- Caritasverbandes e<strong>in</strong>mal ausgedrückt, <strong>und</strong> <strong>di</strong>eser<br />
Tatbestand kennzeichnet <strong>di</strong>e ökonomische Wirklichkeit der Sozialwirtschaft. Zugleich ist mit<br />
den veränderten Ref<strong>in</strong>anzierungsbed<strong>in</strong>gungen im Sozialsektor der Kostendruck <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren immer größer geworden <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Unternehmen haben darauf mit umfassenden Rationalisierungen<br />
<strong>und</strong> Kostensenkungsprogrammen geantwortet, <strong>di</strong>e <strong>in</strong>sbesondere den Personalbereich<br />
betreffen. Tarifliche Aus<strong>di</strong>fferenzierung, <strong>Ausgliederung</strong>en, <strong>di</strong>e Nutzung von Arbeitnehmerüberlassung,<br />
Schaffung von Niedriglohnbereichen usw. s<strong>in</strong>d flächendeckend anzutreffende<br />
Ersche<strong>in</strong>ungsformen e<strong>in</strong>er sich ökonomisierenden Landschaft von Leistungserbr<strong>in</strong>gern,<br />
<strong>di</strong>e im Wettbewerb um Aufträge der Kommunen, der Agenturen für Arbeit oder anderer Kostenträger<br />
stehen <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Wettbewerb bestehen wollen.<br />
Die Kirchen <strong>und</strong> ihre Wohlfahrtsverbände s<strong>in</strong>d von den o.g. Entwicklungen nicht ausgenommen.<br />
Auch <strong>in</strong> den kirchlichen Sozialunternehmen wird nach betriebswirtschaftlichen Notwen<strong>di</strong>gkeiten<br />
gehandelt <strong>und</strong> deshalb steht Personalkostensenkung weit oben auf der Agenda<br />
der Sozialunternehmen. Vor allem <strong>di</strong>e Diakonie hat <strong>in</strong> den vergangenen Jahren <strong>di</strong>e Möglichkeiten,<br />
<strong>di</strong>e <strong>di</strong>e kirchliche Sonderstellung im Arbeitsrecht, der sog. "Dritte Weg" zur Beschreitung<br />
von Sonderwegen bietet, offensiv genutzt <strong>und</strong> sich im Rahmen der verschiedenen Landeskirchen<br />
unterschiedliche Möglichkeiten e<strong>in</strong>er flexiblen Personalpolitik eröffnet. Die Ergebnisse<br />
der explorativen <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> zeigen, dass normatives Postulat <strong>und</strong> Empirie des "Dritten<br />
Weges" stark vone<strong>in</strong>ander abweichen, <strong>und</strong> dass <strong>di</strong>ese Abweichungen sich eben der betriebswirtschaftlichen<br />
Logik e<strong>in</strong>es ökonomisierten Sozialsektors verdanken, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong> Konzept wie<br />
das der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft", sofern es normativen Pr<strong>in</strong>zipien folgt, von <strong>in</strong>nen heraus zerstören<br />
<strong>und</strong> ad absurdum führen. Der derzeit zu beobachtende Druck der verfassten Kirche, das<br />
System des "Dritten Wegs" trotz der offensichtlichen Widersprüchlichkeiten weiterh<strong>in</strong> aufrecht<br />
erhalten zu wollen, verdankt sich Überlegungen, <strong>di</strong>e mit der Realität e<strong>in</strong>es zunehmend<br />
4
vom Gegensatz zwischen Arbeitnehmern <strong>und</strong> Arbeitgebern geprägten <strong>und</strong> unter steigendem<br />
Wettbewerb stehenden Wirtschaftsbereichs wenig zu tun haben.<br />
Metho<strong>di</strong>sches Vorgehen<br />
Die nachfolgenden Darstellungen zur Empirie des "Dritten Wegs" basieren auf verschiedenen<br />
metho<strong>di</strong>schen Schritten:<br />
‐<br />
Dokumentenanalyse (Auswertung von Geschäftsberichten, Statistiken);<br />
‐ qualitative Befragung von Mitarbeitervertretungen <strong>in</strong> allen landeskirchlichen Diakonischen<br />
Werken;<br />
‐ halbstandar<strong>di</strong>sierte schriftliche Befragung von Mitarbeitervertretungen (b<strong>und</strong>esweit);<br />
‐ qualitative Interviews mit ausgewählten <strong>Ver</strong>tretern der verfassten Diakonie.<br />
Insgesamt wurden im Rahmen der <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> ca. 40 qualitative Expertengespräche durchgeführt.<br />
Die schriftliche Befragung von Mitarbeitervertretungen fand im Zeitraum August 2011 bis<br />
Februar 2012 b<strong>und</strong>esweit <strong>in</strong> 299 E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie mit zusammen 15.885 Beschäftigten<br />
statt. Die Befragung erhebt <strong>di</strong>e Sicht der Mitarbeitervertretungen auf <strong>di</strong>e betriebliche<br />
Realität. Die beabsichtigte Parallelbefragung der Geschäftsführungsebene war wegen zu ger<strong>in</strong>ger<br />
Beteiligung nicht umsetzbar. Die Ergebnisse <strong>di</strong>eser <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> verdeutlichen somit<br />
ausschnitthaft Entwicklungen <strong>in</strong> der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialwirtschaft anhand der Wahrnehmung<br />
betrieblicher Interessenvertretungen.<br />
Die Untersuchung ersetzt ke<strong>in</strong>e Gesamt- bzw. Repräsentativerhebung. Sie liefert jedoch als<br />
explorative <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> H<strong>in</strong>weise auf Umfang <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>breitung von Praxen der Ausgründung <strong>und</strong><br />
<strong>Leiharbeit</strong>, <strong>di</strong>e auch <strong>in</strong> den qualitativen Interviews bestätigt wurden.<br />
Die Durchführung der von der Synode der EKD im November 2011 geforderten Gesamterhebung<br />
über <strong>di</strong>e Praxis von Ausgründung <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> <strong>in</strong> der Diakonie scheitert bislang an<br />
gegensätzlichen Interessen des Diakonischen Werkes der EKD als Spitzenverband der Diakonie<br />
<strong>und</strong> dem <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) als Arbeitgeberverband<br />
<strong>in</strong> der Diakonie. Unsere Ergebnisse liefern H<strong>in</strong>weise darauf, wie fortgeschritten <strong>di</strong>e Praxis<br />
von Ausgründungen <strong>in</strong> der Diakonie bereits ist <strong>und</strong> welche Bereiche hiervon i.d.R. betroffen<br />
s<strong>in</strong>d. Sie zeigen gleichzeitig <strong>di</strong>e Notwen<strong>di</strong>gkeit e<strong>in</strong>er umfassenden Repräsentativerhebung<br />
an.<br />
5
Die Fallstu<strong>di</strong>en beruhen auf e<strong>in</strong>er Komb<strong>in</strong>ation unterschiedlicher Methoden (Expertengespräche,<br />
Dokumentenanalyse, Gruppengespräche). Wir möchten uns bei allen Gesprächspartner<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Gesprächspartnern für <strong>di</strong>e f<strong>und</strong>ierten <strong>und</strong> <strong>in</strong> jeder H<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong>formativen Gespräche<br />
bedanken.<br />
6
1. Der "Dritte Weg": Konzept <strong>und</strong> Entwicklung<br />
1.1 Besonderheiten des Arbeitsrechts <strong>in</strong> kirchlichen Sozialverbänden: Der "Dritte Weg"<br />
Kirche <strong>und</strong> Diakonie nehmen im Arbeitsrecht <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Arbeitsbeziehungen seit den 1950er-<br />
Jahren <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Sonderstellung bzw. Sonderpraxis e<strong>in</strong>. 1 Im Bereich der Kirchen<br />
wie <strong>in</strong> ihren karitativen <strong>und</strong> erzieherischen E<strong>in</strong>richtungen f<strong>in</strong>den das staatliche Betriebsver-<br />
fassungsrecht <strong>und</strong> das Personalvertretungsrecht ke<strong>in</strong>e Anwendung (§118 Abs. 2 BtrVG, §112<br />
BPersVG). Auf der überbetrieblichen Ebene der Regulierung allgeme<strong>in</strong>er Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Kirchen von der Geltung des Tarifvertragsgesetzes zwar nicht ausgenommen, sie<br />
schließen aber bis auf wenige Ausnahmen ke<strong>in</strong>e Tarifverträge mit den Gewerkschaften ab.<br />
Die Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen der kirchlich Beschäftigten werden <strong>in</strong> "Arbeitsrechtlichen Kommissionen"<br />
beschlossen.<br />
Diese Sonderstellung wird im kirchlichen Diskurs als "Dritter Weg" bezeichnet. Als "erster<br />
Weg" gilt <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Zusammenhang <strong>di</strong>e Festlegung von Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen durch e<strong>in</strong>seitige<br />
Setzung der Arbeitgeber ohne Beteiligung von Arbeitnehmern; <strong>Ver</strong>handlungen <strong>und</strong> Arbeits-<br />
kampfmaßnahmen zwischen Arbeitgebern <strong>und</strong> Gewerkschaften über den Abschluss von Ta-<br />
rifverträgen werden der "zweite Weg" genannt. Durch <strong>di</strong>ese Bezeichnungen soll e<strong>in</strong> Selbst-<br />
verständnis zum Ausdruck gebracht werden, nach dem im "Dritten Weg" "Dienstgeber" <strong>und</strong><br />
"Dienstnehmer" e<strong>in</strong>e besondere Geme<strong>in</strong>schaft bilden, <strong>di</strong>e als "kirchliche Dienstgeme<strong>in</strong>schaft"<br />
Arbeitskampfmaßnahmen als Mittel der Konfliktregulierung ausschließt.<br />
Auf der rechtlichen Ebene wird <strong>di</strong>e Sonderstellung mit <strong>Ver</strong>weis auf <strong>di</strong>e im Gr<strong>und</strong>gesetz Art.<br />
140 <strong>in</strong>korporierten "Kirchenartikel" (Art. 136-139 <strong>und</strong> 141 der Weimarer Reichsverfassung)<br />
gerechtfertigt. Das <strong>in</strong> Art. 137 Abs. 3 WRV niedergelegte Recht jeder Religionsgesellschaft<br />
<strong>und</strong> weltanschaulichen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igung ihre Angelegenheiten selbstän<strong>di</strong>g zu ordnen <strong>und</strong> zu ver-<br />
walten, wird so ausgelegt, dass zu den eigenen Angelegenheiten auch <strong>di</strong>e Gestaltung <strong>in</strong>sbe-<br />
sondere des kollektiven Arbeitsrechtes gehöre.<br />
Die evangelischen Kirchen haben e<strong>in</strong> eigenes Mitarbeitervertretungsrecht geschaffen, das <strong>in</strong><br />
dem von der Synode der EKD 1992 verabschiedeten "Kirchengesetz über Mitarbeitervertre-<br />
1<br />
In der Weimarer Republik hatten <strong>di</strong>e Kirchen <strong>di</strong>ese Sonderstellung nicht. Die Kirchen <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>richtungen<br />
der Caritas <strong>und</strong> Inneren Mission fielen unter das Betriebsrätegesetz <strong>und</strong> es wurden Tarifverträge geschlossen.<br />
<strong>Ver</strong>gl. Schatz, Susanne: Arbeitswelt Kirche: Mitbestimmung <strong>und</strong> Arbeitsbeziehungen kirchlicher Beschäftigter<br />
<strong>in</strong> der Weimarer Republik. Frankfurt/M. (1999).<br />
7
tungen <strong>in</strong> der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland" niedergelegt ist, kurz MVG.EKD. Die-<br />
ses Gesetz haben 17 der evangelischen Gliedkirchen übernommen. Die Konföderation evan-<br />
gelischer Kirchen <strong>in</strong> Niedersachsen (bis auf <strong>di</strong>e Evangelisch-reformierte Kirche) <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Evangelische<br />
Landeskirche <strong>in</strong> Württemberg haben eigene Regelungen <strong>in</strong> Anlehnung an das<br />
MVG.EKD geschaffen. In der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Hessen <strong>und</strong> Nassau gilt e<strong>in</strong> Mitarbeitervertretungsrecht<br />
aus dem Jahre 1988. In mo<strong>di</strong>fizierter Form wird das MVG.EKD auch von<br />
der Selbstän<strong>di</strong>gen Evangelisch-Lutherischen Kirche <strong>und</strong> der Heilsarmee <strong>in</strong> Deutschland angewendet.<br />
Teil des MVG.EKD s<strong>in</strong>d Regelungen zum kirchlichen Rechtsschutz. Durch <strong>di</strong>e Herausnahme<br />
der Kirchen aus dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen Streitigkeiten aus dem kirchlichen<br />
Mitarbeitervertretungsrecht auch nicht der Zustän<strong>di</strong>gkeit staatlicher Gerichte. Die Kirchen<br />
regeln den Rechtsschutz <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Bereich selbst. Bis zum 31. Dezember 2003 waren zu gerichtlichen<br />
Entscheidungen nach dem MVG.EKD <strong>di</strong>e Schlichtungsstellen <strong>in</strong> erster Instanz <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> zweiter Instanz das <strong>Ver</strong>waltungsgericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten<br />
der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland, kurz <strong>Ver</strong>wG.EKD, berufen.<br />
Mit dem von der Synode der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland am 6. November 2003<br />
verabschiedeten Kirchengesetz über <strong>di</strong>e Errichtung, <strong>di</strong>e Organisation <strong>und</strong> das <strong>Ver</strong>fahren der<br />
Kirchengerichte der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland wurde im MVG.EKD e<strong>in</strong>e Änderung<br />
der Bezeichnung der Schlichtungsstellen <strong>in</strong> "Kirchengerichte" vorgenommen, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>e<br />
Äquivalenz der kirchlichen <strong>und</strong> der staatlichen Rechtsprechungsorgane signalisieren soll.<br />
1.2 Zur theologischen Legitimierung der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft"<br />
Neben den Besonderheiten auf der kollektiven arbeitsrechtlichen Ebene werden auf der <strong>in</strong><strong>di</strong>viduellen<br />
<strong>Ver</strong>tragsebene besondere Loyalitätsanforderungen an kirchlich Beschäftigte gestellt,<br />
<strong>di</strong>e auch <strong>di</strong>e private <strong>und</strong> persönliche Lebensführung betreffen. Zur Legitimierung <strong>di</strong>eser Besonderheiten<br />
wird das Leitbild der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" angeführt.<br />
In e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong>en Def<strong>in</strong>ition, wie sie <strong>in</strong> den Mitarbeitervertretungsordnungen der evangelischen<br />
Kirchen <strong>und</strong> der katholischen Kirche gegeben wird, ist <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" <strong>in</strong><br />
beiden Konfessionen ähnlich beschrieben: "Die geme<strong>in</strong>same <strong>Ver</strong>antwortung für den Dienst<br />
der Kirche <strong>und</strong> ihrer Diakonie verb<strong>in</strong>det Dienststellenleitungen <strong>und</strong> Mitarbeiter wie Mitarbei-<br />
8
ter<strong>in</strong>nen zu e<strong>in</strong>er Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenar-<br />
beit.“ 2 In <strong>di</strong>eser Def<strong>in</strong>ition wird deutlich, dass <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" auf e<strong>in</strong>e arbeitsord-<br />
nungspolitische Gestaltung abzielt <strong>und</strong> nicht auf e<strong>in</strong>e Glaubensaussage begrenzt ist. Diese<br />
Bedeutung hat der Kirchengerichtshof der EKD <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Entscheidung zur <strong>Leiharbeit</strong> im Jahr<br />
2006 herausgestellt: „Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft ist nicht nur als religiöse Ausrichtung zu ver-<br />
stehen, sondern als organisatorische Geme<strong>in</strong>schaft von Dienstgeber <strong>und</strong> Dienstnehmern, <strong>und</strong><br />
zwar auch im rechtlichen S<strong>in</strong>ne". 3<br />
Der Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" ist außerkirchlichen Ursprungs. Er hat ke<strong>in</strong>e eigene<br />
kirchliche <strong>Ver</strong>wendungstra<strong>di</strong>tion. Der Begriff ist aus dem "Gesetz zur Ordnung der Arbeit <strong>in</strong><br />
öffentlichen <strong>Ver</strong>waltungen <strong>und</strong> Betrieben" von 1934 <strong>in</strong> den kirchlichen Zusammenhang übernommen<br />
worden. Auf <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" <strong>di</strong>eses Gesetzes verwiesen <strong>Ver</strong>gütungsordnungen<br />
<strong>in</strong> der Caritas (1936), der Inneren Mission (1937) <strong>und</strong> <strong>in</strong> den verfassten Kirchen<br />
(1938). 4 Nach 1949 wurde der Begriff <strong>in</strong> <strong>Ver</strong>tragsordnungen <strong>und</strong> Richtl<strong>in</strong>ien der Inneren Mission<br />
<strong>und</strong> Caritas weiter verwendet, zunächst jedoch nicht <strong>in</strong> den verfassten Kirchen. Ab den<br />
1950er-Jahren wird der Begriff dann theologisch gedeutet. Das geschieht allerd<strong>in</strong>gs durch<br />
Juristen <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>waltungsfachleute <strong>und</strong> nicht durch Theologen. 5 Dieses Defizit beklagte noch<br />
<strong>in</strong> den 1990er-Jahren der evangelische Kirchenjurist Gerhard Grethle<strong>in</strong>. Die Richtl<strong>in</strong>ien zu<br />
den Arbeitsrechtsregelungen der EKD gründeten, so Grethle<strong>in</strong>, "entscheidend auf theologischen<br />
Überlegungen. Diese Überlegungen wurden ausschließlich von kirchlichen Mitarbeitern<br />
angestrengt, <strong>di</strong>e nicht theologisch ausgebildet <strong>und</strong> ausgewiesen s<strong>in</strong>d. Die Theologen haben<br />
sich bei <strong>di</strong>eser Ause<strong>in</strong>andersetzung (...) beklagenswert zurückgehalten." 6<br />
2<br />
Präambel MVG.EKD i.d.F. 01.01.2004. In der Rahmenordnung für <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretungsordnung der<br />
katholischen Kirche vom 23.06.2003 lautet <strong>di</strong>e entsprechende Stelle: „Gr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> Ausgangspunkt für den<br />
kirchlichen Dienst ist <strong>di</strong>e Sendung der Kirche. (...) Als Maßstab für ihre Tätigkeit ist sie Dienstgebern <strong>und</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeitern vorgegeben, <strong>di</strong>e als Dienstgeme<strong>in</strong>schaft den Auftrag der E<strong>in</strong>richtung erfüllen <strong>und</strong><br />
so an der Sendung der Kirche mitwirken.“<br />
3<br />
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland (2006): <strong>Leiharbeit</strong> im <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Dienst. Beschluss<br />
des KGH.EKD vom 09.10.2006. Zeichen: KGH.EKD II-0124/M35-06. Hier zit. n. Lührs: Kirchliche<br />
Dienstgeme<strong>in</strong>schaft. Genese <strong>und</strong> Gehalt e<strong>in</strong>es umstrittenen Begriffs. In: Kirche <strong>und</strong> Recht, Ausgabe 2.2007,<br />
Berl<strong>in</strong>er Wissenschafts-<strong>Ver</strong>lag (Lührs 2007).<br />
4<br />
Siehe <strong>di</strong>e historische Rekonstruktion <strong>und</strong> Analyse bei Lührs 2007. Diese Bef<strong>und</strong>e widerlegen frühere Annahmen,<br />
wonach <strong>di</strong>e kirchliche "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" auch genetisch e<strong>in</strong> von der nationalsozialistischen Dienstgeme<strong>in</strong>schaft<br />
"völlig unabhängiges Phänomen" sei (so noch bei Hammer: Kirchliches Arbeitsrecht. 2002. S. 177<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere bei Richar<strong>di</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>versen Auflagen des Standardwerkes "Arbeitsrecht <strong>in</strong> der Kirche").<br />
5<br />
In der "Zeitschrift für evangelischen Kirchenrecht" 2. Band 1952/53 präsentiert der Jurist Werner Kalisch <strong>di</strong>e<br />
"Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" auf <strong>di</strong>e <strong>in</strong> den "Richtl<strong>in</strong>ien für Arbeitsverträge der Inneren Mission von 1951" Bezug genommen<br />
wird, als e<strong>in</strong>e biblisch vorgegebene Kategorie. Diese Position wird fortan <strong>in</strong> der kirchenjuristischen<br />
<strong>und</strong> arbeitsrechtlichen Literatur, nicht jedoch <strong>in</strong> der theologischen Literatur rezipiert. <strong>Ver</strong>gl. Lührs 2007.<br />
6<br />
Grethle<strong>in</strong>, Gerhard (1992): Entstehungsgeschichte des Dritten Weges. In: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht.<br />
37. Band 1992. Hier zit.n. Lührs 2007 S. 236.<br />
9
Im theologisch-akademischen Diskurs ist der Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" vor 1985 ent-<br />
weder nicht präsent oder er wird als "verschleiernd" <strong>und</strong> "ideologieverdächtig" abgelehnt. 7<br />
Hirschfeld kommt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er 1999 vorgelegten Untersuchung h<strong>in</strong>sichtlich des Me<strong>in</strong>ungsstandes<br />
<strong>in</strong> den evangelischen Kirchen zu dem Bef<strong>und</strong>: „Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft als Rechtsbegriff<br />
sieht sich (...) doppelt <strong>in</strong> Frage gestellt: zum e<strong>in</strong>en durch e<strong>in</strong>en immer noch nicht erzielten<br />
Konsens über ihren Begriffs<strong>in</strong>halt, zum anderen durch den nicht e<strong>in</strong>gelösten Anspruch auf<br />
theologische Legitimität." 8<br />
Die kirchliche Sonderstellung im Arbeitsrecht ist <strong>in</strong>zwischen nachhaltig <strong>in</strong> <strong>di</strong>e öffentliche<br />
Kritik geraten. Die deutsche <strong>und</strong> europäische Rechtsprechung beg<strong>in</strong>nen, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Form<br />
nur <strong>in</strong> Deutschland bestehende kirchliche Sonderposition im Arbeitsrecht <strong>in</strong> Frage zu stellen.<br />
Die bisherige Legitimationsbasis wird als <strong>in</strong>suffizient wahrgenommen. Die Juristen Germann<br />
<strong>und</strong> de Wall konstatieren im Jahr 2004: Bisher brauchte <strong>di</strong>e staatliche Rechtsprechung "ke<strong>in</strong><br />
umfassendes Leitbild der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft zu rezipieren. Sie konnte sich darauf beschränken,<br />
es über se<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>di</strong>e Gestaltung des kirchlichen Dienstes nachzuzeichnen."<br />
Um aber <strong>di</strong>ese Rechtsfolgen weiterh<strong>in</strong> absichern zu können, sei der Zusammenhang<br />
zwischen Leitbild <strong>und</strong> Rechtsfolgen durch <strong>di</strong>e Kirchen explizit <strong>und</strong> plausibel zu machen: "E<strong>in</strong><br />
konsistentes Leitbild der kirchlichen Dienstgeme<strong>in</strong>schaft hat (...) entscheidende Bedeutung<br />
auch für ihre staatskirchenrechtliche Haltbarkeit.“ 9<br />
Die kirchlichen Akteure antworten <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Lage mit e<strong>in</strong>er Strategie normativer Aufladung<br />
<strong>und</strong> gesteigerter Affirmation. Das kirchliche Arbeitsrecht, so der Ratsvorsitzende der EKD<br />
Nikolaus Schneider im Januar 2011 vor der Synode der Evangelischen Kirche im Rhe<strong>in</strong>land,<br />
sei e<strong>in</strong>e "Errungenschaft, <strong>di</strong>e wir nicht aufgeben wollen." 10 In der Publikation "Perspektiven<br />
der Diakonie im gesellschaftlichen Wandel", <strong>di</strong>e im Jahr 2011 von den Spitzen von EKD <strong>und</strong><br />
Diakonie autorisiert wurde, heißt es im Abschnitt "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> Dritter Weg":<br />
"Mit e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaft im Dienst geht das Ideal e<strong>in</strong>es vertrauensvollen Mite<strong>in</strong>anders, der<br />
Rücksichtnahme <strong>und</strong> der e<strong>in</strong>ander zugewandten Konfliktlösung e<strong>in</strong>her. Das dem staatlichen<br />
7<br />
Vgl. den Beitrag von Buttler, Gottfried <strong>in</strong> Theologische Realenzyklopä<strong>di</strong>e Bd. 19, S. 210 sowie <strong>di</strong>e Kritik von<br />
Nell-Breun<strong>in</strong>g seit den 1970er Jahren <strong>und</strong> im Anschluss daran Hengsbach. (<strong>Ver</strong>gl. Lührs 2007 S. 237ff)<br />
8<br />
Hirschfeld, Matthias (1999): Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft im Arbeitsrecht der evangelischen Kirche : zur Legitimitätsproblematik<br />
e<strong>in</strong>es Rechtsbegriffs. S. 217.<br />
9<br />
Germann, Michael u. de Wall, He<strong>in</strong>rich (2004): Kirchliche Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> Europarecht. In: Recht der<br />
Arbeit <strong>und</strong> der Wirtschaft <strong>in</strong> Europa. Band 25. S. 559. Hier zit. n. Lührs 2007 S. 239.<br />
10<br />
Bericht vom 14.01.2011 unter http://www2.evangelisch.de/pr<strong>in</strong>t/31489?dest<strong>in</strong>ation=pr<strong>in</strong>t%2F31489.<br />
10
Arbeitsrecht zugr<strong>und</strong>e liegende Modell des harten Interessenantagonismus ist dem Dienst <strong>in</strong><br />
der Kirche fremd". 11<br />
Diese Position wird von der Diakonie <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe noch erweitert: Das<br />
"Konsensmodell des Dritten Weges" sei, so das Vorstandsmitglied Barenhoff <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Interview<br />
im April 2011 "zukunftweisend für den sozialen Bereich" <strong>und</strong> "gesamtgesellschaftlich<br />
richtungsweisend". Kirchen <strong>und</strong> Diakonie seien "moderner als <strong>Ver</strong><strong>di</strong>", so Barenhoff. 12 Der<br />
Vorsitzende des <strong>Ver</strong>bandes <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) Rückert kennzeichnet<br />
den "Dritten Weg" als "Diskurs vernünftiger Menschen". Er sei dem "pfeifenden <strong>und</strong><br />
kreischenden Straßenkampf um Lohnerhöhungen" sogar "zivilisatorisch überlegen". 13<br />
Der normativen Aufladung (<strong>Ver</strong>trauen, Rücksichtnahme, Mite<strong>in</strong>ander, <strong>Ver</strong>nunft) <strong>und</strong> gesteigerten<br />
Affirmation (Modernität, Errungenschaft, zivilisatorische Überlegenheit) stehen konterkarierende<br />
Tatsachen auf der Praxis- <strong>und</strong> Strukturebene gegenüber. Im Juni 2010 untersagte<br />
<strong>di</strong>e Leitung des Diakonischen Werkes der EKD elf von dreizehn Zusammenschlüssen der<br />
Mitarbeitervertretungen, <strong>Ver</strong>treter <strong>in</strong> <strong>di</strong>e b<strong>und</strong>esweite Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie<br />
zu entsenden. 14 Dies wurde damit begründet, dass <strong>di</strong>ese Zusammenschlüsse <strong>di</strong>e Arbeit<br />
der Kommission blockiert hätten <strong>und</strong> sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er öffentlichen Erklärung gegen <strong>di</strong>e "Fortführung<br />
des 3. Weges" <strong>und</strong> für den Abschluss von Tarifverträgen ausgesprochen hatten. 15 Seit<br />
Juni 2010 sieht <strong>di</strong>e Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission <strong>di</strong>e Möglichkeit vor, Beschlüsse<br />
für <strong>Ver</strong>gütungsabsenkungen auf betrieblicher Ebene <strong>in</strong> bestimmten Fällen auch ohne<br />
Anwesenheit von Arbeitnehmervertretern fassen zu können. 16<br />
E<strong>in</strong>en anderen Weg, <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" theologisch zu rechtfertigen, sucht der Bochumer<br />
Theologe Traugott Jähnichen: „Im S<strong>in</strong>n der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft s<strong>in</strong>d alle Handelnden<br />
<strong>in</strong> der Diakonie, Dienstgeber wie Dienstnehmer, auf e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Dienstauftrag bezogen,<br />
der sich im S<strong>in</strong>n der biblischen Botschaft <strong>in</strong> der Hilfe für Schwache <strong>und</strong> Benachteiligte<br />
11<br />
Becker, Uwe (Hrsg.) (2011): Perspektiven der Diakonie im gesellschaftlichen Wandel. S.114. Der Publikation<br />
s<strong>in</strong>d Geleitworte des Ratsvorsitzenden der EKD Präses Schneider, des Vorsitzenden des Diakonischen Rates<br />
Bischof July <strong>und</strong> der Vorsitzenden der Diakonischen Konferenz Landespastor<strong>in</strong> Stoltenberg vorangestellt.<br />
12<br />
In: Newsletter Diakonie RWL April 2011 unter /www.<strong>di</strong>akonie-rwl.de<br />
13<br />
Rückert <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonie-unternehmen Ausgabe 2/2011, S. 11 <strong>und</strong> epd-sozial Nr. 23 vom 10.06.2011<br />
14<br />
Es handelt sich um <strong>di</strong>e Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften der Mitarbeitervertretungen (AGMAV) der Landesverbände der<br />
Diakonischen Werke Württemberg, Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schles.Oberlausitz, Niedersachsen, Schleswig-Holste<strong>in</strong>,<br />
Hamburg, Bremen, Mitteldeutschland, Baden, Pfalz, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck.<br />
15<br />
Vgl. Zeitschrift für Mitarbeitervertretung (ZMV) Nr. 4 2010, S. 192. Beschluss der Diakonischen Konferenz<br />
DWEKD vom 15.06.2010. Berichte <strong>in</strong> ZMV Nr. 6 2010 S. 313-315.<br />
16<br />
Es handelt sich um Beschlüsse über betriebliche Öffnungsklauseln <strong>in</strong> besonderen Situationen. §11 Abs. 1<br />
Ordnung für <strong>di</strong>e Arbeitsrechtliche Kommission des Diakonischen Werkes der EKD i.d.F. vom 18.10.2011.<br />
11
ewährt“ 17 . In <strong>di</strong>eser Perspektive wird das Augenmerk auf <strong>di</strong>e Arbeit mit Klienten <strong>und</strong> Hilfe-<br />
bedürftigen, auf <strong>di</strong>e tätige Nächstenliebe, <strong>und</strong> nicht primär auf <strong>di</strong>e Regulierungsform von Ar-<br />
beitsbed<strong>in</strong>gungen gelegt. Der Ansatz von Jähnichen verdünnt dadurch aber auch <strong>di</strong>e gegen-<br />
über B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, B<strong>und</strong>esverfassungsgericht <strong>und</strong> möglicherweise Europäischen Ge-<br />
richtshof zu plausibiliserende Ableitung, e<strong>in</strong> bestimmtes Glaubenskonzept schließe notwen<strong>di</strong>g<br />
Tarifverhandlungen nach dem Tarifvertragsgesetz aus <strong>und</strong> rechtfertige <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>schränkung von<br />
Gr<strong>und</strong>rechten der kirchlich Beschäftigten als Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer, z.B. das<br />
Streikrecht.<br />
Dieter Beese, Super<strong>in</strong>tendent <strong>in</strong> der Evangelischen Kirche von Westfalen, argumentiert <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Gutachten, das dem Landesarbeitsgericht Hamm <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Entscheidung über das<br />
Streikrecht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie <strong>in</strong> 2011 vorgelegt worden ist, h<strong>in</strong>gegen str<strong>in</strong>gent<br />
so: "Die evangelische Kirche kann sich nicht von ihrem <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag <strong>di</strong>spensieren.<br />
E<strong>in</strong> Arbeitskampf <strong>in</strong> der Diakonie wäre allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> der Tendenz mit e<strong>in</strong>er Aussetzung des<br />
<strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrags verb<strong>und</strong>en. Streik <strong>und</strong> Aussperrung kommen daher im kirchlichen<br />
Dienst als Konfliktlösungs<strong>in</strong>strumente nicht <strong>in</strong> Betracht.“ 18 Das Problem des Ansatzes von<br />
Beese wiederum ist, dass <strong>in</strong> ihm <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag <strong>und</strong> Arbeitsvertragspflicht, Glaubenskonzept<br />
<strong>und</strong> Arbeitsordnung, nicht mehr vone<strong>in</strong>ander abgehoben werden. Se<strong>in</strong>e Position führt<br />
so <strong>in</strong> der Tendenz an <strong>di</strong>e Blasphemie der Aussage: "Gott kann man nicht bestreiken" <strong>und</strong> wird<br />
mit entsprechendem theologischem Widerspruch zu rechnen haben.<br />
Den Interpretationen von Jähnichen <strong>und</strong> Beese stehen <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>wände des Bonner Theologen<br />
Hartmut Kress gegenüber. E<strong>in</strong>e Neu<strong>in</strong>terpretation des Begriffes "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" stoße,<br />
so Kress <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em aktuellen Beitrag <strong>in</strong> der Zeitschrift für Rechtspolitik, auf "sachlich große<br />
H<strong>in</strong>dernisse". Der Protestantismus unterscheide theologisch "zwischen Geme<strong>in</strong>de, Geme<strong>in</strong>schaft<br />
<strong>und</strong> Dienst im geistlichen S<strong>in</strong>n ('unsichtbare Kirche') e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der empirischen<br />
Gestalt der Kirche andererseits". Zudem sei der Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" zur Kennzeichnung<br />
der Struktur der modernen Arbeitswelt "wenig ergiebig." Das gegen das Streikrecht<br />
<strong>in</strong> kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen vorgebrachte Argument, Aussperrungen als Gegenmaßnahme<br />
seien den kirchlichen Arbeitgebern aufgr<strong>und</strong> ihrer B<strong>in</strong>dung an den <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag<br />
<strong>und</strong> das <strong>Ver</strong>söhnungs- <strong>und</strong> Liebesgebotes nicht möglich, wertet Kress als "moralische<br />
Heteronomie" <strong>und</strong> "ethisch abzulehnende Fremdbestimmung". Da <strong>di</strong>e Kirchen den Streik im<br />
17<br />
Jähnichen, Dienstgeme<strong>in</strong>schaft, <strong>in</strong>: Bell u.a. (Hg.) 2007, Diakonie im Übergang.<br />
18<br />
Beese, Dieter., 2011, Der Dritte Weg, Gutachten für das Diakonische Werk Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe, S. 27.<br />
www.<strong>di</strong>akonie-rwl.de/dritter_weg<br />
12
außerkirchlichen Bereich für legitim ansehen <strong>und</strong> nur im eigenen Bereich ablehnen, <strong>und</strong> dort<br />
gleichzeitig ihrerseits harte Maßnahmen, wie z.B. Diszipl<strong>in</strong>armaßnahmen gegen Kirchenbe-<br />
amte, Entlassungen von Mitarbeitern <strong>und</strong> Abberufungen von Pfarrern durchführen, <strong>di</strong>e "mit<br />
der von ihnen promulgierten Dienstgeme<strong>in</strong>schaft - <strong>Ver</strong>söhnung, Geschwisterlichkeit, Liebe -<br />
nicht übere<strong>in</strong>stimmen", sei der kirchliche Standpunkt "moralisch doppelbö<strong>di</strong>g" <strong>und</strong> "b<strong>in</strong>nenwidersprüchlich".<br />
19 .<br />
In e<strong>in</strong>em Gutachten zu den Loyalitätspflichten kirchlich Beschäftigter, das der evangelische<br />
Theologe <strong>und</strong> Mitglied der Kammer für Öffentliche <strong>Ver</strong>antwortung der EKD, Hans-Richard<br />
Reuter im Auftrag der EKD im Jahr 2005 vorlegte, 20 macht Reuter auf e<strong>in</strong>en gr<strong>und</strong>legenden<br />
Unterschied im theologischen <strong>Ver</strong>ständnis der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" zwischen den großen<br />
Konfessionen aufmerksam. In katholischer Perspektive werde <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" betrachtet<br />
als "e<strong>in</strong> objektives Strukturpr<strong>in</strong>zip des kirchlichen Dienstes, das <strong>in</strong> vielfältiger H<strong>in</strong>sicht<br />
Maßstabsfunktion besitzt, aus dem sich Anforderungen an <strong>di</strong>e kirchlichen Mitarbeiter<br />
ergeben, dessen Gültigkeit aber nicht von se<strong>in</strong>er subjektiven Annahme durch <strong>di</strong>e Mitarbeiter<br />
abhängt." 21 Auf <strong>di</strong>ese Weise würde der Ethos des christlichen Dienstes zwar <strong>in</strong> Rechtspflichten<br />
des Arbeitsvertrages überführt, "<strong>di</strong>e Anknüpfung der 'Dienstgeme<strong>in</strong>schaft' an das Priestertum<br />
der Getauften <strong>und</strong> <strong>di</strong>e frei aktualisierte Teilhabe am Leib Christi jedoch gekappt – <strong>di</strong>e<br />
'Dienstgeme<strong>in</strong>schaft' würde unterschiedslos zur Pflicht- <strong>und</strong> 'Diszipl<strong>in</strong>argeme<strong>in</strong>schaft'. 22 "Erschlichene<br />
Identifizierungen von 'Dienst der Kirche' <strong>und</strong> 'kirchlichem Dienst' stoßen deshalb",<br />
so Reuter, "zu Recht auf breiten theologischen Widerstand." 23<br />
Zusammenfassend werden <strong>di</strong>e Bemühungen, <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" zu legitimieren, von<br />
konterkarierenden Momenten begleitet se<strong>in</strong>: Die normative Aufladung des Dienstgeme<strong>in</strong>schaftskonzeptes<br />
wird weiter mit den Realitäten <strong>und</strong> Praxen des Kostenwettbewerbes <strong>in</strong> der<br />
Sozialwirtschaft kolli<strong>di</strong>eren. Und zweitens dürfte <strong>di</strong>e - überhaupt erst beg<strong>in</strong>nende - akademisch-theologische<br />
Reflexion den bisher weitgehend e<strong>in</strong>heitlich von den Juristen der katholischen<br />
<strong>und</strong> evangelischen Kirchen formulierten Gehalt der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" entzweien<br />
19<br />
Kress, Hartmut: Aktuelle Probleme des kirchlichen Arbeitsrechts. In: Zeitschrift für Rechtspolitik. Nr. 4/2012.<br />
20<br />
Reuter, Hans-Richard (2006): Kirchenspezifische Anforderungen an <strong>di</strong>e privat- rechtliche berufliche Mitarbeit<br />
<strong>in</strong> der evangelischen Kirche <strong>und</strong> ihrer Diakonie. In: Anselm u. Hermel<strong>in</strong>k: Der Dritte Weg auf dem Prüfstand.<br />
Gött<strong>in</strong>gen, 2006.<br />
21<br />
Reuter (20006) zitiert Josef Jur<strong>in</strong>a, Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft der Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes, ZevKR<br />
29 (1984),<br />
22<br />
Reuter 2006 S. 55. In dem Gutachten setzt Reuter den Begriff "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" durchgängig <strong>in</strong> Anführungszeichen.<br />
Hieran wird <strong>di</strong>e theologische Distanz zu dem Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" sichtbar. Reuter<br />
selbst spricht von der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaftsidee".<br />
23<br />
Reuter 2006 S. 55.<br />
13
<strong>und</strong> <strong>di</strong>e bisher verdeckten <strong>in</strong>terkonfessionellen <strong>und</strong> b<strong>in</strong>nenkonfessionellen Differenzen <strong>und</strong><br />
Gegensätze aufbrechen lassen.<br />
1.3 Die Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts: der <strong>Ver</strong>such, der Erosion des<br />
Dritten Wegs entgegen zu wirken<br />
Die <strong>in</strong> den letzten Jahren beobachtbare immer stärkere Pluralisierung von Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien,<br />
<strong>di</strong>e Praxis der Ausgründungen (Outsourc<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Insourc<strong>in</strong>g), <strong>di</strong>e Nutzung von<br />
<strong>Leiharbeit</strong> u.a.m. haben dazu geführt, dass an verschiedenen Punkten <strong>di</strong>e Kirche den <strong>Ver</strong>such<br />
unternommen hat, der Erosion der Strukturen des Dritten Wegs entgegen zu steuern. So hat<br />
<strong>di</strong>e 11. Synode der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland auf ihrer Tagung <strong>in</strong> Magdeburg (im<br />
November 2011) e<strong>in</strong>en Beschluss zum Kirchengesetz über <strong>di</strong>e Gr<strong>und</strong>sätze der Regelung der<br />
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong> der Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgesetz)<br />
gefasst. Dar<strong>in</strong> wird der <strong>Ver</strong>such unternommen, den <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag der<br />
Kirche <strong>und</strong> ihrer Diakonie <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Festlegung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen für alle Strukturen der<br />
Diakonie verb<strong>in</strong>dlich zu def<strong>in</strong>ieren. In §1 des Beschlusses wird <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft"<br />
hervorgehoben, Streik <strong>und</strong> Aussperrung als e<strong>in</strong>em verb<strong>in</strong>dlichen Schlichtungsverfahren entgegen<br />
stehend ausgeschlossen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> partnerschaftlicher <strong>und</strong> kooperativer Umgang von<br />
Dienstgebern, Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern gefordert.<br />
Ebenfalls auf der 11. Synode der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland (EKD) wurden im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>er K<strong>und</strong>gebung „Zehn Forderungen zur solidarischen Ausgestaltung des kirchlichen<br />
Arbeitsrechts“ aufgestellt. Dar<strong>in</strong> heißt es: „Unter dem Wettbewerbsdruck haben e<strong>in</strong>ige<br />
<strong>di</strong>akonische Träger begonnen, sich ganz oder <strong>in</strong> Teilen den Tarifen der Diakonie zu entziehen.<br />
Vor <strong>di</strong>esem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> haben sich <strong>in</strong> den letzten Jahren alle Landesverbände der Diakonie<br />
erneut <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiv mit Mitgliedschaftsanforderungen, Zuordnungsrichtl<strong>in</strong>ien <strong>und</strong> der Frage<br />
von Ausschlussverfahren beschäftigt.“ (K<strong>und</strong>gebung der Synode der EKD, S. 1). Diakonische<br />
Unternehmen, <strong>di</strong>e über privatrechtliche Konstruktionen <strong>in</strong> den Ersten Weg ausweichen<br />
wollen, müssen danach mit Ausschluss aus der Mitgliedschaft im Diakonischen Werk rechnen,<br />
Missstände wie <strong>Ausgliederung</strong> mit Lohnsenkungen, ersetzende <strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong> nicht h<strong>in</strong>nehmbare<br />
Niedriglöhne müssen „zu ernsthaften Konsequenzen wie Sanktionen führen“ (ebenda,<br />
S. 2).<br />
14
Besondere Bedeutung besitzt <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Zusammenhang e<strong>in</strong> letzt<strong>in</strong>stanzliches Urteil des Kir-<br />
chengerichtshofs der EKD vom Oktober 2006 zur <strong>Leiharbeit</strong> (vgl. dazu ausführlich Kap.<br />
2.2.4).<br />
Obwohl das Gericht <strong>di</strong>e Logik ökonomisierter Steuerungsmodelle kennt <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltlich nachvollzieht,<br />
sieht es <strong>di</strong>e Unklarheiten <strong>in</strong> den Organisationsgrenzen zwischen kirchlich getragener<br />
Dienstleistungsagentur <strong>und</strong> Personalserviceagentur <strong>und</strong> betrachtet <strong>di</strong>es als „Flucht aus<br />
dem Dritten Weg“ (II.2.bbb). Es argumentiert, dass <strong>di</strong>e organisatorischen Rahmensetzungen<br />
<strong>und</strong> damit gegebenen Lohnbed<strong>in</strong>gungen der <strong>Leiharbeit</strong>spraxis den Anspruch auf <strong>di</strong>e kirchliche<br />
Regelung der Anti<strong>di</strong>skrim<strong>in</strong>ierung unterlaufen bzw. aufweichen. 24 Während <strong>di</strong>e Ökonomisierung<br />
sozialer Dienste mehr Effizienz <strong>und</strong> Effektivität abverlangt <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Kirchen mithilfe<br />
der Loyalitätsrichtl<strong>in</strong>ie ihre Identität stärken <strong>und</strong> bewahren wollen, unterlaufen <strong>und</strong> erschweren<br />
unklarer werdende Organisationsgrenzen im Fall der <strong>Leiharbeit</strong> genau <strong>di</strong>esen Prozess.<br />
Der <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em R<strong>und</strong>schreiben<br />
vom 7. Febr. 2007 dazu aufgefordert, das Urteil des Kirchengerichts vom Okt. 2006 zu ignorieren.<br />
25 Die Berufung der Mitarbeitervertretung auf <strong>di</strong>e "Idee der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" sei im<br />
Ergebnis partikularen, gewerkschaftlichen Interessen geschuldet.<br />
Im Falle der <strong>Leiharbeit</strong> argumentiert He<strong>in</strong>ig für e<strong>in</strong> „Regel-Ausnahme-<strong>Ver</strong>hältnis“ 26 , entsprechend<br />
den Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien für das DW der EKD von 2007, <strong>di</strong>e von nicht mehr als<br />
„5 v.H. der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Vollzeitkräfte“ 27 als <strong>Leiharbeit</strong>er ausgehen.<br />
Gleichzeitig erwägt He<strong>in</strong>ig Möglichkeiten, den rechtlichen Gegensatz von loyalitätsungeb<strong>und</strong>enen,<br />
entliehenen Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen von Personalserviceagenturen <strong>und</strong> loyalitätsgeb<strong>und</strong>enen<br />
Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen von kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen rechtlich zu vermitteln: „Ansatzpunkte<br />
hierfür bieten <strong>di</strong>e vertraglichen Beziehungen zum Überlasser sowie <strong>di</strong>e Art der Ausübung<br />
des Direktionsrechts.“ 28 Derartige rechtliche Zuordnungsmodalitäten verr<strong>in</strong>gern <strong>di</strong>e Dichotomie<br />
<strong>in</strong> der Frage der Loyalität, ändern aber nichts daran, dass sich <strong>Leiharbeit</strong>nehmer/<strong>in</strong>nen<br />
24<br />
Das Gericht sieht bereits, dass <strong>di</strong>e von ihm geltend gemachte E<strong>in</strong>heitlichkeit des Dienstverhältnisses – <strong>di</strong>e<br />
„Dienstgeme<strong>in</strong>schaft ist nicht nur als religiöse Ausrichtung zu verstehen, sondern als organisatorische Geme<strong>in</strong>schaft<br />
von Dienstgeber <strong>und</strong> Dienstnehmer“ (II.2.bbb) – unterlaufen werden könnte <strong>und</strong> weist darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>di</strong>e<br />
sog. Gestellungen bzw. das Institut der Gestellungskräfte wie im Falle von Ordensschwestern o.ä. nicht parallelisierbar<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
25<br />
Vgl. He<strong>in</strong>ig, 2009, Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> – kirchenrechtliche Probleme e<strong>in</strong>es komplexen Rechtsbegriffs,<br />
<strong>in</strong>: ZEvKR 54, S. 64, dort Anm. 8.<br />
26<br />
He<strong>in</strong>ig, a.a.O., 75.<br />
27<br />
He<strong>in</strong>ig, a.a.O., 64.<br />
28<br />
He<strong>in</strong>ig, a.a.O., 75.<br />
15
<strong>und</strong> kirchliche Angestellte <strong>in</strong> unterschiedlichen Tarifsystemen, Arbeits- <strong>und</strong> Lohnbed<strong>in</strong>gun-<br />
gen bef<strong>in</strong>den. Daher empfiehlt He<strong>in</strong>ig: „Freilich bleibt staatskirchenrechtlich <strong>in</strong>sbesondere zu<br />
bedenken, ob <strong>di</strong>e für den Fortbestand des kirchlichen Arbeitsrechts im Dritten Weg unerläss-<br />
liche Plausibilisierung des kirchlichen Selbstverständnisses <strong>in</strong> den staatlichen Rechtskreis<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> (Stichwort: Art. 137 Abs. 3 WRV) noch zu leisten ist, wenn <strong>di</strong>e Arbeits- <strong>und</strong> Lohnbe-<br />
d<strong>in</strong>gungen für e<strong>in</strong>en beachtlichen Kreis <strong>in</strong> der Kirche tätiger Arbeitnehmer außerhalb des<br />
Dritten Wegs festgelegt werden“.<br />
Der Diakonie B<strong>und</strong>esverband hat von e<strong>in</strong>em Experten für Krisenkommunikation e<strong>in</strong>e Stellungnahme<br />
erarbeiten lassen, <strong>di</strong>e den Dritten Weg begründen <strong>und</strong> Argumentationen der Gewerkschaft<br />
ver.<strong>di</strong> zurückweisen soll. In <strong>di</strong>esem der Öffentlichkeit zur <strong>Ver</strong>fügung gestellten<br />
Papier heißt es: „Gr<strong>und</strong>sätzlich nicht Ausgründungen etc. mit fiskalischen Zwängen etc.<br />
rechtfertigen. E<strong>in</strong>e solche Argumentation würde <strong>di</strong>e These der Gegenseite bestätigen, dass <strong>di</strong>e<br />
Diakonie wie e<strong>in</strong> beliebiges Wirtschaftsunternehmen auf den Wettbewerb reagiere <strong>und</strong> der<br />
Dritte Weg nicht mehr realisierbar sei. Stattdessen positiv begründen, warum bestimmte Tätigkeiten,<br />
<strong>di</strong>e nicht unmittelbar ‚am Menschen‘ erbracht werden, auch nicht zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> der<br />
Dienstgeme<strong>in</strong>schaft geleistet werden müssen, also unter anderen tariflichen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
(Gebäudere<strong>in</strong>igerhandwerk o.ä.) den Dritten Weg nicht substanziell tangieren“. 29<br />
In dem auf der 4. Tagung der 11. Synode verabschiedeten Arbeitsrechtsregelungsgesetz sollte<br />
auf bestehende Defizite im Dritten Weg reagiert werden. Hierbei werden <strong>in</strong>sbesondere drei<br />
Punkte hervorgehoben:<br />
- Die strukturelle Parität der Interessenvertretungen der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
muss gestärkt werden. Angesichts der Änderungen im Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssystem<br />
braucht <strong>di</strong>e Mitarbeiterseite mehr zeitliche Ressourcen, bessere Fortbildungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> juristische Fachberatung, damit Parität besser gelebt werden kann;<br />
- Erforderlich ist auch <strong>di</strong>e Förderung der Kommunikationsmöglichkeiten von Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeitern an der Basis, <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen mit den Dienstnehmervertreter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> -vertretern <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen;<br />
29<br />
Vgl. dazu: Teetz, A., 2011, Presseerklärung für den Diakonischen B<strong>und</strong>esverband, Süddeutsche Zeitung, 2.<br />
November 2011, S. 3.<br />
16
- Die Formen der Sozialpartnerschaft <strong>in</strong> den Gliedkirchen s<strong>in</strong>d sehr unterschiedlich. Die-<br />
se Heterogenität stellt e<strong>in</strong>e erhebliche Herausforderung für den Dritten Weg dar <strong>und</strong><br />
sollte beseitigt werden. 30<br />
Der Präses der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland, Nikolaus Schneider, hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Gr<strong>und</strong>satzrede im März 2012 notwen<strong>di</strong>ge Korrekturen <strong>und</strong> Reparaturen am System des Dritten<br />
Weges angemahnt, dabei zugleich aber <strong>di</strong>e Gültigkeit der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" für Kirche<br />
<strong>und</strong> Diakonie unterstrichen. Dabei drängt aus se<strong>in</strong>er Sicht der nachfolgend zitierte kritische<br />
Bef<strong>und</strong> auf Abhilfe:<br />
„In der stark föderativ geprägten EKD existieren 16 Arbeitsrechtliche Kommissionen <strong>und</strong><br />
damit deutlich zu viele, wie <strong>di</strong>es auch <strong>di</strong>e Synode <strong>in</strong> ihrer K<strong>und</strong>gebung vom 9. November<br />
2011 festgestellt hat. Diese Vielzahl Arbeitsrechtlicher Kommissionen produziert mit zunehmender<br />
Dynamik unterschiedliche Regelungen; das Arbeitsrecht <strong>in</strong> der evangelischen Kirche<br />
bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sta<strong>di</strong>um der Zersplitterung. Unterschiedliche kirchliche Tarife dürfen<br />
nicht zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ner<strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Konkurrenzsituation mit ‚Kannibalismusgefahr‘ führen. Die<br />
Synode hat zu Recht gefordert, dass an <strong>di</strong>e Stelle <strong>di</strong>eser Zersplitterung wieder e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches<br />
Recht treten muss. Nicht zuletzt zugunsten der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter müssen<br />
für <strong>di</strong>e Diakonie <strong>di</strong>e Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des DW der EKD wieder <strong>di</strong>e Leitwährung<br />
werden. S<strong>in</strong>d für bestimmte Arbeitsfelder oder Regionen besondere Regelungen erforderlich,<br />
können <strong>di</strong>ese <strong>in</strong> den Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien getroffen werden“ (Schneider, Eichstätt 2012).<br />
1.4 Die AVR Diakonie im Überblick<br />
Bis vor wenigen Jahren orientierten sich <strong>di</strong>e Regelwerke der Kirchen <strong>und</strong> ihrer <strong>Ver</strong>bände weitestgehend<br />
am BAT des öffentlichen Dienstes, so dass <strong>di</strong>e <strong>di</strong>fferenzierte Organisationsstruktur<br />
sich kaum <strong>in</strong> unterschiedlichen Regelungen der Arbeitsbeziehungen niederschlug. Dies hat<br />
sich mittlerweile jedoch deutlich verändert. Während für <strong>di</strong>e Beschäftigten der Kirchen auch<br />
weiterh<strong>in</strong> weitgehend das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes (TVöD/B<strong>und</strong> bzw.<br />
TVöD/Länder) angewendet bzw. nachgebildet ist, setzen sich <strong>di</strong>e kirchlichen Wohlfahrtsverbände<br />
für e<strong>in</strong>e Abkehr von den tariflichen Bestimmungen des öffentlichen Dienstes <strong>und</strong> <strong>di</strong>e<br />
Schaffung eigener, davon unabhängiger Arbeitsrechtsregelungen e<strong>in</strong>. Begründet wird <strong>di</strong>es mit<br />
30 Vgl. dazu: Thieme, M., 2011, E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung des Kirchengesetzes über <strong>di</strong>e Gr<strong>und</strong>sätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse<br />
der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong> der Diakonie, 4. Tagung der 11. Synode der EKD,<br />
November 2011, Magdeburg, S. 3.<br />
17
den veränderten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen im Bereich sozialer Dienste. „(…) <strong>di</strong>akonische E<strong>in</strong>rich-<br />
tungen verfügen nicht über Steuere<strong>in</strong>nahmen, sondern f<strong>in</strong>anzieren sich zum großen Teil aus<br />
Leistungsentgelten der Sozialkassen. Mit der Abschaffung des so genannten ‚Selbstkostendeckungspr<strong>in</strong>zips’<br />
<strong>in</strong> den 1990-er Jahren fand hier e<strong>in</strong> Para<strong>di</strong>gmenwechsel statt: Die freie Wohlfahrtspflege<br />
verlor <strong>di</strong>e Garantie, dass ihre Aufgaben <strong>in</strong> voller Höhe erstattet würden. Stattdessen<br />
konkurrieren <strong>di</strong>akonische mit privat-gewerblichen <strong>und</strong> frei-geme<strong>in</strong>nützigen Trägern um<br />
<strong>di</strong>e Erbr<strong>in</strong>gung von Leistungen <strong>und</strong> deren Preise (Ref<strong>in</strong>anzierung).“ 31 Da im Bereich sozialer<br />
Dienste zwischen 70 <strong>und</strong> 80 Prozent der anfallenden Kosten Personalkosten s<strong>in</strong>d, verw<strong>und</strong>ert<br />
es nicht, dass e<strong>in</strong>e „wirtschaftlich solide <strong>di</strong>akonische Personalwirtschaft“ 32 angestrebt wird,<br />
um im Wettbewerb bestehen zu können. Dieser Wettbewerb existiert nicht nur zu privaten<br />
oder frei-geme<strong>in</strong>nützigen, sondern auch zu anderen kirchlichen Anbietern. Beklagt werden<br />
<strong>in</strong>sbesondere: der zugespitzte Druck auf <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>gütungsbed<strong>in</strong>gungen, Outsourc<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Tarifflucht<br />
durch <strong>Leiharbeit</strong>. Daher werden größere Flexibilität (<strong>in</strong>sbesondere bei Bezahlung <strong>und</strong><br />
Arbeitszeit), stärkere Berücksichtigung regionaler Besonderheiten sowie Aufgaben- <strong>und</strong><br />
Klientenorientierung angestrebt. Vor <strong>di</strong>esem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>verse Überarbeitungen der<br />
AVR bei Diakonie <strong>und</strong> Caritas vorgenommen worden.<br />
Novellierungen von AVR Diakonie<br />
Bei der Diakonie gibt es seit 2007 <strong>di</strong>e AVR DW-EKD neu, <strong>di</strong>e jedoch nicht b<strong>und</strong>esweit verb<strong>in</strong>dlich<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>heitlich angewendet werden. Jedes Diakonische Werk (DW) entscheidet eigenstän<strong>di</strong>g<br />
darüber, ob es <strong>di</strong>ese Regelungen (z.T. auch mo<strong>di</strong>fiziert oder ergänzt) oder andere<br />
im Bereich der DW existierende Regelungen anwendet oder selbst solche Regelungen entwickelt<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der ARK abschließt. In der Regel ist <strong>in</strong> der Satzung des jeweiligen DW niedergelegt,<br />
welche arbeitsrechtlichen Regelungen Gr<strong>und</strong>lage der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen<br />
se<strong>in</strong> sollen. S<strong>in</strong>d hier mehrere Regelwerke genannt, so können <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungen selbstän<strong>di</strong>g<br />
entscheiden, welche Regeln für ihre Beschäftigten Geltung haben sollen. 33<br />
31<br />
Diakonie unternehmen, Informationsmagaz<strong>in</strong> des VdDD 2/2008, S. 8f.<br />
32<br />
Ebd. S. 9.<br />
33<br />
E<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränktes Wahlrecht <strong>in</strong> Bezug auf tarifvertragliche Gr<strong>und</strong>lagen gibt es <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Brandenburgschlesische<br />
Oberlausitz (hier können E<strong>in</strong>richtungen das Arbeitsrecht e<strong>in</strong>es gliedkirchlichen DW oder des DW-<br />
EKD oder e<strong>in</strong>er der beteiligten Kirchen übernehmen) sowie <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>land/Westfalen/Lippe (hier können alle <strong>in</strong><br />
kirchengesetzlich anerkannten <strong>und</strong> paritätisch strukturierten <strong>Ver</strong>fahren zustande gekommene Regelwerke angewendet<br />
werden). E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränktes Wahlrecht f<strong>in</strong>den wir <strong>in</strong> Baden (AVR DW-EKD, ggf. mo<strong>di</strong>fiziert, oder<br />
TVöD/B<strong>und</strong>, mo<strong>di</strong>fiziert), <strong>in</strong> der Konföderation Niedersachsen (AVR DW-EKD oder AVR-K), <strong>in</strong> Schleswig-<br />
Holste<strong>in</strong> (AVR DW-EKD, KTD-NEK oder TVöD/B<strong>und</strong>), <strong>in</strong> der Pfalz (AVR DW-EKD oder TVöD oder TV-<br />
18
Eigenstän<strong>di</strong>ge Regelungen gibt es beim DW Bayern, <strong>in</strong> Hessen Nassau, <strong>in</strong> Nordelbien <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
der Konföderation Niedersachsen. Die DW im Osten haben – bis auf Pommern - <strong>di</strong>e AVR<br />
DW-EKD als Gr<strong>und</strong>lage benutzt <strong>und</strong> <strong>in</strong> Anlehnung „landesspezifische“ AVR DW entwickelt<br />
(so z.B. AVR DW Mecklenburg, AVR DW DWBO, AVR DW Mitteldeutschland, AVR DW<br />
Sachsen). Auch <strong>in</strong> Kurhessen-Waldeck <strong>und</strong> <strong>in</strong> Baden liegen regional angepasste Regelungen<br />
vor. Alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Diakonie gibt es mith<strong>in</strong> mehr als e<strong>in</strong> Dutzend Tarifregelungen, <strong>di</strong>e im Rahmen<br />
des "Dritten Weges" zustande gekommen s<strong>in</strong>d. Zusätzlich werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen DW noch<br />
der TVöD bzw. BAT-KF (Rhe<strong>in</strong>land, Westfalen, Lippe, Pfalz, Baden, Württemberg) bzw. <strong>di</strong>e<br />
jeweiligen TV-L angewendet. Hiermit kommt man auf knapp zwei Dutzend TV im Bereich<br />
der Diakonie – ohne deren Ausgründungen zu berücksichtigen, <strong>di</strong>e häufig nicht <strong>di</strong>e AVR,<br />
sondern Haustarife anwenden, wenn überhaupt tarifliche Regelungen Anwendung f<strong>in</strong>den.<br />
Die neuen AVR DW EKD erfassen nach Auskunft des VdDD ca. 150.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
(von ca. 435.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sgesamt), also nach <strong>di</strong>eser Darstellung ca. 34% der Beschäftigten<br />
<strong>in</strong> der Diakonie. Nach der Mitarbeiterstatistik des DWEKD h<strong>in</strong>gegen waren im<br />
Jahr 2008 <strong>di</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Diakonie wie folgt bestimmt:<br />
Tarifierungen <strong>in</strong> der Diakonie: Sept. 2008<br />
Art TVöD angelehnt AVR-DWEKD Regionale AVR Sonstige<br />
Anteil<br />
Beschäftigte 39,2% 22,1% 23,1% 15,6%<br />
Quelle: Mitarbeitendenstatistik zum 01.09.2008. Diakonie Texte - Statistische Informationen - 06.2011. S. 30<br />
Die AVR DW EKD s<strong>in</strong>d somit jedenfalls nicht das b<strong>und</strong>esweit dom<strong>in</strong>ierende Regelwerk der<br />
Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Diakonie. In ihrer quantitativen Relevanz s<strong>in</strong>d sie nach den Angaben<br />
des DW EKD den regionalen AVR <strong>und</strong> den Regelungen analog TVöD nachgeordnet.<br />
Länder), <strong>in</strong> Württemberg (AVR DW-EKD oder AVR Württemberg oder AVR Bayern oder Arbeitsrecht Baden);<br />
ke<strong>in</strong>e Wahlfreiheit gibt es <strong>in</strong> Kurhessen-Waldeck, Mitteldeutschland, Sachsen, Bayern <strong>und</strong> Hessen-Nassau.<br />
19
Übersicht: genutzte Tarifregelungen <strong>in</strong> der Diakonie (Auswahl) 34<br />
Regionales DW Angewendete TV<br />
Nordelbien Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD), AVR DW-<br />
EKD<br />
Konföderation Niedersachsen AVR-K oder kirchlich-<strong>di</strong>akonisches Arbeitsrecht wesentlich<br />
gleichen Inhalts (z.B. AVR DW-EKD)<br />
Rhe<strong>in</strong>land, Westfalen, Lippe BAT-KF, AVR DW-EKD sowie alle <strong>in</strong> kirchengesetzlich<br />
anerkannten, paritätischen <strong>Ver</strong>fahren zustande gekommene<br />
Tarifrechte<br />
Hessen-Nassau Kirchlich-<strong>di</strong>akonische Arbeitsvertragsordnung (KDA-<br />
VO)<br />
Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische AVR DW-DWBO (<strong>in</strong> Anlehnung an AVR DW-EKD)<br />
Oberlausitz<br />
Bayern AVR DW-Bayern<br />
Baden AVR DW-EKD (Fassung Baden), TVöD –B<strong>und</strong> (mo<strong>di</strong>fiziert),<br />
AVR DW-EKD<br />
Württemberg AVR Württemberg = TVöD kommunal, AVR DW-EKD,<br />
AVR Bayern, AVR Bayern, Arbeitsrecht der Diakonie <strong>in</strong><br />
Baden<br />
34<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>er Übersicht aus: <strong>di</strong>akonie unternehmen - Informationsmagaz<strong>in</strong> des VdDD 1/2009, S. 16f.;<br />
vgl. auch Anhang IV.<br />
20
2. Die Ökonomisierung des Sozialsektors <strong>und</strong> ihre Folgen für <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>heit des „Dritten<br />
Wegs“<br />
2.1 Satzungen landeskirchlicher Diakonien im Überblick<br />
Die nachfolgende Übersicht dokumentiert <strong>di</strong>e Regelungen zum Arbeitsrecht <strong>in</strong> den Satzungen<br />
der landeskirchlich zugeordneten Diakonischen Werke. Sie zeigt <strong>di</strong>e Unterschiedlichkeit der<br />
dabei getroffenen Bestimmungen. Während sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Satzungen ke<strong>in</strong>e Aussagen zum<br />
Arbeitsrecht bef<strong>in</strong>den, variieren <strong>di</strong>e Bestimmungen <strong>in</strong> anderen Satzungen <strong>in</strong>sbesondere mit<br />
Blick auf <strong>di</strong>e geforderte <strong>Ver</strong>pflichtung der Mitglieder, sich an <strong>di</strong>e jeweiligen Arbeitsrechtsre-<br />
gelungen der jeweiligen Landeskirche zu halten. In e<strong>in</strong>igen Landeskirchen überlässt man es<br />
den Mitgliedern der Diakonischen Werke, welches Arbeitsrecht der beteiligten Kirchen zur<br />
Anwendung gebracht wird, <strong>in</strong> anderen Landeskirchen bedürfen Ausnahmen von der Anwen-<br />
dung der landeskirchlichen Regelung der ausdrücklichen Genehmigung durch <strong>di</strong>e jeweilige<br />
Landeskirche. E<strong>in</strong>ige Satzungen verpflichten ihre Mitglieder darauf, nur auf dem Dritten Weg<br />
zustande gekommenes Arbeitsrecht anzuwenden, andere führen aus, dass <strong>di</strong>e Mitarbeiter nach<br />
Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen beschäftigt werden müssen, <strong>di</strong>e auf dem strukturellen Gleichgewicht von<br />
Dienstgebern <strong>und</strong> Dienstnehmern beruhen.<br />
Diakonie Baden<br />
(4) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet:<br />
§5, (4), a)<br />
a) <strong>di</strong>e nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der<br />
Evangelischen Landeskirche <strong>in</strong> Baden zustande<br />
gekommenen Arbeitsrechtsregelungen oder <strong>di</strong>e<br />
Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des Diakonischen<br />
Werkes der EKD (AVR) nach Maßgabe des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes<br />
der Evangelischen<br />
Landeskirche <strong>in</strong> Baden oder <strong>in</strong> der Fassung der<br />
<strong>Ver</strong>öffentlichung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen<br />
Kommission des Diakonischen Werkes<br />
der EKD gemäß der Ordnung vom 7. Juni<br />
2001 <strong>in</strong> der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.<br />
Diakonie Bayern Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht, aber AVR<br />
Diakonie der Ev.-ref. Kirchen <strong>in</strong> Bayern<br />
<strong>und</strong> Nordwestdeutschland (Niedersachsen)<br />
Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar<br />
21
Diakonie Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-<br />
Schlesische Oberlausitz<br />
§7, (4), 6.<br />
Diakonie Braunschweig (Niedersachsen)<br />
§8, (2), g)<br />
Diakonie Bremen<br />
§4, 4)<br />
Diakonie Hamburg<br />
§7, (4), b)<br />
Diakonie Hannover (Niedersachsen)<br />
§8, (2), e)<br />
(4) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet<br />
6. Das Arbeitsrecht e<strong>in</strong>es gliedkirchlichen Diakonischen<br />
Werkes oder des DW EKD oder e<strong>in</strong>er<br />
der beteiligten Kirchen zu übernehmen. Der Diakonische<br />
Rat kann von <strong>di</strong>esen Regelungen Ausnahmen<br />
zulassen <strong>und</strong> außerdem Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
bzw. Tarifverträge dem Arbeitsrecht<br />
der Diakonie zuordnen. Die eigenstän<strong>di</strong>gen<br />
Rechte der genossenschaftlichen Diakonie bleiben<br />
unberührt.<br />
(2) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />
g) […] Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen der <strong>in</strong> der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft<br />
aufgr<strong>und</strong> privatrechtlichen Arbeitsvertrags<br />
beruflich Mitarbeitenden das für Diakonische<br />
Rechtsträger <strong>in</strong> der Ev.-luth. Landeskirche<br />
<strong>in</strong> Braunschweig zur Anwendung bestimmte,<br />
kirchliche Arbeitsrecht anzuwenden, soweit nicht<br />
aus Rechtsgründen zw<strong>in</strong>gend anderes Arbeitsrecht<br />
anzuwenden ist;<br />
(4) Mitglieder, <strong>di</strong>e Arbeitsverhältnisse mit ihren<br />
Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern begründen,<br />
s<strong>in</strong>d verpflichtet, das <strong>in</strong> der Bremischen Evangelischen<br />
Kirche jeweils geltende Mitarbeitervertretungsrecht<br />
anzuwenden. Ausnahmen bedürfen<br />
der Genehmigung des Vorstandes <strong>und</strong> der Zustimmung<br />
der Bremischen Evangelischen Kirche.<br />
(4) Die Mitglieder sollen<br />
b) <strong>di</strong>e Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des Diakonischen<br />
Werks der EKD e.V., das <strong>in</strong> der Nordelbischen<br />
Evangelisch-Lutherischen Kirche gültige<br />
Tarifrecht oder e<strong>in</strong> Arbeitsvertragsrecht wesentlich<br />
gleichen Inhalts anwenden.<br />
e) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />
[…] Die Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien der Konföderation<br />
evangelischer Kirchen <strong>in</strong> Niedersachsen<br />
für E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e sich dem ARRGD angeschlossen<br />
haben (AVR-K), oder e<strong>in</strong> anderes<br />
kirchliches <strong>Ver</strong>tragsrecht <strong>in</strong> ihrer jeweils gültigen<br />
Fassung anzuwenden. Das Präsi<strong>di</strong>um kann auf<br />
Antrag e<strong>in</strong> Mitglied von <strong>di</strong>eser Pflicht befreien,<br />
wenn e<strong>in</strong> zw<strong>in</strong>gender Gr<strong>und</strong> vorliegt.<br />
Diakonie Hessen <strong>und</strong> Nassau Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht, aber KDAVO<br />
22
Diakonie Kurhessen-Waldeck<br />
§7, (3), a)<br />
(3) Die […] Mitglieder s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> verpflichtet,<br />
a) das Dienstvertragsrecht e<strong>in</strong>schließlich der Arbeitsrechtsregelung<br />
des Diakonischen Werkes <strong>in</strong><br />
der Fassung der Beschlüsse der zustän<strong>di</strong>gen Arbeitsrechtlichen<br />
Kommission anzuwenden,<br />
Diakonie Lippe (RWL) Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar<br />
Diakonie Mecklenburg<br />
§8, (4)<br />
Diakonie Mitteldeutschland<br />
(Thür<strong>in</strong>gen , Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> Teile<br />
Brandenburgs <strong>und</strong> Sachsens)<br />
§8, (1),h)<br />
(4) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />
c) gr<strong>und</strong>sätzlich e<strong>in</strong> kirchliches Arbeitsrecht, das<br />
auf dem Dritten Weg entstanden ist, <strong>in</strong>sbesondere<br />
AVR DWM oder AVR DW EKD, anzuwenden.<br />
(1)Die Mitglieder haben <strong>di</strong>e Pflicht,<br />
das Arbeitsvertragsrecht der beteiligten Kirchen<br />
e<strong>in</strong>schließlich der Arbeitsrechtsregelungen des<br />
Diakonischen Werkes oder e<strong>in</strong> anderes im Bereich<br />
der Evangelischen Kirchen auf dem Dritten<br />
Weg zustande gekommenes kirchliches Arbeitsrecht<br />
<strong>in</strong> der Fassung der Beschlüsse der jeweils<br />
zustän<strong>di</strong>gen Arbeitsrechtlichen Kommission anzuwenden;<br />
e<strong>in</strong>e Abweichung von der ersten Alternative<br />
ist dem Diakonischen Werk vor Anwendung<br />
anzuzeigen,<br />
Diakonie Oldenburg (Niedersachsen) Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar<br />
Diakonie Pfalz <strong>und</strong> Saarpfalz Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht<br />
Diakonie Pommern Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht<br />
Diakonie RWL Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht<br />
Diakonie Rhe<strong>in</strong>land (RWL)<br />
§5, (1), b)<br />
(1) b) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet, <strong>di</strong>e Mitarbeitenden<br />
nach Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen zu beschäftigen,<br />
<strong>di</strong>e <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kirchengesetzlich anerkannten<br />
<strong>Ver</strong>fahren gesetzt werden, welches auf strukturellem<br />
Gleichgewicht zwischen der Dienstgeber-<br />
<strong>und</strong> Dienstnehmerseite beruht.<br />
Diakonie Sachsen Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar, aber AVR<br />
Diakonie Schaumburg-Lippe (Niedersachsen)<br />
Diakonie Schleswig-Holste<strong>in</strong><br />
§5, 2., h<br />
Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar<br />
2. Die Mitglieder s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere verpflichtet,<br />
h. <strong>di</strong>e Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des Diakonischen<br />
Werks der EKD e.V., das <strong>in</strong> der Nordelbi-<br />
23
Diakonie Westfalen (RWL)<br />
§4, (2), 7., a)<br />
Diakonie Württemberg<br />
§4, (2), 8.<br />
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche geltende<br />
Tarifrecht oder e<strong>in</strong> <strong>in</strong> Anlehnung an <strong>di</strong>ese Arbeitsrechtsregelungen<br />
gestaltetes Arbeitsvertragsrecht<br />
anzuwenden.<br />
(2)Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />
7. a) <strong>di</strong>e Mitarbeitenden nach Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
zu beschäftigen, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kirchengesetzlich<br />
anerkannten <strong>Ver</strong>fahren gesetzt werden, welches<br />
auf strukturellem Gleichgewicht zwischen<br />
der Dienstgeber- <strong>und</strong> Dienstnehmerseite beruht.<br />
2) Die Mitglieder nach §3 Abs. 1 Nr. 2 s<strong>in</strong>d darüber<br />
h<strong>in</strong>aus verpflichtet:<br />
8. mit ihren privatrechtlich angestellten Mitarbeitern<br />
Arbeitsverträge abzuschließen oder bestehende<br />
Arbeitsverträge dah<strong>in</strong>gehen zu ändern,<br />
dass deren M<strong>in</strong>dest<strong>in</strong>halt mit den nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz<br />
der Evangelischen<br />
Landeskirche Württemberg geltenden arbeitsrechtlichen<br />
Regelungen übere<strong>in</strong>stimmt <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
ihren Satzungen e<strong>in</strong>e entsprechende <strong>Ver</strong>pflichtung<br />
aufzunehmen. E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>er Freikirche<br />
s<strong>in</strong>d an <strong>di</strong>e arbeitsrechtlichen Ordnungen<br />
ihrer Freikirche geb<strong>und</strong>en.<br />
2.2 Die Ökonomisierung des Sozialsektors: Folgen für <strong>di</strong>akonische Sozialunternehmen<br />
Die Träger <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen im Sozialsektor haben <strong>in</strong> den vergangenen Jahren e<strong>in</strong>en Modernisierungsprozess<br />
<strong>in</strong>itiiert, <strong>in</strong> dessen Rahmen es primär darum geht, aus weltanschaulich<br />
<strong>und</strong> sozialpolitisch begründeten geme<strong>in</strong>nützigen Organisationen sozialwirtschaftliche Leistungserbr<strong>in</strong>ger<br />
zu formen, deren zentrale Aufgabe <strong>di</strong>e Erbr<strong>in</strong>gung von professionellen Dienstleistungen<br />
ist, deren Leistungserbr<strong>in</strong>gung <strong>und</strong> Ergebnisse unter Effektivitäts- <strong>und</strong> Effizienzkriterien<br />
darstellbar <strong>und</strong> kontrollierbar s<strong>in</strong>d (vgl. Maelicke 1998).<br />
Viele Träger von E<strong>in</strong>richtungen begegnen <strong>di</strong>esen Herausforderungen, <strong>in</strong>dem sie Dienste zurückfahren,<br />
Leistungspotenziale ausgliedern, sich zu größeren E<strong>in</strong>heiten zusammenschließen,<br />
letztlich verkaufen oder schließen. Auf der Ebene der Spitzenverbände werden <strong>in</strong>sbesondere<br />
Krankenhäuser <strong>und</strong> Altenheime <strong>in</strong> eigene, rechtlich selbststän<strong>di</strong>ge Betriebsträgergesellschaften<br />
überführt <strong>und</strong> zusammengeschlossen. Es entstehen <strong>in</strong> der Tendenz immer größere Be-<br />
triebse<strong>in</strong>heiten, <strong>di</strong>e teilweise verbandsübergreifend tätig s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> sich damit den tra<strong>di</strong>tionellen<br />
24
Steuerungsgremien noch weiter entziehen als <strong>di</strong>es <strong>in</strong> den alten Strukturen der Fall war. An <strong>di</strong>e<br />
Stelle des klassischen dualen Systems von öffentlichen <strong>und</strong> freigeme<strong>in</strong>nützigen Trägern im<br />
Sozialsektor tritt so e<strong>in</strong> Mix von (zahlenmäßig abnehmenden) öffentlichen Trägern, freigeme<strong>in</strong>nützigen<br />
<strong>und</strong> privaten Leistungsanbietern, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Wettbewerb zue<strong>in</strong>ander stehen<br />
<strong>und</strong> um Preise <strong>und</strong> Qualitäten konkurrieren. Durch <strong>Ausgliederung</strong> <strong>und</strong> Überführung ihrer E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>in</strong> privatrechtliche Organisationsformen versuchen <strong>di</strong>e freigeme<strong>in</strong>nützigen Träger<br />
<strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e Flexibilität <strong>in</strong> der Aufgabenerfüllung zu steigern <strong>und</strong> dem aus der<br />
Budgetierung resultierenden Druck zu Rationalisierung <strong>und</strong> Effektivierung zu begegnen.<br />
Hierbei lassen sich verbandsübergreifend – also auch für <strong>di</strong>e <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialunternehmen<br />
– folgende Entwicklungen feststellen:<br />
2.2.1 Geschäftsfeldpolitik<br />
Die tra<strong>di</strong>tionelle Art <strong>und</strong> Weise verbandlicher Leistungspolitik, d. h. <strong>di</strong>e bestehende Arbeitsteilung<br />
zwischen den verbandlichen Territorialgliederungen, zwischen <strong>di</strong>esen <strong>und</strong> den Fachverbänden,<br />
<strong>di</strong>e fehlende leistungs-/marktbezogen spezialisierte Aufgabenbündelung sowie <strong>di</strong>e<br />
überkommene Art der Erbr<strong>in</strong>gung <strong>in</strong>terner Dienstleistungen reichen aus Sicht der staatlichen<br />
Auftraggeber <strong>und</strong> auch aus Sicht der Träger <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen nicht mehr aus, <strong>di</strong>e im Leitbild<br />
formulierte „Mission“ unter den neuen Bed<strong>in</strong>gungen der Leistungserbr<strong>in</strong>gung e<strong>in</strong>zulösen.<br />
Hierzu werden <strong>di</strong>e Unternehmen e<strong>in</strong>es Leistungsfeldes als eigenstän<strong>di</strong>ger Geschäftsbereich<br />
aus dem jeweiligen Portfolio von Aufgaben der territorialen <strong>Ver</strong>bandsgliederungen herausgenommen<br />
<strong>und</strong> zur Bearbeitung der spezifischen Aufgaben, <strong>di</strong>e der jeweilige Markt stellt, freigesetzt.<br />
Durch e<strong>in</strong>e geschäftsfeldpolitische Steuerung, <strong>di</strong>e ausschließlich für <strong>di</strong>e Entwicklung<br />
e<strong>in</strong>es Geschäftsbereichs zustän<strong>di</strong>g ist, soll darüber e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Geschäftspolitik gewährleistet<br />
werden.<br />
2.2.2 Trägerkonzentration <strong>und</strong> Aufgabe des Territorialpr<strong>in</strong>zips<br />
Trägerkonzentrationen <strong>und</strong> Fusionen f<strong>in</strong>den gegenwärtig flächendeckend auf der Ebene aller<br />
<strong>Ver</strong>bände statt. Es werden e<strong>in</strong>richtungsübergreifender <strong>Ver</strong>bünde <strong>in</strong> GmbH-Form mit der Zielsetzung<br />
gebildet, sich etwa im Rahmen von Ausschreibungsverfahren durch „Größe“ Konkurrenzvorteile<br />
zu sichern, <strong>und</strong> um sich gegen zunehmende Konzentrationsbewegungen <strong>und</strong> kapitalstarke,<br />
überregional agierende Anbieter behaupten zu können. Zur Entwicklung größerer<br />
Betriebse<strong>in</strong>heiten gehört auch <strong>di</strong>e Tendenz, <strong>di</strong>e gegebenen territorialen Angebotsstruktur <strong>und</strong><br />
25
<strong>di</strong>e Neuordnung der Geschäftsfelder im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er „Portfolio-Bere<strong>in</strong>igung“ zu überw<strong>in</strong>den.<br />
Rationalisierungsprozesse bei der Leistungserbr<strong>in</strong>gung <strong>und</strong> -abwicklung (<strong>Ver</strong>waltung, Cont-<br />
roll<strong>in</strong>g etc.), <strong>di</strong>e geme<strong>in</strong>same Angebotsentwicklung <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Aufteilung <strong>in</strong> Sparten s<strong>in</strong>d ebenso<br />
Ausdruck <strong>di</strong>eses Prozesses. Strategien der externen <strong>Ver</strong>netzung sollen darüber letztlich auch<br />
das wirtschaftliche Investitionsrisiko (z. B. <strong>in</strong> Großgeräte oder Infrastruktur) mildern,<br />
zugleich <strong>di</strong>e K<strong>und</strong>enattraktivität mit e<strong>in</strong>er größeren Leistungsspanne durch Angebotspartner-<br />
schaften steigern - <strong>und</strong> <strong>in</strong>sgesamt <strong>di</strong>e Kosten weiter reduzieren.<br />
<strong>Ver</strong>b<strong>und</strong>en ist <strong>di</strong>e Trägerkonzentration mit der Überw<strong>in</strong>dung des tra<strong>di</strong>tionellen Territorialpr<strong>in</strong>zips.<br />
Große Träger agieren z.T. b<strong>und</strong>esweit oder sogar europaweit <strong>und</strong> treten <strong>in</strong> Konkurrenz<br />
zu regionalen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Werken oder <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen. Träger, <strong>di</strong>e günstigere<br />
Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien nutzen können, haben auf <strong>di</strong>ese Weise e<strong>in</strong>en Wettbewerbsvorteil<br />
gegenüber Trägern, <strong>di</strong>e sich <strong>in</strong> für sie ungünstigeren Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien bef<strong>in</strong>den.<br />
Auf <strong>di</strong>ese Art <strong>und</strong> Weise wachsen zugleich <strong>di</strong>e Bedürfnisse überregional tätiger Träger,<br />
e<strong>in</strong>richtungsspezifische Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien zu entwickeln, <strong>di</strong>e den jeweiligen unternehmerischen<br />
Besonderheiten Rechnung tragen, <strong>und</strong> sich damit vom System e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>heitlichen<br />
Arbeitsrechts <strong>in</strong>nerhalb von Kirche <strong>und</strong> Diakonie abzukoppeln.<br />
2.2.3 <strong>Ausgliederung</strong><br />
Das Ausgliedern von Betrieben oder Betriebsbestandteilen ist e<strong>in</strong> flächendeckend beobachtbarer<br />
Tatbestand <strong>in</strong> der Sozialwirtschaft. Durch <strong>di</strong>e <strong>Ausgliederung</strong> wird <strong>di</strong>e professionelle Betriebsführung<br />
(im ausgegliederten Zweckbetrieb) von der ideellen <strong>Ver</strong>bandstätigkeit (im übergeordneten<br />
Idealvere<strong>in</strong>) getrennt. Durch <strong>di</strong>e GmbHs wird der Vorstand von wirtschaftlicher<br />
Rout<strong>in</strong>earbeit entlastet, er kann sich auf <strong>di</strong>e „ideelle Führung“ konzentrieren. Die <strong>Ver</strong>antwortung<br />
für den Geschäftsbetrieb wird vom Vorstand auf <strong>di</strong>e Geschäftsführung verlagert.<br />
Unter dem Aspekt der Privatisierung im Sozialsektor <strong>und</strong> deren Folgen für <strong>di</strong>e wohlfahrtsverbandliche<br />
Arbeit me<strong>in</strong>t <strong>Ausgliederung</strong> <strong>und</strong> Outsourc<strong>in</strong>g <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>lagerung der Geschäftsführung<br />
ganzer Betriebe unter möglichem E<strong>in</strong>schluss des Betriebsvermögens auf rechtlich selbststän<strong>di</strong>ge<br />
E<strong>in</strong>heiten außerhalb der <strong>Ver</strong>bandsstruktur des <strong>Ver</strong>bandes. Aus Sicht der <strong>Ver</strong>bände<br />
lassen es Effektivitäts- <strong>und</strong> Effizienzgesichtspunkte notwen<strong>di</strong>g ersche<strong>in</strong>en, zur Nutzung von<br />
Synergien Betriebe oder Teile davon <strong>in</strong> eigenstän<strong>di</strong>gen Rechtsformen zusammenzuschließen.<br />
Dies wird <strong>in</strong>sbesondere dann vorgenommen, wenn <strong>Ver</strong>bandsgliederungen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er<br />
Region ihre Dienste zu e<strong>in</strong>em Geschäftsfeld zusammenfügen. Durch <strong>di</strong>e Trennung von haupt-<br />
26
amtlich betriebenen, professionellen Tätigkeitsfeldern (z.B. <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er GmbH) <strong>und</strong> ehrenamtlichen<br />
<strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>en, <strong>di</strong>e ergänzende Leistungen erbr<strong>in</strong>gen, wird angestrebt, e<strong>in</strong>e stärkere<br />
Marktausrichtung zu erreichen, was mittel- bis langfristig zu e<strong>in</strong>er Konkurrenzfähigkeit im<br />
Wettbewerb mit privaten Anbietern führen soll. Als Vorteile von <strong>Ausgliederung</strong>en werden <strong>di</strong>e<br />
schnellere Reaktionsfähigkeit durch <strong>Ver</strong>meidung basisdemokratischer Entscheidungen über<br />
Restrukturierungen <strong>und</strong> <strong>di</strong>e höhere Professionalität der Entscheidungsf<strong>in</strong>dung durch <strong>di</strong>e Besetzung<br />
von Führungsfunktionen mit hauptamtlichen Mitarbeitern genannt. Auch <strong>di</strong>e Möglichkeit<br />
e<strong>in</strong>er Lösung von den – meist an den BAT/TVöD angelehnten – Tarifverträgen der<br />
Wohlfahrtsverbände wird häufig als Vorteil e<strong>in</strong>er <strong>Ausgliederung</strong> gesehen. Auch hier wird der<br />
Wahl e<strong>in</strong>er privatwirtschaftlichen Rechtsform e<strong>in</strong>e quasi automatische Effizienz- <strong>und</strong> Effektivitätssteigerung<br />
zugeschrieben, ähnlich den Erwartungen <strong>di</strong>e schon zu e<strong>in</strong>em viel früheren<br />
Zeitpunkt für <strong>Ausgliederung</strong>en aus der öffentlichen <strong>Ver</strong>waltung formuliert wurden.<br />
2.2.4 Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong><br />
Die Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gehört zu den Eigenarten<br />
der sich unternehmerisch entwickelnden Sozialwirtschaft. Arbeitnehmerüberlassung,<br />
umgangssprachlich „<strong>Leiharbeit</strong>“ genannt, ist <strong>di</strong>e gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmern bei e<strong>in</strong>em Entleiher. Gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz<br />
(AÜG) bedarf <strong>di</strong>ese Überlassung der Erlaubnis durch <strong>di</strong>e jeweils zustän<strong>di</strong>ge Agentur für<br />
Arbeit (AÜG §1 Absatz 1). Gewerbsmäßig ist e<strong>in</strong>e Arbeitnehmerüberlassung dann, wenn sie<br />
auf Dauer angelegt <strong>und</strong> mit dem Ziel der Gew<strong>in</strong>nerzielungsabsicht ausgeübt wird, also für den<br />
<strong>Ver</strong>leiher mehr als nur kostendeckend se<strong>in</strong> soll. Bei der jüngsten Novellierung des AÜG (<strong>in</strong><br />
Kraft seit Dezember 2011) war es erklärte Absicht des Gesetzgebers, durch Aufhebung der<br />
<strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong> begrenzenden Regelungen <strong>di</strong>e Flexibilität des Arbeitsmarktes zu steigern <strong>und</strong><br />
auf <strong>di</strong>esem Weg den von Arbeitslosigkeit Betroffenen e<strong>in</strong>en Zugang zur Beschäftigung zu<br />
eröffnen <strong>und</strong> zusätzliche Beschäftigung zu schaffen. Zugleich wurde damit e<strong>in</strong>e „dauerhafte“<br />
Besetzung von Arbeitsplätzen mit <strong>Leiharbeit</strong>ern als „unzulässig“ erklärt (e<strong>in</strong>e Def<strong>in</strong>ition des<br />
Begriffs „dauerhaft“ bleibt allerd<strong>in</strong>gs den Arbeitsgerichten überlassen).<br />
<strong>Leiharbeit</strong> ist <strong>in</strong> der Diakonie je nach Größe der E<strong>in</strong>richtung <strong>und</strong> je nach Region/Landesverband<br />
unterschiedlich weit verbreitet. Insbesondere s<strong>in</strong>d es große Sozialkonzerne,<br />
<strong>di</strong>e unternehmenseigene <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen unterhalten oder unterhielten. So haben zum Beispiel<br />
Träger wie Agaplesion, Hessen (AGAPLESION Personalservice, APS), Stiftung Friede-<br />
27
horst, Bremen (Parat Personal <strong>und</strong> Service GmbH), Stiftung Bethel, Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(Dienstleistung Zeitarbeit GmbH, DiZ), <strong>di</strong>e Rummelsberger Anstalten, Bayern (Personal-<br />
Agentur für soziale Dienstleistungen GmbHSchwarzenbruck, PAKT), das Alexanderstift e.V.,<br />
Württemberg (Service-GmbH), Paul<strong>in</strong>enpflege W<strong>in</strong>nenden, Württemberg (Arbeit, Bildung,<br />
Qualifizierung, ABQ-Service-GmbH) oder das Evangelische Johannesstift, Berl<strong>in</strong> (Perso-<br />
naGrata GmbH) Zeitarbeitsfirmen gegründet.<br />
Meist handelt es sich dabei um 100-prozentige Töchter der Diakonischen E<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong><br />
der Rechtsform e<strong>in</strong>er GmbH oder – seltener – gGmbH, oft mit (personal-)identischer Geschäftsführung<br />
wie <strong>di</strong>e Muttergesellschaft. Das verfolgte Konzept sieht dabei <strong>in</strong> der Regel so<br />
aus, dass <strong>di</strong>e geme<strong>in</strong>nützige Muttergesellschaft (kirchlicher Arbeitgeber, Anwender von AVR<br />
oder BAT-KF) e<strong>in</strong>e gewerbliche Tochtergesellschaft gründet, deren Gegenstand <strong>di</strong>e Überlassung<br />
von Personal an das Mutterunternehmen, weitere Tochtergesellschaften bzw. fremde<br />
Dritte ist. Gegenüber der Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er externen <strong>Leiharbeit</strong>sfirma bietet <strong>di</strong>eses Modell<br />
den Vorteil, dass <strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>teuerung durch <strong>di</strong>e Umsatzsteuer anfällt („umsatzsteuerliche<br />
Organschaft“). Die <strong>Leiharbeit</strong>sfirma verfügt über e<strong>in</strong>e Erlaubnis zur <strong>Ver</strong>leihung<br />
von Personal <strong>und</strong> beschäftigt zum Beispiel Pflegehilfskräfte, Hauswirtschaftskräfte,<br />
mitunter auch qualifizierte Fachkräfte. Die Mitarbeiter werden nach e<strong>in</strong>em gegenüber dem<br />
Mutterunternehmen günstigeren Tarifvertrag (für Unternehmen der Zeitarbeit) vergütet. Hierdurch<br />
wird verh<strong>in</strong>dert, dass der <strong>Leiharbeit</strong>nehmer e<strong>in</strong>en Anspruch darauf hat, für <strong>di</strong>e Zeit der<br />
Überlassung <strong>in</strong>sbesondere das gleiche Arbeitsentgelt zu erhalten wie vergleichbare Arbeitnehmer<br />
des Entleihbetriebs, also z.B. e<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>gütung nach Maßgabe der AVR sowie e<strong>in</strong>e <strong>in</strong><br />
den AVR verankerte zusätzliche Altersversorgung. Der sogenannte „Equal-Pay-Gr<strong>und</strong>satz“<br />
wird durch <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>barung der Anwendung e<strong>in</strong>es Tarifvertrags für Zeitarbeit (gesetzlich<br />
legitimiert) ausgehebelt. Die gegenüber kirchlichen Tarifen ger<strong>in</strong>ger vergüteten Mitarbeiter<br />
des <strong>Leiharbeit</strong>sunternehmens werden dann an das „tariflich geb<strong>und</strong>ene“ Mutterunternehmen<br />
zwecks Erzielung dauerhafter Personalkostensenkung ausgeliehen; <strong>Leiharbeit</strong> <strong>di</strong>ent somit <strong>in</strong><br />
vielen Fällen nicht nur zur Abfederung vorübergehender Personalengpässe sondern vielmehr<br />
dem dauerhaften Ersetzen „teurerer“ AVR-Mitarbeiter.<br />
Die <strong>Ver</strong>gütung der <strong>Leiharbeit</strong>er/<strong>in</strong>nen orientiert sich an den „marktüblichen“ Zeitarbeits-<br />
Tarifen. Anwendung f<strong>in</strong>den sowohl der Zeitarbeitstarifvertrag der <strong>in</strong>zwischen als nicht tariffähig<br />
beurteilten Tarifgeme<strong>in</strong>schaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit Personal-<br />
Service-Agenturen, CGZP, als auch der Zeitarbeitstarifvertrag des DGB. Beide Tarifverträge<br />
28
liegen erheblich unter den Regelungen der AVR DW EKD bzw. des BAT-KF, Mitarbei-<br />
ter/<strong>in</strong>nen der <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen erhalten also immer e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres Entgelt, reduzierte Zu-<br />
schläge für Mehr- <strong>und</strong> Nachtarbeit; zudem entfallen <strong>in</strong> der Regel Zusatzleistungen wie Al-<br />
tersversorgung <strong>und</strong>/oder Jahressonderzahlungen (13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld) etc. Leihar-<br />
beit wird also – so <strong>di</strong>e Beobachtung e<strong>in</strong>er der von uns befragten Mitarbeitervertretungen– „<strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie zum Drücken der Personalkosten e<strong>in</strong>gesetzt.“.<br />
Die meisten <strong>di</strong>akonieeigenen <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen legen ausdrücklich Wert auf ihre Nähe zur<br />
Diakonie, von deren Image sie profitieren möchten. So wirbt beispielsweise <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirma<br />
PersonaGrata, Berl<strong>in</strong>, mit dem christlichen Ethos ihrer Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen:<br />
„Die PersonaGrata GmbH ist e<strong>in</strong> junges <strong>und</strong> <strong>in</strong>novatives Unternehmen des Evangelischen<br />
Johannesstifts. Wir beschäftigen im Bereich der Diakonie derzeit 140 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen, <strong>di</strong>e<br />
orientiert am christlichen Leitbild <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen unserer K<strong>und</strong>en tätig s<strong>in</strong>d.“<br />
(http://www.personagrata.<strong>in</strong>fo/public/unternehmen/unternehmen.html).<br />
Zur gängigen Praxis gehört es offenbar, gekün<strong>di</strong>gte Mitarbeiter über <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen zu<br />
schlechteren Kon<strong>di</strong>tionen wieder e<strong>in</strong>zustellen.<br />
Immer wieder – so berichtet beispielsweise <strong>di</strong>e AGMAV Württemberg <strong>in</strong> den AGMAV-<br />
Mitteilungen Nr. 101, Ausgabe März 2011 – werde „versucht <strong>und</strong> teilweise auch erreicht,<br />
Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kollegen dazu zu drängen, ihre bestehenden AGV-Arbeitsverträge aufzugeben<br />
<strong>und</strong> bei den eigenen Tochterunternehmen e<strong>in</strong>en neuen, schlechteren Arbeitsvertrag<br />
zu unterschreiben. (...) Immer wieder stellen wir fest, dass <strong>di</strong>e MAV beim E<strong>in</strong>satz von <strong>Leiharbeit</strong>er<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>ern gar nicht beteiligt wird.“<br />
(www.agmav-wuerttemberg.de/mitteilungen/101/101_prekaere_arbeitsverhaeltnisse.html)<br />
Die Interessenvertretungsorgane Mitarbeitervertretung oder Betriebsräte werden für <strong>di</strong>ese<br />
Beschäftigtengruppen <strong>in</strong> aller Regel als nicht zustän<strong>di</strong>g erklärt; <strong>Leiharbeit</strong>er/<strong>in</strong>nen haben <strong>in</strong>sofern<br />
betriebs<strong>in</strong>tern ke<strong>in</strong>e Lobby. Dennoch sahen oder sehen sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Fällen <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretungen<br />
als zustän<strong>di</strong>g an <strong>und</strong> nehmen es <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Hand, <strong>di</strong>e ungleichen Beschäftigungsverhältnisse<br />
zwischen Mitarbeitern „erster Klasse“ <strong>und</strong> „zweiter Klasse“ zu thematisieren,<br />
sie öffentlich zu machen <strong>und</strong> zu skandalisieren. So war es bei der <strong>Leiharbeit</strong>sfirma der<br />
<strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Stiftung Friedehorst, Bremen, <strong>di</strong>e MAV, <strong>di</strong>e – zunächst ohne Erfolg vor dem<br />
Kirchengericht Bremen, dann letzt<strong>in</strong>stanzlich vor dem obersten Kirchengericht der EKD <strong>in</strong><br />
Hannover – e<strong>in</strong>e rechtliche Besserstellung der <strong>Leiharbeit</strong>er/<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>geklagt hat. H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>:<br />
29
Die Mitarbeitervertretung verweigerte <strong>di</strong>e Zustimmung zur befristeten Anstellung e<strong>in</strong>er Mit-<br />
arbeiter<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schwerpunktbereich <strong>di</strong>akonischer Tätigkeit; <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>nehmer<strong>in</strong> sollte<br />
über e<strong>in</strong>e Personalservice-GmbH ausgeliehen werden, welche wiederum e<strong>in</strong>e Tochtergesell-<br />
schaft der Dienststelle war.<br />
Dieses Urteil der EKD vom 9. Oktober 2006 zur <strong>Leiharbeit</strong> 1 ist auch für andere <strong>di</strong>akonische<br />
<strong>Leiharbeit</strong>sfirmen von großer Bedeutung, denn <strong>di</strong>e evangelische Kirche hat damit <strong>di</strong>e „auf<br />
Dauer angelegte Beschäftigung von <strong>Leiharbeit</strong>nehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>nehmern“ als mit<br />
„dem kirchlichen Gr<strong>und</strong>satz des Leitbildes von der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft“ unvere<strong>in</strong>bar erklärt.<br />
In der Urteilsbegründung führen <strong>di</strong>e Richter aus, dass <strong>di</strong>e von der evangelischen Kirche <strong>in</strong><br />
Anspruch genommene Dienstgeme<strong>in</strong>schaft nicht nur als religiöse Ausrichtung zu verstehen<br />
ist, sondern als organisatorische Geme<strong>in</strong>schaft von Dienstgeber <strong>und</strong> Dienstnehmer, <strong>und</strong> zwar<br />
auch im rechtlichen S<strong>in</strong>ne. Dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung widerspricht demnach der<br />
für <strong>di</strong>e Dienstgeme<strong>in</strong>schaft geforderten organisatorischen E<strong>in</strong>heit – <strong>und</strong> zwar durch <strong>di</strong>e stän<strong>di</strong>ge<br />
„Spaltung“ der Belegschaft <strong>und</strong> durch <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>doppelung der Dienststellenleitungen.<br />
In <strong>di</strong>esem Urteil s<strong>in</strong>d vor allem folgende <strong>di</strong>skrim<strong>in</strong>ierungsrelevanten Argumente von Bedeutung:<br />
Das Gericht hält <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>stellung im vorliegenden Fall „mit der Präambel zum MVG<br />
(…), aber auch mit der Richtl<strong>in</strong>ie des Rates der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland nach<br />
Art. 9b GO.EKD (Loyalitätsrichtl<strong>in</strong>ie …) (…) <strong>und</strong> dem daraus abgeleiteten Gr<strong>und</strong>pr<strong>in</strong>zip des<br />
Leitbildes der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft nicht vere<strong>in</strong>bar“( II.2). Es stellt fest: „Die <strong>Leiharbeit</strong>nehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>nehmer schulden der Dienststelle, an <strong>di</strong>e sie ausgeliehen s<strong>in</strong>d, <strong>und</strong><br />
deren Mitarbeitenden unmittelbar weder ex officio noch kraft Arbeitsvertrags <strong>di</strong>e für e<strong>in</strong>e<br />
Dienstgeme<strong>in</strong>schaft prägende Loyalität, noch haben sie e<strong>in</strong>e solche gleichermaßen wie unmittelbar<br />
Be<strong>di</strong>enstete von den Dienststellenleitungen oder den Mitarbeitenden der Dienststelle zu<br />
erwarten. Die Loyalitätspflichten <strong>und</strong> -rechte bestehen vielmehr nur im <strong>Ver</strong>hältnis gegenüber<br />
ihrer <strong>Ver</strong>trags<strong>di</strong>enststelle.“ (II.2 bbb) Für <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>nehmer, <strong>di</strong>e aus eigenen oder fremden<br />
Personalserviceagenturen kommen, gilt daher nicht der Dritte Weg <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Loyalitätsrichtl<strong>in</strong>ie,<br />
sie s<strong>in</strong>d nicht Teil der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft (II.2.bbb). Die Dienststelle sieht es dementsprechend<br />
auch nicht als e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> ihren Loyalitätspflichten begründete Aufgabe an, für etwaige<br />
Weiterbeschäftigungen ihrer befristeten <strong>Leiharbeit</strong>nehmer <strong>in</strong> irgende<strong>in</strong>er Weise <strong>Ver</strong>antwortung<br />
zu tragen.<br />
1<br />
Beschluss des KGH.EKD vom 9. Oktober 2006, Az. II-0124/M35-06; abrufbar unter: http://www.ekd.de. Die<br />
nachfolgenden Angaben im Text beziehen sich auf <strong>di</strong>eses Urteil.<br />
30
Zusammengefasst enthält das Urteil folgende Punkte:<br />
- Das Institut der <strong>Leiharbeit</strong> ist <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Dienstgebern nicht verschlossen.<br />
- Zur Überbrückung kurzzeitigen Beschäftigungsbedarfs darf zum Instrument der <strong>Leiharbeit</strong><br />
gegriffen werden, z.B. <strong>in</strong> <strong>Ver</strong>tretungsfällen <strong>in</strong>folge Urlaub, Krankheit, bei kurzfristigem<br />
Spitzenbedarf.<br />
- Die auf Dauer angelegte Beschäftigung von <strong>Leiharbeit</strong>nehmern, <strong>di</strong>e Substituierung, der<br />
Ersatz von Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter durch <strong>Leiharbeit</strong>nehmer <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>nehmer<strong>in</strong>nen<br />
ist mit dem Kirchenarbeitsrecht nicht vere<strong>in</strong>bar; sie widerspricht dem<br />
kirchlichen Gr<strong>und</strong>satz des Leitbildes von der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft.<br />
- Daraus folgt, dass <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung zum E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es <strong>Leiharbeit</strong>nehmers<br />
oder e<strong>in</strong>er <strong>Leiharbeit</strong>nehmer<strong>in</strong> jedenfalls dann berechtigt verweigert,<br />
wenn e<strong>in</strong> <strong>Leiharbeit</strong>nehmer oder e<strong>in</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>nehmer<strong>in</strong> für zwei Jahre befristet als<br />
Pflegehelfer<strong>in</strong> im Beh<strong>in</strong>dertenbereich Tagesförderstätte beschäftigt werden soll.<br />
(Vor<strong>in</strong>stanz: Geme<strong>in</strong>sames Kirchengericht der Bremischen Ev. Kirche - II. Diakonische<br />
Kammer -, Beschluss vom 21. April 2006, Az.: DII-6/2006).<br />
Insgesamt gesehen zeigt sich mittlerweile, dass der E<strong>in</strong>satz von dauerhafter, „ersetzender<br />
<strong>Leiharbeit</strong>“ <strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen offenbar tendenziell rückläufig ist, was sich sicherlich<br />
vor allem aus den sich ändernden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen <strong>und</strong> aus der<br />
öffentlichen Skandalisierung <strong>di</strong>eser Beschäftigungsform erklärt.<br />
So begann der E<strong>in</strong>satz von <strong>Leiharbeit</strong> bzw. <strong>di</strong>e Gründung eigener <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen durch <strong>di</strong>e<br />
Novellierung des Arbeitnehmergesetzes (seit 2003, im Gefolge der sog. Hartz-Gesetze) attraktiv<br />
zu werden.<br />
Das Kirchengerichtsurteil der EKD vom Oktober 2006 sowie – begleitend dazu – <strong>di</strong>e <strong>di</strong>versen<br />
öffentlichkeitswirksamen Kampagnen gegen <strong>di</strong>ese Praxis, <strong>di</strong>e von den Sozialverbänden als<br />
imageschä<strong>di</strong>gend wahrgenommen wurden, trugen dazu bei, dass sich <strong>in</strong> der Konsequenz viele<br />
Träger von e<strong>in</strong>em umfassenden <strong>und</strong> dauerhaften E<strong>in</strong>satz von <strong>Leiharbeit</strong>er/<strong>in</strong>nen verabschiedet<br />
haben.<br />
Das Geschäft der <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen ist vielfach auch deshalb schwieriger geworden, weil angesichts<br />
des zunehmenden Fachkräftemangels nicht nur <strong>in</strong> der Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege,<br />
sondern auch im Bereich der Erzieher/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Heilerziehungspfleger/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>rich-<br />
31
tungen e<strong>in</strong> Umdenken stattf<strong>in</strong>det. Während früher oft schon nach zwei Jahren <strong>di</strong>e Beschäftig-<br />
ten entlassen <strong>und</strong> neues Personal e<strong>in</strong>gestellt wurde, versucht man heute, den Beschäftigten<br />
e<strong>in</strong>e berufliche Perspektive zu bieten, um sie an den Arbeitgeber zu b<strong>in</strong>den. E<strong>in</strong>ige Hilfefelder<br />
wetteifern bereits mit den <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen um <strong>di</strong>e Fachkräfte <strong>und</strong> haben <strong>in</strong> der Regel besse-<br />
re Chancen.<br />
An der <strong>Leiharbeit</strong> zur „Abdeckung von Personalengpässen“ wird jedoch ausdrücklich festgehalten.<br />
Insbesondere <strong>in</strong> der Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege spielt <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong> weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
große Rolle <strong>und</strong> wird vielfach sogar als „unverzichtbar“ deklariert.<br />
32
3. Zur gegenwärtigen Situation <strong>in</strong> den Diakonischen Werken der Landeskirchen – Er-<br />
gebnisse empirischer Erhebungen<br />
3.1 Diakonisches Werk Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe (DW RWL)<br />
„Die Diakonie Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe e.V. ist der größte <strong>di</strong>akonische Landesverband <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>er der größten Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Sie erstreckt sich über Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen,<br />
Teile von Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz, dem Saarland <strong>und</strong> Hessen. Die Diakonie RWL<br />
repräsentiert 4.900 evangelische Soziale<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> denen 130.000 Mitarbeitende hauptamtlich<br />
<strong>und</strong> 200.000 ehrenamtlich tätig s<strong>in</strong>d.“<br />
(http://www.<strong>di</strong>akonie-rwl.de/<strong>in</strong>dex.php/mID/5.1/lan/de)<br />
Im Diakonischen Werk Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe (RWL) wird gegenwärtig der <strong>Ver</strong>such<br />
unternommen, den Dritten Weg als verb<strong>in</strong>dlich für alle angeschlossenen Gliederungen durchzusetzen.<br />
Dazu gehört u.a., dass <strong>di</strong>e Anwendung von <strong>Leiharbeit</strong> möglichst ausgeschlossen<br />
wird. Unterscheidet man zwischen der verfasst kirchlichen Diakonie <strong>und</strong> der privatwirtschaftlichen<br />
Diakonie, so zeigen sich <strong>di</strong>fferente Strukturen: während <strong>in</strong> der verfasst kirchlichen Diakonie<br />
<strong>Ausgliederung</strong>en <strong>und</strong> Servicegesellschaften e<strong>in</strong>e absolute Ausnahme darstellen, repräsentieren<br />
sie <strong>in</strong> der privatwirtschaftlichen Diakonie den Regelfall. Es gibt e<strong>in</strong>ige Werke, <strong>di</strong>e<br />
offiziell Arbeitnehmerüberlassung beantragt haben <strong>und</strong> hierfür auch <strong>di</strong>e Zustimmung bekommen<br />
haben. Die Anwendung von <strong>Leiharbeit</strong> ist dabei auch abhängig von den Mitarbeitervertretungen:<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>richtung mit vier Häusern, <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong> anwendet, ist <strong>di</strong>es <strong>in</strong> drei<br />
Häusern wieder e<strong>in</strong>gestellt worden, nachdem sich <strong>di</strong>e MAV gewehrt hat, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em vierten<br />
Haus, <strong>in</strong> dem <strong>di</strong>e MAV mitwirkt, wird <strong>Leiharbeit</strong> angewandt.<br />
In mehreren großen Konzernen gibt es eigene <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen. So hat <strong>di</strong>e Stiftung Bethel<br />
vor ca. zehn Jahren <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirma DiZ, Dienstleistung Zeitarbeit GmbH gegründet.<br />
Auch das Johanniswerk hat eigene <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen, wobei deren Geschäftsführung identisch<br />
ist mit der Geschäftsführung der E<strong>in</strong>richtungen.<br />
In RWL besteht <strong>di</strong>e Möglichkeit, verschiedene Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien anzuwenden. Dabei<br />
sei – so <strong>di</strong>e Mitarbeitervertreter – <strong>di</strong>e Anwendung des AVR DW EKD, der deutlich unterhalb<br />
des BAT KF liegt, besonders beliebt. Es gibt aber auch E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e AVR Niedersachsen<br />
anwenden. Aber auch bezogen auf <strong>di</strong>e AVR DW EKD müsse beachtet werden, dass<br />
33
es b<strong>und</strong>esweit erhebliche Unterschiede bezogen auf <strong>di</strong>e Anwendung der AVR DW EKD gebe.<br />
Denn jede Landeskirche, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>e eigene ARK hat, kann hier <strong>Ver</strong>änderungen herbeiführen;<br />
nur <strong>di</strong>e sog. Direktanwender müssen auf <strong>di</strong>e AVR DW EKD zurückgreifen. Alle anderen seien<br />
davon abhängig, wie <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>zelnen Landeskirchen agieren.<br />
Haustarife gibt es <strong>in</strong> RWL nach Wissen der MAV nicht. Es gibt aber E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e<br />
AVR Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz anwenden, vor allem <strong>in</strong> der ambulanten<br />
Pflege.<br />
In e<strong>in</strong>zelnen ausgegliederten Betrieben werden auch Tarife außerhalb der AVR <strong>und</strong> des<br />
BAT/TVöD angewandt. Diese Betriebe – obwohl meist 100%ige Töchter des DW – s<strong>in</strong>d jedoch<br />
<strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e Mitglieder des DW, sondern firmieren als eigenstän<strong>di</strong>ge GmbHs,<br />
allerd<strong>in</strong>gs sei der Gesellschafter oft „zufällig“ <strong>in</strong> beiden Firmen der Gleiche. Das können zum<br />
Beispiel auch Kirchengeme<strong>in</strong>den se<strong>in</strong>, <strong>di</strong>e da Gesellschafter s<strong>in</strong>d (Mitarbeitervertreter).<br />
„Ich kann das mal aus der Geschichte unserer Dienststelle erzählen. Bei uns ist der Bereich<br />
Putzen vor über 30 Jahren ausgegliedert worden, das g<strong>in</strong>g damals an e<strong>in</strong>e Privatfirma. Ich<br />
glaube, Firma A war das. Dann kann Firma D. Und irgendwann setzte auf e<strong>in</strong>mal der Trend<br />
e<strong>in</strong>, dass <strong>di</strong>e anf<strong>in</strong>gen, ihre eigenen Service-GmbHs zu gründen, weil irgendjemand wohl darauf<br />
aufmerksam gemacht hatte, wenn ihr e<strong>in</strong>e externe Firma beschäftigt, dann müsst ihr<br />
Mehrwertsteuer bezahlen, habt ihr aber eure eigenen Servicefirmen, dann könnt ihr euch steuerrechtlich<br />
als verb<strong>und</strong>enes Unternehmen darstellen <strong>und</strong> könnt <strong>di</strong>e Mehrwertsteuer untere<strong>in</strong>ander<br />
verrechnen. Das heißt, man kann da ganz schön Steuern e<strong>in</strong>sparen. Und daraufh<strong>in</strong><br />
schossen dann <strong>di</strong>e eigenen Tochterfirmen hoch. Diese eigenen Tochterfirmen s<strong>in</strong>d aber me<strong>in</strong>es<br />
Wissens nirgendwo <strong>in</strong> RWL Mitglied des DW, denn dann müssten sie ja <strong>di</strong>e Satzung des<br />
DW anwenden, müssten kirchliches Arbeitsrecht anwenden.“ (Mitarbeitervertreter).<br />
Diese Tochterfirmen verfügen teilweise über e<strong>in</strong>en Betriebsrat; sie wenden ke<strong>in</strong> kirchliches<br />
Arbeitsrecht an, sondern haben e<strong>in</strong>en Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel<br />
oder mit e<strong>in</strong>er christlichen Gewerkschaft abgeschlossen.<br />
Da <strong>di</strong>e Satzung des DW besagt, dass e<strong>in</strong>e <strong>di</strong>akonische E<strong>in</strong>richtung kirchliches Arbeitsrecht<br />
anwenden muss, das auf dem "Dritten Weg" zustande gekommen ist, wenden <strong>di</strong>e geme<strong>in</strong>nützigen<br />
Betriebe <strong>di</strong>e AVR an. In e<strong>in</strong>er geplanten Satzungsänderung soll <strong>in</strong> RWL festgelegt werden,<br />
dass <strong>in</strong> Zukunft nur noch AVR DW EKD oder der BAT KF angewandt werden.<br />
34
Als Hauptproblem wird von den befragten Mitarbeitervertretungen RWL <strong>di</strong>e Zunahme prekä-<br />
rer Arbeitsverhältnisse angesehen. Insbesondere <strong>di</strong>e Anwendung von Teilzeitarbeit sei „e<strong>in</strong>e<br />
Katastrophe“. Auch <strong>di</strong>e Arbeitsver<strong>di</strong>chtung <strong>in</strong> den Betrieben <strong>und</strong> <strong>di</strong>e geteilten Dienste stellen<br />
e<strong>in</strong> Problem dar. „Geteilte Dienste“ bedeutet, dass Menschen über den gesamten Tag h<strong>in</strong>weg<br />
Dienste tun <strong>und</strong> dazwischen e<strong>in</strong> paar Blöcke Pause haben.<br />
Die Beschäftigung auf Basis von Werkverträgen sei dagegen <strong>in</strong> RWL ke<strong>in</strong> Thema.<br />
3.2 Diakonie <strong>in</strong> Niedersachsen<br />
Die Diakonie <strong>in</strong> Niedersachsen ist der Zusammenschluss der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Werke der fünf<br />
evangelischen Landeskirchen <strong>in</strong> Niedersachsen. Dies s<strong>in</strong>d:<br />
- das Diakonische Werk der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig e.V.,<br />
- das Diakonische Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V.,<br />
- das Diakonische Werk der Ev.-Luth. Kirche <strong>in</strong> Oldenburg e.V.,<br />
- das Diakonische Werk der Ev.-ref. Kirche <strong>und</strong><br />
- das Diakonische Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe<br />
Diese Werke haben zum 1. Juli 2010 den Diakonie <strong>in</strong> Niedersachsen e.V. gegründet. Sie übertragen<br />
ihre Aufgaben als Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auf Landesebene auf<br />
<strong>di</strong>esen neuen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>. Statt früher fünf Diakonischen Werken handelt seither gegenüber dem<br />
Land <strong>und</strong> den landesweiten Partnern nur noch e<strong>in</strong>e Organisation.<br />
(Quelle: http://www.<strong>di</strong>akonie-niedersachsen.de/ueber_uns.htm)<br />
Die Anzahl der E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> der Beschäftigten lässt sich für <strong>di</strong>e gesamte Diakonie <strong>in</strong><br />
Niedersachsen nicht ermitteln; le<strong>di</strong>glich auf der Homepage des DW Hannover f<strong>in</strong>det sich der<br />
H<strong>in</strong>weis darauf, dass „das Diakonische Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. mit<br />
se<strong>in</strong>en über 3.000 E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> r<strong>und</strong> 40.000 hauptberuflich Beschäftigten (...) zu den<br />
größten Wohlfahrtsverbänden <strong>in</strong> Niedersachsen (gehört).“<br />
(Quelle: http://www.<strong>di</strong>akonie-hannovers.de/pages/<strong>in</strong>dex.html)<br />
Nach Angabe der AG MAV gibt es <strong>in</strong> Niedersachsen r<strong>und</strong> 400 Diakonische Unternehmen.<br />
Von <strong>di</strong>esen 400 Unternehmen s<strong>in</strong>d le<strong>di</strong>glich 232 dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz beigetreten.<br />
Von <strong>di</strong>esen 232 haben aber nur 90 e<strong>in</strong>e Dienstvere<strong>in</strong>barung mit ihrer jeweiligen Mitarbei-<br />
35
tervertretung abgeschlossen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtung verpflichtet, <strong>di</strong>e AVR voll <strong>und</strong> ganz anzuwenden.<br />
E<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>pflichtung, <strong>di</strong>e AVR-K verb<strong>in</strong>dlich anzuwenden, ergibt sich damit für <strong>di</strong>e<br />
Mehrheit der E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Niedersachsen nicht. Daneben gibt es noch e<strong>in</strong>zelne E<strong>in</strong>richtungen,<br />
<strong>di</strong>e <strong>di</strong>e AVR DW EKD anwenden.<br />
Wichtig <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Zusammenhang ist aus Sicht der AGMAV <strong>di</strong>e Feststellung, dass <strong>di</strong>e AVR<br />
nur durch e<strong>in</strong>zelvertragliche Bezugnahmen <strong>in</strong> den Arbeitsvertrag kommen. Das heißt, der<br />
Arbeitgeber – <strong>und</strong> das sei vielfache Praxis – kann dem Arbeitnehmer e<strong>in</strong>en <strong>Ver</strong>trag anbieten,<br />
auf dem steht, „gemäß arbeitsvertragliche Richtl<strong>in</strong>ien der AVR“, <strong>und</strong> kann dann e<strong>in</strong>zelne<br />
Leistungsbestandteile ausschließen. Davon wird nach Aussage der Mitarbeitervertretung vielfach<br />
Gebrauch gemacht.<br />
„Wir bewegen uns auf dem E<strong>in</strong>zelarbeitsvertragsgebiet <strong>und</strong> re<strong>in</strong> rechtstechnisch ist es e<strong>in</strong><br />
<strong>Ver</strong>trag zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, nämlich dem Arbeitgeber <strong>und</strong> dem Arbeitnehmer.<br />
Der E<strong>in</strong>zelarbeitsvertrag wird zu Beg<strong>in</strong>n des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen,<br />
<strong>in</strong> den meisten Fällen prüft der Arbeitnehmer <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Situation nicht e<strong>in</strong>mal den Arbeitsvertrag.“<br />
(Aussage Mitarbeitervertretung).<br />
Im Unterschied zum Mitbestimmungsrecht ist <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretung auch nicht bei der<br />
Prüfung der E<strong>in</strong>zelarbeitsverträge beteiligt. Sie bekommt somit ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> <strong>di</strong>e jeweiligen<br />
e<strong>in</strong>zelvertraglichen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>barungen. Dazu s<strong>in</strong>d den Mitarbeitervertretungen aus ihrer<br />
Beratungspraxis <strong>di</strong>verse E<strong>in</strong>zelfälle bekannt, dass es - abweichend von den gültigen AVR-K –<br />
für den gesamten Betrieb e<strong>in</strong>e 39- oder 40-St<strong>und</strong>en-Woche gibt, was dann e<strong>in</strong>zelvertraglich<br />
mit dem Arbeitnehmer vere<strong>in</strong>bart wird. Oder: im E<strong>in</strong>zelarbeitsvertrag wurde der Paragraph,<br />
der das Weihnachtsgeld be<strong>in</strong>haltet, entfernt.<br />
Die <strong>Ausgliederung</strong> von Servicegesellschaften ist <strong>in</strong> Niedersachsen e<strong>in</strong>e flächendeckend zu<br />
beobachtende Praxis. Die ausgegliederten Betriebe s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel 100%ige Töchter des<br />
Stammbetriebs, <strong>di</strong>e von denselben Führungskräften wie <strong>di</strong>e Stammbetriebe geleitet werden.<br />
Nach Aussage der Mitarbeitervertretungen existiert allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>e verb<strong>in</strong>dliche Regelung<br />
der Zuordnung zum Diakonischen Werk, so dass e<strong>in</strong> großer Teil <strong>di</strong>eser E<strong>in</strong>richtungen Mitglied<br />
im DW ist, jedoch s<strong>in</strong>d nicht alle E<strong>in</strong>richtungen Mitglied im DW. So habe das Diakonische<br />
Werk Hannover <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Satzung vorgesehen, dass es <strong>di</strong>e Mitgliedspflichten überprüfen<br />
muss <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e <strong>di</strong>eser Pflichten sei es, dass <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungen kirchliches Arbeitsrecht anwen-<br />
36
den müssen. Um <strong>di</strong>eser Prüfung auszuweichen, werden <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungen dann nicht als Mit-<br />
glied im DW angemeldet.<br />
Auch <strong>di</strong>e Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> lässt sich im DW Niedersachsen beobachten: So gebe es im<br />
südlichen Bereich von Niedersachsen e<strong>in</strong>e Vielzahl von E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong> betreiben,<br />
darunter u.a. auch e<strong>in</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirma im Besitz e<strong>in</strong>er <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtung, <strong>di</strong>ese<br />
leiht also selbst <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>er aus.<br />
„Das Muster ist, man versucht alle Instrumente der Personalkostene<strong>in</strong>sparung e<strong>in</strong>zusetzen.<br />
Die <strong>Leiharbeit</strong> hat den Vorteil, dass der Leihbetrieb <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>er nur dann beschäftigen<br />
muss, wenn er sie braucht. Die <strong>Leiharbeit</strong> wird <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie zum Drücken der Personalkosten<br />
e<strong>in</strong>gesetzt.“ (Aussage Mitarbeitervertretung).<br />
Da <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen nicht Mitglied im DW s<strong>in</strong>d, haben weder der Dachverband noch <strong>di</strong>e<br />
MAV E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Praxis der <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen.<br />
Ausnahmeregelungen zur Anwendung der AVR gibt es <strong>in</strong> Niedersachsen nach Kenntnis der<br />
Mitarbeitervertretungen nicht. In e<strong>in</strong>zelnen Fällen werden – auf Gr<strong>und</strong> historischer Entwicklungen<br />
– <strong>di</strong>e AVR Bayern von Unternehmen angewandt. Insbesondere im Bereich der E<strong>in</strong>gliederungshilfe<br />
wird auch der TVöD angewandt, <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen ist es hier gelungen, Betriebe<br />
zur Anwendung der AVR-K zu verpflichten. Die Notlagenregelung wird nur von wenigen<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Anspruch genommen. Da <strong>di</strong>es voraussetzt, dass <strong>di</strong>e Betriebe ihre Zahlen<br />
veröffentlichen müssen, ist es für viele Betriebe unattraktiv, Notlagenregelungen anzuwenden.<br />
Befristung <strong>und</strong> Teilzeitarbeit seien <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Altenhilfe weit verbreitet. Dabei handelt<br />
es sich auch um Teilzeitarbeit, <strong>di</strong>e von den Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern nicht gewollt<br />
wird. Allerd<strong>in</strong>gs sei hier wie auch <strong>in</strong> anderen Bereichen zu beobachten, dass sich <strong>di</strong>ese<br />
Praxis bei den Fachkräften zur Zeit ändert, weil der Fachkräftemangel <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>in</strong>zwischen<br />
flächendeckend spürbar ist.<br />
E<strong>in</strong>zelne E<strong>in</strong>richtungen haben <strong>in</strong> Niedersachsen den Mitarbeitervertretungen auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
durchgeführter Streikmaßnahmen Tarifverträge angeboten. Dabei bleibt – so beispielsweise<br />
bei e<strong>in</strong>em Vorschalttarifvertrag e<strong>in</strong>es niedersächsischen Krankenhauses - das Streikrecht<br />
37
unangetastet. Obwohl das entsprechende Krankenhaus aufgefordert wurde, das Diakonische<br />
Werk zu verlassen, ist der Ausschluss bislang nicht erfolgt.<br />
Es sei aber gleichzeitig zu beobachten, dass im DW Niedersachsen der <strong>Ver</strong>such unternommen<br />
wird, e<strong>in</strong>e stärkere <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>heitlichung der Anwendung kirchlichen Arbeitsrechts durchzusetzen.<br />
<strong>Ver</strong>b<strong>und</strong>en ist <strong>di</strong>es mit dem <strong>Ver</strong>such, e<strong>in</strong>en Tarifvertrag Soziales mit Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeitserklärung<br />
anzustreben. Die Situation hierfür wird – im Unterschied zu noch vor 4-5<br />
Jahren – als positiv e<strong>in</strong>geschätzt. Da man den Tarifvertrag Soziales mit Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeitserklärung<br />
nur erreichen kann, wenn sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Branche mehr als 50% der Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmer <strong>in</strong> Tarifverträgen bef<strong>in</strong>den, bedarf es der Mitwirkung der<br />
Kirchen, um überhaupt e<strong>in</strong>e Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeit durchsetzen zu können.<br />
Das Diakonische Werk Niedersachsen ist nun bestrebt, im B<strong>und</strong>estag e<strong>in</strong>e Änderung des Tarifvertragsgesetzes<br />
herbeizuführen, um <strong>di</strong>e im "Dritten Weg" zustande gekommenen Arbeitsverträge<br />
mit Tarifverträgen gleichzusetzen; damit wäre <strong>di</strong>e entsprechende Anzahl von Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Arbeitnehmern <strong>in</strong> Tarifverträgen organisiert. Die Aussichten, e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Änderung herbeiführen zu können, werden ebenfalls positiv e<strong>in</strong>geschätzt.<br />
3.3 Diakonie Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz<br />
Das Diakonische Werk Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) ist Dachverband<br />
für ca. 437 rechtlich selbststän<strong>di</strong>ge Träger <strong>di</strong>akonischer Arbeit aus dem Raum der Evangelischen<br />
Landeskirche <strong>und</strong> der Freikirchen. Die Mitglieder des DWBO unterhalten mit ca.<br />
5200 hauptamtlichen Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern r<strong>und</strong> 1.470 E<strong>in</strong>richtungen im Sozial<strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen.<br />
(Quelle: http://www.<strong>di</strong>akonie-portal.de/verband-1/verband/page-2).<br />
E<strong>in</strong>e Besonderheit der Anwendung der Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien im DWBO (AVR.DWBO)<br />
ist der Tatbestand, dass offenbar e<strong>in</strong>er erheblichen Anzahl von E<strong>in</strong>richtungen Sonderregelungen<br />
der Anwendung der AVR genehmigt worden s<strong>in</strong>d. Diese Ausnahmeregelungen s<strong>in</strong>d an<br />
bestimmte Bed<strong>in</strong>gungen geknüpft: So müssen <strong>di</strong>e Betriebszahlen den Mitarbeitern offengelegt<br />
werden <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Ausnahme muss vom Diakonischen Rat genehmigt werden. Aus Sicht der<br />
Mitarbeitervertretung nutzen immer mehr E<strong>in</strong>richtungen <strong>di</strong>e Öffnungsklauseln <strong>in</strong> den AVR<br />
38
dazu, von den geltenden Richtl<strong>in</strong>ien ganz oder teilweise abzuweichen. Der Diakonische Rat<br />
duldet <strong>di</strong>ese Praxis offenk<strong>und</strong>ig.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Befragung der AGMV, an der sich 260 E<strong>in</strong>richtungen beteiligt haben, gaben <strong>in</strong>sgesamt<br />
91 E<strong>in</strong>richtungen an, dass bei ihnen <strong>di</strong>e AVR.DWBO teilweise oder <strong>in</strong> Gänze (mit oder<br />
ohne Ausnahmegenehmigung des Diakonischen Rats) nicht angewandt wird. 2 Damit – so <strong>di</strong>e<br />
E<strong>in</strong>schätzung der AGMV – sei der DWBO sicherlich „Spitzenreiter“ unter den Diakonischen<br />
E<strong>in</strong>richtungen im b<strong>und</strong>esdeutschen <strong>Ver</strong>gleich, was <strong>di</strong>e Anzahl der Abweichungen anbelangt.<br />
Dabei werden solche Ausnahmeregelungen aus den unterschiedlichsten Gründen beantragt<br />
<strong>und</strong> genehmigt – so werde nicht nur auf aktuelle wirtschaftliche Schwierigkeiten verwiesen,<br />
sondern als Begründung gelte vielfach auch <strong>di</strong>e präventive Abwehr möglicher zukünftiger<br />
<strong>Ver</strong>schlechterungen.<br />
Unter den „Abweichlern“ gibt es sowohl e<strong>in</strong>e Gruppe von Komplettabweichlern, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong> eigenes<br />
Tarifwerk anwenden (so haben zum Beispiel <strong>di</strong>e Wichern-Gruppe <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Fürst-<br />
Donnersmarck-Stiftung völlig eigene Arbeitsordnungen entwickelt) als auch <strong>di</strong>ejenigen, <strong>di</strong>e<br />
ohne Ausnahmegenehmigung <strong>in</strong> Teilen abweichen, weil sie der Me<strong>in</strong>ung s<strong>in</strong>d, sie können <strong>di</strong>e<br />
AVR ökonomisch nicht stemmen. Und es gibt E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e nur für e<strong>in</strong>en Teilbereich<br />
(z.B. Arbeitszeiten oder <strong>di</strong>e Alterszusatzversorgung) e<strong>in</strong>e Ausnahmeregelung bekommen haben.<br />
Aus Sicht der AGMV entsteht auf <strong>di</strong>ese Weise e<strong>in</strong> „Arbeitsrecht nach Gutsherrenart“.<br />
Dabei liegen <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>gütungen nach AVR.DWBO nach Auskunft der GMAV sowieso schon<br />
knapp vier Prozent unter den AVR EKD, was vor allem darauf zurückzuführen sei, dass <strong>di</strong>e<br />
Dienstgeber <strong>in</strong> BBO auf der E<strong>in</strong>haltung des Status quo bestanden, während <strong>di</strong>e AVR EKD <strong>di</strong>e<br />
Tabellenentwicklung im öffentlichen Dienst – wenngleich mit <strong>Ver</strong>zögerung - übernommen<br />
haben. Die Löhne <strong>und</strong> Gehälter der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Mitarbeitenden <strong>in</strong> BBO h<strong>in</strong>ken <strong>in</strong>sofern den<br />
Entwicklungen auf B<strong>und</strong>esebene immer um mehrere Jahre h<strong>in</strong>terher.<br />
<strong>Leiharbeit</strong> wird bei den <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz<br />
vere<strong>in</strong>zelt angewandt. So betreibt beispielsweise das Ev. Johannesstift Berl<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e eigene<br />
<strong>Leiharbeit</strong>sfirma (Persona Grata) als Eigenbetrieb. Persona Grata bezeichnet sich selbst<br />
als „junges <strong>und</strong> <strong>in</strong>novatives Unternehmen des Ev. Johannesstifts … Wir beschäftigen im Be-<br />
2<br />
Die sog. „AVR-Abweichlerliste“ wurde im AGMAV-Newsletter 18/2011 veröffentlicht <strong>und</strong> führte zu heftigen<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen mit der Dienstgeber-Seite. Die „Abweichlerliste“ wird derzeit aktualisiert.<br />
39
eich der Diakonie ca. 140 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen, <strong>di</strong>e orientiert am christlichen Leitbild <strong>in</strong> den<br />
E<strong>in</strong>richtungen unserer K<strong>und</strong>en, tätig s<strong>in</strong>d.“<br />
(www.personagrata/<strong>in</strong>fo/public/mitarbeiter/mitarbeiter.htm. Download vom 12.12.2011)<br />
Beschäftigte, <strong>di</strong>e zuvor im Ev. Johannesstift befristet tätig waren, erhielten – so <strong>di</strong>e MAV –<br />
das Angebot, bei Persona Grata zu schlechteren Bed<strong>in</strong>gungen wieder e<strong>in</strong>gestellt zu werden.<br />
Die <strong>Leiharbeit</strong>skräfte werden nach dem Tarif der Christlichen Gewerkschaft bezahlt (es handelt<br />
sich vorrangig um Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern <strong>in</strong> der Pflege), <strong>di</strong>e im Rahmen e<strong>in</strong>es<br />
sog. „Stammleas<strong>in</strong>g“ bis zu zwei Jahren ausgeliehen werden können.<br />
Zugleich sei aber auch zu beobachten, dass andere <strong>di</strong>akonische E<strong>in</strong>richtungen ihre <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen<br />
wieder auflösen, weil sie ihnen – vor allem aufgr<strong>und</strong> der aktuellen Neuregelungen<br />
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – nicht mehr lohnend ersche<strong>in</strong>en (so zum Beispiel beim<br />
Mart<strong>in</strong>shof Diakoniewerk Rothenburg <strong>in</strong> der Oberlausitz).<br />
Ausgründungen, vor allem <strong>in</strong> den Bereichen Hauswirtschaft, Küchen, Werkstätten, auch IT<br />
<strong>und</strong> Personalabteilungen, seien <strong>in</strong>sgesamt eher <strong>di</strong>e Regel als <strong>di</strong>e Ausnahme. Und <strong>di</strong>es trotz der<br />
sog. „W-Gruppen“ für Beschäftigte der unteren Lohn- <strong>und</strong> Gehaltsgruppen, <strong>di</strong>e eigens zu dem<br />
Zwecke geschaffen wurden, Ausgründungen zu vermeiden.<br />
Die M<strong>in</strong>destlohndebatte bietet aus Sicht der MAV ke<strong>in</strong>e Problemlösung, da der M<strong>in</strong>destlohn<br />
durchweg noch unter den bei der Diakonie geltenden <strong>und</strong> bezahlten Löhnen liegt.<br />
3.4 Diakonisches Werk Schleswig-Holste<strong>in</strong><br />
Die Diakonie ist der größte Wohlfahrtsverband Schleswig-Holste<strong>in</strong>s. Nach Angaben des Nordelbischen<br />
Diakonischen Werkes s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Diakonie 28.000 Hauptamtliche <strong>in</strong> r<strong>und</strong> 750 E<strong>in</strong>richtungen<br />
von Flensburg bis Lauenburg beschäftigt.“ 3<br />
Die größten Träger s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (NKD-Gruppe) mit<br />
mehr als 4.500 Mitarbeitenden <strong>und</strong> der Landesvere<strong>in</strong> für Innere Mission Rickl<strong>in</strong>g (knapp<br />
2.500 Beschäftigte) sowie <strong>di</strong>e Vorwerker Diakonie e.V., Lübeck (knapp 2.000 Mitarbeiter).<br />
3 http://www.nordelbien.de/nordelbien/kirchliche.<strong>di</strong>enste/kirchliche.<strong>di</strong>enste.7/<strong>in</strong>dex.html)<br />
40
Nur <strong>in</strong> 70-80 E<strong>in</strong>richtungen gibt es nach Angaben der AGMAV e<strong>in</strong>e Mitarbeitervertretung;<br />
bei den übrigen E<strong>in</strong>richtungen handelt es sich um kle<strong>in</strong>ere E<strong>in</strong>richtungen ohne MAV.<br />
Für <strong>di</strong>e <strong>in</strong> der Diakonie Beschäftigten können entweder <strong>di</strong>e Arbeitsvertraglichen Richtl<strong>in</strong>ien<br />
des Diakonischen Werkes der EKD oder e<strong>in</strong> „<strong>in</strong> Anlehnung an <strong>di</strong>e AVR (...) gestaltetes Arbeitsrecht“<br />
Anwendung f<strong>in</strong>den. Zur Interpretation <strong>di</strong>eser Formulierung, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Neufassung<br />
der Satzung des DW Schleswig-Holste<strong>in</strong> von 2009 aufgenommen wurde (§5 Pflichten der<br />
Mitglieder), gab es e<strong>in</strong>en längeren Rechtsstreit mit der AGMAV, den <strong>di</strong>ese letztlich verloren<br />
hat. Geklärt werden sollte, ob <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>gleichbarkeit gegeben se<strong>in</strong> sollte <strong>in</strong> Bezug auf das materielle<br />
Ergebnis oder auf das Zustandekommen der Tarife, ob also <strong>di</strong>e Interessenvertretung der<br />
Beschäftigten explizit <strong>in</strong> <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>handlungen e<strong>in</strong>bezogen werden muss oder nicht. Aus Sicht<br />
der MAV ist Letzteres faktisch der „Erste Weg“. „Arbeitsverträge frei Schnauze“, so <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>schätzung<br />
der AGMAV, aber seien <strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong> ohneh<strong>in</strong> weit verbreitet <strong>und</strong> seien<br />
<strong>in</strong>sofern weitaus gefährlicher als <strong>Leiharbeit</strong>.<br />
Stellenersetzende <strong>Leiharbeit</strong>, so <strong>di</strong>e MAV, spiele im Bereich des DW Schleswig-Holste<strong>in</strong><br />
ke<strong>in</strong>e besondere Rolle (mehr); <strong>Leiharbeit</strong>er/<strong>in</strong>nen werden allenfalls, zum Beispiel im Pflegebereich,<br />
zur Abdeckung von „Spitzenzeiten“ e<strong>in</strong>gesetzt. Das sah vor e<strong>in</strong>igen Jahren noch etwas<br />
anders aus, <strong>in</strong> Folge des Kirchengerichtsurteils von 2006 aber habe auch <strong>in</strong> den seltenen<br />
Fällen, wo dauerhafte <strong>Leiharbeit</strong> e<strong>in</strong>gesetzt wurde, e<strong>in</strong> Umdenken stattgef<strong>und</strong>en. So unterhält<br />
<strong>di</strong>e Vorwerker Diakonie zwar formal noch e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirma (Fahr<strong>di</strong>enst), sie wird<br />
aber faktisch nicht mehr be<strong>di</strong>ent: Mittlerweile fand e<strong>in</strong> Leitungswechsel statt, zudem stimmt<br />
<strong>di</strong>e MAV Neue<strong>in</strong>stellungen nicht mehr zu. Nach Kenntnis AGMAV war <strong>di</strong>es der e<strong>in</strong>zige Fall<br />
e<strong>in</strong>er kirchen-/<strong>di</strong>akonieeigenen <strong>Leiharbeit</strong>sfirma <strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong>.<br />
In e<strong>in</strong>er anderen E<strong>in</strong>richtung (Lebenshilfewerk Neumünster, ca. 150 Beschäftigte) werden<br />
allerd<strong>in</strong>gs Werkverträge e<strong>in</strong>gesetzt, wenngleich nicht im großen Stil. Wer über Werkverträge<br />
beschäftigt ist, wird deutlich niedriger bezahlt als <strong>di</strong>e anderen Mitarbeiter.<br />
Weit verbreitet s<strong>in</strong>d dagegen <strong>di</strong>e Ausgründungen, <strong>in</strong>sbesondere machen <strong>di</strong>e großen E<strong>in</strong>richtungen<br />
davon Gebrauch (vor allem <strong>in</strong> den „klassischen“ Bereichen Hauswirtschaft <strong>und</strong> Re<strong>in</strong>igung).<br />
Dazu zählt zum Beispiel <strong>di</strong>e Vorwerker Dienste GmbH, <strong>di</strong>e ihre Mitarbeiter <strong>in</strong> Anlehnung<br />
an den gewerblichen Tarif der Gebäudere<strong>in</strong>igerfirmen bezahlt.<br />
41
Die e<strong>in</strong>zige Ausnahme unter den größeren E<strong>in</strong>richtungen ist hier der Landesvere<strong>in</strong> für Innere<br />
Mission <strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong>, e<strong>in</strong> Träger von <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen, der vor allem <strong>in</strong><br />
den Bereichen Suchterkrankung, seelische Erkrankungen, Altenpflege <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>dertenhilfe<br />
tätig ist.<br />
E<strong>in</strong> wichtiger Gr<strong>und</strong> für den <strong>in</strong>sgesamt ger<strong>in</strong>gen Umfang der Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong><br />
Werkverträgen sei <strong>di</strong>e ger<strong>in</strong>ge Mobilität bzw. Mobilitätsbereitschaft der Beschäftigten im<br />
Flächenstaat Schleswig-Holste<strong>in</strong>. Viele Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen, <strong>in</strong>sbesondere Frauen, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en<br />
Orten auf dem Lande wohnen, seien lokal geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> nicht <strong>in</strong> der Lage oder nicht willens,<br />
<strong>in</strong> andere Städte zu wechseln, daher auch leicht erpressbar. Für <strong>di</strong>e Arbeitgeber sei es daher<br />
leicht, ihnen „nach Gutsherrenart“ Arbeitsverträge mit Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>gütungen<br />
zu <strong>di</strong>ktieren, <strong>di</strong>e weit unterhalb der AVR DW EKD oder der KTD (<strong>Ver</strong>fasste Kirche) s<strong>in</strong>d,<br />
weil sie nicht mit Widerstand rechnen müssen. Der Blick auf E<strong>in</strong>zelverträge lasse e<strong>in</strong>e erhebliche<br />
Bandbreite dessen erkennen, was unter dem Label „Anlehnung an <strong>di</strong>e AVR“ praktisch<br />
alles möglich ist! 4<br />
Für große wie auch für kle<strong>in</strong>ere E<strong>in</strong>richtungen sei es unproblematisch, Arbeitsverträge nach<br />
eigenem Belieben abzuschließen, <strong>di</strong>e sich mehr oder weniger eng an <strong>di</strong>e „gültigen“ Tarifwerke<br />
AVR EW EKD <strong>und</strong> KTC anlehnen. Auch „Notlagenvere<strong>in</strong>barungen“, <strong>di</strong>e den Mitarbeitern<br />
aufgezwungen werden, seien weit verbreitet.<br />
So schließt <strong>di</strong>e Stiftung Diakoniewerk Kropp (ca. 600 Mitarbeitende) mit neu angestellten<br />
Mitarbeitern Arbeitsverträge ab, <strong>di</strong>e gegenüber den für <strong>di</strong>e „alten“ Beschäftigten geltenden<br />
Arbeitsverträgen deutliche <strong>Ver</strong>schlechterungen aufweisen (so werden Lohn- <strong>und</strong> Gehaltserhöhungen<br />
der letzten Jahre nicht mit übernommen).<br />
Die AGMAV plä<strong>di</strong>ert ausdrücklich für das Zustandekommen e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>heitlichen Branchentarifvertrags<br />
Soziales, auch mit dem Ziel, <strong>di</strong>e Wettbewerbssituation der Träger der großen<br />
Wohlfahrtsverbände gegenüber den privaten E<strong>in</strong>richtungen zu stärken, <strong>di</strong>e (vor allem im Bereich<br />
der ambulanten Pflege) meist nicht nach Tarif bezahlen.<br />
Vor vier Jahren wurde, nicht zuletzt auf Betreiben der MAV, e<strong>in</strong> landesweites Aktionsbündnis<br />
Soziales gegründet, dem mittlerweile alle Landesverbände: AWO, Caritas, Diakonie, Jü<strong>di</strong>sche<br />
Landesverbände <strong>und</strong> Paritätischer Wohlfahrtsverband sowie <strong>di</strong>e Gewerkschaft ver.<strong>di</strong><br />
4<br />
Siehe dazu auch beispielhaft den im Anhang III beigefügten E<strong>in</strong>zel-Arbeitsvertrag aus dem Pflegebereich.<br />
42
Landesbezirk Nord <strong>und</strong> Betriebsräte <strong>und</strong> Mitarbeitervertretungen der Sozialen Arbeit angehö-<br />
ren. Sie haben im Oktober 2009 e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Positionspapier („Dem Sozialstaat ver-<br />
pflichtet. Für e<strong>in</strong>en starken geme<strong>in</strong>nützigen Sektor <strong>in</strong> der Sozialwirtschaft“) verfasst, <strong>in</strong> dem<br />
sie <strong>di</strong>e Schaffung von besseren Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für <strong>di</strong>e Beschäftigten <strong>in</strong> der Sozialen<br />
Arbeit fordern. Dar<strong>in</strong> heißt es unter anderem:<br />
„Für ihre wichtige <strong>und</strong> hochwertige Tätigkeit ver<strong>di</strong>enen <strong>di</strong>e Beschäftigen <strong>in</strong> der Sozialen Arbeit<br />
gesellschaftliche Anerkennung sowie e<strong>in</strong>e angemessene <strong>Ver</strong>gütung <strong>und</strong> gute Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen.<br />
(...)<br />
Die Unterzeichnenden fordern von den politisch zustän<strong>di</strong>gen Gremien <strong>Ver</strong>antwortung für<br />
e<strong>in</strong>en sozialen Staat durch e<strong>in</strong>e verbesserte F<strong>in</strong>anzierung zur flächendeckenden <strong>und</strong> nachhaltigen<br />
Dase<strong>in</strong>svorsorge. Dazu gehören:<br />
- Gr<strong>und</strong>lagen für e<strong>in</strong>e angemessene <strong>Ver</strong>gütung<br />
Um angemessene Gehälter <strong>und</strong> Löhne zahlen zu können, bedarf es e<strong>in</strong>er aufgabengerechten<br />
F<strong>in</strong>anzierung. Schon heute fehlen im Sozialen Sektor unter den derzeitigen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Fachkräfte. Diese Lücke wird <strong>in</strong> Zukunft noch größer werden.<br />
- <strong>Ver</strong>besserung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>Ver</strong>träge <strong>in</strong> der Grauzone der Sche<strong>in</strong>selbstän<strong>di</strong>gkeit gefährden <strong>di</strong>e Qualität der Arbeit. Es<br />
muss sichergestellt se<strong>in</strong>, dass <strong>di</strong>e Fachkräfte im sozialen Sektor arbeitsvertraglichen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen beschäftigt werden, <strong>di</strong>e ihnen e<strong>in</strong>e Lebensplanung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e vollwertige Alterssicherung<br />
ermöglichen.“<br />
3.5 Diakonisches Werk Württemberg (DWW)<br />
Im B<strong>und</strong>esland Baden-Württemberg gibt es zwei vone<strong>in</strong>ander unabhängige Landeskirchen<br />
(Baden <strong>und</strong> Württemberg) <strong>und</strong> entsprechend zwei Diakonische Werke mit unterschiedlichen<br />
Regelungen <strong>und</strong> Tarifwerken. Das Diakonische Werk Württemberg – mit Sitz <strong>in</strong> Stuttgart –<br />
ist e<strong>in</strong> selbststän<strong>di</strong>ges Werk <strong>und</strong> der soziale Dienst der Evangelischen Landeskirche <strong>und</strong> der<br />
Freikirchen.<br />
Die württembergische Diakonie beschäftigt gut 40.000 hauptamtliche Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen (entsprechend<br />
31.600 Vollzeitstellen) bei <strong>in</strong>sgesamt 240 Trägern. Unter dem Dachverband bef<strong>in</strong>den<br />
sich über 2.000 E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Dienste.<br />
(Quelle: http://www.<strong>di</strong>akonie-wuerttemberg.de/verband/)<br />
43
Große Träger s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Evangelische Heimstiftung mit zahlreichen Tochterunternehmen (größter<br />
Anbieter von Altenhilfs<strong>di</strong>enstleistungen <strong>in</strong> Baden-Württemberg) mit ca. 7.000 Mitarbeitenden,<br />
<strong>di</strong>e BruderhausDiakonie Reutl<strong>in</strong>gen, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> 14 Landkreisen Baden-Württemberg <strong>in</strong><br />
den Geschäftsfeldern Altenhilfe, Beh<strong>in</strong>dertenhilfe, Jugendhilfe <strong>und</strong> Sozialpsychiatrie tätig ist.<br />
Bei der BruderhausDiakonie <strong>und</strong> ihren Tochtergesellschaften s<strong>in</strong>d ca. 4.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
beschäftigt.<br />
Für <strong>di</strong>e Beschäftigten der Diakonie Württemberg f<strong>in</strong>den unterschiedliche Arbeitsvertragliche<br />
Richtl<strong>in</strong>ien Anwendung: Neben den AVR DW Württemberg gelten <strong>in</strong> bestimmten Fällen auch<br />
<strong>di</strong>e AVR DW EKD.<br />
Diese besondere Situation ist das Resultat langjähriger Ause<strong>in</strong>andersetzungen zwischen <strong>Ver</strong>tretern<br />
der Landeskirche, den Mitarbeitervertretern <strong>und</strong> den Diakonischen Dienstgebern.<br />
Während <strong>di</strong>e Landeskirche <strong>und</strong> <strong>di</strong>e MAV das damals gerade reformierte Tarifwerk des öffentlichen<br />
Dienstes (TVöD) als Gr<strong>und</strong>lage für <strong>di</strong>e AVR DW Württemberg übernehmen wollten,<br />
lehnten <strong>di</strong>e Dienstgeber <strong>di</strong>es ab <strong>und</strong> wollten stattdessen <strong>di</strong>e AVR DW EKD e<strong>in</strong>führen, weil<br />
<strong>di</strong>ese – so <strong>di</strong>e Begründung – mehr Flexibilität ermögliche. Diese Position, <strong>di</strong>e zunächst auf<br />
Widerstand auch bei der Landeskirche stieß, wurde dadurch dr<strong>in</strong>glich gemacht, dass e<strong>in</strong> großer<br />
Träger damit drohte, <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Insolvenz zu gehen, wenn der „starre“ TVöD angewandt werden<br />
müsse. Im Falle e<strong>in</strong>er Insolvenz hätte <strong>di</strong>e Landeskirche <strong>di</strong>e Haftung für <strong>di</strong>e betriebliche<br />
Altersversorgung (kirchliche Zusatzversorgungskasse) übernehmen müssen.<br />
Die evangelische Landessynode, hat als zustän<strong>di</strong>ges Organ daraufh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> sogenanntes „Wahlrecht“<br />
der Diakoniee<strong>in</strong>richtungen bezüglich des Tarifs beschlossen. Seit 2007 kann man nun<br />
unter bestimmten Bed<strong>in</strong>gungen auswählen, ob man <strong>di</strong>e ARV DW Württemberg oder <strong>di</strong>e AVR<br />
DW EKD anwendet. Dabei soll vorrangig <strong>di</strong>e AVR DW Württemberg angewendet werden,<br />
wenn sich aber der Arbeitgeber mit der MAV e<strong>in</strong>igt, dann kann er <strong>di</strong>e AVR DW EKD anwenden.<br />
Damit wurde aus Sicht der AGMAV e<strong>in</strong> Thema auf <strong>di</strong>e betriebliche Ebene gezogen,<br />
das aus deren Sicht dort nicht h<strong>in</strong>gehört.<br />
Im Ergebnis gibt es <strong>in</strong> der Tariflandschaft Württembergs jetzt also sozusagen drei Ebenen:<br />
- Regelfall (für über 30.000 Beschäftigte) s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e AVR DW Württemberg auf Basis des<br />
TVöD.<br />
44
- Bei Ausgründungen können <strong>di</strong>e Arbeitgeber <strong>di</strong>e AVR DW EKD anwenden, allerd<strong>in</strong>gs<br />
mit Überleitungsregelungen (Bestandsschutz für <strong>di</strong>e Mitarbeiter auf TVöD-Niveau).<br />
- Für neu gegründete Tochterunternehmen gilt <strong>di</strong>e Direktanwendung der AVR DW EKD.<br />
Insofern gibt es also jetzt faktisch ganz unterschiedliche Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen, je<br />
nachdem, wo <strong>und</strong> wie <strong>di</strong>e Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen beschäftigt s<strong>in</strong>d. Dieser „Tarifdschungel“ wird<br />
noch dadurch verstärkt, dass bestimmte E<strong>in</strong>richtungen (Krankenhaus Betesta, zum Sozialkonzern<br />
Agaplesion gehörend) <strong>di</strong>e KDAVO anwenden oder – wie das CJD oder <strong>di</strong>e Johanniter –<br />
aus dem württembergischen Tarifwerk ausscheren, <strong>in</strong>dem sie versuchen, unternehmenseigene<br />
AVR anzuwenden, um <strong>di</strong>e Entgelte ihrer Beschäftigten weiter absenken zu können. Auf der<br />
anderen Seite gebe es auch Mitgliedse<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e aus dem kommunalen Bereich kommen<br />
<strong>und</strong> <strong>di</strong>e weiterh<strong>in</strong> den TVöD/Kommunen anwenden, obwohl sie davon ke<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anziellen<br />
Vorteile haben.<br />
Die betrieblichen Mitarbeitervertretungen s<strong>in</strong>d aus Sicht der AGMAV von den Anforderungen,<br />
<strong>di</strong>e aufgr<strong>und</strong> <strong>di</strong>eser unterschiedlichen Entwicklungen auf sie zugekommen s<strong>in</strong>d, oft überfordert.<br />
Dies vor allem vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, dass zunehmend auf betrieblicher Ebene entschieden<br />
werden soll, welche Tarifwerke zur Anwendung kommen sollen, <strong>und</strong> auch, weil <strong>di</strong>e<br />
Arbeitgeber ihre Probleme zunehmend auf <strong>di</strong>e betriebliche Ebene verlagern, obwohl es <strong>in</strong> den<br />
geltenden Tarifwerken schon e<strong>in</strong>e Vielzahl von Ausnahmeregelungen gibt.<br />
Obgleich nach dem Urteil des Kirchengerichtshofes von 2006 dauerhafte, „ersetzende <strong>Leiharbeit</strong>“<br />
ausdrücklich untersagt ist, gibt es <strong>in</strong> Württemberg nach Auskunft der AGMAV mehrere<br />
<strong>di</strong>akonische E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e entweder konzerneigene <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen haben oder Mitarbeiter<br />
über Werkverträge beschäftigen. Letztere Beschäftigungsform nehme sogar zu, seit sich<br />
<strong>di</strong>e gesetzliche Rechtsprechung zur <strong>Leiharbeit</strong> geändert hat (neues Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,<br />
AÜG). Aus Sicht der AGMAV stellt das e<strong>in</strong>e Umgehung von <strong>Leiharbeit</strong> dar.<br />
Ausgründungen (<strong>in</strong> der Regel als gGmbH oder GmbH) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt weit verbreitet <strong>und</strong> bei<br />
großen wie auch bei kle<strong>in</strong>eren <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen üblich.<br />
Aus e<strong>in</strong>er Aufstellung der AGMAV – „ohne Anspruch auf Vollstän<strong>di</strong>gkeit“ – geht überblicksartig<br />
hervor, <strong>in</strong> welchen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen es <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen <strong>und</strong>/oder<br />
Ausgründungen gibt (Stand: 2/2011). Die Liste enthält 18 Muttere<strong>in</strong>richtungen mit „weltli-<br />
45
chen Töchtern“, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> der Regel als GmbH oder gGmbH firmieren. Darunter s<strong>in</strong>d neben <strong>di</strong>-<br />
versen weiteren Ausgründungen 11 E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e ausdrücklich konzerneigene Leihar-<br />
beitsfirmen (meist: Service- resp. Personalservice-GmbH) unterhalten. Dies betrifft vor allem<br />
Tätigkeiten im Küchen-, Cater<strong>in</strong>g- <strong>und</strong> Re<strong>in</strong>igungsbereich sowie im Facility Management,<br />
ausnahmsweise (Paul<strong>in</strong>enpflege W<strong>in</strong>nenden) wird <strong>Leiharbeit</strong> aber auch im klassischen Pfle-<br />
gebereich e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Wie <strong>di</strong>e Situation im E<strong>in</strong>zelnen aussieht, zum Beispiel wie viele Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen<br />
beschäftigt werden <strong>und</strong> zu welchen Bed<strong>in</strong>gungen etc., entzieht sich der Kenntnis<br />
der AGMAV. Auch über <strong>di</strong>e Situation der Beschäftigten <strong>in</strong> den Ausgründungen liegen ke<strong>in</strong>e<br />
detaillierten Auskünfte vor. E<strong>in</strong>e betriebliche Interessenvertretung sei dort eher <strong>di</strong>e Ausnahme,<br />
le<strong>di</strong>glich <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen gebe es e<strong>in</strong>en Betriebsrat. E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> dafür sei der Umstand, dass<br />
<strong>di</strong>e ausgegründeten Servicegesellschaften meist nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gebäude vere<strong>in</strong>igt s<strong>in</strong>d, sondern<br />
oft räumlich weit ause<strong>in</strong>anderliegen, so dass es untere<strong>in</strong>ander wenig Kontaktmöglichkeiten<br />
gibt. Die Gründung e<strong>in</strong>es Betriebsrats sei unter <strong>di</strong>esen Umständen kaum möglich <strong>und</strong> für<br />
<strong>di</strong>e MAV der Stamme<strong>in</strong>richtung gebe es ke<strong>in</strong>e rechtliche Gr<strong>und</strong>lage dafür, sich auch um Belange<br />
der Belegschaften <strong>in</strong> den ausgegründeten E<strong>in</strong>richtungen zu kümmern. Aus <strong>di</strong>esem<br />
Gr<strong>und</strong> wisse letztlich ke<strong>in</strong>er so recht Bescheid über <strong>di</strong>e dortigen Zustände <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Teilweise – so bei der Aufbaugilde Heilbronn – gebe es nur noch 60 Beschäftigte<br />
<strong>in</strong> der Mutterfirma <strong>und</strong> 200 <strong>in</strong> den GmbHs, <strong>in</strong>folge <strong>di</strong>eser Entwicklung sei der Überblick über<br />
<strong>di</strong>e konkrete Arbeits- <strong>und</strong> Beschäftigungssituation der Beschäftigten für <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretungen<br />
tendenziell verloren gegangen.<br />
Mittlerweile lasse sich feststellen, dass <strong>di</strong>e Arbeitgeber <strong>in</strong> jeder Sparte vor allem nach den<br />
billigsten Lösungen suchen.<br />
Von Seiten des Diakonischen Werk Württemberg wurde 2010/2011 e<strong>in</strong>e Befragung durchgeführt,<br />
deren Ergebnisse im Infoblatt für <strong>di</strong>e Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter der Württembergischen<br />
Diakonie veröffentlicht wurden („Ihr gutes Recht“. Infoblatt für <strong>di</strong>e Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter der württembergischen Diakonie. Ausgabe Frühjahr 2011). Ziel <strong>di</strong>eser Umfrage<br />
war es vor allem, der Kritik entgegenzutreten, dass <strong>in</strong> der Diakonie „Lohndump<strong>in</strong>g“<br />
betrieben werde. Zentrales Ergebnis: „Fast 100 Prozent werden nach kirchlich-<strong>di</strong>akonischem<br />
Tarif e<strong>in</strong>gestellt.“ (Nähere Angaben dazu im Anhang II)<br />
46
Die AGMAV kann <strong>di</strong>esen Zahlenangaben ke<strong>in</strong>e eigenen Berechnungen entgegensetzen, be-<br />
zweifelt allerd<strong>in</strong>gs deren Aussagekraft, weil weder <strong>di</strong>e gestellten Fragen noch <strong>di</strong>e Ergebnisse<br />
der Befragung öffentlich zugänglich gemacht wurden, sondern nur <strong>di</strong>e oben zitierte Auswertung<br />
selbst vorliegt.<br />
Die Initiative der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Dienstgeber, sich <strong>in</strong> Bezug auf Bezahlung <strong>und</strong> Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen<br />
der Mitarbeitenden öffentlich zu rechtfertigen, ist vor allem auch im Kontext<br />
der Ause<strong>in</strong>andersetzungen mit der AGMAV um <strong>di</strong>e umstrittene Differenzierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Kernbereich <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Nicht-Kernbereich der Diakonie zu sehen.<br />
Die AGMAV widerspricht ausdrücklich dem Anliegen der Dienstgeber, <strong>di</strong>e <strong><strong>di</strong>akonischen</strong><br />
Dienstleistungen „mit Begriffen aus der Betriebswirtschaft“ <strong>in</strong> „Kern- <strong>und</strong> Nebengeschäfte“<br />
zu unterscheiden <strong>und</strong> damit <strong>di</strong>e Mitarbeiterschaft zu spalten. Sie hat dazu e<strong>in</strong>e Gegenposition<br />
entwickelt:<br />
„Für uns gilt: Diakonie lässt sich nicht teilen <strong>und</strong> Mitarbeitende nicht spalten. Es gibt ke<strong>in</strong>e<br />
wichtigen <strong>und</strong> unwichtigen Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kollegen. Wie brauchen <strong>di</strong>e Re<strong>in</strong>emachefrau<br />
<strong>und</strong> <strong>di</strong>e Köch<strong>in</strong> ebenso wie <strong>di</strong>e Altenpfleger<strong>in</strong> <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Erzieher<strong>in</strong>. Wir s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e unteilbare<br />
Diakonie!“ (aus: „WIR s<strong>in</strong>d Diakonie“. Zeitung für Mitarbeitende <strong>in</strong> der Diakonie. Ausgabe<br />
15 vom August 2011).<br />
Sie sieht sich damit <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmung mit dem geltenden Kirchenrecht, obgleich es auch<br />
hier unterschiedliche Positionen gebe. Die <strong>Ver</strong>fasste Kirche <strong>in</strong> Württemberg habe sich dazu<br />
bisher weder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er offiziellen Stellungnahme geäußert noch daraus Konsequenzen gezogen.<br />
Von Seiten der Kirche zieht man sich darauf zurück, dass <strong>di</strong>ese Gesellschaften ja rechtlich<br />
selbstän<strong>di</strong>g s<strong>in</strong>d. Nach Wahrnehmung der AGMAV reagieren sowohl der <strong>Ver</strong>band als auch<br />
<strong>di</strong>e Kirche nur dann sensibel, wenn das Thema <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Öffentlichkeit kommt. So lange sich <strong>di</strong>e<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung le<strong>di</strong>glich <strong>in</strong>nerhalb des Kirchen- <strong>und</strong> Diakoniekreises abspielt, ändere<br />
sich dagegen nichts.<br />
Aus Sicht der AGMAV liegt <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Ause<strong>in</strong>andersetzung um <strong>di</strong>e Trennung <strong>in</strong> „Haupt- <strong>und</strong><br />
Nebengeschäfte“ e<strong>in</strong>e besondere Sprengkraft. Im „Bad Boller Beschluss zur Tarife<strong>in</strong>heit“ hat<br />
sich <strong>di</strong>e AGMAV e<strong>in</strong>deutig zu der Forderung nach „Tarife<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> der Diakonie <strong>und</strong> <strong>in</strong> der<br />
47
Sozialen Arbeit entschieden“ (Beschluss des AGMAV-Vorstandes vom 28. September 2011.<br />
www.agmav-wuerttemberg.de.<strong>in</strong>dexx.hmtl):<br />
„1. Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) als Flächentarifvertrag für <strong>di</strong>e Soziale<br />
Arbeit ist <strong>und</strong> bleibt das Ziel, um e<strong>in</strong>heitliche Tarifbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> vergleichbare Wettbewerbsbed<strong>in</strong>gungen<br />
auch <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf <strong>di</strong>e Ref<strong>in</strong>anzierung zu schaffen.<br />
2. Bis dah<strong>in</strong> f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> allen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Württemberg für <strong>di</strong>e Arbeitsverhältnisse<br />
der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>di</strong>e AVR-Württemberg auf der Gr<strong>und</strong>lage des<br />
TVöD oder unmittelbar der TVöD Anwendung.<br />
Dies gilt selbstverständlich auch für Unternehmen oder Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen<br />
von <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Trägern, denn <strong>di</strong>ese nehmen unabhängig von ihrer Rechtsform <strong>und</strong><br />
ihrem Status <strong>di</strong>akonische Aufgaben wahr.“<br />
Die enge <strong>und</strong> „offensive“ Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft ver.<strong>di</strong> <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Orientierung<br />
am TVöD ist für <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretungen <strong>in</strong> Württemberg e<strong>in</strong> zentrales Anliegen. Sie vertreten<br />
<strong>di</strong>e geme<strong>in</strong>same Position, dass e<strong>in</strong> Flächentarifvertrag Soziale Arbeit für alle Wohlfahrtsverbände<br />
<strong>di</strong>e richtige Lösung wäre. TV Soziales heißt aus ihrer Sicht immer TVöD.<br />
„Für uns ist der TVöD das Maß aller D<strong>in</strong>ge – egal wie gut oder schlecht der Tarif im E<strong>in</strong>zelfall<br />
ist! Wichtig aber vor allem: e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Lösung für alle.“<br />
Bisher gab es erst e<strong>in</strong>en Fall, wo e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>richtung (das Diakoniewerk Bethel mit Hauptsitz<br />
Berl<strong>in</strong>) aus der Diakonie Württemberg ausgeschlossen wurde, weil sie sich nicht an <strong>di</strong>e satzungsmäßigen<br />
rechtlichen Vorgaben gehalten haben. In <strong>di</strong>esem Fall gab es ke<strong>in</strong>e Gewährsträgerhaftung<br />
bei der kirchlichen Zusatzversorgung, deshalb war aus <strong>di</strong>eser Perspektive e<strong>in</strong> Ausschluss<br />
ohne weitere Folgeprobleme möglich.<br />
Dieser Tatbestand ändere sich allerd<strong>in</strong>gs seit e<strong>in</strong>iger Zeit schrittweise, weil <strong>di</strong>e Zusatzversorgungskasse<br />
für neu gegründete Firmen jetzt kapitalgedeckt werden soll. Dann aber besteht<br />
ke<strong>in</strong> Gewährsträgerhaftungsproblem mehr (<strong>di</strong>e „goldene Fessel“ entfällt); <strong>di</strong>eses Druckmittel<br />
des Diakonischen Werkes gegenüber der Kirche wird <strong>in</strong> Zukunft somit nicht mehr greifen.<br />
Das würde auf der anderen Seite allerd<strong>in</strong>gs auch bedeuten, dass <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>fasste Kirche auf <strong>di</strong>eser<br />
Basis ke<strong>in</strong> Druckmittel mehr hätte, um <strong>di</strong>e Diakonischen E<strong>in</strong>richtungen auf <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>haltung<br />
des Kirchenrechts zu verpflichten.<br />
48
3.6 Das Diakonische Werk Bayern<br />
Das Diakonische Werk Bayern der Evangelisch-Lutherischen Kirche <strong>in</strong> Bayern e.V. ist - mit<br />
3.500 E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> etwa 43.000 Vollzeitstellen <strong>und</strong> mehr als 60.000 Mitarbeitenden -<br />
nach der Caritas der zweitgrößte <strong>Ver</strong>band der freien Wohlfahrtspflege <strong>in</strong> Bayern. (Quelle:<br />
http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/<strong>di</strong>akonisches-werk-bayern.php).<br />
In Bayern gelten seit 2007 für alle <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>di</strong>e Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
des Diakonischen Werkes Bayern, AVR-Bayern.<br />
Zum Landesverband gehören <strong>in</strong>sgesamt ca. 1.300 Mitglieder (Träger). Die größten Träger<br />
(Diakoniewerk Neuendettelsau <strong>und</strong> Rummelsberger Anstalten) bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Mittelfranken,<br />
dem „evangelischen Kerngebiet Bayerns“. Weitere große Träger s<strong>in</strong>d zum Beispiel <strong>di</strong>e<br />
Innere Mission <strong>in</strong> München (ca. 2.000 Beschäftigte) sowie das Diakonische Werk Würzburg<br />
(gut 700 Beschäftigte).<br />
Die Diakonie Neuendettelsau ist mit 190 E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> 6.500 Beschäftigten der größte<br />
<strong>di</strong>akonische Träger <strong>in</strong> Bayern. Dazu gehören <strong>di</strong>e Abteilungen Altenhilfe, Beh<strong>in</strong>dertenhilfe,<br />
Jugend <strong>und</strong> Schule, Krankenhauswesen sowie Dienstleistungen.<br />
Die Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission E. V. <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Rummelsberger Dienste für<br />
Menschen gGmbH mit ihren Tochtergesellschaften betreiben gegenwärtig 202 E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> Dienste mit über 5.400 Mitarbeitenden an 35 Standorten <strong>in</strong> Bayern. (Quelle:<br />
http://www.rummelsberger.de/cms/<strong>in</strong>dex.php?id=169)<br />
<strong>Leiharbeit</strong> spielt <strong>in</strong> der Diakonie <strong>in</strong> Bayern kaum mehr e<strong>in</strong>e Rolle, seit das entsprechende Urteil<br />
des Kirchengerichtshofes der EKD (vom September 2006) <strong>in</strong> Kraft getreten ist, <strong>in</strong> dem<br />
sehr restriktiv entschieden wurde, dass es ersetzende <strong>Leiharbeit</strong> <strong>in</strong> der Diakonie nicht geben<br />
darf. Es wird daher zwar <strong>in</strong> gewissem Umfang von <strong>Leiharbeit</strong> Gebrauch gemacht, um Spitzenarbeitszeiten<br />
abzudecken, vor allem <strong>in</strong> der Altenpflege, aber das – so der <strong>Ver</strong>treter der<br />
AG-MAV Bayern – „ist eigentlich nicht so das Problem aus unserer Sicht“.<br />
Auch der E<strong>in</strong>satz von Werkverträgen ist der Mitarbeitervertretung bisher nicht bekannt geworden.<br />
49
Weit verbreitet seien dagegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse – vor allem im S<strong>in</strong>ne von<br />
ger<strong>in</strong>gfügiger bzw. Teilzeit-Beschäftigung, befristeten Arbeitsverhältnissen <strong>und</strong> schlechter,<br />
nicht Existenz sichernder Bezahlung.<br />
E<strong>in</strong> weiteres, bisher kaum öffentlich bekanntes, Problemfeld stellt aus Sicht der AG-MAV <strong>di</strong>e<br />
Anlagerung von „ehrenamtlicher Tätigkeit mit Aufwandsentschä<strong>di</strong>gung“ an <strong>di</strong>e hauptberufliche<br />
Tätigkeit dar: Nach §3 Nr. 26 des E<strong>in</strong>kommenssteuergesetzes s<strong>in</strong>d 175 Euro pro Monat,<br />
also bis zu 2.100 Euro pro Jahr, als „Aufwandsentschä<strong>di</strong>gung für nebenberufliche Tätigkeit“<br />
steuerfrei, wenn e<strong>in</strong>e Tätigkeit für e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>nützige Organisation oder für e<strong>in</strong>e juristische<br />
Person des öffentlichen Rechtes vorliegt. Diese „ehrenamtliche Beschäftigung“, <strong>di</strong>e als „Übungsleiterpauschale“<br />
abgerechnet wird, werde gerne komb<strong>in</strong>iert mit hauptamtlicher oder<br />
ger<strong>in</strong>gfügiger Beschäftigung (z.B. mit M<strong>in</strong>ijobs). Die Beschäftigten üben dann zwar genau<br />
<strong>di</strong>e gleiche Tätigkeit aus wie zuvor, nun aber getarnt als „Ehrenamt“. Relativ weit verbreitet<br />
sei <strong>di</strong>es <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Bereichen Jugendarbeit/Jugendhilfe sowie <strong>in</strong> der Altenarbeit <strong>und</strong><br />
Pflege. Aus Sicht der MAV ist <strong>di</strong>es e<strong>in</strong>deutig e<strong>in</strong>e Form von Schwarzarbeit, weil es sich dabei<br />
um ganz normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt, denn <strong>di</strong>ese Beschäftigten<br />
üben weisungsgeb<strong>und</strong>ene Tätigkeiten aus <strong>und</strong> sie s<strong>in</strong>d auch an ganz bestimmte Zeiten<br />
geb<strong>und</strong>en, zu denen sie verfügbar se<strong>in</strong> müssen.<br />
Die Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen erhalten für <strong>di</strong>ese Tätigkeit e<strong>in</strong>en festgelegten St<strong>und</strong>enlohn, der <strong>in</strong> der<br />
Regel auch vertraglich so festgelegt ist. Mit knapp 8 Euro liegt er zwar weit unter dem normalen<br />
Arbeitslohn, den Arbeitgeber veranschlagen müssten, wenn sie dafür Steuern <strong>und</strong> Sozialversicherung<br />
abführen würden. Für <strong>di</strong>e Mitarbeiter selbst aber ersche<strong>in</strong>t <strong>di</strong>eser St<strong>und</strong>enlohn<br />
unmittelbar nicht schlechter als ihre normale <strong>Ver</strong>gütung. Sie s<strong>in</strong>d daher an <strong>di</strong>eser Form der<br />
Beschäftigung oft durchaus <strong>in</strong>teressiert, obwohl sie nicht selbst kranken- <strong>und</strong> pflegeversichert<br />
s<strong>in</strong>d, weil sie e<strong>in</strong>s zu e<strong>in</strong>s („Brutto für Netto“) bezahlt werden. Die Mitarbeitervertretungen<br />
aber haben gegen <strong>di</strong>ese Praktiken ke<strong>in</strong>e Handhabe, denn für ehrenamtlich Tätige s<strong>in</strong>d sie<br />
rechtlich nicht zustän<strong>di</strong>g, bei den Ehrenamtlichen haben sie ke<strong>in</strong>e Mitbestimmungsrechte. In<br />
der Öffentlichkeit spielt das Thema ke<strong>in</strong>e Rolle, so dass den <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen<br />
durch <strong>di</strong>ese verbreitete Praxis bisher auch ke<strong>in</strong> Imageverlust droht.<br />
Ausgründungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Bayern offensichtlich nicht so weit verbreitet wie <strong>in</strong> anderen B<strong>und</strong>esländern<br />
bzw. Landeskirchen. So gab <strong>und</strong> gibt es im größten <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Werk Bayerns, <strong>in</strong><br />
50
Neuendettelsau, weder Ausgründungen noch <strong>Leiharbeit</strong>. Andere große <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>ere E<strong>in</strong>rich-<br />
tungen haben dagegen eigene Tochtergesellschaften gegründet <strong>und</strong>/oder sie vergeben be-<br />
stimmte Tätigkeiten nach draußen; doch ist <strong>di</strong>es nicht als e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche Tendenz zu erken-<br />
nen. Im Gegenteil gibt es mittlerweile auch gegenläufige Bewegungen.<br />
So untergliedert sich das Unternehmen Rummelsberger Anstalten, zweitgrößter Träger der<br />
Diakonie <strong>in</strong> Bayern, <strong>in</strong> <strong>di</strong>verse Gesellschaften (GmbHs <strong>und</strong> gGmbHs), <strong>di</strong>e – als 100%ige<br />
Töchter der Rummelsberger Anstalten – e<strong>in</strong>e breite Palette von Serviceleistungen anbieten.<br />
Unter <strong>di</strong>esem Dach bef<strong>in</strong>det sich <strong>di</strong>e Rummelsberger Servicegesellschaft GmbH, e<strong>in</strong> „modernes<br />
Dienstleistungsunternehmen, das vielfältige Service- <strong>und</strong> Leistungsbereiche außerhalb der<br />
<strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Aufgabenfelder umfasst“ (www.rummelsberger-servicegesellschaft.de). Die<br />
Mitarbeiter werden dort nach gewerblichen Tarifen bezahlt <strong>und</strong> es gibt e<strong>in</strong>en freigestellten<br />
Betriebsrat. Zum Sozialkonzern gehört auch <strong>di</strong>e unternehmenseigene Zeitarbeitsfirma PAKT<br />
(PersonalAgentur für soziale Dienstleistungen GmbH Schwarzenbruck), <strong>di</strong>e mittlerweile jedoch<br />
nicht mehr aktiv ist. Sie beschäftigte zeitweilig bis zu 200 Mitarbeiter.<br />
Auch <strong>di</strong>e Rummelsberger Servicegesellschaft wurde zum 1.1.2012 aufgelöst. Ab <strong>di</strong>esem<br />
Zeitpunkt soll der gesamte Küchen-, Re<strong>in</strong>igungs-, Cater<strong>in</strong>g-, Hauswirtschafts-, Technikerbereich<br />
etc. re-<strong>in</strong>tegriert werden <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Beschäftigten e<strong>in</strong>s-zu-e<strong>in</strong>s <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Muttergesellschaft<br />
rückübergeführt werden. Damit – <strong>di</strong>es ist nach Auskunft der MAV für viele der Beschäftigten<br />
der Hauptvorteil <strong>di</strong>eses Insourc<strong>in</strong>g-Prozesses – haben sie wieder Anspruch auf <strong>di</strong>e Arbeitgeberanteile<br />
zur Betriebsrente (kirchliche Zusatzversorgung).<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> für <strong>di</strong>ese Entscheidung war <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Fall vor allem e<strong>in</strong> Vorstandswechsel bei<br />
den Rummelsberger Anstalten, der nach e<strong>in</strong>er Serie von „Skandalen“ erfolgte. Durch <strong>di</strong>e demonstrative<br />
Auflösung der Zeitarbeitsfirma <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Rücküberführung der ausgegliederten<br />
Servicegesellschaft sollen positive Signale gesetzt werden, um das schlechte öffentliche<br />
Image der Rummelsberger wieder <strong>in</strong> e<strong>in</strong> besseres Licht zu rücken (<strong>in</strong> der <strong>Ver</strong>gangenheit gab<br />
es <strong>di</strong>verse Berichte über wiederholte sexistische Übergriffe, f<strong>in</strong>anzielle Unregelmäßigkeiten<br />
<strong>und</strong> den erzwungenen Rücktritt von zwei Vorstandsvorsitzenden).<br />
Auch beim Diakonischen Werk <strong>in</strong> Würzburg gab es vor e<strong>in</strong>igen Jahren zunächst e<strong>in</strong>e Ausgründungsbewegung,<br />
<strong>di</strong>e dann – allerd<strong>in</strong>gs aus anderen Gründen – wieder rückgängig gemacht<br />
wurde. Hier wurden vor allem im Re<strong>in</strong>igungsbereich <strong>di</strong>e Arbeiten e<strong>in</strong>ige Jahre lang an<br />
51
private Re<strong>in</strong>igungsfirmen vergeben, dann aber wieder e<strong>in</strong>gegliedert. Der Gr<strong>und</strong>: Seit <strong>di</strong>e neue<br />
AVR-BY <strong>in</strong> Kraft getreten s<strong>in</strong>d (Anfang 2007), konnten – so <strong>di</strong>e MAV – <strong>in</strong>sbesondere <strong>di</strong>e<br />
Entgelte der Re<strong>in</strong>igungskräfte so weit abgesenkt werden, dass sich e<strong>in</strong>e Auslagerung für den<br />
Dienstgeber nicht mehr rentierte. Man konnte <strong>di</strong>e Beschäftigten demnach durchaus wieder <strong>in</strong><br />
das Diakonische Werk zurückholen, ohne dabei <strong>Ver</strong>luste zu machen.<br />
Nach E<strong>in</strong>schätzung der MAV s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Arbeits- <strong>und</strong> Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen nach den<br />
Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien AVR-BY – auch im <strong>Ver</strong>gleich mit den AVR EW EKD - so<br />
schlecht, dass sie gar nicht unterlaufen werden müssen. So gibt es <strong>in</strong> Bayern <strong>di</strong>e 40 St<strong>und</strong>en-<br />
Woche, das niedrigste Monatsgehalt für Vollzeitbeschäftigte liegt nach der aktuellen Fassung<br />
der AVR-BY (Stand vom 27.10.2011) bei 1.436,55 Euro (E 1 Basisstufe; Entgelttabelle<br />
2012). Neben der KDAVO (Hessen-Nassau) bilden <strong>di</strong>e AVR-BY, so <strong>di</strong>e MAV, <strong>di</strong>e „Schlusslichter<br />
bei der Diakonie“.<br />
Erst recht im <strong>Ver</strong>gleich mit den Entgelt- <strong>und</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen nach dem TVöD schneiden<br />
<strong>di</strong>e AVR-BY schlecht ab. S<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> richtig wäre es aus der AG MAV, <strong>di</strong>eses Tarifwerk<br />
auch für <strong>di</strong>e Beschäftigten der Diakonie zu übernehmen <strong>und</strong> sich <strong>in</strong>sgesamt stärker gewerkschaftlich<br />
zu engagieren.<br />
Die Position f<strong>in</strong>det allerd<strong>in</strong>gs bei den Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Bayern ke<strong>in</strong>en großen Zuspruch.<br />
Probleme – wie Personalmangel, Intensivierung der Arbeit, zunehmender Stress, psychische<br />
Belastungen, Überlastungen, zum Beispiel durch Dokumentationen (Altenpflege) etc. – gebe<br />
es zwar genug. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad aber sei <strong>in</strong> Bayern, gemessen an<br />
anderen westlichen B<strong>und</strong>esländern, eher unterdurchschnittlich, <strong>di</strong>e Mobilisierung für bessere<br />
Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen gestalte sich <strong>in</strong> den meisten Regionen sehr schwierig. Insbesondere<br />
gelte <strong>di</strong>es für <strong>di</strong>e befristet Beschäftigten, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> stän<strong>di</strong>ger Angst um ihre Weiterbeschäftigung<br />
leben.<br />
3.7 Die Anwendung des "Ersten Weges" bei <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Fachverbänden: das Beispiel<br />
Christliches Jugenddorf Deutschland (CJD)<br />
Das CJD ist e<strong>in</strong> b<strong>und</strong>esweit tätiger Träger mit ungefähr 90 E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> über 8.000 Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeitern. Schwerpunkte der Tätigkeit f<strong>in</strong>den sich im Bereich des SGB<br />
52
II <strong>und</strong> SGB III, das CJD betreibt auch Ersatzschulen <strong>und</strong> engagiert sich im Bereich des W<strong>in</strong>-<br />
tersports.<br />
Das CJD ist – wie <strong>di</strong>e Johanniter – e<strong>in</strong> Fachverband im Diakonischen Werk der EKD. Da es<br />
b<strong>und</strong>esweit tätig ist, gehören <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungen des CJD zwar den jeweiligen Landeskirchen<br />
an, das CJD als <strong>Ver</strong>band ist aber Mitglied im DW der EKD. Es handelt sich um e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>getragenen<br />
<strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>. Die Konstruktion, das CJD als Fachverband aufzunehmen, verdankt sich aus<br />
Sicht der Mitarbeitervertretung dem Tatbestand, dass nur so der Weg der Anerkennung durch<br />
<strong>di</strong>e Landeskirchen ausgehebelt werden kann. Am Stammsitz des CJD, <strong>in</strong> Baden-Württemberg,<br />
hat <strong>di</strong>e dortige Landeskirche dem CJD auf Gr<strong>und</strong> der Bestimmungen des dort geltenden kirchlichen<br />
Arbeitsrechts <strong>di</strong>e Anerkennung verweigert.<br />
<strong>Ausgliederung</strong>en existieren im CJD nicht, es gibt zwar GmbHs, deren Personal wird jedoch<br />
durch das CJD gestellt <strong>und</strong> zu den im CJD geltenden <strong>Ver</strong>gütungsbed<strong>in</strong>gungen bezahlt. Tarifverträge<br />
mit christlichen oder anderen (DGB-)Gewerkschaften gibt es ebenfalls nicht.<br />
Das CJD wendet gegenwärtig e<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>gütungsordnung an, <strong>di</strong>e ausschließlich durch <strong>di</strong>e<br />
Dienstgeber festgelegt wurde, ohne dass e<strong>in</strong>e Arbeitsrechtliche Kommission <strong>di</strong>eser VGO jemals<br />
zugestimmt hätte. Ergebnis <strong>di</strong>eser Anwendung der VGO ist aus Sicht der MAV, dass<br />
sich <strong>di</strong>e Schere zwischen den im öffentlichen Bereich oder großen Teilen der Diakonie gezahlten<br />
Entgelten <strong>und</strong> den im CJD gezahlten <strong>Ver</strong>gütungen immer weiter öffnet, weil <strong>di</strong>e VGO<br />
nur altersangepasste Steigerungen der <strong>Ver</strong>gütung vorsieht. E<strong>in</strong> Ergebnis <strong>di</strong>eses Tatbestandes<br />
sei e<strong>in</strong>e hohe Personalfluktuation, da <strong>in</strong>sbesondere jüngeres Personal nach wenigen Jahren auf<br />
Gr<strong>und</strong> der E<strong>in</strong>kommens<strong>di</strong>fferenzen das CJD verlässt <strong>und</strong> alternative Anstellungsträger sucht.<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Diakonischen Werke, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> ihren Satzungen geregelt haben, dass Mitglieder<br />
des DW den "Dritten Weg" anwenden müssen, s<strong>in</strong>d von den MAV angeschrieben worden, um<br />
sich zu dem abweichenden Fall des CJD zu äußern <strong>und</strong> den Tatbestand der Anwendung e<strong>in</strong>es<br />
nicht durch e<strong>in</strong>e ARK legitimierten Tarifs zu korrigieren. Die Reaktion der Diakonischen<br />
Werke war nach Aussage der MAV h<strong>in</strong>haltend <strong>und</strong> ausweichend („Die haben gesagt, da muss<br />
was gemacht werden, lassen sie uns mal reden, aber <strong>di</strong>e haben den Atem der Jahrh<strong>und</strong>erte“).<br />
Es wurde zu ke<strong>in</strong>em Zeitpunkt überprüft, ob seitens des CJD e<strong>in</strong>e Korrektur stattgef<strong>und</strong>en hat.<br />
Nachdem <strong>di</strong>e MAV <strong>di</strong>esen Tatbestand öffentlichkeitswirksam thematisiert hat, wurde ihr<br />
durch <strong>di</strong>e Geschäftsleitung des CJD angeboten, e<strong>in</strong>e ARK zu etablieren. Auf <strong>di</strong>eses Angebot<br />
hat <strong>di</strong>e MAV positiv reagiert, allerd<strong>in</strong>gs mit dem Auftrag, aus dem Dritten Weg heraus e<strong>in</strong>en<br />
53
Branchentarifvertrag anzustreben. Die Dienstgeberseite wiederum sieht <strong>di</strong>e ARK als e<strong>in</strong> In-<br />
strument an, <strong>di</strong>e bestehende <strong>Ver</strong>gütungsordnung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e reguläre AVR zu überführen. Ergebnis<br />
war <strong>di</strong>e Beantragung e<strong>in</strong>er ARK durch das DW Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz<br />
(DWBO), da deren Arbeitsrechtsregelungsgesetz es als E<strong>in</strong>zige ermöglicht, trägerspezifische<br />
Arbeitsrechtliche Kommissionen zuzulassen.<br />
Zweck <strong>di</strong>eser Handhabung von Ausnahmegenehmigungen sei es, so <strong>di</strong>e MAV, E<strong>in</strong>richtungen<br />
oder <strong>Ver</strong>bänden, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e AVR DW EKD nicht anwenden wollen, <strong>di</strong>e Möglichkeit zu geben,<br />
abweichende Regelungen zu treffen. Allerd<strong>in</strong>gs wurde das Arbeitsrechtsregelungsgesetz zu<br />
e<strong>in</strong>em Zeitpunkt entwickelt, wo <strong>di</strong>e Ökonomisierung des Sozialsektors noch nicht so weit<br />
fortgeschritten war <strong>und</strong> dementsprechend noch nicht so viele Träger mit dem Wunsch nach<br />
e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>richtungsspezifischen ARK liebäugelten.<br />
Gegenwärtig werde Druck auf das DWBO ausgeübt, Ausnahmeregelungen nicht (mehr) zu<br />
erteilen, um e<strong>in</strong>er weiteren Zersplitterung des kirchlichen Arbeitsrechts entgegen zu wirken.<br />
Den bei den Beschäftigten zunehmend auf Ablehnung stoßenden Bestrebungen des Johanniter<br />
Ordens <strong>und</strong> der Johanniter Unfallhilfe, sich von den AVR DW-EKD zu lösen <strong>und</strong> b<strong>und</strong>esweit<br />
<strong>di</strong>e hauseigene Regelung der AVR-J zur Anwendung zu br<strong>in</strong>gen, wurde nun durch den Kirchengerichtshof<br />
der EKD, <strong>di</strong>e Gr<strong>und</strong>lage entzogen.<br />
Durch Beschluss vom 8.9.2011 hat der KGH <strong>di</strong>e Beschwerden gegen <strong>di</strong>e Entscheidung der<br />
Schiedsstelle der Konföderation zurückgewiesen. (Näheres zu den H<strong>in</strong>tergründen siehe Meldung<br />
vom 15.10.2010).<br />
Damit steht fest: Die AVR-J s<strong>in</strong>d im Bereich des Diakonischen Werkes Hannovers e.V. ke<strong>in</strong><br />
zulässiges kirchliches Arbeitsrecht.<br />
Der Präsident des Kirchengerichtshofes der EKD, Harald Schliemann, machte <strong>in</strong> der mündlichen<br />
<strong>Ver</strong>handlung zudem deutlich, dass er erhebliche Zweifel daran hat, dass <strong>di</strong>e Bildung<br />
e<strong>in</strong>er unternehmensbezogenen Arbeitsrechtlichen Kommission mit den Gr<strong>und</strong>sätzen des<br />
"Dritten Weges" vere<strong>in</strong>bar ist.<br />
Wie der beteiligte Rechtsanwalt Bernhard Baumann Czichon <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Stellungnahme ausführte,<br />
hat <strong>di</strong>e Entscheidung weitreichende Bedeutung für <strong>di</strong>e betroffenen E<strong>in</strong>richtungen. Es bedeutet<br />
u.a., dass sie von den Kürzungsmöglichkeiten z.B. der Anlage 14 AVR DW EKD (er-<br />
54
gebnisabhängige Zahlung der zweiten Hälfte der Jahressonderzahlung) ke<strong>in</strong>en Gebrauch ma-<br />
chen können; für den Johanniterverb<strong>und</strong> steht das Projekt "AVR-J" <strong>in</strong>sgesamt auf dem Spiel.<br />
Andere E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>e eigene ARK bilden wollen (z.B. das CJD), werden nach Vorliegen<br />
der Entscheidungsgründe prüfen müssen, ob sie den Weg fortsetzen können. Mit <strong>di</strong>eser<br />
Entscheidung bestätigt der KGH das <strong>di</strong>e EKD <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Diakonie prägende Territorialitätspr<strong>in</strong>zip,<br />
wonach ke<strong>in</strong>e Landeskirche der Anderen Regelungen vorschreiben kann.<br />
Aus Sicht der MAV bestätigt das Urteil <strong>in</strong> Sachen Johanniter <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>schätzung, dass e<strong>in</strong>richtungsspezifische<br />
ARK mit der Konstruktion des "Dritten Wegs" nicht <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmung zu<br />
br<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>richtungsspezifische Arbeitsrechtliche Kommissionen hätten immer mit dem<br />
Tatbestand der Abhängigkeit der Mitarbeitervertretungen von den verhandelnden Arbeitgebern<br />
zu tun, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Rahmen unmittelbar deutlich werde.<br />
E<strong>in</strong> weiterer deutlicher Kritikpunkt der MAV ist der Tatbestand, dass <strong>di</strong>e Festlegung der Sozialpartner<br />
<strong>in</strong> der ARK durch e<strong>in</strong> unternehmerbesetztes Organ, <strong>di</strong>e Diakonische Konferenz,<br />
erfolge. Die dort versammelten Arbeitgeber legen <strong>di</strong>e Regeln fest <strong>und</strong> nicht der Rat der EKD.<br />
Dies habe zur Folge, dass „Pseudogewerkschaften“ oder <strong>Ver</strong>tretungsorgane bestimmter Berufsgruppen<br />
<strong>in</strong> <strong>di</strong>e ARK geholt werden, <strong>di</strong>e nur e<strong>in</strong>en Bruchteil der Beschäftigten vertreten.<br />
So mache der Marburger B<strong>und</strong> „re<strong>in</strong>e Lobbyarbeit“ <strong>und</strong> sitzt trotz des ger<strong>in</strong>gen Anteils der<br />
Ärzte an der Gesamtbeschäftigung mit zwei <strong>Ver</strong>tretern <strong>in</strong> der ARK.<br />
55
4. Fallstu<strong>di</strong>e: Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland. Durch Personalkostenmanagement <strong>und</strong><br />
Ausgründungen auf dem Weg zum Sozialwirtschafts-Champion<br />
4.1 Zur Lage der Kirche <strong>und</strong> Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
Die Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland ist gegenwärtig <strong>in</strong> vier Diakonischen Werken organisiert.<br />
Nach der Wende 1989 waren auf dem Gebiet der ehemaligen DDR acht verschiedene Diakonische<br />
Werke entstanden. 2005 wurden durch Fusionen der Landesverbände <strong>di</strong>e heutigen 4<br />
Diakonischen Werke gebildet. Die organisatorische Fusion der Diakonischen Werke ist Folge<br />
der parallel dazu geführten <strong>Ver</strong>handlungen über <strong>di</strong>e Zusammenlegung von Landeskirchen<br />
(bspw. <strong>in</strong> Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> Thür<strong>in</strong>gen), wo <strong>di</strong>e Evangelische Kirche der Kirchenprov<strong>in</strong>z<br />
Sachsen zusammen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche Thür<strong>in</strong>gen <strong>di</strong>e neue Evangelische<br />
Kirche <strong>in</strong> Mitteldeutschland bildet (<strong>di</strong>e auch kle<strong>in</strong>e Teile von Brandenburg <strong>und</strong> Sachsen<br />
umfasst) <strong>und</strong> nach längeren (Vor-)<strong>Ver</strong>handlungen zum 1.1.2009 gegründet werden konnte.<br />
Fusionen von Diakonischen Werken können auch Vorbote langfristig geplanter Fusionen von<br />
Landeskirchen se<strong>in</strong> (bspw. <strong>di</strong>e Fusion von Evangelisch-Lutherischer Landeskirche Mecklenburgs<br />
<strong>und</strong> der Pommerschen Evangelischen Kirche, <strong>di</strong>e jahrelang kirchen<strong>in</strong>tern kontrovers<br />
verhandelt wurde <strong>und</strong> <strong>di</strong>e zu Pf<strong>in</strong>gsten 2012 erfolgt ist). Folgende Diakonische Werke s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland (auf dem Gebiet der ehemaligen DDR) tätig:<br />
‐ Das DW Sachsen besteht seit der Wiedervere<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> ist wie <strong>di</strong>e Evangelisch-<br />
Lutherische Landeskirche Sachsen auf dem Gebiet des ehemaligen Landes Sachsen <strong>in</strong><br />
den Grenzen von 1922 tätig. D. h., e<strong>in</strong>ige kle<strong>in</strong>ere Gebiete des B<strong>und</strong>eslandes Sachsen<br />
werden seelsorgerisch wie wohlfahrtspflegerisch von angrenzenden Landeskirchen <strong>und</strong><br />
ihren DWs versorgt (so ist das DW Mitteldeutschland nördlich von Leipzig <strong>und</strong> das DW<br />
Berl<strong>in</strong>-Brandenburg <strong>in</strong> Teilen der Oberlausitz tätig).<br />
‐ Das DW Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wurde Ende 2004 <strong>in</strong>s Leben gerufen<br />
<strong>und</strong> durch <strong>di</strong>e Synode im November 2004 kirchenrechtlich verankert <strong>und</strong> ist <strong>di</strong>e<br />
<strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igung der zwei im B<strong>und</strong>esland Brandenburg tätigen Diakonischen Werke.<br />
‐ Das DW Mitteldeutschland entstand ebenfalls Ende 2004 durch <strong>di</strong>e Fusion des Diakonischen<br />
Werkes der Kirchenprov<strong>in</strong>z Sachsen, von Anhalt <strong>und</strong> von Thür<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> nahm<br />
zum 1.1.2005 se<strong>in</strong>e Arbeit auf (Sitz <strong>in</strong> Halle a.d.S.). Die kle<strong>in</strong>e Landeskirche Anhalt mit<br />
Sitz <strong>in</strong> der Lutherstadt Wittenberg ist selbstän<strong>di</strong>g geblieben, hat aber ihr Diakonisches<br />
Werk mit dem neuen DW Mitteldeutschland vere<strong>in</strong>igt.<br />
56
‐ Die beiden DW Mecklenburg <strong>und</strong> Pommern verhandeln seit 2004 <strong>di</strong>e Bildung e<strong>in</strong>es<br />
neuen geme<strong>in</strong>samen DW, das se<strong>in</strong>e Arbeit schon 2005 aufnehmen sollte. Im Oktober<br />
2004 hatte <strong>di</strong>e Pommersche Synode mit e<strong>in</strong>em neuen Diakoniegesetz <strong>di</strong>e Fusion e<strong>in</strong>geleitet.<br />
Auch <strong>di</strong>e Herbstsynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche <strong>in</strong> Mecklenburg<br />
hatte der <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igung zugestimmt. Dem <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igungsantrag wurde jedoch durch <strong>di</strong>e<br />
Mitgliederversammlung des Diakonischen Werkes <strong>in</strong> Pommern nicht zugestimmt. Es<br />
bedurfte <strong>in</strong>sgesamt dreier <strong>Ver</strong>suche, bis beide Mitgliederversammlungen im <strong>Ver</strong>lauf des<br />
Jahres 2010 der Bildung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen DW rückwirkend zum 1.1.2010 zustimmten.<br />
Sitz des neuen DW Mecklenburg-Vorpommern ist Schwer<strong>in</strong>. Es gibt jedoch zwei<br />
Geschäftsstellen (Schwer<strong>in</strong> <strong>und</strong> Greifswald), e<strong>in</strong> Zugeständnis der Kirche angesichts<br />
des konfliktösen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igungsprozesses.<br />
Die seit etwa 2005 erfolgte organisatorische Zusammenlegung sowohl von Landeskirchen wie<br />
ihrer Diakonischen Werke <strong>in</strong> Ostdeutschland muss man als <strong>Ver</strong>such werten, <strong>di</strong>e kirchlichen<br />
Strukturen den Strukturen der B<strong>und</strong>esländer – so weit als möglich – anzugleichen, um <strong>in</strong> lan-<br />
despolitischen Prozessen möglichst e<strong>in</strong>heitlich agieren zu können, kirchlich wie wohlfahrts-<br />
pflegerisch <strong>und</strong> sozialpolitisch. Die Fusionen s<strong>in</strong>d aber vor allem auch Folge der mit der A-<br />
genda 2010 e<strong>in</strong>setzenden ausgeprägten Konsoli<strong>di</strong>erungs- <strong>und</strong> Austeritätspolitik auf B<strong>und</strong>es<strong>und</strong><br />
Landesebene, <strong>in</strong> deren Folge <strong>di</strong>e verschiedenen staatlichen Zuwendungen für <strong>di</strong>e Kirchen<br />
<strong>und</strong> ihre Diakonischen Werke entweder gestrichen oder (drastisch) zurückgefahren wurden.<br />
Die sog. Pauschalzuwendungen (Globaldotationen) an <strong>di</strong>e Kirchen wie aber auch an <strong>di</strong>e anderen<br />
Wohlfahrtsverbände s<strong>in</strong>d bis heute heftig umkämpft, da sie <strong>in</strong> verschiedenen Schritten<br />
gekürzt wurden <strong>und</strong> haben alle Wohlfahrtsverbände gezwungen, <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>bandsarbeit auf Landes-<br />
wie auf kommunaler Ebene neu zu organisieren <strong>und</strong> <strong>di</strong>e F<strong>in</strong>anzierung der <strong>Ver</strong>bandsarbeit<br />
neu zu ordnen. Globaldotationen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e nicht zweckgeb<strong>und</strong>ene Förderung <strong>und</strong> sollen sicherstellen,<br />
dass <strong>di</strong>e Wohlfahrtsverbände ihren gesellschaftlichen <strong>und</strong> sozialpolitischen Auftrag<br />
im Rahmen ihrer Selbstbestimmungsrechte wahrnehmen können. Auch der seit dem Jahre<br />
2000 forciert betriebene Umbau der Freien Wohlfahrtspflege zu e<strong>in</strong>er wettbewerblichen<br />
Sozialwirtschaft muss als wichtige Rahmenbed<strong>in</strong>gung angesehen werden, <strong>di</strong>e zur Restrukturierung<br />
der <strong>Ver</strong>bandsarbeit aller Wohlfahrtsverbände beigetragen hat. Die Evangelische Kirche<br />
<strong>in</strong> Ostdeutschland hat <strong>di</strong>e sich seit etwa 2000 abzeichnende Notwen<strong>di</strong>gkeit der Fusionierung<br />
von Diakonischen Werken angesichts der sozialwirtschaftlichen Transformation der<br />
Freien Wohlfahrtspflege früh erkannt <strong>und</strong> wie folgt begründet:<br />
57
„Mit <strong>di</strong>esen <strong>Ver</strong>änderungen“ (d.i. Fusionen, <strong>di</strong>e Autoren) „tragen <strong>di</strong>e genannten <strong>Ver</strong>bände den<br />
<strong>in</strong>sgesamt sich verändernden Struktur- <strong>und</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen Rechnung. E<strong>in</strong>sparungen,<br />
Kürzungen, zurückgehende Fördermittel s<strong>in</strong>d hier nur <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>e Seite, auf <strong>di</strong>e sie reagieren.<br />
Andererseits wachsen soziale Aufgabenfelder <strong>und</strong> neue Brennpunkte entstehen, für <strong>di</strong>e ke<strong>in</strong>e<br />
Mittel bzw. Kapazitäten bereit stehen. Die Fusionen eröffnen für <strong>di</strong>e Diakonie neue Chancen.<br />
Durch das Bündeln von <strong>Ver</strong>waltungsaufgaben <strong>und</strong> Schaffen von effektiven Strukturen ergeben<br />
sich andere, neue Möglichkeiten. So wird <strong>di</strong>e Entwicklung neuer Arbeitsfelder <strong>und</strong> Spezialisierungen<br />
möglich, statt des (vorhersehbaren) Abbaus von Aufgaben <strong>und</strong> Dienstleistungen.<br />
Auch <strong>di</strong>e Beratungsleistungen für <strong>di</strong>e Mitglieder werden verbessert durch <strong>di</strong>e Bündelung<br />
vielfältig schon vorhandener Kräfte. Fusionen der <strong>Ver</strong>bände s<strong>in</strong>d deshalb e<strong>in</strong> Weg, um für <strong>di</strong>e<br />
zukünftigen Aufgaben besser gerüstet zu se<strong>in</strong>.“<br />
(Pressemeldung vom 10.11.2004. www.<strong>di</strong>akonie.de/<strong>di</strong>akonie-news-188-aus-acht-mach-vier-<br />
470.htm)<br />
Die Fusionsprozesse <strong>in</strong> den Diakonischen Werken s<strong>in</strong>d das Spiegelbild der Zusammenlegungsprozesse<br />
<strong>in</strong> den Landeskirchen. Fusionen von Landeskirchen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
weiter fortgeschritten als <strong>in</strong> Westdeutschland, wo <strong>di</strong>e Landeskirchen noch weitgehend <strong>in</strong> den<br />
<strong>in</strong> den tra<strong>di</strong>tionellen territorialen, kirchenrechtlich verankerten Grenzen tätig s<strong>in</strong>d. Die ger<strong>in</strong>ge<br />
Anzahl von Kirchenmitgliedern <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>und</strong> das damit verb<strong>und</strong>ene niedrige Aufkommen<br />
an Kirchensteuer ist e<strong>in</strong> weiterer gewichtiger Gr<strong>und</strong> für <strong>di</strong>e kirchlichen <strong>und</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong><br />
Fusionsprozesse, <strong>di</strong>e das politische, sozialpolitische <strong>und</strong> versorgungspolitische Ziel<br />
haben, effektive <strong>und</strong> effiziente Kirchen- <strong>und</strong> Diakoniestrukturen zu entwickeln.<br />
Kirchenmitgliedschaft <strong>in</strong> Ostdeutschland 2010<br />
evangelisch katholisch zusammen<br />
Berl<strong>in</strong> 18,7% 9,2% 27,9%<br />
Brandenburg 17,1% 3,1% 20,2%<br />
Mecklenburg-Vorpomm. 17,3% 3,3% 20,5%<br />
Sachsen 20,3% 3,6% 28,9<br />
Sachsen-Anhalt 14,1% 3,5% 17,6%<br />
Thür<strong>in</strong>gen 23,8% 7,8% 31,6%<br />
Quelle: EKD; www.kirchensteuern.de<br />
58
In Ostdeutschland ist der Anteil der Kirchenmitglieder von 1980 bis 2008 von ca. 35% auf<br />
20% gesunken. 1 Für <strong>di</strong>e B<strong>und</strong>esrepublik <strong>in</strong>sgesamt lässt sich feststellen: von 1980 bis 2010<br />
ist der Anteil der Kirchenmitglieder (ev. <strong>und</strong> kath. Kirche zusammen) von ca. 85% auf 59%<br />
(Anteil an der Gesamtbevölkerung) zurückgegangen; dabei s<strong>in</strong>d jeweils ca. 29% Mitglieder<br />
der katholischen wie der evangelischen Kirche <strong>und</strong> ca. 34,6% konfessionslos. Das gesamte<br />
Kirchensteueraufkommen betrug 2010 ca. 9,7 Mrd. €. Davon entfielen 4,5 Mrd. auf <strong>di</strong>e ev.<br />
Kirche <strong>und</strong> 5,1 Mrd. auf <strong>di</strong>e kath. Kirche (Quelle: www.kirchensteuer.de). Das Kirchensteueraufkommen<br />
der evangelischen Kirche betrug im Jahr 1992 ca. 4,2 Mrd. €, war aber <strong>in</strong> konjunkturschwachen<br />
Jahren (2006 <strong>und</strong> 2007) auf 3,6 Mrd. gesunken, <strong>in</strong> konjunkturstarken Jahren<br />
dann aber auch wieder gestiegen.. Die weiterh<strong>in</strong> konstant hohe Zahl der jährlichen Kirchenaustritte<br />
– <strong>in</strong> der evangelischen Kirche <strong>in</strong> den letzten zehn Jahren jährlich b<strong>und</strong>esweit<br />
zwischen 180.000 <strong>und</strong> 120.000 - lässt <strong>di</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Situation der evangelischen Kirche <strong>in</strong>sgesamt<br />
wie <strong>in</strong> Ostdeutschland auch <strong>in</strong> Zukunft als e<strong>in</strong>e zentrale Herausforderung ersche<strong>in</strong>en.<br />
Da Kirchensteuere<strong>in</strong>nahmen – wie alle aus E<strong>in</strong>kommen stammenden Steuern – stark konjunkturbed<strong>in</strong>gt<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> <strong>in</strong> ihrer Entwicklung von den steuerpolitischen Entscheidungen des Staates<br />
über <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>kommensteuergesetzgebung abhängen, s<strong>in</strong>d auch im strukturschwachen Ostdeutschland<br />
jährlich starke Schwankungen im Aufkommen der Kirchensteuer zu verzeichnen.<br />
Konjunkture<strong>in</strong>brüche wie Konjunkturaufschwünge <strong>und</strong> <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>kommensteuerpolitik s<strong>in</strong>d<br />
maßgeblich verantwortlich für <strong>di</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Lage der Kirchen auch <strong>in</strong> Ostdeutschland. Die<br />
schwankenden, <strong>in</strong>sgesamt aber s<strong>in</strong>kenden Steuere<strong>in</strong>nahmen der Kirchen s<strong>in</strong>d für <strong>di</strong>e organisatorischen<br />
Restrukturierungen <strong>in</strong> Kirche <strong>und</strong> Diakonie bedeutsam <strong>und</strong> erklären maßgeblich <strong>di</strong>e<br />
kirchlichen <strong>und</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Fusionsprozesse <strong>in</strong> Ostdeutschland. Auch am Kirchensteueraufkommen<br />
kann man ablesen, welche B<strong>und</strong>esländer strukturschwach s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> schnell negativ<br />
von Konjunkturentwicklungen betroffen s<strong>in</strong>d.<br />
1<br />
Vgl. dazu: Daniel Lois. Kirchenmitgliedschaft <strong>und</strong> Kirchgangshäufigkeit im Zeitverlauf. E<strong>in</strong>e Trendanalyse<br />
unter Berücksichtigung von Ost-West-Unterschieden. In: Comparative Population <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong>s. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft,<br />
36. Jg., 2011, S. 127-160; ferner: fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen <strong>in</strong><br />
Deutschland. 25.8.2005.<br />
59
Entwicklung der Kirchensteuern <strong>in</strong> den ostdeutschen ev. Landeskirchen <strong>in</strong> Millionen Euro 2 :<br />
1992 1995 1998 2003 2006 2010<br />
Anhalt 2,8 5,4 4,0 1,8 2,6 4,1<br />
Berl<strong>in</strong>-Brandenburg<br />
Schles. Oberlausitz<br />
Kirchenprov<strong>in</strong>z<br />
Sachsen<br />
Thür<strong>in</strong>gen<br />
Mecklenburg<br />
Pommern<br />
216,2<br />
3,5<br />
28,1<br />
26,2<br />
13,8<br />
4,6<br />
204<br />
5,5<br />
42,9<br />
36,8<br />
19,4<br />
7,1<br />
153,3<br />
4,3<br />
26,0<br />
24,5<br />
17,4<br />
4,6<br />
164<br />
4,3<br />
125<br />
nach Fusion<br />
175<br />
nach Fusion<br />
2<br />
Vgl. dazu: Friederich Halfmann. Zu e<strong>in</strong>igen Aspekten der Kirchenf<strong>in</strong>anzierung <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
(http://www.kirchensteuern.de/Kirchenf<strong>in</strong>anzierungGesamt2.htm, Zugriff: 01.05.2012).<br />
60<br />
51<br />
39,4<br />
16,9<br />
9,1<br />
32<br />
31<br />
18,6<br />
5,9<br />
Sachsen 55,2 77,7 64,4 95 77 99<br />
Quelle: EKD; www.kirchensteuern.de<br />
87<br />
nach Fusion<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d gegenwärtig <strong>in</strong> Ostdeutschland folgende Landeskirchen tätig:<br />
‐ Evangelische Landeskirche Anhalt (ohne eigenes Diakonisches Werk)<br />
‐ Evangelisch-Lutherische Kirche Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz<br />
‐ Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen<br />
‐ Evangelische Kirche <strong>in</strong> Mitteldeutschland<br />
‐ Evangelisch-Lutherische Kirche Mecklenburg-Vorpommern (ab Pf<strong>in</strong>gsten 2012; Diakonische<br />
Werke haben schon 2010 fusioniert)<br />
4.2 Zur Lage der Diakonie <strong>in</strong> der DDR <strong>und</strong> zum Zeitpunkt der Wiedervere<strong>in</strong>igung<br />
Die Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland war der e<strong>in</strong>zige Wohlfahrtsverband, der zur Zeit der Wiedervere<strong>in</strong>igung<br />
über e<strong>in</strong>igermaßen <strong>in</strong>takte Organisationsstrukturen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en (wenn auch kle<strong>in</strong>en)<br />
qualifizierten Personalstamm verfügte. Alle anderen westdeutschen Wohlfahrtsverbände<br />
mussten <strong>in</strong> Ostdeutschland erst neu gegründet werden, soziale Dienste aufbauen <strong>und</strong> Personal<br />
rekrutieren <strong>und</strong> ausbilden bzw. durch staatliche Ausbildungsprogramme weiterbilden <strong>und</strong><br />
umschulen lassen. Die katholische Kirche <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Caritas waren <strong>in</strong> der DDR zwar ähnlich wie<br />
21<br />
8,8
<strong>di</strong>e Diakonie mit Sonderrechten ausgestattet, als sozialer Dienstleistungserbr<strong>in</strong>ger hat <strong>di</strong>e ka-<br />
tholische Kirche im <strong>Ver</strong>gleich zur evangelischen Kirche aber immer nur e<strong>in</strong>e Nebenrolle ge-<br />
spielt, da Ostdeutschland historisch gesehen überwiegend protestantisch war <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Caritas<br />
angesichts des ger<strong>in</strong>gen Anteils katholischer Kirchenmitglieder ke<strong>in</strong>e vergleichbaren Struktu-<br />
ren wie <strong>di</strong>e Diakonie ausgebildet hat.<br />
Die Stellung der Kirchen <strong>in</strong> der DDR geht auf Sonderrechte zurück, <strong>di</strong>e ihnen nach Kriegsende<br />
<strong>di</strong>e sowjetische Besatzungsmacht e<strong>in</strong>räumte, da <strong>di</strong>ese e<strong>in</strong> massives Interesse daran hatte,<br />
Kirchenstrukturen zur L<strong>in</strong>derung der Nachkriegsnot <strong>und</strong> zur Stabilisierung der neuen <strong>Ver</strong>hältnisse<br />
zu nutzen. 3 Die Stellung der evangelischen Kirche <strong>in</strong> der DDR verdankt sich auch<br />
den f<strong>in</strong>anziellen Geldströmen durch <strong>di</strong>e EKD, <strong>di</strong>e, <strong>in</strong>dem sie <strong>di</strong>e Arbeit der Diakonie förderte,<br />
dafür sorgte, dass regelmäßig Westgeld <strong>in</strong> das devisenknappe Land floss. Das führte dazu,<br />
dass <strong>di</strong>e Diakonie aus pragmatischen Gründen akzeptiert wurde 4 , zumal <strong>di</strong>e Werteorientierung<br />
der Diakonie mit den humanistischen Zielen der DDR als vere<strong>in</strong>bar erschien. Ihre Funktionalisierung<br />
durch <strong>di</strong>e SED erlaubte ihr aber auch, eigene kirchliche Strukturen zu bewahren<br />
<strong>und</strong> weiter zu entwickeln <strong>und</strong> sich dabei vor allem auf dem Gebiet der Arbeit mit Menschen<br />
mit Beh<strong>in</strong>derungen wie auf ges<strong>und</strong>heitsbezogenem Gebiet zu betätigen (bspw. konfessionelle<br />
Krankenpflegeausbildung).<br />
„Zu den akzeptierten Arbeitszweigen der Diakonie gehörten vor allem <strong>di</strong>e stationären E<strong>in</strong>richtungen<br />
der Altenhilfe <strong>und</strong> für beh<strong>in</strong>derte Menschen sowie <strong>di</strong>e konfessionellen Krankenhäuser.<br />
Andererseits wollte <strong>di</strong>e staatliche Seite <strong>di</strong>e Diakonie als me<strong>di</strong>z<strong>in</strong>ische oder soziale Dienstleistung<br />
ohne missionarischen Auftrag verstehen. Deshalb wurden auch <strong>in</strong> den 80er Jahren Bereiche<br />
der halboffenen <strong>und</strong> offenen Arbeit skeptisch beobachtet oder waren Restriktionen ausgesetzt“<br />
5 . Ambulante Dienste der Diakonie lagen im Bereich der Suchtkrankenhilfe, der Gefängnisseelsorge,<br />
der Betreuung älterer Menschen <strong>in</strong> Altenheimen <strong>und</strong> Pflegee<strong>in</strong>richtungen<br />
wie der Bereitstellung verschiedener Beratungs<strong>di</strong>enste.<br />
Die Situation der Diakonie zum Ende der DDR lässt sich wie folgt beschreiben:<br />
„Gegen Ende der DDR verfügte <strong>di</strong>e Diakonie über 44 Krankenhäuser, 187 Feierabendheime,<br />
47 Alterspflegeheime, 127 E<strong>in</strong>richtungen für geistig beh<strong>in</strong>derte Menschen (davon 30 Sonder-<br />
3<br />
Vgl. Ingolf Hübner. Der Weg der Diakonie <strong>in</strong> der DDR. In: J. C. Kaiser (Hrsg. unter Mitarbeit von Volker<br />
Herrmann). Handbuch zur Geschichte der Inneren Mission, Stuttgart 2008, S. 12-29; hier. S. 12.<br />
4<br />
Ebd. S. 21ff.<br />
5<br />
Ebd. S. 23.<br />
61
tagesstätten), 290 K<strong>in</strong>dergärten <strong>und</strong> Horte (darunter 15 K<strong>in</strong>derkrippen), 315 Geme<strong>in</strong>depflege-<br />
stationen, 114 Erholungsheime <strong>und</strong> 67 sonstige Heime. In <strong>di</strong>esen 556 stationären E<strong>in</strong>richtun-<br />
gen <strong>und</strong> 635 Tagese<strong>in</strong>richtungen wurden <strong>in</strong>sgesamt 42.000 Betten bzw. Plätze zur <strong>Ver</strong>fügung<br />
gestellt <strong>und</strong> von 15.700 Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern betreut. Für <strong>di</strong>e <strong>in</strong> konfessionellen<br />
E<strong>in</strong>richtungen geleisteten me<strong>di</strong>z<strong>in</strong>ischen Behandlungen <strong>und</strong> Betreuungen wurden 1989 <strong>in</strong>sgesamt<br />
259 Mio. M vom staatlichen Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen erstattet. Die jährlich zu<br />
beantragenden Pflegekostensätze wurden <strong>in</strong> den 80er Jahren meist antragsgemäß bestätigt.<br />
(...) Die fehlenden Mittel oder Materialien, <strong>in</strong>sbesondere für bauliche, technische <strong>und</strong> me<strong>di</strong>z<strong>in</strong>technische<br />
Investitionen, wurden durch <strong>di</strong>e westdeutsche Diakonie <strong>und</strong> <strong>di</strong>e B<strong>und</strong>esregierung<br />
aufgebracht. (...) Darüber h<strong>in</strong>aus wurden ab 1966 für Bauprogramme, <strong>di</strong>e vor allem älteren<br />
<strong>und</strong> beh<strong>in</strong>derten Menschen zugute kamen, durch <strong>di</strong>e aber auch Dienstwohnungen für<br />
kirchliche <strong>und</strong> <strong>di</strong>akonische Mitarbeiter entstanden, etwa 153 Mio. DM aufgewendet. (...) Im<br />
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirchen <strong>in</strong> der DDR waren schließlich 30 Fachverbände<br />
– von den Schwesternschaften <strong>und</strong> dem Diakonenverband bis zu missionarischen <strong>und</strong><br />
seelsorgerlichen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften – vertreten. Die h<strong>in</strong>ter den Fachverbänden stehenden<br />
Arbeitsbereiche zeigen <strong>di</strong>e Vielfalt <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Breite der Diakonie <strong>in</strong> der DDR.“ 6<br />
Die Startbed<strong>in</strong>gungen für <strong>di</strong>e Diakonie zum Zeitpunkt des Beitritts der DDR zum Staatsgebiet<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik waren relativ günstig, verfügte sie doch über e<strong>in</strong>e Reihe von größeren<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> war darüber h<strong>in</strong>aus auf Sektoren des sozialen Dienstleistungssektors tätig<br />
(Krankenhaus, Alten- <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>dertenhilfe), deren F<strong>in</strong>anzierung durch den öffentlichen Kostenträger<br />
nicht nur gesichert, sondern auch recht komfortabel war <strong>und</strong> E<strong>in</strong>nahmen <strong>und</strong> Überschüsse<br />
mit sich brachte, <strong>di</strong>e man zur Weiterentwicklung <strong>di</strong>akonischer Strukturen <strong>in</strong> den ostdeutschen<br />
Landeskirchen e<strong>in</strong>setzen konnte. Darüber h<strong>in</strong>aus war <strong>di</strong>e Diakonie auch <strong>in</strong> der Beratung<br />
<strong>und</strong> Betreuung von Bürgern <strong>und</strong> Bürger<strong>in</strong>nen tätig, <strong>di</strong>e nach der Wende – zivilgesellschaftlich<br />
motiviert <strong>und</strong> ermuntert – angesichts von massiven Defiziten <strong>in</strong> der sozialen Infrastruktur<br />
eigene soziale <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>e aufbauen wollten. Diese Neugründungen mündeten recht häufig,<br />
nach ersten eigenstän<strong>di</strong>gen Gehversuchen, <strong>in</strong> der Diakonie <strong>und</strong> wurden zu <strong><strong>di</strong>akonischen</strong><br />
E<strong>in</strong>richtungen.<br />
E<strong>in</strong> wichtiges Startkapital der Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland war vor allem e<strong>in</strong> motiviertes Personal,<br />
das schon zu DDR-Zeiten <strong>in</strong> der Diakonie beschäftigt war <strong>und</strong> als Beschäftigte der evangelischen<br />
Kirche berufliche <strong>und</strong> <strong>in</strong>tellektuelle Freiräume nutzten, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e DDR nicht ge-<br />
6 Ebd. S. 26f.<br />
62
währte. Auch <strong>di</strong>e materielle <strong>Ver</strong>sorgung der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
(bspw. E<strong>in</strong>kommen, Dienstwohnung) hat <strong>di</strong>e Diakonie als Arbeitgeber attraktiv ersche<strong>in</strong>en<br />
lassen.<br />
Die Restrukturierungen der Diakonie zu großen Landesverbänden <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Ende der 1990er<br />
Jahre e<strong>in</strong>setzende sozialwirtschaftliche Transformation im Sozialsektor hat auch <strong>in</strong> der Diakonie<br />
zur Bildung größerer effizienzorientierter Sozialunternehmen geführt <strong>und</strong> hat das tra<strong>di</strong>tionell<br />
gute, aus DDR-Zeiten herstammende <strong>Ver</strong>hältnis von Geschäftsführung <strong>und</strong> Personal<br />
getrübt <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Arbeitsbeziehungen konfliktös werden lassen, zwar nicht bei allen Diakonischen<br />
Werken Ostdeutschlands gleichermaßen, aber doch so nachhaltig, dass <strong>di</strong>e gesamte<br />
Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland sich mittlerweile <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „Normalisierungsprozess“ bef<strong>in</strong>det,<br />
der <strong>di</strong>e Arbeitsbeziehungen, <strong>di</strong>e Arbeitsprozesse, <strong>di</strong>e Organisationsstrukturen wie <strong>di</strong>e Organisationspolitik<br />
<strong>in</strong> den <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> „E<strong>in</strong>richtungen“ nachhaltig verändert hat, so dass Differenzen<br />
zu anderen sozialwirtschaftlichen Betrieben der anderen sozialwirtschaftlichen Akteure<br />
– seien sie nun geme<strong>in</strong>nützig oder kommerzieller Art – nivelliert werden. Die Organisations-<br />
<strong>und</strong> Personalpolitik der Diakonischen Werke wie ihrer großen E<strong>in</strong>richtungen befördert<br />
<strong>di</strong>esen Trend zusätzlich. Die Diakonie hat <strong>di</strong>e Wettbewerbssituation im Sozialsektor nie aktiv<br />
kritisiert oder auf dadurch aufkommende Widersprüche <strong>und</strong> Konflikte aktiv aufmerksam gemacht.<br />
Es sche<strong>in</strong>t so, als habe man den Wettbewerb aktiv angenommen, um sich im neuen<br />
Markt zu behaupten <strong>und</strong> vor allem um – angesichts der wachsenden gewerblichen Konkurrenz<br />
<strong>in</strong> den tra<strong>di</strong>tionellen Handlungsfeldern der Diakonie, der Krankenhaus- <strong>und</strong> Altenarbeit,<br />
K<strong>in</strong>dergärten – <strong>di</strong>e eigene Marktmacht zu sichern <strong>und</strong> auszubauen. Die tra<strong>di</strong>tionell guten Beziehungen<br />
zur Politik <strong>in</strong> Ostdeutschland s<strong>in</strong>d dabei ke<strong>in</strong> Nachteil.<br />
Welche ostdeutschen Entwicklungstendenzen lassen sich <strong>in</strong> der Diakonie heute registrieren?<br />
4.3 Sozialwirtschaftliche Bedeutung der Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
Die vier Diakonischen Werke <strong>in</strong> Ostdeutschland haben nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung mächtig<br />
expan<strong>di</strong>ert, geht man von folgenden Eckdaten zur Zeit der Wende aus: zum Ende der DDR<br />
betrieb <strong>di</strong>e Diakonie auf dem Staatsgebiet der DDR <strong>in</strong>sgesamt 556 stationäre <strong>und</strong> ambulante<br />
E<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> den 15.700 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen tätig waren (vgl. schon weiter oben). Das hat<br />
sich heute gr<strong>und</strong>legend geändert, denn mittlerweile betreibt <strong>di</strong>e Diakonie <strong>in</strong> vier Landesver-<br />
63
änden <strong>in</strong>sgesamt ca. 5.200 E<strong>in</strong>richtungen mit etwa 108.000 Mitarbeitern/<strong>in</strong>nen 7 . Das soll<br />
anhand e<strong>in</strong>iger Beispiele aus den DW <strong>in</strong> Ostdeutschland illustriert werden. Die im Folgenden<br />
zitierten Daten entstammen den Geschäftsberichten der ostdeutschen Diakonie, <strong>di</strong>e recht un-<br />
e<strong>in</strong>heitlich s<strong>in</strong>d, so dass Informationen rekonstruiert werden müssen <strong>und</strong> nicht immer alle<br />
wünschenswerten Angaben recherchiert <strong>und</strong> abgebildet werden können.<br />
Diakonische Werke <strong>in</strong> Ostdeutschland: e<strong>in</strong> Überblick<br />
Mitglieder E<strong>in</strong>richtungen Mitarbeiter<br />
DW Berl<strong>in</strong>-Brandenburg 437 1.472 52.000<br />
DW Mitteldeutschland 272 1.500 25.000<br />
DW Sachsen 156 1.709 17.305<br />
DW Mecklenb.-Vorpomm 829 10.622<br />
Quelle: Internetportale der Diakonischen Werke<br />
Im Diakonischen Werk Sachsen gibt es im Jahr 2010 <strong>in</strong>sgesamt 1.709 E<strong>in</strong>richtungen mit <strong>in</strong>sgesamt<br />
17.305 Mitarbeitern/<strong>in</strong>nen. Insgesamt arbeiten 12.009 Beschäftigte der Diakonie<br />
Sachsen <strong>in</strong> Teilzeitbeschäftigung. In Teilen des Freistaates Sachsen s<strong>in</strong>d auch noch das Diakonische<br />
Werk Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-oberschlesische Lausitz mit 1.782 Mitarbeitern (davon<br />
1.361 <strong>in</strong> Teilzeit) <strong>und</strong> das Diakonische Werk Mitteldeutschland mit <strong>in</strong>sgesamt 224 Mitarbeitern<br />
(davon 189 <strong>in</strong> Teilzeit) tätig.<br />
Das DW Sachsen hat 156 Mitgliedse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Die schon zu DDR-Zeiten dom<strong>in</strong>anten Arbeitsbereiche s<strong>in</strong>d beibehalten worden <strong>und</strong> konnten<br />
gestärkt werden; neu h<strong>in</strong>zugekommen s<strong>in</strong>d Arbeitsfelder, deren Ref<strong>in</strong>anzierung durch das<br />
Sozialrecht (K<strong>in</strong>der-<strong>und</strong> Jugendhilfe, Pflegeversicherung, Sozialhilfe) geregelt wird. In Sachsen<br />
betreibt <strong>di</strong>e Diakonie folgende E<strong>in</strong>richtungen (auszugsweise, aufgeführt werden nur <strong>di</strong>e<br />
personalstärkeren Bereiche):<br />
7<br />
Nach der Statistik 2010 der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsberufe <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den<br />
ostdeutschen B<strong>und</strong>esländern ca. 152.000 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter(<strong>in</strong>nen) tätig, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Berufsgenossenschaft<br />
dem Diakonischen Werk zurechnet. In Vollzeitäquivalente umgerechnet s<strong>in</strong>d das ca. 109.000<br />
Vollzeitstellen <strong>in</strong> der Diakonie Ostdeutschlands.<br />
64
Auszug aus der Gesamtstatistik der Diakonie Sachsen 2010<br />
Anzahl der<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
Ges<strong>und</strong>heitshilfe/Krankenhäuser 15 2.527<br />
K<strong>in</strong>dertagesstätten/Horte 236 2.116<br />
Jugendberufshilfe 38 265<br />
Betreutes Wohnen/Heime Jugendliche 58 523<br />
Erziehungsberatung 25 76<br />
Sozialstationen 92 2.093<br />
Alten- u. Pflegeheime 111 4.967<br />
Werkstätten f. beh<strong>in</strong>derte Menschen 43 926<br />
Wohnheime f. beh<strong>in</strong>derte Menschen 64 1.578<br />
Wohnstätten chronisch psych. Kranke 27 212<br />
Suchtberatung – Straffälligenhilfe 48 145<br />
Aus-, Fort- u. Weiterbildung 21 143<br />
Quelle: Diakonie Sachsen. Jahresbericht 2010<br />
65<br />
Anzahl der<br />
Mitarbeiter<br />
Angebotsentwicklung <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Personalentwicklung zwischen 1990 <strong>und</strong> 2010 lassen sich an<br />
folgenden Zahlen ablesen, vor allem lassen sie erkennen, <strong>in</strong> welchen Arbeitsfeldern <strong>di</strong>e Diakonie<br />
expan<strong>di</strong>erte <strong>und</strong> welche neuen Arbeitsfelder h<strong>in</strong>zugekommen s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong>richtungs- <strong>und</strong> Personalentwicklung <strong>in</strong> der Diakonie Sachsen<br />
1990 bis 2010; ausgewählte Bereiche<br />
E<strong>in</strong>richtungen Mitarbeiter <strong>in</strong><br />
Vollzeitäquivalente<br />
Art des Angebot 1990 2010 1990 2010<br />
Krankenhäuser 8 13 724 1.932<br />
Diakon. K<strong>in</strong>dergärten 136 1.013<br />
Kirchliche K<strong>in</strong>dergärten 6 0 94 237 636<br />
Heime K<strong>in</strong>der/Jugendliche 2 69 394<br />
Erholungsheime f. Familien 27 17 113 36
Altersheime/-wohnungen 41 6 404 7<br />
Altenpflegeheime 9 100 162 3.358<br />
Sozialstationen 103 82 91 1.274<br />
Heime f. beh<strong>in</strong>derte Menschen 18 117 657 1.181<br />
Sonderschulen 12<br />
277<br />
E<strong>in</strong>richt. f. psych. Kranke<br />
10<br />
66<br />
59<br />
71 979<br />
Allg. Beratungsangebote 30 234 171 341<br />
Quelle: Diakonie Sachsen 2010<br />
Das Diakonische Werk Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz(DWBO) ist das größte<br />
DW <strong>in</strong> Ostdeutschland. Es besteht aus 437 rechtlich selbstän<strong>di</strong>gen Trägern <strong>und</strong> beschäftigt<br />
ca. 52.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> 1.472 E<strong>in</strong>richtungen. Detaillierte Angaben zur E<strong>in</strong>richtungs<strong>und</strong><br />
Personalstruktur waren nicht zugänglich <strong>und</strong> deshalb folgt <strong>di</strong>e (Kurz)Beschreibung des<br />
DW le<strong>di</strong>glich den Angaben des Internetportals.<br />
Die Anzahl der E<strong>in</strong>richtungen ist <strong>in</strong> etwa <strong>di</strong>e gleiche wie <strong>in</strong> anderen ostdeutschen Diakonischen<br />
Werken (Sachsen ca. 1.700 E<strong>in</strong>richtungen, Mitteldeutschland ca. 1.500 E<strong>in</strong>richtungen;<br />
der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern betreibt le<strong>di</strong>glich e<strong>in</strong> wenig mehr als 800 E<strong>in</strong>richtungen).<br />
Da der Landesverband Berl<strong>in</strong>-Brandenburg aber ca. 52.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
zählt, handelt es sich hier im Durchschnitt um wesentlich größere E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Träger<br />
betreiben. Das DW Berl<strong>in</strong>-Brandenburg versorgt wie alle anderen auch e<strong>in</strong>en weitgehend<br />
ländlich strukturierten Raum. Da es aber auch für <strong>di</strong>e Metropole Berl<strong>in</strong> zustän<strong>di</strong>g ist, s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e<br />
Vielzahl von Trägern <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> vor allem e<strong>in</strong> Großteil des Personals <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>eshauptstadt<br />
tätig. Ohne detailliertere Informationen s<strong>in</strong>d aber weiter gehende Aussagen über<br />
E<strong>in</strong>richtungs- <strong>und</strong> Personalstruktur, E<strong>in</strong>richtungsgrößen <strong>und</strong> Betten/Plätze wie auch über<br />
den Anteil der Teilzeitarbeit <strong>in</strong> den <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Betrieben nicht möglich.
Das DW Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz nennt folgende E<strong>in</strong>richtungszahlen <strong>und</strong><br />
Tätigkeitsbereiche:<br />
‐ 135 stationäre Pflegee<strong>in</strong>richtungen<br />
‐ 21 Seniorenwohnheime<br />
‐ 31 Ausbildungsstätten<br />
‐ 252 E<strong>in</strong>richtungen der stationären <strong>und</strong> ambulanten Beh<strong>in</strong>dertenhilfe<br />
‐ 214 E<strong>in</strong>richtung der stationären <strong>und</strong> ambulanten K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
‐ 104 migrationsspezifische E<strong>in</strong>richtungen<br />
‐ 396 K<strong>in</strong>dertagesstätten<br />
‐ 27 Krankenhäuser<br />
‐ 95 Beratungsstelle<br />
‐ 81 Diakonie(sozial)stationen<br />
‐ 47 Kurzzeitpflege<strong>in</strong>richtung<br />
‐ 45 Tagespflegee<strong>in</strong>richtungen.<br />
Für <strong>di</strong>e Diakonie Mitteldeutschland stellt sich <strong>di</strong>e Situation wie folgt dar: <strong>in</strong> ca. 1.500 E<strong>in</strong>richtungen<br />
arbeiten gegenwärtig ca. 25.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen.<br />
Das DW hat 272 Mitglieder, <strong>di</strong>e meisten davon e<strong>in</strong>getragene <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>e (108), 72 als geme<strong>in</strong>nützige<br />
GmbH organisiert <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Mitglied agiert <strong>in</strong> der Rechtsform der geme<strong>in</strong>nützigen Aktiengesellschaft.<br />
Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen DW EKM (Auszug)<br />
Anzahl<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
Krankenhilfe 49 7.116<br />
K<strong>in</strong>der- u. Jugendhilfe 503 4.471<br />
Familienhilfe 50 232<br />
Beh<strong>in</strong>dertenhilfe 262 5.730<br />
Hilfen <strong>in</strong> besond. Sozialen Situationen 74 665<br />
Altenhilfe 199 6.226<br />
Quelle: Diakoniebericht 2011. Diakonisches Werk EKM<br />
67<br />
Anzahl<br />
Mitarbeiter
Ausgewählte personal- <strong>und</strong> platz<strong>in</strong>tensive Arbeitsgebiete des DW EKM<br />
Krankenhäuser<br />
Anzahl<br />
Plätze Anzahl<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
Mitarbeiter<br />
25 4.777 6.801<br />
Vollstationäre Pflegee<strong>in</strong>richtungen<br />
96 6.482 4.242<br />
Ambulante<br />
Pflege<strong>di</strong>enste<br />
Stationäres Wohnen<br />
82 1.821<br />
Beh<strong>in</strong>dertenhilfe<br />
Werkstätten für<br />
174<br />
5.313<br />
3.274<br />
Beh<strong>in</strong>derte<br />
Förderschulen für<br />
56<br />
7.712<br />
1.514<br />
beh<strong>in</strong>derte K<strong>in</strong>der<br />
Stationäre<br />
13<br />
1.116<br />
496<br />
Hilfen z. Erziehung 65<br />
784<br />
527<br />
Ambulante<br />
Hilfen z. Erziehung<br />
35<br />
148<br />
Stationäre<br />
Suchtkrankenhilfe<br />
15 265 153<br />
Psychosoziale Berat.<br />
Suchtkranke<br />
36<br />
107<br />
Quelle: Diakoniebericht 2011. Diakonisches Werk EKM<br />
Das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern umfasst 829 E<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> denen<br />
<strong>in</strong>sgesamt 10.622 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen tätig s<strong>in</strong>d. Das DW Mecklenburg-Vorpommern ist der<br />
kle<strong>in</strong>ste Landesverband <strong>in</strong> Ostdeutschland, veröffentlicht aber regelmäßig umfängliches <strong>und</strong><br />
auskunftsträchtiges statistisches Material, so dass anhand <strong>di</strong>eses Beispiels vor allem tragfähige<br />
Aussagen zum <strong>Ver</strong>hältnis von Vollzeit- <strong>und</strong> Teilzeitarbeit im Diakonischen Werk getroffenen<br />
werden können. Teilzeitarbeit ist <strong>in</strong> den anderen Landesverbänden ebenfalls flächendeckend<br />
anzutreffen (Quelle: Interviews). In den öffentlich zugänglichen Statistiken wird das<br />
<strong>Ver</strong>hältnis von Vollzeit- <strong>und</strong> Teilzeitarbeit aber regelmäßig ausgeblendet.<br />
Die personal<strong>in</strong>tensivsten Tätigkeitsbereiche im DW Mecklenburg-Vorpommern s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Altenhilfe,<br />
<strong>di</strong>e stationäre Ges<strong>und</strong>heitshilfe (Krankenhäuser) <strong>und</strong> <strong>di</strong>e verschiedenen Formen der<br />
Beh<strong>in</strong>dertenhilfe (e<strong>in</strong>schließlich der Hilfen für chronisch psychisch Kranke). Auch <strong>di</strong>e K<strong>in</strong>dertagestätten<br />
s<strong>in</strong>d – wenn auch mit Abstand – besonders personal<strong>in</strong>tensive Tätigkeitsfelder<br />
der Diakonie <strong>in</strong> Mecklenburg-Vorpommern. Die Anzahl der E<strong>in</strong>richtungen variiert <strong>in</strong> den<br />
verschiedenen Hilfearten. E<strong>in</strong>richtungsstark s<strong>in</strong>d vor allem <strong>di</strong>e Altenhilfe <strong>und</strong> Pflege sowie<br />
<strong>di</strong>e Beh<strong>in</strong>dertenhilfe, <strong>di</strong>e gewöhnlich wohnortnah organisiert werden muss <strong>und</strong> deshalb so-<br />
68
wohl e<strong>in</strong>e hohe Anzahl an E<strong>in</strong>richtungen wie an Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen aufweist.<br />
Auffallend ist der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigung, der aber auch <strong>in</strong> den anderen ostdeutschen<br />
Diakonischen Werken recht hoch ist (er liegt über dem B<strong>und</strong>esdurchschnitt). Nach Angaben<br />
der B<strong>und</strong>esarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Freien Wohlfahrtspflege lag der Anteil der Teilzeitarbeit<br />
im Jahre 2008 bei <strong>in</strong>sgesamt 1,6 Mio. Beschäftigten erstmals knapp über 50%. 8 Die<br />
Statistiken des DW Mecklenburg-Vorpommern erlauben auch Rückschlüsse auf e<strong>in</strong>zelne Arbeitsbereiche<br />
<strong>und</strong> zeigen, dass bestimmte Arbeitsbereiche überdurchschnittlich von Teilzeitarbeit<br />
betroffen s<strong>in</strong>d, bspw. <strong>di</strong>e Altenhilfe <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Arbeit <strong>in</strong> K<strong>in</strong>dertagesstätten. Prekarität <strong>in</strong><br />
den sozialen Diensten Ostdeutschland ist demnach auch stark verursacht durch <strong>di</strong>e Durchsetzung<br />
von Teilzeitarbeit seitens der E<strong>in</strong>richtungen, e<strong>in</strong> Trend der seit Ende der 1990er Jahre<br />
b<strong>und</strong>esweit beobachtbar ist <strong>und</strong> immer noch anhält, <strong>in</strong> ostdeutschen, strukturschwachen Ländern<br />
oder Regionen aber besonders leicht durchsetzbar ersche<strong>in</strong>t, berichten ostdeutsche Mitarbeitervertreter.<br />
Da <strong>di</strong>e meisten Mitarbeiter im Krankenhaus wie <strong>in</strong> den Geschäftsstellen <strong>und</strong> sonstigen hoch<br />
qualifizierten Diensten (Sucht-, Schuldnerberatung u.ä.)Vollzeitbeschäftigte s<strong>in</strong>d, kommt es<br />
bei e<strong>in</strong>er zusammenfassenden Betrachtung aller Beschäftigten daher zu statistischen <strong>Ver</strong>zerrungen.<br />
Denn der sehr hohe Anteil der Teilzeitarbeit zeigt sich erst, wenn man ausgewählte<br />
Tätigkeitsbereiche gesondert betrachtet. Da es sich dabei gewöhnlich um überwiegend weibliche<br />
Tätigkeiten handelt, hat durch Teilzeitarbeit verursachte Prekarität e<strong>in</strong>en ausgesprochenen<br />
Genderbezug.<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Personal <strong>in</strong> der Diakonie Mecklenburg-Vorpommern <strong>in</strong> 2010<br />
Tätigkeitsbereich Anzahl Betten/Plätze Mitarbeiter Mitarbeiter<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
Vollzeit Teilzeit<br />
Meck Pom<br />
Meck Pom<br />
Meck Pom<br />
Meck Pom<br />
Krankenhäuser 5 2 1.299 195 1.567 97 708 41<br />
Aus-<br />
Weiterbildung<br />
4 1 15 2 15<br />
Altenhilfe 133 47 3.703 925 288 125 1.833 667<br />
Beh<strong>in</strong>dertenhilfe 163 31 5.660 1.653 691 409 1.308 361<br />
8<br />
Vgl. Gesamtstatistik 2008 der B<strong>und</strong>esarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Freien Wohlfahrtspflege. Berl<strong>in</strong> 2010.<br />
69
Gefährdetenhilfe 95 13 962 12 194 2 148 7<br />
Jugendhilfe 111 46 6.253 35 345 95 778 223<br />
All. Beratung 46 10 30 6 66 8<br />
Familienerholung 4 3 145 219 4 9 14 13<br />
Geschäftsstellen 78 42 233 63 184 73<br />
Insgesamt<br />
Diakonie<br />
634 195 18.02<br />
2<br />
3.039 3.367 808 5.054 1.393<br />
Meckl - Vorpom 829 21.061 4.175<br />
6.447<br />
Quelle: Synodenbericht der ev.-luth. Landeskirche Mecklenburg 2011<br />
Ausgewählte, personal- <strong>und</strong> platz<strong>in</strong>tensive Arbeitsbereiche <strong>in</strong> der Diakonie Mecklenburg-<br />
Vorpommern im Jahr 2010<br />
Anzahl der<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
Anzahl der<br />
Plätze<br />
Beschäftigte<br />
Vollzeit<br />
Altenheime<br />
Ambulante pflegeri-<br />
49 3.809<br />
sche Dienste<br />
Wohnheime für be-<br />
62<br />
h<strong>in</strong>derte Menschen<br />
Werkstätten für Be-<br />
36 1.169<br />
h<strong>in</strong>derte<br />
Pflege-<br />
27 3.640<br />
/Fördere<strong>in</strong>richtg.<br />
Beh<strong>in</strong>derte Menschen<br />
Psychiatrische<br />
11 632<br />
Pfegewohnheime<br />
K<strong>in</strong>dertagesstätten<br />
Integrative K<strong>in</strong>der-<br />
8<br />
65<br />
255<br />
tagesstätten 11<br />
Quelle: Synodenbericht der ev.-luth. Landeskirche Mecklenburg 2011<br />
Beschäftigte<br />
Teilzeit<br />
279 1.674<br />
124 748<br />
200 374<br />
497 313<br />
157 308<br />
33 169<br />
121 450<br />
50 310<br />
Die sozialwirtschaftlichen Fakten zeigen, dass <strong>di</strong>e Diakonie e<strong>in</strong> potenter sozialwirtschaftlicher<br />
Akteur <strong>in</strong> Ostdeutschland ist. Da <strong>di</strong>e Caritas hier sozialwirtschaftlich nur mit ca. 36.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
vertreten ist 9 , ist von den Wohlfahrtsverbänden mit eigenen E<strong>in</strong>richtungen <strong>di</strong>e<br />
Arbeiterwohlfahrt der nächst größere (geme<strong>in</strong>nützige) Konkurrent der Diakonie. B<strong>und</strong>esweit<br />
9<br />
Vgl. dazu <strong>di</strong>e Statistik 2010 der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsberufe <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege.<br />
70
ist dagegen <strong>di</strong>e AWO - gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter(<strong>in</strong>nen) – mit weitem Abstand<br />
zu den Kirchen drittgrößter Wohlfahrtsverband mit ca. 167.000 Mitarbeitern. In Ostdeutsch-<br />
land ist <strong>di</strong>e AWO zweitgrößter sozialer Dienstleistungserbr<strong>in</strong>ger mit ca. 42.200 Mitarbeitern.<br />
Die ca. 140.000 Mitarbeiter <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e der Parität angeschlossen s<strong>in</strong>d verteilen<br />
sich auf e<strong>in</strong>e Vielzahl von spezialisierten <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>eren <strong>Ver</strong>bänden <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>en. 10 Der Pa-<br />
ritätische ist mit se<strong>in</strong>en Landesverbänden <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Fall nur Dachorganisation für <strong>di</strong>e politi-<br />
sche Interessenvertretung <strong>und</strong> Anlaufstelle für rechtliche oder betriebswirtschaftliche Bera-<br />
tungen <strong>und</strong> Information. Deshalb muss man <strong>di</strong>e Diakonie als une<strong>in</strong>geschränkten Champion<br />
der Sozialwirtschaft <strong>in</strong> Ostdeutschland e<strong>in</strong>stufen, der dementsprechend Macht <strong>und</strong> E<strong>in</strong>fluss<br />
zukommt.<br />
Privat-gewerbliche Träger s<strong>in</strong>d auch <strong>in</strong> Ostdeutschland flächendeckend tätig, vor allem im<br />
Bereich Krankenhaus wie auf dem Gebiet der stationären <strong>und</strong> ambulanten Altenhilfe. Da über<br />
<strong>di</strong>e sozialwirtschaftliche Stärke der privat-gewerblichen Träger aber kaum zugängliche Informationen<br />
vorliegen, ist nur schwer e<strong>in</strong>schätzbar, wie groß <strong>di</strong>e Konkurrenz zwischen Diakonie<br />
<strong>und</strong> <strong>di</strong>esen Trägern objektiv zu beurteilen ist. Da <strong>di</strong>e Marktmacht der gewerblichen<br />
Träger vor allem im Bereich der Krankenhäuser wie im stationären <strong>und</strong> ambulanten Pflegebereich<br />
liegt (mit jeweils mehr als 50% Marktanteil), muss <strong>di</strong>eser Trägertyp als ernst zu nehmender<br />
Konkurrent zur Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland e<strong>in</strong>gestuft werden, zumal <strong>di</strong>e Diakonie –<br />
schon seit DDR-Zeiten - ihr Proprium auch im Bereich Krankenhaus <strong>und</strong> Altenpflege hat.<br />
Was <strong>di</strong>e Diakonie stark macht, ist das breite Spektrum an sozialen Diensten: <strong>di</strong>e Diakonie ist<br />
neben der Ges<strong>und</strong>heitshilfe <strong>und</strong> der Pflege auch stark präsent mit sozialen Diensten, deren<br />
Bereitstellung das SGB XII (Sozialhilfe) <strong>und</strong> SGB VIII (K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Jugendhilfe) fordert. Da<br />
<strong>di</strong>e Diakonie mit Angeboten von Fürsorgeleistungen bis h<strong>in</strong> zu hochwertigen Dienstleistungen<br />
breit aufgestellt ist, ist sie auch e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>flussreicher sozialpolitischer Akteur, der über Regierungen<br />
<strong>und</strong> Parteien <strong>in</strong> Ostdeutschland wie andernorts auch sozialpolitische Gestaltungsmacht<br />
wahrnimmt.<br />
4.4 Ausgründungen <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>: Instrumente der Kostenmanagements<br />
10<br />
Der Parität werden nach der Statistik der B<strong>und</strong>esgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsberufe <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege<br />
von 2010 <strong>in</strong> Ostdeutschland ca. 140.000 Mitarbeiter zugerechnet (b<strong>und</strong>esweit ca. 580.000). Das Personal arbeitet<br />
aber gewöhnlich nicht <strong>in</strong> paritätischen E<strong>in</strong>richtungen, sondern <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen von Trägern, <strong>di</strong>e Mitglieder <strong>in</strong><br />
der Parität s<strong>in</strong>d (wie Lebenshilfe, Volkssolidarität, Pro Familia u.ä.) <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>richtungen unter ihrem eigen<br />
<strong>Ver</strong>bandslogo tätig werden lassen.<br />
71
Die Strategie der Teilzeitarbeit ist – so <strong>di</strong>e von uns befragten MAV – für <strong>di</strong>e Diakonie e<strong>in</strong><br />
wichtiges Instrument, nicht nur um <strong>di</strong>e mangelnde Ref<strong>in</strong>anzierung sozialer Dienste durch<br />
staatliche <strong>und</strong> kommunale Kostenträger zu kompensieren, sondern auch zur Generierung von<br />
Wettbewerbsvorteilen, vor allem im Bereich der stationären Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Altenhilfe, <strong>in</strong><br />
denen sich <strong>di</strong>e Diakonie primär durch <strong>di</strong>e privat-gewerblichen Träger herausgefordert sieht.<br />
Da im Dienstleistungsbereich ca. 70% der Kosten Personalkosten s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> Rationalisierung<br />
an anderen Stellen der E<strong>in</strong>richtungen resp. Betriebe ausgeschöpft s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Personalkos-<br />
ten <strong>di</strong>e bevorzugte Unternehmensstrategie im Rahmen des Kostenmanagements im sozialen<br />
Dienstleistungssektor. Die extensive Nutzung von Teilzeitarbeit, vor allem bei den Fachkräften<br />
mit ger<strong>in</strong>gerer Qualifikation (vor allem bei Altenpfleger<strong>in</strong>nen, Erzieher<strong>in</strong>nen), ist Folge<br />
der staatlich <strong>in</strong>duzierten Sozialwirtschaft, aber auch Strategie der E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> ihrer<br />
<strong>Ver</strong>bände, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e ihnen zugewiesene sozialwirtschaftliche Rolle aktiv angenommen haben<br />
<strong>und</strong> seitdem als Wettbewerber auf e<strong>in</strong>em Sozialmarkt agieren. Der Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
ist es gelungen, zum stärksten sozialwirtschaftlichen Akteur <strong>und</strong> Marktführer zu werden<br />
Die Durchsetzung von Teilzeitarbeit (<strong>in</strong> Ostdeutschland werden frei werdende oder neu geschaffene<br />
Stellen <strong>in</strong> den sozialen Diensten schon seit Jahren <strong>in</strong> Teilzeitstellen verwandet, wie<br />
im öffentlichen Dienst auch) ist <strong>in</strong> allen Wohlfahrtsverbänden registrierbar. Das mit der Teilzeitarbeit<br />
zusammen hängende Lohndump<strong>in</strong>g ist aber <strong>in</strong> der Diakonie angesichts ihrer theologisch-ethisch<br />
begründeten (Dienst)Geme<strong>in</strong>schaftsphilosophie fragwür<strong>di</strong>ger als <strong>in</strong> anderen<br />
<strong>Ver</strong>bänden. Das mit dem kirchlichen Arbeitsrecht zusammenhängende e<strong>in</strong>geschränkte Mitwirkungsrecht<br />
der MAVen trägt dazu bei, dass Teilzeitarbeit besonders leicht durchzusetzen<br />
ist.<br />
4.4.1 Ausgründungen: Servicegesellschaften <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong><br />
Ausgründungen <strong>und</strong> <strong>di</strong>e damit e<strong>in</strong>hergehende rechtliche <strong>Ver</strong>selbstän<strong>di</strong>gung von Betrieben<br />
oder Betriebsteilen aus den <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>en, Stiftungen oder sonstigen Rechtsformen, <strong>in</strong> denen <strong>di</strong>akonische<br />
Träger tra<strong>di</strong>tionell agieren, ist e<strong>in</strong> Prozess, der recht früh mit der Transformation der<br />
Freien Wohlfahrtspflege zur Sozialwirtschaft aufgetreten ist. Die sog. GmbH-isierung von<br />
<strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen hat dazu beigetragen, dass größere Betriebse<strong>in</strong>heiten entstanden<br />
s<strong>in</strong>d, <strong>di</strong>e selten noch territoriale B<strong>in</strong>dungen aufweisen <strong>und</strong> deshalb regionsübergreifend oder<br />
<strong>in</strong> anderen B<strong>und</strong>esländern tätig s<strong>in</strong>d. Das hat dazu geführt, dass große Träger mittlerweile <strong>in</strong><br />
verschiedenen B<strong>und</strong>esländern oder b<strong>und</strong>esweit sozialwirtschaftlich agieren <strong>und</strong> dementspre-<br />
72
chend <strong>in</strong> verschiedenen Diakonischen Werken Mitglieder s<strong>in</strong>d, also spitzenverbandsübergreifende<br />
Organisationsstrukturen aufgebaut haben <strong>und</strong> hold<strong>in</strong>gähnliche Strukturen aufweisen.<br />
Diese erste Ausgründungswelle setzte schon recht früh, <strong>in</strong> den 1990er Jahren, e<strong>in</strong> <strong>und</strong> sie hat<br />
dazu geführt, dass <strong>di</strong>e Mitgliedschaftsstruktur der e<strong>in</strong>zelnen Diakonischen Werke durch mittlerweile<br />
recht heterogene sozialwirtschaftliche Akteure gebildet wird: auf der e<strong>in</strong>en Seite <strong>di</strong>e<br />
tra<strong>di</strong>tionellen ortsansässigen Akteure <strong>in</strong> der Rechtsform des e<strong>in</strong>getragen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>s, auf der anderen<br />
Seite e<strong>in</strong>e wachsende Zahl von Trägern, deren E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> der gGmbH-Form operieren<br />
(manchmal auch als nicht geme<strong>in</strong>nützige GmbH). Selbst <strong>di</strong>e Rechtsform der geme<strong>in</strong>nützigen<br />
Aktiengesellschaft ist vere<strong>in</strong>zelt nachweisbar. Die Entscheidungsprozesse <strong>in</strong> den<br />
Landesverbänden s<strong>in</strong>d angesichts der unterschiedlichen Interessenslagen von großen <strong>und</strong><br />
kle<strong>in</strong>en Trägern schwieriger geworden, zumal auch große Träger über andere Formen von<br />
Durchsetzungsmacht verfügen.<br />
Im DW Mitteldeutschland s<strong>in</strong>d bspw. von den 272 Mitgliedern im Diakonischen Werk 72 <strong>in</strong><br />
der Rechtsform der gGmbH tätig. Im DW Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz s<strong>in</strong>d<br />
von den 435 Mitgliedern 134 als gGmbH (vere<strong>in</strong>zelt auch nur als GmbH) organisiert. Hier<br />
gibt es sogar e<strong>in</strong>en größeren Träger, der <strong>in</strong> der Form der geme<strong>in</strong>nützigen Aktiengesellschaft<br />
operiert, <strong>di</strong>e EJF gAG (Evangelisches Jugend- <strong>und</strong> Fürsorgewerk) mit Sitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Standbe<strong>in</strong> im Zustän<strong>di</strong>gkeitsbereich des DW EKM. Nimmt man <strong>di</strong>ese zugänglichen Zahlen<br />
<strong>und</strong> verallgeme<strong>in</strong>ert sie, dann lässt sich sagen, dass mittlerweile 1/4 bis 1/3 aller Mitglieder<br />
<strong>in</strong> den Diakonischen Werken <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>in</strong> neuen sozialwirtschaftlichen Rechtsformen<br />
agieren. Vor allem s<strong>in</strong>d es <strong>di</strong>e Träger der Krankenhäuser <strong>und</strong> der stationären Pflegee<strong>in</strong>richtungen,<br />
aber auch <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungen der Beh<strong>in</strong>dertenhilfe, <strong>di</strong>e als gGmbHs organisiert<br />
s<strong>in</strong>d: platz- <strong>und</strong> personal<strong>in</strong>tensive E<strong>in</strong>richtungen (soziale Dienste) agieren mittlerweile<br />
durchweg <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser, <strong>di</strong>e Sozialwirtschaft mittlerweile kennzeichnenden Rechtsform. Die<br />
GmbH-isierung der Mitgliederstruktur der DWs ist u.a. auch Folge der Unternehmenspolitik,<br />
<strong>di</strong>e <strong>in</strong> den ausgegründeten gGmbHs vorhandenen sozialen Dienste nach Sparten zu sortieren<br />
<strong>und</strong> <strong>di</strong>ese wiederum als neue gGmbH aus der schon vorhandenen ursprünglichen gGmbH<br />
auszugliedern, so dass <strong>di</strong>e Unternehmensstrukturen der größeren <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Träger <strong>di</strong>e<br />
Konturen e<strong>in</strong>er Hold<strong>in</strong>ggesellschaft annehmen (Mutter-Tochtergesellschaften-Struktur). Die<br />
sehr fortgeschrittene gGmbH-isierung <strong>di</strong>eser Form könnte man als Ausgründung zweiten<br />
Grades bezeichnen.<br />
73
Diese Form der Ausgründung von gGmbHs aus dem <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>s- <strong>und</strong> Stiftungsbereich wird von<br />
den MAVen mittlerweile als normaler Betriebsvorgang angesehen, der aus ihrer Sicht „unproblematisch“<br />
sei, da <strong>di</strong>e hierdurch erfolgte Sortierung der E<strong>in</strong>richtungen nach Geschäftsfeldern<br />
der Risikom<strong>in</strong>imierung <strong>in</strong> der Sozialwirtschaft <strong>di</strong>ent <strong>und</strong> akzeptiert wird: „Das ist eher<br />
unproblematisch; hier geht es um <strong>di</strong>e Frage von F<strong>in</strong>anzierung, von Neubauten, von Bürgschaften,<br />
wenn z. B. aus dem Bereich des e.V. e<strong>in</strong>e Altenhilfe-GmbH gegründet wird, oder<br />
wenn auch e<strong>in</strong> zweiter <strong>di</strong>akonischer Träger mit e<strong>in</strong>steigt (...) GmbH ist nicht automatisch mit<br />
Tarifflucht verknüpft (...), (eher) e<strong>in</strong> Stück Risikom<strong>in</strong>imierung, wenn e<strong>in</strong> Träger e<strong>in</strong> neues<br />
Arbeitsfeld aufmacht oder Ersatz<strong>in</strong>vestitionen tätigen muss “.<br />
Die Ausgründung von Geschäftsfeldern <strong>und</strong> deren Organisation <strong>in</strong> der Form der gGmbH ist<br />
mittlerweile durch Ausgründungen dritten Grades ergänzt worden: <strong>di</strong>e verselbstän<strong>di</strong>gten E<strong>in</strong>richtungen<br />
s<strong>in</strong>d seit geraumer Zeit dazu übergegangen, sog. Serviceleistungen, <strong>di</strong>e alle anderen<br />
ausgegründeten E<strong>in</strong>richtungen nutzen, wiederum <strong>in</strong> eigene <strong>di</strong>akonische Servicegesellschaften<br />
auszugründen: dabei handelt es vor allem um Querschnittsleistungen wie Cater<strong>in</strong>g,<br />
Putz<strong>di</strong>enste, Technik <strong>und</strong> Hausmeistertätigkeiten; vere<strong>in</strong>zelt ist auch nachweisbar, dass <strong>Ver</strong>waltungs-<br />
<strong>und</strong> Bürotätigkeiten den ausgegründeten Servicegesellschaften angegliedert s<strong>in</strong>d<br />
oder <strong>in</strong> eigenen Gesellschaften organisiert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> dann als Quasi-<strong>Leiharbeit</strong>sfirma das dort<br />
beschäftigte Personal flexibel <strong>in</strong> den verschiedenen zum Unternehmen gehörigen Betrieben an<br />
verschiedenen Standorten e<strong>in</strong>setzen. Die Ausgründung von sog. Servicegesellschaften –<br />
i.d.R. mit eigenen von den <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Arbeitsrichtl<strong>in</strong>ien abweichenden Tarifstrukturen – ist<br />
mittlerweile für alle stationären E<strong>in</strong>richtungen (Krankenhäuser, Pflege- <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>dertene<strong>in</strong>richtungen)<br />
<strong>in</strong> der Diakonie Ostdeutschlands nachweisbar.<br />
Die Ausgründung von eigenen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen <strong>in</strong> größeren <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen<br />
ist ebenfalls e<strong>in</strong>e beobachtbare Unternehmensstrategie im Rahmen des Kostenmanagements,<br />
allerd<strong>in</strong>gs nicht soweit verbreitet wie <strong>di</strong>e Ausgründung von Servicegesellschaften.<br />
Die Kirche, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Ausgründung von <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen mittlerweile als nicht<br />
vere<strong>in</strong>bar mit dem <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Auftrag <strong>und</strong> dem kirchlichen Arbeitsrecht e<strong>in</strong>stuft, nachdem<br />
es zu e<strong>in</strong>er öffentlichkeitswirksamen Berichterstattung <strong>in</strong> verschiedenen überregionalen Me<strong>di</strong>en<br />
gekommen ist, betrachtet <strong>di</strong>ese Entwicklung als E<strong>in</strong>zelfälle, als „schwarze Schafe“ <strong>in</strong> der<br />
Diakonie. Die Häufigkeit der Ausgründungen - b<strong>und</strong>esweit wie <strong>in</strong> Ostdeutschland - ist nicht<br />
sehr hoch (genaue Zahlen s<strong>in</strong>d <strong>Ver</strong>schlusssache), jedoch <strong>in</strong> allen Diakonischen Werken <strong>in</strong><br />
Ostdeutschland <strong>in</strong> e<strong>in</strong> bis zwei Fällen beobachtbar.<br />
74
Für b<strong>und</strong>esweit agierende <strong>di</strong>akonische Großkonzerne wie <strong>di</strong>e Agaplesion gAG <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Stiftung<br />
Bethel s<strong>in</strong>d eigene <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen mittlerweile selbstverständlich, da man davon ausgeht,<br />
dass <strong>di</strong>ese für <strong>di</strong>e betriebliche Personalentwicklung unabd<strong>in</strong>gbar seien. Gegenüber der<br />
Ausgründung von Servicegesellschaften ist <strong>di</strong>e Ausgründung eigener <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen quantitativ<br />
unbedeutend, aber durchaus überall anzutreffen <strong>und</strong> nicht nur auf „schwarze Schafe“<br />
begrenzt. Die <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> „Big Player“ sche<strong>in</strong>en – trotz kirchlicher Kritik <strong>und</strong> kirchlichen<br />
<strong>Ver</strong>bots – an der Strategie, Personalentwicklung <strong>und</strong> Kostenmanagement mit dem Instrument<br />
der <strong>Leiharbeit</strong> zu betrieben, weiterh<strong>in</strong> festzuhalten.<br />
Die Ausgründungen ersten Grades, also <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>selbstän<strong>di</strong>gung von E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> deren<br />
Transformation zu Sozialbetrieben hat auch dazu geführt, dass sich zwei oder mehrere <strong>di</strong>eser<br />
Betriebe wiederum als Gesellschafter zur Gründung neuer Betriebe zusammen geschlossen<br />
haben oder als Gesellschafter <strong>in</strong> unrentabel gewordene Betriebe e<strong>in</strong>gestiegen s<strong>in</strong>d. Dieser<br />
Prozess der geme<strong>in</strong>samen Gründung neuer E<strong>in</strong>richtungen bzw. des geme<strong>in</strong>samen Betriebes<br />
von E<strong>in</strong>richtungen hat <strong>di</strong>e Beteiligungsstrukturen <strong>in</strong> den größeren <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen<br />
komplexer, aber auch <strong>in</strong>transparenter werden lassen. Vor allem entstehen auf <strong>di</strong>esem Wege<br />
neue Akteure, <strong>di</strong>e dann wiederum als selbststän<strong>di</strong>ge Mitglieder des Diakonischen Werkes<br />
auftreten <strong>und</strong> dort zusammen mit den Gesellschaftern ihre sozialwirtschaftlichen Interessen<br />
formulieren <strong>und</strong> durchsetzen. Die wachsende Anzahl von Mitgliedern <strong>in</strong> den DWs ist auch<br />
Folge der Gründung neuer Gesellschaften durch Gesellschafter, <strong>di</strong>e schon eigene Betriebe <strong>und</strong><br />
E<strong>in</strong>richtungen unterhalten. Dieser Prozess ist für <strong>di</strong>e <strong>di</strong>akonische Willensbildung im DW<br />
kontraproduktiv, da <strong>di</strong>e kle<strong>in</strong>en Träger, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>getragenen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>e, dadurch <strong>in</strong>s H<strong>in</strong>tertreffen<br />
geraten <strong>und</strong> von den sozialwirtschaftlichen Interessen der regionalen wie b<strong>und</strong>eweit agierenden<br />
Big Player dom<strong>in</strong>iert werden.<br />
Unübersichtlich werden <strong>di</strong>e <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Strukturen auch, weil <strong>di</strong>e ausgegründeten Träger<br />
dazu übergangen s<strong>in</strong>d, <strong>di</strong>e von ihnen betriebenen sozialen Dienste bzw. E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
nächsten Schritt <strong>in</strong> Sparten bzw. Geschäftsfeldern zu organisieren <strong>und</strong> <strong>di</strong>ese wiederum <strong>in</strong><br />
selbstän<strong>di</strong>gen gGmbHs zu organisieren, so dass gewöhnlich starke sozialwirtschaftlich operierende<br />
<strong>di</strong>akonische Muttergesellschaften verschiedene Tochtergesellschaften unterhalten, wobei<br />
nicht selten der Geschäftsführer der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Muttergesellschaft gleichzeitig Geschäftsführer<br />
aller ausgegründeten Betriebe <strong>und</strong> Servicegesellschaften ist.<br />
75
Die „Mission“ der Diakonie bleibt bei der weit verbreiteten neuen Geschäftsfelderpolitik auf<br />
der Strecke, da <strong>di</strong>e Ganzheitlichkeit der <strong>in</strong> den Leitbildern verankerten Mission dem dom<strong>in</strong>ant<br />
gewordenen sozialwirtschaftlichen Primat untergeordnet wird <strong>und</strong> unter den neuen Bed<strong>in</strong>gun-<br />
gen der Produktion von sozialen Leistungen nicht mehr e<strong>in</strong>lösbar ist, außer <strong>in</strong> Leitbildern <strong>und</strong><br />
verbandlichen <strong>Ver</strong>lautbarungen. So ist e<strong>in</strong>e neue Arbeitsteilung entstanden: der <strong>Ver</strong>band ist<br />
zustän<strong>di</strong>g für <strong>di</strong>e Mission, <strong>di</strong>e Betriebe für <strong>di</strong>e Wirtschaftlichkeit, e<strong>in</strong>e Arbeitsteilung, <strong>di</strong>e den<br />
Geschäftsführungen den Betrieben weder bei ihrer Wettbewerbsorientierung noch bei ihrem<br />
Streben nach Ausweitung der Geschäftsfelder im Wege steht. Beides f<strong>in</strong>det aber nur noch<br />
schwer zusammen. Der <strong>Ver</strong>band wird neben se<strong>in</strong>er Zustän<strong>di</strong>gkeit für <strong>di</strong>e Mission vor allem<br />
auch aus arbeits- <strong>und</strong> vergütungsrechtlichen Gründen benötigt (vgl. den folgenden Abschnitt).<br />
Die neue Unübersichtlichkeit <strong>in</strong> der Diakonie aufgr<strong>und</strong> der komplexer gewordenen Beteiligungsstruktur<br />
wie der vielfältigen Ausgründungen soll hier im Folgenden beispielhaft anhand<br />
verschiedener Beispiele aus Ostdeutschland demonstriert werden.<br />
76
1.<br />
Beispiel: e<strong>di</strong>a.con Sachsen – Mitglied im DW Sachsen<br />
‐ komplexe Beteiligungsstruktur bestehend aus 8 Gesellschaftern<br />
‐ alle E<strong>in</strong>richtungen als gGmbHs weiter ausgegründet<br />
‐ e<strong>in</strong>schließlich ausgegründeter Servicegesellschaft<br />
77
2.<br />
Beispiel: Diakonie Ostthür<strong>in</strong>gen- Mitglied im DW EKM<br />
‐ mittelkomplexe Beteiligungsstruktur <strong>in</strong> gGmbH-Form<br />
‐ alle sozialen Dienste weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> selbstän<strong>di</strong>ge gGmbHs (Sparten) ausgegründet<br />
‐ e<strong>in</strong>schließlich ausgegründeter Servicegesellschaft<br />
78
3. Beispiel:<br />
Diakonie Westthür<strong>in</strong>gen – Mitglied im DW EKM<br />
‐ ausgegründetes Unternehmen der Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung<br />
‐ mit ausgegründeter Servicegesellschaft <strong>und</strong> Zeitarbeitsfirma<br />
‐ <strong>und</strong> zusätzlich ausgegründeten sozialen Diensten<br />
79
4.4.2 Die AVR als Instrument des Kostenmanagements<br />
Ausgründungen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Instrument der Flexibilisierung wie des Risikomanagements <strong>in</strong> der<br />
Sozialwirtschaft <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d mittlerweile Kennzeichen der deutschen Sozialwirtschaft <strong>in</strong>sgesamt.<br />
Ausgründungen von Servicegesellschaften wie auch von e<strong>in</strong>richtungseigenen Zeitarbeitsfirmen<br />
s<strong>in</strong>d aber auch als e<strong>in</strong> <strong>Ver</strong>such der Träger zu werten, angesichts von massiven Spar-<br />
80
zwängen auf Seiten der Kostenträger den s<strong>in</strong>kenden oder stagnierenden Entgelten <strong>und</strong> E<strong>in</strong>-<br />
nahmen durch e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>richtungs<strong>in</strong>ternes Kostenmanagement gegenzusteuern. Dass das nur zu<br />
Lasten des Personals geht, ist Kostenträgern wie E<strong>in</strong>richtungsträgern bewusst. Die <strong>Ver</strong>lage-<br />
rung von Aufgaben auf ausgegründete Servicegesellschaften hat das Ziel, <strong>di</strong>e Tarifb<strong>in</strong>dung <strong>in</strong><br />
den E<strong>in</strong>richtungen zu umgehen <strong>und</strong> ist deshalb als Mittel der Tarifflucht zu werten. Alle<br />
Wohlfahrtsverbände gehen <strong>di</strong>esen Weg. Den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden steht aufgr<strong>und</strong><br />
des ihnen zugestandenen gr<strong>und</strong>gesetzlichen Selbstbestimmungsrechts <strong>und</strong> dem daraus abgeleiteten<br />
kircheneigenen Arbeitsrecht e<strong>in</strong> weiteres, <strong>di</strong>akoniespezifisches Instrument des Kostenmanagements<br />
zur <strong>Ver</strong>fügung, über das <strong>di</strong>e anderen, weltlichen Wohlfahrtsverbände nicht<br />
verfügen. Die Diakonie nutzt das kirchliche Arbeitsrecht extensiv <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiv als Instrument<br />
des Kostenmanagements, um ihre Stellung als Champion der Sozialwirtschaft <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
zu untermauern.<br />
Die Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien (AVR) des Diakonischen Werkes der EKD bzw. <strong>di</strong>e der gliedkirchlichen<br />
Diakonischen Werke (Landesverbände) s<strong>in</strong>d satzungsrechtlich oder kirchenrechtlich<br />
für <strong>di</strong>e Mitglieder der Diakonischen Werke b<strong>in</strong>dend. Diakonische Träger können wählen,<br />
ob sie <strong>di</strong>e AVR der EKD, <strong>di</strong>e AVR ihres Diakonischen Werkes, neuerd<strong>in</strong>gs sogar, ob sie <strong>di</strong>e<br />
AVR e<strong>in</strong>es anderen Landesverbandes anwenden wollen. Kirchenrechtlich – so <strong>di</strong>e Me<strong>in</strong>ung<br />
vieler Mitarbeitervertreter – „müsse selbst bei Ausgründungen <strong>di</strong>e AVR Anwendung f<strong>in</strong>den,<br />
weil, wenn sie vorher <strong>in</strong><strong>di</strong>vidualrechtlich vere<strong>in</strong>bart s<strong>in</strong>d, werden sie durch <strong>di</strong>e Ausgründung<br />
nicht bee<strong>in</strong>flusst“.<br />
Genaue Zahlen über <strong>di</strong>e Anzahl der <strong>in</strong> ausgegründeten Betrieben tätigen Mitarbeiter der Diakonie<br />
gibt es seitens der DWs nicht. Aufgr<strong>und</strong> von älteren Umfragen verschiedener Gesamt-<br />
Mitarbeitervertretungen auf Ebene der DWs lässt sich nur schätzen, wie viele Mitarbeiter<br />
durch Ausgründungen nicht nur organisatorisch ausgegliedert s<strong>in</strong>d, sondern auch <strong>in</strong> andere<br />
Tarifstrukturen e<strong>in</strong>sortiert werden. Nach Umfragen verschiedener Gesamtvere<strong>in</strong>igungen der<br />
MAVen muss man davon ausgehen, dass auf ca. 10.000 Beschäftigte <strong>in</strong> der Diakonie ca. 800<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> ausgegründeten Betrieben kommen, für <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e AVR ke<strong>in</strong>e Anwendung f<strong>in</strong>den.<br />
Über den Umfang von <strong>di</strong>akonischer <strong>Leiharbeit</strong> liegen ke<strong>in</strong>e verlässlichen Zahlen vor.Pro<br />
DW muss man von etwa zwei <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen ausgehen, <strong>in</strong> denen <strong>di</strong>e AVR<br />
ebenfalls ke<strong>in</strong>e Anwendung f<strong>in</strong>den. Da es ke<strong>in</strong>e zugänglichen Statistiken über <strong>di</strong>e Anzahl der<br />
Ausgründungen <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Anzahl der dort beschäftigten Mitarbeiter <strong>in</strong> den DWs gibt, lassen<br />
sich hier ke<strong>in</strong>e zuverlässigen Schätzungen vornehmen. Da <strong>di</strong>e Umfragen der G-MAVen älte-<br />
81
en Datums s<strong>in</strong>d, vor allem aber der Trend zur Ausgründung von Servicegesellschaften <strong>in</strong> den<br />
stationären E<strong>in</strong>richtungen zugenommen hat <strong>und</strong> mittlerweile flächendeckend praktiziert wird,<br />
ist <strong>di</strong>e Anzahl der <strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Ausgründungen Beschäftigten höher zu veranschlagen, als<br />
<strong>di</strong>e Mitarbeitervertreter aufgr<strong>und</strong> ihrer Umfragen (ger<strong>in</strong>ger Rücklauf wird berichtet) angeben<br />
können.<br />
Die verschiedenen, untere<strong>in</strong>ander substituierbaren Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> den Evangelischen<br />
Kirchen <strong>und</strong> den Diakonischen Werken s<strong>in</strong>d für wettbewerbsorientierte Träger e<strong>in</strong><br />
willkommenes <strong>und</strong> geeignetes Instrument, flexibel auf <strong>di</strong>e Personalkostenentwicklung zu reagieren.<br />
Träger, <strong>di</strong>e b<strong>und</strong>esweit operieren oder <strong>in</strong> mehreren B<strong>und</strong>esländern tätig s<strong>in</strong>d, wechseln<br />
<strong>di</strong>e AVR nach Opportunitätsgesichtspunkten. Es entwickelt sich auch der Trend, dass große<br />
Träger, <strong>di</strong>e Big Player, konzerneigene AVR entwickeln, <strong>di</strong>e sie auf alle ihre E<strong>in</strong>richtungen<br />
anwenden. Beobachtbar ist ferner auch, dass b<strong>und</strong>esweit agierende Träger <strong>di</strong>e AVR des Diakonischen<br />
Werkes anwenden, das ihnen am vorteilhaftesten ersche<strong>in</strong>t, so dass dann bspw. für<br />
alle E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>es <strong>in</strong> Niedersachsen tätigen Trägers <strong>di</strong>e AVR des DW Berl<strong>in</strong>-<br />
Brandenburg Anwendung f<strong>in</strong>det.<br />
Die AVR bieten noch weitere Vorteile: Wenn <strong>di</strong>akonische Träger zusammen mit weltlichen<br />
Trägern e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>richtung betreiben, bestehen sie darauf, dass <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser geme<strong>in</strong>samen E<strong>in</strong>richtung<br />
<strong>di</strong>e AVR Anwendung f<strong>in</strong>den (mit allen Konsequenzen: Streikverbot, Mitarbeitervertretung<br />
statt Betriebsrat usw.) <strong>und</strong> damit quasi zu e<strong>in</strong>er <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtung wird. <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>zelt<br />
lassen sich Fälle von E<strong>in</strong>richtungen nachweisen, <strong>in</strong> denen sich <strong>di</strong>e Beteiligungsstruktur<br />
aus Diakonie <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em weltlichen Träger zusammensetzt (bspw. Lebenshilfe <strong>und</strong> Kommune).<br />
In e<strong>in</strong>igen strukturschwachen Regionen zeichnet sich der Trend ab, dass kommunale<br />
Krankenhäuser <strong>di</strong>e Diakonie beteiligen <strong>und</strong> sich somit tendenziell zu e<strong>in</strong>er <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtung<br />
entwickeln. Für <strong>di</strong>e Kommune br<strong>in</strong>gt das den Vorteil mit sich, dass man mit <strong>Ver</strong>weis<br />
auf betriebliche Schwierigkeiten e<strong>in</strong>en neuen Träger mit an Bord holt <strong>und</strong> den TVöD durch<br />
AVR ersetzen kann <strong>und</strong> fortan <strong>di</strong>e Vorteile nutzt, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e AVR bieten. Die überall vorhandenen<br />
f<strong>in</strong>anziellen Probleme der Kommunen könnten <strong>di</strong>ese auch andernorts veranlassen, <strong>di</strong>e<br />
Zusammenarbeit mit der Diakonie zu suchen, um so soziale E<strong>in</strong>richtungen (<strong>in</strong>sbesondere kostenträchtige<br />
kommunale Krankenhäuser) aus dem TVöD auszugliedern <strong>und</strong> <strong>di</strong>e für <strong>di</strong>e Dase<strong>in</strong>svorsorge<br />
notwen<strong>di</strong>gen <strong>und</strong> gesetzlich vorgeschriebenen E<strong>in</strong>richtungen unter dem Dach<br />
e<strong>in</strong>er AVR zu restrukturieren.<br />
82
Kirchliches Arbeitsrecht <strong>und</strong> <strong>di</strong>e daraus folgenden verschiedenen AVR führen zu e<strong>in</strong>em tarif-<br />
politischen Flickenteppich, der nicht nur dazu führt, dass b<strong>und</strong>esweit zwischen den sozialen<br />
E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie unterschiedliche Arbeits- <strong>und</strong> Entgeltbed<strong>in</strong>gungen herrschen. Die<br />
Politik des "Dritten Weges" führt vielmehr auch dazu, dass <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen E<strong>in</strong>richtungen<br />
e<strong>in</strong>es Diakonischen Werkes une<strong>in</strong>heitliche Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>gütungsbed<strong>in</strong>gungen bestehen.<br />
Das Pr<strong>in</strong>zip „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ ist <strong>in</strong> der Diakonie weder b<strong>und</strong>esweit noch <strong>in</strong><br />
den regionalen Diakonischen Werken gültig. Zersplitterung der Tariflandschaft gibt es nicht<br />
nur aufgr<strong>und</strong> der <strong>in</strong> den verschiedenen Diakonischen Werken Anwendung f<strong>in</strong>denden AVR,<br />
sondern auch deshalb, weil <strong>di</strong>e regionalen Diakonischen Werke (Landesverbände) <strong>in</strong> ihren<br />
Zustän<strong>di</strong>gkeiten <strong>di</strong>e Anwendung eigener oder anderer AVR durchsetzen können. In zwei an<br />
e<strong>in</strong>em Ort ansässigen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen können daher unterschiedliche AVR An-<br />
wendung f<strong>in</strong>den, je nachdem, welche AVR der Träger der E<strong>in</strong>richtung bevorzugt. Das kirch-<br />
liche Arbeits- <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>gütungsrecht erweist sich als günstig für Betriebe im Wettbewerb <strong>und</strong><br />
<strong>di</strong>e DWs sehen <strong>di</strong>eser Entwicklung zu oder befördern sie.<br />
Die AVR bieten über <strong>di</strong>e <strong>in</strong> ihnen enthaltenen Öffnungsklauseln weitere Möglichkeiten, <strong>di</strong>e<br />
<strong>Ver</strong>gütung <strong>in</strong> den Betrieben flexibel zu gestalten. Öffnungsklauseln erlauben bspw., dass Betriebe<br />
<strong>in</strong> wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihre Mitgliedschaft im DW kün<strong>di</strong>gen, aus den AVR<br />
ausscheren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en eigenen betriebskonformen Tarif entwickeln <strong>und</strong> dann sogar Betriebsräte<br />
zulassen (was <strong>in</strong> Servicegesellschaften häufiger anzutreffen ist). Die aus dem DW ausgetretenen<br />
E<strong>in</strong>richtungen können aber auch e<strong>in</strong>en Gaststatus im DW beantragen. Die Geschäftsführung<br />
von Betrieben mit Gaststatus im DW neigt dann gewöhnlich dazu, <strong>di</strong>e gegründeten<br />
Betriebsräte mit dem <strong>Ver</strong>weis auf den neuen, wieder erworbenen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Status als unwirksam<br />
zu betrachten: „Fortan sagen <strong>di</strong>e, Betriebsrat <strong>in</strong>teressiert uns nicht, wir verhandeln<br />
nicht mit euch, ihr müsst wieder e<strong>in</strong>e Mitarbeitervertretung bilden“ (Interview mit MAV).<br />
Gastmitgliedschaften sollen im DW EKM nach Bek<strong>und</strong>en der Landesbischöf<strong>in</strong> zukünftig maximal<br />
zwei Jahre dauern.<br />
Öffnungsklauseln <strong>in</strong> den AVR regeln u.a. auch, dass<br />
‐ Jahressonderzahlungen bei betrieblichen Schwierigkeiten gekürzt werden können:<br />
„Die niedrigschwelligste Möglichkeit ist, <strong>di</strong>e zweite Hälfte von der Jahressonderzahlung<br />
e<strong>in</strong>zubehalten. Die Jahressonderzahlung, <strong>di</strong>e wie so e<strong>in</strong>e Art 13. Monatsgehalt ist,<br />
da wird <strong>di</strong>e erste Hälfte im November bezahlt <strong>und</strong> <strong>di</strong>e zweite Hälfte im Juni des Folgejahres,<br />
je nach Bilanzabschluss. Re<strong>in</strong> AVR-mäßig ist es so, wenn <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtung <strong>di</strong>e<br />
83
zweite Hälfte mit <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Bilanz h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> nimmt <strong>und</strong> sie dann e<strong>in</strong>en positiven Jahresüberschuss<br />
haben, dann müssen sie es zahlen. Wenn sie aber mit der zweiten Hälfte der Jahressonderzahlung<br />
e<strong>in</strong> Jahresdefizit haben, dann dürfen sie <strong>in</strong> Höhe des Fehlbetrages das<br />
e<strong>in</strong>behalten <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Mitarbeiter bekommen dann im Juni des Folgejahres entsprechend<br />
weniger oder gar ke<strong>in</strong>e Jahressonderzahlung.“<br />
‐ e<strong>in</strong>e Absenkung der Gehälter <strong>und</strong> Löhne vorgenommen werden kann:<br />
„Die zweite (Möglichkeit) ist e<strong>in</strong>e Absenkung um sechs Prozent der Entgelte, der Löhne<br />
<strong>und</strong> Gehälter. Da muss e<strong>in</strong>e Dienstvere<strong>in</strong>barung abgeschlossen werden zwischen der<br />
Mitarbeitervertretung <strong>und</strong> der Leitung. Das nennt sich Dienstvere<strong>in</strong>barung zur Leistungssicherung.<br />
Das heißt, wenn ich nachweisen kann, dass ich nicht genügend Klientel,<br />
Bewohner bekomme, weil andere E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> der Umgebung preiswerter s<strong>in</strong>d,<br />
dann kann ich so e<strong>in</strong>e Dienstvere<strong>in</strong>barung abschließen. Ich glaube, <strong>in</strong> dem Moment wo<br />
<strong>di</strong>e Dienststellenleitung <strong>di</strong>e an <strong>di</strong>e Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission<br />
schickt <strong>und</strong> <strong>di</strong>e dort e<strong>in</strong>gegangen ist, ist sie dann auch schon rechtswirksam. Da passiert<br />
dann auch ke<strong>in</strong>e Kontrolle“.<br />
‐ e<strong>in</strong>e Notlage des Betriebes geltend gemacht wird:<br />
„E<strong>in</strong>e dritte Möglichkeit ist e<strong>in</strong>e Dienstvere<strong>in</strong>barung zur Notlagenregelung. Da müssen<br />
<strong>di</strong>e Arbeitgeber, <strong>di</strong>e Geschäftsführer so stark ihre F<strong>in</strong>anzen offen legen, der Arbeitsrechtlichen<br />
Kommission gegenüber <strong>und</strong> auch der Mitarbeitervertretung gegenüber, dass<br />
das möglichst vermieden wird (...) Wir hatten früher viele Notlagenreglungen. “ MAV-<br />
<strong>Ver</strong>treter berichten häufiger, dass Notlagenregelungen durch das jeweilige DW geprüft<br />
werden <strong>und</strong> dass <strong>di</strong>e Empfehlung für <strong>di</strong>e letztendliche Entscheidung <strong>in</strong> der Arbeitsrechtlichen<br />
Kommission gewöhnlich auf „genehmigungswür<strong>di</strong>g“ h<strong>in</strong>ausgelaufen ist.<br />
„Wenn wir dann mit unseren Augen geprüft haben <strong>und</strong> gesagt haben, hier s<strong>in</strong>d so <strong>und</strong><br />
so viele Formfehler dr<strong>in</strong>, wir können <strong>di</strong>e nicht genehmigen, dann war großes Theater“.<br />
Nach Auskunft der MAV-<strong>Ver</strong>treter/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d Notlagenregelungen nicht <strong>di</strong>e Ausnahme,<br />
sondern sie werden von ca. 10% der E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Anspruch genommen.<br />
Das kirchliche Arbeitsrecht sieht vor, dass <strong>di</strong>e Festsetzung der Löhne <strong>in</strong> <strong>Ver</strong>handlungen zwischen<br />
Kirche <strong>und</strong> Mitarbeitervertretern <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen erfolgt. Bei<br />
Streitigkeiten entscheidet e<strong>in</strong>e Schlichtungskommission. Werden <strong>in</strong> den kirchenrechtlichen<br />
Gremien Lohnzuwächse für <strong>di</strong>e Mitarbeiter verhandelt, <strong>in</strong>terveniert - so wird berichtet – nicht<br />
selten der regionale Dienstgeberverband beim Vorstand des Diakonischen Werkes mit der<br />
Bitte, beim Schlichtungsausschuss e<strong>in</strong>e Absenkung der Forderungen zu beantragen. Die<br />
84
Schlichtungen verzögern häufig Lohnerhöhungen bis zu mehr als e<strong>in</strong>em Jahr. Auch <strong>di</strong>e Beschlüsse<br />
der Arbeitsrechtlichen Kommission des DW EKD, <strong>di</strong>e Löhne <strong>in</strong> Ostdeutschland auf<br />
das Westniveau anzuheben, s<strong>in</strong>d bei den regionalen Dienstgeberverbänden <strong>in</strong> Ostdeutschland,<br />
auf Widerstand gestoßen <strong>und</strong> auf dem (Um)Weg über den Vorstand des Diakonischen Werkes<br />
(der <strong>di</strong>e Schlichtungskommission anrufen kann) erst e<strong>in</strong>mal verh<strong>in</strong>dert worden. Diese Politik<br />
hat bspw. im DW EKM, dazu geführt, dass <strong>di</strong>e MAV-<strong>Ver</strong>treter/<strong>in</strong>nen ihre Mitarbeit <strong>in</strong> der<br />
Arbeitsrechtlichen Kommission e<strong>in</strong>gestellt haben, so dass <strong>di</strong>e Kommission von etwa 2009 bis<br />
2012 nicht arbeitsfähig war 11 . In <strong>di</strong>eser Zeit hat das DW ohne Mitwirkung der MAVen <strong>di</strong>e<br />
Lohnpolitik gestaltet. - Die vielfältigen Ausnahmeregelungen <strong>und</strong> Öffnungsklauseln <strong>in</strong> den<br />
AVR wie <strong>di</strong>e strukturelle Schwäche der Mitarbeitervertretungen <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen<br />
Kommissionen ist e<strong>in</strong> Wettbewerbsvorteil für <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungsträger (Arbeitgeber) <strong>in</strong> der Diakonie,<br />
da <strong>di</strong>e Arbeitgeberseite ihren Interessen im DW leichter Gehör verschaffen kann<br />
(bspw. über den Dienstgeberverband) <strong>und</strong> ihre Interessen besser als <strong>di</strong>e Arbeitnehmerseite<br />
(Streikverbot, Loyalitätspflicht) auch durchsetzen kann.<br />
4.4.3 Schlussbemerkung<br />
Der "Dritte Weg" hat sich für <strong>di</strong>e Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland als vorteilhaft erwiesen <strong>und</strong><br />
zweifellos dazu beigetragen, dass <strong>di</strong>e Diakonie hier zum Champion der Sozialwirtschaft aufsteigen<br />
konnte.. Die sozialwirtschaftliche Wende, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Diakonie aktiv angenommen <strong>und</strong><br />
gestaltet hat, hat bei vielen der älteren Mitarbeiter dazu geführt, dass sie „ihre“ Diakonie heute<br />
nicht mehr wiedererkennen. Die Mehrheit der MAV-<strong>Ver</strong>treter <strong>in</strong> Ostdeutschland, <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>di</strong>ejenigen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e großen Diakonischen Werke vertreten, fordern heute <strong>di</strong>e Abkehr vom<br />
"Dritten Weg", da sie auf <strong>di</strong>esem Weg ke<strong>in</strong>e oder nur ger<strong>in</strong>ge Möglichkeiten sehen, <strong>di</strong>e Mit-<br />
11<br />
Am 6.3.2012 vermeldet <strong>di</strong>e Diakonie Mitteldeutschland auf ihrem Internetportal: „Nach mehr als e<strong>in</strong>em Jahr<br />
Stillstand kann ab heute wieder <strong>di</strong>e paritätisch besetzte Arbeitsrechtliche Kommission arbeiten, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
für knapp 26.000 Mitarbeitende <strong>in</strong> Mitgliedse<strong>in</strong>richtungen der Diakonie Mitteldeutschland gestaltet.<br />
Die Kommission kam heute zu ihrer konstituierenden Sitzung <strong>in</strong> Halle zusammen (...)Tatsächlich steht <strong>di</strong>e<br />
Kommission vor wichtigen <strong>und</strong> weitreichenden Entscheidungen. Dienstnehmer <strong>und</strong> Dienstgeber müssen zum<br />
Beispiel e<strong>in</strong>vernehmlich <strong>di</strong>e Höhe der <strong>Ver</strong>gütungen für Mitarbeitende <strong>in</strong> Diakonie-E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Thür<strong>in</strong>gen,<br />
Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> <strong>in</strong> Teilen von Brandenburg <strong>und</strong> Sachsen aushandeln. Sie müssen sowohl <strong>di</strong>e Interessen der<br />
Mitarbeitenden an Steigerungen ihrer Entlohnung als auch <strong>di</strong>e zunehmend schwierige Ref<strong>in</strong>anzierung der sozialen<br />
Arbeit durch öffentliche Haushalte, Sozialkassen <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Eigenanteile der Klienten berücksichtigen“.<br />
In den Arbeitsrechtlichen Kommissionen können gewöhnlich nur Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen tätig werden, <strong>di</strong>e Kirchenmitglied<br />
s<strong>in</strong>d. Angesichts des Fachkräftemangels <strong>und</strong> angesichts der Mitgliederschwäche der ev. Kirche <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
kann man auch als Nicht-Kirchenmitglied e<strong>in</strong>e Beschäftigung bei e<strong>in</strong>er <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtung<br />
f<strong>in</strong>den, anders als <strong>in</strong> Westdeutschland. Für <strong>di</strong>e Mitarbeit <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen ist allerd<strong>in</strong>gs<br />
auch <strong>in</strong> Ostdeutschland <strong>di</strong>e Kirchenmitgliedschaft zw<strong>in</strong>gend.<br />
85
arbeiter<strong>in</strong>teressen zu vertreten. Die <strong>in</strong> der Gesamt-MAV tätigen Mitarbeiter setzen sich deshalb<br />
vehement für gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge e<strong>in</strong>.<br />
In den Diakonischen Werken Sachsen <strong>und</strong> Mecklenburg-Vorpommern wird seitens der MA-<br />
Ven auch Kritik am neuen betriebswirtschaftlichen Primat der sozialwirtschaftlich agierenden<br />
Diakonie geübt, im Gegensatz zu den Gesamt-MAV der meisten anderen Diakonischen Werken<br />
(e<strong>in</strong>schließlich der <strong>in</strong> Westdeutschland) will man aber hier am Dritten Weg festhalten, da<br />
man den Dritten Weg für reformfähig betrachtet; man vertritt <strong>di</strong>e Auffassung, dass man auch<br />
ohne Gewerkschaft <strong>und</strong> Tarifverträge <strong>di</strong>e Interessen der Beschäftigten <strong>in</strong> den Betrieben <strong>und</strong><br />
E<strong>in</strong>richtungen wie <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen angemessen <strong>und</strong> kooperativ mit<br />
der Kirche vertreten könne. Die positive Sicht auf den "Dritten Weg" <strong>und</strong> <strong>di</strong>e AVR durch den<br />
jeweiligen Gesamtausschuss der MAV <strong>in</strong> beiden DWs ist nicht unbed<strong>in</strong>gt Folge e<strong>in</strong>er besonderen<br />
Kirchenloyalität. Eher ist man der Me<strong>in</strong>ung, dass gewerkschaftliche Tarifverträge im<br />
<strong>Ver</strong>gleich zum bestehenden <strong>Ver</strong>gütungssystem zu schlechteren Ergebnissen führen könnten.<br />
Auch ist man der Me<strong>in</strong>ung, dass bei e<strong>in</strong>em gewerkschaftlichen Organisationsgrad von ca. 2%<br />
der Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen, e<strong>in</strong>e Öffnung der Diakonie für <strong>di</strong>e Gewerkschaft <strong>und</strong> deren Beteiligung<br />
an <strong>Ver</strong>gütungsfragen nicht angebracht sei. Inwieweit <strong>di</strong>e Me<strong>in</strong>ung der <strong>Ver</strong>treter <strong>in</strong> der G-<br />
MAV <strong>di</strong>e Me<strong>in</strong>ung der Beschäftigten <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen repräsentiert, ist nicht feststellbar.<br />
Die MAVen im Diakonischen Werk Sachsen <strong>und</strong> Mecklenburg-Vorpommern repräsentieren<br />
e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en Teil der MAVen <strong>in</strong> Ostdeutschland. Die Mitarbeitervertretungen der großen<br />
Landesverbände Mitteldeutschland <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische Oberlausitz setzen<br />
sich – wie <strong>di</strong>e meisten Mitarbeitervertretungen <strong>in</strong> Westdeutschland – für <strong>di</strong>e Abschaffung des<br />
"Dritten Wegs" <strong>und</strong> für Tarifverträge e<strong>in</strong>.<br />
86
5. Argumentationen gegen e<strong>in</strong>en „Tarifvertrag Soziales“<br />
Die Pluralisierung von Tarifstrukturen, der fortschreitende Prozess der <strong>Ausgliederung</strong> <strong>und</strong> der<br />
wachsende Pragmatismus der Sozialunternehmen zerstören <strong>di</strong>e normative Identität verbandlichen<br />
Handelns <strong>und</strong> damit deren Identität als geme<strong>in</strong>nützige Organisationen mit zivilgesellschaftlichem<br />
Auftrag. Insofern be<strong>in</strong>haltet <strong>di</strong>e Entwicklung der Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong><br />
der Sozialwirtschaft für <strong>di</strong>e dort tätigen <strong>Ver</strong>bände e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>sätzliche Herausforderung. <strong>Ver</strong>suche<br />
der Gegensteuerung s<strong>in</strong>d gegenwärtig vermehrt zu beobachten: In verschiedenen B<strong>und</strong>esländern<br />
haben <strong>di</strong>e Wohlfahrtsverbände sich <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samen <strong>Ver</strong>anstaltungen gegen <strong>di</strong>e<br />
Entwicklung der Branche zu e<strong>in</strong>em Niedriglohnsektor ausgesprochen. <strong>Ver</strong>suche der Landesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaften,<br />
zu e<strong>in</strong>er koord<strong>in</strong>ierten Vorgehensweise zu gelangen, scheitern allerd<strong>in</strong>gs<br />
bislang an der Konkurrenz der Sozialunternehmen <strong>und</strong> deren Bestreben, ihre jeweiligen<br />
unternehmerischen Sonderbed<strong>in</strong>gungen zum Maßstab der Tarifpolitik zu erklären.<br />
Die Arbeitgeberseite ist durch Zersplitterung, egoistische Klientel<strong>in</strong>teressen <strong>und</strong> machtpolitischen<br />
Rigorismus (unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit) <strong>in</strong> ihrer Handlungsfähigkeit<br />
e<strong>in</strong>geschränkt. Die wenigen Ansätze <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>suche zur Schaffung b<strong>und</strong>esweit gültiger<br />
Regelungen scheitern nicht zuletzt an der mangelnden Bereitschaft der Untergliederungen <strong>und</strong><br />
Betriebe, sich e<strong>in</strong>em flächendeckenden e<strong>in</strong>heitlichen Tarifvertrag „unterzuordnen“. Zwar wird<br />
<strong>di</strong>e Notwen<strong>di</strong>gkeit e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>heitlichen Sozialtarifvertrags nicht bestritten – das Engagement<br />
dafür hält sich jedoch sehr <strong>in</strong> Grenzen, nicht zuletzt deshalb, weil <strong>di</strong>es auch bedeuten würde,<br />
sich auf e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen (gewerkschaftlichen) Partner zu verstän<strong>di</strong>gen. Das Festhalten der<br />
kirchlichen <strong>Ver</strong>bände an ihrem Privileg des „Dritten Weges“ verh<strong>in</strong>dert <strong>di</strong>e Herausarbeitung<br />
geme<strong>in</strong>samer tariflicher Standards noch zusätzlich. Um e<strong>in</strong>en Branchentarifvertrag abzuschließen,<br />
müssten <strong>di</strong>e Wohlfahrtsverbände e<strong>in</strong>e Tarifgeme<strong>in</strong>schaft bilden <strong>und</strong> mit ver.<strong>di</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Tarifvertrag abschließen. Dieser Tarifvertrag könnte vom B<strong>und</strong>esarbeitsm<strong>in</strong>isterium für<br />
allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärt werden <strong>und</strong> wäre dann Gr<strong>und</strong>lage für jedes Arbeitsverhältnis im<br />
sozialen Bereich <strong>in</strong> Deutschland. Da e<strong>in</strong> Tarifvertrag aber nur für allgeme<strong>in</strong> verb<strong>in</strong>dlich erklärt<br />
werden kann, wenn m<strong>in</strong>destens 50% der Beschäftigten unter <strong>di</strong>esen Tarifvertrag fallen,<br />
ist es erforderlich, dass <strong>di</strong>e Diakonie <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Caritas Mitglied e<strong>in</strong>er solchen Tarifgeme<strong>in</strong>schaft<br />
werden.<br />
Gegen e<strong>in</strong>e solche, den Personalkostenwettbewerb e<strong>in</strong>dämmende Lösung werden folgende<br />
Argumentationen <strong>in</strong>s Spiel gebracht:<br />
87
a.) Die Bedeutung von Flächentarifverträgen wird zurückgehen.<br />
Hier wird argumentiert 1 , dass Flächentarifverträge bereits <strong>in</strong> der <strong>Ver</strong>gangenheit <strong>in</strong> der Sozialwirtschaft<br />
nur e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle gespielt haben. Ihre mangelnde Flexibilität <strong>und</strong><br />
fehlende Möglichkeiten, auf <strong>di</strong>e spezifische Situation der e<strong>in</strong>zelnen E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e regionalen<br />
Arbeitsmarktbed<strong>in</strong>gungen sowie auf <strong>di</strong>e Ref<strong>in</strong>anzierungsumstände e<strong>in</strong>zugehen, wird –<br />
so <strong>di</strong>e Argumentation – weder den Anforderungen der E<strong>in</strong>richtungen noch den Interessen der<br />
Arbeitnehmer ausreichend gerecht. Flexible, branchen-, e<strong>in</strong>richtungs- <strong>und</strong> regionsspezifische<br />
Tarifvere<strong>in</strong>barungen böten <strong>di</strong>e besten Perspektiven für <strong>di</strong>e Herausforderungen der Sozialwirtschaft.<br />
b.) Der Übergang zu Tarifverträgen wird flächentarifähnliche B<strong>in</strong>dungen wie <strong>in</strong> den AVR<br />
auflösen.<br />
Insbesondere durch <strong>Ver</strong>treter der Diakonie wird immer wieder darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass der<br />
Übergang vom "Dritten Weg" <strong>in</strong> den "Zweiten Weg" zu e<strong>in</strong>er Auflösung der bestehenden<br />
B<strong>in</strong>dung der Sozialunternehmen an <strong>di</strong>e AVR führen würde, <strong>di</strong>e gegenwärtig (noch) wie e<strong>in</strong><br />
Flächentarif wirken würden. Kle<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>richtungen würden <strong>in</strong>folge dessen zu Haustarifen übergehen<br />
oder sogar tariffreie Zustände anstreben. Demgegenüber sei es erforderlich, <strong>di</strong>e B<strong>in</strong>dung<br />
an <strong>di</strong>e AVR <strong>in</strong> allen Strukturen des "Dritten Wegs" durchzusetzen.<br />
c.) Die Sozialwirtschaft muss sich vom Sozialstaat abkoppeln <strong>und</strong> zum k<strong>und</strong>enorientierten<br />
Dienstleister werden.<br />
Exemplarisch wird <strong>di</strong>ese Argumentation vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des <strong>Ver</strong>bandes<br />
<strong>di</strong>akonischer Dienstgeber geführt, der mit dem H<strong>in</strong>weis auf fehlende sozialstaatliche F<strong>in</strong>anzierungen<br />
dafür wirbt, dass sich <strong>di</strong>e Sozialwirtschaft als k<strong>und</strong>enorientierter Dienstleister<br />
aufstellt <strong>und</strong> hierfür entsprechende <strong>Ver</strong>gütungsstrukturen entwickelt: „Natürlich weiß ich -<br />
<strong>und</strong> der <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland, VdDD, nicht m<strong>in</strong>der -, dass der<br />
soziale Sektor e<strong>in</strong> Ref<strong>in</strong>anzierungsproblem hat, das aber wegen demographischer <strong>und</strong> vielfältiger<br />
sonstiger Entwicklungen ke<strong>in</strong> politischer Mensch lösen wird - es wird nicht mehr Geld<br />
im System geben, auch wenn es noch so lautstark <strong>und</strong> larmoyant gefordert wird, denn das<br />
System wird <strong>in</strong> sich zunehmend unbezahlbar: Immer weniger arbeitende Menschen müssen<br />
immer mehr Bedürftige via Transferleistung unterstützen. Deswegen ist es von entscheidender<br />
Bedeutung für <strong>di</strong>e Zukunftsfähigkeit <strong>di</strong>akonischer Träger, dass sie ihre Arbeit <strong>in</strong>nerhalb der<br />
1<br />
Vgl. dazu: Tews, B., 2012, Tarifpolitik <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>gütung zwischen Personalknappheit, Preiswettbewerb <strong>und</strong> Leitbild,<br />
<strong>in</strong>: BAG FW (Hrsg.). Den Wandel steuern. Personal <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzen als Erfolgsfaktoren. Bericht über den 7.<br />
Kongress der Sozialwirtschaft, S. 129 -136.<br />
88
von ihnen kaum bee<strong>in</strong>flussbaren Rahmenbed<strong>in</strong>gungen so klientenorientiert, effizient <strong>und</strong> kos-<br />
tenbewusst wie möglich gestalten. Dafür bietet der Dritte Weg e<strong>in</strong> geeignetes <strong>Ver</strong>fahren. An-<br />
ders als <strong>in</strong> der gewerblichen Wirtschaft hat der geme<strong>in</strong>nützige Sektor nicht den <strong>Ver</strong>teilungs-<br />
konflikt erzielter Produktivitätsfortschritte zu lösen, sondern <strong>di</strong>e wohlverstandenen Interessen<br />
von Auftraggebern <strong>und</strong> Auftragnehmern auszubalancieren. Dieser Unterschied begründet <strong>di</strong>e<br />
Sonderstellung des Dritten Weges <strong>in</strong> unserer Zivilgesellschaft.“ 2<br />
d.) ver.<strong>di</strong> schließt Haustarifverträge unterhalb der bestehenden AVR-Entgeltvere<strong>in</strong>barungen<br />
ab.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Argument gegen <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Branchentarifs ist (<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den<br />
ostdeutschen B<strong>und</strong>esländern) der H<strong>in</strong>weis auf Haustarifverträge, <strong>di</strong>e ver.<strong>di</strong> mit E<strong>in</strong>richtungen<br />
abgeschlossen hat <strong>und</strong> <strong>di</strong>e <strong>in</strong> der <strong>Ver</strong>gütungsstruktur oft schlechter als <strong>di</strong>e bestehenden Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
s<strong>in</strong>d. <strong>Ver</strong>.<strong>di</strong> – so verdeutlichen nach Aussage auch von Mitarbeitervertretungen<br />
<strong>di</strong>ese Beispiele – g<strong>in</strong>ge es gar nicht um <strong>di</strong>e Durchsetzung e<strong>in</strong>es höheren Tarifniveaus,<br />
sondern darum, als Gewerkschaft <strong>in</strong> der Kirche Fuß zu fassen, um den Mitgliederschw<strong>und</strong><br />
zu stoppen.<br />
Bewertet man alle Argumentationen gegen <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Branchentarifs vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
der Herausforderungen der Sozialwirtschaft, so weisen sie den entscheidenden Mangel<br />
auf, ke<strong>in</strong>e Lösungsperspektive für den wachsenden Personalkostenwettbewerb zu bieten.<br />
Im Gegenteil: alle Alternativvorschläge verweisen auf den jetzigen – durch <strong>di</strong>e Unternehmen<br />
der Sozialwirtschaft selbst herbei geführten – Zustand <strong>und</strong> argumentieren mit der Faktizität<br />
von <strong>Ver</strong>hältnissen, <strong>di</strong>e man selber wollte <strong>und</strong> offenbar weiter will. Läge e<strong>in</strong> Interesse an e<strong>in</strong>heitlichen<br />
Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen vor, so könnten <strong>di</strong>e Satzungsvorschriften, <strong>di</strong>e derzeit <strong>di</strong>e Anwendung<br />
der AVR verlangen, stattdessen auf <strong>di</strong>e Anwendung e<strong>in</strong>es - dann e<strong>in</strong>heitlichen -<br />
Sozialtarifvertrages bezogen werden. Letztlich erweisen sich <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>wände gegen e<strong>in</strong>en Sozialtarifvertrag<br />
als Argumente für <strong>di</strong>e weitere Partialisierung <strong>und</strong> Differenzierung der Tarifstrukturen,<br />
deren Folgen durch das Personal zu tragen s<strong>in</strong>d.<br />
2<br />
Rückert, M. (2012), Antwort auf N. Wohlfahrt, Briefmanuskript<br />
89
6. Fazit <strong>und</strong> Ausblick<br />
- Jahrzehntelang galt im sozialen Dienstleistungssektor faktisch e<strong>in</strong> Flächentarif, der sich am<br />
BAT orientierte <strong>und</strong> <strong>di</strong>e „Leitwährung“ des sozialen Dienstleistungssektors darstellte. Mit<br />
der sozialpolitisch forcierten Umstellung auf prospektive Entgelte <strong>und</strong> der E<strong>in</strong>führung des<br />
Wettbewerbspr<strong>in</strong>zips s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Träger im Sozialsektor <strong>und</strong> ihre <strong>Ver</strong>bände den Weg gegangen,<br />
sog. „passgenaue“ Tarifsysteme zu entwickeln, <strong>di</strong>e den neuen Bedürfnissen e<strong>in</strong>er auf<br />
Sparpolitik <strong>und</strong> Personalkostensenkung programmierten Branche Rechnung tragen. Ergebnis<br />
<strong>di</strong>eser Entwicklung ist e<strong>in</strong>e Differenzierung <strong>und</strong> Pluralisierung der Tarifstrukturen <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>stärkung des sog. „gender-pay-gap“, also <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>schlechterung der<br />
tariflichen Bezahlung für Frauen, <strong>di</strong>e zudem den überwiegenden Beschäftigtenanteil im<br />
Bereich der Niedriglohngruppen darstellen. Alle Träger <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen folgen dabei<br />
e<strong>in</strong>er identischen betriebswirtschaftlichen Logik, <strong>di</strong>e sich den sozialstaatlich durchgesetzten<br />
neuen Rationalitätskriterien verdankt.<br />
- Der Betrieb Arbeitsrechtlicher Kommissionen <strong>in</strong> den Kirchen, Diakonie <strong>und</strong> Caritas, war<br />
<strong>in</strong> Zeiten des BAT e<strong>in</strong>e Angelegenheit, <strong>di</strong>e ke<strong>in</strong>es herausgehobenen tarifpolitischen Sachverstands<br />
bedurfte, weil <strong>in</strong> der Praxis <strong>di</strong>e im öffentlichen Dienst ausgehandelten Bestimmungen<br />
im wesentlichen <strong>in</strong> das eigene kirchliche Arbeitsrecht le<strong>di</strong>glich übertragen wurden.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> des Kostendeckungspr<strong>in</strong>zips <strong>und</strong> des Besserstellungsverbotes<br />
sorgten <strong>di</strong>e Arbeitsrechtlichen Kommissionen für e<strong>in</strong>e relative E<strong>in</strong>heitlichkeit der Tarifbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Diese Situation änderte sich gr<strong>und</strong>legend mit der sich seit Mitte der 1990er<br />
Jahre entwickelnden Sozialwirtschaft. Die Träger <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen besonders im kirchlichen<br />
Bereich machten Flexibilisierungserfordernisse geltend, <strong>di</strong>e zu e<strong>in</strong>er Differenzierung<br />
der <strong>Ver</strong>gütungsbed<strong>in</strong>gungen im "Dritten Weg" führten. Notfallregelungen, Ausnahmen<br />
von Sonderzahlungen, leistungsorientierte Bezahlung, Flexibilisierung des Personale<strong>in</strong>satzes<br />
u.a.m. <strong>di</strong>ktieren seitdem das Handeln der Leistungserbr<strong>in</strong>ger <strong>und</strong> führen zu e<strong>in</strong>er Auflösung<br />
der tra<strong>di</strong>tionellen, e<strong>in</strong>em Flächentarif gleichkommenden <strong>Ver</strong>gütungsbed<strong>in</strong>gungen.<br />
- Insbesondere im Bereich der Diakonie führt <strong>di</strong>ese Entwicklung zu e<strong>in</strong>er starken Aufweichung<br />
bislang gültiger Arbeits- <strong>und</strong> Entlohnungsstandards. Die relative Autonomie der<br />
Landeskirchen <strong>und</strong> ihrer Diakonischen Werke gestattet es, den Mitgliedern (den Sozialbetrieben)<br />
Ausnahmeregelungen bei der betrieblichen Handhabung der Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
zu gewähren <strong>und</strong> <strong>di</strong>ese vor Ort <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen bedürfnisgerecht zu nutzen. Die<br />
90
Vielfalt von Arbeitsrechtlichen Kommissionen führt zwangsläufig zu e<strong>in</strong>er Pluralisierung<br />
der Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien, <strong>di</strong>e auch den Bedarfen der Sozialunternehmen nach Aus-<br />
dehnung der Arbeitszeit, Gewährung regional <strong>und</strong> situational angepasster Ausnahmebe-<br />
d<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> tariflicher Differenzierung Rechnung tragen. Der wettbewerbliche Ordnungsrahmen<br />
im Sozialsektor (e<strong>in</strong>geführt mit der Begründung, <strong>di</strong>e Allokationseffizienz des<br />
sozialen Dienstleistungssektors <strong>in</strong>sgesamt zu verbessern) wird im Rahmen der kirchlichen<br />
Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> allen Diakonischen Werken dazu benutzt, Besonderheiten der<br />
lokalen <strong>und</strong>/oder regionalen Wettbewerbssituation für <strong>di</strong>e Anwendung von Ausnahmeregelungen<br />
(bspw. Notlagentarife, Aussetzen von vere<strong>in</strong>barten Zusatzzahlungen u.ä.) geltend<br />
zu machen. Der "Dritte Weg" hat sich zu e<strong>in</strong>em Instrument e<strong>in</strong>es an Flexibilität <strong>in</strong>teressierten<br />
Sozialmarkts entwickelt, <strong>in</strong> dem auf Gr<strong>und</strong> der losgetretenen Wettbewerbslogik<br />
zugleich <strong>di</strong>e Interessengegensätze von Arbeitnehmern <strong>und</strong> Arbeitgebern aufbrechen <strong>und</strong><br />
damit <strong>di</strong>e Konflikte <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen e<strong>in</strong>en neuen Charakter bekommen.<br />
- Die Kirche reagiert auf <strong>di</strong>esen Prozess der Erosion bzw. Instrumentalisierung des "Dritten<br />
Wegs" seitens der Sozialbetriebe mit dessen normativer Aufladung, e<strong>in</strong>er gesteigerter Affirmation<br />
<strong>und</strong> dem <strong>Ver</strong>such machtpolitisch begrenzter Gegensteuerung. Die Begründungen<br />
für <strong>di</strong>e besondere (theologische) Qualität des "Dritten Wegs" werden quasi nachgereicht<br />
<strong>und</strong> kolli<strong>di</strong>eren gleichzeitig mit der Realität der Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Sozialwirtschaft,<br />
<strong>di</strong>e von Durchschnittspreisen, Budgetierung <strong>und</strong> Kostensteuerung bestimmt<br />
wird. Gleichwohl zeigen alle <strong>Ver</strong>suche, den "Dritten Weg" durch kirchliche Steuerung<br />
wieder zu vere<strong>in</strong>heitlichen <strong>und</strong> gleiche Standards für alle Werke der Kirchen durchzusetzen,<br />
wie weit <strong>di</strong>e Differenzierung <strong>und</strong> Pluralisierung der Arbeitsrechtsregelungen bereits<br />
fortgeschritten ist.<br />
- Soweit man überhaupt von e<strong>in</strong>er kirchlichen Steuerung der Diakonie sprechen kann, vollzieht<br />
sich <strong>di</strong>ese weitgehend auf der Ebene der e<strong>in</strong>zelnen Landeskirchen, <strong>und</strong> auch hier<br />
sche<strong>in</strong>t <strong>di</strong>e Steuerung eher symbolische Funktion zu erfüllen. Schon <strong>di</strong>e maßgeblichen Satzungen<br />
zeigen erhebliche Unterschiede <strong>in</strong> den Möglichkeiten der Anwendung verschiedener<br />
Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien. Gleichzeitig schafft man sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Landeskirchen<br />
<strong>di</strong>e Möglichkeit e<strong>in</strong>er exzessiven Praxis von Ausnahmegenehmigungsregelungen, <strong>di</strong>e ohne<br />
Mitsprache- oder E<strong>in</strong>wirkungsmöglichkeiten der Mitarbeitervertretungen – quasi als exklusives<br />
Recht e<strong>in</strong>zelner Sozialunternehmen – zustande kommen. Zu <strong>di</strong>eser Praxis gehört<br />
91
auch <strong>di</strong>e Tolerierung von so genannten Fachverbänden, <strong>di</strong>e Mitglied des DW der EKD<br />
s<strong>in</strong>d, deren Werke bzw. Betriebe aber faktisch im Ersten Weg operieren, also <strong>Ver</strong>gütungs-<br />
ordnungen anwenden, <strong>di</strong>e ohne jegliche Mitwirkung der Mitarbeitervertretungen entwi-<br />
ckelt wurden.<br />
- Die sozialunternehmerische Praxis ist primär – das zeigen <strong>di</strong>e empirischen Ergebnisse <strong>di</strong>eser<br />
<strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> – von den betriebswirtschaftlichen <strong>Ver</strong>haltensweisen bestimmt, <strong>di</strong>e <strong>in</strong>zwischen<br />
für den gesamten Sozialsektor gelten. <strong>Ausgliederung</strong>en bestimmter Arbeitsbereiche s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
allen <strong>Ver</strong>bänden übliche Praxis geworden <strong>und</strong> führen dazu, dass <strong>di</strong>e ausgegliederten Betriebsteile<br />
so gut wie ke<strong>in</strong>e (ideelle) B<strong>in</strong>dung mehr an den <strong>Ver</strong>band aufweisen. Ausgründungen<br />
f<strong>in</strong>den flächendeckend statt <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>esen out- oder <strong>in</strong>-gesourcten Betriebsstrukturen<br />
werden häufig auch Tarifverträge bzw. <strong>Ver</strong>gütungsordnungen angewandt, <strong>di</strong>e unterhalb<br />
der <strong>in</strong> den anderen Betriebsteilen geltenden Tarifverträge, AVR oder sonstiger <strong>Ver</strong>gütungsordnungen<br />
liegen.<br />
Für <strong>di</strong>e Diakonie stellt <strong>di</strong>ese Entwicklung e<strong>in</strong>e besondere Herausforderung dar, da alle<br />
„Werke“ der Kirche kirchenrechtlich als Wesensäußerungen der Kirche gelten. Das Vorhandense<strong>in</strong><br />
von Betriebsräten ist <strong>in</strong> <strong>di</strong>esen Strukturen selbstverständliche Praxis. Die Frage,<br />
<strong>in</strong>wieweit <strong>di</strong>ese ausgegliederten Strukturen Mitglieder im Diakonischen Werk <strong>und</strong> damit<br />
der verfassten Kirche s<strong>in</strong>d, ist aber bis heute sowohl auf der Ebene der Betriebe wie<br />
der Diakonischen Werke umstritten <strong>und</strong> bedarf e<strong>in</strong>er Klärung. Vielfach s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>ese ausgegründeten<br />
Betriebsteile (bspw. <strong>Leiharbeit</strong>sgesellschaften <strong>und</strong> sonstige Servicegesellschaften<br />
der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialbetriebe) zu e<strong>in</strong>h<strong>und</strong>ert Prozent Töchter des Mutter-DW <strong>und</strong><br />
gewöhnlich ist <strong>di</strong>e Geschäftsführung beider Bereiche (personal-)identisch, d.h. <strong>di</strong>e Geschäftsführung<br />
des <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialbetriebes ist <strong>in</strong> Personalunion gleichzeitig Geschäftsführung<br />
der ausgegründeten Servicegesellschaft(en). Über welche kirchenrechtliche<br />
Konstruktion hier e<strong>in</strong>e Zugehörigkeit zur Diakonie <strong>und</strong> damit zur verfassten Kirche bestritten<br />
werden kann, ist auch bei den von uns befragten Kirchenjuristen e<strong>in</strong>e ungeklärte Frage.<br />
Die derzeit gängige Praxis der Anwendung des "Dritten Weges" reflektiert sich auch <strong>in</strong> der<br />
– zurückhaltend formuliert – herausfordernden Unterscheidung von sog. „verkün<strong>di</strong>gungsnahen“<br />
<strong>und</strong> „verkün<strong>di</strong>gungsfernen“ Diensten. Gerade so, als sei e<strong>in</strong>e Protestant<strong>in</strong>, <strong>di</strong>e <strong>in</strong><br />
Küche oder Wäscherei arbeitet, zwar getauft, dem „Priestertum aller Gläubigen“ aber fern.<br />
Sollte <strong>di</strong>e Kirche an <strong>di</strong>eser Differenzierung festhalten bzw. <strong>di</strong>ese verfestigen, dann nähert<br />
sie sich der Auffassung der Arbeitsgerichte an, <strong>di</strong>e bei Kün<strong>di</strong>gungen <strong>in</strong> weltlichen Tendenzbetrieben<br />
schon seit längerem <strong>di</strong>e Auffassung vertreten, dass <strong>di</strong>e Loyalitätspflicht der<br />
92
Mitarbeiter danach zu beurteilen sei, wie nah der oder <strong>di</strong>e jeweilige Mitarbeiter/<strong>in</strong> mit der<br />
<strong>Ver</strong>wirklichung der Tendenz befasst ist; konkret bedeutet das: e<strong>in</strong> Hausmeister hat mit der<br />
<strong>Ver</strong>wirklichung der Tendenz im Betrieb weniger zu tun als e<strong>in</strong>/e Sozialarbeiter/<strong>in</strong> oder <strong>di</strong>e<br />
Geschäftsführung. Mit der Unterscheidung von verkün<strong>di</strong>gungsnahen <strong>und</strong> verkün<strong>di</strong>gungs-<br />
fernen Diensten sche<strong>in</strong>t sich <strong>di</strong>e Kirche <strong>di</strong>ese Auffassung zu eigen gemacht zu haben. Nur<br />
müsste man <strong>di</strong>ese Differenzierung dann auch <strong>in</strong> den <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialbetrieben anwen-<br />
den <strong>und</strong> auch hier das „Priestertum aller Gläubigen“ neu def<strong>in</strong>ieren <strong>und</strong> sich dazu durch-<br />
r<strong>in</strong>gen zu entscheiden, wer Priester ist <strong>und</strong> wer nicht (also: der Tendenzverwirklichung nä-<br />
her <strong>und</strong> ferner steht). E<strong>in</strong>e solche Entscheidung würde aber <strong>di</strong>e arbeitsrechtlichen Beson-<br />
derheiten des "Dritten Weges" theologisch <strong>in</strong>s Absurde br<strong>in</strong>gen.<br />
- Die Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> gehört ebenfalls zu den üblichen Praktiken <strong>in</strong> der Sozialbranche,<br />
ist aber – so <strong>di</strong>e Aussagen der Mitarbeitervertretungen - im Unterschied zu <strong>Ausgliederung</strong>en<br />
mit Blick auf ersetzende <strong>Leiharbeit</strong> ke<strong>in</strong>e flächendeckende Praxis. Die Nutzung<br />
von <strong>Leiharbeit</strong> zur Abdeckung von Spitzen u.ä. gehört dagegen wie <strong>in</strong> anderen Branchen<br />
auch zur gängigen Praxis im Sozialsektor. Die vergleichsweise ger<strong>in</strong>ge Nutzung ersetzender<br />
<strong>Leiharbeit</strong> ist u. a. auf <strong>di</strong>e Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zurück zu<br />
führen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Vorteile <strong>di</strong>eser Form der Nutzung e<strong>in</strong>schränkt. E<strong>in</strong>e empirische Bestimmung<br />
des Umfangs, <strong>in</strong> dem <strong>Leiharbeit</strong> genutzt wird, scheitert im Übrigen bislang daran,<br />
dass sich der <strong>Ver</strong>band Diakonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong> das Diakonische<br />
Werk der EKD weder auf e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>heitlichen Fragebogen noch auf <strong>di</strong>e Vorgehensweise<br />
der Datenerhebung verstän<strong>di</strong>gen konnten. Feststellen lässt sich nach unseren Untersuchungsergebnissen,<br />
dass ersetzende <strong>Leiharbeit</strong> flächendeckend nicht nachweisbar ist. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
lässt sich feststellen, dass e<strong>in</strong>zelne Arbeitgeber <strong>in</strong> allen Diakonischen Werken eigene<br />
<strong>di</strong>akonische <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen betreiben <strong>und</strong> dass <strong>di</strong>akonische <strong>Leiharbeit</strong> vorkommt,<br />
je größer der Sozialbetrieb ist. Wenn <strong>Leiharbeit</strong> nur von wenigen „schwarzen Schafen“ betrieben<br />
wird, wie von <strong>di</strong>akonischer Seite immer behauptet wird, dann s<strong>in</strong>d „schwarze Schafe“<br />
<strong>in</strong> allen Diakonischen Werken anzutreffen.<br />
- Die gängige Praxis von Tarifvergleichen anhand der Tabellen liefert ke<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichenden<br />
Informationen über <strong>di</strong>e tatsächlichen E<strong>in</strong>kommensverhältnisse der Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Arbeitnehmer. E<strong>in</strong> <strong>Ver</strong>gleich, der alle notwen<strong>di</strong>gen Variablen, wie beispielsweise Sonderregelungen,<br />
Urlaub, Wochenarbeitszeit, betriebliche Zusatzversorgung etc. umfasst, ist<br />
aufwän<strong>di</strong>g <strong>und</strong> setzt <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>fügbarkeit der notwen<strong>di</strong>gen Daten voraus. Festgestellt werden<br />
93
muss, dass <strong>in</strong> den letzten Jahren Absenkungen bei allen materiellen Tatbeständen – nicht<br />
nur <strong>in</strong> der Diakonie – erfolgt s<strong>in</strong>d, <strong>di</strong>e erhebliche E<strong>in</strong>kommense<strong>in</strong>bußen der Arbeitnehme-<br />
r<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer zur Folge haben. Haustarife <strong>und</strong> Tarife mit Niedriglohnanbietern<br />
s<strong>in</strong>d hierbei gar nicht berücksichtigt. Dass sich auch <strong>in</strong> der Praxis der AVR-Absenkungen<br />
<strong>di</strong>e betriebswirtschaftlichen Notwen<strong>di</strong>gkeiten geltend machen <strong>und</strong> nicht <strong>di</strong>e normativen<br />
Anforderungen des "Dritten Weges" das Betriebshandeln bestimmen, ist offensichtlich.<br />
- Der TVöD hat sich als Flächentarif im Sozialsektor nicht etablieren können. Dennoch organisiert<br />
er e<strong>in</strong>en relevanten Teil der Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer im Sozialsektor.<br />
Die Notwen<strong>di</strong>gkeit e<strong>in</strong>es Flächentarifvertrages zeigt sich schon bei oberflächlicher Betrachtung<br />
der Ref<strong>in</strong>anzierung sozialer Dienste, denn bei steigendem Kostendruck <strong>und</strong><br />
gleichzeitigem Fachkraftmangel muss es auch den Sozialbetrieben e<strong>in</strong> Anliegen se<strong>in</strong>, ihren<br />
Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern <strong>Ver</strong>gütungen zahlen zu können, <strong>di</strong>e für <strong>di</strong>ese attraktiv<br />
s<strong>in</strong>d. Insofern ist der immer wieder zu hörende <strong>Ver</strong>weis der Diakonie darauf, dass im Sozialsektor<br />
e<strong>in</strong> Flächentarif nicht existiere, e<strong>in</strong> Argument dafür, ihn zu schaffen.<br />
Denn objektiv betrachtet müsste es das geme<strong>in</strong>same Ziel der im Sozialsektor tätigen <strong>Ver</strong>bände<br />
<strong>und</strong> Sozialunternehmen se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en solchen Branchentarif zu etablieren, um der<br />
Konkurrenz um möglichst niedrige Personalkosten entgegen wirken zu können. In <strong>di</strong>eser<br />
Situation erweist sich <strong>di</strong>e gesteigerte Affirmation <strong>und</strong> normative Aufladung des "Dritten<br />
Weges" als Sonderweg der Kirchen geradezu als kontraproduktiv. Anstatt auf E<strong>in</strong>heitlichkeit<br />
der Tarifbed<strong>in</strong>gungen zu dr<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> hierfür zu werben, praktiziert <strong>di</strong>e Diakonie das<br />
Gegenteil: Die zunehmende Partikularisierung der Tarifstrukturen. Die <strong>in</strong>zwischen zu beobachtenden<br />
<strong>Ver</strong>suche, den "Dritten Weg" als „tariffähig“ anerkennen zu lassen <strong>und</strong> damit<br />
e<strong>in</strong>e Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeit möglich zu machen, s<strong>in</strong>d ebenfalls nicht Ziel führend. Sieht<br />
man e<strong>in</strong>mal davon ab, dass <strong>di</strong>e Gewerkschaften e<strong>in</strong>en solchen Schritt unter ke<strong>in</strong>en Umständen<br />
akzeptieren können, weil damit e<strong>in</strong>e Praxis, <strong>in</strong> der <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>bandsleitung der E<strong>in</strong>richtungen,<br />
<strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Arbeitgeber s<strong>in</strong>d, <strong>di</strong>e Bed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Formen beschließt, <strong>in</strong> denen <strong>di</strong>e<br />
Arbeitnehmer über ihre Löhne verhandeln (eben <strong>in</strong> Arbeitsrechtlichen Kommissionen)<br />
<strong>und</strong> ihnen f<strong>und</strong>amentale Rechte wie das Streikrecht vorenthält, als tarifpolitische Normalität<br />
legitimiert <strong>und</strong> damit <strong>di</strong>e Gr<strong>und</strong>lagen des Tarifsystems als solches <strong>in</strong> Frage stellt, bildet<br />
der "Dritte Weg" selbst gar ke<strong>in</strong> Tarifgefüge, <strong>in</strong> dem durchsetzungsfähige Koalitionen der<br />
Arbeitnehmer mit denen der Arbeitgeber e<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>gütung regeln. Im Dritten Weg handelt<br />
es sich um e<strong>in</strong>e Kollektivregelung, <strong>di</strong>e der e<strong>in</strong>zelvertraglichen Inbezugnahme bedarf, e<strong>in</strong><br />
94
Tatbestand – auch das zeigen <strong>di</strong>e Ergebnisse <strong>di</strong>eser <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> – der dazu genutzt wird, Ar-<br />
beitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmern <strong>in</strong><strong>di</strong>vidualisierende Sonderregelungen aufzubürden.<br />
- Die von uns durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass sich der "Dritte Weg" nicht nur<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Phase der <strong>in</strong>neren Erosion bef<strong>in</strong>det, sondern auch aktiv als Geschäfts- <strong>und</strong> Wettbewerbsstrategie<br />
genutzt wird, um sich gegenüber sozialwirtschaftlichen Konkurrenten<br />
durchzusetzen. Hier eröffnen sich durch Ausgründungen verschiedenster Form, durch <strong>di</strong>e<br />
Möglichkeit der Anwendung unterschiedlicher AVR, der Nutzung von flexiblen Zulieferstrukturen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Fülle von Sonderregelungen Möglichkeiten e<strong>in</strong>er Wettbewerbspraxis,<br />
<strong>di</strong>e <strong>in</strong>nerhalb tarifvertraglicher Regelungen nicht möglich wären. H<strong>in</strong>zu kommt <strong>di</strong>e schwache<br />
Rolle der Mitarbeitervertretungen, <strong>di</strong>e strukturell im "Dritten Weg" angelegt ist <strong>und</strong><br />
sich bei zunehmenden Arbeitskonflikten verschärfend auswirkt, sowie <strong>di</strong>e ger<strong>in</strong>ge gewerkschaftliche<br />
Organisierung der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter. Der unübersehbare Genderaspekt<br />
bei der Nutzung von sozialer Dienstleistungsarbeit erfährt hier e<strong>in</strong>e weitere <strong>Ver</strong>stärkung<br />
mit Blick auf <strong>di</strong>e Flexibilitätsbedürfnisse der unter Kostendruck stehenden Sozialunternehmen.<br />
Unsere Analysen zeigen, dass es im "Dritten Weg" ke<strong>in</strong>e gesicherten<br />
Schranken der Flexibilisierung gibt, sondern im Gegenteil <strong>di</strong>eser e<strong>in</strong> Arsenal weiterer Flexibilisierungsstrategien<br />
eröffnet, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e Diakonie zu e<strong>in</strong>em im Wettbewerb sich nicht nur<br />
behauptenden, sondern wachsenden Sozialwirtschaftsanbieter machen.<br />
- Die gegenwärtig <strong>in</strong> der Diakonie <strong>di</strong>skutierte notwen<strong>di</strong>ge Stärkung der Strukturen der Mitarbeitervertretung<br />
zeigt, dass <strong>di</strong>e Praxis des "Dritten Weges" nie als e<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
zwischen streitenden Parteien auf Augenhöhe gedacht <strong>und</strong> konzeptionell ausgestaltet<br />
war. Diese Notwen<strong>di</strong>gkeit ergibt sich ja auch nicht, wenn man theologisch davon ausgeht,<br />
dass <strong>in</strong> den sozialen Diensten das missionarische Wirken <strong>in</strong> der Nachfolge Christi <strong>di</strong>e Praxis<br />
der dort tätigen Akteure bestimmt. Insofern s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e gegenwärtigen Diskussionen das<br />
E<strong>in</strong>geständnis, das <strong>di</strong>e neue Gestalt der Sozialwirtschaft Konflikte produziert, <strong>di</strong>e andere<br />
(Arbeitnehmer strukturell stärkende) Bed<strong>in</strong>gungen der Streitaustragung erfordern, als <strong>di</strong>ese<br />
<strong>in</strong> der Figur des "Dritten Wegs" wesensmäßig angelegt s<strong>in</strong>d Alle Mitarbeitervertretungen<br />
bestätigen den Tatbestand, dass mit dem Entstehen e<strong>in</strong>er wettbewerblichen Sozialwirtschaft<br />
<strong>di</strong>e Ause<strong>in</strong>andersetzungen <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen <strong>di</strong>e Interessen<strong>di</strong>vergenz<br />
von Parteien widerspiegeln <strong>und</strong> eben nicht <strong>di</strong>e Interessenidentität von Partnern<br />
darstellen.<br />
95
- Der <strong>Ver</strong>weis auf den Tatbestand, dass Kirche <strong>und</strong> Diakonie zusammen gehören <strong>und</strong> des-<br />
halb der "Dritte Weg" notwen<strong>di</strong>gerweise angewandt werden muss, weil ansonsten <strong>di</strong>e Kir-<br />
che nachhaltigen Schaden davon tragen würde, ist ebenfalls wenig plausibel. In anderen<br />
europäischen Staaten existieren <strong>di</strong>e dort tätigen Diakonischen Werke <strong>und</strong> Caritasverbände<br />
als christliche Sozialwerke ohne arbeitsrechtliche Sonderstellung <strong>und</strong> nehmen <strong>di</strong>es – so<br />
zum Beispiel <strong>in</strong> Österreich– überhaupt nicht als Defizit wahr. Im Gegenteil: man w<strong>und</strong>ert<br />
sich über <strong>di</strong>e komplizierten Prozesse, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>es tarifpolitisch <strong>in</strong> Deutschland auslöst <strong>und</strong> das<br />
dortige Insistieren auf dem "Dritten Weg" aus angeblichen kirchenpolitischen Notwen<strong>di</strong>g-<br />
keiten heraus.<br />
- Die im Kirchenrecht verankerte Drohung, E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e sich nicht an <strong>di</strong>e AVR halten,<br />
aus dem Diakonischen Werk auszuschließen, könnte auch <strong>di</strong>e Option be<strong>in</strong>halten, das DW<br />
nur für soziale Dienste <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen zu öffnen, <strong>di</strong>e unmittelbar kirchliche Interessen<br />
transportieren. E<strong>in</strong>e solche <strong>Ver</strong>kirchlichung der vorhandenen <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> sozialen Dienste<br />
würde aber dem zunehmend europäisierten <strong>und</strong> privatisierten Sozialmarkt als Sonderweg<br />
gegenüberstehen <strong>und</strong> <strong>di</strong>e bisherige Strategie der Diakonie, zunehmend Aufgaben zu<br />
übernehmen, <strong>di</strong>e <strong>di</strong>e öffentliche Hand privatisieren will, konterkarieren. E<strong>in</strong> solcher Weg<br />
würde e<strong>in</strong>e Schwächung der Diakonie als sozialen Dienstleistungsanbieter bedeuten <strong>und</strong><br />
<strong>di</strong>e Frage nach der Zukunft kirchlicher Wohlfahrtsverbände aufwerfen. E<strong>in</strong>e realistische<br />
Option stellt <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>kirchlichung der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen angesichts europäischen<br />
Wettbewerbsrechts <strong>und</strong> der europäischen Dienstleistungsrichtl<strong>in</strong>ie nicht dar. Inwieweit<br />
durch ideologischen Druck Ausgründungen <strong>und</strong> Sonderwege <strong>in</strong>nerhalb des "Dritten Weges"<br />
korrigiert <strong>und</strong> wieder zurückgefahren werden <strong>und</strong> auf <strong>di</strong>esem Wege e<strong>in</strong>heitlichere Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
durchgesetzt werden, ist angesichts der bislang gegenteiligen Praxis unwahrsche<strong>in</strong>lich.<br />
- Das Fazit <strong>di</strong>eser <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> lässt sich dah<strong>in</strong> gehend zusammen fassen, dass der "Dritte Weg"<br />
als "gelebte Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" <strong>in</strong> der Praxis faktisch obsolet ist. Er folgt <strong>in</strong> der sozialunternehmerischen<br />
Wirklichkeit den Gesetzmäßigkeiten der gesamten Sozialbranche <strong>und</strong> <strong>di</strong>e<br />
ist von den herrschenden Ref<strong>in</strong>anzierungsbed<strong>in</strong>gungen bestimmt <strong>und</strong> nicht von Glaubensbzw.<br />
Wertebesonderheiten. Große Teile der Mitarbeitervertretungen der Diakonie fordern<br />
deshalb den Übergang zu Tarifverhandlungen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Tarifvertrag Soziales als Bremse<br />
der herrschenden Konkurrenzbed<strong>in</strong>gungen. Insofern wäre e<strong>in</strong> Tarifvertrag Soziales unter<br />
E<strong>in</strong>schluss der Anerkennung gewerkschaftlicher Rechte nicht nur e<strong>in</strong> Gew<strong>in</strong>n für <strong>di</strong>e Ar-<br />
96
eitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer <strong>in</strong> der Diakonie, sondern auch für <strong>di</strong>e Stellung der Diakonie<br />
als sozialer Dienstleistungsanbieter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em durch Kostenkonkurrenz bestimmten<br />
Markt, der machtvolle <strong>und</strong> durchsetzungsfähige Strukturen der Interessenvertretung mehr<br />
als erforderlich macht.<br />
97
7. Forschungsperspektiven<br />
Die Ergebnisse der hier vorgelegten explorativen <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> zeigen <strong>di</strong>e dramatischen <strong>Ver</strong>änderungen,<br />
<strong>di</strong>e <strong>in</strong> den letzten Jahren im Bereich der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialwirtschaft festgestellt<br />
werden können. Sie zeigen, dass <strong>di</strong>e Praxis der <strong>Ausgliederung</strong> weit fortgeschritten ist <strong>und</strong> <strong>di</strong>e<br />
normativen Koord<strong>in</strong>aten e<strong>in</strong>es kirchlichen Sozialverbandes zu zerstören droht. Dabei war es<br />
im Rahmen der vorliegenden <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> nicht möglich, e<strong>in</strong>e repräsentative Erhebung des Umfangs<br />
von <strong>Ausgliederung</strong>en <strong>und</strong> der Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> durchzuführen. Dies liegt u.a.<br />
daran, dass es dem Diakonischen Werk der EKD nicht gelungen ist, e<strong>in</strong>e derartige Umfrage<br />
eigenstän<strong>di</strong>g durchzuführen, weil der <strong>Ver</strong>band der Diakonischen Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland<br />
<strong>di</strong>ese mit <strong>Ver</strong>weis auf eklatante Mängel bei der Fragebogenkonstruktion nicht unterstützt hat.<br />
E<strong>in</strong>e durch den VdDD selbststän<strong>di</strong>g durchgeführte Erhebung ist bislang nicht publiziert worden,<br />
weist aber nach Aussage von Diakonievertretern selbst e<strong>in</strong>e <strong>Ver</strong>zerrung der Stichprobe<br />
auf. Inwieweit <strong>di</strong>e von <strong>Ver</strong>tretern des DW der EKD angekün<strong>di</strong>gte Zusammenführung beider<br />
Untersuchungen durch e<strong>in</strong> externes wissenschaftliches Institut zu produktiven Ergebnissen<br />
führt, muss abgewartet werden.<br />
Die Ergebnisse <strong>di</strong>eser <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> geben ungeachtet <strong>di</strong>eses Tatbestands e<strong>in</strong>e Fülle von H<strong>in</strong>weisen<br />
auf Praktiken, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> nahezu allen landeskirchlichen Diakonischen Werken eklatante <strong>Ver</strong>stöße<br />
gegen <strong>di</strong>e selbst gesetzten Pr<strong>in</strong>zipien des Dritten Wegs verdeutlichen. Es wäre wünschenswert,<br />
wenn <strong>in</strong> breiterem Umfang, als <strong>di</strong>es im Rahmen der vorliegenden explorativen <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong><br />
geschehen konnte, auch <strong>di</strong>e Geschäftsführungen der e<strong>in</strong>zelnen Diakonischen Träger <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen<br />
e<strong>in</strong>er repräsentativen Befragung zustimmen würden. Gegenwärtig hat nicht nur der<br />
Spitzenverband erhebliche Probleme, aussagefähige Daten bei se<strong>in</strong>en Mitgliedern zu erheben;<br />
viele Geschäftsführungen weigern sich, ihre Strukturen transparent zu machen, obwohl sie<br />
normativ gleichzeitig behaupten, <strong>in</strong> den Koord<strong>in</strong>aten des Dritten Wegs zu handeln.<br />
Es wäre <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Schritt notwen<strong>di</strong>g, auf der Ebene der Sozialbetriebe selbst Untersuchungen<br />
durchzuführen, <strong>in</strong>wieweit sich <strong>di</strong>e normativen Postulate des Dritten Wegs dort<br />
überhaupt <strong>in</strong> der sozialwirtschaftlichen Praxis geltend machen. Auf welchen Ebenen <strong>und</strong> mittels<br />
welcher Instrumente erfüllt sich <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>heißung e<strong>in</strong>er Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> der Praxis<br />
von Krankenhäusern, Altenheimen <strong>und</strong> Pflegestationen. Vorliegende <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong>n, <strong>di</strong>e allerd<strong>in</strong>gs<br />
nicht <strong>di</strong>e Konkretisierung von Inhalten des Dritten Wegs überprüfen, zeigen, dass mit Blick<br />
98
auf Variablen wie Arbeitszeitgestaltung, Burn-Out, Taktung, Handlungsspielräume etc. e<strong>in</strong>e<br />
Unterscheidung sozialwirtschaftlicher Organisationen nicht vorgenommen werden kann.<br />
Die Ergebnisse unserer explorativen <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> sollen zum Dialog anregen. Es wäre wünschenswert,<br />
wenn <strong>di</strong>eser Dialog auf der Basis von empirischen Fakten <strong>und</strong> nicht ideologischen Konzepten<br />
geführt würde. Die gegenwärtigen Ause<strong>in</strong>andersetzungen zwischen ver.<strong>di</strong> <strong>und</strong> der Diakonie<br />
zeigen, dass ideologische <strong>Ver</strong>härtungen für <strong>di</strong>e Gestaltung der Zukunft der Sozialwirtschaft<br />
wenig Ziel führend s<strong>in</strong>d. Die Sozialwirtschaft bedarf mit Blick auf ihre Personal- <strong>und</strong><br />
Organisationspolitik e<strong>in</strong>er ordnungspolitischen Korrektur – <strong>und</strong> <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>bände täten gut daran,<br />
hierfür <strong>di</strong>e vorliegenden Fakten zur Kenntnis zu nehmen.<br />
99
Anhang<br />
I. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Befragung von Mitarbeitervertretungen zu <strong>Ausgliederung</strong> <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong><br />
II. Lohndump<strong>in</strong>g <strong>in</strong> der Diakonie? Zur Bezahlung der Mitarbeitenden. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Umfrage<br />
III. Beispiel: Arbeitsvertrag<br />
IV. Übersichtskarte: Tarife <strong>in</strong> der Diakon<br />
100
I. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Befragung von Mitarbeitervertretungen zu <strong>Ausgliederung</strong> <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> 1<br />
Abbildung 1<br />
Die Befragten repräsentieren 299 E<strong>in</strong>richtungen (n=48) mit 15885 Mitarbeitern (n=36). Die am häufigsten<br />
ausgegliederten Arbeitsbereiche waren (n=44; Mehrfachnennungen möglich):<br />
1. Re<strong>in</strong>igung 31<br />
2. Küche; Cater<strong>in</strong>g 21<br />
3. Hauswirtschaft 16<br />
4. <strong>Leiharbeit</strong>sunternehmen 13<br />
5. <strong>Ver</strong>waltung / EDV 5<br />
6. Fahr-/Hol- <strong>und</strong> Br<strong>in</strong>ge<strong>di</strong>enste 5<br />
7. Altenhilfe (ambulant u. stationär) 5<br />
8. Hausmeister 4<br />
1<br />
Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf den Antworten von 299 Mitarbeitervertretungen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen<br />
der Diakonie mit 15.885 Beschäftigten e<strong>in</strong>er b<strong>und</strong>esweiten schriftlichen Befragung, <strong>di</strong>e im Zeitraum Aug. 2001<br />
bis Feb.2012 durchgeführt wurde. Die Befragung erhebt <strong>di</strong>e Sicht der Mitarbeitervertretungen auf <strong>di</strong>e betriebliche<br />
Realität. Die zunächst beabsichtigte Parallelbefragung der Geschäftsführungsebene war wegen zu ger<strong>in</strong>ger<br />
Beteiligung nicht umsetzbar. Die Ergebnisse <strong>di</strong>eser <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> verdeutlichen somit ausschnitthaft Entwicklungen <strong>in</strong><br />
der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialwirtschaft anhand der Wahrnehmung betrieblicher Interessenvertretungen. Die <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong><br />
ersetzt ke<strong>in</strong>e Gesamt- bzw. Repräsentativerhebung. Sie liefert jedoch als explorative Untersuchung H<strong>in</strong>weise auf<br />
Umfang <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>breitung von Praxen der Ausgründung <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>, <strong>di</strong>e auch <strong>in</strong> den qualitativen Interviews<br />
bestätigt wurden. Die Ergebnisse verdeutlichen auch <strong>di</strong>e Notwen<strong>di</strong>gkeit e<strong>in</strong>er umfassenden Repräsentativerhebung.<br />
Diese ist zwar auch von der Synode der EKD im Nov. 2011 gefordert worden, scheitert aber bislang an<br />
Interessengegensätzen zwischen dem DW EKD als Spitzenverband der Diakonie <strong>und</strong> dem VdDD als Arbeitgeberverband<br />
<strong>in</strong> der Diakonie.<br />
101
Le<strong>di</strong>glich 18% der Beschäftigten der ausgelagerten Arbeitsbereiche s<strong>in</strong>d noch <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>richtung angestellt.<br />
82% der Mitarbeiter s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Servicegesellschaften angestellt. Die Anzahl der Mitarbeiter,<br />
<strong>di</strong>e noch <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>richtung angestellt s<strong>in</strong>d obwohl sie <strong>in</strong> den Servicegesellschaften arbeiten, beläuft<br />
sich auf 52 (n=5).<br />
Abbildung 2<br />
Neben der üblichen Rechtform e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>nützigen GmbH, geben 20 Befragte an, dass bei ihnen<br />
ausgegründete Betriebe auch <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er GmbH agieren. Außerdem gibt jeweils e<strong>in</strong> Befragter an,<br />
dass bei ihm ausgegründete Betriebe <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>getragenen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>s, e<strong>in</strong>er Zwill<strong>in</strong>gsgesellschaft<br />
oder e<strong>in</strong>es Kooperationsbetriebes vorhanden s<strong>in</strong>d (n=23).<br />
102
Abbildung 3<br />
Abbildung 4<br />
Le<strong>di</strong>glich 10% der Befragten gab an, dass <strong>di</strong>e ausgegründeten Servicegesellschaften nicht mehrheitlich<br />
<strong>in</strong> Hand der Muttergesellschaft liegen. Die gewerblichen Träger, <strong>di</strong>e daraufh<strong>in</strong> als Mehrheitsgesellschafter<br />
benannt wurden s<strong>in</strong>d: Agaplesion gAG, Hold<strong>in</strong>g Pflege<strong>di</strong>akonie Hamburg West/Südholste<strong>in</strong>,<br />
Alexianerbrüder, Sgnlab, Gegenbauer, 100% Heimstiftung <strong>und</strong> 49% bei verschiedenen Kompetenzpartnern<br />
bzw. Branchen-Fachfirmen (n=6).<br />
103
Abbildung 5<br />
Die Frage danach, welche AVR oder Tarifverträge <strong>in</strong> den ausgegründeten Betrieben wirksam ist, beantworteten<br />
<strong>di</strong>e Befragten (n=49; Mehrfachnennung möglich) wie folgt:<br />
1. TV Gebäudere<strong>in</strong>igung 11<br />
2. Haustarif 10<br />
3. TV für Zeitarbeitnehmer/ <strong>Leiharbeit</strong>er<br />
4. AVR 6<br />
5. NGG 5<br />
6. KTD 5<br />
7. AVR regional 3<br />
8. ke<strong>in</strong> TV 5<br />
9. HOGA 4<br />
10. KDAVO 2<br />
Abbildung 6<br />
7<br />
Außerdem wurden Privatvertrag, TVöD, AMP, Arbeitsverträge auf dem ersten Weg <strong>und</strong> E<strong>in</strong>zelarbeitsverträge<br />
genannt.<br />
104
53% der Befragten (n=34) gaben an, dass <strong>in</strong> ihrer E<strong>in</strong>richtung zurzeit nicht über neue Ausgründungen<br />
nachgedacht wird, 9% geben sogar an, dass eher über e<strong>in</strong>e Rückführung der ausgelagerten Arbeitsbereiche<br />
<strong>in</strong> den Stammbetrieb nachgedacht wird.<br />
Wenn es jedoch <strong>di</strong>e Überlegung gibt, weitere Arbeitsbereiche auszugründen, betrifft das vor allem den<br />
Bereich Küche <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Essensversorgung mit 4 Nennungen sowie mit jeweils e<strong>in</strong>er Nennung: Altenheim,<br />
Ambulanzen, Dialog-Center, Handwerker, Haustechnik, Hauswirtschaft, <strong>in</strong>tegrative Arbeitsplätze,<br />
Leistungsabrechnung, "geme<strong>in</strong>samer Betrieb" mit EABW u. EAGG, MA der Personalservice<br />
GmbH sollen <strong>in</strong> <strong>di</strong>e EAGG kommen, Pforte, Re<strong>in</strong>igung, Servicekräfte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Servicegesellschaft,<br />
Telefonzentrale <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Gründung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Servicegesellschaft für bisher e<strong>in</strong>zelne ausgelagerte<br />
Arbeitsbereiche mit den Aufgaben: Re<strong>in</strong>igung, IT, <strong>Ver</strong>leihfirma, Büroservice, Fahrbereitschaft,<br />
Aufgaben außerhalb der eigenen E<strong>in</strong>richtung (n=16, Mehrfachnennung möglich).<br />
Wenn es <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>richtung ausgegliederte Personalservicegesellschaften oder <strong>Leiharbeit</strong>sgesellschaften<br />
gibt, <strong>di</strong>e Arbeitnehmerüberlassung betreiben, betrifft das folgende Berufsgruppen (n=26, Mehrfachnennung<br />
möglich):<br />
1. Pflege 10<br />
2. alle Berufsgruppen 6<br />
3. Küche 4<br />
4. Re<strong>in</strong>igung 4<br />
5. IT-Technik 3<br />
Abbildung 7<br />
Außerdem wurden Personalabteilung, Ärzte, Therapeuten, Bürobereich, Servicekräfte, Fachkräfte,<br />
<strong>Ver</strong>waltung, Nichtfachkräfte, ZA Personalservice GmbH, Schreib<strong>di</strong>enst, Betriebshandwerker, WfbM-<br />
Produktionshelfer, Wäsche, Hauswirtschaft, Hausmeister <strong>und</strong> Fahr<strong>di</strong>enst jeweils e<strong>in</strong>mal genannt.<br />
Diese Personalservicegesellschaften beschäftigten 1544 Mitarbeiter (n=15). In <strong>di</strong>esen Gesellschaften<br />
f<strong>in</strong>den folgende Arbeitsvertragsbed<strong>in</strong>gungen Anwendung (n=16, Mehrfachnennung möglich):<br />
1. TV Zeitarbeit 8<br />
2. AVR 3<br />
3. e<strong>in</strong>zelvertragliche Regelungen 2<br />
Abbildung 8<br />
105
Wenn <strong>di</strong>e tariflichen Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den Servicegesellschaften von den Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>richtung<br />
abweichen tun sie <strong>di</strong>es hauptsächlich <strong>in</strong> <strong>di</strong>esen Bereichen (n=34, Mehrfachnennung möglich):<br />
1. Gr<strong>und</strong>vergütung 21<br />
2. Urlaub 17<br />
3. Zulagen 13<br />
4. Arbeitszeit 8<br />
5. Altersversorgung 5<br />
6. alle Bereiche 5<br />
7. Überst<strong>und</strong>en 4<br />
8. Jahressonderzahlungen 4<br />
Abbildung 9<br />
Außerdem wurde jeweils e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong> ganz anderes Tarifwerk, Krankengeldzuschuss, andere E<strong>in</strong>gruppierungsmerkmale,<br />
AVR Wü, AVR, Gaststätten <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>gfügig Beschäftigte genannt.<br />
Begründet wurden <strong>di</strong>e Ausgründungen gegenüber den Mitarbeitern vor allem mit (n=50, Mehrfachnennung<br />
möglich):<br />
1. Kostenersparnis 21<br />
2. Wirtschaftlichkeit 8<br />
3. Kostendruck von Seiten der Kostenträger 6<br />
4. Personal kann besser e<strong>in</strong>gesetzt werden 5<br />
5. F<strong>in</strong>anzielle Gründe 3<br />
6. Inklusion/ Integration für beh<strong>in</strong>derte Beschäftigte<br />
auf den 1. Arbeitsmarkt<br />
7. Profit 2<br />
8. Steuerliche Gründe 2<br />
Abbildung 10<br />
106<br />
3
Zusätzlich gab es <strong>di</strong>e Begründungen: Übernahme durch Pflege<strong>di</strong>akonie, Fusion mit neuen Tochtergesellschaften,<br />
logistische Gründe, hygienische Gründe, fehlende Kompetenz, umlagef<strong>in</strong>anzierte ZVK,<br />
Risikom<strong>in</strong>imierung, flexibleres Wirtschaften, mehr Eigenverantwortlichkeit, bessere Möglichkeiten<br />
zur Betriebsübernahme, AVR DW EKD s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>akonischer, weil niedriger als <strong>di</strong>e AVR Wü, Erhalt der<br />
Arbeitsplätze, Platzierung am Markt außerhalb der Diakonie, "Insourc<strong>in</strong>g", tarifliche Gründe, mit der<br />
Zeit gehen, Wettbewerbsvorteile, Marktorientierung, Konzentration auf das Kerngeschäft, Eröffnung<br />
<strong>und</strong> Marktetablierung erleichtern <strong>und</strong> Arbeitsentlastung.<br />
Abbildung 11<br />
Welche Abweichungen gibt es, falls sich <strong>di</strong>e AVR nicht am TVöD orientieren (n=22, Mehrfachnennungen<br />
möglich)?<br />
1. E<strong>in</strong>gruppierungssystematik 9<br />
2. Entgelttabellen 8<br />
3. Wochenarbeitszeit 5<br />
4. AVR DWBO 5<br />
5. AVR DW EKD 3<br />
6. Höhergruppierung 3<br />
7. Zulagen 3<br />
8. Überst<strong>und</strong>en 2<br />
Abbildung 12<br />
Mit e<strong>in</strong>er Nennung wurden Übergangsregelungen <strong>und</strong> Besitzstandswahrung genannt: s<strong>in</strong>d schlechter<br />
geregelt, <strong>in</strong>sgesamt schlechter <strong>und</strong> KTD hat e<strong>in</strong>e andere Gr<strong>und</strong>struktur genannt.<br />
107
Abbildung 13<br />
In 67% der Fälle <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e Mitarbeit der Gewerkschaft nicht akzeptiert wird, beruft man sich auf<br />
allgeme<strong>in</strong>e kirchenrechtliche Begründungen. Le<strong>di</strong>glich 33% der Befragten geben an, dass <strong>di</strong>e Mitarbeit<br />
der Gewerkschaften unerwünscht sei (n=45).<br />
108
II. Lohndump<strong>in</strong>g <strong>in</strong> der Diakonie? Zur Bezahlung der Mitarbeitenden. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Umfrage<br />
109
Das Diakonische Werk Württemberg hat e<strong>in</strong>e Umfrage unter se<strong>in</strong>en Mitgliedern <strong>in</strong> Württemberg<br />
durchgeführt. 52 Träger, <strong>di</strong>e 88 Prozent der Mitarbeitenden repräsentieren, haben sich an der Umfrage<br />
beteiligt. (S. 1)<br />
Mitarbeitende bei Trägern <strong>di</strong>akonischer Arbeit<br />
Diese Service-GmbHs <strong>und</strong> <strong>di</strong>e <strong>Leiharbeit</strong>sfirmen werden <strong>in</strong> der Öffentlichkeit auch als <strong>di</strong>akonische<br />
Unternehmen angesehen, was sie eigentlich nicht s<strong>in</strong>d. Wenn wir trotzdem all <strong>di</strong>e Mitarbeitenden<br />
zusammenzählen, dann kommen wir zu folgendem Ergebnis:<br />
- 40.000 Mitarbeitende s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Württembergischen Diakonie <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonischer Trägerschaft<br />
oder von ausgegründeten GmbHs beschäftigt.<br />
- 37.500 Mitarbeitende – also 94 Prozent – s<strong>in</strong>d nach kirchlich-<strong>di</strong>akonischem Arbeitsrecht angestellt.<br />
- 424 Mitarbeitende – also e<strong>in</strong> Prozent – s<strong>in</strong>d <strong>Leiharbeit</strong>ende, <strong>di</strong>e im Regelfall nach dem Pr<strong>in</strong>zip<br />
Equalpay bezahlt s<strong>in</strong>d.<br />
- 2.000 Mitarbeitende – also 5 Prozent – s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Service-GmbHs beschäftigt, bei denen <strong>in</strong> 90<br />
Prozent der Fälle nach e<strong>in</strong>em Tarif bezahlt wird, der sich an e<strong>in</strong>en mit e<strong>in</strong>er DGB-<br />
Gewerkschaft ausgehandelten Tarifvertrag anlehnt. (S. 2)<br />
In demselben Infoblatt äußert sich Thilo Rentschler, Vorsitzender der Kommission für Unternehmensfragen<br />
<strong>und</strong> Tarifpolitik im Diakonischen Werk Württemberg, zum Thema: „Service GmbHs – muss<br />
das se<strong>in</strong>?“<br />
- Herr Rentschler, warum gibt es Service-GmbHs?<br />
Viele Unternehmen von Kommunen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen der öffentlichen Hand haben sich <strong>in</strong><br />
den vergangenen Jahren von ihren Regie-, Hilfs- <strong>und</strong> Nebenbetrieben komplett getrennt. E<strong>in</strong>richtungen<br />
der Württembergischen Diakonie haben <strong>di</strong>eses klassische Outsourc<strong>in</strong>g nicht <strong>in</strong><br />
gleicher Weise betrieben wie <strong>di</strong>e freie Wirtschaft <strong>und</strong> viele öffentliche Träger. Stattdessen haben<br />
sie <strong>di</strong>ese Aufgaben eigenen <strong>di</strong>akonienahen Servicegesellschaften übertragen.<br />
- Warum werden <strong>di</strong>ese Aufgaben an Service-GmbHs übertragen?<br />
Die Service-GmbHs bleiben als ‚Tochterfirmen’ <strong>in</strong> enger <strong>Ver</strong>netzung mit der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong><br />
E<strong>in</strong>richtung. Damit ist für das <strong>di</strong>akonische Unternehmen <strong>di</strong>e Organisation, Mitarbeitersituation<br />
<strong>und</strong> <strong>di</strong>e Arbeitsrechtsregelung <strong>in</strong> den Servicebereichen transparent. Ebenso s<strong>in</strong>d gesicherte<br />
<strong>und</strong> faire <strong>Ver</strong>tragsbeziehungen zwischen Dienstleistern <strong>und</strong> Kernbetrieb möglich. Es können<br />
dort auch Mitarbeitende angestellt werden, <strong>di</strong>e sonst wenig Chancen auf dem allgeme<strong>in</strong>en Arbeitsmarkt<br />
haben. Bis zu 2.000 Arbeitsplätze konnten so bei Servicegesellschaften von <strong><strong>di</strong>akonischen</strong><br />
Trägern e<strong>in</strong>gerichtet werden.<br />
- Warum werden sie nicht nach kirchlich-<strong>di</strong>akonischem Arbeitsrecht bezahlt?<br />
Offiziell ist bei <strong>Ver</strong>handlungen über Pflegesätze <strong>di</strong>e kirchliche Tarifb<strong>in</strong>dung zu berücksichtigen.<br />
Doch <strong>di</strong>e Erfahrungen zeigen: Die vollstän<strong>di</strong>ge Anerkennung der höheren Kosten durch<br />
kirchliche Tarifb<strong>in</strong>dung können oft nicht ref<strong>in</strong>anziert werden. Es gibt für Mitarbeitende im Bereich<br />
von Re<strong>in</strong>igung, Küchen etc. extra Tarifverträge, <strong>di</strong>e mit Gewerkschaften ausgehandelt<br />
wurden. Viele Konkurrenten der Diakonie wenden <strong>di</strong>esen an <strong>und</strong> können damit ihre Leistungen<br />
deutlich günstiger anbieten. Deshalb haben <strong>di</strong>akonische Träger nur drei Möglichkeiten,<br />
wenn sie auf dem Markt konkurrenzfähig se<strong>in</strong> <strong>und</strong> nicht dauerhaft rote Zahlen schreiben wollen:<br />
- Sie müssen höhere Pflegesätze aushandeln, was derzeit angesichts der desolaten öffentlichen<br />
Haushaltslage fast nicht möglich ist.<br />
- Sie gründen eigene Service-GmbHs, <strong>in</strong> denen etwas günstigere Branchentarifverträge angewandt<br />
werden <strong>und</strong> können so <strong>di</strong>e Arbeitssituation der Mitarbeitenden positiv bee<strong>in</strong>flussen.<br />
110
- Sie kaufen <strong>di</strong>ese Leistungen von privaten Firmen e<strong>in</strong>. Sie haben dann aber ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss<br />
mehr auf <strong>di</strong>e Gestaltung des Arbeitsbereichs. (S. 2)<br />
Quelle: „Ihr gutes Recht“. Infoblatt für <strong>di</strong>e Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter der Württembergischen<br />
Diakonie. Ausgabe Frühjahr 2011.<br />
III. Beispiel Arbeitsvertrag<br />
111
Arbeitsvertrag<br />
zwischen der XXX GmbH (im Folgenden Gesellschaft genannt)<br />
<strong>und</strong><br />
NN<br />
Präambel<br />
Die Gesellschaft ist dem Auftrag verpflichtet, das Evangelium <strong>in</strong> Wort <strong>und</strong> Tat zu bezeugen. In der<br />
Erfüllung <strong>di</strong>eses Auftrages ist sie Teil der Diakonie als Lebens- <strong>und</strong> Wesensäußerung der Kirche <strong>und</strong><br />
Mitglied des Diakonischen Werkes Schleswig-Holste<strong>in</strong> – Landesverband der Inneren Mission e.V.<br />
§ 1 E<strong>in</strong>trittsdatum<br />
Frau N tritt am 01.01.2007 als Altenpfleger<strong>in</strong> <strong>in</strong> den Dienst der Gesellschaft. Die ersten 6 Monate der<br />
Beschäftigung gelten als Probezeit. In <strong>di</strong>eser Zeit kann der Arbeitsvertrag mit e<strong>in</strong>er Frist von 2 Wochen<br />
zum Ende e<strong>in</strong>es Kalendertages gekün<strong>di</strong>gt werden.<br />
§ 2 Arbeitszeit / Dienstort<br />
Die Arbeitszeit beträgt 75% <strong>und</strong> damit 30,0 St<strong>und</strong>en pro Woche. Frau N kann <strong>in</strong> sämtlichen Betriebsstätten<br />
des Arbeitgebers e<strong>in</strong>gesetzt <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>esen beschäftigt werden.<br />
§ 3 <strong>Ver</strong>gütung<br />
Als <strong>Ver</strong>gütung für <strong>di</strong>e Tätigkeit erhält Frau N e<strong>in</strong> monatliches Bruttogehalt von<br />
Euro 1.481,25<br />
In Worten: E<strong>in</strong>tausendvierh<strong>und</strong>erte<strong>in</strong><strong>und</strong>achzig Euro zahlbar jeweils zum Monatsende.<br />
Es ist mit Frau N vere<strong>in</strong>bart, über das Gehalt Stillschweigen zu bewahren. Die Zahlung erfolgt bargeldlos<br />
auf e<strong>in</strong> Konto e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>län<strong>di</strong>schen Kre<strong>di</strong>t<strong>in</strong>stituts. Die im Rahmen der Tätigkeit geleisteten <strong>und</strong><br />
nicht schriftlich angeordneten Mehrarbeits- <strong>und</strong> Überst<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d mit dem Gehalt nach § 3 abgegolten.<br />
E<strong>in</strong> darüber h<strong>in</strong>ausgehender Anspruch besteht ausdrücklich nicht.<br />
§ 4 Erfolgsbeteiligung<br />
In Abhängigkeit des Geschäftsergebnisses der Gesellschaft kann nach Maßgabe der Geschäftsführung<br />
e<strong>in</strong>e Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter erfolgen. Die Höhe <strong>di</strong>eser Erfolgsbeteiligung beträgt bis zu<br />
112
50% des vere<strong>in</strong>barten monatlichen Entgeltes. Bei <strong>di</strong>eser Leistung handelt es sich ausdrücklich um e<strong>in</strong>e<br />
freiwillige Leistung, auf <strong>di</strong>e auch bei mehrmaliger Zahlung ke<strong>in</strong> Rechtsanspruch besteht.<br />
§ 5 Urlaub<br />
Frau N hat kalenderjährlich e<strong>in</strong>en Anspruch auf 26 Urlaubstage (5-Tage-Woche). Bei e<strong>in</strong>er abweichenden<br />
Anzahl von Arbeitstagen pro Woche ist der Anspruch umzurechnen. Dabei wird kaufmännisch<br />
ger<strong>und</strong>et.<br />
Als Urlaubstage zählen alle Kalendertage mit Ausnahme der Sonntage, der gesetzlichen Feiertage <strong>und</strong><br />
der arbeitsfreien Sonnabende. Im Jahr des E<strong>in</strong>tritts <strong>und</strong> Austritts bei der Gesellschaft wird anteiliger<br />
Jahresurlaub gewährt. Dabei f<strong>in</strong>den nur volle Monate der Betriebszugehörigkeit Berücksichtigung.<br />
Die zeitliche Lage des Erholungsurlaubes wird im Rahmen der für jedes Jahr neu getroffenen Urlaubsvere<strong>in</strong>barung<br />
unter Berücksichtigung betrieblicher Belange festgelegt. Persönliche Term<strong>in</strong>wünsche<br />
werden berücksichtigt, sofern <strong>di</strong>e betrieblichen Belange <strong>di</strong>es zulassen.<br />
Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt <strong>und</strong> genommen werden. Für <strong>di</strong>e Übertragung<br />
von Urlaub <strong>in</strong> das Folgejahr gilt das B<strong>und</strong>esurlaubsgesetz <strong>in</strong> der jeweils gültigen Fassung.<br />
E<strong>in</strong> Anspruch auf Abgeltung des Urlaubes besteht nur, wenn der Urlaub wegen Been<strong>di</strong>gung des Arbeitsverhältnisses<br />
ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann.<br />
§ 6 Zusätzliche Altersversorgung<br />
Der Arbeitgeber beteiligt sich am Aufbau e<strong>in</strong>er zusätzlichen Altersversorgung für den Mitarbeiter. Die<br />
durch den Arbeitgeber zu übernehmenden Leistungen s<strong>in</strong>d auf maximal 2% der monatlichen <strong>Ver</strong>gütung<br />
aus § 3 begrenzt.<br />
§ 7 Arbeitsunfähigkeit<br />
Bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gelten <strong>di</strong>e jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Lohnfortzahlungen<br />
über das Ende des Arbeitsverhältnisses h<strong>in</strong>aus werden nicht gewährt. Der Anspruch auf<br />
Lohnfortzahlung entsteht nach 4-wöchiger ununterbrochender Dauer des Arbeitsverhältnisses.<br />
§ 8 Schadenersatz<br />
Soweit Herr (sic.!) N aufgr<strong>und</strong> gesetzlicher Vorschriften von Dritten Ersatz e<strong>in</strong>es Schaden beanspruchen<br />
kann, der ihm durch Krankheit, Unfall oder Invali<strong>di</strong>tät entstanden ist, gilt als vere<strong>in</strong>bart, dass der<br />
Anspruch <strong>in</strong>soweit im Augenblick der Entstehung auf <strong>di</strong>e Gesellschaft übergeht, als sie dem Entschä<strong>di</strong>gungsberechtigten<br />
nach dem Vorstehenden Leistungen gewährt.<br />
§ 9 <strong>Ver</strong>pflichtungen<br />
Herr (sic.!) N verpflichtet sich se<strong>in</strong>en Dienst gewissenhaft zu erfüllen. Er hat sich so zu verhalten, wie<br />
es von Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen im kirchlichen <strong>und</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Dienst erwartet wird.<br />
Frau N verpflichtet sich, alle während der Dauer <strong>di</strong>eses <strong>Ver</strong>trags entstehenden Aufzeichnungen über<br />
geschäftliche Angelegenheiten bei ihrem Ausscheiden vollstän<strong>di</strong>g herauszugeben <strong>und</strong> über alle ihr<br />
während ihres Anstellungsverhältnisses bei der Gesellschaft zur Kenntnis gelangten Geschäftsgeheimnissen<br />
unbed<strong>in</strong>gtes Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach Been<strong>di</strong>gung des Arbeitsverhältnisses.<br />
113
Geschenke <strong>und</strong> Belohnungen <strong>in</strong> Bezug auf <strong>di</strong>enstliche Tätigkeit darf Frau N ausdrücklich nicht entgegennehmen.<br />
§ 10 Nebentätigkeiten<br />
Frau N wird ihre ganze Arbeitskraft <strong>und</strong> alle ihre Kenntnisse <strong>in</strong> den Dienst der Gesellschaft stellen.<br />
Sie darf anderweitig ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Gesellschaft weder für eigene<br />
noch für fremde Rechnung e<strong>in</strong>er auf Gew<strong>in</strong>n gerichteten Tätigkeit nachgehen.<br />
<strong>Ver</strong>öffentlichungen <strong>und</strong> Vorträge über das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft s<strong>in</strong>d ohne Genehmigung<br />
der Gesellschaft nicht gestattet.<br />
Es werden folgende Zeitzuschläge gewährt:<br />
§ 11 Zeitzuschläge<br />
1. Für Nacharbeit (sic.!) im S<strong>in</strong>ne des Arbeitszeitgesetzes <strong>in</strong> der jeweils gültigen Fassung wird e<strong>in</strong><br />
Zuschlag von € 1,28 brutto pro St<strong>und</strong>e gewährt.<br />
§ 12 Been<strong>di</strong>gung des Dienstverhältnisses / Kün<strong>di</strong>gung<br />
Dieser <strong>Ver</strong>trag tritt am 01.01.2007 <strong>in</strong> Kraft. Es gilt beiderseitig <strong>di</strong>e gesetzliche Kün<strong>di</strong>gungsfrist.<br />
Das Anstellungsverhältnis mit Frau N endet, soweit e<strong>in</strong>e Auflösung oder Aufhebung nicht aus irgendwelchen<br />
anderen Gründen bereits früher erfolgt ist, spätestens aber, sobald Frau N Anspruch auf ungekürzte<br />
Leistungen des zustän<strong>di</strong>gen Rentenversicherungsträgers hat, ohne dass es e<strong>in</strong>er Kün<strong>di</strong>gung<br />
bedarf.<br />
§ 13 Nebenabreden / Gerichtsstand<br />
Dieser <strong>Ver</strong>trag unterliegt ke<strong>in</strong>er tariflichen B<strong>in</strong>dung.<br />
Zusätze <strong>und</strong> Abänderungen <strong>di</strong>eses <strong>Ver</strong>trages bedürfen der Schriftform. Nebenabreden <strong>in</strong> anderer Form<br />
s<strong>in</strong>d unwirksam. Die Gesellschaft behält sich vor, Frau N im Rahmen des Unternehmens auch e<strong>in</strong>e<br />
andere, ihrer Vorbildung <strong>und</strong> ihren Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit zu übertragen, wenn <strong>di</strong>es aus<br />
geschäftlichen bzw. betrieblichen Gründen erforderlich ist.<br />
Frau N verpflichtet sich, arbeitsme<strong>di</strong>z<strong>in</strong>ische Untersuchungen auf Weisung der Gesellschaft <strong>und</strong> auf<br />
Gr<strong>und</strong> gesetzlicher Bestimmungen <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>ordnungen durchführen zu lassen.<br />
Sollte e<strong>in</strong>e Bestimmung <strong>di</strong>eses <strong>Ver</strong>trages unwirksam se<strong>in</strong>, wird dadurch <strong>di</strong>e Gültigkeit des übrigen<br />
<strong>Ver</strong>trags<strong>in</strong>haltes nicht berührt.<br />
Gerichtsstand für alle sich aus <strong>di</strong>esem Anstellungsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Flensburg.<br />
114
IV. Überblickskarte: Tarife <strong>in</strong> der Diakonie<br />
115