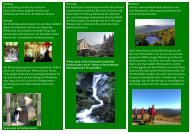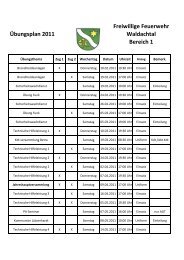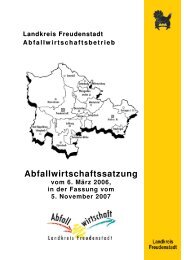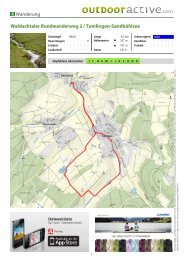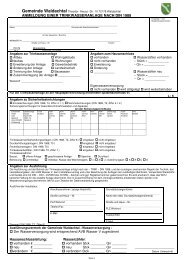Sitzungsvorlage - Waldachtal
Sitzungsvorlage - Waldachtal
Sitzungsvorlage - Waldachtal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forsteinrichtungs-Stichtag: 01.01.2012<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong><br />
zur<br />
Örtlichen Prüfung der<br />
Forsteinrichtungserneuerung<br />
2012 – 2021<br />
Gemeinde <strong>Waldachtal</strong><br />
am 12.06.2012
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Vorbemerkung<br />
Nach dem Landeswaldgesetz und der Körperschaftswaldverordnung für Baden-<br />
Württemberg ist für den öffentlichen Wald alle 10 Jahre eine mittelfristige Betriebsplanung<br />
durchzuführen. Die Forsteinrichtungsplanung stellt die Planungs- und Arbeitsgrundlage für<br />
den Forstbetrieb in den nächsten 10 Jahren dar.<br />
Der Waldbesitzer bestimmt im Rahmen des Landeswaldgesetzes die Ziele der<br />
Waldbewirtschaftung („Eigentümerzielsetzung“), die Forsteinrichtung setzt diese<br />
Zielvorgaben an jedem Waldort planerisch um.<br />
Die Gemeinde <strong>Waldachtal</strong> hat folgende Ziele zur Entwicklung des Gemeindewaldes<br />
für die Forsteinrichtung der Jahre 2012 – 2021 formuliert :<br />
A Hauptziele der Gemeindewaldwirtschaft :<br />
die Erhaltung der Waldfläche und des Waldvermögens<br />
die nachhaltige Gewährleistung der Waldfunktionen im Sinne eines größtmöglichen<br />
Gesamtnutzens für Bevölkerung, Umwelt und regionale Wirtschaft.<br />
Für alle Maßnahmen gilt das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Auftretende Zielkonflikte werden<br />
nicht zu Lasten der Nachhaltigkeit oder der ökologischen Ausgewogenheit gelöst. Der<br />
Wald leistet einen möglichst hohen Beitrag zur CO2 Bilanz.<br />
Die Waldbewirtschaftung erfolgt seit Oktober 2002 nach den Kriterien der PEFC-<br />
Zertifizierung<br />
(Das deutsche PEFC-System („Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes“)<br />
zur Zertifizierung<br />
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung basiert auf den Vorgaben des „PEFC Council Technical<br />
Document“, das von der Generalversammlung des PEFCC am 22. November 2002 verabschiedet wurde,<br />
in der jeweils gültigen Fassung.)<br />
B Einzelziele :<br />
1. Waldbauliche Ziele<br />
1.1 Grundlage allen waldbaulichen Handelns ist die naturnahe Waldwirtschaft, d.h. der<br />
Aufbau, die Pflege und die Erhaltung gemischter, strukturreicher, ungleichaltriger und<br />
stabiler Waldbestände aus standortangepassten Baumarten.<br />
1.2 Natürliche Verjüngungsmöglichkeiten sind zu nutzen und zu fördern. Wichtige<br />
Voraussetzung dafür ist eine dauerhafte Anpassung der Rehwildbestände.<br />
1.3 Notwendige Pflegeeingriffe erfolgen in nutzbaren Beständen durch Holzernte<br />
(Durchforstung) mit anschließender Schlagpflege, oder in jüngeren Wäldern durch<br />
intensive bestandesstabilisierende Jungbestandspflegemaßnahmen.<br />
1.4 In entsprechend geeigneten, stabilen Beständen ist die Wertästung der Tanne zum<br />
langfristigen Aufbau wertholzreicher Vorräte zu planen und durchzuführen.<br />
1.5 Der Laubholzanteil soll langfristig auf mindestens 20 % angehoben werden.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: II 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
2. .Ziele für die Waldarbeit<br />
2.1 Arbeitssicherheit, Bestandes- und Bodenpfleglichkeit sowie Wirtschaftlichkeit sind die<br />
Hauptkriterien für die Waldarbeit. Daran orientieren sich zeitlichen Abläufe ebenso wie<br />
die Verfahrenswahl und der Modus der Auftragsvergabe.<br />
2.2 Die Gemeinde <strong>Waldachtal</strong> beschäftigt eigene qualifizierte Forstwirte und sichert so<br />
Arbeitsplätze. Die Forstwirte kommen auch in anderen Betriebsteilen (Bauhof) sowie in<br />
anderen Forstbetrieben zum Einsatz.<br />
2.3 Die Gemeinde unterhält keine eigenen Forstmaschinen und strebt dies auch nicht an.<br />
Stattdessen bevorzugt sie die Zusammenarbeit mit geeigneten regionalen<br />
Unternehmern.<br />
2.4 Zur Vermeidung flächiger Befahrungsschäden ist ein angemessenes<br />
Feinerschließungsnetz anzulegen; das flächige Befahren der Wälder ist verboten<br />
3. Waldschutz<br />
3.1 Auf die Verwendung von Pestiziden wird generell verzichtet. Sie ist nur in<br />
Ausnahmefällen bei drohenden Borkenkäferkatastrophen möglich.<br />
3.2 Zum Schutz des gefährdeten Holzes unterhält die Gemeinde ein Nasslager, für das<br />
auch die Holzeinlagerung von anderen Waldbesitzern angestrebt wird.<br />
3.3 Insektizidausbringung durch Dritte (z.B. durch Holzkäufer) ist untersagt.<br />
4. Biotop- und Naturschutz<br />
4.1 Bei der Waldwirtschaft sind Gesichtspunkte des Arten- und Biotopschutzes zu<br />
berücksichtigen und der Aufbau standortsgerechter, vielseitiger, stufiger und stabiler<br />
Waldbestände anzustreben.<br />
4.2 Wo möglich, sollen arten- und abwechslungsreiche Waldränder aufgebaut werden.<br />
4.3 Bestehende Biotope sind zu erhalten und zu pflegen, ggf. neue Biotopflächen im<br />
Rahmen einer örtlichen Biotopvernetzung zu schaffen.<br />
4.4 Wenn Verkehrssicherungsaspekte und Arbeitssicherheit es erlauben, sollen an<br />
geeigneten Stellen Altholzinseln ausgewiesen und vorhandenes Totholz belassen<br />
werden.<br />
4.5 Bei der Baumartenwahl und Waldpflege sind aktuelle Erkenntnisse über die Folgen<br />
des Klimawandels zu berücksichtigen. Anzustreben ist eine größere Vielfalt<br />
einheimischer und standortsangepasster Baumarten in Mischbeständen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: III 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
5. Erholung und Tourismus<br />
5.1 Walderholung und Tourismus haben im Gemeindewald einen besonderen<br />
Stellenwert, der bei der Waldbewirtschaftung als wichtige Zielsetzung berücksichtigt<br />
wird.<br />
5.2 Im Rahmen des gesetzlich garantierten Betretensrechts bietet der gesamte<br />
Gemeindewald den Erholungssuchenden Entspannung und Naturerfahrung.<br />
5.3 Markierte Wanderwege, Rundwege, Laufstrecken sowie Radwege stärken die<br />
Erholungsfunktion; sie dienen aber auch forstwirtschaftlichen Maßnahmen und<br />
können daher vorübergehend in ihrer Erholungsnutzung eingeschränkt werden.<br />
Der Wellnesswald in Hörschweiler ist als wichtiger Erholungsschwerpunkt<br />
entsprechend zu erhalten und zu pflegen; Waldwirtschaft und Holzproduktion<br />
5.4 erfolgen auch hier auf der ganzen Holzbodenfläche unter ganz besonderer<br />
Berücksichtigung der Erholungsfunktion.<br />
6. Betriebsvollzug und Wirtschaftlichkeit<br />
Der Gemeindewald finanziert sich vor allem aus dem Verkauf marktgerecht aufbereiteten<br />
Rundholzes. Angestrebt werden unter Beachtung aller vorgenannten Ziele<br />
eine nachhaltig hohe Wertschöpfung<br />
möglichst hohe Deckungsbeiträge zugunsten des Verwaltungshaushaltes<br />
An die Betriebs- und Revierleitung bestehen deshalb folgende Erwartungen:<br />
6.1 Ausschöpfen standörtlicher Produktionskapazitäten durch stabile, vorratsreiche<br />
Bestände mit möglichst hohen Anteilen wertvollen Starkholzes gemäß den Prinzipien<br />
naturnaher Waldwirtschaft.<br />
6.2 Offensive, flexible Präsenz am Rundholzmarkt unter Berücksichtigung der örtlichen<br />
und regionalen Nachfrage.<br />
6.3 Weitgehendes Vermeiden von Fäll-, Rücke- und Bodenschäden durch pflegliche<br />
Waldarbeit.<br />
6.4 Vermeiden von unnötigem Aufwand vor allem durch biologische Automation, wo<br />
immer die betrieblichen Ziele durch natürliche, walddynamischen Prozesse erreichbar<br />
sind.<br />
6.5 Effizienter und flexibler Betriebsvollzug gemäß dem Stand der Technik und der<br />
Wissenschaft inklusive regelmäßiger Erfolgskontrollen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: IV 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Die Forsteinrichtung ist durch einen dreiteiligen Verfahrensablauf gekennzeichnet: Nach<br />
der Erfassung des aktuellen Zustandes (Inventur) werden die durchgeführten Maßnahmen<br />
des abgelaufenen Forsteinrichtungszeitraums (Vollzug) gewürdigt. Darauf aufbauend<br />
werden die konkreten Planungen für die kommenden 10 Jahre entwickelt.<br />
Das Forsteinrichtungswerk stellt einen fachlichen Vorschlag dar, über den die Gemeinde<br />
<strong>Waldachtal</strong> als Waldeigentümerin entscheidet.<br />
Dies geschieht im Rahmen einer Örtlichen Prüfung, an welcher seitens der Waldbesitzers<br />
Bürgermeister Heinz Hornberger und der Gemeinderat, seitens der Forstverwaltung von<br />
der Forstdirektion des Regierungspräsidiums Freiburg der Forsteinrichter Richard Koch,<br />
sowie von der Unteren Forstbehörde des Kreisforstamts Freudenstadt Dieter Zuleger und<br />
Revierleiter Ferdinand Schorpp teilnehmen.<br />
Die Forsteinrichtungserneuerung zum Stichtag 01.01.2012 erfolgt auf Grundlage der<br />
nachhaltigen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes für den Zeitraum 2012 - 2021. Sie ist<br />
Bestandteil der forsttechnischen Betriebsleitung des Landes für die Gemeinden und damit<br />
kostenfrei<br />
Im Rahmen dieser Forsteinrichtung wurde kein Alt- und Totholzkonzept und kein<br />
Pflegeprogramm aus Naturschutzgründen planerisch festgelegt, da bisher nicht feststeht,<br />
unter welchen Bedingungen kommunalen Waldbesitzern ein Nutzungsverzicht oder ein<br />
Pflegeprogramm als naturschutzrechtliche Ausgleichsleistung, zum Beispiel in Form von<br />
Ökopunkten, anerkannt wird.<br />
Folgende Flächen mit insgesamt rund 1,0 ha erscheint für Maßnahmen für ein Ökokonto<br />
der Gemeinde besonders geeignet :<br />
Betrieb BKL/Distr./Abt. Bestand Best.fläche ha<br />
16 1 / 2 / 1 y W 1,0 1,0<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: V 13.06.12<br />
(ha)<br />
Σ Waldorte 1,0 1,0<br />
Bei Bedarf sollte die Gemeinde entsprechende Verhandlungen mit der<br />
Naturschutzverwaltung führen.
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Hauptziele der Gemeindewaldwirtschaft :............................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.<br />
B Einzelziele I<br />
1. Waldbauliche Ziele<br />
2. .Ziele für die Waldarbeit......................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.<br />
3. Waldschutz ............................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.<br />
4. Biotop- und Naturschutz ........................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.<br />
5. Erholung und Tourismus ....................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.<br />
A. Waldzustand..................................................................................................................................... 8<br />
A.1 Waldfläche........................................................................................................................................ 8<br />
A.1.1 Flächenveränderungen (ha) .................................................................................................... 8<br />
A.1.2 Flächenveränderungen der Holzbodenfläche (ha) 1879 bis 2012 .......................................... 8<br />
A.2 Waldfunktionen und Waldbiotope .................................................................................................... 9<br />
A.2.1 Waldfunktionen........................................................................................................................ 9<br />
A.2.2 Waldbiotope........................................................................................................................... 10<br />
A.2.3 Natura 2000/ FFH- Gebiete ................................................................................................... 10<br />
A.3 Erholungseinrichtungen (Stand 2012)............................................................................................ 11<br />
A.4 Standörtliche Grundlagen............................................................................................................... 12<br />
A.4.1 Standortsbilanz...................................................................................................................... 12<br />
A.5 Baumartenverhältnis ...................................................................................................................... 13<br />
A.5.1 Derzeitiges Baumartenverhältnis........................................................................................... 13<br />
A.5.2 Geschichtliche Entwicklung Baumartenverhältnis 1959 bis 2012 ......................................... 13<br />
A.5.3 Qualitative Kurz- Bewertung der Baumarten......................................................................... 14<br />
A.6 Klimadiskussion.............................................................................................................................. 15<br />
A.6.1 Derzeit erwartete Folgen einer Klimaerwärmung.................................................................. 15<br />
A.6.2 Reaktionsmöglichkeiten des Forstbetriebs auf Klimaerwärmung ......................................... 15<br />
A.7 Waldentwicklungstypen.................................................................................................................. 15<br />
A.8 Vorrat und Zuwachsleistung........................................................................................................... 17<br />
A.8.1 Holzvorratsveränderung ........................................................................................................ 17<br />
A.8.2 Wuchsleistung ....................................................................................................................... 17<br />
A.9 Altersaufbau des Gemeindewaldes ............................................................................................... 17<br />
A.9.1 Altersklassenverteilung.......................................................................................................... 17<br />
A.9.2 Baumartenflächen nach Altersklassen und Entwicklungsphasen in ha ................................ 18<br />
A.9.3 Normalverteilung der Altersklassen....................................................................................... 18<br />
A.10 Naturverjüngung unter Schirm................................................................................................... 19<br />
A.10.1 Verjüngungsvorrat nach Baumarten...................................................................................... 19<br />
B. Betriebsvollzug im abgelaufenen Jahrzehnt - ................................................................................ 20<br />
B.1 Holzeinschlag ................................................................................................................................. 20<br />
B.1.1 Hiebsergebnisse.................................................................................................................... 20<br />
B.1.2 Vornutzung und Hauptnutzung.............................................................................................. 20<br />
B.1.3 Hiebsergebnisse im Verlauf des vergangenen Einrichtungsjahrzehnts................................ 21<br />
B.1.4 Anteil Planmäßiger Hiebe und Zufälliger Nutzungen ............................................................ 21<br />
B.2 Verjüngungszugänge, Kulturen -.................................................................................................... 22<br />
B.2.1 Verjüngungszugang............................................................................................................... 22<br />
B.2.2 Pflanzenverbrauch................................................................................................................. 22<br />
B.3 Bestandespflege, Ästungen ........................................................................................................... 23<br />
B.3.1 Bestandespflege.................................................................................................................... 23<br />
B.3.2 Ästung.................................................................................................................................... 23<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: VI 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B.3.3 Ästung nach Baumarten ........................................................................................................ 23<br />
B.4 Maßnahmen zur Wildschadensverhütung...................................................................................... 24<br />
B.5 Erschließung .................................................................................................................................. 24<br />
B.6 Betriebswirtschaftliche Ergebnisse ................................................................................................ 24<br />
B.6.1 Finanzielles Ergebnis ............................................................................................................ 24<br />
B.6.2 Entwicklung des finanziellen Ergebnisses............................................................................. 25<br />
B.6.3 Durchschnittliche Betriebswirtschaftliche Kenndaten............................................................ 25<br />
C. Planung .......................................................................................................................................... 26<br />
C.1 Hiebssatz........................................................................................................................................ 26<br />
C.1.1 Hiebssatz............................................................................................................................... 26<br />
C.1.2 Nutzungsmaßnahmen ........................................................................................................... 26<br />
C.1.3 Entwicklung von Hiebsatz, Einschlag und Vorrat 1879 bis 2011 .......................................... 27<br />
C.2 Verjüngung ..................................................................................................................................... 28<br />
C.2.1 Verjüngungsmaßnahmen ...................................................................................................... 28<br />
C.2.2 Geplante Verjüngungsziele des AKl-Waldes nach Baumarten............................................. 28<br />
C.3 Sonstige Planung (Ästung, Wegebau)........................................................................................... 29<br />
C.3.1 Jungbestandspflege .............................................................................................................. 29<br />
C.3.2 Ästung.................................................................................................................................... 29<br />
C.3.3 Wegebau und Feinerschließung............................................................................................ 29<br />
C.3.4 Kalkung.................................................................................................................................. 29<br />
C.4 Holzverkauf .................................................................................................................................... 29<br />
C.5 Waldarbeit ...................................................................................................................................... 30<br />
C.6 Ausblick auf die betriebswirtschaftliche Entwicklung ..................................................................... 30<br />
C.7 Anhang 1, Wildverbiss im Spiegel der Forsteinrichtungswerke 1981 bis 2012 ............................. 31<br />
C.7.1 Forsteinrichtung 1981............................................................................................................ 31<br />
C.7.2 Forsteinrichtung 1992............................................................................................................ 31<br />
C.7.3 Forsteinrichtung 2002............................................................................................................ 33<br />
C.7.4 Niederschrift Zwischenrevision 2006..................................................................................... 33<br />
D. Erläuterung von Begriffen aus der Forsteinrichtung ...................................................................... 36<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: VII 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A. Waldzustand<br />
A.1 Waldfläche<br />
A.1.1 Flächenveränderungen (ha)<br />
Forsteinrichtungsstichtag<br />
Forstliche<br />
Betriebs-<br />
fläche<br />
Forstliche Betriebsfläche Holzbodenfläche<br />
(Wirtschaftswald)<br />
Holzboden- Nichtholzbodenfläche<br />
fläche insgesamt (davon BW)<br />
AKl-Wald DauerWald<br />
01.01.2002 676,2 654,5 21,7 (0,0) 614,1 40,4<br />
01.01.2012 667,1 643,1 24,0 (0,0) 599,1 43,9<br />
Differenz - 9,1 - 11,4 + 2,3 (0,0) -15,0 +3,5<br />
Mehrere kleinere Zu- und Abgänge.<br />
Größerer Abgang an die Stiftung Altheim als Ausgleich für geplante Steinbrucherweiterung.<br />
Abgang von Holzbodenfläche an Wellnesswald<br />
Weitere Arrondierungen mit Staats-, Privat- und Spitalwald wären dringend wünschenswert, sofern<br />
sich entsprechende Möglichkeiten ergeben.<br />
A.1.2 Flächenveränderungen der Holzbodenfläche (ha) 1879 bis 2012<br />
ha<br />
700<br />
650<br />
600<br />
550<br />
500<br />
1879 bis 1929 ohne Cresbach<br />
Entwicklung der Holzbodenfläche<br />
Gemeinde <strong>Waldachtal</strong><br />
1879<br />
1889<br />
1899<br />
1909<br />
1919<br />
1929<br />
1939<br />
1949<br />
1959<br />
1969<br />
1982<br />
1993<br />
2002<br />
2012<br />
Jahr<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite: 8 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.2 Waldfunktionen und Waldbiotope<br />
A.2.1 Waldfunktionen<br />
Schutzwald<br />
Fläche Anteil der Waldfläche<br />
ha %<br />
Bodenschutzwald 0,0 0<br />
Lawinenschutz 0,0 0<br />
Wasser- und Quellschutzgebiete 85,7 13<br />
Klimaschutzwald 0,0 0<br />
Immissions-/Sichtschutzwald 0,0 0<br />
Wald in Schutz- und Erholungsgebieten<br />
Erholungswald Stufe I 0,0 0<br />
Stufe II 271,6 41<br />
Wald in Naturschutzgebieten 15,2 2<br />
Naturdenkmale 0,0 0<br />
Wald in Landschaftsschutzgebieten 132,6 20<br />
Wald im Naturpark 667,1 100<br />
Waldschutzgebiete<br />
Bannwald 0,0 0<br />
Schonwald 0,0 0<br />
Summe 1.172,1 176<br />
Neben der Holzproduktion erfüllt der Gemeindewald auf 1.172,1 ha weitere wichtige Funktionen,<br />
durchschnittlich ist jede Waldfläche 1,7- fach mit Schutzwaldstatus belegt, ohne Berücksichtigung<br />
des Naturparks allerdings nur 0,8- fach, was allerdings landesweit und auch regional eher<br />
unterdurchschnittlich ist. Eine herausragende Rolle spielt der Erholungswald und das<br />
Landschaftsschutzgebiet.<br />
Die übergeordnete Zielsetzung für den Gemeindewald <strong>Waldachtal</strong> ist der höchstmögliche<br />
Gesamtnutzen aus der Summe aller Funktionen, wobei die einzelnen Kriterien sorgfältig<br />
untereinander abgewogen werden müssen. Dieser Abwägungsprozess und die Bemühungen um eine<br />
Optimierung war und ist Grundlage für die Zertifizierung des Gemeindewaldes nach PEFC.<br />
Auf dem überwiegenden Teil der Waldflächen sollen alle Kriterien, sowie die verschiedenen<br />
Funktionen gleichrangig erfüllt und in ihrer Summe optimiert werden.<br />
Unabhängig davon bleibt der Gemeindewald wirtschaftlich ausgerichtet.<br />
Trotzdem ergeben sich in vielen Arbeitsbereichen durch die vorgegebenen Schutzfunktionen,<br />
insbesondere die Erholungsfunktion, zusätzliche Arbeiten und Mehraufwendungen, die sich im<br />
Betriebsergebnis niederschlagen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 9 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.2.2 Waldbiotope<br />
Leitbiotoptyp Anzahl Fläche<br />
absolut in % *1 ha in % *1<br />
Moorbereich / Feuchtbiotop 4 15 0,3 6<br />
Stillgewässer mit Verlandungsbereich 14 54 1,0 19<br />
Fließgewässer m. naturnah.<br />
Begleitvegetation<br />
4 15 0,3 6<br />
Strukturreiche Waldränder 1 4 0,5 10<br />
Wald mit schützenswerten Tierarten 3 12 2,9 58<br />
insgesamt 26 100 5 100<br />
Die Waldbiotopkartierung hat im Gemeindewald 26 Biotope in 6 Biotopgruppen auf insgesamt 9 ha<br />
erfaßt.<br />
Dieser Wert ist unterdurchschnittlich, trotzdem weist der Gemeindewald einen hohen Grad an<br />
Naturnähe auf.<br />
Besondere Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Biotope sind gegenwärtig nicht erforderlich.<br />
In einigen Waldorten werden Neophyten, insbesondere Indisches Springkraut zum Problem, es sollte<br />
dringend bekämpft werden. Da die Verbreitung gegenwärtig noch entlang der Wege stattfindet,<br />
müsste auch chemische Bekämpfung möglich und erfolgreich sein. Ist die Verbreitung einmal auf<br />
der Fläche, erscheint Bekämpfung aussichtslos.<br />
A.2.3 Natura 2000/ FFH- Gebiete<br />
Natürliche Lebensräume, sowie die Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sind nach dem<br />
Konzept NATURA 2000 europaweit geschützt. Natura 2000 umfasst Vogelschutzgebiete und FFH-<br />
Gebiete (FFH- Gebiet = Schutzgebiet gemäß der europäischen Flora- Fauna- Habitat-Richtlinie)<br />
FFH- Fläche insgesamt: 15,0 ha = 2,2 % d. Betriebsfläche<br />
Teile des Gemeindewaldes (II / 1 + 2) liegen im FFH- Gebiet 7516-341, Freudenstädter Heckengäu.<br />
Lebensraumtypen sind nicht ausgewiesen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 10 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.3 Erholungseinrichtungen (Stand 2012)<br />
Einheit<br />
gekennzeichnete Wanderwege km 14<br />
gekennzeichnete Radwanderwege km 13<br />
Waldsportpfade „Gehen hält fit“ km 3<br />
Waldlehrpfade „Krabbenweg“ km 2<br />
Parkplätze Stck 2<br />
Spielplätze Stck 2<br />
Spiel- und Liegewiese ha 1<br />
Schutz- bzw. Grillhütten Stck 3<br />
Rastplätze Stck 1<br />
gekennzeichnete Nordic Walking- Strecke km 5<br />
Aussichtspunkt Stck 1<br />
Kombinierte Erholungsfläche „Wellnesswald“ Stck 1<br />
Sonstige Erholungsfläche „Tumlinger See“ Stck 1<br />
Bau und Unterhaltung der Erholungseinrichtungen erfolgen durch den Bauhof. Sie sind in einem<br />
sehr guten Zustand.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 11 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.4 Standörtliche Grundlagen<br />
A.4.1 Standortsbilanz<br />
Mittlere Sto,<br />
mäßig trocken<br />
17%<br />
ProblemSto,<br />
wechselfeucht<br />
13%<br />
Sehr gute Sto,<br />
frisch<br />
3%<br />
Es liegt eine Standortskartierung aus dem Jahr 1981 vor.<br />
Gute Sto, mäßig<br />
frisch<br />
67%<br />
Der Nord- Westteil des Gemeindewaldes, rund 50 % der Fläche, (Cresbacher und Hörschweiler Wald)<br />
liegt im Wuchsgebebiet Schwarzwald, Einzelwuchsgebiet 3/06, Flächenschwarzwald,<br />
Regionalwaldgesellschaft Montaner Buchen- Tannenwald. Hier herrschen gute<br />
Wachstumsbedingungen für Tanne, Fichte und Buche.<br />
Die Distrikte Salzstetter und Tumlinger Wald liegen im Wuchsgebiet Neckarland, Einzelwuchsbezirk<br />
4/23, Oberer Neckar, Regionalwaldgesellschaft Submontaner Buchen- Tannenwald mit Eiche.<br />
Die jährlichen Niederschläge nehmen von Westen nach Osten ab von durchschnittlich 1.100 mm auf<br />
850 mm, während gleichzeitig die Durchschnittstemperatur steigt von 7,2 ° C auf 7,6 °. Auch die<br />
Vegetationszeit nimmt von West nach Ost zu.<br />
Im Nordwesten des Gemeindewaldes befinden sich Böden aus Buntsandsteinverwitterung, mit sehr<br />
guten Vorraussetzungen für das Wachstum von Tanne und Fichte.<br />
Im Süd- Osten aus bestehen die Böden aus Muschelkalkverwitterung, teilweise mit etwas<br />
Feinlehmbeimischung. Regional bestehen hier gute landwirtschaftliche Voraussetzungen, so dass<br />
der Wald auf landwirtschaftlich weniger günstige Standorte, sowie auf Hanglagen begrenzt ist.<br />
Geringe Niederschläge und schwache Wasserspeicherkapazität der Böden bringen das Nadelholz<br />
auf trockeneren Standorten an die Grenze ihrer Eignung, Fichte ist durch hohen Kalk zusätzlich stark<br />
rotfäulegefährdet. Hier wird die künftige Baumartenzusammensetzung daher im Wesentlichen aus<br />
Tanne und Laubholz (Buche) bestehen, wobei der Laubholzanteil mit abnehmender Wasserkapazität<br />
steigen muß bis hin zu reinen Laubholztypen.<br />
Vernässende Standorte mit sehr hohem Sturmrisiko befinden sich nur auf 2 % der Fläche.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 12 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.5 Baumartenverhältnis<br />
A.5.1 Derzeitiges Baumartenverhältnis<br />
Nadelbäume Holzbodenfläche %<br />
Fichte 36<br />
Weißtanne 48<br />
Douglasie 1<br />
Waldkiefer 3<br />
Sonstige Nadelbäume *1
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.5.3 Qualitative Kurz- Bewertung der Baumarten<br />
- Fichte,<br />
Alle Bestände haben hohe Leistung und gute Qualität (Anteil an Schreinerware, Althölzer vermutlich<br />
teilweise geästet). Die Massen- und Wertleistung der Fichte ist hoch, allerdings nimmt ihre<br />
Bedeutung als bestandesbildende Hauptbaumart im Ostteil weiter ab, weil sie sich hier auf<br />
trockeneren Standorten zunehmend labil erweist (Käfer, Dürre, Sturm). Anbauwürdig ist sie hier aber<br />
nach wie vor kleinflächig auf guten, frischen Standorten, sowie grundsätzlich im Schwarzwaldteil.<br />
- Tanne,<br />
ebenfalls hohe Leistung und sehr gute Qualität , ebenfalls häufig geästet. Wichtigste Baumart im<br />
Gemeindewald, weiterhin von großer Bedeutung auf fast allen Standorten. Geordnete Wildstände<br />
sind Grundvoraussetzung für Tannenwirtschaft.<br />
- Kiefer,<br />
ebenfalls gute Qualität bei mäßiger Leistung, langfristig Bedeutung abnehmend.<br />
- Douglasie,<br />
es ist sehr hohe Massenleistung bei durchschnittlichen bis guten Holzqualitäten zu erwarten. Als<br />
Leistungsträger auf den stabilen und kalkarmen Standorten geeignet, Anbauten sollten<br />
unternommen werden, wenn sich geeignete Flächen ergeben.<br />
- Buche<br />
Die Buche als eine Hauptbaumart des Naturwaldes ist in den Altersklassen I bis VI zwar vorhanden,<br />
aber nur gering vertreten und sehr stabil. Auf trockeneren Standorten sollte der Anteil deutlich<br />
erhöht werden, auf frischen Standorten in Beimischung zur Tanne sind keine hohen Buchenanteile<br />
erforderlich. Die Buche hat nur mäßige Qualität, was allerdings durch die hohen Brennholzpreise<br />
derzeit nicht entscheidend ist<br />
Eiche,<br />
Eichenkulturen sind relativ teuer, im Jugendwachstum ist Eiche allen anderen Baumarten<br />
unterlegen, ihre Erhaltung daher pflegerische Daueraufgabe und jahrzehntelanger aufwendiger<br />
„Kampf gegen die Natur“. Diese Nachteile werden kompensiert durch Langfristigkeit und Stabilität.<br />
Daher sollte Eiche wo natürlich vorhanden grundsätzlich gefördert und bei Bedarf im<br />
Stangenholzalter wertgeästet werden, um in der Geschwindigkeit der waldbaulichen Förderung frei<br />
zu sein.<br />
Es fehlen weitgehend vernässende Standorte (2 %), die hohe Eichenanteile erfordern würden,<br />
deshalb wird Eiche auch künftig keine große Bedeutung erlangen.<br />
Bergahorn, Esche,<br />
Sehr gute Qualitäten, verjüngen sich hervorragend, in der Jugend sehr wuchskräftig, vor allem auf<br />
frischen Standorten. Seit einigen Jahren leidet Esche in Baden- Württemberg unter<br />
„Eschentriebsterben“, einem Pilzbefall, der einen neuen gravierenden Schadfaktor darstellt, der zu<br />
hohen Verlusten, Kulturausfällen und vorzeitigen Nutzungen führen kann. . Der weitere Verlauf der<br />
Epidemie ist offen, ein aktiver Anbau der Esche wird derzeit nicht empfohlen.<br />
Kirsche,<br />
Die natürlich verjüngte Kirsche hat eine hervorragend Qualität, wird aber von Mischbaumarten stark<br />
bedrängt und bedarf dringend der Förderung. Gegebenenfalls Wertästung analog Eiche.<br />
Nuß<br />
verjüngt sich neuerdings sehr gut , auch unter Schirm, möglicherweise Folge des für diese Baumart<br />
klimatisch günstigen, weil relativ warmen vergangenen Jahrzehnts. Bei Pflanzung ist Weitverband<br />
möglich, zum Beispiel auf verwilderten Flächen. Ästung zur Qualitätsverbesserung ist immer<br />
wünschenswert.<br />
Esskastanie, Robinie, Birke,<br />
sollten als Wärme liebende, trockenresistente Baumarten erhalten werden, überall wo sie auftreten.<br />
Die Birke verjüngt sich hervorragend auf allen Standorten wo ältere Birken vorhanden sind, sie hat<br />
eine sehr gute Qualität, durchwurzelt die nassen Böden und ist auch auf trockenen Standorten stabil.<br />
Hainbuche, Feldahorn, Linde, Elsbeere, Speierling, Vogelbeere, Ulme, Wildobst, sonstige<br />
„Besonderheiten“<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 14 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
werden, sorgfältig gepflegt und gefördert.<br />
A.6 Klimadiskussion<br />
Über die Konsequenzen des Klimawandels für den Waldbau und die Baumartenwahl wird derzeit<br />
intensiv geforscht. Forstlicherseits kann bisher nur auf sehr allgemeine Trends verwiesen, und<br />
behutsam reagier werden.<br />
Unübersehbar hat aber die warme Witterung der letzten 20 Jahren, verstärkt durch den<br />
Trockensommer 2003, im Gemeindewald deutliche Spuren hinterlassen (Fichtenrückgang, Dürre bei<br />
Kiefer, Schäden bei Buche).<br />
A.6.1 Derzeit erwartete Folgen einer Klimaerwärmung<br />
- Verlängerung der Vegetationsperiode.<br />
- Zunahme trocken- heißer Dürreperioden ?<br />
- Abnahme der Zahl der Frost-/ Eistage.<br />
- Zunahme konvektiver (= durch aufsteigende Luftmassen verursacht) Starkregen.<br />
- Zunahme der Häufigkeit von Stürmen ?<br />
A.6.2 Reaktionsmöglichkeiten des Forstbetriebs auf Klimaerwärmung<br />
1. Der Einzelbaum kann sich in gewissem Rahmen geänderten Klimawerten anpassen. Diese<br />
Veranlagung schwindet allerdings mit zunehmendem Alter. Einzelbaum vital erziehen.<br />
2. Anpassung einer Baumart durch geänderte genetische Selektion. Das genetische<br />
Variationspotential der Baumarten ist sehr groß. Beispielsweise sind die heutigen Althölzer in einer<br />
„Kältezeit“ entstanden (Gletscherhöchststand in den Alpen). Die Nachkommen dieser Population<br />
würden heute mehr in Richtung Wärmeverträglichkeit selektiert, sind also an die heutigen<br />
Verhältnisse besser angepasst als die Vorgängergeneration. Die entsprechenden Auswahlkriterien<br />
kommen allerdings nur voll zum Tragen bei großer genetischer Vielfalt, in der Regel also bei hohen<br />
Anteilen von Naturverjüngung.<br />
3. Verschiebung innerhalb der möglichen Baumartenmischung von eher kälteverträglichen hin zu<br />
Wärme liebenden Baumarten, also zum Beispiel Rücknahme von Fichtenanteilen und Verzicht auf<br />
reine Fichtentypen.<br />
4. Gezieltes Einbringen und Fördern von Baumarten die erfahrungsgemäß höhere Temperaturen<br />
ertragen, zum Beispiel Eiche, Roteiche, Douglasie, Esskastanie, Birke, Nuß.<br />
5. Große Baumartenvielfalt in jedem Einzelbestand. Auch zum Beispiel im Buchenoptimum keine<br />
Buchen- Reinbestände anstreben, sondern „Buntmischungen“.<br />
6. Auf möglichst großer Fläche einen ungleichaltrigen Wald mit gut bekronten, vitalen Individuen bis<br />
hin zum Dauerwald anstreben. In derartigen Beständen herrscht über die gesamte Lebensdauer<br />
eines Baumes das gleiche Bestandesinnenklima, er muß also nicht auch noch auf kleinklimatische<br />
Veränderungen reagieren. Dies schließt aber natürlich nicht aus, dass in Trockensommern wie 2003<br />
auch solche Bestände erheblich geschädigt werden, und sogar partienweise absterben.<br />
7. Risikogerechtes Nutzungsalter, zum Beispiel Fichtenbestände auf Problemstandorten nicht mehr<br />
so alt werden lassen.<br />
Die Forsteinrichtungsplanung hat diese Faktoren berücksichtigt.<br />
A.7 Waldentwicklungstypen<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 15 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
WET Fläche Anteil DW<br />
ha % HbFl % WET<br />
b Buche 22 3 0<br />
d Douglasie 8 1 0<br />
e Eiche 3 Bu o Kie t Tanne y Extensiv<br />
Der Waldentwicklungstyp wird vorgegeben durch die führende Baumart des jeweiligen Bestandes.<br />
Es wurden die Bestände relativ kleinflächig ausgewiesen und Typen getrennt, um erforderliche<br />
Informationen auf der Karte zu haben, und den Wirtschaftern so eine differenzierte Behandlung<br />
unterschiedlicher Flächen zu ermöglichen.<br />
Auf 81 % der Fläche sind hohe Tannenanteile vorhanden, Schwerpunkt in bis IV. und VI. Altersklasse<br />
(Alter 61 bis 120). Es handelt sich um hochwertige, leistungsstarke Bestände.<br />
Anteile von Buchen- und Buntlaubholbeständen im Alter 1 bis40.<br />
Fichtenbestände befinden sich nur noch auf 12 %, davon 11 % stabil und 1 % labil. Die jüngeren<br />
Bestände bedürfen intensiver Pflege.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 16 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.8 Vorrat und Zuwachsleistung<br />
A.8.1 Holzvorratsveränderung<br />
Jahr wirklicher Vorrat<br />
insges Ges.betrieb AKl-Wald DW<br />
Vfm Vfm / ha Vfm / ha Vfm / ha<br />
2002 328.817 502 504 486<br />
2012 311.461 484 480 537<br />
Differenz Vfm - 17.356 - 18 - 24 +51<br />
Differenz % - 5% - 4% - 5% +11%<br />
Der Vorrat bleibt etwa gleich.<br />
A.8.2 Wuchsleistung<br />
Die Herleitung des Holzzuwachses basiert auf den Daten: Baumartenflächen, Altersgliederung und<br />
Angabe der Bonität (=Maßstab für die Wuchsleistung einer Baumart).<br />
Der dGz 100 (Gesamtzuwachs im Durchschnitt von 100 Jahren) wurde eingeschätzt auf 8,9 Efm je<br />
Jahr und ha, der laufende Zuwachs liegt bei 10,3 Efm. Als Schätzgrundlage wurden die Ergebnisse<br />
der Betriebsinventur des Stadtwaldes Horb und des Stadtwaldes Dornstetten verwendet. Es wurde<br />
vorsichtig bonitiert.<br />
A.9 Altersaufbau des Gemeindewaldes<br />
A.9.1 Altersklassenverteilung<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
I II III IV V VI VII VIII ff DW<br />
NB LB<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 17 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.9.2 Baumartenflächen nach Altersklassen und Entwicklungsphasen in ha<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
BL Ia Ib II III IV V VI VII VIII ff J W V P<br />
sNb *1: Pic, Abg, Wey, ELä, Lä, sNb<br />
Fi Ta Dgl Kie sNb *1 Bu BAh sLb *2<br />
sLb *2: REi, Ei, SAh, FAh, Es, REr, As, HBu, Kir, Nu, Vb, Li, Rob, RKa, Bi, Wei, sLb, Str<br />
ha<br />
A.9.3 Normalverteilung der Altersklassen.<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Normale AKL-Fläche<br />
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-<br />
Jahre<br />
Ges. Fläche<br />
Norm. Fläche<br />
Deutliche Überhang der Altersklassen IV bis VI (Bestände zwischen 61 und 120 Jahren) mit sehr<br />
hochwertigen Beständen, die jüngeren Altersklassen sind deutlich geringer als normal ausgestattet.<br />
7 % des Gemeindewaldes sind Dauerwald, 66 % sind älter als 61 Jahre. Dieser Alters- Aufbau<br />
erfordert hohe Verjüngungsvorräte.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 18 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
A.10 Naturverjüngung unter Schirm<br />
A.10.1 Verjüngungsvorrat nach Baumarten<br />
(1) Verjüngungsvorrat unter Schirm<br />
Bezugsfläche Verjüngungsvorrat (ha) Anteil an der<br />
Holzbodenfläche<br />
Alterklasse >= IV und Dauerwald 266 57<br />
Gesamtbetrieb 278 43<br />
Der Verjüngungsvorrat setzt sich zusammen aus Naturverjüngung, Saat, Vorbau und Unterbau.<br />
(2) Baumartenanteile an der Verjüngung unter Schirm (bezogen auf den Gesamtbetrieb)<br />
Baumart<br />
Fläche<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 19 von 41 13.06.12<br />
ha<br />
Anteil am<br />
Verjüngungsvorrat %<br />
Fichte 48 17<br />
Weißtanne 170 61<br />
Sonstiges Nadelholz 1
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B. Betriebsvollzug im abgelaufenen Jahrzehnt -<br />
B.1 Holzeinschlag<br />
B.1.1 Hiebsergebnisse<br />
Ordentliche<br />
Nutzung<br />
Außerordentliche<br />
Nutzung<br />
Gesamtnutzung (GN)<br />
insgesamt je Jahr u. ha<br />
Hiebssatz für 10 Jahre Efm 64.000 0 64.000 9,8<br />
Korrektur zur ZR Efm 71.200 0 71.200 10,9<br />
IST in 10 Jahren Efm 65.541 0 65.541 10,0<br />
Differenz Efm - 5.659 0 - 5.659 - 0,9<br />
IST in % SOLL % 92 0 92<br />
B.1.2 Vornutzung und Hauptnutzung<br />
Vornutzung<br />
(incl. Jungbestandspflege)<br />
SOLL in 10 Jahren Efm 53.002 !Synt<br />
axfeh<br />
ler, .<br />
Haupt- /DW-Nutzung<br />
Insgesamt In % GN Insgesamt in % GN<br />
11.001 !Synt<br />
axfeh<br />
ler, .<br />
Korrektur zur ZR Efm 59.200 83 12.000 17<br />
IST in 10 Jahren Efm 54.191 90 11.350 18<br />
Differenz Efm - 5.009 - 650<br />
IST in % SOLL % 92 95<br />
Zur Zwischenrevision nach 5 Jahren lag die Vornutzung mit 27.705 fm (52 %) nur wenig über dem<br />
Soll, 17 % der Nutzungsmenge waren Kalamitätsanfälle, insbesondere Käferholz. Entsprechend<br />
konnte die Durchforstungsfläche nicht erfüllt werden. Um im zweiten Jahrfünft die zurückhängende<br />
Fläche von 525 ha erfüllen zu können, ergab sich rechnerisch eine benötigte Vornutzungsmenge für<br />
das zweite Jahrfünft von 31.500 fm (6.300 fm pro Jahr)<br />
Die Hauptnutzung erreichte zur Zwischenrevision mit 6.047 fm rund 55 % der Zehnjahresmenge,<br />
davon entfielen rund 1.700 fm auf Zufällige Nutzungen. Um die waldbaulichen Ziele umzusetzen,<br />
können nur Teile der Zufälligen Ergebnisse in der Zufälligen Ergebnisse in den planmäßigen<br />
Hiebsatz integriert werden, ein Teil der Planmäßigen Nutzung muß nachgeholt werden. Für das<br />
Zweite Jahrfünft wurde deshalb eine Hauptnutzung von 6.000 fm (1.200 fm pro Jahr) vorgesehen.<br />
Hiebsatz zur Zwischenrevision somit :<br />
Vornutzung : 27.700 fm Vollzug + 31.500 fm Planung ergibt 59.200 fm.<br />
Hauptnutzung :6.000 fm Vollzug + 6.000 fm Planung ergibt 12.000 fm.<br />
Gesamtnutzung somit :33.700 fm + 37.500 fm = 71.200 fm<br />
Der Hiebsatz wurde nur zu 92 % erfüllt.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 20 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B.1.3 Hiebsergebnisse im Verlauf des vergangenen Einrichtungsjahrzehnts<br />
Efm<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Jahr<br />
B.1.4 Anteil Planmäßiger Hiebe und Zufälliger Nutzungen<br />
Anteil in %<br />
Efm Betrieb % ZN<br />
Planmäßige Hiebe 56.969 87<br />
ZN 8.570 13 100<br />
Sturm 1.941 3 23<br />
Schnee, Duft, Eisbruch 48 0 1<br />
Insekten 5.771 9 67<br />
Dürre, Pilze, Sonstige 810 1 9<br />
Summe 65.539 100 100<br />
Einschlag<br />
Hiebsatz<br />
13 % der Gesamtnutzung waren Zufällige Ergebnisse, die schwerpunktmäßig im ersten Jahrfünft<br />
anfielen.<br />
Der Zwischenrevisionshiebsatz wurde in den Jahren 2009 bis 2011 nur jeweils zu 80 % vollzogen, da<br />
die Verjüngungssituation auf vielen Flächen eine weitere Auflichtung nicht ermöglicht, weil<br />
gegenwärtig nur Hecken und Brombeeren, aber keine Tannen durchkommen.<br />
Die Zwischenrevision hatte dazu ausgeführt :<br />
„Insgesamt muß die Verjüngungssituation deutlich verbessert werden, andernfalls kommen auf den<br />
Betrieb bei dem hohen Flächenumfang der V. Altersklasse in absehbarer Zukunft hohe<br />
Aufwendungen zu…..Damit ist es höchste Zeit, die Wildstände auf eine waldverträgliche Höhe zu<br />
reduzieren, wenn künftig erhebliche wirtschaftliche und ökologische Nachteile durch umfangreiche<br />
Pflanzungen (Und entsprechenden Schutz) vermieden werden sollen.“<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 21 von 41 13.06.12<br />
ZN
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B.2 Verjüngungszugänge, Kulturen -<br />
B.2.1 Verjüngungszugang<br />
Plan Inventur 2011<br />
ha % ha % % Plan<br />
aus Anbau/Ausbesserung 6,4 41 7,6 57 119<br />
aus abgedeckter Nvj /Vorbau 9,2 59 5,8 43 63<br />
Summe 15,6 100 13,4 100 86<br />
Als Folge der Einschlagszurückhaltung liegt der Verjüngungszugang unter der Planung.<br />
57 % sind aus Anbau, 43 % aus Naturverjüngung und früherem Vorbau.<br />
B.2.2 Pflanzenverbrauch<br />
Baumart Stück %<br />
Summe 79.140 100<br />
Nadelholz 1.600 2<br />
Laubholz 77.540 98<br />
Tanne 1.600 2<br />
Eiche 600 1<br />
Buche 72.750 92<br />
Ahorn 1.470 2<br />
Esche 320 0<br />
Erle 250 0<br />
sonstige Laubbäume 1* 2.150 3<br />
*1: RKa, WLi<br />
Der Schwerpunkt der Pflanzungen lag auf Buchen- Vorbau.<br />
Es hätte mehr für die Nadelholzeinbringung getan werden können, schon in der vorletzten<br />
Einrichtungsperiode war abgesehen von einigen Tannen- Heister- Pflanzungen wenig Nadelholz<br />
künstlich eingebracht worden.<br />
Der Nachbesserungsanteil war hoch (18 %), durch Dürre (Trockenheit in der Pflanzzeit) und Verbiß<br />
(Hase).<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 22 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B.3 Bestandespflege, Ästungen<br />
B.3.1 Bestandespflege<br />
Jungbestandspflege Vornutzung<br />
ha ha Efm/ha in % ZN<br />
Planung *1 46,8 509,3 104<br />
Planung *2 46,8 842,1 63<br />
Planung *3 46,8 842,1 70 12<br />
Vollzug *4 75,4 842,5 64 12<br />
in % SOLL 166 100<br />
Pflegerückstände 0,8 2,3<br />
*1 : einfache Fläche; *2 : mehrfache Fläche; *3 : Nach der ZR; *4 : verbuchte Fläche.<br />
Bei der Jungbestandspflege wurden 166 % der geplanten Pflegefläche erforderlich (hauptsächlich<br />
Mischwuchsregulierung zugunsten von Tanne). Der Pflegezustand ist sehr gut.<br />
Bei der Vornutzung wurde die Fläche zu 100 % bearbeitet, allerdings mit geringerem Anfall als bei<br />
der Zwischenrevision unterstellt. Der Hektaranfall lag mit ZN genauso hoch, wie ohne ZN geplant.<br />
Der Pflegezustand in Ordnung, die pflegedringlichen Flächen sind überschaubar (38,3 ha).<br />
B.3.2 Ästung<br />
Plan<br />
Vollzug<br />
Stück Stück in % Plan Stufe 2 Stufe 3<br />
3.580 3.519 98 92 8<br />
B.3.3 Ästung nach Baumarten<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 23 von 41 13.06.12<br />
in %<br />
Baumart in % aller geästeten Bäume<br />
Ta 79<br />
Dgl 14<br />
Ei 3<br />
BAh 1<br />
Kir 3<br />
Die Ästung ist auf dem Laufenden.
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B.4 Maßnahmen zur Wildschadensverhütung<br />
Planung Vollzug<br />
ha ha % Plan<br />
Zaunbau 0,3 1,1 367<br />
Einzelschutz 0 233,5*<br />
* mehrfache Fläche<br />
Beim verbuchten Einzelschutz handelt es sich um Spritzen von Tannenverjüngungen gegen<br />
Wildverbiß, das in unterschiedlicher Intensität durch die Jagdpächter erfolgte. Das Spritzmittel wurde<br />
vom Betrieb gestellt.<br />
Um künftig den Einzelschutz effektiver gestalten zu können, empfiehlt es sich, ihn komplett vom<br />
Betrieb durchzuführen, und den Jagdpächtern in Rechnung zu stellen.<br />
Zusätzlich wurden 2.450 Pflanzen durch Pfisterpfähle und Wuchshüllen geschützt und 8,7 ha alte<br />
Zäune abgebaut.<br />
B.5 Erschließung<br />
Es wurden auf 3.900 lfm ausgefahrene Rückegassen und Maschinenwege wieder instand gesetzt,<br />
davon 1.100 lfm in Gemengelage mit Privat- Spital- und Staatswald.<br />
B.6 Betriebswirtschaftliche Ergebnisse<br />
B.6.1 Finanzielles Ergebnis<br />
Erlöse<br />
Betriebskosten<br />
Verwaltungskosten<br />
Betriebsergebnis<br />
Betrieb<br />
EUR insgesamt 4.582.236<br />
EUR/JuhaH 700,11<br />
EUR insgesamt 2.217.586<br />
EUR/JuhaH 338,82<br />
EUR insgesamt 626.328<br />
EUR/JuhaH 95,70<br />
EUR insgesamt 1.715.508<br />
EUR/JuhaH 262,11<br />
EUR/Efm 26,17<br />
Kleiner Betriebskoeffizient 48<br />
Großer Betriebskoeffizient 62<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 24 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
B.6.2 Entwicklung des finanziellen Ergebnisses<br />
EUR/1000<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Jahr<br />
Kosten Erlöse Betriebsergebnis<br />
Es sind jährliche Förderbeträge von insgesamt 59.533 Euro, sowie 2002 bis 2004 Naßlagerverkäufe<br />
(Holz aus der Vor- Einrichtungsperiode) von 384.004 Euro enthalten.<br />
B.6.3 Durchschnittliche Betriebswirtschaftliche Kenndaten<br />
Kosten Einheit Betrieb<br />
Holzernte EUR/Efm Einschlag 23,29<br />
EUR/JuhaH 233,24<br />
Verjüngung EUR/JuhaH 37,55<br />
Bestandespflege EUR/hH 13,47<br />
Waldschutz EUR/haH 7,57<br />
produktive Stunden (eigene WA) Std/haH 9<br />
Unternehmeranteil am<br />
Gesamtaufwand<br />
% 50<br />
∅ Erlös / Efm Einschlag EUR/Efm 65,74<br />
Einschlag und Holzverkauf sind nicht immer im gleichen Jahr gebucht.<br />
Es wird sehr kostenbewußt gewirtschaftet. Die Einschlagszurückhaltung in Zeiten schlechter<br />
Holzmarktlage (2002 und 2005) mit erhöhtem Einschlag bei erholtem Holzmarkt (2004 bis 2008) wirkt<br />
sich positiv auf die Zehnjahresbilanz aus.<br />
Der „Einbruch“ 2009 bis 2011 ist auf verringerten Einschlag zurückzuführen.<br />
Die Kulturkosten sind überdurchschnittlich.<br />
Es handelt sich um ein ganz hervorragendes Ergebnis, etwas „geschönt“ durch Naßlagerverkäufe<br />
von Holz aus der Voreinrichtungsperiode, sowie Förderbeiträge.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 25 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
C. Planung<br />
C.1 Hiebssatz<br />
C.1.1 Hiebssatz<br />
Nutzung (Efm)<br />
Jahr / ha insgesamt<br />
alter Hiebssatz 10 Jahre 9,8 64.000<br />
Hiebsatz nach ZR 10 Jahre 10,9 71.200<br />
Vollzug 10 Jahre 10,0 65.541<br />
Plan (neu) 10 Jahre 8,4 54.000<br />
C.1.2 Nutzungsmaßnahmen<br />
Vornutzung Hauptnutzung Dauerwaldnutzung<br />
ha Efm/ha ha Efm/ha ha Efm/ha<br />
Bestandesfläche 301 86 237 101 44 91<br />
Arbeitsfläche 561 46 433 55 84 47<br />
Gesamtmenge 26.000 Efm (incl. Jpfl) 24.000 Efm 4.000 Efm<br />
48% 44% 7%<br />
Der Hiebsatz ist rein waldbaulich ausgerichtet und enthält keine Reserven für eventuell anfallende<br />
zufällige Nutzungen. Er liegt mit 8,4 Efm je Jahr und Hektar größenordnungsmäßig deutlich unter<br />
Planung und Vollzug des abgelaufenen Forsteinrichtungszeitraums.<br />
Bei den Vornutzungen wurde ein hoher Turnus (1,86) mit sehr moderaten Eingriffen geplant (46 Efm<br />
je Eingriff).<br />
Grundsätzlich sollten alle Eingriffe Stammzahl schonend geführt werden (spätere<br />
Nutzungsmöglichkeiten).<br />
Bei den Hauptnutzungen erlaubt der auf großer Fläche ungenügende Verjüngungsvorrat eine<br />
Nutzung in der geplanten Höhe nur, wenn sich die Verjüngungssituation umgehend und<br />
entscheidend verbessert. Die Forsteinrichtung hat auf einer Hauptnutzungsfläche von 294 ha<br />
unzureichende Verjüngungssituation festgestellt, die bei der Zwischenrevision zu überprüfen ist.<br />
Sollte sich die Situation durch weiterhin ungenügende jagdliche Zustände nicht bessern, muß<br />
spätestens bei der Zwischenrevision der Hiebsatz nochmals zurückgenommen werden (kein zweiter<br />
Eingriff auf diesen Flächen, keine weitere Auflichtung über Brombeere und Hecken), und es muß<br />
großflächig gezäunt und vorgebaut werden.<br />
Die Dauerwaldnutzungen sollen Struktur, Qualität und Stabilität dieser Bestände erhöhen.<br />
Hauptziel aller Eingriffe muß es sein, die Bestände weiter zu stabilisieren und die<br />
Verjüngungsvorräte weiter zu erhöhen.<br />
Die seitherige waldbauliche Vorgehensweise des Forstbetriebs erfüllt diese Vorgaben vorbildlich,<br />
und sollte ohne die geringsten Änderungen so fortgesetzt werden :<br />
Im jüngeren Laubholz und in jüngeren ästungswürdigen Nadelholz- Beständen erfolgt Z- Baum-<br />
Auswahl. Ansonsten werden die in der Regel tannen- und strukturreichen, stabilen Bestände durch<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 26 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
baumzahlschonende Hiebsführung auf starke, grobastige oder beschädigte Bäume gepflegt und<br />
qualitativ verbessert. Gleichzeitig wird dabei durch die Öffnung des Kronendaches vielerorts die<br />
erforderliche Naturverjüngung der Tanne angeregt und die Bestände in Richtung langfristige<br />
Verjüngung bis hin zum Dauerwald entwickelt. Weiterhin wichtig ist die Kronenpflege der in<br />
Nadelholzbeständen beigemischten Laubhölzer als zukünftige Samenbäume.<br />
C.1.3 Entwicklung von Hiebsatz, Einschlag und Vorrat 1879 bis 2011<br />
Efm/J/ha<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1879<br />
1889<br />
Entwicklung des Einschlags und des Vorrats<br />
1899<br />
1909<br />
1919<br />
1929<br />
1939<br />
1879 bis 1929 ohne Cresbach.<br />
Sehr hohe Nutzungen 1929 bis 1949.<br />
1949<br />
Jahr<br />
1959<br />
1969<br />
1982<br />
1993<br />
2002<br />
2012<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 27 von 41 13.06.12<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Vorrat<br />
Vfm/ha<br />
Hiebsatz Efm/J/ha<br />
Einschlag Efm/J/ha<br />
Vorrat Vfm/ha
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
C.2 Verjüngung<br />
C.2.1 Verjüngungsmaßnahmen<br />
geplanter Verjüngungszugang<br />
davon BL<br />
Anteil<br />
Naturverjüngung<br />
ha ha %<br />
6,9 0,0 97<br />
Anbau Vorbau Saat Unterbau Zäunung<br />
davon DW davon DW<br />
ha ha ha ha ha<br />
0,2 12,9 0,0 0,0 12,9<br />
0,2 0,0<br />
Nur relativ geringe Verjüngungstätigkeit, Verjüngungszugang 6,9 ha, davon 6,7 ha aus<br />
Naturverjüngung.<br />
Vorbau ist geplant auf 12,9 ha in aufgelichteten, schlecht verjüngten Beständen (12,5 ha Tanne, 0,4<br />
ha Buche)<br />
Der Verjüngungszustand auf 294 ha ist derzeit sehr kritisch, er soll zur Zwischenrevision überprüft<br />
werden. Sollte er dann noch mangelhaft sein, muß der Hiebsatz zurückgenommen und in größerem<br />
Stil gezäunt und vorgebaut werden, was dramatische Auswirkungen auf das Betriebsergebnis hätte.<br />
C.2.2 Geplante Verjüngungsziele des AKl-Waldes nach Baumarten<br />
WET ∑ Verj. WET Ta Bu Fi BAh<br />
ha ha ha ha ha<br />
b Buchenbestand 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0<br />
f Fichte stabil. 2,1 1,2 0,7 0,1 0,1<br />
t Tanne 4,5 2,5 1,2 0,7 0,1<br />
∑ Verj.ziel (ha) 6,9 3,8 2,1 0,8 0,2<br />
(%) 100% 55% 31% 11% 3%<br />
Sofern es im Planungszeitraum zu Zufälligen Nutzungen mit Verjüngungszugang kommt, sollte bei<br />
Tanne und Buche verstärkt mit Vorwald gearbeitet, und auf geeigneten Standorten auch Douglasie<br />
eingebracht werden. werden.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 28 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
C.3 Sonstige Planung (Ästung, Wegebau)<br />
Jungbestandspfl. im Ästung Wegebau Kalkung<br />
AKl-Wald Unter<br />
Schirm<br />
Stufe 1-<br />
3<br />
Fahr-<br />
wege<br />
Maschinen-<br />
wege<br />
ha ha Stck lfm lfm ha<br />
Bestandesfläche 61,4 63,5 193,5<br />
2.225 0 4.850<br />
Arbeitsfläche 66,7<br />
193,5<br />
C.3.1 Jungbestandspflege<br />
Jungbestandspflege ist geplant auf 61,4 ha, davon auf 5,3 ha in zwei Eingriffen<br />
Jungbestandspflege unter Schirm ist erforderlich, um unbrauchbare Verjüngung zu entfernen, in der<br />
Regel Hecken und so brauchbarer Verjüngung ein Ankommen zu ermöglichen.<br />
C.3.2 Ästung<br />
Zur Ästung vorgesehen sind 2.225 Stück, 1.845 Stück Tanne, 180 Stück Eiche, 50 Stück Kirsche, 100<br />
Stück Douglasie und 50 Stück Lärche.<br />
C.3.3 Wegebau und Feinerschließung<br />
Keine Neubauten an Fahr- und Maschinenwegen.<br />
Auf 4.850 lfm sind Rückegassen und Maschinenwege in einem so schlechten Zustand, dass<br />
Hauptverbesserung erforderlich wird.<br />
C.3.4 Kalkung<br />
Sofern Fördermittel bereitstehen, sollten die Abteilungen IV / 1 bis 9 (173,5 ha), sowie Teile von I / 2<br />
(20 ha) gekalkt werden.<br />
C.4 Holzverkauf<br />
Alle anfallenden Nadelholz- Sortimente wurden durch das Forstamt bzw. durch die zentrale<br />
Holzverkaufsabteilung des Kreisforstamtes vermarktet. Hauptkunden sind zwei örtliche Sägewerke.<br />
Wertholz wird separat angeboten.<br />
Laubholz spielt praktisch keine Rolle, es geht fast ausschließlich an Brennholzkunden.<br />
Der Anteil von Brennholzselbstwerbern und Brennholzinteressenten hat in den letzten Jahren stark<br />
zugenommen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 29 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
C.5 Waldarbeit<br />
Die Gemeinde beschäftigt drei Forstwirte in Vollzeit. Die Gruppe kommt auch in Nachbarwäldern<br />
(Spitalwald, Heiligenwald) und im Bauhof der Gemeinde zum Einsatz. Sie ist mit der Wartung des<br />
gemeindeigenen Dauernasslagers beauftragt und erbringt überdurchschnittliche Leistung, auch<br />
qualitativ.<br />
Im Gewann Kapfhalde ist eine kleine Betriebshütte mit Werkstatt für Regenarbeiten vorhanden.<br />
Rückearbeiten und rund 30 % Holzerntearbeiten werden von Unternehmern durchgeführt.<br />
C.6 Ausblick auf die betriebswirtschaftliche Entwicklung<br />
Fazit der Zwischenrevision 2007:<br />
„Die hoch bevorrateten, qualitativ häufig vorzüglichen Bestände sind in einem guten Pflegezustand<br />
und erlauben eine ökonomisch erfolgreiche Bewirtschaftung, selbst bei schwieriger Holzmarktlage.<br />
Die Sturm- und Kalamitätsfolgen sind beseitigt bzw. „im Griff“, die An- und Vorbauten sind mit<br />
hohem Aufwand erfolgt, können infolge hoher Verbißbelastung bei reduziertem Schutzaufwand aber<br />
nicht durchgängig befriedigen. Kurzfristig sollen deshalb die Schutzmaßnahmen bei Vorbauten<br />
wieder verstärkt werden (Zaunschutz, Tubex), langfristig wachsen die wirtschaftlichen und<br />
ökologischen Probleme, wenn es weiterhin nicht gelingt, auf den Muschelkalk- Standorten die<br />
Naturverjüngung über die Verbisszone hoch zu bringen.<br />
Die wichtigste Einnahmequelle des Betriebes sind die Erlöse aus dem Holzverkauf, die direkt vom<br />
Holzpreis und der Holzmenge abhängig sind. Der Hiebsatz ist massen- und wertmäßig<br />
überdurchschnittlich, und enthält fast ausschließlich Nadelholz, das derzeit einen sehr ordentlichem<br />
Holzmarkt hat.<br />
Auf der Ausgabenseite bewegen sich Jungbestandspflege (Mischwuchsregulierung zugunsten von<br />
Tanne, Eiche, Kirsche) und Wertästung über dem Niveau des Vollzugs, sind insgesamt aber von<br />
untergeordneter Bedeutung. Diese Maßnahmen sichern und erhöhen die Qualität der Bestände, und<br />
sind daher unverzichtbar.<br />
Die sehr moderat geplanten Vorbauten als Reaktion auf die ungenügende Verjüngungssituation<br />
belasten den Betrieb mit rund 200.000 Euro.<br />
Die Sanierung der schlechten Rückegassen und Maschinenwege wird sich in einer pfleglicheren und<br />
kostengünstigeren Holzernte auszahlen.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich bei normalisierter Wirtschaftslage und ungestörtem<br />
Betriebsablauf das Betriebsergebnis auch zukünftig positiv sein wird.<br />
Der Gemeindewald ist allerdings durch Aufwendungen und Mindererträge außerhalb der<br />
Holzerzeugung, z.B. für Erholungsmaßnahmen, Verkehrssicherung sowie möglichen<br />
Nutzungsverzicht für Naturschutz und Landschaftspflege belastet.<br />
Einschränkend ist nochmals zu betonen, dass diese Planung von einer umgehenden Lösung der<br />
Wildproblematik, und damit von einer positiven Entwicklung der Verjüngungsvorräte ausgeht. Sollte<br />
diese Vorgabe durch weiterhin ungenügende jagdliche Zustände nicht zutreffen, muß spätestens bei<br />
der Zwischenrevision der Hiebsatz zurückgenommen werden (keine Auflichtung über Brombeere und<br />
Hecken), und es muß großflächig gezäunt und vorgebaut werden. Überschlägig würde sich dadurch<br />
das Betriebsergebnis umdrehen von jährlich plus 100.000 Euro in jährlich minus 50.000 bis 100.000<br />
Euro.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 30 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
C.7 Anhang 1, Wildverbiss im Spiegel der Forsteinrichtungswerke 1981 bis 2012<br />
C.7.1 Forsteinrichtung 1981<br />
Beurteilung des Vollzugs im abgelaufenen Jahrzehnt<br />
„Kritisch zu vermerken sind die 15,5 ha Fi-Reinbestände, denn im Gemeindewald ist praktisch keine<br />
Standortseinheit, die Fi-Reinbestände erlaubt. Dies ist vor allem eine Folge der hohen Wildbestände,<br />
verschärft durch zu geringen Zaunbau.<br />
Insgesamt muss gesagt werden, dass die gesamte Kulturtätigkeit unter der Wildfrage zu leiden hat. Der<br />
Wildstand ist im gesamten Gemeindewald zwar nicht gleich hoch, aber überall zu hoch.<br />
Zum Schutz von Kulturen und Vorbauten waren 33 ha Zäune geplant, vollzogen wurden lediglich 8,3 ha. Diese<br />
beiden Zahlen erklären den hohen Fi-Anteil und den zu geringen Ta- und Bu-Anteil ohne große Worte.“<br />
Betriebszieltypen und Verjüngungsverfahren:<br />
BZT Ta-Fi-Bu: Hier muss zunächst eine starke Verunkrautung entfernt werden, zusätzlich sind die Zäune<br />
durch ständige Scheidholzanfälle kaum dicht zu halten.<br />
Hinweise für die Zwischenprüfung: Die Verbisssituation und die Frage, ob sich bei der Rehwildreduktion<br />
positive oder negative Aspekte ergeben haben.<br />
Vollzugsnachweis für Wildschutzmaßnahmen 1971-1981<br />
Wildschutzmaßnahmen: Zäunung 33,2 ha (Planung), 8,3 ha (Vollzug)<br />
15990 m 5550 m<br />
Zaunabbau 4,6 ha = 2390 m (Vollzug)<br />
C.7.2 Forsteinrichtung 1992<br />
„Die Tanne verjüngt sich auf so ziemlich allen Standorten hervorragend, wie die Unzahl von Sternchen<br />
beweisen. Tannenverjüngung älter als 3-4 Jahre findet sich jedoch nur im Zaun oder in den wenigen<br />
rehwildarmen Zonen. Der große Rest nimmt ein unrühmliches Ende im Pansen der zahlreichen Rehe.“<br />
„Waldschutz und Jagd: Das Forstamt hat keinen Einfluss auf die verpachteten Jagden im Gemeindewald.<br />
Die bisherige Abfassung der Jagdpachtverträge ist unbefriedigend, da bisher keiner der Pächter zur<br />
Übernahme von Wildschutzkosten verpflichtet ist. Die Wildbestände sind dementsprechend. Im Anhang findet<br />
sich eine Übersicht der Abschusszahlen der abgelaufenen Einrichtungsperiode, aus der ersichtlich wird, dass<br />
in diesem Bereich in den letzten Jahren keine Verbesserungen eingetreten sind.<br />
Eine positive Änderung im Bereich der Jagdpachtverträge zeichnet sich in Salzstetten ab, wo zukünftig eine<br />
Wildschutzkostenbeteiligung von 60% der entstehenden Kosten bei Zaunbauten und von 30% bei sonstigen<br />
Wildschutzmaßnahmen vorgesehen ist.“<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 31 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Verbiss: Die folgende Tabelle zeigt die vorgefundenen Verbissschäden:<br />
Kulturen Vorbau Nverj. Summe<br />
ha ha ha ha<br />
Tanne 0,2 1,1 1,3 2,6<br />
Buche 0,3 0,9 - 1,2<br />
Fichte 0,1 - - 0,1<br />
Summe 0,6 2,0 1,3 3,9<br />
„Die Verbissfläche ist relativ gering, was damit zusammenhängt, dass der größte Teil der verbissempfindlichen<br />
Baumarten gezäunt ist. Außerhalb Zaunes wird die Tannen-Naturverjüngung meist so vollständig gefressen,<br />
dass keinerlei Verbissspuren zurückbleiben. Der Wildstand ist von wenigen Ausnahmen abgesehen überall<br />
viel zu hoch, insbesondere im Tumlinger und Salzstetter Wald.“<br />
„Insgesamt sind 65% der Verjüngungs- und Vorbauflächen gezäunt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass<br />
in der Verjüngungsfläche auch Fichtenkulturen enthalten sind, die nicht gezäunt wurden. In den letzten Jahren<br />
wurden an günstigen Stellen auch Vorbauten außerhalb Zaunes begründet, wobei hier noch abzuwarten<br />
bleibt, ob die Sache auch funktioniert. Die Zahl der Zäune ist aber inzwischen so groß, dass der notwendige<br />
Kontroll- und Reparaturaufwand kaum mehr durchzuführen ist. Der Zustand der Zäune lässt häufig zu<br />
wünschen übrig. Insgesamt hat die Zaunfläche die akzeptable Grenze bereits überschritten.“<br />
„Die meisten Zäune sind „Sparmodelle“ ohne imprägnierte Pfosten usw., was auch den teilweise sehr<br />
schlechten Zustand erklärt.<br />
Für die Zukunft ergeben sich neben der Reduktion der Holzerntekosten Einsparmöglichkeiten vor allem im<br />
Bereich der Kulturen und im Forstschutz. Außer der Verringerung der Pflanzenzahlen muss es gelingen,<br />
Verjüngungsvorräte unter Schirm und außerhalb Zaunes aufzubauen. Das spart Kultursicherungskosten und<br />
Wildschutzkosten.“<br />
„Da der Gemeindewald auf dem überwiegenden Teil der Fläche weit von diesem Idealzustand entfernt ist und<br />
angesichts der übergroßen Rehwildbestände nicht an natürliche Verjüngung der Tanne gedacht werden kann,<br />
muss die Einbringung über Vorbau erfolgen. In der Vergangenheit erfolgte dieser fast ausschließliche im<br />
Zaun, mit allen entsprechenden Nachteilen wie Probleme der räumlichen Ordnung flächenweise Entmischung<br />
der Baumarten, hoher Kontroll- und Kostenaufwand sowie Verlust der waldbaulichen Freiheit, da die dicht<br />
gepflanzte Verjüngung über kurz oder lang eine schnelle Räumung erforderte. In der zukünftigen Planung geht<br />
der Vorbau im Weitverband auf die Gesamtbestandesfläche, und zwar in Form von Heisterpflanzen zur<br />
Entschärfung der Verbiss- und Kultursicherungsproblematik.“<br />
Planung für das kommende Jahrzehnt<br />
„Vorbau ist auf 25,0 ha geplant. Davon sollen 13,2 ha als Tannen- Heisterpflanzungen durchgeführt werden.<br />
Hauptgrund für diese Vorgehensweise ist der Versuch, auf die Zäunung zu verzichten. Bereits jetzt ist der<br />
notwendige Kontroll- und Reparaturaufwand für die bestehenden Zäune kaum mehr durchzuführen. Das<br />
Konzept ist der letzte Versuch eine standortsgerechten Waldwirtschaft trotz hoher Verbissbelastung durch das<br />
Rehwild.“<br />
„Waldschutz und Jagd: Zäunung wurde auf 13,0 ha geplant (gegenüber 51,8 ha bei der letzten Einrichtung);<br />
davon 3,0 ha festgelegt und 10.0 ha für die Betriebsleitung frei disponierbar. Dabei ist vor allem an die<br />
Anzucht der benötigten Tannenheister im Zaun auf günstigen Standorten gedacht.<br />
Die Reduktion der Zaunfläche soll auch der Jagd entgegenkommen. Das Gelingen des zaunfreien Vorbaus<br />
wird jedoch im starken Maße von der Mithilfe der Jägerschaft abhängen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 32 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Einzelschutz ist auf 11, ha vorgesehen. Ähnlich wie bei der Entfichtung sollte auch hier die Wirkung anhand<br />
von Nullflächen überprüft werden.“<br />
„Hinweise für die Zwischenrevision:<br />
Verbissbelastung: Hat sich die Verbissbelastung verbessert oder verschlechtert ? Wie läuft die<br />
Naturverjüngung z. Bsp. in IV, 1 a12/2 oder IV, 7 a9 ? Kann evtl. im Hörschweiler Wald auf Vorbau verzichtet<br />
werden bzw. genügt hier konventioneller Vorbau ?“<br />
C.7.3 Forsteinrichtung 2002<br />
Verbissschäden<br />
„Die starken Verbissschäden (über 50% verbissen) sind flächenmäßig gering (nur 0,7 ha). Hier nicht<br />
berücksichtigt sind Totalausfälle, also Flächen ohne jegliche Verjüngung, wo der Verbissdruck so hoch ist, das<br />
sogar typische Äsungspflanzen außerhalb der Kontrollzäune nicht mehr vorhanden sind. Diese Flächen sind<br />
vor allem in Tumlingen anzutreffen. Hier wird Schwerpunktbejagung oder konsequente Zäunung empfohlen.<br />
Insgesamt dürften höhere Verjüngungsanteile vor allem beim Laubholz ohne kostspielige Schutzmaßnahmen<br />
nur durch konsequente Bejagung des Rehwildes zu erreichen sein. Die Gemeinde wurde wiederholt, auch<br />
anlässlich der Örtlichen Prüfung, auf die Problembereiche hingewiesen.“<br />
Verjüngungszugang<br />
„Tannen-Vorbau wurde nur getätigt, wo standörtliche und jagdliche Widrigkeiten eine natürliche Verjüngung<br />
als aussichtslos erscheinen ließen.“<br />
Waldschutz und Jagd<br />
„Es wurden – in Erwartung einer weiteren Verbesserung der Situation – keine Zäune geplant. Um<br />
kostenintensive Wildschadensverhütungsmaßnahmen zu vermeiden, muss eine den waldbaulichen<br />
Notwendigkeiten angepasste Höhe der Rehwildbestände gesichert werden. Das Gelingen des Aufbaus von<br />
stabilen Mischbeständen unter voller Ausnutzung des natürlichen Verjüngungspotentials ist auch von der<br />
Mithilfe der Jäger abhängig. Hier liegt ein zweifaches Einsparpotential : zum einen werden die Pflanzkosten,<br />
zum anderen die Wildschadensverhütungskosten gesenkt.“<br />
Wildschutz<br />
Plan Vollzug Vollzugs%<br />
Zaunneubau 3 1,9 63<br />
Anstelle von 3,0 ha mussten bisher nur 1,9 ha gezäunt werden. Dafür wird ein intensiver Einzelschutz<br />
betrieben. Die Wildproblematik ist noch nicht befriedigend gelöst.<br />
Zielsetzung für den Gemeindewald <strong>Waldachtal</strong> zur Forsteinrichtung 2003-2012<br />
„Nutzfunktion: Um eine standortsgerechte Naturverjüngung zu ermöglichen und kostenaufwendige<br />
Wildschutzmaßnahmen zu vermeiden, soll eine dauerhafte Anpassung des Rehwildbestandes erfolgen.“<br />
C.7.4 Niederschrift Zwischenrevision 2006<br />
Abgesehen vom Distrikt IV (Hörschweiler Wald), der hervorragende Naturverjüngungsanteile aufweist, scheint<br />
auf den Muschelkalk-Distrikten die Naturverjüngung (Ta, Ah, sLb) auch durch Wildverbiss die kritische Höhe<br />
offenbar nicht zu überwachsen. In den großflächigen Baumholzbeständen ab der V. Akl. sind häufig in großer<br />
Zahl Ta-Sämlinge und bis zu ca. 15 cm hohe Jungpflanzen zu sehen, die aber offensichtlich regelmäßig in der<br />
Verbisshöhe stecken bleiben. Aus der Verbisshöhe herausgewachsene Verjüngung fehlt dort weitgehend.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 33 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Die geplante Vorbaufläche wird erkennbar nicht erreicht werden. Bei den offensichtlich hohen Wildständen<br />
macht es keinen Sinn, Buchen in großem Stil zu pflanzen, die letztlich hauptsächlich „Wildfutter“ darstellen.<br />
Verabredet ist die Fortsetzung des Bu- Vorbaus im Umfang von jährlich 1 ha, die aber so gesichert sein sollen,<br />
dass Wildverbiss zuverlässig ausgeschlossen werden kann. Bei geeigneten Flächenformen und –größen<br />
bedeutet dies die Rückkehr zum früher erprobten und bewährten Vorbauzaun, bei kleinen Flächen sollten<br />
erste Erfahrungen mit Tubex- Röhren gesammelt werden.<br />
Die besichtigten Durchforstungsbestände sind sehenswert. Insbesondere in der stark ausgestatteten, stabilen,<br />
weil Ta- reichen V. Altersklasse ist die baumzahlschonende Hiebsführung auf starke, grobastige oder<br />
beschädigte Bäume ein bewährtes Mittel ökonomisch erfolgreiche Bestandespflege zu betreiben und<br />
gleichzeitig durch gezielte Öffnung des Kronendachs die Naturverjüngung insbesondere der Tanne<br />
anzuregen.<br />
Hier sind allerdings die Jäger gefordert, durch eine ausreichend hohe Abschußgestaltung diesen<br />
Verjüngungsprozess zu unterstützen. Der Betrieb kann nur durch großflächige Durchforstungen ökologisch<br />
richtig den Boden bereiten (Abt. II/ 6,7,9, c9/ c10/; III/ 9 c9 u.a.). Leider ist in den älteren, eigentlich zur<br />
Verjüngung heranstehenden Beständen (z.B. Abt III/ 2c12, III/ f 16/1) die vorhandene Naturverjüngung absolut<br />
unzureichend. Die Verjüngungen in diesen Beständen stammen meist aus früheren, in der Regel<br />
zaungeschüzten Vorbauten. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden, wenn der Gemeinde erhebliche<br />
ökonomische Nachteile erspart bleiben sollen.<br />
Im vergangenen Jahrfünft wurden entsprechend den betrieblichen Nachweisungen auf 8,7 ha alte nicht mehr<br />
benötigte (Vorbau) Zäune entfernt. 0,5 ha (Eichentyp) wurde neu gezäunt. Von Seiten der Jäger wurde auf<br />
insgesamt 111 ha (in 5 Jahren) Ta getupft, nach dem örtlichen Augenschein in Höhen zwischen 10 und<br />
maximal 20 cm. Zusätzlich wurden 550 Pflanzen durch Pfisterpfähle geschützt.<br />
Die Anteile der Jagdpächter an den Wildschutzkosten betragen nach Kenntnis der Betriebsleitung in den<br />
durch die Ortschaftsverwaltungen abgeschlossenen Jagdpachtverträgen zwischen 30 und 60% der<br />
nachgewiesenen Kosten, jeweils jedoch mit gedeckelten Obergrenzen. In der Praxis stellt der Betrieb die<br />
Schutzmittel, die Jagdpächter sorgen für die Ausbringung.<br />
Abgesehen vom Distrikt IV (Hörschweiler Wald), den eine hervorragende Naturverjüngung mit hohen<br />
Tannenanteilen auszeichnet, kann die Verjüngungssituation in den restlichen Distrikten nicht überzeugen. Die<br />
Tanne ist verbreitet im Sämlings- bis Kleinpflanzenstadium vorhanden, hat aber auch in zu verjüngenden<br />
Althölzern der VI. bis VIII. Akl. keine nennenswerten Verjüngungsvorräte aufbauen können. Die gut<br />
gelungenen älteren Bu- Vorbauflächen sind erkennbar alle im Zaun hochgewachsen. Dagegen fallen die<br />
außerhalb Zaun gestarteten neuen An- und Vorbauflächen deutlich ab. Neben den Trockenschäden trägt<br />
insbesondere der Verbiss zu hohen Ausfällen bei. Der Betrieb hat auch aus Kostengründen in den<br />
vergangenen Jahren mit einer starken Zurückhaltung beim Vorbau reagiert. Für das 2. Jahrfünft wird deshalb<br />
eine Rücknahme der Vorbaufläche auf etwa 5 ha empfohlen, gleichzeitig aber deren konsequenter Schutz, um<br />
zumindest diese Anteile zu sichern. Je nach Größe und Flächenform wird Zaunschutz oder der Schutz durch<br />
Tubex- Röhren empfohlen.<br />
Insgesamt muss die Verjüngungssituation deutlich verbessert werden, andernfalls kommen auf den Betrieb<br />
bei dem hohen Flächenumfang der V. Akl. in absehbarer Zukunft hohe Aufwendungen zu. Als Folge der<br />
großflächigen Durchforstungen muss die Verjüngung „durchstarten“ und namhafte Verjüngungsvorräte<br />
aufbauen können. Die Tanne benötigt hierfür Zeiträume zwischen mindestens 20 und 40 Jahren. Damit ist es<br />
höchste Zeit, die Wildstände auf eine waldverträgliche Höhe zu reduzieren, wenn künftig erhebliche<br />
wirtschaftliche und ökologische Nachteile durch umfangreiche Pflanzungen (und entsprechenden Schutz)<br />
vermieden werden sollen.<br />
Die Aufwendungen für Waldschutz in Höhe von 7 €/J/ha beinhalten den vom Betrieb getragenen Anteil an<br />
Wildschutzmaßnahmen, daneben aber auch Aufwendungen im Zusammenhang mit der<br />
Borkenkäferbekämpfung. Die vom Betrieb finanzierten Wildschutzaufwendungen sind demnach nicht hoch, sie<br />
sollten aber nicht über die unbefriedigende Verjüngungs- und Verbisssituation hinwegtäuschen. Bei den<br />
derzeitigen Wildbeständen sind die Schutzmaßnahmen für die gepflanzte Buche nicht überall ausreichend, die<br />
Naturverjüngungsentwicklung scheint durch den Verbiss zumindest stark gebremst.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 34 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Die beachtlich hohen Kulturkosten spiegeln die finanziellen Auswirkungen dieser Situation besser.<br />
Die Tatsache, dass die Jagdpachteinnahmen im Betriebsergebnis auch nicht anteilig berücksichtigt sind,<br />
können dazu beitragen, dass die Gemeinde den Zusammenhang Jagd- Wild- Wald nicht in seiner vollen<br />
Bedeutung wahrnimmt. Häufig weisen die Gemeinden anteilige Pachteinnahmen im haushaltsplan nach.<br />
Als Fazit ist festzuhalten : Die hoch bevorrateten, qualitativ häufig vorzüglichen Bestände sind in einem guten<br />
Pflegezustand und erlauben eine ökonomisch erfolgreiche Bewirtschaftung, selbst in schwieriger<br />
Holzmarktlage.<br />
Die Sturm- und Kalamitätsfolgen sind beseitigt bzw. „im Griff“, die An- und Vorbauten sind mit hohem Aufwand<br />
erfolgt, können infolge hoher Verbissbelastung aber nicht durchgängig befriedigen. Kurzfristig sollen deshalb<br />
die Schutzmaßnahmen bei Vorbauten wieder verstärkt werden (Zaunschutz, Tubex), langfristig wachsen die<br />
wirtschaftlichen und ökologischen Probleme, wenn es weiterhin nicht gelingt, auf den Muschelkalk- Standorten<br />
die Naturverjüngung über die Verbisszone hoch zu bringen.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 35 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
D. Erläuterung von Begriffen aus der Forsteinrichtung<br />
• Abteilung<br />
Die Abteilung ist eine Einheit der Waldeinteilung und wird mit arabischen Ziffern (1, 2, ...) und<br />
Gewannnamen bezeichnet. Ihre Größe beträgt i.a. 10-30 ha.<br />
Sie untergliedert die Distrikte* als übergeordnete Größe.<br />
• Altersklassen<br />
Bei der zahlenmäßigen Darstellung der Ergebnisse der Forsteinrichtung werden die einzelnen<br />
Bestände* zwanzigjährigen Altersklassen zugeteilt. Die Altersklassen werden bei der jüngsten<br />
beginnend mit römischen Ziffern bezeichnet (I=1-20jährig, II=21-40jährig usw.). In der<br />
Altersklassenkarte erhält jede Altersklasse eine landesweit gültige Farbe (I= gelb, II= braun, III=<br />
grün usw.). Die Altersklassen können in jeweils 10 Jahre umfassende Altersstufen* weiter<br />
untergliedert werden.<br />
Das Altersklassenverhältnis in einem Betrieb zeigt den aktuellen Altersaufbau nach Baumarten.<br />
Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit wird dieses mit einem idealen Altersaufbau (gleichmäßige<br />
Verteilung auf die Altersklassen) verglichen.<br />
• Altersklassenwald<br />
Der Altersklassenwald ist wesentlich durch einen altersmäßig räumlich differenzierten Bestandesaufbau<br />
geprägt. Altersklassenwald ist dadurch gekennzeichnet, dass waldbauliche<br />
Maßnahmen, wie Verjüngung, Jungwuchspflege oder Durchforstung, isoliert voneinander<br />
ablaufen und bei dem ganze Bestände oder Teilflächen in definierten Verjüngungszeiträumen<br />
genutzt werden. Die einzelnen Bestände sind besonders im Hinblick auf das Alter ziemlich<br />
einheitlich zusammengesetzt.<br />
• Anbau<br />
Anbau als Planungsgröße ist sowohl die vollständige künstliche Verjüngung* unbestockter Flächen<br />
als auch die Ergänzung von Naturverjüngungen* (Ausbesserung). Zur Herleitung der Anbaufläche<br />
wird die tatsächlich anzubauende (reduzierte) Fläche zugrunde gelegt. Die<br />
Reduzierung der Fläche erfolgt im Anhalt an die üblichen Pflanzverbände. Bei Ausbesserungen<br />
bzw. Weitverbandspflanzungen, die über die maximalen Pflanzabstände hinausgehen, sind<br />
reduzierte Flächen anzugeben<br />
• Arbeitsfläche<br />
Die Arbeitsfläche wird für alle Holznutzungen* angegeben. Sie ist die Fläche, die während des<br />
Planungszeitraums durchhauen werden soll. Die Arbeitsfläche wird immer für den Einzelbestand<br />
angegeben<br />
• Behandlungstyp<br />
Behandlungstypen fassen Bestände eines Waldentwicklungstyps zusammen, in denen im<br />
Planungszeitraum eine gleichartige waldbauliche Behandlung vorgesehen ist (z.B.<br />
Jungwuchspflege im WET Fi-Ta-Bu, Durchforstung im WET stabile Fichte,<br />
Zieldurchmesserernte im WET Buche).<br />
• Bestand<br />
Der Bestand ist ein Kollektiv von Bäumen auf einer zusammenhängenden Mindestfläche, das<br />
eine einheitliche Behandlung erfährt. Er wird im Revierbuch* und in der Karte mit kleinem<br />
Buchstaben und der Altersstufen-Ziffer bezeichnet (a 1 , b 3 ...).<br />
• Bonität<br />
Die Bonität ist der Maßstab für die Zuwachsleistung* einer Baumart. Sie wird als dGz 100<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 36 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
angegeben (⇒Zuwachs).<br />
• Bruchbestand<br />
Bruchbestände sind Althölzer, deren Kronendach bereits soweit aufgelichtet ist, dass die<br />
vorhandene Naturverjüngung nur noch teilweise überdeckt ist und bereits einer Altersstufe<br />
zugeordnet werden kann. Das dadurch entstehende Mosaik von Altholzkronendach und<br />
Verjüngungskegeln wird forsteinrichtungstechnisch als Bruch beschrieben (a 13/1: a13=Altholz,<br />
Altersstufe 13; a1=abgedeckte Verjüngung, Altersstufe 1).<br />
• Forsteinrichtungswerk<br />
Das Forsteinrichtungswerk ist die zusammenfassende Darstellung und Erläuterung aller<br />
Forsteinrichtungsergebnisse. Es umfasst den Erläuterungsband, Tabellen, das Revierbuch*,<br />
Flächenbücher*, den Betriebsvollzug, Kartenwerke* u.a.m..<br />
• Derbholz<br />
Derbholz ist die oberirdische Holzmasse über 7 cm Durchmesser mit Rinde.<br />
• Distrikt<br />
Distrikt ist ein von fremden Flurstücken oder von einer anderen Nutzungsart allseits umschlossener<br />
Waldteil und wird mit römischen Ziffern bezeichnet (I, II, usw.).<br />
• Dringlichkeit der Holznutzungen<br />
Bei der Planung der Holznutzungen* ist die Dringlichkeit des Eingriffs zu beurteilen.<br />
Dringlichkeitsstufe I umfasst alle Bestände, unabhängig vom Alter, die vordringlich zu<br />
bearbeiten sind. Dringlichkeitsstufe 1 kann für alle Holznutzungen vergeben werden<br />
(Jungwuchspflege, Durchforstung, Hauptnutzung, Nutzung im Dauerwald, Plenterwaldnutzung).<br />
Vordringlich zu bearbeitende Bestände sind bis zur Zwischenrevision zu durchhauen<br />
• Durchforstung<br />
Die Durchforstung dient der Pflege der Bestände, der Mischungsregulierung der Baumarten und<br />
der Erziehung der einzelnen Bestandesmitglieder zu möglichst hohem Massen- und<br />
Wertzuwachs.<br />
Die Durchforstungsfläche ist die Fläche in ha, die während des Planungszeitraumes durchforstet<br />
werden soll. Sie errechnet sich aus der Fläche der Durchforstungsbestände und der Anzahl der<br />
für die Bestände geplanten Durchforstungswiederholungen.<br />
Die Wiederholungen der Durchforstungen in einem Bestand werden als Durchforstungsturnus<br />
bezeichnet.<br />
Die Stärke des Eingriffes (Nutzungssatz) wird als Erntefestmeter* je ha (Efm/ha) für jeden<br />
Bestand und als Durchschnittswert des Betriebes angegeben.<br />
• Erntefestmeter (Efm)<br />
Der Erntefestmeter ohne Rinde ist die Maßeinheit für Planung, Einschlag, Verkauf und<br />
Verbuchung des Holzes. In der Praxis wird er errechnet, indem vom Vorrat* des stehenden<br />
Bestandes (gemessen in Vfm mit Rinde*) 20 % für Ernte- und Rindenverluste abgezogen<br />
werden.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 37 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
• Gesamtbetriebsfläche<br />
Gesamtbetriebsfläche alle Flurstücke des Forstbetriebes<br />
die sonstige Betriebsfläche<br />
und<br />
gliedert sich in<br />
Flurstücke, die nicht mit Wald bestockt sind und eine<br />
eigenwirtschaftliche Bedeutung haben (z.B. Kiesgrube),<br />
die forstliche Betriebsfläche alle Flurstücke, die der forstlichen Produktion dienen<br />
gliedert sich in<br />
die Holzbodenfläche und tatsächliche Produktionsfläche<br />
die Nichtholzbodenfläche nicht zur Holzerzeugung bestimmte Flächen wie Wege,<br />
Schneisen etc. und Bannwald<br />
• Hauptnutzung<br />
Zur Hauptnutzung gehören: Holznutzungen*, die eine Verjüngung* der Bestände* bezwecken<br />
oder erforderlich machen. Hauptnutzung wird nur im Altersklassenwald angegeben<br />
• Hiebssatz<br />
Der Hiebssatz ist die im Forsteinrichtungswerk festgesetzte jährliche planmäßige Holznutzung in<br />
Efm ohne Rinde für den Forsteinrichtungszeitraum. Er gliedert sich in Nutzungen in der<br />
Jungwuchspflege, der Durchforstung, der Verjüngung und in Nutzung im Dauerwald. Für alle<br />
Holznutzungen wird einzelbestandsweise Arbeitsfläche* und Turnus* sowie ggf.<br />
Dringlichkeitsstufe I geplant.<br />
• Jungbestandspflege<br />
Die Jungwuchspflege fördert Jungwüchse (gesicherte Naturverjüngungen und Kulturen) und<br />
Dickungen* im Hinblick auf die Ziele des jeweiligen Waldentwicklungstyps* bis zum Eintritt<br />
ins Durchforstungsalter.<br />
• Kartenwerke, forstliche<br />
Es werden im wesentlichen folgende Kartenwerke (Maßstab 1: 10.000) anlässlich einer<br />
Forsteinrichtung aufgestellt bzw. fortgeführt:<br />
− Betriebskarte: Sie stellt Baumarten, Anteile von Mischungen und Altersklassen farbig dar.<br />
Die Betriebskarte ist die Hauptkarte der Forsteinrichtung.<br />
− Planungskarte: Sie stellt die Planungen für jeden Einzelbestand und die Wegebauplanung<br />
dar.<br />
− sonstige Karten: Je nach betrieblichen Erfordernissen werden Sonderkarten gefertigt. Z.B.:<br />
Pflege-, Ästungs-, Schadens-, Verjüngungsvorratskarte u.a.m..<br />
Neben den Karten der Forsteinrichtung sind wichtige Grundlagen:<br />
a) die forstliche Standortskarte als Ergebnis der Standortskartierung*,<br />
b) die Waldfunktionenkarte*,<br />
c) die Waldbiotopkarte*.<br />
• Nachhaltigkeit<br />
Unter Nachhaltigkeit versteht man die Fähigkeit eines Forstbetriebes, dauernd und optimal die<br />
vielfältigen Leistungen des Waldes (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) zum Nutzen der<br />
gegenwärtigen und künftiger Generationen zu erfüllen. Die Sicherstellung der Nachhaltigkeit ist<br />
eine der wichtigsten Aufgaben der Forsteinrichtung.<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 38 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
• Dauerwald<br />
Dauerwald ist eine Form des Wirtschaftswaldes, bei der ohne festgelegte Produktionszeiträume<br />
die Holznutzung auf Dauer einzelbaum-, gruppen- bis kleinflächenweise erfolgt. Dauerwald<br />
benötigt für die Ausweisung ein hohes Maß an Struktur im Hinblick auf Durchmesserverteilung,<br />
Höhenentwicklung und Baumartenmischung. Im Dauerwald erfolgt die Kennzeichnung neben<br />
dem Buchstaben des Waldentwicklungstyps mit den Ergänzungen J (Jungwuchsphase), W<br />
(Wachstumsphase), V (Verjüngungsphase) und P (Plenterwald) als Kurzbezeichnung der<br />
überwiegend vorherrschenden natürlichen Entwicklungsphase*.<br />
• Nutzung<br />
Die Forsteinrichtung unterscheidet bei der Nutzung<br />
a) die planmäßige Nutzung, die durch den Plan der Forsteinrichtung festgesetzt wird. Sie wird<br />
weiter unterteilt nach Vor- und Endnutzungen.<br />
b) die zufällige Nutzung, die durch verschiedene Schadereignisse unplanmäßig erfolgt,<br />
• Örtliche Prüfung<br />
Die Erörterung der Ergebnisse der Forsteinrichtung erfolgt anlässlich der Örtlichen Prüfung, an<br />
der die Vertreter der Körperschaft, die Vertreter der Abteilung Forsteinrichtung der<br />
Forstdirektion sowie der Forstamtsleiter und die Revierleiter des örtlichen Forstamtes teilnehmen.<br />
Im Körperschaftswald erfolgt diese Schlussabnahme der Forsteinrichtung in der Regel im<br />
Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatsitzung mit anschließender Beschlussfassung nach<br />
§ 2 der Körperschaftswaldverordnung.<br />
• Revierbuch<br />
Das Revierbuch ist die Zusammenstellung der Bestandesbeschreibungen*, geordnet nach<br />
Distrikten und Abteilungen. Es ist Teil des Forsteinrichtungswerkes.<br />
• Schutzwald (⇒Waldfunktionenkarte)<br />
Schutzwald nach § 29 Landeswaldgesetz (LWaldG) ist<br />
a) Bodenschutzwald<br />
b) Biotopschutzwald (⇒Waldbiotopkarte)<br />
c) Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen.<br />
Schutzwälder werden durch die Forstbehörde ortsüblich bekannt gemacht und erfahren eine ihrer<br />
Funktion entsprechende Behandlung.<br />
• Standortskartierung<br />
Die Standortskartierung ist die flächendeckende, systematische Erfassung der natürlichen<br />
Standorte und ihrer ökologischen Beschaffenheit. Sie dient als Entscheidungshilfe für die<br />
Planung (Baumartenwahl) in der Forsteinrichtung (Standortskarte mit Standortsbilanz sowie<br />
einem Erläuterungsband).<br />
• Summarische Planung<br />
Summarische Nutzungsplanungen werden insbesondere in Betrieben mit<br />
Rasterstichprobenergebnissen auf der Ebene von Waldentwicklungstypen und Behandlungstypen<br />
durchgeführt. Sie können<br />
− die einzelbestandsweise Nutzungsherleitung für den gesamten Betrieb oder einzelne<br />
Waldentwicklungs-/Behandlungstypen ersetzen bzw.<br />
− als Gesamtweiser die waldbauliche Einzelplanung überprüfen<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 39 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
• Turnus<br />
Der Eingriffsturnus gibt die Anzahl der Eingriffe in Holznutzungen - bezogen auf den Bestand -<br />
innerhalb des Planungszeitraums an. Er dient zur Berechnung der mehrfachen Arbeitsflächen*.<br />
Der Turnus wird mit einer Stelle hinter dem Komma angegeben. Beispiel: Turnus 1,5 bedeutet,<br />
auf 50% der Fläche sollen 2 Eingriffe stattfinden<br />
• Verjüngungsziel<br />
Das Verjüngungsziel gibt Aufschluss über die angestrebte Baumartenmischung des für die<br />
nächsten 10 Jahre geplanten Verjüngungszugangs*. Verjüngungsziele werden auf standörtlicher<br />
Grundlage unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Waldfunktionenkartierung* nach<br />
betriebstechnischen, betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten festgelegt<br />
• Vorbau<br />
Der Vorbau ist die künstliche Vorausverjüngung eines Bestandes durch Anbau von Schattbaumarten<br />
unter dem Kronenschirm. Dadurch sollen Baumarten eingebracht werden, die<br />
aufgrund fehlender Samenbäume nicht natürlich zu verjüngen sind.<br />
• Vorrat<br />
Der Vorrat ist das stehende Holzvolumen. Er wird in Vorratsfestmetern Derbholz mit Rinde*<br />
(Vfm D m.R.) ausgedrückt.<br />
• Vorratsfestmeter<br />
Vorratsfestmeter ist die Maßeinheit für den stehenden Holzvorrat an Derbholz* mit Rinde und<br />
für die Zuwachswerte*.<br />
• Waldschutzgebiete<br />
Waldschutzgebiete nach § 32 LWaldG sind Bann- und Schonwald. Sie werden mit Zustimmung<br />
des Waldbesitzers durch die höhere Forstbehörde durch Rechtsverordnung ausgewiesen und<br />
dienen ökologischen und wissenschaftlichen Zwecken. Der Bannwald ist ein sich selbst<br />
überlassenes Waldreservat, in dem i.d.R. jeder Eingriff unzulässig ist. Im Schonwald sollen<br />
bestimmte Waldgesellschaften erhalten, entwickelt oder erneuert werden. Die dazu notwendigen<br />
Pflegemaßnahmen werden in der Rechtsverordnung näher geregelt.<br />
• Waldfunktionenkartierung<br />
Die Waldfunktionenkartierung erfasst die Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes flächendeckend<br />
in Waldfunktionenkarten* für alle Waldeigentumsarten und stellt damit eine<br />
wichtige Entscheidungsgrundlage für die mittelfristige Planung im Forstbetrieb dar.<br />
• Waldbiotopkartierung<br />
Durch die Waldbiotopkartierung werden Biotopschutzwälder nach § 30 a LWaldG abgegrenzt<br />
und beschrieben sowie in Karten und Verzeichnisse eingetragen. Die Kartierung erfolgt<br />
flächendeckend für alle Waldeigentumsarten und ist ortsüblich durch die Forstbehörde<br />
bekanntzumachen.<br />
Die Ausweisung von Biotopschutzwald ist für die Forsteinrichtung bindend und wird entsprechend<br />
den jeweiligen Schutzzielen bei der Planung von Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
berücksichtigt.<br />
• Waldentwicklungstyp<br />
Zu Waldentwicklungstypen werden Bestände mit vergleichbarem waldbaulichen<br />
Ausgangszustand und Produktionsziel zusammengefasst. Sie beschreiben die zweckmäßigsten<br />
waldbaulichen Verfahren und Techniken zur Erreichung dieses Zieles unter Beachtung der<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 40 von 41 13.06.12
FE-Stichtag: 01.01.2012 Forstamt- / Betriebsnummer: 237 00016<br />
Funktionenvielfalt des Waldes. Waldentwicklungstypen sind Einheiten für Zustandserfassung,<br />
Planung, Vollzug und Kontrolle.<br />
• Zuwachs<br />
Die Forsteinrichtung unterscheidet im wesentlichen:<br />
− den durchschnittlichen, jährlichen Gesamtzuwachs (dGz), der die nachhaltig jährlich<br />
zuwachsende und nutzbare Masse im Laufe einer bestimmten Zeit (100 Jahre (dGz 100) und<br />
den<br />
− laufenden, jährlichen Zuwachs (lGz), der die gegenwärtige Zuwachsleistung wiedergibt.<br />
Die Zuwachswerte werden i.d.R. in Vorratsfestmetern Derbholz mit Rinde* und je Jahr und ha<br />
angegeben (Vfm/J/ha).<br />
<strong>Sitzungsvorlage</strong> Seite 41 von 41 13.06.12