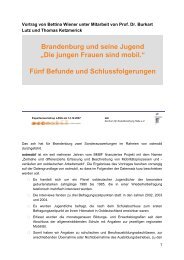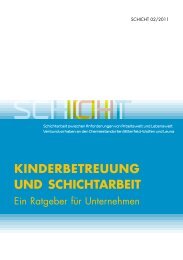Forschungsberichte aus dem zsh 10-1 - Zentrum für Sozialforschung ...
Forschungsberichte aus dem zsh 10-1 - Zentrum für Sozialforschung ...
Forschungsberichte aus dem zsh 10-1 - Zentrum für Sozialforschung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ingo Wiekert (Hrsg.)<br />
<strong>zsh</strong>-HERBSTTAGUNG<br />
zur<br />
Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten<br />
-<br />
Tagungsband 2<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> <strong>10</strong>-1
Die Verantwortung <strong>für</strong> den Inhalt liegt bei den Autor/innen.<br />
<strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e. V. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Emil-Abderhalden-Str. 6<br />
06<strong>10</strong>8 Halle<br />
Telefon: 0345 / 552 66 00<br />
Fax: 0345 / 552 66 01<br />
E-Mail: info@<strong>zsh</strong>.uni-halle.de<br />
Internet: http://www.<strong>zsh</strong>-online.de<br />
Druck: Druckerei der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Satz: Siegfried Makarskyj<br />
ISSN 1617-299X<br />
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis<br />
Thomas Pleye<br />
Grußwort zur Herbsttagung des <strong>zsh</strong> am 05. November 2009 ............................... 5<br />
Uwe Bentrup<br />
Grußwort ................................................................................................................... 9<br />
Ingo Wiekert<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen ................................................................ 11<br />
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt – Neue Risiken <strong>für</strong> Unternehmen<br />
in der Nachwuchs- und Fachkräftesicherung ............................................... 27<br />
Holle Grünert<br />
Weiterbilderbildungsaktivität und differenzierte Weiterbildungsprofile<br />
von Betrieben ................................................................................................... 47<br />
Sabine Löser<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen<br />
im Land Brandenburg – Möglichkeiten und Grenzen ................................... 67<br />
Burkart Lutz<br />
Qualifizieren <strong>für</strong> die Zukunft – Schlusswort zur <strong>zsh</strong>-Herbsttagung ................... 81<br />
Autorenverzeichnis ................................................................................................... 89<br />
Tagungsprogramm ................................................................................................... 91<br />
Teilnehmerliste ......................................................................................................... 93
Grußwort zur Herbsttagung des <strong>zsh</strong> am 05. November 2009<br />
5<br />
Staatssekretär Thomas Pleye<br />
Ministerium <strong>für</strong> Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten<br />
Schon <strong>aus</strong> der Tagesordnung der heutigen Konferenz kann man erkennen, dass das<br />
<strong>zsh</strong> seit vielen Jahren Themen bearbeitet, die von erheblicher Relevanz <strong>für</strong> die<br />
Landespolitik sind. Ich nenne hier nur die Schlagworte „Ausbildung von<br />
Jugendlichen“, „Qualifizierung von Beschäftigten“ und nicht zuletzt auch das Thema<br />
„Bürgerarbeit“. Das <strong>zsh</strong> hat dabei die Entwicklung im Land und auch die politischen<br />
Ansätze der Landesregierung im Bereich der Aus- und Weiterbildung immer<br />
konstruktiv kritisch begleitet und leistet damit seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur<br />
Fortentwicklung der politischen Instrumente.<br />
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass das <strong>zsh</strong> in<br />
Person von Professor Lutz schon sehr früh auf das Problem der „<strong>dem</strong>ografischen<br />
Lücke“ hingewiesen hat und damit bei Politik und Verwaltung in Sachsen-Anhalt den<br />
Blick <strong>für</strong> <strong>dem</strong>ografisch bedingte Probleme der Fachkräftesicherung geschärft hat.<br />
Damit haben Sie einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das Ministerium <strong>für</strong><br />
Wirtschaft und Arbeit rechtzeitig strategische Ansätze entwickeln konnte, mit denen<br />
Unternehmen bei der Sicherung ihres Fachkräftebedarfes unterstützt werden<br />
können.<br />
Ich freue mich daher sehr, dass ich heute zu Beginn Ihrer Veranstaltung ein kurzes<br />
Grußwort an Sie richten darf und möchte diese Gelegenheit nutzen, Ihnen noch<br />
einmal einen ganz kurzen Überblick über unsere Strategie zur Fachkräftesicherung<br />
und Fachkräfteentwicklung in Unternehmen zu geben.<br />
Die Fachkräftestrategie des Ministeriums <strong>für</strong> Wirtschaft und Arbeit des Landes<br />
Sachsen-Anhalt ruht insgesamt auf drei Säulen:<br />
1. Säule der Fachkräftestrategie: Betriebliche Ausbildung stärken<br />
Wesentlicher Ausgangspunkt ist dabei die Eigenverantwortung der Wirtschaft <strong>für</strong> die<br />
Sicherung des eigenen Fachkräftenachwuchses durch betriebliche Erst<strong>aus</strong>bildung.<br />
Die Landesregierung unterstützt die Wirtschaft bei dieser Aufgabe zum einen durch<br />
Maßnahmen im Vorfeld der Ausbildung. Hier geht es insbesondere darum, dass<br />
Jugendliche die allgemeinbildenden Schulen <strong>aus</strong>bildungsreif verlassen und bei der
Thomas Pleye<br />
Berufswahl durch flächendeckende Angebote zur Berufsorientierung unterstützt<br />
werden. Ein wichtiges Beispiel da<strong>für</strong> ist unser landesweites, gemeinsam mit den<br />
Arbeitsagenturen durchgeführtes Berufsorientierungsprogramm BRAFO <strong>für</strong> alle<br />
Schülerinnen und Schüler an Sekundarschulen und Förderschulen.<br />
Auf der anderen Seite unterstützen wir in bestimmten Fällen aber auch Betriebe<br />
direkt bei der betrieblichen Erst<strong>aus</strong>bildung von Jugendlichen. Hier geht es<br />
insbesondere um unser Förderinstrumentarium zur Unterstützung der Verbund-<br />
<strong>aus</strong>bildung und der Förderung von Zusatzqualifikationen, mit <strong>dem</strong> wir auch<br />
Betrieben, die z.B. aufgrund einer weitgehenden Spezialisierung eine Voll<strong>aus</strong>bildung<br />
in bestimmten Berufen nur im Verbund mit anderen Betrieben oder mit<br />
Bildungsträgern sicherstellen können, die Ausbildung von eigenem Fachkräfte-<br />
nachwuchs ermöglichen.<br />
Da das Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze trotz aller Anstrengungen der<br />
Wirtschaft in den letzten Jahren noch nicht <strong>aus</strong>reichte, um allen Lehrstellen-<br />
suchenden einen Ausbildungsplatz anbieten zu können, hat die Landesregierung in<br />
den vergangenen Jahren zusätzlich dazu noch außerbetriebliche (Ausbildungs-<br />
programm Ost und Landesergänzungsprogramm) und schulische Ausbildungsplätze<br />
bereitgestellt. Diese Programme werden in Zukunft allerdings nicht mehr in der<br />
bisherigen Form erforderlich sein. Wir denken allerdings darüber nach, wie wir die<br />
positiven Erfahrungen, die wir mit den genannten Programmen in den letzten Jahren<br />
gesammelt haben, zukünftig nutzen können, um Betriebe auch zur verstärkten<br />
betrieblichen Ausbildung von leistungsschwächeren Jugendlichen zu motivieren.<br />
2. Säule der Fachkräftestrategie: Qualifizierung von Beschäftigten <strong>für</strong> und in<br />
Unternehmen unterstützen<br />
Kernpunkt unserer Aktivitäten ist hier unser Programm zur Qualifizierung von<br />
Beschäftigten. Inhaltlich geht es dabei darum, die Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Unternehmen im Land durch Weiterbildung der Beschäftigten zu verbessern. Konkret<br />
werden Unternehmen bei der Finanzierung von notwendigen Anpassungs-<br />
qualifizierungen von Beschäftigten an veränderte betriebliche Bedarfe unterstützt.<br />
Wir wollen damit auch Unternehmen zur Durchführung betrieblicher Qualifizierungs-<br />
vorhaben und zur Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Konzepte zur<br />
Organisations- und Personalentwicklung ermutigen und sie dabei unterstützen.<br />
6
7<br />
Grußwort<br />
Da viele kleine und mittelständische Unternehmen mit dieser Aufgabe überfordert<br />
sind, setzen wir seit Jahren erhebliche Mittel des Landes und des ESF <strong>für</strong> spezielle<br />
Einzelprojekte ein, die Führungskräfte in Unternehmen durch entsprechende<br />
Coaching-, Beratungs- und Weiterbildungsangebote bei der Personal- und<br />
Organisationsentwicklung zu unterstützen. Auch das <strong>zsh</strong> hat hier in den letzten<br />
Jahren seine wissenschaftlichen Kompetenzen eingebracht, zum Beispiel um die<br />
Weiterbildungsbereitschaft und die Kompetenzentwicklung von Unternehmen im<br />
Bereich der Landwirtschaft zu unterstützen, und ich freue mich, dass wir an dieser<br />
Stelle auch weiter zusammenarbeiten.<br />
Strategisch ist uns im Zusammenhang mit der Weiterbildung von Beschäftigten noch<br />
besonders wichtig, dass sich auch die Hochschulen des Landes zukünftig noch<br />
stärker in diesem Bereich engagieren. Wir glauben, dass es notwendig ist, den<br />
Know-How-Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft durch Verstärkung der<br />
wissenschaftlichen Weiterbildung zu verbessern und haben dazu an allen<br />
Hochschulen des Landes sogenannte Transferzentren eingerichtet, die den Kontakt<br />
zwischen Unternehmen und Hochschulen unterstützen sollen. Auf Grundlage solcher<br />
Kontakte können die Hochschulen Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung<br />
entwickeln, die <strong>dem</strong> tatsächlichen Bedarf der Unternehmen entsprechen und daher<br />
auch von diesen angenommen werden.<br />
3. Säule der Fachkräftestrategie: Zusätzliche Fachkräftepotentiale erschließen<br />
Auf die dritte Säule unserer Fachkräftestrategie möchte ich nur noch ganz kurz<br />
eingehen. Hier tragen wir durch verschiedene Ansätze dazu bei, den Kontakt und die<br />
Kommunikation zwischen fachkräftesuchenden Unternehmen in Sachsen-Anhalt und<br />
gut <strong>aus</strong>gebildeten Fachkräften, die hier im Land eine berufliche Perspektive suchen,<br />
zu verbessern.<br />
Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle nur auf das Projekt PFIFF hinweisen. Dieses<br />
zielt auf die Sicherung von Fachkräften <strong>für</strong> Sachsen-Anhalts Unternehmen.<br />
Angesprochen werden bundesweit potenzielle Fachkräfte, die sich in einer<br />
beruflichen Aus- und Weiterbildung oder in einer Hoch- und Fachschul<strong>aus</strong>bildung<br />
befinden, sowie gut <strong>aus</strong>gebildete Arbeitnehmer in anderen Bundesländern, die gern<br />
in ihre Heimatregion Sachsen-Anhalt zurückkehren würden. PFIFF ist auch ein<br />
Informations- und Vermittlungsportal <strong>für</strong> gut <strong>aus</strong>gebildete Fachkräfte, die Arbeit<br />
suchen, und <strong>für</strong> Unternehmen, die dringend Fachkräfte benötigen. PFIFF unterstützt
Thomas Pleye<br />
die Fachkräfte und die Unternehmen durch Informationen. Allerdings ist PFIFF keine<br />
Arbeitsvermittlung. Das heißt, die Bewerber/innen und die Unternehmen müssen<br />
selbst aktiv werden (z.B. durch Bewerbungen oder durch gezielte Ansprache<br />
geeigneter Bewerber durch Unternehmen).<br />
Eine ähnliche Funktion übernehmen die Transfercenter <strong>für</strong> junge Absolventen der<br />
Hochschulen. Diese sollen frühzeitig – schon während des Studiums – Kontakte<br />
zwischen zukünftigen Studienabsolventen und Unternehmen der Region herstellen<br />
und befördern. Damit wollen wir erreichen, dass mehr Absolventen als bisher<br />
berufliche Chancen in sachsen-anhaltischen Unternehmen erkennen und ergreifen<br />
und dadurch die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte verhindern.<br />
Damit komme ich zum Schluss meiner Ausführungen.<br />
Ich hoffe, in meinen Ausführungen wurde deutlich, dass wir der beruflichen Aus- und<br />
Weiterbildung in den Unternehmen des Landes eine zentrale Bedeutung <strong>für</strong> die zu-<br />
künftige Fachkräftesicherung zumessen – auch und gerade in den „turbulenten<br />
Zeiten“, die Sie im Titel Ihrer Veranstaltung ansprechen. Wir sind froh, dass die<br />
Wirtschaftskrise bisher noch nicht dramatisch auf den Arbeitsmarkt und die Aus- und<br />
Weiterbildungsbereitschaft der Unternehmen in Sachsen-Anhalt durchgeschlagen<br />
hat und ich habe daher Anlass zur Hoffnung, dass sich die Unternehmen auch zu-<br />
künftig nicht von <strong>dem</strong> richtigen Weg der Fachkräftesicherung durch kontinuierliche<br />
Aus- und Weiterbildung abbringen lassen werden.<br />
Ich denke, Sie werden sich im weiteren Verlauf der Veranstaltung – insbesondere im<br />
zweiten Teil – mit dieser Frage auch wissenschaftlich <strong>aus</strong>einandersetzen. Da<strong>für</strong><br />
wünsche ich Ihnen viel Erfolg, gute Gespräche und eine in jeder Hinsicht<br />
interessante, angenehme und erfreuliche Herbsttagung.<br />
8
Grußwort<br />
9<br />
Uwe Bentrup<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Bildung und Forschung<br />
Anlass, heute über Qualifizierung und berufliche Kompetenzentwicklung zu<br />
sprechen, ist der Abschluss eines sehr erfreulich verlaufenen Projekts.<br />
Die Bundesregierung hat mit ihren Initiativen im Innovationskreis Weiterbildung und<br />
mit Instrumenten wie der Bildungsprämie die richtigen Maßnahmen ergriffen.<br />
Angesichts der Her<strong>aus</strong>forderungen <strong>für</strong> die berufliche Aus- und Weiterbildung vor <strong>dem</strong><br />
Hintergrund der Wirtschaftskrise und der <strong>dem</strong>ografischen Entwicklung sind aber<br />
weitere Anstrengungen notwendig. Dies belegt das Projekt. Es hat die Rolle der<br />
Weiterbildungsträger angesichts der Zukunftsaufgaben prozessorientierter beruf-<br />
licher Weiterbildung untersucht und führte dazu eine aufwendige empirische<br />
Untersuchung bei Bildungsträgern und Betrieben durch. Durch eine Kooperation mit<br />
<strong>dem</strong> Bundesinstitut <strong>für</strong> Berufsbildung (BIBB) und der Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit wurde<br />
der Zugang zu Adressen von Bildungsträgern eröffnet und wurden die Adressen der<br />
Betriebe <strong>aus</strong> der Betriebsnummerndatei gezogen.<br />
1.270 Interviews mit Betrieben und 1.262 Interviews mit Bildungsträgern sind im<br />
Projekt in neuen und alten Ländern erfolgt. Die Kontextanalysen im Projekt erwiesen<br />
sich als sehr ertragreich. Die telefonische Breitenerhebung war bei den Betrieben<br />
und auch bei den Bildungsträgern erfolgreich. Durch die Qualität der Stichprobe<br />
wurden gute Vor<strong>aus</strong>setzungen <strong>für</strong> die nachfolgenden Auswertungen geschaffen.<br />
Die aktuellen Forschungsergebnisse des Projekts werden heute auf der<br />
Herbsttagung des <strong>Zentrum</strong>s <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> zum Thema „Zur Fachkräfte-<br />
sicherung in turbulenten Zeiten“ mit den Schwerpunkten „Local Governance“ und<br />
„Qualifizierungspotentiale“ präsentiert und diskutiert. Es hat sich gezeigt, dass bei<br />
aller Bedeutung <strong>für</strong> drängende aktuelle Aufgaben der Blick auf die berufliche<br />
Weiterbildung, deren Trends und die Zukunftsperspektiven nicht verloren gehen darf.<br />
Auch belegen die erreichten Forschungsergebnisse, dass weitere Untersuchungen<br />
auf diesem Feld notwendig sind. Ich führe hierzu nur die Charakteristik der<br />
kontrastierenden Typen von Betrieben, die Her<strong>aus</strong>arbeitung der Weiterbildungs-<br />
aktivität und unterschiedlichen Weiterbildungsprofile von Betrieben und die aufge-<br />
zeigten Konsequenzen <strong>aus</strong> den empirischen Ergebnissen <strong>für</strong> die Zusammenarbeit<br />
mit Weiterbildungsträgern an. Es sind gute Grundlagen gelegt.
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
1. Zur Problematik<br />
11<br />
Ingo Wiekert<br />
<strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist die Versorgung mit<br />
qualifizierten Arbeitskräften von zentraler Bedeutung. Da<strong>für</strong> bildet die berufliche<br />
Erst<strong>aus</strong>bildung einen notwendigen Teil der Rekrutierungsstrategie eines Betriebes,<br />
um eine langfristig <strong>aus</strong>reichende Versorgung mit benötigten Qualifikationen zu<br />
sichern. Jedoch befindet sich auch Deutschland in einem tief greifenden <strong>dem</strong>o-<br />
graphischen Wandel, der nicht nur allgemein mit <strong>dem</strong> Stichwort der „alternden<br />
Gesellschaft“ charakterisiert werden kann. Speziell in Ostdeutschland führt dieser<br />
gegenwärtig sehr abrupt zum Rückgang der Zahlen von Schulabgängern,<br />
Ausbildungsplatzbewerbern und damit zu einem drastisch rückläufigen Angebot von<br />
jungen Fachkräften. 1 Vielen Betrieben ist diese Entwicklung durch<strong>aus</strong> bewusst und<br />
viele versuchen auch, darauf zu reagieren. Im Folgenden sollen jedoch die<br />
Ergebnisse zweier Untersuchungen vorgestellt werden, die zeigen, dass die Zeit<br />
darauf zu reagieren, knapp zu werden beginnt.<br />
Eine notwendige Vor<strong>aus</strong>setzung <strong>für</strong> eine langfristige Personalplanung ist, dass<br />
<strong>dem</strong>ographische Entwicklungen von den Personalverantwortlichen im Betrieb<br />
gekannt und reflektiert werden. Eine Studie des Instituts <strong>für</strong> Mittelstandsforschung<br />
Bonn (IfM) <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahr 2008 konnte zeigen, dass dies in Ansätzen auch der Fall<br />
ist: Auf die bundesdeutsche Wirtschaft hochgerechnet gaben im vorletzten Jahr<br />
etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen an, von der Thematik „Demographischer<br />
Wandel“ gehört und sich Gedanken zu den Auswirkungen <strong>für</strong> den Betrieb gemacht<br />
zu haben. 2 Zumindest 45 Prozent der Unternehmen hatte schon einmal davon<br />
gehört, sich aber noch keine Gedanken über mögliche Folgen gemacht. Aber auch<br />
18 Prozent der Befragten hatten sich noch gar nicht mit <strong>dem</strong> Thema beschäftigt.<br />
Alles in allem – so ein Fazit <strong>aus</strong> der IfM-Studie – kann man einer Mehrheit der<br />
Betriebe eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber der Demographie-Thematik<br />
attestieren und nun vermuten, dass Betriebe diese absehbaren Entwicklungen in<br />
1 Bereits sehr früh verwiesen Studien <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> auf die Konsequenzen dieser absehbaren<br />
Entwicklung; siehe dazu z.B. Lutz, B. 2000; oder branchenspezifisch Wiener, B. 2005.<br />
2 Vgl. Kay, R.; Kranzusch, P.; Suprinovic, O. 2008: S.36ff.
Ingo Wiekert<br />
ihrem eigenen Rekrutierungsverhalten berücksichtigen. Angesichts des aufgrund<br />
seiner zeitlichen Struktur in den neuen Ländern nur als dramatisch zu<br />
bezeichnenden Umschlags von einem Überschuss an Ausbildungsplatznachfragern<br />
zu einem Mangel an diesen, soll an dieser Stelle am Beispiel von Ausbildungs-<br />
betrieben in Sachsen-Anhalt der Problematik nachgegangen werden.<br />
2. Datenhintergrund<br />
Das empirische Material da<strong>für</strong> ist zwei repräsentativen Befragungen von<br />
<strong>aus</strong>bildenden Betrieben in Sachsen-Anhalt entnommen. 3 Die Befragungen wurden im<br />
Telefonlabor des <strong>zsh</strong> in den Jahren 2001 und 2006 mit Unterstützung der Deutschen<br />
Forschungsgemeinschaft und des Landes Sachsen-Anhalt durchgeführt. Die<br />
Nettostichprobe 2001 umfasst 768, die <strong>aus</strong> 2006 640 Interviews mit Ausbildungs-<br />
betrieben in Sachsen-Anhalt (vgl. Tabelle 1). Die Auswertungen fanden im Rahmen<br />
des Sonderforschungsbereichs 580 der Universitäten Halle und Jena statt, an <strong>dem</strong><br />
das <strong>zsh</strong> mit einem Teilprojekt beteiligt ist. 4<br />
Tabelle 1: Umfang der Nettostichproben der Befragungen 2001 und 2006 von<br />
Ausbildungsbetrieben in Sachsen-Anhalt – absolute Zahlen<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und weniger 20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
12<br />
Gesamt<br />
2001 241 257 270 768<br />
2006 444 156 40 640<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Betriebsbefragung 2001 und <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Für die Darstellung ist der Vergleich der Aussagen der Betriebe zu den beiden<br />
Zeitpunkten wichtig. Als Hintergrundinformation ist noch einmal die Entwicklung der<br />
Betriebslandschaft im Allgemeinen und darunter die der Ausbildungsbetriebe im<br />
Besonderen zusammengestellt. Generell ist die Ausbildungs-beteiligung über den<br />
Beobachtungszeitraum von sechs Jahren in Sachsen-Anhalt gesunken. 5 Das ist u.a.<br />
den Veränderungen in der anhaltinischen Betriebslandschaft geschuldet. In der<br />
Tabelle 2 ist die Entwicklung zwischen den beiden Befragungs-jahren abgebildet.<br />
Insgesamt gab es zum letzten Befragungszeitpunkt 16 Prozent weniger Betriebe als<br />
2001. Unter den <strong>aus</strong>bildenden Betrieben ist die Entwicklung dramatischer: In 2006<br />
sind es fast ein Drittel Ausbildungsbetriebe weniger als noch in 2001.<br />
3 Vgl. Grünert, H.; Lutz, B.; Wiekert, I. 2002 sowie Grünert, H.; Lutz, B.; Wiekert, I. 2007.<br />
4 Siehe Schmidt, R. et al. 2002 und Best, H. et al. 2004 sowie im Internet: www.sfb580.uni-halle.de.<br />
5 Vgl. Grünert, H.; Lutz, B.; Wiekert, I. 2007: S.20f.
13<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Tabelle 2: Veränderungen der Betriebslandschaft in Sachsen-Anhalt 2001 zu 2006 –<br />
Prozent (2001 = <strong>10</strong>0 Prozent)<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und weniger 20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Gesamt<br />
Betriebe gesamt -16,4 -14,6 -5,0 -16,0<br />
darunter<br />
<strong>aus</strong>bildende<br />
Betriebe<br />
-33,0 -22,1 -8,0 -29,3<br />
Quelle: Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit 2006; Berechnungen des <strong>zsh</strong><br />
Ist das schon der Bewerbermangel oder benötigen die Betriebe einfach weniger<br />
beruflich qualifizierte Fachkräfte? Mit einer knappen Antwort auf den zweiten Teil der<br />
Frage beginnend, soll eingangs ein kurzer Blick auf den Stellenwert von Facharbeit<br />
und auf mögliche Alternativen zur eigenen Ausbildung in diesen Betrieben geworfen<br />
werden.<br />
3. Facharbeit und Rekrutierung<br />
Da<strong>für</strong> wurden die Betriebe um eine Einschätzung gebeten, welche Rolle ihre<br />
Fachkräfte <strong>für</strong> den betrieblichen Erfolg spielen. Wie <strong>aus</strong> der folgenden Tabelle 3 zu<br />
ersehen ist, stimmte eine Mehrheit (87 Prozent) der sachsen-anhaltinischen<br />
Ausbildungsbetriebe der Aussage zu, dass die Qualität der Fachkräfte entscheidend<br />
<strong>für</strong> den betrieblichen Erfolg sei. Die Unterschiede zwischen den einzelnen<br />
Betriebsgrößen sind dabei marginal. 6<br />
Vergleicht man die Angaben <strong>aus</strong> 2001 und 2006 wird Folgendes deutlich (vgl.<br />
Tabelle 3). Der hohe Grad an Wertschätzung von Facharbeit in den Betrieben zeigt<br />
sich über die Zeit beständig: Damals wie heute setzt eine eindeutige Mehrheit der<br />
Betriebe auf die Qualität der eigenen Fachkräfte, um Erfolg zu haben. Und die<br />
Zustimmungswerte sind sogar leicht angestiegen – zumindest in der Gruppe von<br />
Betrieben mit 19 und weniger Beschäftigten bzw. in der mit <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Beschäftigten. In der mittleren Gruppe gehen die Anteilswerte von 87 Prozent in<br />
2001 auf 80 Prozent in 2006 zurück.<br />
6 Diesen hohen Grad an Wertschätzung findet Michael Behr ebenso in seinen aktuellen<br />
Untersuchungen der Metall- und Elektroindustrie in allen fünf neuen Bundesländern und verweist<br />
zugleich auf eine folgenreiche Diskrepanz zwischen der Wertschätzung der betrieblichen<br />
Fachkräftebasis und der Anerkennung der Leistungen der (Facharbeiter-) Belegschaft. Vgl. Behr,<br />
M. 2009.
Ingo Wiekert<br />
Tabelle 3: Rolle der Fachkräfte im Betrieb nach Betriebsgröße im Zeitvergleich –<br />
2001 und 2006; Sachsen-Anhalt; Prozent<br />
entscheidend<br />
nicht entscheidend<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und<br />
weniger<br />
14<br />
20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Gesamt<br />
2001 85,7 87,1 85,8 86,0<br />
2006 88,7 80,0 90,0 86,7<br />
2001 14,3 12,9 14,2 14,0<br />
2006 11,3 20,0 <strong>10</strong>,0 13,3<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Betriebsbefragung 2001 und <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Letzteres erklärt sich zum Teil dar<strong>aus</strong>, dass vor allem Betriebe dieser Größenklasse<br />
in 2006 angaben, der gegenwärtige Hauptweg ihrer Rekrutierungen richte sich eher<br />
auf die Einstellung vom Arbeitsmarkt mit anschließender interner Weiterbildung und<br />
Vermittlung betriebsspezifischen Wissens denn auf die eigene Ausbildung der<br />
benötigten Fachkräfte. 7 Ausbildung hat <strong>dem</strong>zufolge hier als Rekrutierungsinstrument<br />
einen anderen Stellenwert (vgl. Tabelle 4).<br />
Tabelle 4: Hauptwege der Fachkräfterekrutierung – 2006; Sachsen-Anhalt;<br />
Zeilenprozent<br />
vom Arbeitsmarkt<br />
mit interner<br />
Weiterbildung<br />
Hauptweg Einstellung Fachkräfte<br />
eigene<br />
Ausbildung<br />
passgenaue<br />
Qualifikation vom<br />
Arbeitsmarkt<br />
Insgesamt<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und weniger <strong>10</strong>,9 58,7 30,3 <strong>10</strong>0,0<br />
20 bis 99 22,5 50,0 27,5 <strong>10</strong>0,0<br />
<strong>10</strong>0 und mehr 13,7 60,8 25,5 <strong>10</strong>0,0<br />
Gesamt 13,9 56,8 29,3 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Dies zeigt sich auch, befragt man die Ausbildungsbetriebe nach möglichen<br />
Alternativen zur eigenen Ausbildung (vgl. Tabelle 5). In erster Linie ist <strong>für</strong> die große<br />
Mehrheit der Befragten hier die eigene Ausbildung der Königsweg. Mögliche weitere<br />
Alternativen zur Ausbildung spielen derzeit insgesamt nur <strong>für</strong> einen kleinen Teil der<br />
Betriebe eine Rolle.<br />
7 Zu Form und Funktion betrieblicher Weiterbildung siehe den Beitrag Holle Grünerts in diesem Band.
15<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Tabelle 5: Perspektivische Alternativen zur eigenen Ausbildung nach Betriebsgröße<br />
– 2006; Sachsen-Anhalt; Prozent; Mehrfachnennungen; „trifft zu“ - Angabe<br />
Ausbildungsbetriebe mit ...<br />
Beschäftigten Gesamt<br />
19 und weniger 20 und mehr<br />
eigene Ausbildung ist Königsweg 85,9 85,4 85,8<br />
Auslagerung von Ausbildungsteilen an<br />
Bildungsträger bzw. andere Partner<br />
9,6 16,4 11,7<br />
betriebsspezifisch <strong>aus</strong>bilden <strong>10</strong>,5 11,7 <strong>10</strong>,9<br />
verstärkt Fachkräfte vom Arbeitsmarkt<br />
einstellen<br />
4,7 15,0 7,9<br />
Einstellung von Höherqualifizierten 2,1 8,5 4,1<br />
Produktion umstellen und weniger<br />
Qualifizierte einstellen<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
1,6 3,3 2,1<br />
Betrachtet man die Unterschiede zwischen den Betriebsgrößen, so scheint mit<br />
steigender Mitarbeiterzahl das Gestaltungspotential jedoch zuzunehmen. Auch wenn<br />
in den größeren Betrieben ebenso die Mehrheit die eigene Ausbildung als<br />
Königsweg sieht, gehen diese Betriebe zu<strong>dem</strong> davon <strong>aus</strong>, Äquivalente wie die<br />
Einstellung von Fachkräften bzw. Höherqualifizierten vom Arbeitsmarkt oder eine<br />
Kooperation in der Ausbildung 8 als Rekrutierungsweg realisieren zu können.<br />
Festzuhalten ist, dass sich die Rolle der Facharbeit nicht geändert hat. Fachkräfte<br />
sind nach wie vor ein wichtiger Erfolgsfaktor <strong>für</strong> die Betriebe, und die eigene<br />
Ausbildung ist, wenn auch mit einigen kleinen Abstrichen, der wichtigste Weg <strong>für</strong><br />
diese Betriebe, um sich mit Fachkräften zu versorgen. Zurück zum ersten Teil der<br />
Frage: Macht sich der Bewerbermangel bei den Betrieben bereits bemerkbar?<br />
4. Problemwahrnehmung<br />
Wie die oben zitierte IfM-Studie belegen konnte, zeigen sich viele Betriebe<br />
sensibilisiert, wenn es um die <strong>dem</strong>ographischen Entwicklungen geht. Jedoch<br />
verweisen die Autoren der Studie auch darauf, dass der Umstand, dass viele<br />
Unternehmen vom <strong>dem</strong>ographischen Wandel zumindest gehört hatten, der Bericht-<br />
erstattung in den Massenmedien geschuldet ist. 9<br />
8 Bei den möglichen Kooperationsformen kommt der in den neuen Ländern etablierten<br />
Bildungsträgerstruktur eine spezifische Rolle zu. Siehe dazu Wiekert, I. 2007 und zu den dar<strong>aus</strong><br />
erwachsenen Konsequenzen: Wiekert, I.; Sackmann, R. 20<strong>10</strong>.<br />
9 Siehe dazu Kay, R.; Kranzusch, P.; Suprinovic, O. 2008: S.42.
Ingo Wiekert<br />
Ein massenmedial thematisierter „Fachkräftemangel“ ist aber <strong>für</strong> die konkrete<br />
Handlungsebene der betrieblichen Rekrutierungspolitik zu abstrakt. Die sich <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
Wandel ergebenden Konsequenzen <strong>für</strong> das Rekrutierungsverhalten der Betriebe sind<br />
dar<strong>aus</strong> nur schwer abzuleiten.<br />
Eine von den Betrieben erfahrbare Konsequenz des <strong>dem</strong>ographischen Wandels ist<br />
jedoch der Rückgang der Zahl der Schulabsolventen, die sich unmittelbar bei den<br />
Betrieben als Rückgang der Bewerberzahl bemerkbar macht. Die rückläufige<br />
Entwicklung der Absolventenzahlen setzte in Ostdeutschland ungefähr zur Mitte des<br />
Jahrzehnts ein und wird im Jahr 20<strong>10</strong> ungefähr die Hälfte des Nive<strong>aus</strong> von 2003<br />
erreicht haben. <strong>10</strong><br />
Tabelle 6: Entwicklung Bewerberzahl in den letzten fünf Jahren nach Betriebsgröße –<br />
2006; Sachsen-Anhalt; Spaltenprozent<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und weniger 20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Gesamt<br />
gestiegen 29,9 31,7 14,0 29,1<br />
gleich geblieben 40,3 44,1 62,6 42,9<br />
gesunken 29,8 24,2 23,4 28,0<br />
Insgesamt <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Befragt nach der Veränderung der Bewerberzahlen gaben mehr als 40 Prozent der<br />
anhaltinischen Ausbildungsbetriebe an, dass sich diese, rückblickend auf die letzten<br />
fünf Jahre, nicht verändert haben (vgl. Tabelle 6). Ein knappes Drittel verzeichnete<br />
gar eine Steigerung der Bewerberzahlen über diesen Zeitraum. Nur jeder Vierte gibt<br />
an, dass sich die Lage verschlechtert hat. Lediglich eine Minderheit ist <strong>dem</strong>zufolge<br />
bereits von sinkenden Nachwuchszahlen betroffen.<br />
Einerseits geben die Betriebe an, von der sich abzeichnenden Problematik zu<br />
wissen, aber andererseits sind sie mit ihr noch nicht mehrheitlich konfrontiert.<br />
Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund die Einschätzung der zukünftigen Lage<br />
auf <strong>dem</strong> Ausbildungsstellenmarkt, der aufgrund der hohen Schulabgängerzahlen bis<br />
2005 noch durch einen Bewerberüberschuss gekennzeichnet war.<br />
So sieht nicht einmal die Hälfte der befragten Betriebe in Sachsen-Anhalt dieses<br />
Problem <strong>für</strong> sich als akut an (vgl. Tabelle 7). Mehr als jeder Zweite geht davon <strong>aus</strong>,<br />
dass Ausbildungsplatzbewerber in den nächsten Jahren nicht knapper werden.<br />
<strong>10</strong> Siehe dazu die (laufenden) statistischen Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz; hier: Nr.<br />
173 – Januar 2005.<br />
16
17<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Tabelle 7: Werden Ausbildungsplatzbewerber in den nächsten Jahren knapper? nach<br />
Wirtschaftssegmenten – 2006; Sachsen-Anhalt; Spaltenprozent<br />
Primäres<br />
Segment<br />
Wirtschaftssegmente 2006 11<br />
Sekundäres<br />
Segment<br />
Tertiäres<br />
Segment<br />
public<br />
sector<br />
Gesamt<br />
ja 32,3 43,2 55,0 38,9 45,4<br />
nein 67,7 56,8 45,0 61,1 54,6<br />
Insgesamt <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Aber es zeigen sich ebenso sektorale Unterschiede in der Einschätzung: Im tertiären<br />
Segment ist die Sensibilität <strong>für</strong> dieses Problem stärker <strong>aus</strong>gebildet. Das ist auch<br />
nicht weiter verwunderlich, da in diesem Teil der Wirtschaft bereits vermehrt die<br />
Erfahrung gemacht wurde, angebotene Ausbildungsplätze nicht besetzen zu können<br />
bzw. mit einer sinkenden Bewerberzahl umgehen zu müssen. Gaben im Schnitt 45<br />
Prozent der Betriebe an, dass Bewerber knapper werden, waren es im<br />
Dienstleistungssektor 55 Prozent. Eine gegenteilige Einschätzung geben Aus-<br />
bildungsbetriebe <strong>aus</strong> jenen Segmenten, die in den letzten Jahren weit weniger von<br />
einem Bewerberrückgang betroffen waren: das primäre oder Landwirtschafts-<br />
segment mit 68 Prozent und der i.w.S. public oder soziale Sektor mit 61 Prozent.<br />
Auch <strong>für</strong> die Begründung ihrer Einschätzung lassen sich Unterschiede <strong>aus</strong>machen.<br />
Generell gilt <strong>für</strong> die Ursachenzurechnung jedoch eine einfache Zuschreibungsformel:<br />
Der Erfolg (die Erwartung des Bewerbermangels als unproblematisch) liegt im<br />
eigenen Betrieb begründet, der Misserfolg (die Erwartung eines zum Problem<br />
werdenden Bewerbermangels) ist den Umständen zuzurechnen (vgl. Tabelle 8 bzw.<br />
Tabelle 9):<br />
11 Die einzelnen Wirtschaftszweige wurden <strong>für</strong> die Analysen in vier Wirtschaftsbereiche<br />
zusammengefasst. Dabei handelt es sich um:<br />
1) den „Primären Bereich“, welcher Betriebe der Land- und Forstwirtschaft u.ä. umfasst,<br />
2) den „Sekundären Bereich“ mit Betrieben des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes,<br />
3) den „Tertiären Bereich“ mit Betrieben, die Dienstleistungen (i.w.S.) <strong>für</strong> Unternehmen und<br />
Personen anbieten und um<br />
4) den „Öffentlicher Sektor“ mit Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen wie Teilen des<br />
Öffentlichen Dienstes und der Sozialversicherung.
Ingo Wiekert<br />
Tabelle 8: Warum werden Ausbildungsplatzbewerber knapper? nach Betriebsgröße<br />
– 2006; Sachsen-Anhalt; Prozent; Mehrfachnennungen; „trifft zu“ - Angabe<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und<br />
weniger<br />
18<br />
20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Gesamt<br />
Zahl Schulabgänger rückgängig 60,0 79,7 79,2 65,8<br />
Abwanderung 51,4 54,7 33,3 50,6<br />
schulische Ausbildung bevorzugt 17,8 17,2 8,3* 16,9<br />
attraktivere Betriebe 18,9 39,1 16,7 23,1<br />
Attraktivitätseinbußen<br />
Ausbildungsberuf<br />
geringes Leistungsniveau der<br />
Bewerber<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006; *geringe Fallzahlen<br />
37,3 25,0 20,8 33,3<br />
14,1 12,5 16,7 13,9<br />
So führen zwei Drittel der Betriebe, die einen Rückgang erwarten, dies ganz<br />
realistisch auf rückläufige Schulabgängerzahlen zurück. Noch die Hälfte sieht diese<br />
Entwicklung, evtl. zusätzlich, durch die Abwanderung junger Menschen <strong>aus</strong> der<br />
Region verursacht. Dass andere Betriebe auf potentielle Bewerber attraktiver wirken<br />
würden bzw. das Angebot eines weniger attraktiven Berufs der Grund <strong>für</strong><br />
<strong>aus</strong>bleibende Bewerbungen sein könnten, wird als Begründung <strong>für</strong> die Einschätzung<br />
der zukünftigen Bewerberlage vergleichsweise selten angeführt.
19<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Tabelle 9: Warum werden Ausbildungsplatzbewerber nicht knapper? nach<br />
Wirtschaftssegmenten – 2006; Sachsen-Anhalt; Prozent; Mehrfachnennungen; „trifft<br />
zu“ - Angabe<br />
Zahl Schulabgänger nicht<br />
rückgängig<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und<br />
weniger<br />
20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Gesamt<br />
22,7 27,5 11,5 23,1<br />
Altbewerber 25,6 34,1 19,2 27,3<br />
Zuwanderung 9,5 7,7 15,4 9,5<br />
attraktiver Betrieb 46,4 61,5 73,1 52,3<br />
Attraktivitätszunahme<br />
Ausbildungsberuf<br />
große Nachfrage trägt<br />
weiterhin<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
49,8 47,3 53,8 49,4<br />
12,3 11,0 11,5 11,9<br />
Deutlich anders ist das Bild, das sich <strong>aus</strong> den Antworten der Betriebe ergibt, die nicht<br />
mit einem Rückgang der Zahl der Lehrstellenbewerber rechnen. Diese Betriebe<br />
nennen vor allem zwei Gründe, die ihrer Meinung nach beide belegen, dass die<br />
Entwicklung der Zahl der Ausbildungsbewerber <strong>für</strong> sie kein ernsthaftes Problem ist:<br />
Die Attraktivität des eigenen Betriebes sei hoch, worauf vor allem die größeren<br />
Betriebe hinweisen und die Attraktivität des Berufes, in <strong>dem</strong> diese Betriebe<br />
<strong>aus</strong>bilden, sei gestiegen.<br />
5. Reaktionen und Konsequenzen<br />
Angesichts der in 2006 bereits absehbaren Verknappung von Bewerbern um einen<br />
betrieblichen Ausbildungsplatz hätten die Betriebe verschiedene Möglichkeiten auf<br />
diese Entwicklungen zu reagieren. Unabhängig davon, wie die Betriebe die<br />
zukünftige Bewerberlage einschätzen, wurden sie gebeten anzugeben, wie sie einem<br />
Bewerbermangel begegnen würden.<br />
Mit den Zahlen der Tabelle <strong>10</strong> wird deutlich, dass dabei zwei Reaktionen im<br />
Vordergrund stehen: Ein relativ hoher Anteil von 42 Prozent der Betriebe gibt an, sie<br />
würden so weitermachen wie bisher. 40 Prozent würden härter um die weniger<br />
werdenden Lehrstellenbewerber konkurrieren. Stärkere Kooperation wird von knapp<br />
30 Prozent als realistische Perspektive gesehen. Mehr als jeder vierte Betrieb gibt<br />
an, im Falle eines Rückgangs der Bewerberzahl nicht mehr <strong>aus</strong>zubilden. Hingegen
Ingo Wiekert<br />
schlechtere Bewerber einzustellen, wird nur von je<strong>dem</strong> sechsten Betrieb als<br />
mögliche Reaktion auf einen spürbaren Rückgang der Bewerberzahl ins Auge<br />
gefasst.<br />
Tabelle <strong>10</strong>: Reaktionen auf sinkende Bewerberzahlen nach Betriebsgröße – 2006;<br />
Sachsen-Anhalt; Prozent; Mehrfachnennungen; „trifft zu“ - Angabe<br />
Ausbildungsbetriebe mit ...<br />
Beschäftigten Gesamt<br />
19 und weniger 20 und mehr<br />
härteres Konkurrieren 37,7 45,1 40,0<br />
Einstellung schlechterer Bewerber 15,7 17,0 16,1<br />
Kooperation und Engagement in<br />
Ausbildungsverbünden<br />
Aufgabe Erst<strong>aus</strong>bildung und<br />
Einstellung von Absolventen<br />
28,1 32,5 29,5<br />
28,3 28,8 28,5<br />
weitermachen wie bisher 42,6 41,7 42,4<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Gerade Letzteres wäre eine nicht unpl<strong>aus</strong>ible, erwartbare Reaktion der Betriebe:<br />
Angesichts der veränderten Knappheiten am Lehrstellenmarkt könnte die<br />
Bereitschaft der Betriebe steigen, die Anforderungen an die Schulabgänger<br />
abzusenken. Dies ist jedoch nicht der Fall.<br />
In den Befragungen 2001 und 2006 wurden die Ausbildungsbetriebe gebeten, sich<br />
eine Situation vorzustellen, in der sie nur Bewerber mit einem schlechteren<br />
schulischen Abschluss einstellen könnten. Im Anschluss daran sollten sie zwischen<br />
drei Reaktionsmöglichkeiten wählen: Einen Bewerber auch dann einzustellen, wenn<br />
der Gesamteindruck trotz unzureichender schulischer Leistungen überzeugt; einen<br />
weniger überzeugenden Bewerber zu nehmen, weil es keine Alternative gibt oder<br />
den Ausbildungsplatz lieber nicht zu besetzen. Die Tabelle 11 zeigt die Präferenz der<br />
befragten Betriebe <strong>für</strong> diese drei Reaktionsmöglichkeiten.<br />
20
21<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Tabelle 11: Einstellung von Bewerbern mit niedrigerem Abschluss? im Zeitvergleich<br />
– 2001 und 2006; Sachsen-Anhalt; Prozent<br />
Einstellung, wenn der<br />
Gesamteindruck überzeugt<br />
Einstellung, wenn es keine<br />
anderen Bewerber gäbe<br />
nein, Platz eher nicht besetzen<br />
Ausbildungsbetriebe mit ... Beschäftigten<br />
19 und<br />
weniger<br />
20 bis 99 <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Gesamt<br />
2001 72,6 79,6 68,3 73,9<br />
2006 67,1 64,6 57,1 65,8<br />
2001 3,8 2,7 9,2 3,9<br />
2006 4,2 8,9 8,2 5,6<br />
2001 23,6 17,8 22,5 22,2<br />
2006 28,7 26,6 34,7 28,6<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Betriebsbefragung 2001 und <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Die Grundtendenz in den Antworten hat sich dabei zwischen 2001 und 2006 kaum<br />
verändert. Nach wie vor ist eine deutliche Mehrzahl der Betriebe der Meinung, bei<br />
einem überzeugenden Gesamteindruck seien Schulniveau und schulische<br />
Leistungen sekundär. Zugleich wird nach wie vor das Ausweichen auf schlechtere<br />
Bewerber, die auch abgesehen von den Schulnoten nicht überzeugen können, nur<br />
von einer kleinen Minderheit ins Auge gefasst.<br />
Insgesamt hat jedoch die Position „einstellen, wenn der Gesamteindruck überzeugt“<br />
von 2001 auf 2006 genau acht Prozentpunkte verloren, hingegen die Position „den<br />
Platz eher nicht besetzen“ über sechs Prozentpunkte gewonnen. Die Bereitschaft der<br />
Betriebe zu Zugeständnissen bei den Bewerbervor<strong>aus</strong>setzungen ist also entgegen<br />
der formulierten Erwartung eher gesunken denn gestiegen.<br />
Mit einem Wechsel der Perspektive vom Ausbildungsbeginn zum Ausbildungsende<br />
soll abschließend noch ein kurzer Blick auf das Übernahmeverhalten der Betriebe<br />
gerichtet werden. Es wäre zu erwarten, dass Betriebe, wenn sie auf die Qualität der<br />
Fachkräfte als Erfolgsrezept setzen, eine eigene Ausbildung als wichtigen<br />
Bestandteil ihrer Fachkräfterekrutierung erachten und weniger Kompromisse bei den<br />
Bewerbervor<strong>aus</strong>setzungen machen, die selbst <strong>aus</strong>gebildeten Nachwuchsfachkräfte<br />
auch übernehmen.<br />
Befragt nach eventuellen Veränderungen im eigenen Übernahmeverhalten, gibt über<br />
die Hälfte der interviewten Betriebe an, dass sich bei ihren Übernahmen in den<br />
letzten fünf Jahren nichts geändert hat (vgl. Tabelle 12). Aber ein weiteres Fünftel<br />
trifft bei möglichen Übernahmen eine genauere Auswahl. Jeweils elf Prozent<br />
beschreiben die Veränderungen dahingehend, dass sie mehr Ausbildungs-
Ingo Wiekert<br />
absolventen unbefristet oder befristet übernehmen bzw. weniger oder auch gar nicht<br />
mehr übernehmen.<br />
Tabelle 12: Änderung des Übernahmeverhaltens in den letzten fünf Jahren nach<br />
Betriebsgröße – 2006; Sachsen-Anhalt; Prozent; Mehrfachnennungen; „trifft zu“ -<br />
Angabe<br />
Ausbildungsbetriebe mit ...<br />
Beschäftigten Gesamt<br />
19 und weniger 20 und mehr<br />
keine Veränderungen 56,2 54,9 55,8<br />
genauere Auswahl 19,2 20,7 19,7<br />
mehr unbefristete<br />
Übernahmen<br />
3,0 5,2 3,7<br />
mehr befristete Übernahmen 6,6 <strong>10</strong>,8 7,9<br />
weniger unbefristete<br />
Übernahmen<br />
weniger befristete<br />
Übernahmen<br />
5,6 3,8 5,0<br />
3,0 4,2 3,4<br />
keine Übernahmen mehr 3,5 1,4 2,9<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Im Zeitvergleich des allgemeinen Übernahmeverhaltens ergibt sich<br />
<strong>dem</strong>entsprechend ein relativ konstantes Bild (vgl. Abbildung 1). In den anhaltinischen<br />
Betrieben, in denen <strong>aus</strong>gebildet wird, wird auch mehrheitlich unbefristet oder<br />
zumindest befristet übernommen.<br />
Insgesamt hat sich der Anteil der übernehmenden Betriebe jedoch reduziert. Im Jahr<br />
2001 gaben 53 Prozent der befragten Betriebe an zu übernehmen. In 2006 sank<br />
dieser Anteil auf 48 Prozent. Zu<strong>dem</strong> verdoppelte sich der Anteil der Betriebe, die<br />
angaben, generell nicht zu übernehmen von acht in 2001 auf 16 Prozent in 2006.<br />
Gerade unter den kleinen Betrieben (mit 19 und weniger Beschäftigten) wird deutlich<br />
häufiger die Option „keine Übernahme“ gewählt, wenn es darum geht, die eigene<br />
Übernahmestrategie zu beschreiben. Entgegen <strong>dem</strong> Trend in den beiden anderen<br />
Größenklassen fällt in der kleinsten Betriebsgröße der aktuelle Anteil der<br />
Übernehmenden hinter den von 2001 zurück.<br />
Von der Nennung „Übernahme im Ausnahmefall“ wurde in der 2006er Befragung mit<br />
36 Prozent nicht so oft wie in 2001 mit 39 Prozent Gebrauch gemacht. Angesichts<br />
dieser Zahlen und eingedenk dessen, dass 20 Prozent der Befragten angegeben<br />
haben, sie würden bei Übernahmen zunehmend genauer hinschauen, liegt die<br />
22
23<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Schlussfolgerung nahe, dass sich die Ausbildungsbetriebe einer (verglichen mit<br />
2001) rigideren Rekrutierungsstrategie zugewandt haben – auf Kosten der<br />
Übernahme.<br />
Abbildung 1: Übernahmeverhalten nach Betriebsgröße im Zeitvergleich 2001/2006 in<br />
Sachsen-Anhalt<br />
<strong>10</strong>0%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
8,5<br />
41,0<br />
50,5<br />
20,2<br />
39,5<br />
40,3<br />
7,9 7,7 6,6 6,3 8,3<br />
34,1<br />
58,1<br />
28,8<br />
63,5<br />
2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006<br />
weniger als 20<br />
Beschäftige<br />
34,6<br />
58,8<br />
27,2<br />
66,5<br />
20-99 Beschäftigte <strong>10</strong>0 und mehr<br />
Beschäftigte<br />
Betriebe mit ...<br />
39,1<br />
52,6<br />
16,2<br />
36,0<br />
47,7<br />
Betriebe gesamt<br />
unbefristete wie befristete Übernahme Übernahme im Ausnahmefall generell keine Übernahme<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Betriebsbefragung 2001 und <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
6. Zwischenfazit<br />
An dieser Stelle sei eine knappe Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen<br />
eingefügt:<br />
Zum einen ist der Informationsgrad zum Thema „Demographischer Wandel“ unter<br />
den Betrieben hoch, aber die Thematik wird auf einem hohen Abstraktionsniveau<br />
diskutiert, so dass die mit ihr verbundenen Konsequenzen nur schwer auf die<br />
betriebliche Handlungsebene herunter gebrochen werden können, um dar<strong>aus</strong><br />
entsprechenden Schlüsse zu ziehen.<br />
Zum anderen wird die Bedeutung von Facharbeit <strong>für</strong> das betriebliche Leistungs-<br />
konzept von den Betrieben als sehr hoch angesehen. Zu<strong>dem</strong> gibt es in betrieblicher<br />
Perspektive zur eigenen Ausbildung kaum Alternativen im Rekrutierungsverhalten.
Ingo Wiekert<br />
Eine konkrete Erfahrung mit <strong>dem</strong> Umschlag der Knappheitsverhältnisse ist unter den<br />
Betrieben noch nicht stark verbreitet. Je nach Einschätzung der zukünftigen Lage auf<br />
<strong>dem</strong> Bewerbermarkt machen die Betriebe verschiedene Ursachen <strong>für</strong> Erfolg bzw.<br />
Misserfolg bei der Bewerbersuche <strong>aus</strong>. Diese Zuschreibungen resultieren in ganz<br />
unterschiedlichen Reaktionen.<br />
Die Reaktionen der Betriebe auf die <strong>dem</strong>ographische Entwicklung sind eher<br />
kontraintuitiv: Entgegen der pl<strong>aus</strong>iblen Erwartung sind die Betriebe weniger zu<br />
Zugeständnissen bei den Bewerbervor<strong>aus</strong>setzungen bereit und haben sich zu<strong>dem</strong> in<br />
ihrem Übernahmeverhalten einer rigideren Auswahl zugewandt.<br />
7. Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Abschließend soll noch einmal zu einem bereits angeführten Sachverhalt<br />
zurückgekehrt werden: Eine Mehrheit der befragten Betriebe war der Meinung, dass<br />
nicht mit einer sinkenden Bewerberzahl zu rechnen sei. Wie ist zu erklären, dass die<br />
<strong>dem</strong>ographischen Veränderungen, die doch von großer Bedeutung <strong>für</strong> die Betriebe<br />
sind, von vielen auch dann noch nicht wahrgenommen werden, wenn sie – was 2006<br />
bereits der Fall war – offensichtlich sind?<br />
Die Befragungsergebnisse legen eine Antwort auf diese Frage nahe: Es besteht<br />
offenkundig ein enger Zusammenhang zwischen der Einschätzung der zukünftigen<br />
Entwicklung der Bewerberzahlen auf der einen und den eigenen aktuellen<br />
Erfahrungen der Betriebe mit tatsächlichem Rückgang der Lehrstellenbewerber auf<br />
der anderen Seite.<br />
Tabelle 13: Bisherige und erwartete Entwicklung der Bewerberzahlen – 2006;<br />
Sachsen-Anhalt; Tabellenprozent<br />
Die Bewerberzahl ...ist nicht gesunken. ...ist gesunken. Gesamt<br />
...wird nicht sinken. 46,8 6,4 53,2<br />
...wird sinken. 24,6 22,2 46,8<br />
Gesamt 71,4 28,6 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Ausbildungsbetriebsbefragung 2006<br />
Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich, dass ein gutes Viertel aller befragten Betriebe<br />
bereits Erfahrungen mit rückläufigen Bewerberzahlen gemacht hat. Mehrheitlich<br />
rechnen diesen Betriebe – ganz realistisch – damit, dass diese Entwicklung anhält<br />
oder sich noch verstärkt. Nur die wenigsten erwarten zukünftig eine gegenläufige<br />
24
25<br />
Aus Erfahrungen werden Erwartungen<br />
Entwicklung. Viele von ihnen haben vermutlich noch die Chance, sich rechtzeitig auf<br />
die neuen Verhältnisse einzustellen.<br />
Ganz anders ist die Lage bei der größten Gruppe, der knapp drei Viertel der<br />
befragten Betriebe angehören. Diese Betriebe haben bisher keine Erfahrungen mit<br />
sinkenden Bewerberzahlen gemacht. Und sie rechnen mit deutlicher Mehrheit auch<br />
in Zukunft nicht mit einem Rückgang der Bewerberzahlen. Diese Betriebe hatten<br />
noch keine Gelegenheit zu lernen und sind auf <strong>dem</strong> Weg in eine Zeitfalle, was sie mit<br />
sehr hoher Wahrscheinlichkeit erst feststellen dürften, wenn es zu spät ist,<br />
erfolgreich gegenzusteuern.<br />
Es ist also nicht die Diskussion um die <strong>dem</strong>ographische Entwicklung und ihre<br />
Konsequenzen, welche die Basis <strong>für</strong> die betriebliche Wahrnehmung eines<br />
Rekrutierungsproblems bildet, sondern es werden vielmehr die konkreten<br />
Erfahrungen bei der Rekrutierung der letzten Jahre in die Zukunft fortgeschrieben.<br />
War es <strong>für</strong> Betriebe in der Vergangenheit schwierig Schulabsolventen <strong>für</strong> sich zu<br />
gewinnen, so rechnet ein Großteil dieser Betriebe auch in Zukunft mit<br />
Schwierigkeiten. Konkret betroffen zu sein, be<strong>für</strong>chten Betriebe, die konkret betroffen<br />
waren: Aus Erfahrungen wurden Erwartungen. 12<br />
Nun liegt der letzte Befragungszeitpunkt bereits drei Jahre zurück. Angesichts<br />
dessen, dass es mehr als drei Ausbildungsjahre braucht, um eine Fachkraft<br />
heranzubilden, kann man annehmen, dass sich das Zeitfenster einer<br />
Lerngelegenheit <strong>für</strong> Betriebe bereits wieder zu schließen beginnt. 13 Betriebe, die erst<br />
heute damit beginnen auf die langfristigen Entwicklungen zu reagieren, könnten<br />
damit schon in einer Zeitfalle stecken.<br />
12 Dass es sich dabei nicht um einen <strong>für</strong> Ostdeutschland spezifischen Zusammenhang handelt, konnte<br />
in einer Studie <strong>für</strong> die Region Hannover gezeigt werden, an der das <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong><br />
Halle maßgeblich beteiligt war. Vgl. Brandt, A.; Brunken, K.; Gehrke, J.-P.; Wiekert, I.;<br />
Ketzmerick, T.; 20<strong>10</strong>: insbes. S.41ff.<br />
13 Vgl. dazu auch Lutz, B.; Wiekert, I. 2008: S.23ff.
Ingo Wiekert<br />
Literatur<br />
Behr, Michael (2009): Der unglückliche Erfolgsfaktor - beschleunigt, aktiviert, aber nicht<br />
zukunftsfähig. WSI-Mitteilungen; Heft <strong>10</strong>.<br />
Brandt, Arno; Brunken, Kerstin; Gehrke, Jan-Phillip; Wiekert, Ingo; Ketzmerick, Thomas;<br />
(20<strong>10</strong>): Fachkräftemangel und <strong>dem</strong>ographischer Wandel bis 2020: Gutachten im Auftrag<br />
der Region Hannover. Teil II: Handlungsansätze <strong>für</strong> kleine und mittlere Unternehmen in<br />
der wissensintensiven Wirtschaft in der Region Hannover. Online-Publikation der<br />
Wirtschaftsförderung Hannover; www.unternehmerbuero-hannover.de (14.02.20<strong>10</strong>).<br />
Best, Heinrich et al. (2004): Challenge und Response - Das Forschungsprogramm des SFB<br />
580 in den Jahren 2004 bis 2008; Mitteilungen des SFB 580; Heft 15, Jena.<br />
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2002): Betriebliche Erst<strong>aus</strong>bildung in Sachsen-<br />
Anhalt. <strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 02-3, Halle.<br />
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2007): Betriebliche Ausbildung und<br />
Arbeitsmarktlage – eine vergleichende Untersuchung in Sachsen-Anhalt, Brandenburg<br />
und Niedersachsen. <strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 07-5, Halle.<br />
Kay, Rosemarie; Kranzusch, Peter; Suprinovic, Olga (2008): Absatz- und Personalpolitik<br />
mittelständischer Unternehmen im Zeichen des <strong>dem</strong>ographischen Wandels –<br />
Her<strong>aus</strong>forderungen und Reaktionen. In: IfM-Materialien, 183, Bonn, Institut <strong>für</strong><br />
Mittelstandsforschung.<br />
Lutz, Burkart (2000): Versuch einer ersten Bilanz. Der blockierte Generationen<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch als<br />
dominanter Tatbestand. In: Lutz, Burkart; Grünert, Holle; Steiner, Christine (Hg.): Bildung<br />
und Beschäftigung in Ostdeutschland, Bd. 1. Berlin: Berliner Debatte<br />
Wissenschaftsverlag, S. 199-215.<br />
Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2008): Ostdeutsche Betriebe in der Falle oder im<br />
Paradigmenwechsel? In: Arbeits- und Industriesoziologische Studien. Online-Journal der<br />
Sektion Arbeits- und Industriesoziologie in der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Soziologie<br />
(DGS); S.6-26; www.ais-studien.de.<br />
Schmidt, Rudi et al. (2002): Ein neuer sozialwissenschaftlicher Sonderforschungsbereich<br />
stellt sich vor. Mitteilungen des SFB 580, Heft 1, Jena.<br />
Wiekert, Ingo (2007): Wild blühende Landschaften? Strukturelle Merkmale der ostdeutschen<br />
Bildungsträgerlandschaft. In: Berger, Kl<strong>aus</strong>; Grünert, Holle (Hg.): Zwischen Markt und<br />
Förderung. Wirksamkeit und Zukunft von Ausbildungsplatzstrukturen in Ostdeutschland.<br />
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, S. 139-165.<br />
Wiekert, Ingo; Sackmann, Reinhold (20<strong>10</strong>): Mehr Ungleichheit durch weniger duale<br />
Ausbildung? Probleme der Ausbildungsbereitschaft. In: Krüger, Heinz-Hermann; Rabe-<br />
Kleberg, Ursula; Kramer, Rolf-Torsten; Budde, Jürgen (Hg.): Bildungsungleichheit<br />
revisited. Bildung und soziale Ungleichheit vom Kindergarten bis zur Hochschule. Studien<br />
zur Schul- und Bildungsforschung Bd. 30; Wiesbaden: VS Verlag <strong>für</strong><br />
Sozialwissenschaften, S. 299-319.<br />
Wiener, Bettina (2005): Wird die <strong>dem</strong>ographische Falle zum Kassandra-Ruf? In: Wiekert,<br />
Ingo (Hg.) (2005): Zehn <strong>aus</strong> Achtzig. Burkart Lutz zum 80. Berlin: Berliner Debatte<br />
Wissenschaftsverlag, S. 47-75.<br />
26
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt – Neue Risiken <strong>für</strong><br />
Unternehmen in der Nachwuchs- und Fachkräftesicherung<br />
Michael Behr, Martin Ehrlich und Ingo Wiekert<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena und <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
1. Zur Ausgangslage<br />
In den neuen Ländern haben sich 20 Jahre nach der Wende im<br />
Dienstleistungssektor, in der Verwaltung, der Sozialwirtschaft und <strong>dem</strong><br />
Gesundheitssektor, der Landwirtschaft, <strong>dem</strong> B<strong>aus</strong>ektor sowie <strong>dem</strong> verarbeitenden<br />
Gewerbe – bei allen noch vorhandenen strukturellen Defiziten – wettbewerbsfähige<br />
Betriebe her<strong>aus</strong>gebildet. Insbesondere im industriellen Sektor haben sich inzwischen<br />
wieder viele dynamische Unternehmen in zukunftsträchtigen Industriebranchen<br />
etabliert, die in den vergangenen Jahren erhebliche Wachstumsraten bei Umsätzen,<br />
Exportanteilen und Beschäftigung erzielen konnten. Dies gilt in besonderem Maße<br />
<strong>für</strong> den Werkzeug- und Maschinenbau, den Fahrzeugbau und die<br />
Fahrzeugzulieferindustrie, die Optische Industrie und die Metall- und Elektroindustrie,<br />
die Chemische Industrie und die Kunststoffindustrie, die Mikroelektronik und nicht<br />
zuletzt auch <strong>für</strong> die Nahrungsmittelindustrie. Entgegen <strong>dem</strong> Bundestrend weisen<br />
gerade die Bundesländer Sachsen und Thüringen seit mehr als <strong>10</strong> Jahren einen<br />
starken Aufbau an Industriearbeitsplätzen und Arbeitsplätzen im Bereich der<br />
unternehmensnahen Dienstleistungen auf. Auch wenn die Unternehmen mit Blick auf<br />
die Wirtschaftskrise die Umsatzerwartungen <strong>für</strong> 2009 stark nach unten korrigierten,<br />
dominiert bei den meisten Geschäftsführern zumindest heute noch eine optimistische<br />
Haltung, aufgrund der eigenen Wettbewerbsposition und der hohen Flexibilität beim<br />
nächsten Aufschwung wieder gut dabei zu sein. 1<br />
Viele Firmen haben sich dabei – anders als es die Metapher der „verlängerten<br />
Werkbank“ nahe legt – vor allem als intelligente Problemlöser und flexible Anbieter<br />
kundenspezifischer Produkte mit erheblicher Innovationsfähigkeit in die Märkte<br />
hineingearbeitet und sich dabei nach und nach in übergeordnete<br />
Wertschöpfungszusammenhänge integriert. Flexibilität, Zuverlässigkeit, Qualitäts-<br />
orientierung und Produkte sowie Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen sind die<br />
1 So die Ergebnisse eigener Geschäftsführerbefragungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahr 2009 in der Optischen<br />
Industrie Thüringens und der Fahrzeugzulieferindustrie in der Wirtschaftsregion Chemnitz-<br />
Zwickau, siehe: Behr, M.; Tolksdorf, G. 2009 und Behr, M.; Thieme, C. 2009.<br />
27
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Markenzeichen ostdeutscher Unternehmen. Weit<strong>aus</strong> mehr als in den Jahren nach<br />
der Wende profitiert das Innovationsgeschehen in den Firmen von einer zunehmend<br />
besseren Verzahnung zwischen der teilweise sehr guten Wissenschaftsinfrastruktur<br />
und den Aktivitäten in den Firmen. Die Dynamik in der Kooperation zwischen<br />
Wissenschaft und Wirtschaft ist das Ergebnis einer verstärkten Bedeutung des<br />
Themas Innovation in den Unternehmen. Die Unternehmen der Region sind immer<br />
mehr in der Lage, Ressourcen in den Transferprozess einzubringen: Know-how, Zeit,<br />
Entwicklungsperspektiven, Anwendermärkte und Geld. Für die Hochschulen und<br />
außeruniversitären Forschungseinrichtungen lohnt es sich immer mehr, ihre<br />
Forschungsschwerpunkte auf die Technologieschwerpunkte der Industriebranchen<br />
der Region <strong>aus</strong>zurichten. 2 Die enge Zusammenarbeit bietet den Unternehmen zu<strong>dem</strong><br />
Chancen, hervorragend <strong>aus</strong>gebildetes Personal zu finden.<br />
Zu<strong>dem</strong> profitieren auch heute noch die Unternehmen von der guten Ausstattung mit<br />
Humankapital. Qualifizierte Ingenieure und Facharbeiter, engagierte Leitungskräfte<br />
und Verwaltungspersonal sind der zentrale Erfolgsfaktor der Region – dies sehen<br />
gerade die Geschäftsführer der Unternehmen so. Insbesondere <strong>aus</strong> West-<br />
deutschland kommende Leitungskräfte loben die solide Qualifikationsbasis der<br />
Mitarbeiter ebenso wie deren Einsatzbereitschaft, Firmenidentifikation und<br />
Motivation. Trotz aller Veränderungen nach der Wende hat sich in vielen<br />
Unternehmen ein hohes Maß an Kollegialität erhalten. 3<br />
Träger der Erfolgsgeschichten in Ostdeutschland sind in einem hohen Maße<br />
Beschäftigte und Führungskräfte, die zum Zeitpunkt der Wende 30 bis 40 Jahre alt<br />
waren und sich nun <strong>dem</strong> Rentenalter nähern. Gegenwärtig sind 28 % der<br />
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den neuen Ländern älter als 50 Jahre. Im<br />
Jahr 2020 werden es vor<strong>aus</strong>sichtlich 40 % sein, 4 während die Zahl der<br />
Renteneintritte von Wissens- und Erfahrungsträgern deutlich zunimmt. Damit geht in<br />
den nächsten 15 Jahren ein erheblicher Teil des Erfahrungs- und Wissensschatzes<br />
sowie des betrieblichen Sozialkapitals verloren.<br />
Aufgrund der <strong>aus</strong>gedünnten <strong>dem</strong>ographischen Basis wird die Bevölkerung in den<br />
neuen Ländern bis 2025 um etwa 15 %, das Potential an Erwerbspersonen aber um<br />
30 % zurückgehen. Das heißt, wir erleben einen dramatischen Umbruch jener<br />
2 Behr, M.; Thieme, C. 2009.<br />
3 Behr, M.; Hinz, A.; Engel, T. 2006.<br />
4 Statistisches Bundesamt und Landesarbeitsämter 2009.<br />
28
29<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
Rahmenbedingungen personalwirtschaftlichen Handelns, die <strong>für</strong> die Wirtschaft und<br />
den Arbeitsmarkt in den letzten 20 Jahren besonders günstig waren. Bis 2015<br />
halbiert sich die Zahl der 18- bis 25-Jährigen potentiellen Nachwuchskräfte<br />
gegenüber 2005. Schon heute erleben wir einen starken Rückgang der<br />
Schulabgängerzahlen. Der Geburtenrückgang hat den Ausbildungsmarkt längst<br />
erreicht, bald verändert er auch die Rekrutierungsbedingungen auf <strong>dem</strong> Arbeitsmarkt<br />
nachhaltig.<br />
In den nächsten 15 Jahren wird es darum gehen, alle Ressourcen zu mobilisieren,<br />
um einen Verlust in der Humankapital<strong>aus</strong>stattung der Industrieunternehmen und der<br />
öffentlichen und privaten Dienstleistungsinfrastruktur zu verhindern. Gelingt es nicht,<br />
das Qualifikationsniveau der Beschäftigten in der Region aufrechtzuerhalten, droht<br />
nicht nur ein Rückfall im Wettbewerbsstatus mit gravierenden Folgen <strong>für</strong> die eben<br />
erst erstarkte Exportwirtschaft, sondern auch ein Absinken der allgemeinen Lebens-<br />
qualität, wenn man etwa an die Bildungsinfrastruktur, die Gesundheitswirtschaft und<br />
die Pflege und Betreuung junger und alter Menschen denkt. In je<strong>dem</strong> Fall wird der<br />
Kampf um die Köpfe zunehmen.<br />
2. Verwöhnt und entwöhnt – Die Vertreibung <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> personalwirtschaftlichen<br />
Paradies<br />
Während der Arbeitsmarkt <strong>für</strong> Arbeitnehmer und Ausbildungsplatzsuchende durch<br />
hohe Arbeitslosigkeit und hohe Eintrittsbarrieren, geringe Jobalternativen und<br />
unsichere Übernahmeerwartung geprägt war, herrschte <strong>für</strong> das Management ein<br />
„personalwirtschaftliches Paradies“ 5 . Die Reserve an qualifizierten, berufserfahrenen<br />
Fachkräften auf den externen Arbeitsmärkten sorgte <strong>für</strong> eine exzellente<br />
Rekrutierungsbasis. Neben der arbeitsmarktbedingten Machtasymmetrie zugunsten<br />
des Managements stellte die schwächere gewerkschaftliche Infrastruktur, die<br />
geringere Konfliktfähigkeit von Arbeitnehmervertretungen und der geringere Anteil<br />
von Betriebsräten eine Ursache <strong>für</strong> die Schwächung der Arbeitnehmerposition 6 dar.<br />
Die innerbetrieblichen Sozialbeziehungen, wie sie sich vor diesem Hintergrund über<br />
den Zeitraum einer Dekade etablieren konnten, lassen sich als „impliziter<br />
Nachwendepakt“ während des „personalpolitischen Moratoriums“ bezeichnen:<br />
„Beschäftigungssicherheit gegen die Bereitschaft zu niedriger Entlohnung, harten<br />
5 Siehe Behr, M; Engel, T. 2001. Für dies und das Folgende vgl. Behr, M.; Engel, T.; Hinz, A. 2008.<br />
6 Vgl. Artus, I. et al. 2001 sowie Ellguth, P. 2004.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Arbeitsbedingungen und geringen Partizipationsansprüchen“ 7 . Tatsächlich<br />
versuchten die Geschäftsführer seit Mitte der 90er Jahre betriebliche Kündigungen<br />
zu vermeiden und ein hohes Maß an Stabilität und Kontinuität zu erhalten 8 , wobei der<br />
dominante Führungsstil als „autokratisch-paternalistisch“ bezeichnet wurde, bei <strong>dem</strong><br />
das „Durchsteuern“ Vorrang hat „gegenüber <strong>dem</strong>okratisch-partizipativen<br />
Entscheidungen in Gremien, Gruppen usw.“ 9 .<br />
Im <strong>dem</strong>ographischen Umbruch verändert sich nun die Machtasymmetrie ein Stück<br />
weit zugunsten der qualifizierten Arbeitskräfte. Die Optionen der Beschäftigten –<br />
natürlich gerade der jungen, gut qualifizierten – steigen. Durch die verbesserten<br />
Wahlmöglichkeiten der Arbeitssubjekte werden jene Unternehmen Vorteile haben,<br />
die bereits in der Vergangenheit – ob mit oder ohne Druck von selbstbewussten Mit-<br />
arbeitern, engagierten Betriebsräten und Gewerkschaften – akzeptable Standards <strong>für</strong><br />
Arbeitnehmer aufgebaut haben wie Leistungsanerkennung, gute Arbeits-<br />
bedingungen, Tariflöhne, gutes Betriebsklima und einen funktionierenden<br />
Generationen<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch. Unternehmen mit defizitären Anerkennungspolitiken,<br />
fehlenden Partizipationsmöglichkeiten, schlechten Arbeitsbedingungen und<br />
autoritären Führungskulturen werden dagegen unter Druck geraten.<br />
Durch den gravierenden Umbruch der personalwirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
kommen in mehrfacher Hinsicht neue Risikokonstellationen auf die Unternehmen zu,<br />
die im Kern auf Fehleinschätzungen über die Motivlage und die beruflichen<br />
Interessen von jungen potentiellen Nachwuchskräften beruhen.<br />
Auf der einen Seite finden sich Unternehmen mit Ausbildungstradition und –<br />
aufgrund der hohen Absolventenzahlen der vergangenen Jahre – sehr günstigen<br />
Rekrutierungs- und Selektionsbedingungen. Diese Erfahrung verführt zu der<br />
Annahme, dass stets <strong>aus</strong>reichend viele Bewerber zur Verfügung stehen. <strong>10</strong> Die in<br />
dieser Perspektive verwöhnten Unternehmen gehen – nicht immer berechtigt –<br />
davon <strong>aus</strong>, ein attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber zu sein. Sollte die Einschätzung<br />
nicht zutreffen, spüren Unternehmen mit einem schlechten Image dann die<br />
Konsequenzen fehlender Attraktivität, wenn die zahlenmäßig geringeren Schul-<br />
abgänger weit bessere Wahlmöglichkeiten haben und sich anders orientieren.<br />
7 Behr, M. 2000.<br />
8 Lungwitz, R.-E.; Preusche, E. 1999.<br />
9 Pohlmann, M.; Meinerz, K.-P.; Wrede, I. 1998: S. 359ff.<br />
<strong>10</strong> Siehe auch den Beitrag Ingo Wiekerts in diesem Band.<br />
30
31<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
Auf der anderen Seite stehen Unternehmen, die über längere Zeiträume kaum oder<br />
gar nicht <strong>aus</strong>gebildet und auch kaum junge Leute vom Arbeitsmarkt eingestellt<br />
haben. Solche „alternden ostdeutschen Überlebensgemeinschaften“ leiden<br />
regelrecht unter <strong>dem</strong> Syndrom der „Jugendentwöhnung“ 11 . Ihnen fehlen – als<br />
verfestigtes Ergebnis des anhaltenden blockierten Generationen<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>chs 12 –<br />
eingespielte Routinen in der Gewinnung, der Ansprache und der Integration von<br />
Nachwuchskräften. Besonders problematisch ist die Syndromatik der Jugend-<br />
entwöhnung dann, wenn in kurzer Zeit große Zahlen älterer Erfahrungsträger in<br />
Rente gehen und dann „plötzlich“ viele Nachwuchskräfte gewonnen werden müssen.<br />
Hier greift dann – neben den Imageproblemen bei den Firmen – auch noch die<br />
Unerfahrenheit im Umgang mit jüngerem Personal.<br />
Die These ist, dass die „Jugendkompetenz“ der Unternehmen zu einem zentralen<br />
Agens von Differenzierungsprozessen wird, bei denen bestimmte Konstellationen,<br />
etwa „alternde Überlebensgemeinschaften“ mit <strong>aus</strong>geprägter Routine der Problem-<br />
verdrängung in ihrer Existenz gefährdet sein könnten. Unternehmenskonstellationen<br />
mit einer etablierten Kultur der Integration von Nachwuchskräften profitieren dagegen<br />
von einem früh begonnenen Paradigmenwechsel. 13<br />
Dazu soll im Folgenden ein Blick auf die Altersstruktur der betrieblichen<br />
Belegschaften gerichtet werden. Im Rahmen einer breiten Unternehmensbefragung<br />
in einer der industriellen Kernregionen der neuen Länder, <strong>dem</strong> Wirtschaftsraum<br />
Chemnitz-Zwickau, konnten unterschiedliche Altersstrukturtypen identifiziert werden<br />
(Abbildung 1).<br />
Besonders auffällig ist, dass das Gros der untersuchten Betriebe (mit 60 %)<br />
problematische Altersstrukturen aufweist. In Unternehmen dieses Typs ist<br />
durchschnittlich nur ein Viertel der Belegschaft jünger als 35 Jahre. Die größte<br />
Gruppe wird dabei von Betrieben gebildet, deren Belegschaft als „<strong>aus</strong>geprägt<br />
mittelalt“ bezeichnet werden kann: Über die Hälfte der Mitarbeiter in diesen Betrieben<br />
ist zwischen 35 und 49 Jahren alt. Fast 40 % aller Betriebe sind dieser Gruppe<br />
zuzurechnen. Ein weiteres Fünftel der Firmen ist durch eine „stark alterszentrierte“<br />
Belegschaft – über die Hälfte ist 50 Jahre und älter – charakterisiert. In diesen beiden<br />
Betriebstypen mit einer alterskomprimierten bzw. alterszentrierten Belegschafts-<br />
11 Behr, M. 2004: S. 145.<br />
12 Siehe dazu u.a. Wiekert, I. 2002.<br />
13 Vgl. Lutz, B.; Wiekert, I. 2008.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
struktur sind über die Hälfte aller Mitarbeiter der untersuchten Unternehmen<br />
beschäftigt.<br />
Abbildung 1<br />
Altersstrukturtypen in Industrieunternehmen*<br />
der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau 2005<br />
Beschäftigtenanteile in Prozent an allen Mitarbeitern (MA)<br />
*Basis der Clusteranalyse: 328 Unternehmen mit 18.498 Mitarbeitern<br />
Jugendzentrierte Belegschaften<br />
16% der Betriebe mit 14% der MA<br />
Alters<strong>aus</strong>gewogene Belegschaften<br />
22% der Betriebe mit 26% der MA<br />
Belegschaften mit <strong>aus</strong>geprägtem<br />
Mittelalter 39% der Betriebe mit 37% der<br />
MA<br />
Alterszentrierte Belegschaften<br />
22% der Betriebe mit 23% der MA<br />
bis 24 25 bis 34 35 bis 49 50 bis 59 60 und älter<br />
11 44 29 12 3<br />
16 22 37 20 5<br />
6 13 60 18 3<br />
9 13 28 45 6<br />
Alle Betriebe <strong>10</strong> 20 42 24 4<br />
Quelle: Behr, M.; Barche, U.; Seiwert, T.; Ehrlich, M.; Thieme, C. 2007<br />
Besonders hoch ist der Anteil an alterszentrierten Unternehmen in der<br />
Elektrotechnischen und der Textilindustrie (Abbildung 2). Nicht weniger dramatisch<br />
ist jedoch auch die Situation in den beiden Metallbranchen und im Dienstleistungs-<br />
sektor mit einer eher alterskomprimierten Belegschaftsstruktur.<br />
32
Abbildung 2<br />
Altersstrukturtypen in Industrieunternehmen<br />
der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau 2005<br />
Unterschieden nach Branchen<br />
Altersstrukturtyp nach Clusteranalyse<br />
(Angaben in %)<br />
33<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
jugendzentriert <strong>aus</strong>gewogen mittleres Alter alterszentriert Gesamt<br />
IT / Datenverarbeitung (N=83) 41 22 27 11 <strong>10</strong>0<br />
Maschinen und Werkzeugbau (N=89) 12 30 38 20 <strong>10</strong>0<br />
Metallerzeugung / -bearbeitung (N=111) 15 18 45 22 <strong>10</strong>0<br />
Textil- und Bekleidungsindustrie (N=51) 16 12 41 31 <strong>10</strong>0<br />
Elektrotechnik (N=31) 26 23 19 32 <strong>10</strong>0<br />
Dienstleistungen (N=21) 14 29 38 19 <strong>10</strong>0<br />
Chemie / Kunststoff / Papier / Holz (N=4) 25 50 25 0 <strong>10</strong>0<br />
Fahrzeugbau (N=17) 29 29 35 7 <strong>10</strong>0<br />
Quelle: Behr, M.; Barche, U.; Seiwert, T.; Ehrlich, M.; Thieme, C. 2007<br />
Allein schon mit Blick auf die betriebliche Altersstruktur ist absehbar, dass vor allem<br />
Betriebe mit einer alterskomprimierten und alterszentrierten Belegschaft in den<br />
nächsten Jahren einen deutlich erhöhten Ersatzbedarf <strong>für</strong> die dann <strong>aus</strong>scheidenden<br />
Mitarbeiter haben werden. Zusätzlich ist vor diesem Hintergrund zu bedenken, dass<br />
allein in Thüringen die Zahl der Industriebeschäftigten im Zeitraum zwischen 1996<br />
und 2006 von <strong>10</strong>8 Tsd. auf 147 Tsd. gestiegen ist. 14 Demgegenüber ist die Zahl der<br />
Industriebeschäftigten in Westdeutschland im gleichen Zeitraum deutlich<br />
zurückgegangen (um rund <strong>10</strong> %). Darüber hin<strong>aus</strong> rechnen Vertreter ostdeutscher<br />
Schlüsselbranchen wie der Chemischen Industrie, des Maschinenb<strong>aus</strong>, <strong>dem</strong><br />
Fahrzeugbau, der Metall- und Elektroindustrie oder der Nahrungsmittelindustrie<br />
aufgrund der erkämpften Märkte (zunehmend auch im Ausland) und der<br />
Umsatzerwartungen weiter mit Zuwächsen beim Personal (Erweiterungsbedarf).<br />
Interessant ist nun der Zusammenhang zwischen Altersstruktur und Erwartungen an<br />
die Zukunft des Unternehmens (Abbildung 3). Betriebe mit einer jugendzentrierten<br />
bzw. <strong>aus</strong>gewogenen Belegschaftsstruktur schätzen ihre gegenwärtige Geschäfts-<br />
situation deutlich positiver als die beiden anderen betrieblichen Altersstrukturtypen<br />
14 Dies entspricht einem Zuwachs um 36 %, wenn man von <strong>dem</strong> nach der Wende niedrigsten Wert<br />
<strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahr 1996 <strong>aus</strong>geht; Quelle: Statistisches Landesamt Thüringen.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
ein. Zu<strong>dem</strong> richten Erstere eher einen optimistischen Blick in die eigene betriebliche<br />
Zukunft, der zugleich mit der Erwartung eines Umsatz- und Personalwachstums<br />
verbunden ist.<br />
Abbildung 3<br />
Geschäftssituation und Zukunftsperspektive in<br />
Abhängigkeit von der Alterszusammensetzung<br />
der Betriebsbelegschaften (Angaben in %)<br />
Aktuelle<br />
Geschäftssituation<br />
sehr gut oder gut<br />
Umsatzerwartung<br />
wachsend<br />
34<br />
Personalzuwachs<br />
erwartet<br />
Optimistischer Blick<br />
in die Zukunft<br />
Jugendzentriert 55 57 45 76<br />
Ausgewogen 50 60 36 73<br />
Alterskomprimierte<br />
Belegschaften<br />
38 46 27 60<br />
Alterszentriert 33 36 25 58<br />
Quelle: Behr, M.; Barche, U.; Seiwert, T.; Ehrlich, M.; Thieme, C. 2007<br />
Der erfolgreiche Konsolidierungspfad der ostdeutschen Wirtschaft (dies schließt eine<br />
Veränderung der prozentualen Beschäftigtenanteile zugunsten wertschöpfungsnaher<br />
Bereiche ein) könnte – unter <strong>dem</strong> jedoch unwahrscheinlichen Andauern der<br />
bisherigen personalwirtschaftlichen Rahmenbedingungen – durch<strong>aus</strong> weiter<br />
voranschreiten. Zumal sich ein industrieller Mittelstand entwickelt hat, der eine hohe<br />
(wenngleich oft noch zu stark kundenbezogene) Wettbewerbs- und<br />
Innovationsfähigkeit aufweist. Anhand der identifizierten Altersstrukturtypen lassen<br />
sich zum einen ein personeller Ersatzbedarf und zum anderen ein personeller<br />
Erweiterungsbedarf ableiten. Aber die personalwirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
im mitteldeutschen Wirtschaftsraum verändern sich <strong>aus</strong> den bereits angeführten<br />
Gründen sehr stark und sehr schnell. Der Umbruch erhöht die betrieblichen Kosten<br />
<strong>für</strong> Personalrekrutierung, -gewinnung und -bindung. Die bisherige Machtasymmetrie<br />
auf <strong>dem</strong> Arbeitsmarkt verschiebt sich ein Stück weit (zunächst nur) zugunsten der<br />
qualifizierten Arbeitskräfte (wie Ingenieure und gewerbliche Facharbeiter).
3. Die Erosion des Nachwendepaktes – Eine Betriebstypologie<br />
35<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
Es war ein zentrales Ergebnis einer Studie im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung 15 ,<br />
dass sich nicht nur insgesamt eine Erosion des Nachwendepaktes beobachten lässt,<br />
sondern sich gravierende unternehmenskulturelle Unterschiede in der ostdeutschen<br />
Betriebslandschaft fixieren lassen. Innerhalb des Umschlags auf <strong>dem</strong> ostdeutschen<br />
Arbeitsmarkt <strong>für</strong> Nachwuchskräfte differenzieren sich die Rekrutierungschancen<br />
zwischen „alternden, abkühlenden Überlebensgemeinschaften“ sowie „erzwungenen<br />
betrieblichen Arrangements“ gegenüber „produktiven Leistungsgemeinschaften“ mit<br />
Erfahrung im Generationen<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch deutlich <strong>aus</strong>:<br />
(1) Produktiven ostdeutschen Leistungsgemeinschaften ist es gelungen, Standards<br />
guter Arbeit mit hohen Innovations- und Leistungserfordernissen von Unternehmen in<br />
dynamischen Marktumwelten zu verknüpfen. Geschäftsführung, Management und<br />
Belegschaft kooperieren auf einer Augenhöhe und die Führungskultur berücksichtigt<br />
die Anerkennungsbedürfnisse der ostdeutschen Arbeitnehmer. Solche Unternehmen<br />
konnten – aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Wachstumsdynamik – bereits in den<br />
vergangenen Jahren eine veritable Verjüngung einleiten und damit auch das Image<br />
nach außen als „gutes Unternehmen mit vernünftiger Bezahlung, sicheren<br />
Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektiven“ etablieren. Solche Unternehmen müssen<br />
sich wenig Sorgen um ihre personalwirtschaftliche Zukunft machen. 16<br />
(2) Dies sieht bei <strong>dem</strong> zweiten Unternehmenstyp schon anders <strong>aus</strong>. Abkühlende<br />
Überlebensgemeinschaften verdanken ihren Zusammenhalt einem kohäsiven<br />
Belegschaftskern <strong>aus</strong> stabil-loyalen Mitarbeitern, die ihre berufliche Perspektive mit<br />
<strong>dem</strong> Überleben des Unternehmens verkoppelt haben. Die Unternehmen leiden<br />
jedoch nicht nur unter Überalterung sondern auch unter einem abnehmenden<br />
Commitment der Mitarbeiter. Die Unzufriedenheit über die konstant hohen<br />
Leistungszumutungen bei sich kaum verbessernden Entlohnungsbedingungen<br />
schafft Frust, der – angesichts fehlender Vertretungsorgane – kaum artikuliert wird.<br />
Gerade die Facharbeiter leiden oft unter fehlender Anerkennung der<br />
Geschäftsführung und treten – bei fehlenden Alternativen auf <strong>dem</strong> Arbeitsmarkt –<br />
den Weg in die innere Emigration an. Diese Unternehmensformation wird durch die<br />
neuen Rahmenbedingungen unter erheblichen Modernisierungsdruck gestellt.<br />
15 Ausführlich dazu Behr, M.; Engel, T.; Hinz, A.; Möller, M. 2006.<br />
16 Dazu und <strong>für</strong> Folgendes vgl. Behr, M.; Engel, T.; Hinz, A. 2008.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
(3) Erzwungene Arrangements charakterisieren Unternehmenstypen, die ihr<br />
Überleben einer weitgehenden Alternativlosigkeit des Personals verdanken. Es<br />
stimmt weder die Entlohnung, noch wäre auch nur in Ansätzen eine Kultur der<br />
Leistungsanerkennung gegeben. Für die Beschäftigten gilt es „irgendwie bis zur<br />
Rente durchzukommen“. Diese Unternehmen dürften in den nächsten Jahren<br />
erhebliche Probleme haben, ihre – überwiegend – ersatzbedarfsbedingte Nachfrage<br />
nach „willigen und billigen“ Arbeitskräften zu befriedigen. Die von Burkart Lutz und<br />
anderen 20<strong>10</strong> in die Debatte gebrachten Szenarien einer „zweiten<br />
Deindustrialisierung“ respektive einer „Retaylorisierung“ der Produktionsregime<br />
könnten am ehesten bei diesem Unternehmenstyp greifen. 17<br />
4. „Wer einen Blaumann trägt, hat schon verloren.“<br />
Auch in einem anderen Punkt werden Erosionstendenzen am Nachwendepakt<br />
deutlich. Diese speisen sich <strong>aus</strong> Unzufriedenheiten mit beruflichen<br />
Entwicklungsmöglichkeiten, autoritativen Führungsstilen sowie einer „gefühlten“<br />
Abkühlung des Betriebsklimas und treten vor allem in der Differenzierung nach<br />
Beschäftigtengruppen in puncto Arbeitzufriedenheit deutlich hervor. 18<br />
Das betrifft vor allem die individuellen Entwicklungs- und Mitbestimmungs-<br />
möglichkeiten, die fast durchweg von allen Arbeitnehmern als kritisch bewertet<br />
werden. Die größte Unzufriedenheit – aber auch die größten Unterschiede zwischen<br />
den unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen – sind bei den Arbeitsbedingungen<br />
zu verzeichnen, die sich auf den Anspruch einer aktiven Teilhabe am Unternehmens-<br />
geschehen beziehen (vgl. Abb. 4). Während die meisten Beschäftigten mit <strong>dem</strong><br />
beruflichen Zuschnitt ihrer Tätigkeiten zufrieden sind (ablesbar an den recht guten<br />
Werten <strong>für</strong> die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten einzubringen), häuft sich Kritik bei<br />
jenen Dimensionen, die die Chancen beruflichen Fortkommens und Entfaltungs-<br />
möglichkeiten beinhalten. Die eigenen Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume<br />
werden von fast der Hälfte der Befragten (45 %) negativ beurteilt, 51 % der Befragten<br />
sind unzufrieden mit den Möglichkeiten zur Weiterbildung und 59 % mit den<br />
Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen. Besonders der Umstand, dass fast die<br />
Hälfte der Befragten ihre Arbeit als nicht <strong>aus</strong>reichend anerkannt betrachtet, gibt<br />
17 Lutz, B. u.a. 20<strong>10</strong>.<br />
18 Behr, M.; Engel, T.; Hinz, A. 2008.<br />
36
37<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
Hinweise auf deutliche Defizite in der Führungskultur und in der Motivationspolitik der<br />
Unternehmen.<br />
Abbildung 4<br />
Detaillierte Beurteilung der Arbeitsbedingungen, des Betriebsklimas<br />
und der individuellen Entwicklungsmöglichkeiten<br />
(Anteil der Befragten in %)<br />
Quelle: Behr, M.; Engel, T.; Hinz, A.; Möller, M. 2006<br />
Dabei ist keine Beschäftigtengruppe mit der Anerkennung der eigenen Leistung so<br />
unzufrieden wie die der Facharbeiter (43 %). Im Angestelltenbereich ist rund ein<br />
Drittel unzufrieden mit den Anerkennungspolitiken seitens der Geschäftsführung.<br />
Auch bei den Defiziten in der Wahrnehmung von Aufstiegsmöglichkeiten gibt es<br />
starke Statusdifferenzen. Während nur 20 % der Facharbeiter und auch nur 38 % der<br />
technischen Angestellten damit zufrieden sind, sind es bei den leitenden Angestellten<br />
67 %.<br />
materielle Arbeitsbedingungen<br />
Arbeitszeiten (1.092)<br />
Lohn/Gehaltshöhe (1.091)<br />
Sozialbeziehungen<br />
Verhältnis zu den Kollegen (1.082)<br />
Verhältnis zu den Vorgesetzten (1.097)<br />
Betriebsklima insgesamt (1.091)<br />
Betriebsfeste o.ä. (856)<br />
Möglichk., Verantwortung zu übernehmen (990)<br />
Möglichk., eig. Fähigk. einzubringen (1.023)<br />
eig. Gestaltungs- + Entscheid.spielräume (991)<br />
Anerkennung meiner Leistung (1.069)<br />
Möglichk. zur Weiterbildung/Qualifiz. (1.013)<br />
Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen (873)<br />
individuelle<br />
Entwicklungsmöglichkeiten<br />
5. Die Hypothek der mentalen Deindustrialisierung<br />
Eingedenk der Entwicklung, dass Fragen des Images von Unternehmen und<br />
Branchen an Bedeutung generell zunehmen werden, birgt das soeben gezeichnete<br />
Stimmungsbild <strong>für</strong> Unternehmen mit potentiellem Erweiterungs- oder zumindest<br />
Ersatzbedarf noch weitere Konsequenzen:<br />
21<br />
16<br />
17<br />
12<br />
16<br />
<strong>10</strong><br />
7<br />
9<br />
8<br />
5<br />
6<br />
38<br />
33<br />
32<br />
34<br />
28<br />
25<br />
26<br />
24<br />
27<br />
18<br />
1<br />
18<br />
5<br />
35<br />
42<br />
39<br />
45<br />
44<br />
51<br />
53<br />
53<br />
52<br />
57 20<br />
<strong>10</strong>0 75 50 25 0 25 50 75 <strong>10</strong>0<br />
57<br />
56<br />
6<br />
eher zufrieden sehr zufrieden<br />
eher unzufrieden sehr unzufrieden<br />
11<br />
16<br />
8<br />
<strong>10</strong><br />
11<br />
13<br />
23<br />
12<br />
12<br />
41
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Das Ergebnis mehrerer Schülerbefragungen in verschiedenen Regionen der neuen<br />
Länder belegt eindeutig, dass die Industrie als Beschäftigungsfeld bei Schülern und<br />
Schülerinnen aller Schultypen ein eher schlechtes Image hat. 19 Dienstleistungsberufe<br />
und der Öffentliche Dienst haben deutlich bessere Imagewerte. Schlechter als die<br />
Industrie wird nur die Landwirtschaft und (inzwischen) das Baugewerbe bewertet<br />
(Abbildung 5).<br />
Abbildung 5<br />
personen- und unternehmensnahe<br />
Dienstleistungen<br />
In welchem Bereich möchtest Du später einmal arbeiten?<br />
Öffentlicher Dienst<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Bau<br />
Landwirtschaft<br />
Quelle: Behr, M.; Kr<strong>aus</strong>e, N.; Schindler, T. 2009<br />
2<br />
3<br />
3<br />
4<br />
<strong>10</strong><br />
38<br />
14<br />
14<br />
13<br />
32<br />
31<br />
33<br />
0 <strong>10</strong> 20 30 40 50<br />
41<br />
2008 (N=404)<br />
2006 (N=987)<br />
Auch die Ergebnisse der Belegschaftsbefragung in der ostdeutschen Metall- und<br />
Elektroindustrie belegen dies. Allerdings fallen die Antworten auf die Frage: „Würden<br />
Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter den eigenen Beruf empfehlen ?“ bei Ingenieuren und<br />
Facharbeiten sehr unterschiedlich <strong>aus</strong> (s. u. Abbildung 7). Während die Mehrzahl der<br />
Ingenieure den eigenen Beruf positiv bewertet und auch empfehlen würde<br />
(„abwechslungsreiche Arbeit“, „man kann im Team Probleme lösen“, „vernünftig<br />
bezahlt und zukunftsfähig“), rät eine deutliche Mehrheit der Facharbeiter vom<br />
eigenen Beruf ab („harte Arbeit“, „schlechte Bezahlung“, „als Blaumann ist man<br />
nichts mehr wert“). Dies wiederum erklärt, warum sich männliche Gymnasiasten eher<br />
19 Vgl. Behr, M.; Kr<strong>aus</strong>e, N.; Schindler, T. 2009.
39<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
<strong>für</strong> Industrieberufe interessieren als Regelschüler respektive Haupt- und Realschüler,<br />
die sich von der Industrie abwenden (Abbildung 6).<br />
Abbildung 6<br />
Öffentlicher Dienst<br />
Dienstleistungen<br />
weiß nicht<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Landwirtschaft<br />
Bau<br />
1<br />
In welchem Bereich möchtest Du später einmal arbeiten?<br />
1<br />
Quelle: Behr, M.; Kr<strong>aus</strong>e, N.; Schindler, T. 2009<br />
3<br />
3<br />
3<br />
7<br />
(nach Schultyp, Anteile in %)<br />
<strong>10</strong><br />
11<br />
11<br />
13<br />
15<br />
17<br />
17<br />
18<br />
18<br />
20<br />
23<br />
25<br />
25<br />
30<br />
32<br />
Hauptschüler (n=133)<br />
Realschüler (n=564)<br />
Gymnasiasten (n=498)<br />
Geht man davon <strong>aus</strong>, dass das negative Image von Industrieberufen bei jungen<br />
Menschen – insbesondere bei Haupt- und Realschülern – etwas mit den materialen<br />
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Industriebeschäftigten zu tun hat und die<br />
Kolportage <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Elternh<strong>aus</strong> in hohem Maße „imageprägend“ ist, so sind die<br />
Antworten auf die Frage, ob die Beschäftigten den <strong>aus</strong>geübten Beruf auch ihren<br />
Kindern empfehlen würden, von großer Relevanz. Das Ergebnis ist ziemlich deutlich:<br />
Über alle Beschäftigtengruppen hinweg würden nur 31 % ihren Kindern den eigenen<br />
Beruf empfehlen, wohingegen 41 % davon <strong>aus</strong>drücklich abraten (Abbildung 7). 20<br />
20 Vgl. dazu und Folgen<strong>dem</strong> Behr, M. 2009.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Abbildung 7<br />
Quelle: Behr, M.; Engel, T.; Hinz, A. 2008<br />
An dieser Stelle fallen besonders große Diskrepanzen zwischen leitenden<br />
Angestellten und technischen Angestellten einerseits und gewerblichen<br />
Facharbeitern sowie Un- und Angelernten andererseits auf. Bei den Arbeitern zeigt<br />
sich – konfrontiert mit der Überlegung, <strong>dem</strong> Sohn oder der Tochter ähnliche Berufs-<br />
erfahrungen zumuten zu sollen – die Summe der kritischen Faktoren der heutigen<br />
Arbeiterexistenz. Während man sich selbst mit den Verhältnissen arrangiert hat und<br />
– angesichts der oft noch intakt gebliebenen zwischenmenschlichen Beziehungen –<br />
auch positive Gesichtspunkte der Arbeitssituation sieht, werden <strong>für</strong> die Kinder die<br />
kritischen objektiven Faktoren gleichsam der sentimentalen Einbindung in<br />
Betriebsgeschichte, kollegialer Erfahrung und gelebter Arbeiterkultur entkleidet. Am<br />
häufigsten werden die „fehlende Anerkennung als Arbeiter“, die „schlechten Arbeits-<br />
40
41<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
marktchancen“ und die „Benachteiligung bei den Verdiensten gegenüber den<br />
Angestellten“ erwähnt.<br />
Dieser Befund erklärt möglicherweise zu einem großen Teil die veränderten<br />
Berufswahlorientierungen ostdeutscher Schüler, wobei Industriebetriebe als<br />
potentielle Arbeitgeber von den jungen Menschen weit weniger favorisiert werden als<br />
es <strong>dem</strong> aktuellen Beschäftigtenanteil und mehr noch <strong>dem</strong> zukünftigen prozentualen<br />
Ersatz- wie Erweiterungsbedarf entspricht. Angesichts dieser massiven – und auf<br />
authentischem Erleben von Industriearbeit beruhenden – Erfahrungskolportage,<br />
scheint das Image <strong>für</strong> Arbeiterberufe im verarbeitenden Gewerbe nachhaltig belastet.<br />
Die Söhne und Töchter von Industriebeschäftigten – normalerweise die wichtigste<br />
Rekrutierungsbasis – vollziehen – gleichsam stellvertretend <strong>für</strong> ihre Eltern – die „Exit-<br />
Option“. Was ihre Eltern nicht konnten, wünschen diese sich <strong>für</strong> ihre Kinder. In<br />
gewisser Weise hat nicht nur die Deindustrialisierung unmittelbar nach der Wende<br />
sondern auch die arbeitspolitischen Versäumnisse in vielen ostdeutschen<br />
Industrieunternehmen „verbrannte Erde“ hinterlassen. Angesichts der Verringerung<br />
der Nachwuchskohorten in Folge des Geburten<strong>aus</strong>falls nach der Wende und einer<br />
Verbesserung der Wahlmöglichkeiten <strong>für</strong> die geburtenschwachen Nachwende-<br />
jahrgänge ist dies eine schwere Hypothek, neben anderen, die die Fortschreibung<br />
der Erfolgspfade der vergangenen Jahre erschweren. 21<br />
6. Quo vadis Ostdeutschland? Zwei Entwicklungsszenarien<br />
Die neuen Bundesländer stehen somit knapp zwei Jahrzehnte nach der Wende vor<br />
einer neuen großen Her<strong>aus</strong>forderung. Während die Wirtschaft gerade in den drei<br />
mitteldeutschen Bundesländern in den vergangenen Jahren erheblich an<br />
Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat und die Schlüsselbranchen des verarbeitenden<br />
Gewerbes – neben <strong>dem</strong> wachsenden Ersatzbedarf – vermehrt Erweiterungsbedarf<br />
an Fachkräften generieren, verändern sich die Rekrutierungsbedingungen <strong>für</strong> die<br />
Unternehmen dramatisch: Junge Nachwuchskräfte werden in <strong>dem</strong> Moment knapp,<br />
wenn viele Kompetenz- und Erfahrungsträger, die die schwierigen Nachwendejahre<br />
erfolgreich gestaltet haben, das Rentenalter erreichen. Zugleich verringert sich das<br />
Potential an verfügbaren, einschlägig qualifizierten Erwerbspersonen auf den<br />
Arbeitsmärkten.<br />
21 Behr, M. 2009a.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Anders als nach der „ersten Wende“ 1989/90 steuert Ostdeutschland nunmehr in<br />
eine offene Zukunft, weil es <strong>für</strong> die Bewältigung seiner erwerbsgesellschaftlich-<br />
<strong>dem</strong>ographischen Sondersituation keine Vorbilder gibt. 22 Von der Problem-<br />
lösungsfähigkeit der Unternehmen und der regionalen Akteure <strong>aus</strong> Politik, Wirtschaft<br />
und Wissenschaft der Region hängt es ab, wo wir im Jahr 2020 leben werden:<br />
Entweder in einem der dynamischsten Wirtschaftsräume Deutschlands, mit<br />
wettbewerbsfähigen Unternehmen, einem hohen Vernetzungsgrad der Firmen, einer<br />
Wissenschaftsinfrastruktur, die eng mit der regionalen Wirtschaft verzahnt ist, einem<br />
Bildungssystem, das den jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten und folglich<br />
Mitwirkungschancen an der Weiterentwicklung der Region gibt – einer Region, die<br />
bei wachsen<strong>dem</strong> Positivimage durch Zuwanderung von qualifizierten, weltoffenen<br />
und kulturell interessierten Menschen geprägt ist, wodurch die Innovationsfähigkeit<br />
weiter steigt und somit Positivkreisläufe in Gang kommen, dank derer die<br />
<strong>dem</strong>ographischen Hypotheken der Nachwendezeit kompensiert werden können.<br />
Kurz: in einer Region, in der die <strong>dem</strong>ographische Falle zur <strong>dem</strong>ographischen Chance<br />
umgemünzt und genutzt werden kann (Abbildung 8).<br />
22 Ebd.<br />
42
Abbildung 8<br />
Demografische Chance statt<br />
Demografische Falle<br />
Quelle: Behr, M. 20<strong>10</strong><br />
43<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
Oder aber in einer Region, die durch weitere Schrumpfung der Bevölkerung, durch<br />
Alterung und Fachkräftemangel gekennzeichnet ist, in der die Jugend weiterhin<br />
abwandert, weil in den Städten und auf <strong>dem</strong> Land „nichts los ist“, wo der<br />
Einwohnerverlust Arbeitslosigkeit im Dienstleistungssektor verursacht und<br />
Fachkräftemangel die Innovationskraft der Unternehmen gefährdet, in der die<br />
Unternehmen von der Versorgung mit jungen Innovationsträgern <strong>aus</strong> den<br />
Hochschulen abgekoppelt sind und Wissenschaftler ihre Partner eher in<br />
Westdeutschland suchen – kurz: wo Negativspiralen eine so starke Schwächung des<br />
<strong>dem</strong>ographisch-ökonomischen Potentials bewirken, dass eine progressive<br />
Entwicklung kaum mehr möglich ist (Abbildung 9).
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Abbildung 9<br />
Ökonomisch – <strong>dem</strong>ografischer Teufelskreis<br />
Quelle: Behr, M. 20<strong>10</strong><br />
Noch profitieren die mitteldeutschen Unternehmen von der guten Ausstattung mit<br />
Humankapital. Qualifizierte Ingenieure und Facharbeiter, engagierte Leitungskräfte<br />
und Verwaltungspersonal sind der zentrale Erfolgsfaktor der Region. Aber eine<br />
Verschlechterung des Qualifikationsnive<strong>aus</strong> statt einer Weiterentwicklung bedroht<br />
den erreichten Status gelungener Reintegration. Ein drohender Statusverlust in den<br />
Wertschöpfungsketten würde auch das geringe Einkommensniveau zementieren –<br />
was die Rekrutierungsbedingungen von Fachkräften und Ingenieuren weiter<br />
verschlechtert. Hierin liegt die Gefahr eines ökonomisch-<strong>dem</strong>ographischen<br />
Teufelskreises, die <strong>dem</strong>ographische Chance wäre vertan.<br />
44<br />
:
Literatur<br />
45<br />
Fachkräfteverwöhnt und Jugendentwöhnt<br />
Artus, Ingrid; Liebold, Renate; Lohr, Karin; Schmidt, Evelyn; Schmidt, Rudi; Strohwald, Udo<br />
(2001): Betriebliches Interessenhandeln. Opladen.<br />
Behr, Michael (2000): Ostdeutsche Arbeitsspartaner. Der positive Trend in der ostdeutschen<br />
Industrie führt zu neuen Her<strong>aus</strong>forderungen. In: Die politische Meinung, S. 27-38.<br />
Behr, Michael (2004): Jugendentwöhnte Unternehmen in Ostdeutschland - Eine Spätfolge<br />
des perso-nalwirtschaftlichen Moratoriums. In: Lutz, Burkart (Hrsg.): Bildung und<br />
Beschäftigung. Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, S. 143-188.<br />
Behr, Michael (2009): Der unglückliche Erfolgsfaktor – beschleunigt, aktiviert aber nicht<br />
zukunftsfähig, in: WSI-Mitteilungen Heft <strong>10</strong>/2009. Schwerpunktheft „Beschleunigt –<br />
Aktiviert – Zukunftsfähig? Leben und Arbeiten im Kapitalismus“, S. 554-559.<br />
Behr, Michael (2009a): Planungsparadoxien im gesellschaftlichen Transformationsprozess.<br />
Ost-deutschland als prognostisches Dauerproblem, in: Mittelweg 36. Zeitschrift des<br />
Hamburger Instituts <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong>, Heft 6/2009, S. 64-81.<br />
Behr, Michael (20<strong>10</strong>): Arbeitsmarkt, Fachkräfteentwicklung und regionale Dynamik nach <strong>dem</strong><br />
personalwirtschaftlichen Paradies“. Neue Risiken, neue Perspektiven <strong>für</strong> Unternehmen,<br />
Regionalentwicklung, Arbeitsmarkt und Arbeitnehmer/innen in Ostdeutschland.<br />
Manuskript Jena.<br />
Behr, Michael; Engel, Thomas (2001): Entwicklungsverläufe und Entwicklungsszenarien<br />
ostdeutscher Personalpolitik. Ursachen, Folgen und Risiken der personalpolitischen<br />
Stagnation, in: Pawlowsky, Peter; Wilkens, Uta (Hg.), <strong>10</strong> Jahre Personalarbeit in den<br />
neuen Bundesländern, München, S. 255-278.<br />
Behr, Michael; Hasenöhrl, Claudia; Seiwert, Tina (2004): Jugend auf Abwanderungskurs –<br />
keine Perspektiven in der Region? Ergebnisse einer Schülerbefragung in Dessau zu<br />
Lebenszielen, Berufs- und Abwanderungsorientierungen 2004, Jena.<br />
Behr, Michael; Engel, Thomas; Hinz, Andreas; Möller, Mario (2006): Produktive Leistungsgemeinschaften<br />
und erzwungene Arrangements. Ergebnisse einer<br />
Beschäftigtenbefragung in der Metall- und Elektroindustrie 2005/06 in allen fünf neuen<br />
Bundesländern, Jena.<br />
Behr, Michael; Barche, Uta; Seiwert, Tina; Ehrlich, Martin; Thieme, Christoph (2007):<br />
Wirtschaftliche Chancen und Handlungserfordernisse in der Wirtschaftsregion Chemnitz-<br />
Zwickau. Abschlußbericht des BMBF Projekts "Weiterentwicklung und Kontinuisierung<br />
eines Berichts- und Interventionssystems zur Vermeidung von Fachkräftelücken als<br />
Maßnahme zur nachhaltigen Absicherung der Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit in<br />
der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau".<br />
Behr, Michael; Engel, Thomas; Hinz, Andreas (2008): Blockierte Modernisierung<br />
ostdeutscher Unternehmenskulturen als Standortrisiko. Wie die Erosion des<br />
Nachwendepaktes die weitere Konsolidierung der Industrie gefährdet. In: Rainer<br />
Benthin/Ulrich Brinkmann (Hg.): Unternehmenskultur und Mitbestimmung. Betriebliche<br />
Integration zwischen Konsens und Konflikt - Frankfurt/New York (Campus) S. 259-283.<br />
Behr, Michael; Kr<strong>aus</strong>e, Norbert.; Schindler, Tina (2009): Berufswahlorientierung und<br />
Wanderungsneigung von Jugendlichen in der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau,<br />
Manuskript Jena.<br />
Behr, Michael; Tolksdorf, Guido (2009): Flexibilität als Erfolgsfaktor <strong>für</strong> den<br />
Automobilstandort Sachsen. Wird die Automobilregion Zwickau am Ende gestärkt <strong>aus</strong> der<br />
Krise hervorgehen? Ms. Jena/Zwickau<br />
Behr, Michael; Thieme, Christoph (2009): Die Optische Industrie in Thüringen.<br />
Wirtschaftssituation und Fachkräfteentwicklung im Jahr 2009. Eine Veröffentlichung des<br />
OptoNet e.V. Jena.
Michael Behr, Martin Ehrlich, Ingo Wiekert<br />
Behr, Michael; Thieme, Christoph (2009): Von den Paralleluniversen zur neuen<br />
Kooperationsdynamik. Warum die Zukunft der ostdeutschen Wirtschaft von Qualität und<br />
Intensität der Forschungskooperationen abhängt, in: Die Hochschule. Journal <strong>für</strong><br />
Wissenschaft und Bildung. Themenheft "Hochschulen in kritischen Kontexten. Forschung<br />
und Lehre in den ostdeutschen Regionen", her<strong>aus</strong>gegeben von Peer Pasternack 18.<br />
Jahrgang, Heft 1/2009, S. 69-85.<br />
Ellguth, Peter (2004): Erosion auf allen Ebenen? Zur Entwicklung der quantitativen Basis des<br />
dualen Systems der Interessenvertretung, in: Artus, Ingrid; Trinczek, Rainer (Hg.): Über<br />
Arbeit, Interessen und andere Dinge. Phänomene, Strukturen und Akteure im modernen<br />
Kapitalismus, München, S. 159-180.<br />
Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2008): Ostdeutsche Betriebe in der Falle oder im<br />
Paradigmenwechsel? In: Arbeits- und Industriesoziologische Studien. Online-Journal der<br />
Sektion Arbeits- und Industriesoziologie in der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Soziologie<br />
(DGS); S.6-26; www.ais-studien.de.<br />
Lutz, Burkart unter Mitwirkung von Holle Grünert, Thomas Ketzmerick, Ingo Wiekert (20<strong>10</strong>):<br />
Fachkräftemangel in Ostdeutschland – Konsequenzen <strong>für</strong> Beschäftigung und<br />
Interessenvertretung. Eine Studie <strong>für</strong> die Otto Brenner Stiftung, OBS-Arbeitsheft 65, FaM.<br />
Lungwitz, Ralph-Elmar; Preusche, Evelyn (1999): Vom Mängelwesen zum Macher?<br />
Management in Ostdeutschland als Gestalter einer leistungsfähigen Unternehmens- und<br />
Arbeitsorganisation, Arbeit, Jg. 8, Heft 4, S. 341-356.<br />
Pohlmann, Markus; Meinerz, Kl<strong>aus</strong>-Peter; Wrede, Iris (1998): Rationale Organisation und<br />
Management. Der Prozess »klassischer Modernisierung« ostdeutscher Industriebetriebe,<br />
Soziale Welt, Vol. 49, S. 355-376.<br />
Wiekert, Ingo (2002): Blockierter Generationen<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch und Nachwuchsstau - Einige<br />
Ausgangsbe-funde. In: Grünert, Holle (Hg.): Generationenwechsel in Ostdeutschland als<br />
Her<strong>aus</strong>forderung <strong>für</strong> den Arbeitsmarkt. Mitteilungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> SFB 580, H. 2, S. 9-15.<br />
46
Weiterbilderbildungsaktivität und differenzierte<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
1. Einleitung<br />
47<br />
Holle Grünert<br />
<strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
Wir haben bisher am heutigen Nachmittag in den Beiträgen von Ingo Wiekert und<br />
Michael Behr über berufliche Erst<strong>aus</strong>bildung, Übernahme <strong>aus</strong> eigener Ausbildung<br />
und Fachkräfterekrutierung vom externen Arbeitsmarkt gesprochen. Ich möchte jetzt<br />
Ihre Aufmerksamkeit auf die berufliche Weiterbildung lenken, die angesichts neuer<br />
Her<strong>aus</strong>forderungen, mit denen sich die meisten Betriebe konfrontiert sehen, <strong>für</strong> die<br />
Sicherung eines <strong>aus</strong>reichenden Bestandes an qualifizierten Fachkräften immer<br />
wichtiger wird.<br />
Erfolgreiche berufliche Weiterbildung hängt bekanntlich von vielen Akteuren ab: von<br />
den Individuen mit ihrer Motivation und ihrer Initiative, vom Weiterbildungs-<br />
engagement der Betriebe, von der Qualität externer Weiterbildungsanbieter, mit<br />
denen die Betriebe zusammenarbeiten und nicht zuletzt von äußeren Rahmen-<br />
bedingungen einschließlich überbetrieblicher Unterstützungsstrukturen und<br />
gegebenenfalls öffentlicher Förderung.<br />
Eine groß dimensionierte empirische Untersuchung des <strong>Zentrum</strong>s <strong>für</strong><br />
<strong>Sozialforschung</strong> Halle, die das Bundesministerium <strong>für</strong> Bildung und Forschung fördert,<br />
beschäftigt sich mit <strong>dem</strong> Zusammenspiel von Betrieben und externen Weiter-<br />
bildungsträgern. Ihr Ziel besteht darin, Strukturen der Betriebs- wie der<br />
Trägerlandschaft möglichst differenziert zu erfassen und auf dieser Grundlage<br />
festzustellen, welches Bild sich beide Seiten voneinander machen, welche<br />
Erwartungen sie aneinander haben, wie die Zusammenarbeit funktioniert und was<br />
möglicherweise zu verbessern ist.<br />
Über einige Ergebnisse dieser Untersuchung möchte ich im Folgenden berichten.<br />
Angesichts der begrenzten Zeit werde ich mich dabei hauptsächlich auf die<br />
weiterbildenden Betriebe konzentrieren. Vorangestellt sei aber ein kurzer Überblick<br />
über unser Vorgehen und die Materialbasis insgesamt, auf die wir uns stützen.<br />
Um unser Ziel zu erreichen, erschien uns eine konvergente Betrachtung sowohl <strong>aus</strong><br />
der Perspektive der Betriebe, die man etwas verkürzt als Nachfrageperspektive
Holle Grünert<br />
bezeichnen kann, als auch <strong>aus</strong> der Angebotsperspektive der Bildungsträger sinnvoll.<br />
Wir entschieden uns deshalb <strong>für</strong> zwei komplementäre computergestützte<br />
Telefonbefragungen bei Betrieben und bei Weiterbildungsträgern. Ergänzend führten<br />
wir <strong>aus</strong>führliche Gespräche vor Ort mit Experten <strong>aus</strong> Betrieben und Bildungsträgern<br />
wie auch zum Beispiel von den Tarifpartnern.<br />
Die repräsentativen Zufallsstichproben <strong>für</strong> die Telefonbefragungen ließen wir uns <strong>aus</strong><br />
den derzeit wohl <strong>aus</strong>sagefähigsten Datenbanken ziehen: Die Betriebsstichprobe zog<br />
uns das Datenzentrum der Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit <strong>aus</strong> der Betriebsnummerndatei<br />
der Beschäftigtenstatistik. Die Trägerstichprobe zogen uns Kollegen vom<br />
Bundesinstitut <strong>für</strong> Berufsbildung <strong>aus</strong> der Datenbank KURSNET 2007, in die alle<br />
Bildungsträger ihre Angebote eintragen können.<br />
Wir beabsichtigten, je 1.200 Interviews mit Betrieben und mit Weiterbildungsträgern<br />
zu führen, jeweils hälftig <strong>aus</strong> den neuen und <strong>aus</strong> <strong>aus</strong>gewählten alten Bundesländern.<br />
Beide Befragungen fanden parallel zueinander im Zeitraum Ende 2007/Anfang 2008<br />
statt. Das Interesse der Betriebe und mehr noch das der Weiterbildungsträger war<br />
erfreulich hoch, sodass wir das gesteckte Ziel erreichen und sogar leicht überbieten<br />
konnten.<br />
Wie Tabelle 1 zeigt, befindet sich in der Tat etwa die Hälfte unserer Betriebe und<br />
Weiterbildungsträger in einem der ostdeutschen Bundesländer bzw. in Berlin, die<br />
andere Hälfte in einem westdeutschen Referenzland. Als Referenzländer wählten wir<br />
drei an Ostdeutschland angrenzende alte Bundesländer mit sehr unterschiedlicher<br />
Wirtschaftsstruktur: Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Innerhalb der<br />
beiden Subgruppen „Ost“ und „West“ wurde eine Verteilung der Fallzahlen etwa<br />
proportional zur Bevölkerungsstärke der Bundesländer vorgenommen.<br />
48
49<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Tabelle 1: Zahl der geplanten und der realisierten Interviews mit Betrieben und mit<br />
Weiterbildungsträgern<br />
Bundesland<br />
geplante<br />
Interviews<br />
realisierte Interviews<br />
Bildungsträger Betriebe<br />
Berlin 122 125 97<br />
Brandenburg 92 92 130<br />
Mecklenburg-Vorpommern 61 66 66<br />
Sachsen 153 166 173<br />
Sachsen-Anhalt 88 94 99<br />
Thüringen 84 <strong>10</strong>0 <strong>10</strong>8<br />
neue Bundesländer gesamt 600 643 673<br />
Bundesland<br />
geplante<br />
Interviews<br />
realisierte Interviews<br />
Bildungsträger Betriebe<br />
Bayern 321 336 305<br />
Niedersachsen 206 212 201<br />
Schleswig-Holstein 73 71 91<br />
alte Bundesländer gesamt 600 619 597<br />
Anzahl insgesamt 1200 1262 1270<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragungen von weiterbildenden Betrieben und Bildungsträgern 2008<br />
Aus der Fülle der Informationen, die wir mit den beiden komplementären<br />
Befragungen gewinnen konnten, seien hier einige Ergebnisse zu vier Fragen<br />
vorgestellt:<br />
• Welche Eindrücke von der Weiterbildungsaktivität der Betriebe haben wir?<br />
• Welche Hinweise auf differenzierte Weiterbildungsprofile ergeben sich?<br />
• Wodurch sind (im Hinblick auf Niveau und Profil ihres<br />
Weiterbildungsengagements) kontrastierende Typen von Betrieben<br />
charakterisiert?<br />
• Welche Konsequenzen <strong>für</strong> die Zusammenarbeit von Betrieben mit<br />
Weiterbildungsträgern zeichnen sich ab?<br />
Vor allem mit den ersten drei Fragen (und Antworten) möchte ich das Spektrum<br />
betrieblichen Weiterbildungsengagements zur Fachkräftesicherung – entsprechend<br />
unserem heutigen Thema – umreißen. Ausblicke auf die Zusammenarbeit mit
Holle Grünert<br />
externen Weiterbildungsträgern können am Schluss nur sehr knapp und<br />
streiflichtartig erfolgen. 1<br />
2. Unterschiedliche Weiterbildungsaktivität von Betrieben<br />
Nur <strong>für</strong> etwa zwei Prozent der befragten Betriebe sind Weiterbildung und Lernen<br />
„kein Thema“. Alle anderen engagieren sich in der einen oder anderen Weise auf<br />
diesem Gebiet. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass wir es zu einem gewissen<br />
Grade mit einer Positiv<strong>aus</strong>wahl zu tun haben, denn die Beteiligung an der Befragung<br />
war freiwillig; und man kann davon <strong>aus</strong>gehen, dass Firmen, die sich <strong>für</strong><br />
Weiterbildung und Lernen interessieren, eher zur Teilnahme bereit waren als andere.<br />
Auch haben wir „Weiterbildung und Lernen im Betrieb“ relativ breit gefasst. Wir<br />
fragten nach neun verschiedenen Lernformen:<br />
• Kurse und Seminare bei externen Anbietern,<br />
• Kurse und Seminare im Betrieb,<br />
• Informationsveranstaltungen (Teilnahme an Fachvorträgen, Konferenzen,<br />
Fachmessen),<br />
• Unterweisungen durch Vorgesetzte oder Kollegen,<br />
• Lernzirkel oder Qualitätszirkel,<br />
• Jobrotation oder wechselnde Einsätze in verschiedenen Abteilungen,<br />
• selbstgesteuertes Lernen mit Medien, (und wegen aktueller Diskussionen<br />
gesondert)<br />
• E-Learning oder web-based Learning sowie<br />
• Blended Learning als Mischung <strong>aus</strong> online-gestütztem Lernen und<br />
Präsenzphasen.<br />
Bei jeder Lernform wollten wir wissen, ob sie <strong>für</strong> Führungskräfte und<br />
Hochqualifizierte, <strong>für</strong> Fachkräfte mit qualifiziertem Abschluss und/oder <strong>für</strong> Un- und<br />
Angelernte angeboten wird.<br />
Zahlreiche Erfahrungen deuten darauf hin, dass sich die Akteure in<br />
weiterbildungsaktiven Betrieben in aller Regel mehr Gedanken über<br />
Lerngelegenheiten <strong>für</strong> ihre Mitarbeiter und den aufeinander abgestimmten Einsatz<br />
einer größeren Zahl unterschiedlicher Lernformen machen als in weniger aktiven<br />
1 Für eine <strong>aus</strong>führlichere Ergebnisdarstellung sei verwiesen auf Grünert, H.; Wiener, B.; Winge, S.<br />
20<strong>10</strong>.<br />
50
51<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Betrieben. Wir verwenden deshalb den Grad der Nutzung unterschiedlicher<br />
Lernformen als einen Indikator <strong>für</strong> betriebliche Weiterbildungsaktivität. 2<br />
Als ein zweiter Indikator dient uns die Einbeziehung der verschiedenen<br />
Mitarbeitergruppen in Weiterbildung und Lernen im Betrieb. Weiterbildungsaktive<br />
Betriebe beziehen nach Möglichkeit alle Qualifikationsgruppen ihrer Mitarbeiter ein.<br />
Das ist keine Selbstverständlichkeit. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass es<br />
<strong>aus</strong>geprägte Ungleichheiten bei der Teilhabe an Weiterbildung und Lernen gibt.<br />
Nach <strong>dem</strong> Motto: „Wer hat, <strong>dem</strong> wird gegeben“, bemühen sich Betriebe oft sehr viel<br />
mehr um Weiterbildungsgelegenheiten <strong>für</strong> ihre Hochqualifizierten als <strong>für</strong> ihre<br />
Fachkräfte und <strong>für</strong> diese wiederum mehr als <strong>für</strong> die Un- und Angelernten. 3 Auch<br />
unsere Untersuchung bestätigt die Existenz solcher Hierarchieeffekte. Vor allem<br />
kostenintensive Lernformen – wie Kurse und Seminare bei externen Anbietern –<br />
werden häufiger <strong>für</strong> Mitarbeiter höherer Qualifikations-gruppen angeboten (siehe<br />
Tabelle 2).<br />
Tabelle 2: Die drei häufigsten Formen von Weiterbildung und Lernen <strong>für</strong> Mitarbeiter<br />
verschiedener Qualifikationsgruppen<br />
Rang<br />
Führungskräfte,<br />
Hochqualifizierte<br />
Fachkräfte Un- und Angelernte<br />
1 Kurse extern 91,0 Unterweisung 88,2 Unterweisung 89,9<br />
2 Fachvorträge usw. 82,0 Kurse extern 84,3 Kurse intern 65,7<br />
3 Unterweisung 70,8 Kurse intern 77,4 Kurse extern 44,3<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008;<br />
Mehrfachantworten, „trifft zu“-Angaben in Prozent<br />
Neun von zehn Betrieben bieten externe Lehrveranstaltungen <strong>für</strong> ihre Führungskräfte<br />
an, acht von zehn <strong>für</strong> Fachkräfte, lediglich vier von zehn Betrieben <strong>für</strong> ihre Un- und<br />
Angelernten. Die deutlichste Abstufung besteht nach diesen Daten nicht zwischen<br />
den Hochqualifizierten und der übrigen Belegschaft, sondern zwischen Hoch-<br />
2 Dies liegt umso näher, als es bei der Anlage unserer Arbeit nicht darum gehen konnte, Ergebnisse<br />
<strong>aus</strong> anderen, periodisch durchgeführten Erhebungen – wie <strong>dem</strong> Berichtssystem Weiterbildung,<br />
den europäischen Erhebungen zur Weiterbildung in Unternehmen und nationalen<br />
Zusatzerhebungen oder auch den Weiterbildungserhebungen des Instituts der deutschen<br />
Wirtschaft Köln – zu duplizieren und wir deshalb darauf verzichtet haben, Teilnehmerzahlen,<br />
zeitliche Volumina oder finanzielle Aufwendungen <strong>für</strong> Weiterbildung im Einzelnen zu erheben.<br />
3 Vgl. hierzu bereits Sass, J.; Sengenberger, W.; Weltz, F. 1974; in den letzten Jahren zum Beispiel<br />
Lutz, B. 2005; Konsortium Bildungsberichterstattung 2006; Autorengruppe<br />
Bildungsberichterstattung 2008.
Holle Grünert<br />
qualifizierten und qualifizierten Fachkräften einerseits und den Un- und Angelernten<br />
andererseits.<br />
Ein anderes Bild ergibt sich bei bestimmten arbeitsplatznahen bzw. arbeits-<br />
integrierten Lernformen (siehe Tabelle 3):<br />
Tabelle 3: Die drei häufigsten Formen von Weiterbildung und Lernen <strong>für</strong> Mitarbeiter<br />
verschiedener Qualifikationsgruppen<br />
Rang<br />
Führungskräfte,<br />
Hochqualifizierte<br />
Fachkräfte Un- und Angelernte<br />
1 Kurse extern 91,0 Unterweisung 88,2 Unterweisung 89,9<br />
2 Fachvorträge usw. 82,0 Kurse extern 84,3 Kurse intern 65,7<br />
3 Unterweisung 70,8 Kurse intern 77,4 Kurse extern 44,3<br />
4 Kurse intern 63,0 Fachvorträge usw. 59,5 Jobrotation 28,6<br />
5 selbstgesteuertes<br />
Lernen<br />
6 Lern-, Qualitätszirkel 42,6 selbstgesteuertes<br />
45,4 Lern-, Qualitätszirkel 37,8 Lern-, Qualitätszirkel 26,5<br />
Lernen<br />
52<br />
34,8 Fachvorträge usw. 19,8<br />
7 Jobrotation 21,0 Jobrotation 28,8 selbstgesteuertes<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008;<br />
Mehrfachantworten, „trifft zu“-Angaben in Prozent<br />
Lernen<br />
So werden Unterweisungen häufiger bei Un- und Angelernten als bei Fachkräften<br />
und noch häufiger als bei Hochqualifizierten genutzt. Auch Jobrotation findet bei<br />
Hochqualifizierten seltener Anwendung als bei Fachkräften und bei Un- und<br />
Angelernten. Allerdings ist der Anteil des „Lernens“ innerhalb dieser Formen deutlich<br />
geringer als bei formellen Lernformen oder auch beim selbstgesteuerten Lernen mit<br />
Medien. In der nationalen Zusatzerhebung zur dritten europäischen Erhebung über<br />
die berufliche Weiterbildung in Unternehmen (CVTS3) 4 ordneten beispielsweise zwei<br />
Drittel aller Befragten Unterweisungen grundsätzlich „eher <strong>dem</strong> Arbeiten“ als <strong>dem</strong><br />
Lernen zu, 44 Prozent trafen eine solche Zuordnung auch <strong>für</strong> die Jobrotation. 5 Eines<br />
unserer Expertengespräche machte deutlich, dass bei der Jobrotation <strong>für</strong> Un- und<br />
Angelernte (in diesem Fall ging es um Fließbandarbeiter) oft gar nicht so sehr die<br />
4 CVTS = Continuing Vocational Training Survey.<br />
5 Siehe Moraal, D.; Lorig, B.; Schreiber, D.; Azeez, U. 2009.<br />
15,2
53<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Erweiterung von Kenntnissen und Fähigkeiten als die Gesundheitsprävention –<br />
Vermeidung einseitiger Belastung – im Vordergrund steht.<br />
All dies unterstreicht eher noch die Existenz von Hierarchieeffekten als sie in<br />
irgendeiner Weise zu relativieren. Will man wissen, ob es überhaupt einschränkende<br />
oder gar entgegenwirkende Faktoren gibt, sollte man vielleicht nach den Anteilen der<br />
verschiedenen Mitarbeitergruppen im Betrieb differenzieren. Wir haben Anzeichen<br />
da<strong>für</strong>, dass Betriebe mit einem hohen Anteil Un- und Angelernter etwas mehr <strong>für</strong> die<br />
Weiterbildung dieser Beschäftigtengruppe tun als andere. Auch könnte man nach der<br />
größeren oder geringeren Durchlässigkeit der Grenzen zwischen verschiedenen<br />
Mitarbeitergruppen bei bestimmten Weiterbildungsangeboten fragen. In einem<br />
anderen Forschungsprojekt fanden wir zum Beispiel Hinweise darauf, dass<br />
Weiterbildungen <strong>für</strong> Ingenieure in der untersuchten Branche ganz selbstverständlich<br />
auch <strong>für</strong> sehr gute Fachkräfte mit qualifiziertem Abschluss geöffnet werden (Grünert,<br />
Böttcher 2009).<br />
Doch zurück zu unseren Indikatoren <strong>für</strong> die Weiterbildungsaktivität. Wir entschieden<br />
uns <strong>für</strong> folgende Operationalisierung: Unter Berücksichtigung aller erhobenen<br />
Lernformen <strong>für</strong> die drei großen Qualifikationsgruppen im Betrieb ermittelten wir <strong>für</strong><br />
jeden Betrieb den Quotienten <strong>aus</strong> der maximal möglichen und der tatsächlichen Zahl<br />
genutzter Lernformen. Anhand der Häufigkeiten bildeten wir sodann fünf Gruppen<br />
von Betrieben. Dabei ging es uns nicht darum, die einzelnen Gruppen nach <strong>dem</strong><br />
Wert des Quotienten oder der Zahl tatsächlich genutzter Lernformen zu definieren.<br />
Unser Ziel bestand vielmehr darin, Zusammenhänge mit bestimmten Parametern<br />
festzustellen.<br />
Bei diesem Vorgehen zeigt sich klar ein positiver Betriebsgrößeneffekt, das heißt<br />
ein direkter Zusammenhang zwischen der Weiterbildungsaktivität und der<br />
Betriebsgröße (Tabelle 4):
Holle Grünert<br />
Tabelle 4: Nutzungsgrad der erhobenen Lernformen und Betriebsgröße<br />
Betriebe<br />
nach Zahl der<br />
Beschäftigten<br />
unterste<br />
Gruppe<br />
Betriebe nach <strong>dem</strong> Nutzungsgrad der Lernformen<br />
untere<br />
Mitte<br />
Mittel-<br />
gruppe<br />
54<br />
obere<br />
Mitte<br />
Spitzen-<br />
Gruppe<br />
Gesamt<br />
unter 20 22,1 32,3 25,0 <strong>10</strong>,3 <strong>10</strong>,3 <strong>10</strong>0,0<br />
20 bis 49 15,7 28,6 22,3 21,9 11,5 <strong>10</strong>0,0<br />
50 bis 99 18,5 26,7 24,3 19,3 11,2 <strong>10</strong>0,0<br />
<strong>10</strong>0 bis 249 9,9 24,3 25,2 21,3 19,3 <strong>10</strong>0,0<br />
250 und mehr 4,9 19,9 23,9 27,8 23,5 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Zeilenprozente<br />
Je größer der Betrieb, desto höher ist der Nutzungsgrad unterschiedlicher<br />
Lernformen. Während in der untersten Gruppe über ein Fünftel der Betriebe weniger<br />
als 20 Beschäftigte und nur fünf Prozent der Betriebe 250 oder mehr Beschäftigte<br />
haben, hat in der Spitzengruppe besonders weiterbildungsaktiver Betriebe (mit <strong>dem</strong><br />
höchsten Nutzungsgrad unterschiedlicher Lernformen) nur jeder Zehnte weniger als<br />
20 und nahezu jeder Vierte mindestens 250 Beschäftigte.<br />
Ergänzt sei, dass auch bei personalstrategisch so wichtigen Sachverhalten wie der<br />
Planung von Weiterbildung oder der kollektivvertraglichen Regelung von Weiter-<br />
bildungsfragen deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen.<br />
3. Hinweise auf differenzierte Weiterbildungsprofile<br />
Etwas anders liegen die Dinge, wenn man die unterschiedliche<br />
Branchenzugehörigkeit der Betriebe berücksichtigt. Die Angaben in Tabelle 5<br />
deuten darauf hin, dass wir es offensichtlich nicht nur mit Niveauunterschieden<br />
zwischen Betrieben im Sinne von mehr oder weniger Aktivität bei der Nutzung der<br />
verschiedenen Lernformen zu tun haben, sondern dass unterschiedliche<br />
Weiterbildungserfordernisse in den einzelnen Branchen auch zu differenzierten<br />
Weiterbildungsprofilen führen.
Tabelle 5: Nutzungsgrad der erhobenen Lernformen und Branche<br />
Branche<br />
Landw., Forstw.,<br />
Bergbau, Energie<br />
verarbeitendes<br />
Gewerbe<br />
unterste<br />
Gruppe<br />
55<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Betriebsgruppen nach Nutzung der Lernformen<br />
untere<br />
Mitte<br />
Mittel-<br />
gruppe<br />
obere<br />
Mitte<br />
Spitzen-<br />
Gruppe<br />
Gesamt<br />
23,3 33,4 18,3 18,3 6,7 <strong>10</strong>0,0<br />
22,2 32,5 23,5 14,8 7,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Bau 28,2 37,7 18,8 <strong>10</strong>,6 4,7 <strong>10</strong>0,0<br />
personennahe<br />
Dienstleistungen<br />
unternehmensnahe<br />
Dienstleistungen<br />
Gesundheit,<br />
Veterinär, Soziales<br />
12,1 32,9 21,7 18,6 14,7 <strong>10</strong>0,0<br />
13,0 25,6 19,1 20,7 21,6 <strong>10</strong>0,0<br />
2,4 9,6 31,1 35,7 21,2 <strong>10</strong>0,0<br />
Gesamt 13,6 26,2 23,4 21,8 15,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Zeilenprozente<br />
So ist es sicher kein Zufall, dass sich im verarbeitenden Gewerbe und im Bau (auch<br />
in der Landwirtschaft, aber da sind unsere Fallzahlen gering) die meisten Betriebe in<br />
den unteren Gruppen mit einer relativ geringen Diversität der genutzten Lernformen<br />
– vor allem in der unteren Mittelgruppe – konzentrieren, während die Vielfalt der<br />
Lernformen im Sektor Gesundheit/Soziales deutlich größer ist und folglich dort die<br />
oberen Gruppen – vor allem die obere Mittelgruppe – stärker besetzt sind.<br />
Noch deutlicher wird die Existenz solcher inhaltlich bedingten Unterschiede, wenn<br />
man die großen Themenfelder von Weiterbildung und Lernen im Betrieb<br />
betrachtet. Folgende Themenfelder wurden – jeweils gesondert <strong>für</strong> Führungskräfte<br />
und Hochqualifizierte, <strong>für</strong> Fachkräfte mit qualifiziertem Abschluss sowie <strong>für</strong> Un- und<br />
Angelernte – erhoben:<br />
• kaufmännische Weiterbildung,<br />
• gewerblich-technische Weiterbildung,<br />
• soziale Kompetenzen,<br />
• Führungs- und Managementtraining (nur bei Führungskräften und<br />
Hochqualifizierten),
Holle Grünert<br />
• EDV-Anwendungen,<br />
• Rechts- und Steuerfragen,<br />
• Fremdsprachen und fremde Kulturen.<br />
Vor allem zwei Themenfelder kontrastieren ganz klar im Hinblick auf den<br />
Nutzungsgrad der verschiedenen Lernformen. Es handelt sich um die Weiterbildung<br />
auf <strong>dem</strong> Gebiet sozialer Kompetenzen und die gewerblich-technische Weiterbildung<br />
(siehe Tabelle 6):<br />
Tabelle 6: Nutzungsgrad der erhobenen Lernformen und (<strong>aus</strong>gewählte) Themengebiete<br />
von Weiterbildung <strong>für</strong> Fachkräfte<br />
Themengebiet<br />
soziale<br />
Kompetenzen<br />
gewerblich-<br />
technische<br />
Weiterbildung<br />
Betriebe nach <strong>dem</strong> Nutzungsgrad der Lernformen<br />
unterste<br />
Gruppe<br />
untere<br />
Mitte<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008;<br />
56<br />
Mittel-<br />
gruppe<br />
obere<br />
Mitte<br />
Spitzen-<br />
Gruppe<br />
Korrelations-<br />
koeffizient<br />
21,3 39,4 56,6 66,8 83,6 ,382<br />
66,5 63,4 54,2 47,8 41,0 –,176<br />
Mehrfachantworten, Prozent, Korrelation nach Spearman<br />
In der Gruppe von Betrieben mit <strong>dem</strong> geringsten Nutzungsgrad der erhobenen<br />
Lernformen bieten zwei von drei Betrieben ihren Fachkräften (unter anderem)<br />
gewerblich-technische Weiterbildung an, aber nur einer von fünf Weiterbildung auf<br />
<strong>dem</strong> Gebiet sozialer Kompetenzen. Umgekehrt bieten in der Spitzengruppe mit <strong>dem</strong><br />
höchsten Nutzungsgrad unterschiedlicher Lernformen vier von fünf Betrieben<br />
Weiterbildung auf <strong>dem</strong> Gebiet sozialer Kompetenzen an und nur zwei von fünf auf<br />
gewerblich-technischem Gebiet. Mit anderen Worten, in den Fällen, in denen sich die<br />
Weiterbildung auf die Vermittlung und Aneignung sozialer Kompetenzen richtet,<br />
besteht ein starker positiver Zusammenhang mit der Diversität der Lernformen (der<br />
sich auch im <strong>aus</strong>gewiesenen Korrelationskoeffizienten zeigt). Die Vielfalt und der<br />
unterschiedliche Situationsbezug sozialer Kompetenzen erfordern offenbar auch<br />
vielfältige Lernformen. Dort hingegen, wo gewerblich-technische Inhalte im<br />
Mittelpunkt stehen, scheint der Weiterbildungsbedarf in sich homogener zu sein und<br />
kann <strong>dem</strong>nach sehr viel leichter mit nur einer Lernform oder einem bestimmten Typ
57<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
von Weiterbildungsmaßnahmen gedeckt werden. Der Zusammenhang mit <strong>dem</strong><br />
Nutzungsgrad unterschiedlicher Lernformen ist hier tendenziell negativ.<br />
Ähnlich klare Zusammenhänge wie bei den Fachkräften zeigen sich auch bei der<br />
Weiterbildung <strong>für</strong> andere Qualifikationsgruppen.<br />
Ebenso sei auf die Anlässe <strong>für</strong> Weiterbildung und Lernen im Betrieb verwiesen.<br />
Solche Anlässe können sehr vielfältig sein, oftmals treten mehrere in Kombination<br />
miteinander auf. Tabelle 7 gibt einen Überblick über Gruppen möglicher Anlässe<br />
oder Lernanstöße, wobei wiederum der Bezug zum Nutzungsgrad der erhobenen<br />
Lernformen hergestellt wird.<br />
Tabelle 7: Nutzungsgrad der erhobenen Lernformen und (<strong>aus</strong>gewählte)<br />
Weiterbildungsanlässe<br />
Anlass <strong>für</strong><br />
Weiterbildung<br />
technische<br />
Entwicklung,<br />
Innovation<br />
Wünsche der<br />
Beschäftigten<br />
arbeits- oder<br />
betriebs-organisat.<br />
Änderungen<br />
Betriebe nach <strong>dem</strong> Nutzungsgrad der Lernformen<br />
unterste<br />
Gruppe<br />
untere<br />
Mitte<br />
Mittel-<br />
gruppe<br />
obere<br />
Mitte<br />
Spitzen-<br />
Gruppe<br />
Korrelations-<br />
Koeffizient<br />
61,5 73,5 76,9 73,0 79,6 ,086<br />
49,1 64,4 69,0 78,5 86,6 ,236<br />
55,0 56,0 70,3 74,1 79,0 ,190<br />
Neueinstellungen 39,1 59,4 59,7 69,3 74,2 ,194<br />
Probleme im Betrieb 15,4 17,8 18,6 20,7 24,2 ,063<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008;<br />
Mehrfachantworten, Prozent, Korrelation nach Spearman<br />
Dort, wo die Wünsche und Anregungen der Beschäftigten als Anstöße <strong>für</strong><br />
Weiterbildung und Lernen im Betrieb aufgegriffen und ernst genommen werden, ist<br />
die Vielfalt genutzter Lernformen deutlich größer als in Betrieben, in denen dies nicht<br />
der Fall ist. Auch statistisch zeigt sich ein positiver Zusammenhang (Korrelation)<br />
zwischen der Häufigkeit des – unter allen angebotenen Möglichkeiten am<br />
zweithäufigsten genannten – Weiterbildungsanlasses „Wünsche der Beschäftigten“<br />
und <strong>dem</strong> Nutzungsgrad unterschiedlicher Lernformen.
Holle Grünert<br />
Ganz anders sieht das Bild bei <strong>dem</strong> – am häufigsten genannten –<br />
Weiterbildungsanlass „technische Entwicklung“ <strong>aus</strong>. Hier scheinen eher gleichartige,<br />
weniger diversifizierte Bedarfe vorzuliegen, die mit einer begrenzten Zahl von<br />
Lernaktivitäten und Lernformen befriedigt werden können. Es lässt sich kein direkter<br />
Zusammenhang mit <strong>dem</strong> Nutzungsgrad der erhobenen unterschiedlichen<br />
Lernformen feststellen.<br />
Auch bei <strong>dem</strong> – selten genannten – Weiterbildungsanlass „Probleme im Betrieb“<br />
besteht kein solcher Zusammenhang. Hingegen zeichnet sich bei den anderen hier<br />
erhobenen Weiterbildungsanlässen („arbeits- oder betriebsorganisatorische<br />
Änderungen“, „Neueinstellung von Beschäftigten“) zumindest ein schwacher<br />
Zusammenhang mit <strong>dem</strong> Nutzungsgrad unterschiedlicher Lernformen ab.<br />
Insgesamt lassen sich anhand der unterschiedlichen Beziehungen zwischen<br />
Weiterbildungsanlässen, Inhalten und Formen auf der Basis unserer Empirie die<br />
Umrisse von zwei Weiterbildungsprofilen erkennen:<br />
• Zum einen handelt es sich um ein vergleichsweise eng fokussiertes Profil,<br />
das inhaltlich stärker technisch <strong>aus</strong>gerichtet oder in anderer Weise<br />
faktenbezogen ist, das oftmals an bestimmte, konkret wahrnehmbare Anlässe<br />
(zum Beispiel eine Innovation) gebunden ist und das, da der Bedarf relativ<br />
homogen und klar umgrenzt auftritt, auch mit einer relativ geringen Zahl von<br />
Lernformen und Lernaktivitäten <strong>aus</strong>kommt.<br />
• Zum anderen geht es um ein wesentlich breiter angelegtes Profil, das eher<br />
sozial-kommunikativ <strong>aus</strong>gerichtet ist, unter dessen Inhalten soziale<br />
Kompetenzen eine wichtige Rolle spielen, bei <strong>dem</strong> Weiterbildung häufig als<br />
ein fortdauernder, mehr oder weniger kontinuierlicher (zum Beispiel auf die<br />
Wünsche und Anregungen der Beschäftigten reagierender) Prozess<br />
organisiert ist, wobei eine größere Diversität von Lernformen genutzt wird.<br />
Gerade <strong>für</strong> dieses Profil ist auch die Einbettung von Planung und<br />
Durchführung der Weiterbildung in die betriebliche Personalpolitik und in das<br />
System kollektivvertraglicher Interessenregulierung von erheblicher<br />
Bedeutung.<br />
4. Zwei kontrastierende Typen weiterbildender Betriebe<br />
Natürlich haben wir uns gefragt, ob wir zu diesen empirisch umrissenen<br />
Weiterbildungsprofilen Hinweise, Parallelen oder Analogien in der Literatur finden.<br />
58
59<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Fündig geworden sind wir vor allem bei der Diskussion um berufsorientierte und<br />
prozessorientierte Weiterbildung, zu der beispielsweise Baethge und Schiersmann<br />
schon vor mehr als zehn Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet haben.<br />
Nach Meinung der Autoren charakterisiert sich der „berufsorientierte“<br />
Weiterbildungstyp vor allem durch fachliche Inhalte, durch Angebote formeller<br />
Weiterbildung und eine vergleichsweise geringe Nutzung informeller Lernformen. Der<br />
„prozessorientierte“ Weiterbildungstyp charakterisiert sich durch fachliche und<br />
fachübergreifende Inhalte sowie durch die Nutzung formalisierter und informeller<br />
Lernformen. Diese Kennzeichen und Unterscheidungen finden wir durch<strong>aus</strong> in<br />
unserem Material wieder. Wir können in bestimmten Grenzen mit ihrer Hilfe Typen<br />
weiterbildender Betriebe ermitteln.<br />
Gewisse Vorbehalte habe ich allerdings gegen eine gelegentlich in der Diskussion<br />
anzutreffende Tendenz, die „Beruf“ und „Prozess“ einander entgegensetzt, den Beruf<br />
dabei im Wesentlichen auf das reduziert, was in der beruflichen Erst<strong>aus</strong>bildung<br />
vermittelt wird und ihn dann als etwas relativ Starres, wenig Entwicklungsfähiges<br />
kritisiert. Ich sehe unter anderem die Gefahr, dass die – ihrerseits einem ständigen<br />
Aktualisierungs- und Veränderungsdruck unterliegenden – berufsfachlichen<br />
Kompetenzen als Kern und Grundlage beruflicher Weiterbildung (gegenüber<br />
„zusätzlichen“ berufsübergreifenden Kompetenzen) unterschätzt werden könnten.<br />
Auch kann man empirisch zwar innerhalb eines bestimmten Tätigkeitsgebietes oft<br />
recht klar unterscheiden, was berufliche und was berufsübergreifende Kompetenzen<br />
sind. Beim Vergleich von verschiedenen Berufen, Tätigkeitsgebieten oder Branchen<br />
wird das sehr viel schwieriger. So können soziale Kompetenzen bei zahlreichen<br />
Tätigkeiten auf <strong>dem</strong> Bau oder im verarbeitenden Gewerbe zwar sehr hilfreich, aber<br />
durch<strong>aus</strong> etwas „Zusätzliches“ sein. Bei Erziehern oder bei Pflegekräften gehören<br />
soziale Kompetenzen dagegen zweifellos zu den beruflichen Kernkompetenzen<br />
(oder – wenn man an den Zeitdruck denkt, unter <strong>dem</strong> Pflegekräfte heute oftmals<br />
arbeiten müssen – sollten jedenfalls dazu gehören).<br />
Wenn ich deshalb vorschlage, von „fachlichem“ (statt „beruflichem“) und<br />
“prozessorientiertem“ Weiterbildungstypus zu sprechen, t<strong>aus</strong>che ich scheinbar<br />
nur ein Wort <strong>aus</strong>; aber ich möchte damit ein wenig meine Bedenken gegen die<br />
Entgegensetzung von „Beruf“ und „Prozess“ und die implizite Abwertung des Berufs<br />
(und des Berufskonzeptes) anklingen lassen.
Holle Grünert<br />
Anknüpfend an Baethge, Schiersmann (1998) haben wir – vereinfacht – die Betriebe<br />
unseres Samples nach zwei Kriterien unterschieden:<br />
a) danach, ob sie neben Angeboten zur formellen Weiterbildung über- oder<br />
unterdurchschnittlich häufig auf informelle Lernformen zurückgreifen;<br />
b) danach, ob sich die Weiterbildungsangebote (nur) auf im engeren Sinne<br />
fachliche – zum Beispiel kaufmännische oder gewerblich-technische – Inhalte<br />
richten oder ob auch fachübergreifende Inhalte – zum Beispiel auf <strong>dem</strong> Gebiet<br />
sozialer Kompetenzen – vermittelt werden.<br />
Das erste Kriterium ist, wie mir scheint, gut handhabbar. Mit <strong>dem</strong> zweiten sind wir<br />
selber nicht ganz glücklich, denn genau das Problem, was denn nun im Einzelnen<br />
fachliche Inhalte sind und was nicht, bekommen wir damit auch nicht in den Griff.<br />
Trotz<strong>dem</strong> haben wir uns hier <strong>für</strong> diesen Weg der Annäherung entschieden.<br />
Das Vorgehen lässt sich anhand einer Vierfeldertafel (siehe Abbildung 1)<br />
veranschaulichen:<br />
Abbildung 1: Zwei kontrastierende Betriebstypen<br />
nur fachliche Inhalte<br />
fachliche und<br />
fachübergreifende Inhalte<br />
formelle Weiterbildung und<br />
unterdurchschnittliche Nutzung<br />
informelle Lernformen<br />
eher „fachlicher“<br />
Weiterbildungstypus<br />
Mischform<br />
60<br />
formelle Weiterbildung und<br />
überdurchschnittliche Nutzung<br />
informeller Lernformen<br />
Mischform<br />
eher „prozessorientierter“<br />
Weiterbildungstypus<br />
Wir erhalten zwei kontrastierende Weiterbildungstypen und damit – wenn wir<br />
unterstellen, dass in einem Betrieb jeweils ein Weiterbildungstyp vorherrscht – zwei<br />
kontrastierende Betriebstypen: den „fachlichen“ Typ mit unterdurchschnittlicher<br />
Nutzung informeller Lernformen und Konzentration auf fachliche Inhalte sowie den<br />
„prozessorientierten“ Typ mit fachlichen wie fachübergreifenden Inhalten und<br />
überdurchschnittlicher Nutzung informeller Lernformen.<br />
Auf den „fachlichen“ Weiterbildungstypus entfällt knapp ein Viertel der befragten<br />
Betriebe, auf den „prozessorientierten“ Typus knapp ein Fünftel. Die Konzentration<br />
auf diese beiden kontrastierenden Typen (unter Vernachlässigung der Mischformen)<br />
soll dazu dienen, einige Merkmale der Betriebe deutlicher hervorzuheben, wobei ich<br />
mich auf Branche und Betriebsgröße, auf die Planung von Weiterbildung und auf
61<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Einschätzungen der Befragten zum Status von Weiterbildung im Betrieb<br />
beschränken möchte.<br />
Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Zugehörigkeit der Betriebe zu vier großen<br />
Wirtschaftssektoren: <strong>dem</strong> produzierenden Gewerbe, den (eher) personennahen<br />
Dienstleistungen, den (eher) unternehmensnahen Dienstleistungen und <strong>dem</strong> Sektor<br />
Gesundheit, Veterinär, Soziales.<br />
Tabelle 8: Branchenzugehörigkeit bei zwei kontrastierenden Betriebstypen<br />
Branche<br />
Typus<br />
„fachlich“<br />
(N = 314)<br />
Typus<br />
„prozessorientiert“<br />
(N = 230)<br />
alle Betriebe<br />
(N = 1270)<br />
produzierendes Gewerbe 52,5 12,6 31,4<br />
personennahe Dienstleistungen 22,3 23,9 25,4<br />
unternehmensnahe Dienstleistungen 18,8 21,7 20,1<br />
Gesundheit, Veterinär, Soziales 6,4 41,8 23,1<br />
Gesamt <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Spaltenprozente<br />
Wie sich erkennen lässt, gibt es <strong>aus</strong>geprägte sektorale Schwerpunkte. So gehören<br />
über die Hälfte der Betriebe des „fachlichen“ Typus zum produzierenden Gewerbe.<br />
42 Prozent der Betriebe im „prozessorientierten“ Typ kommen dagegen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
Gesundheitswesen oder <strong>dem</strong> sozialen Sektor. Dienstleistungsbetriebe sind in beiden<br />
Typen etwa proportional zu ihrem Gewicht in der Gesamtstichprobe vertreten.<br />
Tabelle 9 ergänzt das Bild durch die Betriebsgröße anhand der Beschäftigtenzahl:<br />
Tabelle 9: Zwei kontrastierende Betriebstypen: Größe<br />
Beschäftigte<br />
Typus<br />
„fachlich“<br />
Typus<br />
„prozessorientiert“<br />
alle Betriebe<br />
unter 50 51,8 27,9 44,5<br />
50 bis 249 38,2 38,0 37,3<br />
250 und mehr <strong>10</strong>,0 34,1 18,2<br />
Gesamt <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Spaltenprozente<br />
Es fällt auf, dass der „fachliche“ Typ einen <strong>aus</strong>gesprochenen Kleinbetriebs-Bias<br />
aufweist. Über die Hälfte der Betriebe haben weniger als 50 Mitarbeiter, nur 20<br />
Prozent beschäftigen mindestens 250 Personen. Dagegen ist die Größenverteilung<br />
beim „prozessorientierten“ Typ sehr viel <strong>aus</strong>gewogener.<br />
Auf unsere Frage nach der Planung von Weiterbildung im Betrieb äußerten sich<br />
die Gesprächspartner insgesamt recht optimistisch (siehe Tabelle <strong>10</strong>):
Holle Grünert<br />
Tabelle <strong>10</strong>: Zwei kontrastierende Betriebstypen: Planung von Weiterbildung<br />
Wird Weiterbildung im Betrieb<br />
geplant?<br />
Typus<br />
„fachlich“<br />
62<br />
Typus<br />
„prozessorientiert“<br />
alle Betriebe<br />
regelmäßig 58,0 90,4 70,2<br />
weniger regelmäßig 36,3 7,9 24,4<br />
überhaupt nicht 5,7 1,7 5,4<br />
Gesamt <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0 <strong>10</strong>0,0<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Spaltenprozente<br />
Vor allem im „prozessorientierten“ Typus wird großer Wert auf die Planung von<br />
Weiterbildung gelegt. Hier geben neun von zehn Betrieben an, regelmäßig zu<br />
planen; im „fachlichen“ Typ sind es sechs von zehn. Nur wenige Betriebe (im<br />
„prozessorientierten“ Typus nur knapp zwei Prozent) planen – nach eigenen<br />
Angaben – ihre Weiterbildungsaktivitäten gar nicht.<br />
Allerdings dürften die Zeithorizonte der Planung und wohl auch die Erwartungen an<br />
das, was Weiterbildungsplanung überhaupt leisten kann, sehr unterschiedlich sein. In<br />
einer anderen Untersuchung fanden wir her<strong>aus</strong>, dass etwa die Hälfte der Betriebe<br />
nur <strong>für</strong> das laufende Jahr sicher angeben kann, welche Weiterbildung benötigt wird;<br />
lediglich ein Viertel kann dies <strong>für</strong> einen längeren Zeitraum. 6<br />
Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir diverse Einschätzungen mit erhoben,<br />
die uns helfen sollen, die Aussagen unserer Gesprächspartner zum Weiterbildungs-<br />
engagement in ihrem Betrieb besser einzuordnen. Tabelle 11 zeigt einige<br />
<strong>aus</strong>gewählte Beispiele:<br />
6 Vgl. Grünert, H.; Böttcher, S. 2009.
63<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Tabelle 11: Zwei kontrastierende Betriebstypen: Einschätzungen zur Weiterbildung<br />
Beschäftigte<br />
Typus<br />
„fachlich“<br />
Typus<br />
„prozessorientiert“<br />
alle Betriebe<br />
In unserem Betrieb ist Lernen stark in die Arbeit bzw. in die Geschäftsprozesse eingebunden.<br />
stimme völlig zu 37,9 50,0 45,6<br />
In Arbeitsteams bilden sich die Mitarbeiter gegenseitig weiter.<br />
stimme völlig zu 20,4 29,8 27,0<br />
Nur ein geringer Teil des Lernens wird formal vermittelt, den Hauptanteil bildet das Lernen im<br />
Arbeitsprozess.<br />
stimme völlig zu 47,1 29,1 42,2<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Prozent<br />
Auch hier bestehen klare Unterschiede zwischen den kontrastierenden<br />
Betriebstypen. So geben überdurchschnittlich viele Vertreter des „prozess-<br />
orientierten“ Typs, aber unterdurchschnittlich viele des „fachlichen“ Typs an, in ihren<br />
Betrieben sei das Lernen generell stark in die Arbeit bzw. in die Geschäftsprozesse<br />
eingebunden. Ähnlich verhält es sich mit der Einschätzung, dass sich die Mitarbeiter<br />
innerhalb ihrer Arbeitsteams gegenseitig weiterbilden. Auch hier liegt der<br />
„prozessorientierte“ Typ über <strong>dem</strong> „fachlichen“.<br />
Anders ist die Situation bei der Aussage, nur ein geringer Teil des Lernens erfolge<br />
formalisiert, den Hauptteil bilde das Lernen im Arbeitsprozess. Hier weisen die<br />
Betriebe des „fachlichen“ Typs überraschend hohe Zustimmungswerte auf. Dabei<br />
dürfte es sich – nach allem, was wir über die Weiterbildungserfordernisse in<br />
verschiedenen Branchen und auch über die Nutzung unterschiedlicher Lernformen<br />
wissen – nicht selten um eine Schutzbehauptung handeln, wenn eigentlich nicht viel<br />
Weiterbildung im Betrieb gemacht wird. Wäre es doch weit logischer, wenn Betriebe,<br />
bei denen das Lernen im Arbeitsprozess im Vordergrund steht, auch besonders<br />
häufig informelle Lernformen nutzen.<br />
Alles in allem weisen die beiden kontrastierenden Betriebstypen differenzierte<br />
Weiterbildungserfordernisse auf, die nicht zuletzt mit unterschiedlichen<br />
Strukturmerkmalen der betreffenden Betriebe korrespondieren. Eine intensive<br />
typenbezogene Analyse betrieblicher Weiterbildung, die freilich erst am Anfang steht,<br />
könnte einen wichtigen Beitrag dazu leisten, solche differenzierten Erfordernisse<br />
noch genauer als bisher zu erfassen und Möglichkeiten (auch neuartige<br />
Möglichkeiten) zu ihrer Deckung zu explorieren. Wir wollen keinesfalls einer starren<br />
Gegenüberstellung von „besseren“ und „schlechteren“, von „moderneren“ und
Holle Grünert<br />
„weniger modernen“ Weiterbildungstypen das Wort reden. Es gibt jedoch Anzeichen<br />
da<strong>für</strong>, dass gerade der „prozessorientierte“ Typ über erhebliche Zukunftspotentiale<br />
verfügt.<br />
5. Ausblick: Konsequenzen <strong>für</strong> die Zusammenarbeit mit Weiterbildungsträgern<br />
Die weitere Arbeit an einer noch zu verfeinernden Betriebstypologie wäre sicher auch<br />
nützlich, um mehr über die Interessen und Beweggründe bei der Zusammenarbeit<br />
von Betrieben mit externen Weiterbildungsanbietern zu lernen. Schon jetzt sehen wir<br />
auch hier deutliche Unterschiede. Zwei Beispiele seien genannt:<br />
Das erste Beispiel bezieht sich auf die Zusammenarbeit bei der Konzipierung von<br />
Weiterbildungsangeboten und die Art der bevorzugten Angebote. Wir fragten die<br />
Betriebe nach ihren Erfahrungen bei der Arbeit mit einem konkreten Partner in<br />
jüngster Zeit. Diese zeitnahen Erfahrungen deuten – auch bei der Konzipierung der<br />
Angebote – auf generelle Präferenzen hin. Tabelle 12 veranschaulicht drei Arten von<br />
Weiterbildungsangeboten, die Gegenstand von Aushandlungsprozessen waren. Es<br />
wurde danach gefragt, ob der jeweilige Weiterbildungspartner (nur) sein<br />
Standardangebot <strong>für</strong> den Betrieb leicht abgewandelt hat, ob der Betrieb das Angebot<br />
<strong>aus</strong> Modulen selbst <strong>aus</strong>wählen und zusammenstellen konnte oder ob gemeinsam ein<br />
individuelles Angebot erarbeitet wurde.<br />
Tabelle 12: Zwei kontrastierende Betriebstypen: Zusammenarbeit mit einem Partner<br />
bei der Konzipierung von Weiterbildungsangeboten<br />
Wie sind in letzter Zeit … Weiterbildungsangebote<br />
zustande gekommen?<br />
Der Anbieter hat sein inhaltliches<br />
Standardangebot <strong>für</strong> Sie leicht abgewandelt.<br />
Sie konnten sich das Angebot <strong>aus</strong> Modulen<br />
selbst zusammenstellen.<br />
Sie haben gemeinsam mit <strong>dem</strong> Anbieter ein<br />
individuelles Angebot erarbeitet.<br />
Typus<br />
„fachlich“<br />
64<br />
Typus<br />
„prozessorientiert“<br />
alle Betriebe<br />
33,2 38,8 36,9<br />
34,9 51,3 38,8<br />
38,3 65,6 48,3<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Mehrfachantworten, Prozent<br />
Durchweg fällt eine Präferenz <strong>für</strong> passgenaue, individuell erarbeitete Angebote auf.<br />
Besonders <strong>aus</strong>geprägt ist diese Präferenz im „prozessorientierten“ Typus. Hier<br />
gaben zwei Drittel der Betriebe an, in letzter Zeit gemeinsam mit einem externen<br />
Weiterbildungsanbieter ein maßgeschneidertes Angebot erarbeitet zu haben. Gut die<br />
Hälfte stellte sich ein Weiterbildungsangebot <strong>aus</strong> Modulen des Anbieters zusammen,<br />
weniger als zwei Fünftel entschieden sich <strong>für</strong> ein Standardangebot des
65<br />
Weiterbildungsprofile von Betrieben<br />
Bildungsträgers. Im „fachlichen“ Typus sind die Gewichte zwischen den<br />
verschiedenen Angebotsarten etwas gleichmäßiger verteilt: Hier entschieden sich in<br />
letzter Zeit knapp zwei Fünftel der Betriebe <strong>für</strong> ein individuelles Angebot und jeweils<br />
etwa ein Drittel <strong>für</strong> ein Angebot <strong>aus</strong> Modulen bzw. <strong>für</strong> ein Standardangebot.<br />
Das zweite Beispiel bezieht sich auf die Zufriedenheit mit <strong>dem</strong> Partner. Betriebe,<br />
die eng mit einem externen Weiterbildungsanbieter zusammenarbeiten, sind offenbar<br />
auch mit der Qualität ihres Partners deutlich zufriedener als andere. Wir baten die<br />
Betriebe, mehrere Qualitätsdimensionen des Partners (fachlich-inhaltliche Qualität,<br />
pädagogische und didaktische Qualität, Beratungsqualität im Vorfeld, infrastrukturelle<br />
Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis) auf einer Skala von „sehr gut“ über „gut“ und<br />
„weniger gut“ bis „nicht gut“ zu bewerten. Tabelle 13 zeigt die Verteilung der<br />
Bewertungen mit „sehr gut“ bei den Betrieben der beiden kontrastierenden Typen.<br />
Tabelle 13: Zwei kontrastierende Betriebstypen: Wie beurteilen Sie die Qualität Ihres<br />
Partners?<br />
Beurteilung „sehr gut“ im Hinblick<br />
auf…<br />
Typus<br />
„fachlich“<br />
Typus<br />
„prozessorientiert“<br />
alle Betriebe<br />
Beratung im Vorfeld 16,2 31,8 25,9<br />
fachlich-inhaltliche Qualität 38,5 53,4 49,1<br />
pädagogische und didaktische Qualität 16,2 33,5 26,8<br />
Infrastruktur 29,7 33,8 32,5<br />
Preis-Leistungs-Verhältnis 20,6 20,8 20,8<br />
Quelle: <strong>zsh</strong>-Befragung weiterbildender Betriebe 2008; Mehrfachantworten, Prozent<br />
Gemessen an diesen Bewertungen sind die Betriebe des „prozessorientierten“ Typs<br />
alles in allem viel zufriedener mit der Qualität ihres Partners als die Betriebe des<br />
„fachlichen“ Typs. Dies gilt besonders <strong>für</strong> die Einschätzung der fachlich-inhaltlichen<br />
Qualität, der pädagogischen und didaktischen Qualität wie auch der Beratungs-<br />
qualität im Vorfeld, die sich gerade bei der gemeinsamen Konzipierung passgenauer,<br />
auf die betrieblichen Bedürfnisse zugeschnittener Angebote erweist.<br />
Es scheint, dass Betriebe, die von sich <strong>aus</strong> weiterbildungsaktiv sind und ein<br />
vergleichsweise breit angelegtes Weiterbildungsprofil aufweisen, auch über gute<br />
Vor<strong>aus</strong>setzungen verfügen, um in der Zusammenarbeit mit externen Anbietern ihre<br />
Anforderungen zu formulieren, gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen<br />
und die Stärken der Anbieter effektiv <strong>für</strong> sich und ihre Mitarbeiter zu nutzen.
Holle Grünert<br />
Auf welche öffentlichen Unterstützungsstrukturen Betriebe in diesem Prozess und<br />
generell bei der Fachkräftesicherung mittels Aus- und Weiterbildung zurückgreifen<br />
können, dazu wird der folgende Beitrag am Beispiel Brandenburgs einen Überblick<br />
geben.<br />
Literatur<br />
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland. Ein<br />
indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Übergängen im Anschluss an den<br />
Sekundarbereich I. Bielefeld: W. Bertelsmann.<br />
Baethge, Martin; Schiersmann, Christiane (1998): Prozessorientierte Weiterbildung -<br />
Perspektiven und Probleme eines neuen Paradigmas der Kompetenzentwicklung <strong>für</strong> die<br />
Arbeitswelt der Zukunft. In: Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungs-<br />
Management (Hrsg.): Kompetenzentwicklung ’98: Forschungsstand und<br />
Forschungsperspektiven. Münster; New York; München; Berlin: Waxmann, S. 15-87.<br />
Grünert, Holle; Böttcher, Sabine (2009): Wissensbedarf in der mitteldeutschen<br />
Kunststoffindustrie. <strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 09-3. Halle.<br />
Grünert, Holle; Wiener, Bettina; Winge, Susanne (20<strong>10</strong>): Zusammenarbeit von Betrieben und<br />
Bildungsträgern in der beruflichen Weiterbildung. Abschlussbericht (im Erscheinen).<br />
Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2006): Bildung in Deutschland. Ein<br />
indikatoren-gestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld: W.<br />
Bertelsmann.<br />
Lutz, Burkart (2005): Weiterbildung und Kompetenzentwicklung. In: Winge, Susanne (Hrsg.):<br />
Kompetenzentwicklung in Unternehmen. <strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 05-1, Halle, S.<br />
65-166. Halle.<br />
Moraal, Dick; Lorig, Barbara; Schreiber, Daniel; Azeez, Ulrike (2009): Ein Blick hinter die<br />
Kulissen der betrieblichen Weiterbildung in Deutschland. Daten und Fakten der<br />
nationalen CVTS3-Zusatzerhebung. Bundesinstitut <strong>für</strong> Berufsbildung (Hrsg.): BIBB-<br />
Report, Heft 7, Januar 2009. Bonn.<br />
Sass, Jürgen; Sengenberger, Werner; Weltz, Friedrich (1974): Weiterbildung und<br />
betriebliche Arbeitskräftepolitik. Eine industriesoziologische Analyse. Köln; Frankfurt<br />
(Main): Europäische Verlagsanstalt.<br />
66
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter kleiner und mittlerer<br />
Unternehmen im Land Brandenburg – Möglichkeiten und Grenzen<br />
67<br />
Sabine Löser<br />
Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
1. Das Projekt Regionalbüros <strong>für</strong> Fachkräftesicherung und das<br />
Brandenburgische Fachkräfteinformationssystem<br />
Das Projekt Regionalbüros <strong>für</strong> Fachkräftesicherung und das Brandenburger<br />
Fachkräfteinformationssystem wurden im Jahr 2006 mit finanzieller Unterstützung<br />
<strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie durch das brandenburgische<br />
Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familien (MASGF) ins Leben<br />
gerufen. Die Brandenburger Landesregierung hat damit die Landesagentur <strong>für</strong><br />
Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH (LASA) beauftragt. Neben der Einrichtung<br />
der Büros an sechs Schlüsselstandorten des Landes war es Ziel, ein flächen-<br />
deckendes Fachkräfteinformationssystem (FIS) aufzubauen.<br />
Abbildung 1: Das Brandenburger Fachkräfteinformationssystem (FIS)<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
Sabine Löser<br />
Dieses öffentlich zugängliche Informationssystem ist über die Domain<br />
www.fachkraefte-brandenburg.de oder über die Internetseite der LASA (www.lasa-<br />
brandenburg.de) zu erreichen.<br />
Das FIS zeigt, wie sich der Arbeitsmarkt in Brandenburg in den letzten Jahren<br />
entwickelt hat und welche Veränderungen künftig auf uns zukommen. Unterschieden<br />
wird dabei zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten, den Branchen<br />
und den 30 beschäftigungsstärksten Berufen Brandenburgs. Besondere Bedeutung<br />
kommt dabei der Frage nach den zu erwartenden Rentenabgängen als Indikator <strong>für</strong><br />
zukünftige Fachkräftebedarfe und den Schulabgängerzahlen in den Regionen zu.<br />
Dem FIS kann man auch entnehmen, wie sich die Bevölkerung in Brandenburg und<br />
in den Landkreisen entwickeln wird. Solches Wissen kann Unternehmen dabei<br />
helfen, sich z. B. gezielt auf den Wandel am Arbeitsmarkt einzustellen und<br />
notwendige Anpassungsstrategien (Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen) auf den<br />
Weg zu bringen. Auch SchülerInnen können die Informationen über zukunftssichere<br />
Berufsfelder <strong>für</strong> die eigene Berufsorientierung nutzen. Die Entscheidung <strong>für</strong><br />
Ausbildungs- und Studiengänge kann Unentschlossenen leichter fallen, wenn<br />
bekannt ist, welche Wirtschaftbereiche sich in Brandenburg vor<strong>aus</strong>sichtlich als<br />
Zukunftsbranchen durchsetzen werden und wo Arbeitsmarktchancen entstehen.<br />
Als Schnittstelle in die Regionen und zu den Unternehmen fungieren die sechs<br />
Regionalbüros <strong>für</strong> Fachkräftesicherung.<br />
68
Abbildung 2: Die Regionalbüros <strong>für</strong> Fachkräftesicherung<br />
LASA Brandenburg GmbH –<br />
Regionalbüros <strong>für</strong> Fachkräftesicherung<br />
Die Regionalbüros <strong>für</strong><br />
Fachkräftesicherung bieten:<br />
• Information und Beratung<br />
• Fördermittelberatung EU/BUND/Land<br />
• Kontakte zu weiteren Akteuren<br />
• Mitarbeit in Initiativen zur Fachkräftesicherung<br />
• Unterstützung bei Ansiedlungs- und<br />
Erweiterungsinvestitionen<br />
Dieses Projekt wird <strong>aus</strong> den Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Brandenburg gefördert.<br />
ESF – Investition in Ihre Zukunft.<br />
69<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
HERBSTTAGUNG zur Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
05.11.2009<br />
Die Regionalbüros der LASA sind die arbeitspolitischen Ansprechpartner in den<br />
Regionen <strong>für</strong> Unternehmen, Wirtschaftsförderer, Kammern und Bildungsträger. Sie<br />
unterstützen bei der Antragstellung zu Fördermöglichkeiten und haben in der Region<br />
den Überblick über alle Aktivitäten im Bereich der Fachkräftesicherung. Zu<strong>dem</strong><br />
geben sie ihr Wissen an interessierte Akteure weiter.<br />
So erhalten beispielsweise Unternehmen in den sechs Regionalbüros gezielte<br />
Informationen zum Thema Personalentwicklung und werden zu Förderprogrammen<br />
beraten. Durchschnittlich 150 Beratungen werden im Quartal pro Büro durchgeführt.<br />
Zu<strong>dem</strong> ist die Mitarbeit in regionalen oder branchenspezifischen Initiativen zur<br />
Fachkräftesicherung integraler Bestandteil der Arbeit. Daneben unterstützt der<br />
Koordinator <strong>für</strong> Ansiedlungs- und Erweiterungsinvestitionen durch Informationen zu<br />
aktuellen Fachkräftezahlen in den Regionen und Branchen.<br />
Im Projekt werden außer<strong>dem</strong> qualitative Fachkräftebedarfsanalysen <strong>für</strong> die Regionen<br />
initiiert, mit Kooperationspartnern durchgeführt und <strong>aus</strong>gewertet. So werden,<br />
ergänzend zu den vorhandenen Daten der amtlichen Statistik, spezifische Prognosen<br />
<strong>für</strong> Ersatz-, Erweiterungs- und Qualifizierungsbedarfe aufgezeigt, die <strong>für</strong> die<br />
befragten Unternehmen einen sofortigen Mehrwert <strong>für</strong> die eigene Fachkräfte-<br />
sicherung mit sich bringen.
Sabine Löser<br />
Die LASA verfolgt bei der Fachkräftesicherung einen ganzheitlichen Ansatz. Die<br />
Regionalbüros unterstützen durch ihre Vernetzung im Land und durch die<br />
länderübergreifenden Kontakte die wirtschaftlichen und politischen Akteure mit<br />
konkreten Vorschlägen zu kurz- und mittelfristigen Maßnahmepaketen. Sie schieben<br />
regionale und branchenspezifische Prozesse der Fachkräftesicherung an, die von<br />
der Berufsorientierung über Aus- und Weiterbildung bis hin zu Kooperationen mit<br />
Hochschulen reichen. Die eigentliche Umsetzung der Maßnahmen erfolgt dann in<br />
den Unternehmen, bei den Bildungsträgern, Kammern und Wirtschaftsförderungen.<br />
Besonders jetzt in der aktuellen Weltwirtschaftskrise arbeiten die Regionalbüros eng<br />
mit den Arbeitsagenturen und den Kammern zusammen.<br />
2. Die brandenburgischen Fördermöglichkeiten<br />
Den brandenburgischen Fördermöglichkeiten vorangestellt werden soll der erst in<br />
diesem Jahr neu eingeführte Bildungsscheck. Ihn können sozialversicherungs-<br />
pflichtig Beschäftigte mit Hauptwohnsitz im Land Brandenburg bis zu zweimal<br />
jährlich, nach mündlicher Beratung durch die LASA, beantragen und <strong>für</strong> individuelle<br />
berufliche Weiterbildung unabhängig vom Arbeitgeber bei einem Bildungsträger<br />
einlösen. Bis zu 500 € gibt es jeweils als maximal 70 %igen (in Ausnahmefällen 90<br />
%igen) Zuschuss. Das Projekt ist noch ganz neu und befindet sich in der Startphase.<br />
Der Bildungsscheck bietet den Vorteil, dass damit sonst eher bildungsferne<br />
Personen erreicht werden können und die Qualifizierungsinhalte nicht an die aktuelle<br />
berufliche Tätigkeit gebunden sind, sondern auch zur beruflichen Umorientierung<br />
dienen können. Ausgeschlossen sind jedoch berufsabschlussbezogene und<br />
gesetzlich vorgeschriebene Qualifizierungen.<br />
70
Abbildung 3: Der brandenburgische Bildungsscheck<br />
Folie 6<br />
Der brandenburgische Bildungsscheck<br />
individuelle Qualifizierung <strong>für</strong><br />
brandenburgische Arbeitnehmer<br />
Hauptwohnsitz im Land Brandenburg<br />
maximal 500 € je Bildungsscheck<br />
pro Person können max. 2 Bildungsschecks pro Jahr <strong>aus</strong>gestellt werden<br />
der Bildungsscheck muss innerhalb eines halben Jahres eingelöst werden<br />
Eigenbeteiligung beträgt mind. <strong>10</strong> % <strong>für</strong> Beschäftigte, die sich in Elternzeit<br />
befinden oder die im Rahmen des "Kommunal-Kombi" tätig sind oder die<br />
ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten<br />
<strong>für</strong> alle anderen SV-Beschäftigten beträgt die Eigenbeteiligung an den<br />
Kursgebühren mind. 30 %<br />
Infos telefonisch unter 0331 - 6002 333<br />
71<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
per E-Mail unter bildungsscheck@lasa-brandenburg.de<br />
im Internet unter www.bildungsscheck.brandenburg.de<br />
HERBSTTAGUNG zur Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
05.11.2009<br />
Nachfolgend werden drei weitere brandenburgische Fördermöglichkeiten <strong>für</strong> kleine<br />
und mittlere Unternehmen (KMU) im Überblick vorgestellt und parallel einer<br />
kritischen Bilanz unterzogen. Es sind dies die Kompetenzentwicklungs-, die<br />
Verbund<strong>aus</strong>bildungs- sowie die sogenannte Netzwerkrichtlinie.<br />
Unternehmen in den regionalen Wachstumskernen (RWK) und in<br />
Branchenkompetenzfeldern genießen dabei besondere Priorität. Bei Einhaltung der<br />
Fördergrundsätze und Antragsformalitäten ist die Förderung aber auch <strong>für</strong> andere<br />
KMU möglich.
Sabine Löser<br />
Abbildung 4: Überblick über brandenburgische Fördermöglichkeiten<br />
Überblick über brandenburgische Fördermöglichkeiten<br />
Kompetenzrichtlinie<br />
• Qualifizierungsmaßnahmen <strong>für</strong> Mitarbeiter (MA) und<br />
Management<br />
• Personalcheck (Erstellung eines Gutachten)<br />
• nur <strong>für</strong> KMU<br />
HERBSTTAGUNG zur Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
72<br />
Verbund<strong>aus</strong>bildung<br />
• Förderung der Kosten des Verbundpartners <strong>für</strong><br />
Azubi<br />
• Förderung von Zusatzqualifikationen und<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
• Förderung Ausbildungscoach<br />
Qualifizierungsnetzwerke und Arbeitgeberzusammenschlüsse<br />
• Qualifizierungsnetzwerke (Aufbau oder Konsolidierung), mind. <strong>10</strong> Partner, davon mind. 6 KMU<br />
• Arbeitgeberzusammenschlüsse (Aufbau), mind. 6 KMU<br />
• bis zu 2 Jahre Förderung<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
05.11.2009<br />
Die Förderrichtlinien im Einzelnen und viele Hinweise zu den Antragsverfahren<br />
finden Sie auf der Homepage der LASA Brandenburg GmbH unter www.lasa-<br />
brandenburg.de.<br />
1. Richtlinie zur Unterstützung von Qualifizierungsnetzwerken und<br />
Arbeitgeberzusammenschlüssen (AGZ) in KMU<br />
Gefördert werden der Aufbau oder die Konsolidierung von Qualifizierungsnetzwerken<br />
und Arbeitgeberzusammenschlüssen <strong>für</strong> einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren.<br />
Die Ziele der Qualifizierungsnetzwerke müssen sich an den Themenschwerpunkten<br />
orientieren, die das Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, Soziales, Familie und Frauen in der<br />
entsprechenden Richtlinie vorgegeben hat. Dies kann beispielsweise die kooperative<br />
Ermittlung und Planung von Qualifizierungsbedarfen sein, kann aber zu<strong>dem</strong><br />
inhaltliche Konkretisierungen in den Bereichen Qualitäts- oder Wissensmanagement,<br />
Verzahnung von Aus- und Weiterbildung u.v.m. einschließen. Großer Wert wird<br />
dabei auf den Netzwerkcharakter der Zusammenarbeit gelegt. So soll durch die<br />
Förderung des Netzwerkmanagers nicht einfach die Personalentwicklung der<br />
beteiligten Unternehmen auf einen Externen <strong>aus</strong>gelagert werden, sondern der<br />
Netzwerkmanager soll bislang ungenutzte Synergien einer gemeinsamen Personal-
73<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
entwicklung zwischen den Betrieben identifizieren und fördern. Trotz steigender<br />
Nachfrage (pro Jahr ca. 20 Anträge) und auch höherer Bewilligungszahlen ist die<br />
Fortführung der Netzwerkarbeit nach Auslaufen der Förderung nur in wenigen Fällen<br />
erfolgreich gelungen.<br />
Arbeitgeberzusammenschlüsse (AGZ) sind relativ neu in Deutschland und werden –<br />
mangels Bekanntheit – noch selten nachgefragt. Ziel eines AGZ ist es, Fachkräfte<br />
einzustellen, die ein einzelnes Unternehmen zwar benötigt, aber zeitlich und<br />
finanziell nicht voll <strong>aus</strong>lasten kann. Diese Fachkräfte können dann durch die<br />
Mitgliedsunternehmen vom AGZ <strong>aus</strong>geliehen werden. Dieser hat also die Aufgabe,<br />
die Einsatzplanung der im AGZ eingestellten Mitarbeiter sowie die Neueinstellungen<br />
und strategische Personalentwicklung (bspw. durch Aus- und Weiterbildung) zu<br />
koordinieren.<br />
Übergeordnetes Ziel ist es, Fachkräfte in der Region zu halten, die sonst abwandern<br />
würden, weil ein einzelnes Unternehmen sie nicht (voll) einstellen kann.<br />
Problematisch ist momentan noch die rechtliche Unsicherheit, da es de facto um eine<br />
kontinuierliche Arbeitnehmerüberlassung geht, ohne dass der AGZ der klassischen<br />
Zeitarbeitsbranche zuzuordnen ist. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefragt,<br />
entsprechende Rechtssicherheit zu schaffen.<br />
2. Richtlinie zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in<br />
kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg<br />
Zentrales Ziel der geförderten Qualifizierungsmaßnahmen ist es, einerseits die<br />
strategischen Kompetenzen in den KMU im Bereich Personal- und<br />
Organisationsentwicklung zu stärken und andererseits die Weiterbildungsbereitschaft<br />
und Weiterbildungsteilnahme der Beschäftigten zu erhöhen. Die zu fördernden<br />
Maßnahmen müssen einer der drei im Folgenden vorgestellten Richtlinienelemente<br />
zuzuordnen sein:
Sabine Löser<br />
Abbildung 5: Förderung nach Punkt 2.2.1. der Richtlinie<br />
Kompetenzentwicklungsrichtlinie 2.2.1<br />
Qualifizierung von Beschäftigten und des<br />
Managements auf Basis betrieblicher<br />
Qualifizierungsbedarfe<br />
• Förderung von Weiterbildungskosten bis zu 80 %<br />
• max. 3.000 € pro Mitarbeiter/Jahr<br />
• keine berufsabschlussbezogenen Qualifizierungen<br />
HERBSTTAGUNG zur Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
74<br />
05.11.2009<br />
Im Mittelpunkt dieses Förderinstrumentes steht die mitarbeiterspezifische<br />
Weiterbildung im Unternehmen. Bei der Wahl der Qualifizierungsinhalte als auch der<br />
Bildungsträger sind die Unternehmen weitgehend frei. Förderfähig sind alle<br />
Weiterbildungsmaßnahmen, die <strong>für</strong> die Erreichung der Unternehmensziele von<br />
Nutzen sind. Lediglich berufsabschlussbezogene (Ausbildung, Meister oder Studium)<br />
sowie gesetzlich vorgeschriebene Qualifizierungen und Produktschulungen sind nicht<br />
förderfähig. Die Bildungsträger müssen zu<strong>dem</strong> über ein überprüftes<br />
Qualitätssicherungssystem verfügen (z.B. ISO 9001, AZWV u.a.).<br />
Diese inhaltlich weitgehend unbegrenzte Qualifizierung nach den Bedarfen im<br />
Unternehmen ist eine zielorientierte Förderung und wird daher von den Unternehmen<br />
gern und in großem Umfang angenommen. Mit jährlich bis zu 3.000 € <strong>für</strong> jeden<br />
Mitarbeiter ist auch die finanzielle Ausstattung der Förderung sehr attraktiv. Aus all<br />
diesen Gründen wird dieses Förderinstrument von den Unternehmen am häufigsten<br />
beantragt und ist <strong>für</strong> die bedarfsorientierte, wirtschaftsnahe Fachkräfteentwicklung im<br />
Land Brandenburg von her<strong>aus</strong>ragender Bedeutung.
Abbildung 6: Förderung nach Punkt 2.2.2. der Richtlinie<br />
Kompetenzentwicklungsrichtlinie 2.2.2<br />
Qualifizierung in KMU in spezifischen<br />
Themenfeldern<br />
Beispiele:<br />
• Qualitätsmanagement<br />
• flexible Arbeitszeitgestaltung<br />
• altersgerechtes Arbeiten<br />
• Inovationsfähigkeit<br />
u.a.<br />
• Förderung von Weiterbildungskosten bis zu 80 %<br />
• max. <strong>10</strong>.000 € pro Unternehmen/Jahr<br />
75<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
HERBSTTAGUNG zur Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
05.11.2009<br />
Ergänzend und im Unterschied zum ersten Förderinstrument (Nr. 2.2.1) geht es hier<br />
um Qualifizierungsthemen, die <strong>für</strong> das gesamte Unternehmen von Bedeutung sind.<br />
Beispiele sind Förderungen <strong>für</strong> den Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen oder<br />
Systemen zum alter(n)sgerechten Arbeiten. Aus diesem Grund ist auch die<br />
Förderhöhe nicht auf den einzelnen Mitarbeiter <strong>aus</strong>gerichtet, sondern beträgt jährlich<br />
bis zu <strong>10</strong>.000 € pro Unternehmen.
Sabine Löser<br />
Abbildung 7: Förderung nach Punkt 2.2.3. der Richtlinie<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
Der Personalcheck <strong>für</strong> die betriebliche Fachkräftesicherung ist ein Gutachten,<br />
welches beispielsweise von einem Personaldienstleister oder Unternehmensberater<br />
erstellt wird. Ziel ist es, mithilfe dieses Gutachtens personalpolitische<br />
Handlungsempfehlungen <strong>für</strong> das Unternehmen zu geben.<br />
Der Personalcheck beinhaltet die Analyse der strategischen Unternehmensziele, der<br />
Personalstrukturen und eine Qualifikationsbedarfsanalyse. Zusätzlich zu diesen drei<br />
Pflichtmodulen müssen zwei Wahlmodule <strong>aus</strong>gewählt werden, die den<br />
Personalcheck inhaltlich konkretisieren. So kann ein Personalcheck beispielsweise<br />
die Fachkräftesicherung mit besonderem Fokus auf das Innovationsmanagement<br />
oder die Gesundheitskompetenz in den Blick nehmen.<br />
Liegt der Personalcheck vor, können auf Basis der darin enthaltenen<br />
Qualifikationsbedarfsanalyse die konkreten Weiterbildungsmaßnahmen der<br />
Mitarbeiter und des Managements nach Punkt 2.2.1 der Richtlinie beantragt und<br />
gefördert werden.<br />
Trotz stets positiver Resonanz bei den Unternehmen wird dieses Förderinstrument<br />
nur selten in Anspruch genommen. Ein Grund da<strong>für</strong> ist möglicherweise das starke<br />
Bedürfnis bei kleinen und mittleren Unternehmen, möglichst schnell und situativ zu<br />
76
77<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
qualifizieren. Die Zeit <strong>für</strong> eine umfassendere Reflexion von Unternehmenszielen und<br />
entsprechend <strong>aus</strong>gerichteter Personalentwicklung ist bei den meisten Unternehmen<br />
vielleicht nicht vorhanden.<br />
Antragstellung<br />
Bei der Antragstellung nimmt die LASA Brandenburg GmbH eine Pionierstellung in<br />
Sachen papierloser Verwaltung ein. Im sogenannten „LASA-Portal“, das auf der<br />
Internetpräsenz der LASA verlinkt ist, erhalten Antragsteller ein Benutzerkonto und<br />
haben dann Zugriff auf die Formulare <strong>für</strong> sämtliche Förderprogramme, die die LASA<br />
Brandenburg GmbH im Auftrag der Landesregierung verwaltet. Antragsformulare,<br />
Anlagen und Zuwendungsbescheide sind <strong>aus</strong>schließlich in digitaler Form<br />
einzureichen. Einzige Ausnahme ist die rechtsverbindliche Unterschriftsseite des<br />
Antragformulars, da auf die teure Einführung der digitalen Signatur verzichtet wurde.<br />
Abbildung 8: Kompetenzentwicklungsrichtlinie – Antragsstellung<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
Für die konkreten Qualifizierungsmaßnahmen nach den Punkten 2.2.1 und 2.2.2<br />
können KMU entweder selber den Antrag stellen oder einen Organisationsträger mit<br />
der Beantragung und Durchführung der Maßnahme beauftragen. In diesem Fall<br />
muss der Organisationsträger allerdings mehrere KMU bündeln.
Sabine Löser<br />
Im Jahr 2009 wurden allein <strong>für</strong> die oben vorgestellte Kompetenzentwicklungsrichtlinie<br />
(Stand Oktober) 741 Qualifizierungsförderungen <strong>für</strong> KMU beantragt. Die<br />
Weltwirtschaftskrise hat viele Unternehmen zunächst verunsichert, was bis August<br />
2009 zu einem starken Rückgang der Anträge im Vergleich zu den Vorjahren geführt<br />
hat.<br />
Der Fördergeber hat darauf reagiert und mit der Anpassung der Förderhöhen ab<br />
August 2009, der Reduzierung der Anzahl der zu bündelnden KMU <strong>für</strong><br />
Organisationsträger und einer verstärkten Werbung <strong>für</strong> Qualifizierung in der Krise<br />
deutliche Erfolge in der Zunahme der Antragszahlen erreicht.<br />
3. Richtlinie des MASGF zur Förderung von Ausbildungsverbünden und<br />
Zusatzqualifikationen im Rahmen der Berufs<strong>aus</strong>bildung im Land Brandenburg<br />
Gegenstand der Förderung ist u. a. die Durchführung von Teilen der betrieblichen<br />
Ausbildung bei einem Kooperationspartner, was ein oder mehrere Betriebe,<br />
Bildungsträger oder Ausbildungsstätten der Kammern sein können.<br />
Abbildung 9: Förderung der Ausbildung im Verbund<br />
Quelle: Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH<br />
Ein Kooperationsvertrag ist Vor<strong>aus</strong>setzung <strong>für</strong> die Zuschüsse, die jeweils pro Tag<br />
und Auszubildenden bis max. 4.200 € pro Auszubildenden in kaufmännischen<br />
78
79<br />
Geförderte Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
Berufen und 6.000 € pro Auszubildenden in gewerblich-technischen Berufen<br />
bezogen auf die gesamte Ausbildungszeit gewährt werden.<br />
Darüber hin<strong>aus</strong> kann die Vermittlung von Zusatzqualifikationen mit 5 € pro Stunde<br />
und Auszubildenden <strong>für</strong> mindestens 40 und höchstens <strong>10</strong>0 Stunden während der<br />
gesamten Ausbildungszeit gefördert werden.<br />
Neu ist die Förderung von Ausbildungscoaches in kleinen und mittleren<br />
Unternehmen (KMU) im Rahmen der Richtlinie mit bis zu 750 € pro KMU <strong>für</strong> die<br />
gesamte Ausbildungszeit. Dabei muss ein Ausbildungscoach mindestens 40 Stunden<br />
pro Unternehmen eingesetzt werden.<br />
Ausbildungscoaches sind beauftragte externe Personen, die betriebliche Ausbilder in<br />
KMU durch individuelle Beratung bei der Verbesserung der Ausbildungsqualität<br />
unterstützen, insbesondere dann, wenn schwer vermittelbare Jugendliche<br />
<strong>aus</strong>gebildet werden.<br />
Sowohl die Förderung der Ausbildung im Verbund als auch die Zusatzqualifikationen<br />
<strong>für</strong> Auszubildende bieten <strong>für</strong> Unternehmen eine ideale Ergänzung zur<br />
Kompetenzentwicklung bereits vorhandener Mitarbeiter. Denn kaum eine andere<br />
Maßnahme wirkt so nachhaltig positiv auf den Fachkräftebestand, wie die Ausbildung<br />
eigener Nachwuchskräfte. Doch viele Unternehmen schaffen es nicht, alle gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte selbst abzudecken und sind zur Schaffung von<br />
Ausbildungsplätzen auf Kooperationspartner angewiesen, die die fehlenden<br />
Ausbildungsinhalte abdecken können. Wie groß der Bedarf dazu im Land<br />
Brandenburg nach wie vor ist, zeigen die ca. 900 Unternehmen, die allein in 2009<br />
einen entsprechenden Antrag auf Förderung gestellt haben.<br />
3. Welche Wirkungen zeigen die Förderprogramme des Landes?<br />
Zusammenfassend kann man festhalten, dass mit den vorgestellten<br />
Förderinstrumenten ein wichtiger Beitrag <strong>für</strong> die betriebliche Fachkräftesicherung im<br />
Land Brandenburg geleistet wird. Denn in aller Regel ist das Bewusstsein, die<br />
Personalentwicklung zu fördern, bei den Betrieben durch<strong>aus</strong> vorhanden. Oft fehlt es<br />
aber an den finanziellen Möglichkeiten. Genau hier greift die Kompetenz-<br />
entwicklungsrichtlinie, die mit bis zu 80 % die Kosten <strong>für</strong> Weiterbildung senken kann.<br />
Aber auch dort, wo die betriebliche Fachkräftesicherung innerhalb eines Branchen-<br />
kompetenzfeldes oder eines Regionalen Wachstumskernes noch der strategischen<br />
Ausrichtung bedarf und Synergien durch Kooperationen in diesem Bereich
Sabine Löser<br />
un<strong>aus</strong>geschöpft sind, kann die erwähnte Netzwerkrichtlinie kleinteiliger, mithin<br />
individueller fördern, als dies beispielsweise über die großen GA-Netzwerke leistbar<br />
ist.<br />
Neben den drei vorgestellten Programmen gibt es zu<strong>dem</strong> noch eine Vielzahl an<br />
ergänzenden Projektförderungen, die in der Kürze der Zeit hier nicht näher erläutert<br />
werden konnten. So wird von der Berufsorientierung, über Aus- und Weiterbildung<br />
bis hin zu Netzwerken und Fachkräftebedarfsanalysen ein Portfolio an Förderungen<br />
bereitgestellt, das den komplexen Her<strong>aus</strong>forderungen der Fachkräftesicherung<br />
gerecht wird.<br />
Die Landesregierung Brandenburg ist dabei stets engagiert, die bestehenden<br />
Programme den neuen Entwicklungen anzupassen, nicht selten auch – wie bei den<br />
Arbeitgeberzusammenschlüssen – innovative Akzente zu setzen. Eine wichtige Rolle<br />
bei der Weiterentwicklung der Förderprogramme spielen die Regionalbüros <strong>für</strong><br />
Fachkräftesicherung, denn durch Sensibilisierung und Information sowie<br />
regelmäßigen Aust<strong>aus</strong>ch mit den KMU können Effekte und Nutzen der Förder-<br />
programme an das Ministerium mit konkreten Empfehlungen zur Nachjustierung<br />
rückgekoppelt werden.<br />
80
Qualifizieren <strong>für</strong> die Zukunft – Schlusswort zur <strong>zsh</strong>-Herbsttagung<br />
81<br />
Burkart Lutz<br />
<strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e.V.<br />
In einem abschließenden Beitrag soll, so haben es die Kolleginnen und Kollegen, in<br />
deren Händen die Organisation dieser Tagung lag, beschlossen, versucht werden,<br />
eine erste Bilanz der im Laufe des Tages vorgetragenen Ideen, offenen Fragen und<br />
Erfahrungen zu ziehen. Das übergreifende Thema unserer Veranstaltung<br />
„Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten“ wurde heute in zwei Perspektiven<br />
behandelt, die sich in mehr als einer Hinsicht wechselseitig ergänzen: lokale<br />
Governance (auf die ich hier nur kursorisch eingehen möchte) und berufliche<br />
Bildung, vor allem betriebliche Aus- und Weiterbildungsaktivitäten.<br />
Perspektiven und Themen<br />
Im ersten Halbtag der Fachtagung, heute Vormittag, ging es um lokale Governance<br />
im Sinne von Regelung und Steuerung mit mehreren Partnern bei der Erbringung<br />
von Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen. Zunehmend lassen sich an<br />
verschiedenen Stellen und in verschiedenen Kontexten, vor allem an den „Rändern“<br />
der gut funktionierenden Regelungs- und Leistungssysteme, neuartige Formen der<br />
Selbstorganisation beobachten.<br />
Dies zeigt sich beispielsweise bei Projekten zur Integration von Personen, denen<br />
dauerhafte Exklusion von Arbeitsmarkt und Beschäftigung droht, und bei<br />
unterschiedlichen Kooperationslösungen <strong>für</strong> KMU zur Sicherung der Verfügbarkeit<br />
von qualifiziertem Personal. Besonders in den neuen Bundesländern häufen sich<br />
Problemlagen, <strong>für</strong> deren Bewältigung neue Formen der Erbringung öffentlicher<br />
Leistungen dringend geboten erscheinen.<br />
Diese neuen Formen sind – auf zumeist ganz selbstverständliche Weise – in die seit<br />
<strong>dem</strong> <strong>aus</strong>gehenden 19. Jahrhundert entstandenen und immer weiter <strong>aus</strong>gebauten<br />
sozialpolitischen Leistungs- und Regelungssysteme integriert, weisen aber<br />
andererseits wichtige Merkmale, Entscheidungsstrukturen und Vollzugsformen auf,<br />
die nicht ohne Weiteres mit der Funktionslogik dieser Systeme vereinbar sind.<br />
Ausgehend von diesen Beobachtungen wurden vier Initiativen bürgerlichen und<br />
lokalen Engagements vorgestellt, die mit ihren Lösungsansätzen zum konstruktiven
Burkart Lutz<br />
Umgang mit bestimmten Problemlagen im Spannungsfeld zwischen hoher Arbeits-<br />
losigkeit und sich anbahnender Fachkräftelücke beitragen wollen (siehe<br />
Tagungsband 1).<br />
Am zweiten Halbtag der Fachtagung, heute Nachmittag, dessen Beiträge im<br />
Tagungsband 2 zusammengefasst sind, galt das vorrangige Interesse den betrieb-<br />
lichen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten.<br />
Für ein hochentwickeltes Land wie die Bundesrepublik Deutschland ist die<br />
Versorgung mit gut qualifizierten Arbeitskräften von zentraler Bedeutung. Auch<br />
Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden <strong>dem</strong>ographischen Wandel, der<br />
nicht nur allgemein mit <strong>dem</strong> Stichwort von der „alternden Gesellschaft“ charakterisiert<br />
werden kann, sondern der speziell in Ostdeutschland – <strong>aus</strong> Gründen, die zum Teil<br />
bis in die Geschichte der DDR zurückreichen – sehr abrupt zu einem massiven<br />
Rückgang des Angebots an jungen Fachkräften führt. Vielen Betrieben ist diese<br />
Entwicklung durch<strong>aus</strong> bewusst und viele versuchen auch, darauf zu reagieren.<br />
Anhand des raschen Umschlagens von einem Nachwuchskräfteüberschuss zu<br />
einem drastischen Rückgang der Nachwuchskräftezahlen in Ostdeutschland stellten<br />
mehrere Beiträge die Frage, wie die bisherigen Erfahrungen <strong>aus</strong>bildender Betriebe<br />
ihre Zukunftserwartungen beeinflussen und welche Lernprozesse sich abzeichnen.<br />
Zugleich lassen neue Entwicklungen auf den internationalen Märkten, der rasche<br />
technologische Wandel sowie Veränderungen in den Organisations- und Personal-<br />
strukturen der Betriebe systematische betriebliche Weiterbildung immer dringlicher<br />
erscheinen.<br />
Auch hier gilt: Viele Betriebe sind sich der Notwendigkeit von Weiterbildung bewusst,<br />
aber längst nicht alle; und auch die weiterbildenden Betriebe engagieren sich in sehr<br />
unterschiedlichem Maße. So kam es in der Fachtagung teilweise zu lebhaften<br />
Diskussionen über geeignete Indizien <strong>für</strong> Weiterbildungsaktivitäten und unter-<br />
schiedliche Weiterbildungsprofile, <strong>aus</strong> denen sich auch differenzierte Anforderungen<br />
an die Zusammenarbeit mit externen Weiterbildungsanbietern ergeben können.<br />
Gerade in Ostdeutschland tragen öffentlich geförderte Strukturen wesentlich dazu<br />
bei, immer mehr Betriebe zu sensibilisieren, zu aktivieren und sie in bestimmtem<br />
Maße bei der Organisation von Weiterbildung zu unterstützen.<br />
82
83<br />
Qualifizieren <strong>für</strong> die Zukunft<br />
Drei Thesen zur Stellung der beruflichen Aus- und Weiterbildung im<br />
Bildungssystem<br />
In turbulenten Zeiten ist es oftmals von sehr hoher Bedeutung, nicht zwischen Hektik<br />
und falschem Zögern den Blick in die Zukunft zu verlieren, sondern sich auf die<br />
zukünftigen Folgewirkungen aktueller Veränderungen ebenso vorzubereiten wie auf<br />
das, was sich gegenwärtig bereits konturiert genug darstellt. Hierbei stehen <strong>für</strong> den<br />
Einzelnen vor allem die Sicherung seines Arbeitsplatzes und/oder ein <strong>aus</strong>reichendes<br />
Angebot an guten Beschäftigungschancen im Vordergrund, während <strong>für</strong> viele<br />
Unternehmen zweifellos die Verfügbarkeit an kompetenten und gut qualifizierten,<br />
lern- und leistungsfähigen Arbeitskräften überlebenswichtig sein kann.<br />
Nun ist es sicherlich nicht einfach, die zum Teil <strong>aus</strong>gesprochen komplexen<br />
Zusammenhänge zu umreißen, die hier zu beachten sind. Meiner Meinung nach<br />
können hierbei drei Thesen von Nutzen sein, mit deren Hilfe sich zumindest ein<br />
größerer Teil dessen in Erinnerung rufen lässt, was heute an klugen, besorgten oder<br />
aber perspektivereichen Dingen gesagt wurde, die zumindest erste Perspektiven<br />
eröffnen und offenkundig eine intensivere Reflexion verdienen.<br />
These I<br />
Gute Gründe sprechen da<strong>für</strong>, die gängigen Kennziffern zur Bewertung<br />
beruflicher Weiterbildung zu ergänzen.<br />
(a) Das Volumen von Weiterbildung als nach wie vor wichtiges Kriterium<br />
Um zu messen und zu bewerten, wie viel Weiterbildung – z.B. in einem Betrieb oder<br />
Unternehmen, <strong>für</strong> bestimmte Gruppen von Beschäftigten oder <strong>für</strong> Personen mit<br />
bestimmten Eigenschaften – angeboten wird, steht seit langer Zeit das Volumen<br />
ganz eindeutig im Vordergrund. Je mehr Weiterbildung angeboten (oder auch<br />
verordnet) wurde, so kann man diese Sichtweise etwas überspitzt auf einen Punkt<br />
bringen, desto besser.<br />
Der Nutzen, den Betriebe und Beschäftigte von Weiterbildung erwarten dürfen,<br />
hängt, so eine weit verbreitete Überzeugung, in großem Umfang von deren Volumen<br />
ab. Nimmt das Weiterbildungsvolumen im Zeitablauf oder im Vergleich zwischen<br />
Belegschaftsgruppen zu, so darf, alles in allem, auch steigender Nutzen unterstellt<br />
werden. Dies erlaubte und erlaubt es dann auch, zur Untersuchung von<br />
Weiterbildung oder zu ihrer praktischen Bewertung einfache quantitative Indikatoren
Burkart Lutz<br />
zu verwenden. Darf man doch ohne großes Irrtumsrisiko davon <strong>aus</strong>gehen, dass die<br />
Chancen des Zugangs zu Weiterbildung und der Nutzen der Beteiligung oder auch<br />
die Einbeziehung bestimmter Beschäftigtengruppen besser sind oder besser werden,<br />
wenn die entsprechenden Indikatoren – beispielsweise die Zahl der Kurs- oder<br />
Seminarstunden je Beschäftigtem und Jahr – ansteigen.<br />
Das Bild betrieblicher Weiterbildung, das sich <strong>aus</strong> den gängigen Erhebungen und<br />
Statistiken ergibt, hat sich seit längerer Zeit nicht wesentlich verändert. Die Chancen<br />
der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen und die hierbei <strong>für</strong> den Betrieb<br />
entstehenden Kosten bilden nach wie vor in hohem Maße die betriebliche Hierarchie<br />
ab: Je angesehener die Stellung eines Beschäftigten im Betrieb und je höher sein<br />
Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau, desto größer ist auch das Volumen an<br />
Weiterbildung, mit <strong>dem</strong> er rechnen kann und desto selbstverständlicher erscheint ein<br />
entsprechend hoher Aufwand des Betriebes.<br />
Recht gute Argumente können erklären, warum dieses Bild immer noch realistisch<br />
ist. So haben in nicht wenigen Betrieben seit einiger Zeit auch die<br />
Weiterbildungsaktivitäten die Aufmerksamkeit des Controllings gefunden und<br />
unterliegen zunehmend <strong>dem</strong> Zwang, ein günstiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis<br />
nachzuweisen. Und der Druck auf die Arbeitsvorgesetzten, sorgfältig zu prüfen, ob<br />
man nicht Etliches einsparen und ob man nicht vielleicht einen größeren Anteil der<br />
Kosten in die Eigenbeteiligung der Beschäftigten verschieben kann, entspricht<br />
zweifellos <strong>dem</strong> Zeitgeist.<br />
(b) Niveau und Profil als komplementäre Bewertungskriterien<br />
Je breiter das Spektrum der Aufgaben von beruflicher Weiterbildung ist, je vielfältiger<br />
die zu erbringenden Leistungen sind, je mehr Gruppen von Beschäftigten mit sehr<br />
unterschiedlichen Aufgaben und Kompetenzen an Weiterbildung teilnehmen sollen<br />
und je wichtiger die Fähigkeit wird, schnell und flexibel auf neue Anforderungen<br />
einzugehen, desto weniger ist es geraten, sich bei der Planung und Bewertung von<br />
Weiterbildungsaktivitäten mit stark standardisierten und wenig differenzierten<br />
Messgrößen zu begnügen.<br />
Als erster Schritt liegt es nahe, zwei Aspekte (oder Dimensionen) der Bewertung zu<br />
unterscheiden, die sich offenkundig in vielfältiger Weise miteinander kombinieren<br />
können. Sie lassen sich bezeichnen als:<br />
• das Niveau betrieblicher Weiterbildung und<br />
84
• das Profil der Weiterbildungsaktivitäten eines Betriebes (oder auch<br />
Betriebsteils).<br />
85<br />
Qualifizieren <strong>für</strong> die Zukunft<br />
Mit <strong>dem</strong> Niveau betrieblicher Weiterbildung wird im Wesentlichen das Volumen der<br />
entsprechenden Maßnahmen gemessen. Das Profil bildet insbesondere die Felder<br />
und/oder die Schwerpunkte von Weiterbildung ab.<br />
Durch Veränderungen des Nive<strong>aus</strong> („mehr oder weniger Weiterbildung“) oder des<br />
Profils („andere Felder und Schwerpunkte von Weiterbildung“) oder von bei<strong>dem</strong><br />
können Betriebe ein recht breites Spektrum von Effekten erzielen. Diese Effekte sind<br />
sicherlich vielfach vorrangig qualifikatorischer Art, doch dient Weiterbildung oftmals –<br />
zusätzlich oder alternativ zu qualifikatorischen Effekten – auch anderen betriebs-<br />
organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Zielen, wie mehr oder weniger<br />
Hierarchie oder als Anreiz <strong>für</strong> eigengesteuertes (und mehr oder minder<br />
eigenfinanziertes) Lernen und Ähnliches.<br />
Dieses Zusammenspiel verschiedener Ziele und ihr Zusammenhang mit spezifischen<br />
Ausgestaltungen von Weiterbildungsprofilen sind bisher nur wenig untersucht,<br />
obwohl bereits eine erste Inventur besonders häufiger oder besonders wichtiger<br />
Kombinationen zweifellos von erheblichem Nutzen sein könnte.<br />
These II<br />
Während sehr langer Zeit gab es eine klare, fest gefügte Arbeitsteilung und<br />
Abgrenzung von beruflicher Erst<strong>aus</strong>bildung und beruflicher Weiterbildung, die<br />
sich allerdings seit einiger Zeit immer stärker verändert.<br />
Die zumeist seit langem bewährten Formen der Arbeitsteilung geraten gegenwärtig<br />
zunehmend in Bewegung. Dies kann <strong>für</strong> die wichtigsten Akteure erheblichen<br />
Anpassungsdruck <strong>aus</strong>lösen. Vier Sachverhalte sind in diesem Zusammenhang vor<br />
allem zu nennen:<br />
• Die Linien, entlang derer die wechselseitige Abgrenzung verlief, verlieren an<br />
verschiedenen Stellen ihre Festigkeit.<br />
• Wissensmodule, Fertigkeiten und Kompetenzen, die traditionell Bestandteil<br />
der Erst<strong>aus</strong>bildung, insbesondere der Lehre, waren, werden – auf eine Art und<br />
Weise, die z.B. von Beruf zu Beruf wechseln kann – in das Angebot an
Burkart Lutz<br />
Weiterbildung integriert oder an Bildungseinrichtungen mit vorberuflicher<br />
Funktion übertragen.<br />
• Neben die klassischen Akteure des dualen Systems beruflicher<br />
Erst<strong>aus</strong>bildung, Betrieb und Berufsschule, treten neue Akteure, wie<br />
Weiterbildungsträger oder veränderte schulische Einrichtungen.<br />
• Zumindest in ersten Umrissen werden Strukturen eines „trialen“ Systems<br />
absehbar, das entweder Bildungsträgern einen gewichtigen Part in der<br />
Erst<strong>aus</strong>bildung einräumt oder aber von <strong>aus</strong>bildenden Betrieben explizite<br />
Beiträge zum Unterricht in der Berufsschule erwartet.<br />
Die Ursachen <strong>für</strong> derartige Veränderungen sind vielfältiger Art:<br />
Die nicht selten als dramatisch bezeichnete Verkürzung der Lebensdauer von<br />
Produkten, Produktionsmitteln und Technologien kann einen erheblichen Bedarf an<br />
mehr oder minder regelmäßiger Auffrischung wichtiger Wissensbestände erzeugen.<br />
Der deutlich stärker werdende Einfluss <strong>aus</strong>ländischer Kapitaleigner oder Kunden, die<br />
es als ganz selbstverständlich betrachten, dass ein Gutteil der im Betrieb benötigten<br />
Kompetenzen nicht in einer formalisierten Erst<strong>aus</strong>bildung, sondern in den ersten<br />
Berufsjahren erworben wird, setzt traditionsreiche Bestandteile des deutschen<br />
Systems unter erheblichen Veränderungsdruck.<br />
Bestimmte Formen der Arbeitsintensivierung, die im Betrieb kaum mehr Zeit <strong>für</strong> die<br />
kleinen Gespräche nebenbei lassen, in denen traditionell neues Wissen in die<br />
Belegschaft einsickerte, können dazu führen, dass – meist „unter der Hand“ – ein<br />
wachsender Bedarf an neuem Wissen entsteht, der nur durch Ausbau von – zumeist<br />
betrieblicher – Weiterbildung gedeckt werden kann.<br />
Es versteht sich wohl von selbst, dass mit Entwicklungen der genannten Art ein<br />
nachdrücklich steigender Bedarf an formalisierter Weiterbildung entstanden ist oder<br />
in Zukunft entstehen wird.<br />
86
These III<br />
87<br />
Qualifizieren <strong>für</strong> die Zukunft<br />
Wir stehen möglicherweise am Beginn eines tiefgreifenden Wandels der<br />
gesamten Ausbildungs- und Weiterbildungslandschaft. Wo dieser Wandel<br />
hinführt, ist offen.<br />
Welche Bedeutung die eben genannten Veränderungen an der Grenzlinie von<br />
Erst<strong>aus</strong>bildung und Weiterbildung erhalten werden, ist überwiegend offen. Es ist sehr<br />
wohl möglich, dass es sich hierbei um bloße Bestrebungen zur Modernisierung und<br />
Effizienzsteigerung der Weiterbildung handelt, wie sie auch in der Vergangenheit<br />
immer wieder zu beobachten waren. Es kann – andererseits – keineswegs<br />
<strong>aus</strong>geschlossen werden, dass wir es gegenwärtig mit ersten Anzeichen <strong>für</strong> mehr<br />
oder minder weitreichende Entwicklungen im Gesamtsystem von Bildung und<br />
Ausbildung zu tun haben, die in naher Zukunft von hoher Bedeutung <strong>für</strong> die Struktur<br />
und die Funktionsweise von beruflicher Weiterbildung werden können.<br />
Allerdings ist der einschlägige Forschungsstand immer noch sehr lückenhaft, sodass<br />
die Wissenschaft nur mit Vorsicht Aussagen treffen kann. So kann es beispielsweise<br />
vorkommen, dass wir heute bestimmte Entwicklungstendenzen im Feld der<br />
beruflichen Weiterbildung registrieren, deren prognostische Reflexion von hohem<br />
Reiz wäre, von denen wir jedoch in Kürze vielleicht feststellen werden, dass sie<br />
lediglich Ausdruck kurzfristiger Anpassungsprozesse ohne größere Tiefenwirkung<br />
sind.<br />
Ich möchte mich deshalb mit einigen Stichworten zu intrinsischen<br />
Veränderungstendenzen im Bildungs- und Ausbildungssystem und in seinem<br />
engeren Umfeld begnügen, die <strong>aus</strong>reichend pl<strong>aus</strong>ibel zu sein scheinen:<br />
Wir erleben gegenwärtig recht starke Tendenzen der Europäisierung im Bildungs-,<br />
Schul- und Hochschulsystem. Diese Tendenzen können – insbesondere, wenn es zu<br />
stärkeren Wechselwirkungen mit der <strong>dem</strong>ographischen Entwicklung kommt – zu<br />
einer verstärkten Verschulung der beruflichen Bildung führen, die im Folgezuge, wie<br />
eben in den Kommentaren zur zweiten These gesagt, auch auf die Weiterbildung<br />
einwirken.<br />
Die in den neuen Bundesländern sehr schnelle, in den alten Bundesländern deutlich<br />
langsamere Abnahme der Stärke der Geburtsjahrgänge kann zu einem wachsenden<br />
Druck auf das duale System der Erst<strong>aus</strong>bildung führen. Dies wird Auswirkungen<br />
sowohl auf die Erst<strong>aus</strong>bildung wie auf die Weiterbildung haben.
Burkart Lutz<br />
In der hierdurch <strong>aus</strong>gelösten Konkurrenz verschiedener Teile des Bildungs- und<br />
Ausbildungssystems um die verbleibende, tendenziell sinkende Zahl von<br />
leistungsfähigen und lernbereiten Bewerbern werden vor allem die professionellen<br />
Interessen des Bildungssystems bzw. der wichtigsten durchsetzungsstarken<br />
Personalgruppen eine erhebliche Rolle spielen.<br />
Ähnlich wie bereits seit längerer Zeit in anderen europäischen Ländern zu<br />
beobachten, können auf diese Weise auch in Deutschland neue Mischformen von<br />
schulischer Unterweisung und praktischem Lernen an Bedeutung gewinnen: „Duale<br />
Studiengänge“ und die offenbar wachsende Attraktivität von Berufsaka<strong>dem</strong>ien<br />
könnten Vorläufer einer breiteren Entwicklung werden.<br />
Wachsender Wissensbedarf an vielen Arbeitsplätzen kann – vor allem dort, wo<br />
bisher kleine Betriebe eine wichtige Rolle spielen – erhebliche Teile des Systems in<br />
die gleiche Richtung drängen.<br />
Gleiches gilt auch <strong>für</strong> die angesichts <strong>aus</strong>ländischer Erfahrungen absehbaren<br />
Bestrebungen von Betrieben, zumindest nennenswerte Teile der Ausbildungskosten<br />
auf das Bildungssystem abzuwälzen.<br />
Es versteht sich wohl von selbst, dass dies alles auch erhebliche neue<br />
Anforderungen an die Steuerung unabhängiger, aber dennoch kooperierender<br />
Partner im System der Aus- und Weiterbildung aufwirft – weshalb die hier am<br />
Vormittag vorgestellten Steuerungsmodelle auch <strong>für</strong> Verantwortliche der Aus- und<br />
Weiterbildung von hohem Interesse sein könnten und sollten.<br />
Ein Schlusswort<br />
Es gibt – ich würde sagen: leider – gute Argumente da<strong>für</strong>, dass wir uns in zwei<br />
Jahren zum gleichen Thema wieder treffen.<br />
88
Autorenverzeichnis<br />
Prof. Dr. Michael Behr, Lehrstuhl <strong>für</strong> Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie<br />
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Forschungsschwerpunkte:<br />
Industriesoziologie, Arbeitsmarktforschung, Ostdeutschlandforschung,<br />
Industrielle Beziehungen, Managementsoziologie<br />
Martin Ehrlich, M.A., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl <strong>für</strong> Arbeits-,<br />
Industrie- und Wirtschaftssoziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.<br />
Forschungsschwerpunkte: Arbeitsmarktforschung, sozialwissenschaftliche<br />
Regionalanalysen, Innovations- und Betriebsforschung<br />
PD Dr. Holle Grünert, Soziologin, Gründungsmitglied und leitende Wissenschaftlerin<br />
des <strong>Zentrum</strong>s <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Arbeitsschwerpunkte: Arbeitsmarkt und Beschäftigung sowie<br />
Unternehmensstrategien im Transformationsprozess<br />
Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Burkart Lutz, Soziologe, Gründungsmitglied und<br />
Forschungsdirektor des <strong>Zentrum</strong>s <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
wichtigste Arbeitsgebiete: Technik und Arbeit, Bildung und Berufsbildung,<br />
Arbeitsmarkt, Entwicklungsperspektiven industrieller Gesellschaften<br />
Sabine Löser, Landesagentur <strong>für</strong> Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH,<br />
Koordinatorin der Regionalbüros <strong>für</strong> Fachkräftesicherung<br />
Ingo Wiekert, Diplom-Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Arbeitsschwerpunkte: Entwicklungen auf <strong>dem</strong> zwischenbetrieblichen<br />
Arbeitsmarkt und Konsequenzen <strong>für</strong> die berufliche Bildung, Personalpolitiken<br />
in KMU<br />
89
Tagungsprogramm<br />
<strong>zsh</strong>-Herbsttagung „Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten“<br />
5. November 2009, <strong>10</strong>.00 – 17.00 Uhr, Händelhalle in Halle/Saale<br />
Aktuelles Tagesprogramm:<br />
<strong>10</strong>.00 – <strong>10</strong>.30 Uhr Ankommen bei Kaffee und einer kleinen Stärkung<br />
<strong>10</strong>.30 – <strong>10</strong>.45 Uhr Grußworte<br />
Dr. Ulrich Cramer, Ministerium <strong>für</strong> Wirtschaft und Arbeit Sachsen-<br />
Anhalt<br />
Dr. Uwe Bentrup, Bundesministerium <strong>für</strong> Bildung und Forschung<br />
Schwerpunkt I: local governance<br />
<strong>10</strong>.45 – 11.30 Uhr Bürgerarbeit<br />
Sylvia Kühnel, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt – Thüringen<br />
Sabine Böttcher, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e. V.<br />
Job Perspektive Plus<br />
Undine Schreiber, Regionaldirektion Bayern<br />
11.30 – 12.15 Uhr Nachwuchskräftepool<br />
Bettina Wiener, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e. V.<br />
Arbeitgeberzusammenschlüsse<br />
Dr. Thomas Hartmann, tamen<br />
12.15 – 12.45 Uhr Selbststeuerung in Regionen – local governance<br />
Michael Fischer, ÖAR Regionalberatung GmbH<br />
12.45 – 14.00 Uhr Mittagsp<strong>aus</strong>e und zwanglose Gespräche<br />
Schwerpunkt II: Qualifizierungspotentiale<br />
14.00 – 14.45 Uhr Ausbildungsbereitschaft von Betrieben<br />
Ingo Wiekert, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e. V.<br />
Prof. Dr. Michael Behr, Friedrich-Schiller-Universität Jena<br />
14.45 – 15.30 Uhr Weiterbildungsbereitschaft von Betrieben<br />
PD Dr. Holle Grünert, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e. V.<br />
Sabine Löser, LASA Brandenburg<br />
15.30 – 16.00 Uhr Qualifizieren <strong>für</strong> die Zukunft<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Burkart Lutz, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle e. V.<br />
16.00 – 17.00 Uhr Kultureller Abschluss und Ausklang<br />
Moderation der Veranstaltung: Susanne Winge, <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> e. V.<br />
91
Teilnehmerliste<br />
Name Organisation<br />
Carsten Bauers Berufsförderungswerk Leipzig<br />
Katharina Beck Mitteldeutscher Rundfunk<br />
Wolfgang Beck Ministerium <strong>für</strong> Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Michael Behr Friedrich-Schiller-Universität Jena<br />
Dana Bernikas Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft<br />
Dörte Biermann Strukturförderungsgesellschaft Wittenberg mbH<br />
Bettina Bochenski Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e. V.<br />
Sabine Böttcher <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Petra Bratzke Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit Dessau-Roßlau<br />
Dieter Brückner Verein <strong>für</strong> Bildungsinnovationen e. V.<br />
Christina Buchwald <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Mirka Burkert Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Herbert Buscher Institut <strong>für</strong> Wirtschaftsforschung Halle<br />
Stefan Chlebowski Verein <strong>für</strong> Bildungsinnovationen e. V.<br />
Jana Csongar Qualifizierungsförderungswerk Chemie GmbH<br />
Sten Cudrig <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Michael Fischer ÖAR Regionalberatung GmbH<br />
Amadeus Flößner Bildungsträger A.M. Gastro Coaching<br />
Karla Franz Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH<br />
Holle Grünert <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Katrin Harm Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Lars Hartenstein Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e. V.<br />
Thomas Hartmann tamen GmbH<br />
Heike Heldt Stadt Bitterfeld-Wolfen<br />
Ingrid Hölzler Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg<br />
Marko Huber Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit Sachsen-Anhalt – Thüringen<br />
Anemone Jäger Volkssolidarität Plauen/Oelsnitz e. V.<br />
Ute Kämmer Jugend- und Schulplattform e. V.<br />
Almut Kapper-Leibe IG Metall Halle<br />
Ingelore Kapust InfraLeuna GmbH<br />
Michael Kleber DGB Region Dessau<br />
Reiner Kleinfeld Teutloff Bitterfeld<br />
Antje Knuth Senatsverwaltung <strong>für</strong> Integration, Arbeit und Soziales Berlin<br />
Verena Kriessler CURA Unternehmensgruppe<br />
93
Andreas Krüger CURA Unternehmensgruppe<br />
Sylvia Kühnel Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit Sachsen-Anhalt – Thüringen<br />
Annegret Künzel Fraktion DIE LINKE. im Bundestag<br />
Katrin Liebscher Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft<br />
Sabine Löser LASA Brandenburg GmbH<br />
Burkart Lutz <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Corinna Malik BMVBS<br />
Andrea Marks Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen<br />
Jörg Marquardt Piening GmbH<br />
Birgit Mühlenberg Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt<br />
Hilmar Müller Sekundarschule Bad Schmiedeberg<br />
Udo Nistripke Handwerkskammer Halle<br />
David Nowaczyk Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e. V.<br />
Bernhard Ott ETZ Projektmanagement GmbH Weißenfels<br />
Peer Pasternack Institut <strong>für</strong> Hochschulforschung Wittenberg<br />
Petra Pietzsch ZAW Leipzig GmbH<br />
Thomas Pleye Ministerium <strong>für</strong> Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Oliver Powalla <strong>Zentrum</strong> Technik und Gesellschaft Berlin<br />
Sylvia Purz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Ulrich Reymann Institut <strong>für</strong> Marktwirtschaft Magdeburg<br />
Olaf Richardt Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e. V.<br />
Kerstin Richter<br />
Frank Röder QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt<br />
Reinhold Sackmann Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Martina Scherer Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit Wittenberg<br />
Anja Schika Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Günter Schmidt VHS-Bildungswerk in Thüringen GmbH<br />
Udo Schmode Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e.V.<br />
Angela Schreck Landesverwaltungsamt<br />
Undine Schreiber Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit Bayern<br />
Sabine Schwarz Volkssolidarität Plauen/Oelsnitz e. V.<br />
Simone Simon Bundesagentur <strong>für</strong> Arbeit Sachsen-Anhalt – Thüringen<br />
Sabine Thiele Bildungsaka<strong>dem</strong>ie Verkehr Sachsen-Anhalt e. V.<br />
Michael Thomas BISS e. V.<br />
Michael Uhlmann ATB Arbeit, Technik und Bildung GmbH<br />
Dorothea Walther Netzwerk Ostdeutschlandforschung<br />
Dorit Wehling BiG - Bildungszentrum in Greifswald gGmbH<br />
94
Ingo Wiekert <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Bettina Wiener <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Susan Willhardt Kooperationsstelle MLU-DGB<br />
Susanne Winge <strong>Zentrum</strong> <strong>für</strong> <strong>Sozialforschung</strong> Halle<br />
Gabi Witschorke Entwicklungsgesellschaft Energiepark L<strong>aus</strong>itz GmbH (EEpL)<br />
Kl<strong>aus</strong> Zimmermann DGB Sachsen-Anhalt<br />
95
Bisher veröffentlichte „<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong>“ (20<strong>10</strong> – 2001)<br />
Wiekert, Ingo (Hg.) (20<strong>10</strong>): <strong>zsh</strong>-Herbsttagung zur Fachkräftesicherung in turbulenten Zeiten<br />
– Tagungsband 2.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> <strong>10</strong>-1<br />
Böttcher, Sabine (Hg.) (2009): <strong>zsh</strong>-Herbsttagung zur Fachkräftesicherung in turbulenten<br />
Zeiten – Tagungsband 1.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 09-4<br />
Grünert, Holle; Böttcher, Sabine (2009): Wissensbedarf in der mitteldeutschen<br />
Kunststoffindustrie.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 09-3<br />
Winge, Susanne; Wiener, Bettina (2009): Fachkräftesicherung in der Landwirtschaft<br />
Sachsen-Anhalts Eine große Her<strong>aus</strong>forderung <strong>für</strong> die Zukunft.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 09-2<br />
Winge, Susanne; Wiener, Bettina (2009): Lernen in kleinen und mittleren Unternehmen.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 09-1<br />
Christine Steiner, Friedrich H<strong>aus</strong>s, Sabine Böttcher, Burkart Lutz (2008): Evaluation des<br />
Projektes Bürgerarbeit im 1. Flächenversuch in der Stadt Bad Schmiedeberg<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 08-1<br />
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2007): Betriebliche Ausbildung und<br />
Arbeitsmarktlage - eine vergleichende Untersuchung in Sachsen-Anhalt, Brandenburg<br />
und Niedersachsen<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 07-5<br />
Lutz, Burkart (2007): Wohlfahrtskapitalismus und die Ausbreitung und Verfestigung interner<br />
Arbeitsmärkte nach <strong>dem</strong> Zweiten Weltkrieg. (Preprint)<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 07-4<br />
Meier, Heike; Wiener, Bettina; Winge, Susanne (2007): Regionaler Qualifizierungspool<br />
landwirtschaftlicher Unternehmen.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 07-3<br />
Ketzmerick, Thomas; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2007): Brandenburg und seine Jugend -<br />
Integrationspfade Brandenburger Jugendlicher in Beschäftigung.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 07-2<br />
Ketzmerick, Thomas; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2007): Brandenburg und seine Jugend -<br />
Regionale Mobilität.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 07-1<br />
97
Steiner, Christine (2006): Integrationspfade von ostdeutschen Ausbildungsabsolventen in<br />
Beschäftigung.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 06-6<br />
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2006): Zukunftsperspektiven der<br />
Berufs<strong>aus</strong>bildung in den neuen Ländern und die Rolle der Bildungsträger.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 06-5<br />
Wiener, Bettina; Winge, Susanne (2006): Planen mit Weitblick. Her<strong>aus</strong>forderungen <strong>für</strong> kleine<br />
Unternehmen.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 06-4<br />
Buchwald, Christina (2006): Das Telefoninterview - Instrument der Zukunft?<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 06-3<br />
Buchwald, Christina (2006): Studie zur Bildungslandschaft in Aschersleben. Eine<br />
Untersuchung zur Integration einer weiterführenden Schule in freier Trägerschaft in die<br />
Bildungslandschaft der Stadt Aschersleben.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 06-2<br />
Wiener, Bettina; Meier, Heike (2006): Maßnahmen <strong>für</strong> ostdeutsche Jugendliche und<br />
Jungerwachsene an der zweiten Schwelle. Inventarisierung und Ermittlung von<br />
Erfolgsfaktoren. Abschlussbericht.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 06-1<br />
Böttcher, Sabine (2005): Eignung des Mikrozensus-Panels <strong>für</strong> Analysen des Übergangs von<br />
der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 05-3<br />
Lutz, Burkart; Wiener, Bettina (Red.) (2005): Ladenburger Diskurs. Personalmanagement<br />
und Innovationsfähigkeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>zsh</strong> 05-2<br />
Winge, Susanne (Hg.) (2005): Kompetenzentwicklung in Unternehmen. Ergebnisse einer<br />
Betriebsbefragung.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 05-1<br />
Meier, Heike (Hg.) (2004): Kompetenzentwicklung in deutschen Unternehmen. Formen,<br />
Vor<strong>aus</strong>setzungen und Veränderungsdynamik. Dokumentation zur Fachtagung am 23.<br />
Juni 2004 in Halle.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 04-3<br />
98
Wiener, Bettina; unter Mitarbeit von Richter, Thomas; Teichert, Holger (2004): Abschätzung<br />
des Bedarfs landwirtschaftlicher Fachkräfte unter Berücksichtigung der <strong>dem</strong>ographischen<br />
Entwicklung (Schwerpunkt neue Bundesländer).<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 04-2<br />
Steiner, Christine; Böttcher, Sabine; Prein, Gerald; Terpe, Sylvia (2004): Land unter.<br />
Ostdeutsche Jugendliche auf <strong>dem</strong> Weg ins Beschäftigungssystem.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 04-1<br />
Lutz, Burkart; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2003): Personalstrukturerhebung in der<br />
Landwirtschaft 2002.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 03-1<br />
Grünert, Holle; Steiner, Christine (2002): Geförderte Berufs<strong>aus</strong>bildung in Ostdeutschland –<br />
Materialien <strong>aus</strong> der Forschung.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 02-4<br />
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2002): Betriebliche Erst<strong>aus</strong>bildung in Sachsen-<br />
Anhalt.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 02-3<br />
Lutz, Burkart; Meier, Heike; Wiener, Bettina (Red.) (2002): Neue Aufgaben an der<br />
Schnittstelle von Ingenieur- und Sozialwissenschaften – Dokumentation eines Dialogs.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 02-2<br />
Meier, Heike; Pauli, Hanns; Wiener, Bettina (2002): Der Nachwuchskräftepool als<br />
Sprungbrett in Beschäftigung.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 02-1<br />
Meier, Heike; Weiß, Antje; Wiener, Bettina (Red.) (2002): Generationen<strong>aus</strong>t<strong>aus</strong>ch in<br />
industriellen Unternehmensstrukturen - Dokumentation zum Forschungs-Praxis-<br />
Kolloquium.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 02-5<br />
Böttcher, Sabine; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2001): Alters- und Qualifikationsstruktur in<br />
der ostdeutschen Industrie am Beispiel der Chemie.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 01-3<br />
Lutz, Burkart (2001): Im Osten ist die zweite Schwelle hoch.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 01-2<br />
Ketzmerick, Thomas (2001): Ostdeutsche Frauen mir instabilen Erwerbsverläufen am<br />
Beispiel Sachsen-Anhalt.<br />
<strong>Forschungsberichte</strong> <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>zsh</strong> 01-1<br />
99