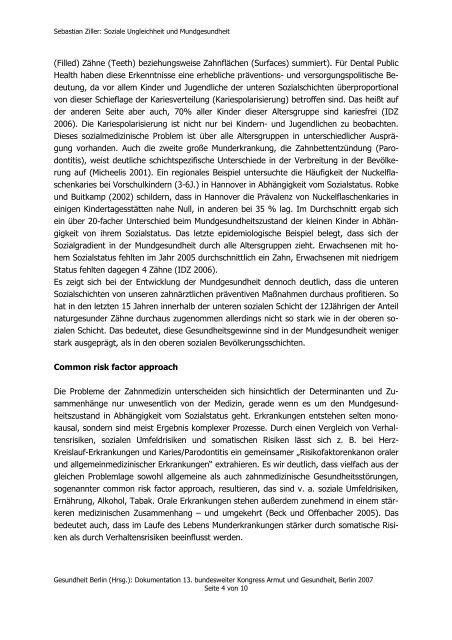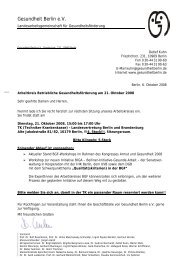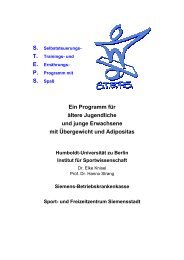Soziale Ungleichheit und Mundgesundheit - Gesundheit Berlin eV
Soziale Ungleichheit und Mundgesundheit - Gesundheit Berlin eV
Soziale Ungleichheit und Mundgesundheit - Gesundheit Berlin eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sebastian Ziller: <strong>Soziale</strong> <strong>Ungleichheit</strong> <strong>und</strong> M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit<br />
(Filled) Zähne (Teeth) beziehungsweise Zahnflächen (Surfaces) summiert). Für Dental Public<br />
Health haben diese Erkenntnisse eine erhebliche präventions- <strong>und</strong> versorgungspolitische Be-<br />
deutung, da vor allem Kinder <strong>und</strong> Jugendliche der unteren Sozialschichten überproportional<br />
von dieser Schieflage der Kariesverteilung (Kariespolarisierung) betroffen sind. Das heißt auf<br />
der anderen Seite aber auch, 70% aller Kinder dieser Altersgruppe sind kariesfrei (IDZ<br />
2006). Die Kariespolarisierung ist nicht nur bei Kindern- <strong>und</strong> Jugendlichen zu beobachten.<br />
Dieses sozialmedizinische Problem ist über alle Altersgruppen in unterschiedlicher Ausprä-<br />
gung vorhanden. Auch die zweite große M<strong>und</strong>erkrankung, die Zahnbettentzündung (Paro-<br />
dontitis), weist deutliche schichtspezifische Unterschiede in der Verbreitung in der Bevölke-<br />
rung auf (Micheelis 2001). Ein regionales Beispiel untersuchte die Häufigkeit der Nuckelfla-<br />
schenkaries bei Vorschulkindern (3-6J.) in Hannover in Abhängigkeit vom Sozialstatus. Robke<br />
<strong>und</strong> Buitkamp (2002) schildern, dass in Hannover die Prävalenz von Nuckelflaschenkaries in<br />
einigen Kindertagesstätten nahe Null, in anderen bei 35 % lag. Im Durchschnitt ergab sich<br />
ein über 20-facher Unterschied beim M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heitszustand der kleinen Kinder in Abhän-<br />
gigkeit von ihrem Sozialstatus. Das letzte epidemiologische Beispiel belegt, dass sich der<br />
Sozialgradient in der M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit durch alle Altersgruppen zieht. Erwachsenen mit ho-<br />
hem Sozialstatus fehlten im Jahr 2005 durchschnittlich ein Zahn, Erwachsenen mit niedrigem<br />
Status fehlten dagegen 4 Zähne (IDZ 2006).<br />
Es zeigt sich bei der Entwicklung der M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit dennoch deutlich, dass die unteren<br />
Sozialschichten von unseren zahnärztlichen präventiven Maßnahmen durchaus profitieren. So<br />
hat in den letzten 15 Jahren innerhalb der unteren sozialen Schicht der 12Jährigen der Anteil<br />
naturges<strong>und</strong>er Zähne durchaus zugenommen allerdings nicht so stark wie in der oberen so-<br />
zialen Schicht. Das bedeutet, diese Ges<strong>und</strong>heitsgewinne sind in der M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>heit weniger<br />
stark ausgeprägt, als in den oberen sozialen Bevölkerungsschichten.<br />
Common risk factor approach<br />
Die Probleme der Zahnmedizin unterscheiden sich hinsichtlich der Determinanten <strong>und</strong> Zu-<br />
sammenhänge nur unwesentlich von der Medizin, gerade wenn es um den M<strong>und</strong>ges<strong>und</strong>-<br />
heitszustand in Abhängigkeit vom Sozialstatus geht. Erkrankungen entstehen selten mono-<br />
kausal, sondern sind meist Ergebnis komplexer Prozesse. Durch einen Vergleich von Verhal-<br />
tensrisiken, sozialen Umfeldrisiken <strong>und</strong> somatischen Risiken lässt sich z. B. bei Herz-<br />
Kreislauf-Erkrankungen <strong>und</strong> Karies/Parodontitis ein gemeinsamer „Risikofaktorenkanon oraler<br />
<strong>und</strong> allgemeinmedizinischer Erkrankungen“ extrahieren. Es wir deutlich, dass vielfach aus der<br />
gleichen Problemlage sowohl allgemeine als auch zahnmedizinische Ges<strong>und</strong>heitsstörungen,<br />
sogenannter common risk factor approach, resultieren, das sind v. a. soziale Umfeldrisiken,<br />
Ernährung, Alkohol, Tabak. Orale Erkrankungen stehen außerdem zunehmend in einem stär-<br />
keren medizinischen Zusammenhang – <strong>und</strong> umgekehrt (Beck <strong>und</strong> Offenbacher 2005). Das<br />
bedeutet auch, dass im Laufe des Lebens M<strong>und</strong>erkrankungen stärker durch somatische Risi-<br />
ken als durch Verhaltensrisiken beeinflusst werden.<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>Berlin</strong> (Hrsg.): Dokumentation 13. b<strong>und</strong>esweiter Kongress Armut <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit, <strong>Berlin</strong> 2007<br />
Seite 4 von 10