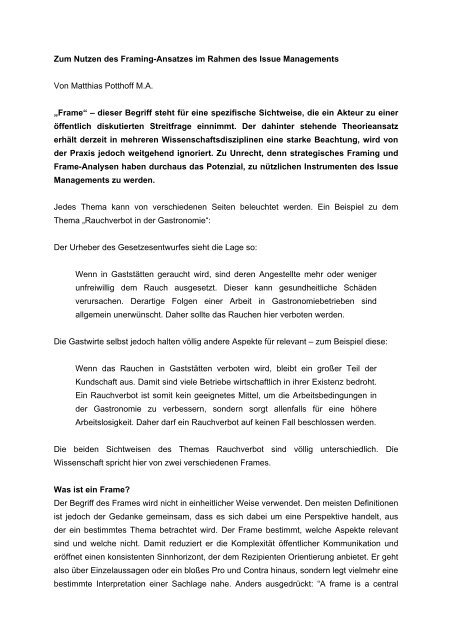Lesen Sie den Aufsatz von Matthias Potthoff - JP|KOM GmbH
Lesen Sie den Aufsatz von Matthias Potthoff - JP|KOM GmbH
Lesen Sie den Aufsatz von Matthias Potthoff - JP|KOM GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zum Nutzen des Framing-Ansatzes im Rahmen des Issue Managements<br />
Von <strong>Matthias</strong> <strong>Potthoff</strong> M.A.<br />
„Frame“ – dieser Begriff steht für eine spezifische Sichtweise, die ein Akteur zu einer<br />
öffentlich diskutierten Streitfrage einnimmt. Der dahinter stehende Theorieansatz<br />
erhält derzeit in mehreren Wissenschaftsdisziplinen eine starke Beachtung, wird <strong>von</strong><br />
der Praxis jedoch weitgehend ignoriert. Zu Unrecht, <strong>den</strong>n strategisches Framing und<br />
Frame-Analysen haben durchaus das Potenzial, zu nützlichen Instrumenten des Issue<br />
Managements zu wer<strong>den</strong>.<br />
Jedes Thema kann <strong>von</strong> verschie<strong>den</strong>en Seiten beleuchtet wer<strong>den</strong>. Ein Beispiel zu dem<br />
Thema „Rauchverbot in der Gastronomie“:<br />
Der Urheber des Gesetzesentwurfes sieht die Lage so:<br />
Wenn in Gaststätten geraucht wird, sind deren Angestellte mehr oder weniger<br />
unfreiwillig dem Rauch ausgesetzt. Dieser kann gesundheitliche Schä<strong>den</strong><br />
verursachen. Derartige Folgen einer Arbeit in Gastronomiebetrieben sind<br />
allgemein unerwünscht. Daher sollte das Rauchen hier verboten wer<strong>den</strong>.<br />
Die Gastwirte selbst jedoch halten völlig andere Aspekte für relevant – zum Beispiel diese:<br />
Wenn das Rauchen in Gaststätten verboten wird, bleibt ein großer Teil der<br />
Kundschaft aus. Damit sind viele Betriebe wirtschaftlich in ihrer Existenz bedroht.<br />
Ein Rauchverbot ist somit kein geeignetes Mittel, um die Arbeitsbedingungen in<br />
der Gastronomie zu verbessern, sondern sorgt allenfalls für eine höhere<br />
Arbeitslosigkeit. Daher darf ein Rauchverbot auf keinen Fall beschlossen wer<strong>den</strong>.<br />
Die bei<strong>den</strong> Sichtweisen des Themas Rauchverbot sind völlig unterschiedlich. Die<br />
Wissenschaft spricht hier <strong>von</strong> zwei verschie<strong>den</strong>en Frames.<br />
Was ist ein Frame?<br />
Der Begriff des Frames wird nicht in einheitlicher Weise verwendet. Den meisten Definitionen<br />
ist jedoch der Gedanke gemeinsam, dass es sich dabei um eine Perspektive handelt, aus<br />
der ein bestimmtes Thema betrachtet wird. Der Frame bestimmt, welche Aspekte relevant<br />
sind und welche nicht. Damit reduziert er die Komplexität öffentlicher Kommunikation und<br />
eröffnet einen konsistenten Sinnhorizont, der dem Rezipienten Orientierung anbietet. Er geht<br />
also über Einzelaussagen oder ein bloßes Pro und Contra hinaus, sondern legt vielmehr eine<br />
bestimmte Interpretation einer Sachlage nahe. Anders ausgedrückt: “A frame is a central
organizing idea for news content that supplies a context and suggests what the issue is<br />
through the use of selection, emphasis, exclusion, and elaboration.” (Tankard et al. 1991: 11)<br />
Frames existieren sowohl als menschliche Kognition sowie auch als Merkmal eines Textes.<br />
Im ersten Fall bestimmt der Frame, welche Themenaspekte einer Person schneller einfallen<br />
und welche sie als wichtiger empfindet, stellenweise wer<strong>den</strong> Frames auch mit Schemata<br />
gleichgesetzt. Im zweiten Fall zeigen sie sich in sprachlichen, inhaltlichen oder strukturellen<br />
Merkmalen eines Textes, die alle gleichsam relevant sein können.<br />
Im oben skizzierten Beispiel zum Rauchverbot könnte man <strong>den</strong> ersten Frame – die<br />
Perspektive, die sich aus der Gesamtheit der genannten Aussagen ergibt – mit<br />
»gesundheitliche Schä<strong>den</strong>« bezeichnen. Er legt eine positive Bewertung und eine möglichst<br />
schnelle Umsetzung des Rauchverbotes nahe. Der zweite Frame – nennen wir ihn<br />
»wirtschaftliche Schä<strong>den</strong>« – empfiehlt eine <strong>von</strong> dem ersten Frame abweichende<br />
Herangehensweise an <strong>den</strong> Gesetzesentwurf, nämlich seine Abweisung. Dennoch sind beide<br />
Sichtweisen in gewissem Sinne zutreffend und auf Fakten gegründet. Somit ist es für die<br />
jeweiligen Parteien einer Debatte <strong>von</strong> hoher Relevanz, ihrer Deutung des Themas die<br />
höhere Aufmerksamkeit zu verschaffen und sie als verbindlich durchzusetzen. Damit treten<br />
sie in einen Wettstreit um die Deutungsmacht, bei dem es meist um die Mobilisierung <strong>von</strong><br />
Ressourcen und die Erhaltung oder Erweiterung <strong>von</strong> Handlungsspielräumen geht.<br />
Der praktische Nutzen des Framing-Ansatzes für das Issue Management<br />
Frames wer<strong>den</strong> in der Kommunikationswissenschaft und anderen Disziplinen in erster Linie<br />
als Phänomen und weniger als strategisches Instrument verstan<strong>den</strong>. Daher fin<strong>den</strong> sich in der<br />
Literatur auch nur selten praktisch umsetzbare Hinweise, sondern vielmehr Versuche, das<br />
Phänomen zu erfassen und zu verstehen. Jedoch spricht vieles dafür, dass sich<br />
gewinnbringende Handlungsempfehlungen aus diesen Erkenntnissen ableiten lassen – so<br />
eben auch für das Issue Management (vgl. Dahin<strong>den</strong> 2006: 216). Dies gilt insbesondere im<br />
Falle einer proaktiven Herangehensweise: Ist ein Issue im Sinne eines potenziell kritischen<br />
Themas einmal i<strong>den</strong>tifiziert, setzen sich viele Organisationen eigeninitiativ damit auseinander.<br />
Um ihre Interessen zu vertreten und ihre organisationsstrategischen Handlungsspielräume<br />
zu sichern, greifen sie offensiv in die Debatte ein. Ab diesem Punkt bietet der Framing-<br />
Ansatz mehrere Hilfestellungen: Zum einen eignet er sich, um die verschie<strong>den</strong>en<br />
Perspektiven, unter <strong>den</strong>en ein Thema öffentlich diskutiert wird, zu erfassen und zu<br />
systematisieren. Eine solche Analyse zeigt, wie sich die verschie<strong>den</strong>en Akteure in einer<br />
Kontroverse positionieren. Außerdem bietet der Ansatz Anhaltspunkte, aus welchen<br />
Bestandteilen Akteure eine eigene Sichtweise – einen eigenen Frame für ein Thema –<br />
entwickeln können und wie sie diese effektiv in einen Nachrichtenkontext integrieren.<br />
Schließlich stellt der Framing-Ansatz eine Methode zur Verfügung, mit der sich der Erfolg<br />
des Issue Managements evaluieren lässt.
Strategisches Framing<br />
Viele Personen und Organisationen entwerfen ohne Kenntnis des Framing-Ansatzes eigene<br />
Sichtweisen zu bestimmten Issues und kommunizieren diese strategisch. Ein bewusster<br />
Umgang mit dem Phänomen ist jedoch sicherlich gewinnbringender: Er ermöglicht ein<br />
erweitertes Verständnis des eigenen Handelns und stellt Entscheidungen auf eine<br />
wissenschaftliche, valide Basis.<br />
Ziel der strategischen Nutzung <strong>von</strong> Frames ist der so genannter Framing-Effekt, dessen<br />
genaue Wirkungsweise noch nicht vollständig erforscht ist. Die Grundidee lautet jedoch,<br />
dass eine Person, die mehrfach mit einem bestimmten Frame in Kontakt gerät, die durch ihn<br />
hervorgehobenen Aspekte als wichtiger empfindet und sich schneller an sie erinnert.<br />
Dementsprechend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Person diese und nicht<br />
andere Aspekte heranzieht, wenn sie sich ein Urteil bildet oder eine Entscheidung fällt. Auf<br />
einer übergeordneten Ebene kann dies also bedeuten: „Convincing others to accept one's<br />
framing means to a large extent winning the debate.” (Tankard 2001: 96)<br />
Der erste Schritt des strategischen Framings besteht darin, eine eigene Perspektive auf das<br />
betreffende Thema zu konstruieren. Auf der Grundlage der eigenen Ziele müssen die<br />
Akteure hierbei entschei<strong>den</strong>, welche Aspekte sie für richtig und wichtig erachten. Die hierbei<br />
festgelegten Punkte sollten sich nicht widersprechen oder in Konkurrenz zueinander stehen,<br />
da sich ansonsten kein kohärenter Sinnzusammenhang ergibt. Auf die Frage, welcher Art die<br />
Aspekte sein müssen, hat die Framing-Forschung viele Antworten. Beispielhaft genannt sei<br />
hier eine sehr populäre Framing-Definition <strong>von</strong> Robert M. Entman. Laut Entman sollten bei<br />
der Konstruktion eines Frames folgende Aspekte berücksichtigt wer<strong>den</strong>: Definition des<br />
Problems, Darstellung der Ursache, moralische Bewertung und Verhaltensempfehlung (vgl.<br />
Entman 1993: 52; H.i.O.). Entman beschreibt Frames in idealtypischer Weise – man kann<br />
nicht da<strong>von</strong> ausgehen, dass sie sich regelmäßig in derart klarer Einteilung in<br />
Medienangeboten fin<strong>den</strong> lassen. Als Konstruktionshilfe bietet sich seine Definition damit<br />
jedoch umso mehr an.<br />
Im zweiten Schritt kommunizieren die Akteure – die Frame-Sponsoren – das entwickelte<br />
Deutungsmuster. Eine Verbreitung über die Medien ist dabei der klassische Weg. Ob es<br />
gelingt, die eigene Sichtweise hier zu lancieren und als verbindlich durchzusetzen (»framing<br />
potency«), kann dabei u. a. <strong>von</strong> folgen<strong>den</strong> Faktoren abhängen:<br />
� Macht und Ressourcen des Frame-Sponsors: <strong>Sie</strong> bestimmen, welche Art des Zugangs zu<br />
<strong>den</strong> Medien besteht.<br />
� Professionalität: Je besser die Nachricht, in die der Frame integriert ist, journalistischen<br />
Standards entspricht, desto höher ist die Chance, dass sowohl die Nachricht als auch der<br />
Frame beachtet wer<strong>den</strong>. (Beispiel: Ist der Frame die Perspektive einer Interessengruppe
auf das Thema Abtreibung, so wird eine Stellungnahme der Interessengruppe zu einem<br />
neuen Gesetzentwurf umso eher veröffentlicht, je besser die Nachricht journalistisch<br />
aufbereitet ist.)<br />
� Grad der journalistischen Eigenaktivität: Journalistische Medien können ebenfalls zu<br />
einem Akteur einer Debatte wer<strong>den</strong> und versuchen, einen eigenen Blickwinkel<br />
einzubringen. Ergibt sich hier keine Entsprechung mit dem gesponserten Frame, wirkt<br />
sich dies evtl. nachteilig aus.<br />
� Kulturelle Faktoren: Der Grad, zu dem sich der gesponserte Frame in die entsprechende<br />
Gesellschaftskultur einfügt, mit gesellschaftlichen Werten harmoniert oder an bereits<br />
bestehende Deutungsmuster anknüpft, kann ebenfalls wesentlich seine Akzeptanz<br />
bestimmen.<br />
� Zeitpunkt der Aktion: Ist eine Debatte bereits durch eine Vielzahl anderer Sichtweisen<br />
gesättigt, haben neue Frames es ggf. schwer, Beachtung zu fin<strong>den</strong>.<br />
Methodik und Nutzen der Frame-Analyse<br />
Die Frame-Analyse ermöglicht die I<strong>den</strong>tifizierung <strong>von</strong> Deutungsmustern anhand <strong>von</strong><br />
Medienangeboten oder PR-Materialien. Damit kann sie im Rahmen des Issue Managements<br />
in zweierlei Hinsicht nützlich sein:<br />
1. Zur I<strong>den</strong>tifizierung <strong>von</strong> Verbündeten und Kontrahenten: Vermitteln zwei Organisationen in<br />
einer Debatte die gleiche Deutung eines Themas, verfolgen sie zumindest ähnliche Ziele.<br />
2. Zur Erfolgsevaluation <strong>von</strong> Framing-Bemühungen: Der Grad der Beachtung, der dem<br />
eigenen Frame in der öffentlichen Debatte zukommt, stellt einen aussagekräftigen<br />
Wirksamkeitsindikator der eigenen Anstrengungen oder der <strong>von</strong> Verbündeten dar.<br />
Frame Analysen wer<strong>den</strong> in großer Zahl durchgeführt, jedoch unterschei<strong>den</strong> sie sich oft<br />
grundlegend in der Operationalisierung des Phänomens sowie in ihrer Methodik. Für die<br />
Zwecke des Issue Managements erscheint es sinnvoll, einen Frame als ein wiederholt<br />
auftretendes Muster <strong>von</strong> Einzelaussagen – wie beispielsweise Problemdefinitionen,<br />
Kausalattributionen, Handlungsempfehlungen und Bewertungen – zu begreifen. Eine<br />
entsprechende Analyse kann wie folgt ablaufen:<br />
1. I<strong>den</strong>tifizierung aller relevanten Problemdefinitionen, Kausalattributionen,<br />
Handlungsempfehlungen und Bewertungen in der Debatte mittels einer strukturieren<strong>den</strong><br />
Inhaltsanalyse zweckmäßig ausgewählter Materialen, anschließend Verdichtung der<br />
i<strong>den</strong>tifizierten Aussagen zu Kernaussagen.<br />
2. Übertragung der Kernaussagen in das Codebuch einer quantitativen Inhaltsanalyse,<br />
anschließend erneute Codierung des Materials und Eingabe der Daten in eine<br />
Statistiksoftware.
3. I<strong>den</strong>tifizierung <strong>von</strong> wiederholt auftreten<strong>den</strong> Aussagemustern mittels Anwendung einer<br />
Faktor- oder Clusteranalyse – ebenso kommt die Analyse latenter Klassen in Betracht.<br />
4. Interpretation der Ergebnisse und Benennung der Deutungsmuster.<br />
Frame-Analysen bringen einen hohen Arbeitsaufwand mit sich und funktionieren keineswegs<br />
immer. Ein Beispiel: Enthalten viele der ausgewählten Analyseeinheiten durchmischte<br />
Frames, kommt die Untersuchung zu keinem sinnvollen Ergebnis.<br />
Weiterführende Literatur: Matthes (2007), Matthes/Kohring (2004), Pan und Kosicki (2001).<br />
Literatur<br />
Dahin<strong>den</strong>, U. (2006): Framing. Eine integrative Theorie der Massenkommunikation.<br />
Konstanz.<br />
Entman, R. M. (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In: Journal of<br />
Communication, 43. Jg., Nr. 4: 51-58.<br />
Matthes, J./M. Kohring (2004): Die empirische Erfassung <strong>von</strong> Medien-Frames. In: Medien &<br />
Kommunikationswissenschaft, 52. Jg., Nr. 1: 56-75.<br />
Matthes, J. (2007): Framing-Effekte. Zum Einfluss der Politikberichterstattung auf die<br />
Einstellungen der Rezipienten. München.<br />
Pan, Z./G. M. Kosicki (2001): Framing as a Strategic Action in Public Deliberation. In: Reese,<br />
Stephen D./Oscar H. Gandy/Auguste E. Grant (2001): Framing Public Life. Perspectives<br />
on Media and our Understanding of the So-cial World. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum<br />
Associates.<br />
Tankard, J. W. (2001): The Empirical Approach to the Study of Media Framing. In: Reese,<br />
Stephen D./Oscar H. Gandy/August E. Grant (2001): Framing Public Life. Perspectives on<br />
Media and Our Understanding of the Social World. Mahwah (NJ): 95-106.<br />
Tankard, J. W./L. Hendrickson/J. Silberman/K. Bliss/S. Ghanem (1991): Media frames:<br />
Approaches to conceptualization and measurement. Paper presented to the Association<br />
for Education in Journalism and Mass Communication. Boston.<br />
Zum Autor<br />
<strong>Matthias</strong> <strong>Potthoff</strong> studierte Kommunikationswissenschaft, Kultur,<br />
Kommunikation und Management sowie Englische Philologie an der<br />
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und an der Hawaii Pacific<br />
University Honolulu. Praxiserfahrungen sammelte <strong>Potthoff</strong> bei RTL, Pleon<br />
und der MediaCompany Berlin. Derzeit promoviert <strong>Potthoff</strong> zum Thema<br />
Framing.<br />
Kontakt: matt.pott@uni-muenster.de.