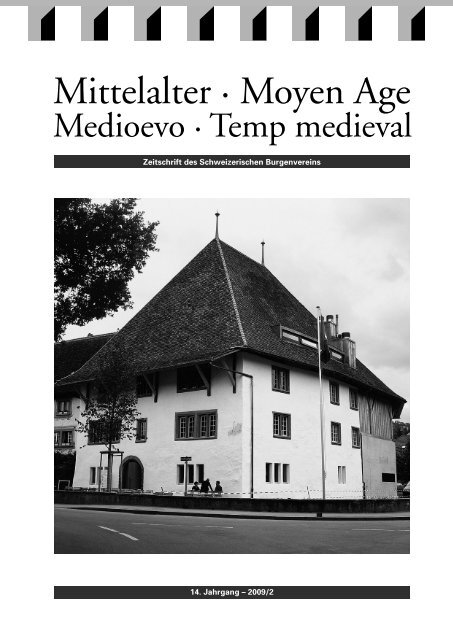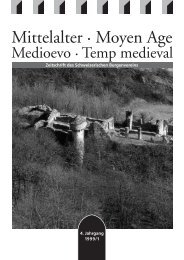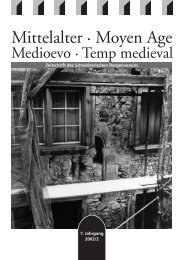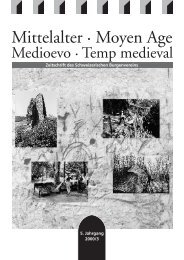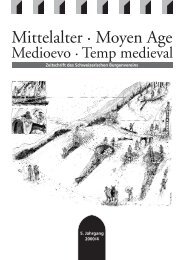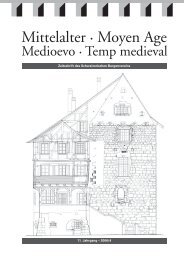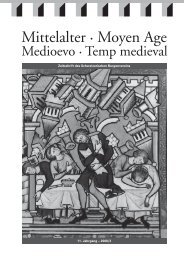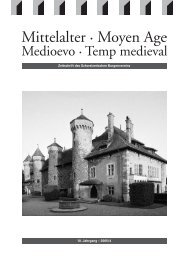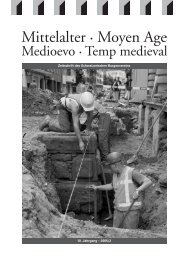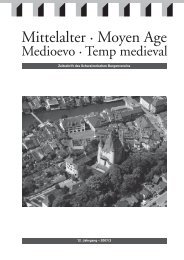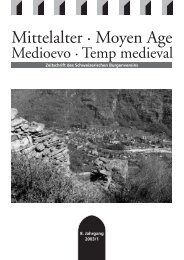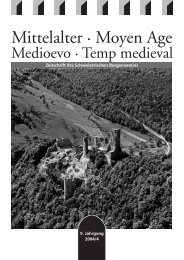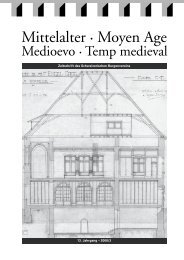Mittelalter 2009/2 - Schweizerischer Burgenverein
Mittelalter 2009/2 - Schweizerischer Burgenverein
Mittelalter 2009/2 - Schweizerischer Burgenverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeitschrift des Schweizerischen <strong>Burgenverein</strong>s<br />
14. Jahrgang – <strong>2009</strong>/2
Herausgeber/Editrice<br />
<strong>Schweizerischer</strong> <strong>Burgenverein</strong><br />
Geschäftsstelle Basel<br />
Blochmonterstrasse 22, 4054 Basel<br />
L’association suisse châteaux forts<br />
© <strong>2009</strong> <strong>Schweizerischer</strong> <strong>Burgenverein</strong><br />
Redaktionskommission<br />
Urs Clavadetscher, lic. phil.<br />
Archäologischer Dienst<br />
Graubünden<br />
Loëstrasse 26, 7001 Chur<br />
Dr. Elisabeth Crettaz<br />
Le Forum, 3961 Zinal VS<br />
Flurina Pescatore, lic. phil.<br />
Denkmalpflege<br />
Kanton Schaffhausen<br />
Beckenstube 11, 8200 Schaffhausen<br />
Redaktion und Geschäftsstelle<br />
<strong>Schweizerischer</strong> <strong>Burgenverein</strong><br />
Geschäftsstelle Basel<br />
Thomas Bitterli<br />
Blochmonterstrasse 22, 4054 Basel<br />
Telefon +41 (0)61 361 24 44<br />
Fax +41 (0)61 363 94 05<br />
Email: info@burgenverein.ch<br />
Homepage: www.burgenverein.ch<br />
Postkonto 40-23087-6<br />
Redaktionstermin /Delai de rédaction<br />
15.1. /15. 5./15. 8./1.11.<br />
Erscheinungsdatum/Parution<br />
31.3. /30. 6./30. 9./29. 12.<br />
Richtlinien zum Einreichen<br />
von Textbeiträgen sind einsehbar unter<br />
www.burgenverein.ch/Richtlinien<br />
Auflage/Tirage 1500<br />
Erscheint vierteljährlich /trimestriel<br />
ISSN 1420-6994 <strong>Mittelalter</strong> (Basel)<br />
Druck/Impression<br />
Schwabe AG, Basel<br />
Verlag und Druckerei<br />
Zeitschrift des Schweizerischen <strong>Burgenverein</strong>s<br />
Revue de l’Association Suisse Châteaux forts<br />
Rivista dell’Associazione Svizzera dei Castelli<br />
Revista da l’Associaziun Svizra da Chastels<br />
14. Jahrgang, <strong>2009</strong>/2, Juni <strong>2009</strong><br />
Inhalt / Sommaire<br />
33 Armand Baeriswyl / Jürg Schweizer,<br />
Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
42 Jürg Schweizer, Schlösser und Landsitze<br />
in der Landschaft Bern<br />
58 Kurzmitteilungen<br />
58 Veranstaltungen<br />
61 Publikationen<br />
62 Vereinsmitteilungen<br />
Die Schweizerische Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation<br />
im Schweizer Buch, der schweizerischen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten finden Sie in Helveticat, dem Katalog<br />
der Schweizerischen Nationalbibliothek, unter: www.nb.admin.ch/<br />
helveticat.<br />
Umschlagbild /Couverture: Die Eingangsfassade des restaurierten<br />
Grossen Höchhuses mit dem originalen Portal von 1526–30 und die<br />
Ostfassade mit dem neuen Ökonomietrakt. Der 1946 entstandene<br />
Neubauteil wurde 2006 abgebrochen und vollständig erneuert. Während<br />
innen modernste Gebäudeinfrastruktur liegt, entschloss man sich,<br />
die Ökonomiefassaden zu rekonstruieren, allerdings mit modernem<br />
Material.
Das Grosse Höchhus in Steffisburg –<br />
Die archäologische Untersuchung eines spätgotischen Patriziersitzes<br />
von Armand Baeriswyl<br />
Das alte Pfarrdorf Steffisburg erstreckt sich entlang der<br />
alten Landstrasse zwischen Thun und Bern bzw. Thun<br />
und Schwarzenegg, die dort die Zulg überquert. Die<br />
Baugruppe der beiden Steffisburger Höchhüser liegt<br />
am Ostrand und etwas abseits vom Dorf (Abb. 1). Sie<br />
besteht aus dem Grossen Höchhus, im heutigen Zustand<br />
ein freistehender, massiver spätgotischer Geviertbau unter<br />
einem mächtigen Vollwalmdach sowie dem unmittelbar<br />
danebenstehenden ähnlich massiven Kleinen Höchhus. 1<br />
(Abb. 2) Das Grosse Höchhus wurde 2006–08 umfassend<br />
saniert. Es zeigte sich dabei, dass sich hinter dem ein<br />
heitlichen Erscheinungsbild eine komplexe Baugeschich<br />
te verbirgt. Sanierungen bringen immer Veränderungen,<br />
1: Steffisburg auf der Dufour-Karte des 19. Jh. Links unten<br />
ist die Aare zu sehen, ganz unten das Westende der Altstadt<br />
von Thun. Bereits damals verlief die Landstrasse Bern –Thun<br />
bereits nicht mehr durch Steffisburg, sondern am Dorf<br />
vorbei längs der Aare. Eingekreist die Höchhus-Gruppe am<br />
Ostrand des Dorfes.<br />
2: Das Grosse Höchhus vor der Sanierung. Aufnahme 2006.<br />
Erneuerungen und Zerstörungen mit sich. Da sowohl im<br />
aufgehenden Mauerwerk wie im Boden ältere Bausub<br />
stanz und archäologische Reste zu erwarten waren, nah<br />
men die Archäologen und Bauforscher im Vorfeld und<br />
parallel zu den Arbeiten Untersuchungen vor.<br />
Im Folgenden sollen die wichtigsten Entwicklungsphasen<br />
des Höchhuses kurz nachgezeichnet werden. Dieser<br />
Bericht ist allerdings nur vorläufig, da die eigentliche<br />
archäologische Auswertung noch bevorsteht. 2 Sie muss –<br />
wie viele andere Auswertungen auch – einstweilen ver<br />
schoben werden, da der Archäologische Dienst mit Not<br />
und Rettungsgrabungen im Vorfeld von Baumassnahmen<br />
im ganzen Kanton mehr als ausgelastet ist.<br />
1 Literatur zu Steffisburg: Christian sChiffmann, Dorf und Land<br />
schaft Steffisburg im Laufe der Jahrhunderte (Bern 1917); hans<br />
Zeller, Steffisburg: Bilder aus der Geschichte von Dorf und Landschaft<br />
(Thun 1967).<br />
2 Vorbericht: armand Baeriswyl, Steffisburg, Grosses Höchhus. Bauuntersuchung<br />
und Grabung seit November 2006. In: Erziehungsdirektion<br />
des Kantons Bern (Hrsg.), Archäologie Bern. Jahrbuch<br />
des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern 2008 (Bern 2008)<br />
72–75.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2 33
Armand Baeriswyl –Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
Phasen I und II:<br />
Eine hochmittelalterliche Adelsburg<br />
Eine Steinreihe, zugehörige Pfostenlöcher und eine Schicht<br />
mit vielen Tierknochen sind als Reste eines Holzgebäudes<br />
zu interpretieren und wohl ins Hochmittelalter zu datie<br />
ren (Abb. 3).<br />
Die nächste Bauphase hat wesentlich bedeutendere<br />
Spuren hinterlassen: Rund 1,5 m starke Mauerreste im<br />
3: Die Steinreihe der ersten Bauphase: Reste eines Holzbaus.<br />
4: Mauerreste der nordseitigen Ringmauer der Phase II.<br />
34 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
unteren Teil der Nord, Ost und Südfassade des Höch<br />
huses bilden den Rest einer mehrteiligen Bauanlage<br />
(Abb. 4, 5). Diese erstreckte sich gegen Norden über<br />
die Grundfläche des heutigen Gebäudes hinaus auf das<br />
Areal des benachbarten Kleinen Höchhuses, wie ein 1989<br />
anlässlich einer Leitungserneuerung aufgedecktes Mauer<br />
stück beweist (Abb. 6). 3<br />
Rekonstruieren lässt sich ein von einer Ringmauer<br />
umschlossener Hof und zwei an die Mauer anstossende<br />
Steingebäude; ein grösseres, im Grundriss längsrecht<br />
eckiges im Norden, an der Stelle des heutigen Kleinen<br />
Höchhuses, und ein kleineres, im Grundriss quadrati<br />
sches, vielleicht turmartiges Gebäude in der Südostecke.<br />
Aufgrund des Mauercharakters sind diese Baureste wohl<br />
ins 13. Jh. zu datieren und aufgrund des Erscheinungs<br />
bildes als Adelsburg zu interpretieren: dicke Mauern,<br />
eine mehrteilige Struktur mit mindestens zwei Stein<br />
gebäuden – einem Palas und einem Turm? – und einer<br />
Umfassungsmauer.<br />
Aus den Schriftquellen bekannt ist, dass in diesem Areal<br />
im <strong>Mittelalter</strong> das Landgericht tagte und das Höchhus<br />
der Standort des Hochgerichtes war. Da im Hochmit<br />
telalter Burg und Hochgericht oft zusammengehörten,<br />
kann man annehmen, dass diese Burg das Zentrum der<br />
5: Die Südostecke der Anlage der Phase II nach Abbruch der<br />
Neubauten von 1946.
6: Grundriss der Höchhus-<br />
Gruppe. Ostseitig das Grosse<br />
Höchhus, westseitig das<br />
Kleine Höchhus. Die Zahl<br />
«1988» bezeichnet eine<br />
Sondage im Garten des Kleinen<br />
Höchhuses, bei der der<br />
ADB auf die – damals noch<br />
unverstandene – Ringmauer<br />
stiess. Unmittelbar westlich<br />
des Kleinen Höchhuses verläuft<br />
der Mühlebach, ein<br />
seit dem <strong>Mittelalter</strong> aus der<br />
Zulg abgeleiteter Gewerbekanal.<br />
In Dunkelgrau die<br />
Mauerreste der mutmasslichen<br />
Adelsburg der Phase II.<br />
mittelalterlichen Herrschaft Steffisburg bildete. 4 Mög<br />
licherweise handelt es sich bei dieser Burg um die bisher<br />
bei der Pfarrkirche gesuchte «Stevensburc» des gleich<br />
namigen Egolf, einem Ministerialen, der 1133 als Ange<br />
höriger des regionalen zähringischen Gefolges erscheint. 5<br />
Steffisburg war damals Teil der zähringischen Grafschaft<br />
Thun. Damit könnten die Holzbaureste der Phase I mög<br />
licherweise als Vorgänger der Steinburg des 13. Jh. inter<br />
pretiert werden.<br />
Phase III: Ein ländlicher Patriziersitz<br />
von stadtbernischen Aufsteigern<br />
Im Lauf des 14. Jh. dürfte diese Burg, die damals im<br />
Besitz der Herren von Kien war, schlecht unterhalten<br />
worden sein. Wohl aus diesem Grund kam es gemäss<br />
dendrochronologischen Untersuchungen um 1415, nach<br />
dem die Anlage durch Erbgang an die Bernburger Familie<br />
17<br />
9<br />
H ö c h h u s w e g<br />
12<br />
14A<br />
1988<br />
615150<br />
Armand Baeriswyl – Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
M ü h l e b a c h<br />
15<br />
17<br />
Matter gegangen war, zu einer umfassenden Erneuerung.<br />
Dabei wurde der Palas im Norden abgebrochen und der<br />
Südteil des Burghofes überbaut: Das Mauergeviert des<br />
heutigen Höchhuses entstand, allerdings noch mit ganz<br />
anderen Innenniveaus und wohl noch mit einem zweiten<br />
Obergeschoss aus Holz.<br />
2006<br />
Z e l g s t r a s s e<br />
Diese Umgestaltung spiegelt die sozialgeschichtlichen Ver<br />
änderungen, die sich im spätgotischen Bern abspielten:<br />
Die Matter sind eine typische Stadtberner Aufsteigerfami<br />
3 daniel GutsCher, Steffisburg, Höchhusweg 15. Mauerfund 1989<br />
In: daniel GutsCher/Peter J. suter (Hrsg.), Archäologie im Kanton<br />
Bern 3A (Bern 1994) 251–252.<br />
4 anne-marie duBler, Die Region ThunOberhofen auf ihrem<br />
Weg in den bernischen Staat (1384–1803). Berner Zeitschrift für<br />
Geschichte und Heimatkunde 66, 2004, 70 und 72.<br />
5 suse Baeriswyl, Siedlung und Herrschaft vor der Stadtgründung –<br />
Herrschaftsstrukturen. In: rainer C. sChwinGes (Hrsg.), Berns<br />
mutige Zeit, Das 13. und 14. Jahrhundert neu entdeckt. Berner<br />
Zeiten 1 (Bern 2003) 71.<br />
21<br />
17A<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
N<br />
180 750<br />
615 200<br />
35
Armand Baeriswyl –Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
lie dieser Zeit. Ursprünglich wohl einfache Gerber, waren<br />
sie durch Handel zu grossem Reichtum gekommen und<br />
erscheinen seit der Zeit um 1400 als Offiziere, Ratsherren<br />
und Schultheissen in Bern und Thun. Zusammen mit den<br />
Tschachtlan, von Ringoltingen und Diesbach gehörten sie<br />
im 15. Jh. zur burgerlichen Führungsschicht Berns. 6 Ihren<br />
Aufstieg suchten sie durch Einheirat in den alten Ministe<br />
rialadel zu sichern und durch den Kauf von Grundbesitz<br />
mit Herrschaftsrechten zu legitimieren. Dazu gehörte es,<br />
diese ererbten oder erworbenen Herrschaftssitze entspre<br />
chend auszubauen bzw. zu erneuern. 7<br />
Phase IV: Ein ländlicher Patriziersitz<br />
eines ländlichen Aufsteigers<br />
Ein zweiter umfassender Umbau lässt sich dendrochro<br />
nologisch auf die Zeit um 1526–30 datieren. Er liess das<br />
heutige Gebäude entstehen. Man kernte den Bau aus,<br />
verlegte neue Geschossbalkenlagen, führte das zwei<br />
te Obergeschoss neu in Stein auf und setzte das noch<br />
bestehende Dachwerk auf (Titelbild). Die Gliederung des<br />
Gebäudes konnte dank der Untersuchungen in wesent<br />
lichen Zügen rekonstruiert werden: Über dem nur mit<br />
schmalen Schlitzfenstern belichteten Sockelgeschoss, das<br />
als Lager, Stall, aber auch als Eingangsgeschoss diente,<br />
erhoben sich zwei Wohn bzw. Repräsentationsgeschosse.<br />
Sie zeichneten sich durch eine Untergliederung in je drei<br />
westseitige holzgetäferte Stuben aus (Abb. 7, 8), an die in<br />
jedem Geschoss ein mittig gelegener hallenartiger Bereich<br />
7: Die mit einer prachtvollen Fenstergruppe ausgestattete<br />
Stube im ersten Obergeschoss.<br />
36 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
8: Diese Stube im zweiten Obergeschoss besass noch ihre<br />
ursprüngliche Vertäferung.<br />
9: Die Nordfassade. Zwei (rekonstruierte) grosse Kreuzstockfenster<br />
markieren die Position des grossen Festsaals von<br />
1526–30. Links der neue Ökonomietrakt von 2007.<br />
anschloss. Dieser war zum einen Erschliessungszone mit<br />
einer hölzernen Wendeltreppe und diente zum zweiten<br />
als Küchenbereich. Von dieser Halle aus konnte man im<br />
ersten Obergeschoss einen sich über anderthalb Stock<br />
werke erstreckenden Festsaal im nordwestlichen Viertel<br />
betreten (Abb. 9), während sich im nordöstlichen Viertel<br />
die Ökonomie bzw. Scheunenräume befanden.<br />
Die Umbauten stehen im Zusammenhang mit dem in den<br />
Schriftquellen nachweisbaren Übergang des Hauses an
Peter Surer, den damaligen örtlichen Vertreter (Statthalter)<br />
Berns in Steffisburg. 8 Er übernahm es 1525 pachtweise<br />
von Elsbeth D’Affry, der Tochter Heinrich Matters. 9 1538<br />
konnte er es dann erwerben. Ebenfalls im Käuferkonsor<br />
tium war die Dorfgemeinde, der vor allem daran gelegen<br />
war, in den Besitz der zum Höchhus gehörigen Allmende<br />
und der Wasserrechte in der Zulg zu kommen.<br />
Dieser Umbau wirft wiederum ein Schlaglicht auf das<br />
Phänomen des sozialen Aufstiegs im Alten Bern. Nach<br />
dem die Adelsburg im frühen 15. Jh. von stadtbernischen<br />
Aufsteigern übernommen und ein erstes Mal stilgemäss<br />
erneuert worden war, kam nun die einheimische länd<br />
liche Oberschicht in Gestalt von Peter Surer in den Besitz<br />
des prestigeträchtigen Gebäudes, der es ebenfalls umge<br />
hend – noch bevor er es gekauft hatte – im Stil der Zeit<br />
ausbaute. 10<br />
Phase V: Vom Patriziersitz<br />
zum sozialen Wohnungsbau<br />
Mit dem Aussterben der Surer im späten 16. Jh. fiel<br />
das Höchhus an die Gemeinde. Sie hatte den ehemali<br />
gen Matterschen Besitz seinerzeit wegen der Allmende<br />
erworben und damit keinen Verwendungszweck für ein<br />
Gebäude mit einem derart patrizischen Zuschnitt. Man<br />
wusste sich aber zu helfen: Gemäss dendrochronologi<br />
schen Datierungen wurde das Gebäude im Jahr 1592<br />
durch den Einzug von Zwischenböden und den Anbau<br />
von mehreren Erschliessungslauben in ein Mehrparteien<br />
Wohnhaus umgebaut. Aufgrund des billigen Ausbaus<br />
ist anzunehmen, dass die Gemeinde Taglöhner, Hinter<br />
sassen und Arme im ehemaligen Patriziersitz unterbrach<br />
ten, man möchte beinahe von sozialem Wohnungsbau<br />
sprechen.<br />
In der ersten Hälfte des 19. Jh. richtete ein Töpfer seine<br />
Werkstatt mitsamt Brennofen im Sockelgeschoss des<br />
Höchhuses ein (Abb. 10). Zu den hergestellten Produkten<br />
gehören einerseits Blumentöpfe und andererseits vielfältig<br />
verziertes Kaffeegeschirr sowie Tonpfeifen. 11<br />
Phase VI: Das Restaurant des 20. Jh.<br />
1946 fand der nächste tiefgreifende Umbau statt, bei dem<br />
das südöstliche Viertel des Hauses mit dem Stall und<br />
Armand Baeriswyl – Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
10: Die Reste des Töpferofens konnten erhalten und mit<br />
einer Bodenvitrine sichtbar gemacht werden (Glas im Vordergrund).<br />
An der Wand ein stilisierter gemalter Querschnitt, der<br />
die Höhendimensionen des Ofens deutlich macht.<br />
Ökonomietrakt abgebrochen und in Backstein erneuert<br />
wurde. Für den Einbau eines Restaurants im Erdgeschoss<br />
wurden Kellerräume angelegt und pseudogotische Fenster<br />
durch das Mauerwerk des bis dahin weitgehend geschlos<br />
senen Sockels gebrochen.<br />
Phase VII: Die Stiftung und die Sanierung<br />
von 2006 bis 2008<br />
Eine von der Einwohnergemeinde, Burgergemeinde, Orts<br />
verein und dem Verein «HöchhusFreunde Steffisburg»<br />
gegründete Stiftung zum Zweck der Erhaltung des Höch<br />
huses erwarb 1979 das sanierungsbedürftige Gebäude. Es<br />
6 roland GerBer, Gott ist Burger zu Bern, Eine spätmittelalterliche<br />
Stadtgesellschaft zwischen Herrschaftsbildung und sozialem Ausgleich.<br />
Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 39 (Weimar<br />
2001) 267.<br />
7 JürG sChweiZer, Der bernische Schlossbau im 15. Jahrhundert.<br />
In: ellen J. Beer/norBerto GramaCCini/Charlotte GutsChersChmid<br />
(Hrsg.), Berns grosse Zeit, Das 15. Jahrhundert neu entdeckt.<br />
Berner Zeiten 2 (Bern 1999) 173–187. Nachdruck in: <strong>Mittelalter</strong>,<br />
Zeitschrift des Schweizerischen <strong>Burgenverein</strong>s 8 2003, H. 2,<br />
32–44.<br />
8 BarBara studer immenhauser, Verwaltung zwischen Innovation<br />
und Tradition. Die Stadt Bern und ihr Untertanengebiet 1250–1550.<br />
<strong>Mittelalter</strong>Forschungen 19 (Ostfildern 2006) 304–306.<br />
9 sChiffmann 1917 (wie Anm. 1) 269f.<br />
10 JürG sChweiZer, Schlösser und Landsitze. In: andré holenstein<br />
(Hrsg.), Berns mächtige Zeit. Das 16. und 17. Jahrhundert neu entdeckt.<br />
Berner Zeiten 3 (Bern 2006) 520–533. Nachdruck in diesem<br />
Heft.<br />
11 Baeriswyl 2008 (wie Anm. 2).<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
37
Armand Baeriswyl –Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
dauerte aber rund 25 Jahre, bevor die Sanierung möglich<br />
wurde.<br />
Die Sanierung zeichnet sich dadurch aus, dass zum einen<br />
erfolgreich versucht wurde, die erhaltene historische<br />
Bausubstanz zu restaurieren, teilweise zu rekonstruie<br />
ren, so der seit 1592 verbaute SurerSaal. Zum ande<br />
ren brachten die Bedürfnisse des modernen Wohnens<br />
und einer zeitgemässen Gastronomie Unterkellerungen,<br />
Durchbrüche, Zerstörungen und Veränderungen mit sich.<br />
Und dies, obwohl die kluge Entscheidung der Architek<br />
ten und Bauherrschaft, das 1946 erbaute nordöstliche<br />
Viertel des Gebäudes neu zu errichten und dort die<br />
Servicebedürfnisse zu konzentrieren (WCs, Küche, Hei<br />
zung etc.), viel Druck von der alten Bausubstanz nahm<br />
(Abb. 11). Heute beherbergt das Gebäude zum einen ein<br />
gutes Restaurant, zum anderen gibt es privat vermietete<br />
Büroräumlichkeiten. Ferner bestehen im ersten Ober<br />
geschoss und im Dachgeschoss Säle für Seminare, Ver<br />
sammlungen und andere Anlässe. 12<br />
Diese Sanierung, die dem Höchhus seine spätgotische<br />
patrizische Würde wiedergab, wird bei künftigen Archäo<br />
logen wohl als Bauphase VII in die Geschichte eingehen.<br />
Auch historische Gebäude unterliegen einem steten Wan<br />
del, eines ist aber entscheidend: Eine sorgfältige archäo<br />
logische Dokumentation und Untersuchung durch die<br />
11: Im Südostviertel des Höchhuses befand sich 1526 der<br />
Ökonomietrakt. Er bestand aus einem gemauerten Sockel<br />
mit grossem Tor, wo die Ställe und das Tenn lagen, und<br />
darüber ein hölzernes Scheunengeschoss. Hier der heutige,<br />
rekonstruierte Zustand seit 2007.<br />
38 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
Archäologen und Bauforscher, auf die eine ebenso sorg<br />
fältige Sanierung durch die Architekten und Denkmal<br />
pfleger folgt, ermöglichen es, dass ein heute rund 700jäh<br />
riger Bauzeuge, gleichsam wie eine ehrwürdige Urkunde<br />
oder ein altes Buch, weitere Jahrhunderte vom Leben und<br />
Streben unserer Vorfahren berichten kann.<br />
Bedeutung und Stellung des Höchhuses<br />
in der Architekturgeschichte<br />
von Jürg Schweizer<br />
Zum Namen<br />
Der First des Grossen Höchhuses erreicht eine Höhe von<br />
19 m. Damit erhob er sich bis ins 20. Jh. über alle ande<br />
ren Bauten in Steffisburg, auch über den First der Kirche<br />
(18 m). Einzig der Kirchturm übertraf das Grosse Höch<br />
hus, war aber eben kein Haus, sondern ein Turm. Die<br />
zwei Höchhüser überragten während Jahrhunderten das<br />
ländliche, locker gefügte Dorf Steffisburg, in dem kaum<br />
ein Haus mehr als ein Obergeschoss zählte und wo die<br />
Masse der Bauten aus Holz bestand: daher der Name<br />
Höchhus (Titelbild).<br />
Übrigens: Auch für heutige Verhältnisse ist ein Gebäude<br />
mit einer Höhe von 19 m ein hohes Haus. Eingeteilt in<br />
heutige Geschosshöhen ergäben sich etwa 7 Stockwerke;<br />
für das jetzige bernische Baugesetz sind Häuser mit mehr<br />
als 8 Stockwerken oder 30 m Gesamthöhe Hochhäuser.<br />
Phase III: Das Mauergeviert des Höchhuses<br />
Wie uns die archäologischen Untersuchungen zeigen,<br />
entstanden die Aussenmauern des Grossen Höchhuses<br />
um 1415, als die in Bern zu Reichtum und politischer<br />
Macht gelangte Familie Matter die heruntergekommene<br />
Burg von den verarmten Freiherren von Kien übernahm,<br />
weitgehend abbrach und das heutige Mauergeviert errich<br />
tete. Es entstand ein spätmittelalterlicher Palas, wie er<br />
etwa gleichzeitig auch im Schloss Burgistein durch eine<br />
rivalisierende Berner Familie errichtet worden war – auch<br />
dort in der Nachfolge adeliger Vorbesitzer. Der Typus des<br />
mehrgeschossigen quadratnahen Wohnbaus in geschlos-<br />
senem Volumen, eingeteilt in zahlreiche Räume, ent<br />
sprach der damaligen Vorstellung eines Herrenhauses.
So repräsentierte damals eine aufgestiegene, regierende<br />
Familie ihre politische und wirtschaftliche Macht. 13<br />
Phase IV: Das heutige Volumen<br />
Wir kennen das zweite Obergeschoss und das Dach<br />
des MatterBaus nicht, dürfen aber annehmen, dass der<br />
oberste Stock hölzern war und das Dach keineswegs die<br />
heutige Höhe hatte. Der Gesamtumbau unter Gerichts<br />
statthalter Peter Surer um 1530 folgte den im Laufe des<br />
15. und frühen 16. Jh. neu entwickelten Vorstellungen<br />
des herrschaftlichen Bauens: das enorme Dachvolumen!<br />
(Abb. 9, 11). In vielen Herrschaftsbauten aus dieser Zeit –<br />
so etwa Worb, Münsingen, Holligen oder Ralligen – kön<br />
nen wir die Aufrichtung gewaltiger Dachstühle verfolgen,<br />
die die Höhe der Fassaden erreichten oder wie in Stef<br />
fisburg diese sogar übertrafen. Das übliche Verhältnis<br />
Fassadenhöhe zu Dachhöhe betrug nun 1:1. Diese Dächer<br />
waren keineswegs Lagervolumen wie bei den Bauern<br />
häusern, sondern Hauptträger der Repräsentation und<br />
werden auf die Zeitgenossen, die in niedrigen Häusern<br />
wohnten, einen gewaltigen Eindruck gemacht haben. 14<br />
Auch uns Heutige beeindruckt das riesige Dach, obwohl<br />
wir längst an grosse Bauvolumen gewöhnt sind.<br />
Der Kombibau<br />
Eine Sonderleistung des SurerUmbaus ist die Kombina-<br />
tion unterschiedlicher Nutzungen in einem geschlosse<br />
nen Volumen und unter einem Dach: Keller, Wohnräume<br />
(Abb. 12), Schlafkammern, Küchen enthält fast jedes<br />
Haus, hier kamen aber ein überhoher repräsentativer<br />
Saal (Abb. 13) und ein mehrgeschossiger Ökonomiebau<br />
12. Eine Täferstube im zweiten Obergeschoss.<br />
Armand Baeriswyl – Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
13: Das Innere des grossen Festsaals. Die Details sind aufgrund<br />
von archäologischen Befunden rekonstruiert worden.<br />
dazu (Abb. 11). Es gelang, all diese auch im Äusseren<br />
sehr unterschiedlich in Erscheinung tretenden Bauteile<br />
zu kombinieren und zusammenzufassen, eine sehr bemer<br />
kenswerte Leistung.<br />
Die Höchhus-Gruppe<br />
Gerade im Aaretal kennen wir aus dem 16. Jh. die Ten<br />
denz, zwei architektonisch unabhängige Herrschafts<br />
bauten in unmittelbarer Nachbarschaft zu erbauen, also<br />
eine Schlösserfamilie zu errichten, so z.B. in Münsingen<br />
und in Belp. Die Gesamtwirkung dieser Baugruppen war<br />
natürlich grösser als jene zweier verstreuter Einzelbauten.<br />
Obwohl wir die Baugeschichte des Kleinen Höchhuses<br />
nicht gut kennen, können wir doch sagen, dass die so ein<br />
prägsame Baugruppe, wie wir sie heute vor uns haben, seit<br />
dem mittleren 16. Jh. besteht und als einzige dieser Schlös-<br />
sergruppen im Zustand des 16. Jh. erhalten geblieben ist.<br />
Phase V: Der soziale Abstieg<br />
Wir wissen, dass um 1600 der Abstieg zum Mehrfami<br />
lienhaus einsetzte, wobei die Ansprüche im Laufe der<br />
Zeit immer bescheidener und die Umbauten immer<br />
behelfsmässiger wurden. War das ein Unglück? Nein,<br />
denn durch den Sozialabstieg wurde das Haus während<br />
350 Jahren bis zum Umbau 1946 vor schweren Eingriffen<br />
bewahrt und ist uns damit weitgehend im Zustand des<br />
12 Stiftung Höchhus Steffisburg, c/o Recher Anton, Präsident, Oberdorfstrasse<br />
21 a, 3612 Steffisburg. Zum Restaurant: www.höchhus.ch<br />
13 Schweizer 2003 (wie Anm. 7).<br />
14 Schweizer 2006 (wie Anm. 10).<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
39
Armand Baeriswyl –Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
16. Jh. erhalten geblieben. Wäre das Haus im 18. Jh. noch<br />
in der Hand einer patrizischen Familie Berns gewesen,<br />
so stünde hier heute ein dem damaligen Zeitgeist ent<br />
sprechendes Gebäude wie beim Landsitz Ortbühl oder<br />
Eichberg. Es ist die Gunst der Geschichte, die uns die<br />
einmalige Gruppe der Hochhüser mit ihrer so sprechen<br />
den Geschichte erhalten hat.<br />
Die jetzige Bauphase<br />
Zu dieser Geschichte hat die Stiftung mit allen Beteiligten –<br />
Architekten, Archäologen, Denkmalpflegern und Unter<br />
nehmern – nun eine weitere, wichtige Seite hinzugefügt,<br />
ist doch seit dem SurerUmbau um 1530 das Haus nie<br />
mehr nach einem Gesamtkonzept umgebaut worden.<br />
Der Bau hat dabei mit Überraschungen nicht gespart<br />
und allen Beteiligten erhebliche geistige Beweglichkeit<br />
und eine gehörige Portion Phantasie und Einfühlungs<br />
vermögen abverlangt. Sie wurden erbracht, erforderten<br />
intensive Gespräche und tragen nun ganz entscheidend<br />
zum erfreulichen Resultat bei.<br />
595.00<br />
590.00<br />
585.00<br />
müM<br />
283<br />
273<br />
167<br />
154<br />
298<br />
176<br />
40 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
Résumé<br />
L’ensemble de bâtiments «Grosses Höchhus» et «Kleines Höchhus»<br />
se trouve en bordure est du village de Steffisburg, à l’écart<br />
de l’église. Ces deux bâtisses doivent leurs noms au fait qu’elles<br />
étaient, au 16 e s., plus élevées que l’église. Le «Grosse Höchhus»<br />
a été entièrement rénové et soumis à un examen archéologique<br />
entre 2006 et 2008.<br />
On retrouve des vestiges du bâtiment fondateur datant du Haut<br />
Moyenâge, un château noble, dans le sol et la maçonnerie du<br />
bâtiment actuel. En 1415(d), un nouveau bâtiment a été érigé<br />
au niveau de la partie sudest du château délabré. Il s’agissait<br />
d’un bâtiment d’habitation de deux étages, pratiquement carré,<br />
une forme de construction typique, par laquelle les familles dirigeantes<br />
bernoises en pleine ascension démontraient leur pouvoir<br />
politique et économique.<br />
Une seconde transformation globale peut, grâce aux examens<br />
dendrochronologiques, être attribuée aux alentours des années<br />
1526–30. Le gouverneur bernois, Peter Surer, un campagnard<br />
qui avait su grimper les échelons de la société, a fait construire<br />
le bâtiment actuel, composé de trois étages coiffés d’un toit en<br />
croupe. De tels toits imposants ont souvent été construits au 16 e s.,<br />
sans pour autant servir de surface de stockage comme dans les<br />
fermes. Ils avaient principalement une fonction représentative<br />
et faisaient sans doute forte impression sur les contemporains<br />
qui vivaient dans des maisons plus basses.<br />
Avec la disparition des propriétaires à la fin du 16 e s., le Höchhus<br />
est passé aux mains de la commune. Celleci ne savait trop<br />
25 20 15 10<br />
85 96<br />
126<br />
14: Der Phasenplan der Südfassade:<br />
14 35<br />
299<br />
14<br />
168<br />
Dunkelgrau: Die Burganlage der Phase II (13. Jh.)<br />
Mittelgrau: Das Höchhus der Phase IV (1526–30)<br />
154<br />
169<br />
284 312 223 172<br />
127<br />
273<br />
311<br />
280<br />
14<br />
14<br />
306<br />
176<br />
14<br />
273<br />
176<br />
300<br />
Hellgrau: Umbauten und Eingriffe des 20. Jh. (vorwiegend 1946)<br />
Weiss: kleinere Umbauten aus verschiedenen Epochen
à quelle utilisation vouer un bâtiment possédant une coupe aussi<br />
aristocratique. Mais on était ingénieux: en 1592(d) le bâtiment<br />
a été transformé en maison d’habitation pour plusieurs familles,<br />
grâce àl’aménagement d’étages intermédiaires et àlaconstruction<br />
de plusieurs arcades d’accès. On y logea des personnes touchant<br />
une solde et des pauvres –lamaison aristocratique se transforma<br />
en lieu d’asile.<br />
Le Grosse Höchhus a subsisté ainsi jusqu’en 1946, date à laquelle<br />
un restaurant a été aménagé au rezdechaussée. La dernière<br />
rénovation effectuée entre 2006–2008 a redonné à cette<br />
bâtisse sa noblesse patricienne de la fin de l’époque gothique.<br />
(Sandrine Wasem, Thun)<br />
Riassunto<br />
Sul lato orientale del paese di Steffisburg, lontano dalla chiesa,<br />
sorge il complesso edilizio chiamato «Grosses Höchhus» e<br />
«Kleines Höchhus». Queste denominazioni risalgono al XVI sec.,<br />
e furono attribuite a questi edifici per la loro altezza, che era<br />
maggiore rispetto a quella della chiesa. Il «Grosse Höchhus» è<br />
stato restaurato completamente e sottoposto ad una dettagliata<br />
indagine archeologica nel 2006–2008.<br />
Di una costruzione più antica, un castello medievale, si conservano<br />
alcuni resti sia nel sottosuolo come anche nell’apparato<br />
murario dell’edificio attuale. Nel 1415(d) sorse a sudest del<br />
castello in rovina una costruzione nuova. Questo edificio a due<br />
piani e a pianta quadrata, che presenta una forma tipica, è stato<br />
eretto da famiglie benestanti della città di Berna, per mettere in<br />
risalto il loro potere politico ed economico.<br />
Una seconda importante ristrutturazione dell’edificio (datazione<br />
dendrocronologica) risale al 1526–30: Il governatore della<br />
città di Berna Peter Surer, venuto dalla campagna per fare<br />
carriera, fece erigere l’edificio attuale suddiviso in tre piani.<br />
La costruzione in questione è caratterizzata da un alto tetto a<br />
padiglione. Questa forma del tetto era abbastanza diffusa nel<br />
XVI sec. Il sottotetto non fungeva da magazzino come era usuale<br />
nelle costruzioni rurali, bensì metteva in evidenza lo stato<br />
sociale di una famiglia benestante. Sulla popolazione rurale,<br />
che aquel tempo soleva vivere in abitazioni piuttòsto modeste,<br />
un edificio di tali proporzioni doveva sicuramente fare una notevole<br />
impressione.<br />
Nel tardo XVI sec. dopo la morte dei proprietari, il Höchhus<br />
passò al comune. Il comune tuttavia non riuscì a trovare un<br />
uso adeguato per un edificio caratterizzato da elementi architettonici<br />
così particolari. Tuttavia in seguito una soluzione fu<br />
trovata. Nel 1592(d) oltre all’inserimento di nuovi piani, furono<br />
aggiunte anche alcune balconate di passaggio che garantivano<br />
un collegamento tra i vari locali dell’edificio. Questi interventi<br />
trasformarono il Höchhus in un tipo di abitazione plurifamiliare,<br />
nella quale alloggiavano braccianti e persone non abbienti.<br />
Il Höchhus assunse così la funzione di ospizio per i poveri.<br />
Fino al 1946 il «Grosse Höchhus» non subì ulteriori trasformazioni.<br />
In quell’anno il pianterreno fu adibito aristorante. Grazie<br />
agli interventi più recenti (2006–2008) il Höchhus èstato riportato<br />
agli antichi splendori, e oggi si presenta nuovamente come<br />
una casa patriziale tardogotica.<br />
Christian Saladin (Basilea/Origlio)<br />
Armand Baeriswyl – Das Grosse Höchhus in Steffisburg<br />
Resumaziun<br />
A l’ur da l’ost da la vischnanca Steffisburg, lunsch davent da<br />
la baselgia, sa chatta la gruppa d’edifizis «Grosses Höchhus»<br />
e «Kleines Höchhus». Quest num han ils dus edifizis survegnì,<br />
perquai ch’els eran en il 16avel tschientaner pli auts che la baselgia.<br />
Il «Grosse Höchhus» è vegnì sanà a moda cumplessiva<br />
ils onns 2006 fin 2008 ed è cun quella occasiun vegnì perscrutà<br />
archeologicamain.<br />
Da la construcziun oriunda, erigida en il temp medieval tardiv,<br />
èn mantegnids fragments en il terrain ed en ils mirs da l’edifizi<br />
dad oz. Il 1415(d) è vegnida construida en la part dal sidost dal<br />
chastè en ruina ina chasa da dus plauns en furma quadratica.<br />
Cun questa furma da construcziun tipica per las famiglias arrivisticas<br />
che regnavan la citad Berna, mussavan ellas lur pussanza<br />
politica ed economica.<br />
Ina segunda transfurmaziun cumplessiva sa lascha datar cun<br />
la metoda dendrocronologica al temp dal 1526 fin il 1530: Il<br />
stattalter bernais Peter Surer, in arrivist da la champagna, ha<br />
construì l’edifizi dad oz cun trais plauns e cun in tetg a quatter<br />
alas fitg aut. Da quests tetgs colossals èn vegnids erigids savens<br />
en il 16avel tschientaner. Lur intent n’era però betg da servir<br />
sco volumen da magasin, analog a las grondas chasas da purs,<br />
ma da represchentar il status social da las famiglias bainstantas.<br />
Probablamain han quels tetgs fatg gronda impressiun als<br />
contemporans che vivevan en chasas modestas.<br />
Cun la mort da la famiglia proprietaria en il 16avel tschientaner<br />
tardiv è il «Höchhus» pervegnì a la vischnanca. Ella n’ha<br />
betg chattà ina moda adequata per utilisar quest edifizi cun<br />
ina structura talmain patriziana. Ins ha dentant gì in’idea: il<br />
1592(d) è l’edifizi vegnì transfurmà en ina chasa d’abitar per<br />
pliras partidas cun bajegiar en ulteriurs palantschieus e pliras<br />
lautgas d’access. En quella chasa han chattà alloschi schurnaliers<br />
e povers; la chasa patriziana è daventada in asil.<br />
En quest stadi ha il «Grosse Höchhus» survivì fin l’onn 1946,<br />
cura ch’ins ha integrà in restaurant en il plaunterren. La sanaziun<br />
la pli recenta dal 2006 fin il 2008 ha restituì al Höchhus<br />
sia dignitad patriziana da la gotica tardiva.<br />
(Lia rumantscha, Cuira/Chur)<br />
Abbildungsnachweis:<br />
Alle Abbildungen Archäologischer Dienst des Kantons Bern (Eliane<br />
Schranz, Katharina Ruckstuhl, Heinz Kellenberger, Katrin Glauser).<br />
Adresse der Autoren:<br />
Dr. Armand Baeriswyl<br />
Archäologischer Dienst des Kantons Bern<br />
Leiter Stadt, Kirchen und Burgenarchäologie<br />
Brünnenstrasse 66, Postfach 5233<br />
CH3001 Bern<br />
Dr. Jürg Schweizer<br />
Kantonale Denkmalpflege Bern<br />
Münstergasse 32<br />
CH3011 Bern<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
41
Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
von Jürg Schweizer<br />
Im 15. und 16. Jh. wechselte eine erhebliche Zahl von<br />
kleineren Twingherrschaften, von Land und Rebgütern<br />
die Besitzer, gelangte von Ministerialadeligen an stadtber<br />
nische Familien, von altadeligen Bernerfamilien an neu<br />
aufgestiegene Sippen. Dabei profitierten diese von ihrer<br />
besseren wirtschaftlichen Situation, von der Kraft der<br />
aufstrebenden Stadt und von der von ihr ausgehenden<br />
Aufbruch und Aufbaustimmung. 1<br />
Die Reformation verwandelte die grossen Landklöster in<br />
Landvogteien, die den geistlichen Besitz an Ländereien<br />
und Rechten nach Reorganisationsschritten und Kodifi<br />
zierung verwalteten. 2 Überflüssiges wurde abgestossen,<br />
kleinere geistliche Herrschaften wurden verkauft, doch<br />
konnten auffallenderweise die Stadtbürger von der güns<br />
tigen Situation nur bedingt profitieren – offensichtlich<br />
fehlte gerade in der Reformationszeit oft das nötige Geld.<br />
Wohl ebenso wichtig war jedoch, dass sich die stadtber<br />
nische Burgerschaft zunehmend von Handel und Gewer<br />
be abwandte und umso stärker von den Vorteilen der<br />
Landwirtschaft als dem wahren Ursprung des Wohlstands<br />
überzeugt war.<br />
Für die burgerlichen Familien war neben diesem Interesse<br />
am Primärsektor der Staatsdienst Lebensinhalt, Erfül<br />
lung, und für jene, die es schafften, Quelle erheblicher<br />
Einkünfte, ja Reichtümer. Es zeigt sich dies etwa in der<br />
nicht seltenen Situation, dass Landvögte auf Ende ihrer<br />
sechsjährigen Amtszeit zum Erwerb von Grundherrschaf<br />
ten schritten, Neubauten von Stadthäusern ausführten<br />
oder Landsitze errichteten. Schliesslich waren der fremde<br />
Solddienst und die damit verbundenen Einkünfte eine<br />
der Einnahmequellen des neuen städtischen Bürgertums.<br />
Auch Rebbesitz galt bis ans Ende des 18. Jh. als gute<br />
Kapitalanlage, entsprechend begehrt und geschätzt waren<br />
die Rebgüter, vorweg an den Seen.<br />
Der Herrschaftsbau im 16. Jh.<br />
fasst den Aussenraum<br />
Im ersten und zweiten Drittel des 16. Jh. wurden meh<br />
rere Herrschaftsschlösser um und zeitgemäss ausgebaut.<br />
42 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
1: Toffen, Schloss von Südosten (Ausschnitt),<br />
Albrecht Kauw (1616–1681), 1667.<br />
Dabei fällt auf, dass das alte Schema der ummauerten<br />
Anlage – der Topografie folgender Ringmauerzug, Wohn<br />
und Wehrbauten in Ecklage oder frei ins Zentrum gestellt,<br />
Nebenbauten mehr zufällig als Anbau an bestehende<br />
Mauern gelehnt – räumlich geordnet und neu formuliert<br />
wird.<br />
Das mittelalterliche Schloss Toffen wurde wohl im ersten<br />
Drittel des 16. Jh. unter seinem neuen Besitzer, Bartho
lomäus May, auch sonst ein grosser Bauherr, tiefgreifend<br />
umgebaut. 3 Seine Gestalt vor den Veränderungen des<br />
späten 17. und 18. Jh. ist uns durch mehrere Veduten<br />
von Albrecht Kauw überliefert (Abb. 1). Der vermutlich<br />
ältere viergeschossige Wohnturm mit einem bloss raum<br />
tiefen Westflügel wurde so von einem sauberen Rechteck<br />
aus gezinnten Mauern eingefasst, dass ein quadratnaher<br />
repräsentativer Zugangshof entstand. Die Hofecken wur<br />
den von zwei Pavillons und die Eingangsmauer von einem<br />
Uhrtürmchen überhöht. 4 In ähnlichem Geist erfolgte der<br />
Umbau des privaten Herrschaftsschlosses in Schlosswil<br />
nach dem Grossbrand 1546: Dem an den alten Turm<br />
angeschlossenen und damals neu aufgeführten Wohntrakt<br />
wurde ein geräumiger, quadratnaher, von zwei Ecktürm<br />
chen gesäumter Empfangshof vorgelegt. 5 Der Besucher<br />
wird jedoch nicht nur aussen von einem klar definierten<br />
Hof empfangen, sondern gelangt – nach Durchschreiten<br />
einer gewölbten Eingangshalle – zum von offenen Pfeiler<br />
arkaden gesäumten quadratnahen Innenhof (Abb. 2). 6<br />
Bauherr war der ehemalige Münsterprobst Nicolaus von<br />
Wattenwyl (1492–1551), der mit der Enkelin des Bau<br />
herrn von Toffen, mit Clara May, verheiratet war.<br />
Nicht mit dieser Rigidität, jedoch mit verwandter Absicht<br />
formulierte sein Bruder, Schultheiss Hans Jakob von Wat<br />
tenwyl, ab 1537 das von ihm erworbene Kloster Mün<br />
chenwiler zum Herrschaftsschloss um und passte es den<br />
neuen räumlichen Vorstellungen an. 7 Einen geschlosse<br />
nen Hof, eingefasst von einraumtiefen Flügeln und einer<br />
Gruppe von Rundtürmen, schuf er auch in seinem ande<br />
ren Schloss, in Colombier, das ihm seine Frau Rose de<br />
Chauvirey eingebracht hatte. 8<br />
2: Schlosswil, Arkadenhof, erbaut nach dem Grossbrand 1546.<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
Quadratnahe, sauber rechteckige Zugangshöfe, Doppel<br />
hofsysteme und Ecktürme sind alles Elemente, die die<br />
französische Schlossarchitektur des späten 15. und frü<br />
hen 16. Jh., namentlich in der LoireGegend, entwickelt<br />
hatte. 9 Vergleicht man diese Anlagen mit unseren Schlös<br />
sern, so erhellt sich schlagartig die bürgerliche, geradezu<br />
demokratisch anmutende Bescheidenheit der bernischen<br />
Beispiele.<br />
Wiesehr dem Zeitalter die räumliche Fassung des Schloss<br />
zugangs ein Anliegen war, zeigt die Umgestaltung des<br />
Schlosses Burgistein (Abb. 3), ausgeführt durch Rein<br />
hard von Wattenwyl (†1549), Bruder der Bauherren von<br />
Schlosswil, Münchenwiler und Colombier, verheiratet<br />
mit Elisabeth de Chauvirey, der Schwester der Rose, und<br />
durch deren Sohn Bernhard (1538–1581). Reinhard baute<br />
den wohl aus dem 15. Jh. stammenden repräsentativen<br />
Westtrakt um und erschloss ihn neu mittels Wendelstein<br />
(um 1535). Bernhard errichtete oder erneuerte den beschei<br />
deneren Ostbau und schuf um 1567 einen Verbindungs<br />
trakt. Ziel dieser Unternehmung war einmal, die beiden<br />
Trakte auf zwei Niveaus miteinander zu verbinden. Dabei<br />
1 Sonderdruck aus JürG sChweiZer, Schlösser und Landsitze. In:<br />
andré holenstein (Hrsg.) Berns mächtige Zeit. Berner Zeiten 3<br />
(Bern 2006) 520–533.<br />
2 Vgl. JürG sChweiZer, Säkularisation. In: holenstein 2006 (wie<br />
Anm. 1) 173.<br />
3 Vgl. ellen J. Beer (Hrsg.) Berns grosse Zeit, Das 15. Jahrhundert<br />
neu entdeckt (Bern 1999) 163.<br />
4<br />
GeorGes herZoG, Albrecht Kauw (1616–1681). Der Berner Maler<br />
aus Strassburg. Schriften der Burgerblibliothek Bern (Bern 1999)<br />
Kat. Nr. 97, 98, 139, 144, 145. Kauws Darstellung um 1670 gibt den<br />
um 1630 erneut umgebauten Zustand wieder; wohl damals wurden<br />
die Zinnen west und südseits zugemauert und die Eckpavillons mit<br />
geschweiften Hauben erneuert.<br />
5 Das eine Türmchen ist erhalten, das andere nachweisbar; auch dazu<br />
gibt es eine Vedute von Kauw; vgl. herZoG 1999 (wie Anm. 4)<br />
Kat. 93.<br />
6 Weitere Beispiele in der Waadt, z. B. Denens.<br />
7 So Münchenwiler nach 1535. Peter eGGenBerGer/martin Bossert/<br />
GaBriele KeCK/JürG sChweiZer, Schloss Münchenwiler – ehemaliges<br />
CluniazenserPriorat (Bern 2000).<br />
8<br />
Jean Courvoisier, Les monuments d’art et d’histoire du Canton de<br />
Neuchâtel 2 (Bâle 1963) 286–308.<br />
9 Zu nennen Le PlessisBourré und le Verger; vgl. alain erlande-<br />
BrandenBurG/anne-BénédiCte mérel-BrandenBurG, Du Moyen<br />
Age à la Renaissance. Histoire de l’Architecture Française 1 (Paris<br />
1995) 418 f.; Jean-marie Pérouse de montClos, De la Renaissance<br />
à la Révolution. Histoire de l’Architecture Française 2 (Paris<br />
2003) Abb. 22.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
43
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
3: Burgistein, Schloss, Flugbild von Südosten.<br />
4: Burgistein, Schloss, Wandelhalle im Verbindungstrakt, im<br />
Hintergrund das von der Halle abgeschnittene Esszimmer, im<br />
linken Bildteil ist die dekorierte Rahmung des Erkergemachs<br />
zu sehen, datiert 1575. Heutige Farbfassung um 1900.<br />
stand nicht bloss Bequemlichkeit im Vordergrund, sondern<br />
durchaus moderner Repräsentationswille, löste doch die<br />
horizontale Raumfolge die im <strong>Mittelalter</strong> übliche vertika<br />
le Raumschichtung ab: In Burgistein entstand eine gross<br />
dimensionierte Wandelhalle (das Speisezimmer wurde<br />
davon erst im späten 18. Jh. abgetrennt), gleichzeitig Auf<br />
enthaltsraum und Durchgangsraum zum damals angeleg<br />
ten und um 1600 mit der heutigen Decke bereicherten Fest<br />
saal (Abb. 4). Im französischen und englischen Schlossbau<br />
des 16. Jh. taucht die beidseits belichtete Galerie, zweifellos<br />
Vorbild für die Halle in Burgistein, als eigener Repräsenta<br />
tionsraum auf und eröffnet damit die glorreiche Zukunft<br />
44 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
5: Burgistein, Schloss, Schlosshof mit Rundbogenloggia und<br />
Polygonalerker, datiert 1573.<br />
dieses im 17. und 18. Jh. unentbehrlichen Statussymbols<br />
fürstlicher Schlösser. Der überreich dekorierte Erker ist<br />
ein Muster der manieristischen Renaissance, die Rund<br />
bogenloggia stellt ein Novum in der bernischen Architek<br />
tur dar (Abb. 5). Sie hat sich im Flügel an der Schmalseite<br />
des Westbaus weitgehend verselbständigt. Die Architek<br />
tursprache hat sich hier, wie sonst nur sehr selten, fast<br />
vollständig von der übermächtigen Spätgotik gelöst.<br />
Erstmals formulierte man um 1550/75 hier auch den<br />
Typus des dreiseitig geschlossenen, gegen Süden offenen<br />
Hofes – eine architektonische Empfangsgeste.<br />
Es ist das 16. Jh., das die eigene Qualität des gefassten<br />
Freiraums als ebenso wichtiges Gegenstück zum geschlos<br />
senen Volumen entdeckt und zelebriert: Hohl und voll<br />
sind gleichwertige Partner in der Architektur gewor<br />
den, dafür sind Münchenwiler und Burgistein wichtige<br />
Marchsteine. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der
Bauherrschaft sind wohl Zeichen einer gewissen Ideal<br />
konkurrenz.<br />
Neuinterpretation alter Herrschaftsschlösser<br />
Um 1550 modernisiert Hans Franz Nägeli die beiden mit<br />
telalterlichen Schlösser Münsingen und Bremgarten. 10 In<br />
beiden Fällen werden Teile der Burg miteinbezogen, und<br />
es entstehen als Grundelement langgestreckte donjon<br />
artige Wohnkomplexe. Jener in Münsingen ist grössten<br />
teils erhalten; Hauptmerkmal ist die Überbauung der<br />
Osthälfte des ehemaligen Schlosshofs unter Einbezug<br />
der Ringmauer und der Gliederung dieses Massivs durch<br />
den kräftigen Westrisalit, der auch den Wendelstein ein<br />
schliesst. In beiden Fällen wurden riesige Walmdächer<br />
aufgerichtet.<br />
In Oberdiessbach erbauten Niklaus von Diesbach und<br />
seine Gemahlin Elisabeth von Erlach um 1566/69 das<br />
sogenannte Alte Schloss, das zwischen 1640 und 1669<br />
6: Oberdiessbach, Torturm des Alten Schlosses, errichtet<br />
1556. Zustand nach der Restaurierung von 1994.<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
7: Oberdiessbach, Torturm, zugehöriges Wappenrelief des<br />
Niklaus von Diessbach und der Margaretha von Erlach,<br />
eingefasst von Kandelabersäulen, Haurerive-Stein, entdeckt<br />
1990.<br />
durch einen schlanken, langgezogenen Riegbau unter<br />
Krüppelwalmdach ersetzt wurde, wie er im 16. und 17. Jh.<br />
als Herrschaftshaus oft vorkommt (Abb. 6 und 7). Nicht<br />
der Wohnbau ist hier – jedenfalls in seiner heutigen Schin<br />
delverkleidung des 19. Jh. – aufsehenerregend, vielmehr<br />
ist es die Gesamtanlage, aufgereiht längs der Ringmauer<br />
an der Hangkante über dem Diessbach.<br />
Der Stock, der «Normlandsitz» des 16. und 17. Jh.<br />
In vernünftiger Reitdistanz um Bern gab es Dutzende<br />
von kleineren Landsitzen, die Stadtbewohnern gehörten<br />
und meist einen zugehörigen Landwirtschaftsbetrieb ein<br />
schlossen. 11 In den wenigsten Fällen ist die Entstehungs<br />
zeit dieser Herrensitze geklärt. Eine Ausnahme ist das<br />
ehemalige ManuelGut an der Stadtbachstrasse in Bern 12 ,<br />
dessen steinerner Kernbau von 10 auf 8,5 m im Spät<br />
mittelalter entstand und das bis ins 20. Jh. fortdauernd<br />
erneuert und erweitert wurde. Anderswo dürften Neu<br />
bauten des 16. und früheren 17. Jh. aus Holz oder Fach<br />
werk gewesen sein, wie der Kern des Landsitzes Feldegg,<br />
Bolligenstrasse. 13<br />
10 ueli Bellwald, Schloss Bremgarten (Privatdruck Bremgarten 1988).<br />
11 Pläne der Umgebung von Bern – etwa jener von Plepp/Friederich<br />
um 1620, Staatsarchiv Bern AA I, Nr. 55, belegen eine erstaunliche<br />
Besiedlungsdichte.<br />
12 Erziehungsdirektion des Kantons Bern (Hrsg.), Archäologie Bern.<br />
Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern 5, 42–45.<br />
13 Baudokumentation des Verfassers im Archiv Kantonale Denkmal<br />
pflege Bern.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
45
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
8: Bern, Stadtbachstrasse 36, Manuel-Gut, Zustand 1620/23,<br />
festgehalten im Brouillonplan zum Schanzenprojekt von<br />
Josef Plepp/Valentin Friedrich, um 1620/23.<br />
Der Geviertbau des ehemaligen ManuelGutes wies,<br />
wie die Planvedute Plepp/Friederich zeigt (Abb. 8), ein<br />
steiles Giebeldach auf, etwa in der Form des Osthauses<br />
von Burgistein. Bereits im früheren 16. Jh. wurde es um<br />
einen Treppenturm an der Traufseite ergänzt. Mit dieser<br />
Grundform, hier entstanden in zwei getrennten Baupha<br />
sen, ist der Normtypus des herrschaftlichen Stockes kurz<br />
nach 1500 greifbar. Zwar wissen wir über seine Raum<br />
gliederung nichts, doch ist die Teilung in eine zwei Fenster<br />
breite Stube und ein schmales Kabinett pro Stockwerk<br />
durchaus anzunehmen.<br />
Wie im Fall des ManuelGutes ist bei nicht wenigen ande<br />
ren Bauten der Treppenturm als Ersatz für eine hölzerne<br />
steile Innentreppe im Korridorbereich oder für äussere<br />
Laubenwerke nachzuweisen oder anzunehmen, so am<br />
Westbau von Burgistein, in Wittigkofen, Wegmühle<br />
Bolligen, beim Altschloss Oberdiessbach oder im Land<br />
46 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
9: Büren, Schloss. Dieses repräsentativste aller Landvogteischlösser<br />
des 17. und Jh. Jh. wurde 1620 bis 1624 unter der<br />
Leitung von Werkmeister Daniel II. Heintz erbaut. Gesamtansicht<br />
nach der Fassadenrestaurierung 2003.<br />
vogteischloss von Wangen. Die Treppentürme («Wen<br />
delstein», «Schnegg») weisen ein breites Variationsfeld<br />
auf, und zwar hinsichtlich Form wie hinsichtlich Stel<br />
lung. Ihr Grundriss wechselt von Quadrat über verschie<br />
dene Polygonalvarianten und kombinationen zu Kreis,<br />
auch können Inneres und Äusseres des Treppenmantels<br />
differieren. Vielfältig sind auch die oberen Abschlüsse:<br />
Spitzhelme unterschiedlichster Grundform und Höhe,<br />
Pyramiden, Walme, seit dem ersten Viertel des 17. Jh.<br />
auch geschweifte Hauben aller Art, so in Daniel Heintz’<br />
Entwurf zu Schloss Büren, um 1620 (Abb. 9), oder in<br />
Toffen, um 1628. Häufig sind die Türme ein bis zwei<br />
Stockwerke höher aufgeführt als die Estrichzugänge und<br />
enthalten bald lustige Turmstuben, bald blosse Ausgucke.<br />
In Landshut (Abb. 10) hat man noch während des Baus<br />
beschlossen, den Treppenturm um ein Stockwerk höher<br />
aufzurichten, damit man über den First sehen könne. Eine<br />
Art Megaphon diente dazu, die Bediensteten zu rufen. 14<br />
Meist stehen die Treppentürme an der Traufseite der<br />
Gebäude, je nach Grundriss bald in der Mitte, bald<br />
desaxiert; in der alten Schadau bei Thun gab es gar auf
10: Landshut, Landvogteischloss, erbaut ab 1624 unter der<br />
Leitung von Werkmeister Daniel II Heintz.<br />
beiden Traufseiten einen Turm. Im Normalfall führte ein<br />
Korridor quer durch das Haus, der beidseits Zugang zu<br />
den Räumen bietet. Möglich ist, offenbar vor allem in<br />
der Mitte des 16. Jh., die Giebelstellung des Turms, so in<br />
Rothaus Ostermundigen und Hünigen.<br />
Bis gegen 1660 galt der Treppenturm als ziemende<br />
Erschliessung und als Zeichen gehobenen Standes und<br />
höherer Ansprüche. Im Treppenturm lebt ein letzter<br />
Reflex des mittelalterlichen Turmbaus und seiner nobili<br />
tierenden Repräsentation fort. In Einzelfällen nahm der<br />
Turm ausserordentliche Grösse an, so etwa, als Hans<br />
Rudolf Stürler um 1631–36 das spätmittelalterliche<br />
Schlösschen Belp verdoppelte und neu erschloss, so dass<br />
eine Gesamthöhe von über 40 m resultierte. Der weltliche<br />
Herr über Belp machte damit dem Kirchturm ernsthaft<br />
Konkurrenz (Abb. 11). 15<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
11:Belp, Dorf (Ausschnitt). Albrecht Kauw (1616–1681), 1671.<br />
Kehren wir zum Stock zurück: Seine Grundform variiert,<br />
wie jene des Turms, beträchtlich. 16 Bei allen Unterschie<br />
den ist festzustellen, dass der zwei oder dreigeschossige<br />
Krüppelwalmdachbau mit Giebelfrontalität und seit<br />
lichem Treppenturm die häufigste Form des frei stehen<br />
den Herrschaftshauses zwischen dem späteren 16. Jh. und<br />
der Zeit um 1670 ist, und zwar in allen Teilen des heuti<br />
gen und des alten Kantonsgebiets. Zu nennen sind als Bei<br />
spiele unter vielen die ehemaligen Landsitze und heutigen<br />
Pfarrhäuser Wattenwil und Grosshöchstetten (um 1600<br />
bzw. 1631), das Schlösschen Lattigen bei Spiez (1607),<br />
die Schlösschen Kirchdorf und Zimmerwald (beide 1641,<br />
Abb. 12), Kiesen (1668), das Siechenschlösschen in der<br />
Waldau (1598/99), die Landvogteischlösser Aarberg und<br />
Landshut (Abb. 10) oder der Landsitz an der Kirchgasse<br />
in Ins (zweites Drittel 17. Jh., Abb. 13). Der Bautyp exis<br />
tiert auch im Inneren von Städten, so sei etwa an das<br />
ehemalige Zunfthaus zu Schmieden und Zimmerleuten<br />
in Burgdorf erinnert. 17<br />
Die äussere Erscheinung der Bauten folgt in aller Regel<br />
der spätgotischen Tradition. Bei den älteren Bauten rich<br />
tet sich demgemäss die Befensterung – gekuppelte und<br />
14 JürG sChweiZer, Landshut, Baugeschichte und Beschreibung. In:<br />
hans-JürG steiner, Schloss Landshut (Bern 1980) 26–43.<br />
15 JürG sChweiZer, Schloss Belp. Renovation und Ausbau, hrsg. von<br />
der Baudirektion des Kantons Bern, Hochbauamt (Bern 1992) 8–17.<br />
16 Ein Raum breite, schlanke, hohe Stöcke bis zu breiten gedrungenen<br />
Baukörpern.<br />
17 Kirchbühl 22, heutige Form zur Hauptsache 1638.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
47
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
12: Zimmerwald, Schlössli, heutige Form zur Hauptsache 1641.<br />
13: Ins, sogenannter Rosenhof, wohl zweites Drittel 17. Jh.,<br />
Befensterung um 1700. Giebelständige Krüppelwalmdach-<br />
Stöcke mit seitlichem Treppenturm.<br />
gestaffelte Rechteckfenster, anfänglich noch mit Kehl<br />
profilen – weitgehend nach den inneren Bedürfnissen;<br />
erst nach 1600 gliedern sich die Fenster zu Achsen, wird<br />
der Fassadenaufbau im Sinne der Renaissance symmetri<br />
siert. Bereits im letzten Viertel des 16. Jh. taucht in den<br />
durch Stabwerk bereicherten Fenster und Türgewänden<br />
der spätgotischen Fenstergruppen eine Fülle von Renais<br />
sancemotiven auf. Namentlich die Stabfüsse verlassen<br />
den in der Spätgotik formulierten Formenschatz und<br />
kombinieren verschiedenste Volutenformen, Akanthus<br />
blätter und andere Renaissanceornamente. Aufgrund<br />
dieser Eigenheiten und der Innenausstattung, in der die<br />
gotischen Formen völlig verschwinden, nennt man diese<br />
48 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
14: Schloss Gümligen (Ausschnitt). Albrecht Kauw (1616–<br />
1681), 1674 – Der Vorgängerbau des heutigen Schlosses<br />
wurde 1525 in Form eines Vollwalmdach-Stockes errichtet.<br />
Stilstufe RenaissanceGotik. Sie wird, wie das Bauge<br />
schehen der Zeit generell, von den Walserbaumeistern<br />
und steinhauern getragen, den sogenannten Prismellern.<br />
Zu ihnen zählt auch Daniel I. Heintz. 18 Im Profanbau ist<br />
das 1624–1630 durch dessen Sohn, Werkmeister Daniel<br />
II. Heintz, ausgeführte Landvogteischloss Landshut ein<br />
Musterbeispiel für diese Stilphase (Abb. 10).<br />
Trotz der Vorherrschaft des Krüppelwalmstocks mit<br />
betonter Schmalseite lebt der alte Donjon – querrecht<br />
eckiges bis quadratnahes Volumen unter Vollwalmdach<br />
mit betonter Längsseite – in wenigen, aber markanten<br />
Bauten weiter. Offenbar galt der Bautypus im 16. und<br />
in der ersten Hälfte des 17. Jh. als veraltet. Am besten<br />
erfasst ist heute der teilweise in den spätbarocken Neubau<br />
von Schloss Gümligen integrierte Vorgängerbau. Anläss<br />
lich der Restaurierung im Jahre 2001 konnten Umfang<br />
und Alter dieses noch stark in spätgotischer Tradition<br />
stehenden Bauwerks untersucht werden 19 , dessen Form<br />
im Aquarell von Kauw von 1674 überliefert ist (Abb. 14).<br />
Wiederverwendete Deckenbalken und bretter erlauben,<br />
das Vorgängerschloss präzis ins Jahr 1525 zu datieren.<br />
Der leicht querrechteckige Geviertbau mit unregel<br />
mässiger Fassadierung besitzt ein gebrochenes Walm<br />
dach, das gegen den Hof hin über die Fassade vorgezo<br />
gen und auf doppelgeschossigen Holzpfosten abgestützt
15: Thun, Schlossberg, sogenanntes Abzugshaus, erbaut<br />
um 1568 als Festsaalbau zur Ergänzung eines Landsitzes intra<br />
muros, Zustand 1992 nach Restaurierung.<br />
ist. 20 Die Gesamtform des elegant umrissenen Baukörpers<br />
könnte geradeso gut einem Landsitz des 18. Jh. angehö<br />
ren. Gümligen transportiert den Bautypus, wie er etwa<br />
im Westtrakt von Burgistein um 1430 greifbar ist, in die<br />
Neuzeit. In der gleichen Tradition stehen das Schloss<br />
Ralligen, umgebaut 1514 und im frühen 16. Jh., und<br />
das sogenannte Abzugshaus auf dem Thuner Schlossberg,<br />
erbaut um 1568 als Festsaalbau zur Ergänzung eines<br />
heute verschwundenen Landsitzes intra muros (Abb. 15).<br />
Verändert oder verschwunden sind das Saxergut in Bern,<br />
Altenberg, und das sogenannte Steigerschloss in Münsin<br />
gen, in die durch Bildquellen überlieferte Form gebracht<br />
um 1570. An diese Tradition knüpfte die zweite Hälfte<br />
des 17. Jh. an.<br />
Innere Struktur und Ausstattung<br />
Die Grundrisse und Raumdispositionen der Schlösser und<br />
Landsitze im 16. und früheren 17. Jh. sind, sieht man von<br />
besonderen Bauten ab, erstaunlich einfach. Das Normale<br />
sind Mittelkorridoranlagen, die Inkaufnahme gefangener<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
Räume, der Wechsel von Stube und schmälerem Kabinett;<br />
insgesamt fällt die «nutzungsneutrale» Raumcharakteri<br />
sierung auf. Die Trennung in Wohnen, Essen und Schla<br />
fen war wenig üblich, Schlafgelegenheiten, oft mit unter<br />
geschobenen Zusatzbetten, befanden sich in fast allen<br />
Räumen, auch noch im 18. Jh. Nicht verzichtet wurde auf<br />
einen stattlichen Saal, meist aus statischen Gründen im<br />
obersten Stockwerk untergebracht. Freilich kennen wir<br />
von manchen Schlössern wegen späterer Veränderungen<br />
weder die ursprüngliche Gestalt der Räume noch deren<br />
Ausstattung und Funktion.<br />
Man darf davon ausgehen, dass die Bauvollendung kei<br />
neswegs den Abschluss der Ausstattung bedeutete; diese<br />
Arbeiten zogen sich, gerade bei Landsitzen, oft über Jahre<br />
hin und waren abhängig von den zur Verfügung stehen<br />
den finanziellen Mitteln, oft noch stärker von den zur<br />
Verfügung stehenden Handwerkern, namentlich Tisch<br />
machern (Schreinern) und Dekorationsmalern.<br />
Die Räume waren allerdings vor diesem Ausbau keines<br />
wegs unbewohnbar, sondern wurden durch die zwei wich<br />
tigsten Unternehmer – SteinhauerMaurer und Zimmer<br />
mann – in einem gepflegten Rohbau der Bauherrschaft<br />
übergeben. Ohnehin waren die Primärkonstruktionen<br />
auf Sicht gearbeitet, in erster Linie die Aussenmauern<br />
und die unterteilenden Riegwände, dann die Decken<br />
balken, oft am Rand auf Steinkonsolen aufgelegt, und<br />
ihre Einschubbretter dazwischen. Zudem wissen wir,<br />
dass Maurer auch Verputze, Kalkanstriche und einfache<br />
dekorative Einfassungen in Schwarz und Grautönen<br />
(hergestellt mit Holzkohle von Rebstöcken) schufen, Ton<br />
platten verlegten, Feuertische und Potagers (Kochherde)<br />
sowie Kamineinfassungen aufrichteten. Die Zimmerleute<br />
verlegten auch Bretterböden und fügten einfache Türen.<br />
Reichere Holzarbeiten lieferten natürlich die Tisch<br />
macher, die zusammen mit den Glasern auch die Fenster<br />
schufen; Beschläge steuerten die Schmiede bei, Kachel<br />
öfen die Hafner. Diese Arbeitsweise bringt es mit sich,<br />
18 Vgl. stePhan Gasser, Die Arbeiten am Berner Münster. In: holenstein<br />
2006 (wie Anm. 1) 196.<br />
19 Bauuntersuchung anlässlich der Restaurierung 2000/01 im Archiv<br />
Kantonale Denkmalpflege Bern.<br />
20 Ein namentlich aus städtischen Bauten bekanntes System (dômes); in<br />
unserer Gegend etwa in Unterseen.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
49
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
dass einfache Dekorationen, randprofilierte Balken und<br />
gehobelte Bretterdecken gelegentlich fast «frisch» unter<br />
Decken und Wandverkleidungen zutage treten, die kaum<br />
viel jünger sind. 21 Anderswo blieb dieser gepflegte Roh<br />
bau bis ins 18. und 19. Jh. sichtbar und verschwand erst<br />
damals unter neuen Verkleidungen. Mit der geschilderten<br />
Eigenheit übernahm der Innenausbau im 16. und frühen<br />
17. Jh. die Prinzipien des spätgotischen Baubetriebs;<br />
dies gilt auch für die einfacheren Formen des Ausbaus,<br />
namentlich für die aus Brettern gefügten Wand und<br />
Deckentäfer mit Fugenleisten. Im Einzelnen sind freilich<br />
auch hier erhebliche Unterschiede zu sehen. Die Bretter<br />
decke mit Flachschnitzfriesen verschwand nach 1530 und<br />
machte einfachen Leistendecken Platz, wobei die Leis<br />
tenprofile, ähnlich wie die Fenstergewände, geschweift,<br />
nicht mehr gekehlt, wurden. Daneben entstanden reiche<br />
re Formen wie Feldergliederungen und Kassettierungen,<br />
deren Formenvielfalt beachtlich ist. In Mode kam unter<br />
Integration von Einbaumöbeln die Teilbekleidung der<br />
Wände bis zum Dreivierteltäfer mit charakteristischen<br />
Aussparungen für Öfen und dekorativ gefasste Putzstrei<br />
fen längs der Decke. Die Wandtäferformen wurden, wie<br />
die Decken, bereichert. In der ersten Hälfte des 16. Jh.<br />
blieb es meist bei Felderteilungen, später wurden Pilas<br />
tertäfer angeschlagen, deren architektonische Formen<br />
von der Renaissance geprägt sind. Seit dem späteren<br />
16. Jh. entwickeln sich diese Architekturtäfer zu immer<br />
reicheren und komplizierteren Formen, wobei man auch<br />
zunehmend edlere Hölzer verarbeitete. Die Schnitzereien<br />
16: Landshut, Landvogteischloss, Festsaal im zweiten Obergeschoss,<br />
sogenannter Schiltensaal.<br />
50 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
17: Burgistein, Festsaal, Mittelmotiv der Kassettendecke mit<br />
reich eingelegten Mauresken und geschnitztem Beschlägwerk.<br />
Das Wappen Graffenried stammt wohl aus dem 19. Jh.<br />
wurden häufiger und raffinierter, Gestaltungsprinzipien<br />
des Manierismus hinterliessen nach 1600 ihre Spuren.<br />
Die Formenfreude der Wandvertäfelungen, Decken und<br />
Möbel steigert sich ins Reiche und Prächtige. Die Ober<br />
flächen von Pilastern, Feldern, Füllungen werden fast im<br />
Sinne eines Horror Vacui dekoriert: Schuppen, Intarsien,<br />
Fruchtholzmaser, Schnitzereien füllen alle Flächen. Deut<br />
sche Tischmacher schufen offenbar die wertvollsten und<br />
reichsten Arbeiten; verwiesen sei auf Täferausstattungen<br />
in Landshut (Abb. 16), Oberhofen, Burgistein (Abb. 17)<br />
und Toffen.<br />
Ähnliche Tendenzen gelten auch für die Dekorations<br />
malerei, die um 1550 die Architekturformen und ver<br />
täfelten Partien mit Bollenfriesen, Linien oder Bändern<br />
einfasst, mit Pfauenaugen und lebhaften Mauresken
dekoriert, meist büschelförmig an Ecken, unter Konso<br />
len oder um Balkenauflagern angeordnet. Das Kolorit<br />
ist durchwegs grau und schwarz. Im dritten Viertel des<br />
16. Jh. lösen sich die Mauresken von den spätgotischen<br />
Anordnungsprinzipien und werden zum selbständigen<br />
Dekorationsstil, etwa im Gewölberaum über der Loggia<br />
von Burgistein. Namentlich nach 1620 wird das Reper<br />
toire um Groteskenornamente und um Farbe bereichert,<br />
eine reiche Spätrenaissancewelt blüht auf. 22 Auch figür<br />
liche, mythologische und allegorische Malereien tauchen<br />
im letzten Viertel des 16. Jh. auf, so in den Schlössern<br />
Kehrsatz und Interlaken.<br />
Beliebt sind Einbaumöbel: Buffet, Giessfassschrank,<br />
Banktruhe, WandKlapptisch, wobei gleich anzumerken<br />
ist, dass nur noch Reste vom einstigen Reichtum künden. 23<br />
18: Spiez, Schloss, Turmofen um 1600, Berner Werkstatt –<br />
Der Ofen ist von einerm reliefierten, polychromen Teppichmuster<br />
überzogen. Am Aufsatz Reliefdarstellung der Fünf<br />
Sinne.<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
Das bewegliche Mobiliar war einfach: Schragentische,<br />
Stabellen, Bänke, selten Armstühle, etwa in Scherenform.<br />
Hochblüte des Ausstattungsreichtums ist der Dreissig<br />
jährige Krieg mit seiner für unsere Gegend günstigen<br />
Konjunktur. Erhalten haben sich wichtige Bestände im<br />
ehemals privaten Herrschaftsschloss Belp, in Toffen, aber<br />
auch in den Landvogteischlössern von Nidau, Landshut<br />
und Interlaken. Die dortige Audienzstube von 1641 geht<br />
in der Auflösung der Fensterwand bis an die Grenzen des<br />
statisch möglichen und weckt mit ihren dünnen Hinter<br />
stürzen und Pfeilern ein Gefühl der Instabilität.<br />
Im Berner Umkreis entstehen um 1534 und 1600 für die<br />
Schlösser Spiez und Worb die ältesten Fayenceöfen der<br />
Schweiz – für ihre Zeit wahre Prunkstücke (Abb. 18).<br />
Weder die erhaltenen späteren Öfen noch die Bodenfunde<br />
erlauben den Schluss, daraus sei später eine Hafnertradi<br />
tion entstanden, die sich etwa mit Winterthur vergleichen<br />
liesse. Offensichtlich blieb es bei dieser hoffnungsvollen<br />
Knospe. Vielmehr scheinen selbst die Importe aus dem<br />
blühenden Zentrum eher selten zu sein, und die eigene<br />
Produktion konzentrierte sich meist auf grün glasierte<br />
und reliefierte Rapportmuster. Erhalten haben sich dage<br />
gen grosse Prunkkamine, so in Burgistein 1570, in Worb<br />
1594 und in Belp 1636.<br />
Mit Farben prangten in den Fenstern die Wappenschei<br />
ben, die in neu ausgestattete Schlösser geschenkt wurden,<br />
etwa nach Worb oder nach Burgistein.<br />
Die bernische Campagne –<br />
die Neuerungen im späten 17. Jh.<br />
Die ungebrochene Lebenskraft des Hauptbautypus im<br />
Zeitraum 1550 bis 1650, giebelständiger Krüppelwalm<br />
stock mit traufseitigem Treppenturm, belegen die monu<br />
mentalen Spätlinge Kiesen, erbaut 1686, oder Riggisberg,<br />
erbaut um 1700. Allerdings mehren sich um die Mitte des<br />
17. Jh. die Anzeichen, dass ein Wandel in der Vorstellung<br />
eines Herrenhauses eintritt. Die grossen Neuerungen, die<br />
21 Wir nennen etwa Befunde im Schloss Münchenwiler und jüngste<br />
Feststellungen im Schlösschen Rörswil.<br />
22 Vgl. GeorGes herZoG, Zur Malerei Berns vom Einbruch der Reformation<br />
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. In: holenstein 2006<br />
(wie Anm. 1) 345.<br />
23 Vgl. manuel Kehrli, Wohnen in der Stadt Bern. In: holenstein<br />
2006 (wie Anm. 1) 514.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
51
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
den Landsitzbau des 18. Jh. einleiten, fallen in die zwei<br />
Jahrzehnte zwischen 1664 und 1684 und treten schritt<br />
weise in mehreren markanten Neubauten hervor:<br />
Gebäudestellung<br />
Schloss Utzigen ist für den Ratsherrn Samuel Jenner ab<br />
1664 erbaut worden (Abb. 19). Der mächtige, drei auf<br />
sieben Fensterachsen zählende Baukörper auf hohem<br />
Kellersockel wendet der Terrasse, der Gartenanlage, der<br />
Landschaft und der alten Strasse seine Längsseite zu. Die<br />
Fassade wird mit zweiläufiger Freitreppe, architektonisch<br />
ausgezeichnetem Portal, ungerader Fensterzahl, freigehal<br />
tener Dachmitte und der (rückwärtigen) Turmstellung<br />
unmissverständlich als Hauptfassade charakterisiert. Die<br />
Lösung von Utzigen löste die über hundert Jahre vor<br />
herrschende Giebelstellung ab und leitete die bis in<br />
den Historismus beibehaltene, weit repräsentativere<br />
Gebäudestellung ein. Dem Beispiel von Utzigen folgte<br />
der gleiche Bauherr auch um 1694/99 beim Bau des Thal<br />
gutes in Ittigen. 24<br />
Dachform<br />
Schloss Utzigen weist ein steiles, elegant auslaufendes<br />
Vollwalmdach mit langem First auf; damit endet der<br />
Vorrang des Krüppelwalms mit Giebelausbildung. Dieses<br />
Prinzip setzt sich augenblicklich durch und gilt bis weit<br />
ins 19. Jh. Interessanterweise kehrt Jenner beim Bau des<br />
weit kleineren Thalguts zur älteren Dachform zurück.<br />
Mancher Herrschaftsbau des 16. und 17. Jh. ist im 18.<br />
19: Utzigen, Schloss, von der Gartsenseite her gesehen.<br />
52 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
oder 19. Jh. aufwendig zum VollwalmdachBau umge<br />
staltet worden. Erwähnt seien etwa Belp, Rörswil, Büren<br />
stock in Worb. Das französische Mansarddach hielt um<br />
1690 mit dem Schloss Reichenbach Einzug und eröffnete<br />
im Schlossbau die spätbarocke Tradition.<br />
Verhältnis zur Landschaft<br />
Für Albrecht von Wattenwyl, Oberst in französischen<br />
Diensten, errichteten 1666–1668 Jonas Favre aus Neuen<br />
burg als SteinhauerMaurer und JeanGeorges Riedkess<br />
ler von Morges als Zimmermeister nach Durchlaufen<br />
einer noch wenig geklärten Planungsphase seitlich des<br />
alten Schlosses das hochherrschaftliche Neue Schloss<br />
Oberdiessbach, das Hauptwerk des bernischen Profan<br />
baus aus der zweiten Hälfte des 17. Jh. (Abb. 20). Als<br />
erstes bernisches Schloss ist Oberdiessbach voll in die<br />
Landschaft integriert: Der Bau wird von der Hangkante<br />
in die Ebene gerückt und greift mit Längs und Querachse<br />
rechtwinklig in die Landschaft aus. Geschickt wird der<br />
rahmende Hügelzug als Fassung des Achsenwinkels einge<br />
setzt. Dem Baukörper des Schlosses wurde ein «vorderer<br />
Hof», straff geformt aus drei übermannshohen Mauern,<br />
vorgesetzt, dessen Eckpunkte durch Pavillons besetzt sind<br />
und entfernt an die Hoflösungen des 16. Jh. erinnern.<br />
Freilich sind die trutzigen Türmchen von Schlosswil oder<br />
Schwarzenburg putzigen Pavillons gewichen.Trotzdem<br />
verkörpert der Hof von Oberdiessbach den herben Geist<br />
eines geschlossenen Renaissancehofes. Erst der Ersatz der<br />
vorderen und der rechten Hofmauer im 18. und 19. Jh.<br />
schuf die heutige offene Situation. 25<br />
20: Oberdiessbach, Neues Schloss, errichtet 1660–1668.
Wie in Utzigen bildet die Längsseite des Rechteckbaus<br />
unter ausladendem Walmdach die Hauptfassade, die den<br />
Besucher mit einer offenen, doppelgeschossigen Drei<br />
bogenloggia, flankiert von zwei je dreiachsigen Seiten<br />
flügeln, empfängt. Für das späte 17. Jh., besonders aber<br />
für das 18. Jh., das seine Landsitze möglichst landschafts<br />
bezogen erbaute, war die Haltung von Oberdiessbach<br />
richtungweisend.<br />
Erschliessungssystem<br />
Utzigen, Kiesen und das Thalgut Ittigen halten am trauf<br />
seitigen Treppenturm fest, der freilich durch Grund und<br />
Aufrissdisposition stärker in das Gesamtkonzept der<br />
Bauten einbezogen wird, was gerade in Utzigen vor der<br />
Reduktion des Turms um ein Geschoss auffiel. Hier ist<br />
auch der traditionelle kreisförmige Treppenlauf durch<br />
eine dreifach gebrochene Führung mit Podesten ersetzt<br />
25: Oberdiessbach, Neues Schloss, Grundriss der Schlossanlage, nach 1668.<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
worden. In Oberdiessbach dagegen wurde die Treppenan<br />
lage ins Hausinnere einbezogen (Abb. 25), und zwar nicht<br />
wie in Rörswil als kompromisshafte Verlegenheitslösung,<br />
sondern in monumentaler Form; gewölbte Flure und die<br />
rechteckig um einen zentralen Schacht angelegte Treppe<br />
beanspruchen in der Breite des Loggientrakts die ganze<br />
Gebäudetiefe. Interne Treppenanlagen gehören seit Ober<br />
diessbach zu den Selbstverständlichkeiten der Landsitze;<br />
so folgen bereits Reichenbach und Rockhall in Biel im<br />
letzten Jahrzehnt des 17. Jh. dem neuen Prinzip.<br />
24 hans GuGGer, Ittigen, eine junge Gemeinde mit alter Geschichte<br />
(Bern 1998) 374–385.<br />
25 Über die ursprüngliche Gestalt orientieren Pläne des 17. Jh. und<br />
von 1716. Die Abbrüche der Hofmauern fallen wohl in die Zeit<br />
um 1820, als auch der Eckpavillon Südwest mit Peristylia erweitert<br />
wurde. Plan und Bilddokumente jetzt abgebildet in: niKlaus voGel,<br />
Oberdiessbach. Die Geschichte eines Dorfes (Oberdiessbach 1960).<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
53
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
Grundrisssystematisierung,<br />
Grundrissdifferenzierung<br />
Die Durchquerung der Gebäudetiefe durch einen vom<br />
Treppenturm erschlossenen Korridor war zwar bereits<br />
ein erster Schritt zur Grundrisssystematisierung, hingegen<br />
wurde der Korridor erst mit der Längsseitenfrontalität<br />
zur Symmetrieachse. Im Thalgut gibt es beidseits des<br />
Korridors je vier grosse, je einen Viertel des Grundrisses<br />
beanspruchende Räume. Utzigen gliedert den Grundriss<br />
noch gravitätischer mit durchlaufendem kreuzförmigem<br />
Korridor, doch werden ausser grossen Sälen auch kleinere<br />
Kompartimente ausgeschieden. In Oberdiessbach wird<br />
eine breite Palette von differenzierten Räumen angeboten:<br />
ausser dem grossen Saal mehrere Cabinets, eine Garde<br />
robe und Räume für Bedienstete, Küche und eine interne<br />
Toilette.<br />
Fassadensystematisierung<br />
Entsprechend den gestiegenen Ansprüchen an die Reprä<br />
sentation und den gestrafften Grundrissen werden auch<br />
die Fassaden streng systematisiert. Axialitäten und Sym<br />
metrien, Mittenbetonung, Normierung der Steingrössen<br />
und des Steinschnitts und ein von der französischen<br />
Renaissance genährtes architektonisches Formenvoka<br />
bular werden üblich.<br />
Homogenisierter Ausstattungsluxus<br />
Der Eindruck des Stucksaals von Spiez (Abb 21 und 22)<br />
wurde noch gesteigert durch die dunkle, üppige Vertä<br />
felung des Nebensaals. 26 Gesucht war offensichtlich ein<br />
scharfer HellDunkelKontrast (Abb. 23). In der Tat<br />
waren die reichen Innenausstattungen der 1. Hälfte des<br />
17. Jh. geprägt vom Wunsch nach Vielfalt, Wechsel,<br />
54 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
21: Spiez, Schloss, zweites Obergeschoss, Prunksaal mit Blick<br />
gegen den Kamin. stuckiert von Antonio Castello, 1614.<br />
Gegensatz, wie neueste Befunde in Rörswil zeigen, wo in<br />
einem der Säle sogar eine wohl um die Jahrhundertmitte<br />
eingerichtete Textilbespannung der Wände, am ehesten<br />
in Form zugekaufter Gobelins, anzunehmen ist. In Ober<br />
diessbach werden solche Gegensätze vermieden, ein alle<br />
Räume durchwirkender, weit einheitlicherer gestalteri<br />
scher Geist prägt die überaus prächtige Ausstattung in<br />
den Stilen Louis XIII und Louis XIV, die, im Gegensatz<br />
zur Aussenarchitektur, à jour ist (Abb. 24). Ob sich in die<br />
ser Eigenschaft das Wirken Albrecht Kauws, der mit ganz<br />
namhaften Aufträgen beteiligt war, widerspiegelt? 27 Die<br />
klassischen Kassettendecken und Pilastertäfer in Grau,<br />
Elfenbein und Gold, die flächigen Wandgliederungen mit<br />
eingepassten (jüngeren) Gobelins und Marinebildern, die<br />
gepressten, vergoldeten und bemalten flämischen Leder<br />
tapeten und völlig polychrom ausgemalte Salons schlagen<br />
22: Spiez, Schloss, zweites<br />
Obergeschoss, Prunksaal.<br />
Ausschnitt aus dem<br />
umlaufenden Stuckfries:<br />
Das Gleichnis des verlorenen<br />
Sohnes. Das Verprassen der<br />
Erbschaft mit Wein, Essen,<br />
Frauen und Musik.
23: Spiez, Schloss, zweites Obergeschoss, ausgetäferte Prunkstube<br />
mit Einbaumöbeln unter Kassettendecke, datiert 1628.<br />
24: Oberdiessbach, Neues Schloss, Festsaal im ersten Stock.<br />
Mit Ausnahme des Parketts vollständig aus der Bauzeit des<br />
Schlosses erhaltene Innenausstattung mit grossem Kamin,<br />
Holzarbeiten, in Grau und Gold gefasst, Wandbekleidungen<br />
mit flämischen bemalten Ledertapeten und in die Architektur<br />
eingebundenen Ruinen- und Grottenbildern von Albert Kauw.<br />
einen Ton an, der bisher in bernischen Landen unbekannt<br />
war. Endlich ist mit dem Turmofen im Esszimmer, datiert<br />
1675, wieder ein (blauer) Fayenceofen in situ erhalten<br />
geblieben, der von der Qualität der bernischen Hafnerei<br />
im späteren 17. Jh. kündet.<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
Die Landvogteischlösser<br />
Am Ende des Ancien Régime gab es etwa 50 Land<br />
vogteien. Alle sechs Jahre wählte der grosse Rat die<br />
jeweiligen Amtsinhaber, durchwegs Stadtburger, neu. Als<br />
Sitz dieser kleinen «Feudalherren auf Zeit» dienten in<br />
der Regel alte Herrschaftszentren, Schlösser und ehema<br />
lige Klöster, die Bern im Laufe der Zeit dem jeweiligen<br />
Komfortanspruch und Geschmack anpasste. Zentrum<br />
der Landvogtwohnung bildeten die grosse Stube, die<br />
Küche und mehrere Nebenstuben. Schlafgelegenheiten<br />
gab es fast in jedem Raum. Die alten Hauptsäle mehre<br />
rer Schlösser, die eigentlichen «Rittersäle», wurden für<br />
repräsentative Zwecke und Anlässe bis ins 16. und 17. Jh.<br />
instand gehalten. Ihre Nachfolger sind die seit dem 16. Jh.<br />
nachweisbaren, meist nur mit einem grossen Kamin heiz<br />
baren sogenannten Schiltensäle. Sie lagen meist, hierin<br />
den Festräumen der Stadthäuser entsprechend, im zwei<br />
ten Stock und gehören bis ins 18. Jh. zur Standardausrüs<br />
tung von Landvogteischlössern (Abb. 16). Ihren Namen<br />
trugen sie von einem Hauptausstattungsobjekt, dem Stan<br />
deswappen und der Wappenfolge der hier residierenden<br />
Landvögte. Anfänglich wurden die Wappen direkt auf die<br />
Wand gemalt, wohl in der Nachfolge ritterlicher Wappen<br />
zyklen, später stellte man hölzerne Wappentafeln her. Die<br />
Amtsräume waren von jeher einfach; sie umfassten meist<br />
bloss eine Audienzstube – also ein Sprechzimmer –, einen<br />
Warteraum und eine Schreibstube.<br />
Den Ansprüchen des 16. und 17. Jh. genügten die spät<br />
mittelalterlichen Vogtswohnungen in der Regel nicht<br />
mehr; gross angelegte Umbauten und Ergänzungen des<br />
Wohnungsangebots lassen sich etwa in Burgdorf und<br />
Thun um 1540–1546 beziehungsweise 1565–1570, in<br />
Interlaken und anderswo ab 1600 im Einzelnen verfol<br />
gen. In einer beeindruckenden Reihe entstanden kurz vor<br />
und während des Dreissigjährigen Krieges eine ganze<br />
Reihe von Landvogteisitzen oder wenigstens ihre Haupt<br />
gebäude. Offenbar weitgehend unter der Oberleitung von<br />
Daniel II. Heintz (1574–1633) wurden in einem in der<br />
bernischen Baugeschichte beispiellosen Schwung fünf<br />
26 JürG sChweiZer, Eine Sonderleistung: der Stucksaal im Schloss<br />
Spiez. In: holenstein 2006 (wie Anm. 1) 529.<br />
27 herZoG 1999 (wie Anm. 4) 92–96, 112–114.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
55
Jürg Schweizer –Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
neue Landvogteischlösser gebaut oder mit wesentlichen<br />
Neubauteilen versehen. 28<br />
Ihnen gemeinsam ist der Bautypus: Krüppelwalmstock<br />
mit traufseitigem Treppenturm, also der Herrschaftsbau<br />
typ der Zeit (Abb. 9). Mehrfach wurden wesentlich ältere<br />
Bestände integriert, am augenfälligsten in Nidau, wo mit<br />
der befensterten Eingangsseite das Schwergewicht auf die<br />
nur zum Teil freie südliche Traufseite gelegt wurde. 29<br />
Besonders ausgezeichnete Bauten sind Landshut und<br />
Büren: In Landshut erhebt sich die repräsentative, gegen<br />
den Besucher gerichtete Zugangsfront als mächtige Gie<br />
belfassade unter schlanker Ründe (Abb.10), einer in der<br />
Stadt und in obrigkeitlichen Bauten des 16. und 17. Jh.<br />
entwickelten Vordachverschalung, die erst im 18. Jh.<br />
Eingang in die bäuerliche Architektur gefunden hat. Die<br />
Kuppelfenster sind streng axiert, eine Fensterbekrönung<br />
in Form eines Sprenggiebels betont die Mitte. Im Hof<br />
wird das geohrte Treppenturmportal, gleichzeitig Haupt<br />
eingang ins Schloss, von breiten rustizierten Pilastern<br />
gerahmt, die Gebälk und den klassischen Dreieckgiebel<br />
tragen.<br />
Der weitaus anspruchsvollste Bau der Gruppe ist Büren,<br />
bedeutendster bernischer Schlossbau der ersten Hälfte<br />
des 17. Jh. (Abb. 9). Der Bauplatz am westlichen Stadt<br />
eingang wurde bewusst gewählt, erwarb Bern doch vier<br />
Häuser und riss sie zur Gewinnung des Bauplatzes ab. Der<br />
grosse Baukörper mit seitlichem Treppenturm tritt vor<br />
allem mit seiner Giebelfassade in Erscheinung. Sie wird<br />
charakterisiert durch die zwei dicht befensterten Ober<br />
geschosse auf dem stärker geschlossenen Gebäudesockel<br />
und durch den stärker geschlossenen Giebel unter einer<br />
weiteren frühen Berner Ründe, besonders aber durch<br />
28 Münchenbuchsee 1600–1604; Aarberg 1608–1610; Büren a. A.<br />
1620–1624; Landshut 1624–1630 und Nidau 1625–1636. Nicht<br />
in allen Fällen ist derzeit der gleich enge Bezug von Daniel Heintz<br />
II. für die Neubauten nachgewiesen, da die Quellen unterschiedlich<br />
ausgewertet sind. Immer waren jedoch «Lamparter» (wörtlich:<br />
Lombarden) als SteinhauerUnternehmer tätig (eigentlich deutschsprachige<br />
SüdwalserBaumeister), die zum Teil derselben Sippe angehörten<br />
wie Werkmeister Heintz selbst oder aus gleichen Familien<br />
stammten. Ob der Unterbruch der Erneuerungswelle durch den Tod<br />
von Daniel Heintz 1633 mitverursacht wurde, ist offen. Jedenfalls<br />
setzten die Neubauten erst 1648–1651 mit dem Neuen Schloss<br />
Laupen und ab 1654 mit dem Schloss Unterseen wieder ein.<br />
29 Vgl. andres moser, Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern Land<br />
III, Der Amtsbezirk Nidau 2. Teil (Bern 2005) 48–49.<br />
56 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
die zwei das Dach durchstossenden seitlichen Erker. Die<br />
Steinhauerarbeiten, nämlich die Fensterlaibungen mit fein<br />
dekorierten Stabfüssen, das Wappenrelief, aber auch die<br />
Konsolen der Erker sind besonders sorgfältig. Erhöhten<br />
Ansprüchen hatte auch der Zugang zu entsprechen. Das<br />
seitliche Portal an der wehrmauerartigen Hofabschluss<br />
mauer führt in den Schlosshof. Die überaus repräsentative<br />
Schaufront ist wohl mit der Grenzsituation von Büren im<br />
alten Staate Bern und mit dem einzigen Flussübergang<br />
zwischen Aarberg und Solothurn zu erklären: Jenseits der<br />
Aare begann das Fürstbistum Basel.<br />
Résumé<br />
Aux 15 e et 16 e siècles, un nombre considérable de petits<br />
domaines seigneuriaux issus de la noblesse vasalle (petite noblesse)<br />
passèrent en mains de familles bernoises citadines ambitieuses.<br />
Pour démontrer leur pouvoir politique et économique,<br />
ces citadins ont fait transformer ou aménager les châteaux médiévaux<br />
délabrés en manoirs modernes. Différentes solutions<br />
architectoniques ont été mises à contribution. Si dans certains<br />
cas, les matériaux de construction médiévaux sont restés plus<br />
ou moins apparents pour être entourés de bâtiments d’habitation,<br />
ils ont en d’autres lieux été en partie démontés et intégrés aux<br />
nouvelles bâtisses. Dans d’autres cas encore, les antécédents<br />
médiévaux ont totalement disparu pour laisser place à une toute<br />
nouvelle construction et enfin, à d’autres endroits encore, un<br />
nouveau château a été érigé à côté de l’aménagement médiéval,<br />
qu’on laissait alors simplement subsister. L’élément nouveau<br />
essentiel de cette époque est l’intégration dans l’architecture<br />
noble de la cour intérieure fermée sur deux ou trois côtés<br />
(Burgistein).<br />
En 1500, apparaît une nouvelle forme de construction, l’étage<br />
d’habitation, composé d’une partie habitable carrée et d’une<br />
tour d’escaliers, qui remplaçait l’ancien escalier escarpé aménagé<br />
à l’intérieur. De nombreuses possibilités existaient concernant<br />
l’emplacement de la tour par rapport au bâtiment, sa forme et<br />
sa hauteur. La structure intérieure des bâtiments d’habitation<br />
(reliés les uns aux autres par des corridors), telle que<br />
l’aménagement des pièces (lambris, stuc, peintures) est également<br />
soumise à d’importants changements. En 1530 apparaît<br />
par exemple à Spiez le premier poêle en faïences de Suisse.<br />
Alafin de l’Ancien Régime, il yavait environ 50 baillis bernoises.<br />
En règle générale, de vieux centres seigneuriaux, châteaux ou<br />
anciens monastères, adaptés par Berne, au cours du temps, aux<br />
exigences de confort et de goût individuelles, servaient de siège<br />
à ces petits «seigneurs féodaux temporaires». Le centre de<br />
l’habitat baillival se composait d’un grand salon et de la cuisine<br />
pour le secteur privé. Les anciennes salles principales de plusieurs<br />
châteaux, les «sallesdes chevaliers», étaiententretenues et<br />
aménagées à des fin représentatives et pour des manifestations<br />
particulières; les «salles des écussons» décorées des armoiries<br />
du bailli résidant, faisaient partie de l’aménagement standard<br />
des sièges baillivaux.
Toutes ces modifications sont présentées dans l’article avec de<br />
nombreux exemples tirés de la région bernoise.<br />
(Sandrine Wasem, Thun)<br />
Riassunto<br />
Nel XV e XVI sec. molte signorie minori appartenenti alla piccola<br />
nobiltà furono cedute a importanti famiglie della città di<br />
Berna. Per mettere in risalto il loro potere economico e finanziario<br />
questi cittadini benestanti trasformarono i castelli medievali<br />
ormai cadenti, in lussuose dimore, che rispecchiavano i gusti del<br />
tempo. Questo sviluppo portò a delle soluzioni architettoniche<br />
differenti. In un primo caso, alle strutture murarie medievali,<br />
lasciate in parte visibili, furono aggiunte abitazioni più conformi<br />
al tempo. In un secondo caso le strutture murarie medievali<br />
furono in parte demolite ed in seguito integrate in nuovi edifici.<br />
In un terzo caso il fortilizio medievale fu completamente<br />
abbattuto e ad al suo posto si costruì una nuova abitazione.<br />
In un quarto caso le nuove residenze vennero erette accanto al<br />
complesso castellano medievale, che di conseguenza non subì<br />
alterazioni particolari. In quel periodo nell’architettura signorile<br />
come nuovo elemento fu introdotta la corte interna, delimitata<br />
da edifici posti su due o tre lati della medesima (Burgistein).<br />
Intorno al 1500 fu introdotto come nuovo elemento architettonico<br />
il locale d’abitazione a pianta rettangolare, posto su un<br />
unico piano. Il locale era raggiungibile attraverso una torre con<br />
scala a chiocciola, la quale sostituì le ripide scale fino ad allora<br />
situate all’interno degli edifici. La posizione della torre rispetto<br />
all’edificio, la sua forma e l’altezza, poteva variare. Anche la<br />
struttura interna degli edifici d’abitazione (accessibili attraverso<br />
dei corridoi), come pure l’arredamento dei locali (rivestimenti<br />
lignei delle pareti, stucchi, pitture) subì una profonda trasformazione.<br />
Intorno al 1530 a Spiez per esempio fu costruita la<br />
prima stufa in faenza della Svizzera.<br />
Alla fine dell’Ancien Régime esistevano circa 50 baliaggi bernesi.<br />
Come residenze per questi «signori feudali in carica per un<br />
periodo di tempo limitato» fungevano in genere vecchi centri<br />
amministrativi, castelli e conventi in disuso. Questi edifici nel<br />
corso dei secoli erano stati trasformati da Berna in abitazioni<br />
più confortevoli che rispecchiavano i gusti del tempo. Il nucleo<br />
della sede di un landvogto era composto dalla «Stube» (stanza<br />
di soggiorno) e dalla cucina privata. Le antiche sale principali<br />
«Rittersäle» di molti castelli, per questioni di rappresentanza,<br />
furono ampliate e mantenute in buono stato. Queste sale «Schiltensäle»<br />
adornate con gli stemmi dei rispettivi landvogti in carica,<br />
erano un elemento tipico dei baliaggi.<br />
In questo articolo le varie innovazioni architettoniche vengono<br />
descritte facendo riferimento a molti esempi provenienti dalla<br />
regione di Berna. Christian Saladin (Basilea/Origlio)<br />
Resumaziun<br />
En il 15avel ed il 16avel tschientaner ha midà maun in considerabel<br />
dumber da pitschens dominis da l’aristocrazia ministeriala<br />
(aristocrazia bassa) a famiglias arrivisticas da la citad<br />
da Berna. Per demonstrar lur pussanza politica ed economica<br />
han ils citadins laschà transfurmar ed amplifitgar ils chastels<br />
Jürg Schweizer – Schlösser und Landsitze in der Landschaft Bern<br />
medievals en ruina a residenzas modernas. Igl ha dà differentas<br />
soluziuns architectonicas. En l’emprim cas han ins laschà pli u<br />
main visibel la substanza da construcziun medievala e circumdà<br />
quella cun edifizis d’abitar confurms al temp. En il segund<br />
cas han ins per part stratg giu las construcziuns medievalas ed<br />
integrà ellas en ils edifizis d’abitar. En il terz cas è l’antecessur<br />
medieval svanì cumplettamain ed a sia plazza è vegnì erigì in<br />
edifizi nov. En il quart cas han ins construì il nov chastè sper il<br />
stabiliment medieval ch’ins ha simplamain laschà en ses stadi<br />
oriund. Sco nov element substanzial vegn introducì da lez temp<br />
en l’architectura signurila la curt interna circumdada dad edifizis<br />
da dus u da trais varts (Burgistein).<br />
Enturn il 1500 han ins cumenzà a construir en furma d’in unic<br />
plaun d’abitar che consistiva dad in local d’abitar rectangular.<br />
Quel era accessibel sur ina tur da stgala che remplazzava las<br />
stgalas stippas oriundas erigidas a l’intern da l’edifizi. Areguard<br />
la posiziun da la tur en confrunt cun l’edifizi, sia furma<br />
ed autezza devi diversas variantas. Era la structura interna dals<br />
edifizis d’abitar (accessibels tras corridors) ed il furniment da<br />
las stanzas (tavlegià, stuc, pictura) s’han midads considerablamain.<br />
Enturn il 1530 chatt’ins a Spiez per exempel l’emprima pigna<br />
da Fayence da la Svizra.<br />
A la fin da l’Ancien Régime devi var 50 podestatarias. Sco sedias<br />
da quests pitschens «signurs feudals a temp limità» servivan per<br />
regla vegls centers da domini, chastels ed anteriuras claustras.<br />
Berna ha adattà cun l’ir dal temp quels edifizis al sentiment<br />
da confort ed al gust dal temp. La part centrala da l’abitaziun<br />
dal podestat furmava la stiva gronda e la cuschina per il sectur<br />
privat. Las veglias salas principalas da plirs chastels, las «salas<br />
da chavalier» per propi, han ins mantegnì ed amplifitgà per<br />
occurrenzas ed intents represchentativs; las «salas da vopna»<br />
decoradas cun ils emblems dals podestats che residiavan mintgamai<br />
là, appartegnevan tar l’equipament da standard da las<br />
podestatarias.<br />
Tut questas midadas vegnan preschentadas en la contribuziun<br />
cun numerus exempels da la regiun da Berna.<br />
(Lia rumantscha, Cuira/Chur)<br />
Abbildungsnachweis:<br />
1: Privatbesitz<br />
2, 18: Benjamin Zurbriggen, Bern<br />
3–7, 12: Denkmalpflege Bern<br />
8: Staatsarchiv Bern AA VII, 14a.v<br />
9, 16: Denkmalpflege Bern, Markus Beyeler, Hinterkappelen<br />
11: Berner Historisches Museum Inv. 26078<br />
13: Denkmalpflege Bern, Johannes Gfeller, Münchenbuchsee<br />
14: Berner Historisches Museum Inv. 26075<br />
15, 19: Denkmalpflege Bern, Gerhard Howald, Kirchlinsdach<br />
20, 24, 25: Sigmund von Wattenwyl, Archiv Schloss Oberdiessbach<br />
Die übrigen Abbildungen nach Holenstein 2006 (wie Anm. 1) 630.<br />
Adresse des Autors:<br />
Dr. Jürg Schweizer<br />
Kantonale Denkmalpflege Bern<br />
Münstergasse 32<br />
CH3011 Bern<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2<br />
57
Kurzmitteilungen / Veranstaltungen<br />
Kurzmitteilungen<br />
Schloss Wildegg,<br />
Möriken-Wildegg AG<br />
Der Bund will das Schloss Wildegg<br />
abstossen<br />
Am Samstag, 18.4.<strong>2009</strong>, öffnete das<br />
Schloss Wildegg nach einer Innenrenovation<br />
seine Tore wieder. Der Bund will das<br />
bis heute zur Gruppe der Landesmuseen<br />
gehörende Schloss dem Kanton Aargau<br />
verkaufen, obwohl die letzte Eigentümerin<br />
es der Eidgenossenschaft geschenkt<br />
hat.<br />
Der Bund hat seit 2005 die Innenräume<br />
für 2,7 Millionen Franken durch das<br />
Bundesamt für Bauten und Logistik,<br />
die aargauische Denkmalpflege und die<br />
Landesmuseen renovieren lassen. Das<br />
Schloss und seine Domäne wurden der<br />
Eidgenossenschaft 1912 von der letzten,<br />
kinderlosen Eigentümerin, Julie Effinger,<br />
zugunsten des Landesmuseums vermacht.<br />
Zuvor war das Schloss während<br />
11 Generationen im Besitz der Familie<br />
Effinger gewesen.<br />
Im Zug der Reorganisation der Landesmuseen<br />
im Museums und Sammlungsgesetz<br />
fasst der Bund das heutige Landesmuseum<br />
in Zürich, das Schloss Prangins,<br />
das Forum der Schweizer Geschichte in<br />
Schwyz sowie das Sammlungszentrum<br />
in Affoltern am Albis in einer öffentlichrechtlichen<br />
Anstalt als Nationalmuseum<br />
zusammen. Zu jenen Museen, von denen<br />
sich der Bund trennen will, zählt auch<br />
die Schlossanlage von Wildegg. Der Bund<br />
strebt einen Verkauf des Schlosses samt<br />
seiner Domäne (mit dem Restaurant<br />
Bären) an den Kanton Aargau an. Die<br />
Veranstaltungen<br />
ARTUS – Geschichten<br />
um den König, seine Ritter<br />
und den heiligen Gral<br />
1.4.–31.10.<strong>2009</strong><br />
Sonderausstellung auf den Schlössern<br />
Lenzburg und Hallwyl<br />
58 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
aargauische Verwaltung bestätigt die Verhandlungen<br />
mit dem Bund. Eine Arbeitsgruppe<br />
unter der Leitung von Staatsschreiber<br />
Peter Grünenfelder definiert<br />
gegenwärtig die Eckwerte für den Handel.<br />
Auch wenn das Schloss innen durch<br />
den Bund renoviert worden ist, machen<br />
die jährlichen Kosten für den Unterhalt<br />
eine sechsstellige Summe aus. Der Aargau<br />
ist in der Nähe von Wildegg bereits für<br />
die Schlösser Lenzburg und Hallwil sowie<br />
die Habsburg und die Klosterkirche<br />
Königsfelden verantwortlich.<br />
Beim Bundesamt für Kultur ist man zum<br />
Schluss gekommen, dass ein Verkauf an<br />
den Aargau rechtlich möglich sei. Die<br />
Stiftungsurkunde enthalte kein Veräusserungsverbot.<br />
Bei einem Verkauf müssen<br />
weiterhin der Unterhalt der Anlage sowie<br />
die öffentliche Zugänglichkeit sichergestellt<br />
werden. Auch beim Kanton Aargau<br />
sieht man kein rechtliches Hindernis. Die<br />
Schenkung sei 1912 an die Eidgenossenschaft<br />
gegangen, weil der Aargau damals<br />
noch über keine entsprechenden Strukturen<br />
im Denkmalschutz verfügt habe.<br />
Während sich in den eidgenössischen<br />
Räten keinerlei Widerstand gegen einen<br />
allfälligen Verkauf der bisherigen Museen<br />
des Bundes in Wildegg, Seewen oder Gandria<br />
regte, hat im Aargau SVPGrossrat<br />
Jürg StüssiLauterburg im vergangenen<br />
Dezember eine Interpellation eingereicht.<br />
Der Historiker will vom Regierungsrat<br />
wissen, wie er es mit dem Respekt vor<br />
dem Willen der letzten Eigentümerin hält,<br />
die mit ihrer Schenkung das Schloss und<br />
seine Domäne «auf Dauer in den Händen<br />
des Bundes wissen wollte». Weiter verlangt<br />
der Politiker eine Antwort auf die<br />
Frage, was denn im Schloss unter Obhut<br />
Das Museum Aargau wird zu Camelot!<br />
König Artus hält Einzug auf den Schlössern<br />
Lenzburg und Hallwyl. Die Sonderausstellung<br />
spürt der Faszination rund<br />
um die ArtusSage nach. Auf Schloss<br />
Lenzburg steht der Themenkreis um die<br />
des Aargaus in Zukunft gezeigt werden<br />
soll und welche Kosten längerfristig mit<br />
der Transaktion verbunden sind. Regierung<br />
und Verwaltung haben für ihre Antwort<br />
um eine Fristerstreckung bis Ende<br />
Juni gebeten, weil die Sache komplizierter<br />
sei und die Verhandlungen mit dem<br />
Bund noch nicht abgeschlossen seien. Es<br />
geht nicht zuletzt um die Konditionen der<br />
Transaktion. Hier möchte sich der Kanton<br />
vor Abschluss der Verhandlungen<br />
nicht in die Karten schauen lassen.<br />
(SX in NZZOnline, 18.4.<strong>2009</strong>)<br />
Magdeburg DE<br />
800-jährige Schuhe gefunden<br />
Mehrere rund 800 Jahre alte Lederschuhe<br />
sind bei einer Grabung in der<br />
Innenstadt von Magdeburg gefunden<br />
worden. «Schuhfunde aus der Gotik<br />
kommen in Mitteleuropa sehr selten<br />
vor», sagte Restaurator Heiko Breuer<br />
von Landesmuseum für Vorgeschichte<br />
in Halle. Es handle sich um fünf sogenannte<br />
Schlupfschuhe aus Schaftsleder,<br />
das sich in einer feuchten Bodenschicht<br />
gut erhalten habe. Zudem haben Archäologen<br />
bei Umbettungen in der Gruft<br />
der Klosterkirche Ilsenburg im Harz ein<br />
350 Jahre altes Kinderschuhpaar aus dem<br />
Barock entdeckt. Laut Breuer lässt sich<br />
anhand des Fundes von Magdeburg gut<br />
erkennen, wie Schuhe im <strong>Mittelalter</strong> hergestellt<br />
wurden. «Die Einzelteile wurden<br />
auf einen Leisten gespannt, zusammengenäht<br />
und dann zum Schutz der Naht<br />
gewendet.» Weitere Infos unter www.<br />
archlsa.de<br />
(BaZ, 8.6.<strong>2009</strong>, DPA)<br />
Ritter der Tafelrunde im Zentrum, und<br />
auf Schloss Hallwyl dreht sich alles um<br />
die Suche nach dem sagenumwobenen<br />
Gral, um Merlin und die zauberhafte<br />
Anderswelt. In beiden Schlössern können<br />
sich die Besucher mit Brettspielen, PC
Games, MiniKinos und Leseecken noch<br />
weiter in dieses spannende Thema vertiefen.<br />
Das Ausstellungsprojekt entstand<br />
in Kooperation mit dem Schweizerischen<br />
Institut für Kinder und Jugendmedien<br />
SIKJM, Zürich.<br />
Mächtig sei er gewesen, gütig und tugendhaft.<br />
Mit Hilfe des magischen Schwertes<br />
Excalibur schlug er härter zu als jeder<br />
andere: Artus, der Held und weise König,<br />
der in seiner Burg Camelot die besten<br />
Ritter Britanniens versammelte und<br />
erfolgreich alle Eindringlinge bekämpfte.<br />
So jedenfalls erzählen es die Sänger und<br />
Dichter über die Jahrhunderte. Doch wie<br />
kommt es, dass eineinhalb Jahrtausende<br />
danach die Geschichten um Artus noch<br />
immer weiterleben, obwohl dessen historische<br />
Existenz nicht einmal bewiesen<br />
ist? Selbst in Kinderzimmern des 21. Jh.<br />
ist er unter all den glänzenden Helden das<br />
unsterbliche Idol geblieben – in Sagenbüchern<br />
genauso wie in der neuesten<br />
FantasyLiteratur.<br />
Auf Schloss Lenzburg stehen die Ritter<br />
der Tafelrunde im Zentrum<br />
Besucherinnen und Besucher können<br />
sich an diese Tafel setzen und sich wie<br />
jene Ritter fragen, wo sie auf ihrem Lebensweg<br />
gerade stehen. Wer Ritter der<br />
Tafelrunde werden wollte, hatte allerlei<br />
Abenteuer zu bestehen und musste sich<br />
in Minne und Kampf bewähren. Da<br />
konnte es passieren, dass Ritter Krisen<br />
durchmachten und als wilde Männer<br />
durch Wälder irrten – bis es ihnen gelang,<br />
Liebe und Kampf in ihrem Leben zu<br />
versöhnen. Die alten und neuen Rittergeschichten<br />
sprechen vor allem die (jugendliche)<br />
Selbstfindung an. Die Themen sind<br />
mitten aus dem Leben gegriffen.<br />
Ausstellungsrundgang als ritterliche Aventiure<br />
Die Sonderausstellung spürt der Faszination<br />
um die ArtusSage nach. Sie besticht<br />
durch die Vielfalt an Darstellungen vom<br />
<strong>Mittelalter</strong> bis zu Comics des 21. Jh. und<br />
erzählt Geschichte(n). Neben wertvollen<br />
historischen Objekten werden aber auch<br />
Filme gezeigt, und in einem Raum stehen<br />
Spielkonsolen mit Computerspielen.<br />
Brettspiele und Leseecken mit ArtusLiteratur<br />
erlauben einen weiteren, vertieften<br />
Zugang zum ArtusStoff. Beim Rund<br />
gang durch die Ausstellung auf Schloss<br />
Lenzburg kann man die Abenteuer der<br />
Ritter selbst nachempfinden und so die<br />
Welt von Artus sozusagen von innen<br />
kennenlernen und merkt: Artus lebt und<br />
der Gral wurde noch immer nicht gefunden…?<br />
Das Sackmesser –<br />
ein Werkzeug wird Kult<br />
Forum für Schweizer Geschichte, Schwyz<br />
16.5.–18.10.<strong>2009</strong>, Di–So, 10–17 Uhr<br />
Bajonett, Coltello d’amore, Schweizerdolch,<br />
römisches Klappmesser<br />
Das rote Taschenmesser mit Schweizerkreuz,<br />
weltweit bekannt als «Schweizer<br />
Messer» oder «Swiss Army Knife», hat<br />
kulturgeschichtlich bedeutende Vorgänger.<br />
Die grosse Vielfalt an historischen<br />
Klappmessern aufzuzeigen, ist Ziel der<br />
in Zusammenarbeit mit dem Winterthurer<br />
Sammler Horst A. Brunner und<br />
der Firma Victorinox entstandenen Sonderausstellung.<br />
Angelegt als themenorientierter Parcours<br />
widmet sich die Ausstellung der Herkunft<br />
des Klappmessers. Sie greift das Thema<br />
Messer und Aberglaube auf, zeigt Sonderbarkeiten<br />
wie Pistolenmesser oder<br />
Sensationelles wie das grösste und das<br />
kleinste Taschenmesser. Die Ausstellung<br />
geht auf die Gründung der Messerfabrik<br />
Karl Elsener in Ibach bei Schwyz ein und<br />
beleuchtet, was heute Innovation im Bereich<br />
der Messerproduktion heisst. Zur<br />
Ausstellung gibt es eine Begleitbroschüre<br />
in 4Sprachen (ISBN 9783908025771).<br />
Vom 20.11.<strong>2009</strong> bis 25.4.2010 wird<br />
die Ausstellung im Château de Prangins<br />
(Genfersee) zu sehen sein.<br />
Form für Schweizer Geschichte, Hofmatt,<br />
Zeughausstr. 5, 6430 Schwyz<br />
Tel. 041 819 60 11<br />
www.sackmesserkult.ch<br />
Burgen 1:25. <strong>Mittelalter</strong> im Modell<br />
21.5.–18.10.<strong>2009</strong><br />
LVRLandesMuseum Bonn<br />
Colmantstr. 14–16, D53115 Bonn<br />
Di, Do, Fr, Sa, 10–18 Uhr<br />
Mi, 10–21 Uhr<br />
So, 10–18 Uhr<br />
Mo geschlossen<br />
Veranstaltungen<br />
Miniaturwelten locken jedes Jahr hunderttausende<br />
Modellbaufans, <strong>Mittelalter</strong>märkte<br />
mobilisieren genauso viele<br />
Geschichtsfans. Ab dem 21. Mai <strong>2009</strong><br />
bietet das LVRLandesMuseum Bonn das<br />
<strong>Mittelalter</strong> in Miniatur. An einem einzigen<br />
Tag und einem einzigen Ort lassen<br />
sich Burgen, Basare und Bastionen sowie<br />
ein Hafen samt Kreuzfahrerschiffen erobern.<br />
Die einzigartigen Modelle wurden im<br />
Massstab 1:25 von der Gesellschaft für<br />
Internationale Burgenkunde in Aachen<br />
e.V. erarbeitet. Die Zusammenschau im<br />
LVRLandesMuseum Bonn kombiniert<br />
sämtliche Highlights der zwei erfolgreichen<br />
Ausstellungen «Französische<br />
Donjons» sowie «Burgen und Basare der<br />
Kreuzfahrerzeit».<br />
Die historischen Momentaufnahmen sind<br />
voller Leben. So belagern zum Beispiel<br />
2500 Zinnritter – jeder einzelne durch<br />
Bewegung, Haltung und Bemalung ein<br />
Unikat – den legendären Donjon von<br />
Coucy mit der Ausrüstung, wie sie um<br />
1339 üblich war.<br />
Tausende Figuren rücken der 36 Quadratmeter<br />
großen Nachbildung der mächtigen<br />
JohanniterFestung Crac des Chevaliers<br />
zu Leibe. Die Szene zeigt die letzte<br />
Phase der Belagerung im Jahre 1271.<br />
Mineure haben die äusseren Burgmauern<br />
untergraben. Die Angreifer sind mit Belagerungsmaschinen<br />
und Leitern bis kurz<br />
vor die Kernburg vorgedrungen.<br />
Im 6 Quadratmeter grossen Hafen von<br />
Akkon können die Gedanken der Besucher<br />
mit einem Pilgerschiff aus der<br />
Flotte Ludwig IX. von 1246 oder einer<br />
Galeere aus der Flotte von Karl von Anjou<br />
von 1274 in See stechen. Der Basar<br />
von Aleppo lädt mit seinen 750 Figuren<br />
auf 16 Quadratmetern zum «fantastischen»<br />
Mitfeilschen ein.<br />
Friedlich geht’s am Hofe Friedrichs II.<br />
rund um Castel del Monte zu, die als<br />
neuestes Modell am 9. Juni die Sammlung<br />
ergänzen wird. FigurenSzenen mit<br />
Christen und Muslimen zeigen die Toleranz,<br />
die am Hofe des Kaisers herrschte,<br />
der selbst inmitten seiner Falkner, Wissenschaftler<br />
und Gesandten aus Orient<br />
und Okzident dargestellt ist.<br />
Die Ausstellung kombiniert Spannung<br />
und Vermittlung von Wissen und bietet<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2 59
Veranstaltungen<br />
Attraktionen für Modellbau oder Ritterfans,<br />
Laien oder Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler. Im Mitmachbereich<br />
können alle Grossen und Kleinen selbst<br />
als Burgenbauer ans Werk gehen.<br />
Ergänzt wird die Sonderausstellung<br />
durch einen Rundgang durch die Dauerausstellung<br />
des LVRLandesMuseums<br />
Bonn mit seinen reichen Beständen zu<br />
Kunst und Kultur des <strong>Mittelalter</strong>s.<br />
Die Ausstellung ist gefördert durch Mittel<br />
des Landes NRW – Der Ministerpräsident<br />
des Landes NRW.<br />
Weitere Infos unter:<br />
www.landesmuseumbonn.lvr.de oder<br />
www.burgenkunde.de<br />
Tel.: +49 (0) 228 20700<br />
Fax: +49 (0) 228 2070299<br />
Ruine Belmont<br />
Samstag, 18.7.<strong>2009</strong><br />
9.00 Uhr<br />
Im Rahmen von «flimserstein.ch», dem<br />
Flimser Musikfestival vom 15. bis 21.7.09,<br />
findet auf Burgruine Belmont ein Morgenkonzert<br />
mit Anna Kellnhofer (Gesang)<br />
und Karen Marit Ehlig (Fidel) statt.<br />
Es erklingen Lieder aus der Tradition des<br />
deutschen Minnegesangs und beleuchten<br />
die Rolle der Frau, die Inspiration, Muse,<br />
Partnerin und Herrin war. Spannendes<br />
und Humorvolles aus der Zeit um 1450,<br />
der Zeit der Zerstörung der Burg, wird<br />
zu hören sein. Gleichzeitig erläutern Ritter<br />
aus der Zeit der Herren von Belmont<br />
(14. Jh.), dargestellt von Mitgliedern des<br />
<strong>Burgenverein</strong>s Graubünden, die Burgruine.<br />
Die Kinder können sich mit bereitgestellten<br />
Kleidern und Rüstungsteilen<br />
mittelalterlich einkleiden oder einrüsten<br />
lassen. Für die Grossen gibt es Kaffee<br />
und Gipfeli; Extrabus ab Post Waldhaus<br />
8.30 Uhr, ab Post Flims 8.35 Uhr.<br />
www.flimserstein.ch<br />
60 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
Europäischer Tag des Denkmals<br />
Journées européennes<br />
du patrimoine<br />
Giornate europee del patrimonio<br />
Am Wasser, Au fil de l’eau,<br />
Al bordo dell’acqua.<br />
12./13.9.<strong>2009</strong><br />
In der Schweiz findet am 2. Wochenende<br />
im September traditionell der Europäische<br />
Tag des Denkmals ETD statt.<br />
Im gleichen Monat wird er auch in den<br />
meisten anderen europäischen Ländern<br />
durchgeführt.<br />
Er ist dem gebauten und kulturellen Erbe<br />
gewidmet, das sich am Wasser befindet<br />
oder in Beziehung zu dieser natürlichen<br />
Ressource steht. Das Wasser, Lebens und<br />
Energiespender, hat die Entstehung einer<br />
breiten Palette von Gebäudetypen für den<br />
Alltag, das Handwerk und die Industrie<br />
gefördert, die noch immer unsere Umgebung<br />
prägen.<br />
Entdecken Sie zum Beispiel die Suonen,<br />
die traditionellen Walliser Bewässerungsanlagen,<br />
und erfahren Sie vor Ort, welch<br />
wichtige Rolle sie bei der Entwicklung<br />
der Landwirtschaft sowie des sozialen<br />
Dorfgefüges gespielt haben. Fahrten mit<br />
historischen Schiffen auf Seen oder das<br />
Flanieren unter kundiger Führung auf<br />
den Quaianlagen des 19. Jh. gehören<br />
ebenso zum Angebot wie die Möglichkeit,<br />
sich ins Innere von Staudamm<br />
Mauern zu begeben oder die Geheimnisse<br />
des Jet d’eau in Genf zu entdecken. Das<br />
Programm wäre nicht vollständig ohne<br />
die Gelegenheit, historische Privathäuser<br />
zu besuchen, die ein Wochenende lang<br />
exklusiv ihre Türen und Tore öffnen.<br />
Vorträge, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen,<br />
Rahmenveranstaltungen für<br />
Familien oder der Fotowettbewerb für<br />
Kinder und Jugendliche «Expérience<br />
Photographique Internationale des Monuments<br />
EPIM» ergänzen die Palette der<br />
Veranstaltungen.<br />
Ab Ende Juli ist das komplette Programm<br />
unter www.hereinspaziert.ch zu<br />
finden. Sie können zudem die Programm<br />
Broschüre unter info@nikekultur.ch bestellen.<br />
Tradition oblige, les Journées européennes<br />
du patrimoine JEP se tiennent le<br />
deuxième weekend de septembre dans<br />
toute la Suisse et le reste du mois dans<br />
de nombreux pays européens.<br />
Elles sont consacrées au patrimoine bâti<br />
et culturel situé au fil de l’eau ou en lien<br />
avec cette ressource naturelle qui a donné<br />
naissance à une importante diversité<br />
architecturale et culturelle liée à la vie<br />
quotidienne, à l’artisanat et à l’industrie.<br />
Au fil de l’eau, vous pourrez découvrir<br />
les bisses valaisans qui pendant des décennies<br />
ont permis d’irriguer les cultures,<br />
de parcourir les voies navigables à<br />
bord de bateaux historiques, de flâner<br />
le long des quais construits à la fin du<br />
19 e siècle et de saisir l’importance de<br />
ceuxci pour le développement des villes,<br />
de vous promener à l’intérieur d’un barrage<br />
ou d’un réservoir d’eau, de connaître<br />
les secrets de fonctionnement du jet d’eau<br />
de Genève ou d’accéder à des demeures<br />
historiques en mains privées et ouvertes<br />
le temps d’un weekend.<br />
De nombreuses conférences, des podiums<br />
de discussions, des expositions,<br />
des animations pour enfants et la possibilité<br />
pour des jeunes jusqu’à 21 ans de<br />
participer au concours international de<br />
photographie intitulé Expérience Photographique<br />
Internationale des Monuments<br />
EPIM donneront la possibilité aux participants<br />
d’échanger des points de vue et<br />
des expériences.<br />
Le programme complet est accessible dès<br />
fin juillet <strong>2009</strong> sous www.venezvisiter.ch<br />
ou à travers la brochure que vous pouvez<br />
commander gratuitement par courriel<br />
sous info@nikekultur.ch<br />
www.hereinspaziert.ch<br />
www.venezvisiter.ch<br />
www.venitevedere.ch
Vereinsmitteilungen<br />
<strong>Schweizerischer</strong> <strong>Burgenverein</strong>,<br />
Jahresbericht 2008<br />
Wissenschaftliche Tätigkeit<br />
Tagungen<br />
Die Jahresversammlung 2008 fand in<br />
Bischofszell statt und war mit einer Besichtigung<br />
der spätmittelalterlichen Brücke<br />
und einer Führung durch die Altstadt<br />
verbunden, wobei der Stadtammann u.a.<br />
aktuelle Fragen der Siedlungsentwicklung<br />
thematisierte. Zuvor hatten sich die Mitglieder<br />
des SBV in der Gemeinde Kradolf<br />
Schönenberg über das Erhaltungskonzept<br />
für die Ruine Last und das Vermittlungsangebot<br />
mit dem Ruinenweg informieren<br />
lassen. Die Sonntagsexkursion, die wie<br />
bereits die Führungen am Vortag vom<br />
Thurgauer Kantonsarchäologen Dr.Hansjörg<br />
Brem geleitet wurde, führte u.a. ins<br />
ehemalige Städtchen Bürglen und auf die<br />
neu restaurierte Ruine Castels bei Tägerwilen.<br />
Vorträge<br />
Der SBV veranstaltet jeweils im Winterhalbjahr<br />
in Zürich eine öffentliche<br />
Vortragsreihe. Zum Abschluss der Reihe<br />
2007/2008 berichtete der Bauforscher<br />
Peter Albertin, Winterthur, über seine<br />
Untersuchungen am Schloss Vaduz. Das<br />
Programm 2008/09 eröffnete Dr. Bruno<br />
Meyer, Baden, aus Anlass des Jubiläumsjahrs<br />
mit einem Referat zu den Habsburgern,<br />
dem Aargau und den Eidgenossen<br />
im <strong>Mittelalter</strong>. Im zweiten Vortrag präsentierte<br />
Dr. Armand Baeriswyl neue stadtarchäologische<br />
Forschungen im Kanton<br />
Bern.<br />
Exkursionen<br />
Der SBV führte neben der Jahresversammlung<br />
drei Exkursionen durch.<br />
Neben einer Führung durch Stadt und<br />
Schloss Rapperswil standen ein Besuch<br />
der Festung Magletsch (1940–1996) und<br />
der Burgruine Wartau sowie eine mehrtägige<br />
Exkursion ins Aostatal mit Führungen<br />
in mehreren bedeutenden Burganlagen<br />
auf dem Programm.<br />
Projekte<br />
Im Zusammenhang mit der Herausgabe<br />
der vollständig überarbeiteten Neuauflage<br />
der Burgenkarte der Schweiz 2007<br />
erhielt der Schweizerische <strong>Burgenverein</strong><br />
den Auftrag, im Rahmen der Revision<br />
des Schweizerischen Inventars der Kulturgüter<br />
die Liste der Burgen von nationaler<br />
Bedeutung zu überprüfen, einen<br />
Vorschlag der national einzustufenden<br />
Anlagen sowie die zum Inventar gehörigen<br />
Beschreibungen zu liefern. Für die<br />
Erarbeitung eines Vorschlags zur nationalen<br />
Einstufung setzte der SBV eine<br />
Arbeitsgruppe von Burgenexperten ein.<br />
Die Arbeit für das Inventar konnte Mitte<br />
2008 abgeschlossen werden.<br />
Publikationen<br />
In die Monographienreihe «Schweizer<br />
Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie<br />
des <strong>Mittelalter</strong>s» wurde 2008<br />
als Band 35 eine Arbeit von Thomas<br />
Reitmaier über vorindustrielle Lastsegelschiffe<br />
in der Schweiz aufgenommen. Für<br />
<strong>2009</strong> ist die Herausgabe der Beiträge des<br />
Kolloquiums «Geschichte und Archäologie<br />
– disziplinäre Interferenzen», das<br />
der Arbeitskreis für Stadtgeschichte im<br />
Februar 2008 in Zürich durchgeführt<br />
hatte, vorgesehen. Weitere Bände sind in<br />
Planung.<br />
Die Zeitschrift «<strong>Mittelalter</strong> – Moyen Age<br />
– Medioevo – Temp medieval» umfasst<br />
im Berichtsjahr wiederum vier Hefte<br />
mit insgesamt 176 Seiten. Heft 1 enthält<br />
Beiträge zu Ringgenberg, u.a. zur bauarchäologischen<br />
Untersuchung und zur<br />
2008 abgeschlossenen Restaurierung.<br />
Heft 2 war wie üblich dem Tagungskanton<br />
der Jahresversammlung gewidmet<br />
und beinhaltet verschiedene Artikel zur<br />
Burgenforschung und Burgenkonservierung<br />
im Thurgau, u.a. zur Burgruine<br />
Castels sowie zu den Schlössern Hagenwil<br />
und Frauenfeld. Heft 3 umfasst einen<br />
Beitrag zum Schloss Ripaille am Genfersee<br />
und dessen Neugestaltung um 1900<br />
im Zeichen von Art Nouveau und Heimatstil<br />
sowie einen Artikel über stadtarchäologische<br />
Untersuchungen in Lutry.<br />
Zwei Beiträge zur Burg bzw. zum Schloss<br />
Vereinsmitteilungen<br />
Birseck (Arlesheim BL), einerseits zu<br />
den bauarchäologischen Untersuchungen,<br />
andererseits zum Wiederaufbau der<br />
Ruine als Inszenierung für den englischen<br />
Garten der Ermitage sind in Heft 4 publiziert.<br />
Internationale Beziehungen<br />
Der SBV pflegt u.a. im Rahmen von<br />
Schriftentausch den Kontakt mit verschiedenen<br />
ausländischen Vereinigungen.<br />
Verschiedene Vorstandsmitglieder<br />
besuchten Tagungen im Ausland, hielten<br />
Referate oder haben Einsitz in Vorständen<br />
fachverwandter ausländischer Vereinigungen.<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Einen wichtigen Platz in der Öffentlichkeitsarbeit<br />
nimmt die Homepage ein,<br />
auf der neu die in der Zeitschrift «<strong>Mittelalter</strong><br />
– Moyen Age – Medioevo – Temp<br />
medieval» publizierten Beiträge in digitaler<br />
Form greifbar sind. Zudem wurden<br />
die Arbeiten für eine Erweiterung der<br />
Website, die sich speziell an ein jüngeres<br />
Publikum richten soll, wieder aufgenommen.<br />
Wie in den vergangenen Jahren<br />
präsentierte sich der SBV an einem<br />
öffentlichen Anlass, am Burgfest in Ringgenberg,<br />
das zum Abschluss der Konservierung<br />
veranstaltet wurde.<br />
Renata Windler<br />
Einladung zur Jahresversammlung<br />
vom 29./30. August <strong>2009</strong><br />
in Thun/Steffisburg<br />
Samstag, 29.8.<strong>2009</strong><br />
<strong>Mittelalter</strong>liche Burg – patrizischer Herrschaftssitz<br />
– Mehrfamilienhaus<br />
Führung: Lilian Raselli, Museumsleiterin,<br />
Armand Baeriswyl<br />
Die Exkursion beginnt mit dem Besuch<br />
der mittelalterlichen Burg Thun, die um<br />
1200 von Herzog Bertold V. von Zähringen<br />
errichtet wurde. Nachmittags findet<br />
ein Rundgang durch das im Grundriss<br />
noch vom <strong>Mittelalter</strong> geprägte Städtchen<br />
Thun statt.<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2 61
Vereinsmitteilungen<br />
Danach fahren wir nach Steffisburg zum<br />
Grossen Höchhus. An diesem Bau betrachten<br />
wir den Wandel von der kleinen<br />
mittelalterlichen Burg «Stevenburc» zum<br />
patrizischen Herrschaftssitz. Das Grosse<br />
Höchhus wurde im 15. und frühen 16. Jh.<br />
in zwei Etappen ausgebaut. Ende des<br />
16. Jhs. kam das Haus in die Hand<br />
der Gemeinde, die es in ein Mehrfamilienhaus<br />
verwandelte. In dieser Form<br />
überdauerte es die Jahrhunderte, auch<br />
tiefgreifende Umbauten des 20. Jh. Seit<br />
der eben erst beendeten Gesamtsanierung<br />
erscheint das Höchhus wieder in<br />
seiner alten Pracht. Im Dachgeschosssaal<br />
des Grossen Höchhuses wird die Jahresversammlung<br />
des Vereins durchgeführt.<br />
Programm<br />
Anreise:<br />
Basel ab 8.28 Uhr<br />
Bern ab 9.35 Uhr<br />
Zürich ab 8.32 Uhr (Bern umsteigen)<br />
Thun an 9.52 Uhr (für alle)<br />
10.30 Uhr:<br />
Treffpunkt Schloss Thun<br />
Führung durch Schloss und Kirche<br />
(Liliane Raselli / Armand Baeriswyl)<br />
12.00 Uhr:<br />
Freies Mittagessen in Thun<br />
13.30 Uhr:<br />
Treffpunkt Rathaus<br />
Führung durch die Altstadt Thun<br />
15.00 Uhr:<br />
Bahnhofplatz Thun,<br />
Transfer nach Steffisburg<br />
LinienBus 15.09 Uhr ab<br />
15.18 Uhr:<br />
Steffisburg Platz an<br />
15.30 Uhr:<br />
Treffpunkt Höchhus<br />
Führung durch Kirche Steffisburg<br />
und Höchhus<br />
17.00 Uhr:<br />
Jahresversammlung Höchhus Steffisburg,<br />
Höchhausweg 17<br />
anschliessend Apéro<br />
19.00 Uhr:<br />
Gemeinsames Nachtessen im Höchhus<br />
22.00 Uhr:<br />
Organisierte Rückfahrt nach Thun<br />
62 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
Sonntag, 30.8.<strong>2009</strong><br />
Frühneuzeitliche Landsitze und Campagnen<br />
im Raum Bern–Thun<br />
Führung: Jürg Schweizer, ehem. kant.<br />
Denkmalpfleger, Armand Baeriswyl<br />
Seit dem 15. Jh. wechselte eine erhebliche<br />
Zahl von kleineren Herrschaften aus dem<br />
Ministerialadel (Niederadel) in die Hand<br />
von aufstrebenden stadtbernischen Familien.<br />
Zur Demonstration ihrer politischen<br />
und wirtschaftlichen Macht liessen diese<br />
Stadtbürger die verfallenden mittelalterlichen<br />
Burgenzuzeitgemässen Landsitzen<br />
um oder ausbauen. Dabei kam es zu<br />
unterschiedlichen architektonischen Lösungen.<br />
Wurde im einen Fall die mittelalterliche<br />
Bausubstanz mehr oder weniger<br />
sichtbar gelassen und mit zeitgemässen<br />
Wohnbauten umgeben, wurde sie im<br />
zweiten Fall teilweise abgetragen und in<br />
den Wohnbau integriert. Im dritten Fall<br />
verschwand der mittelalterliche Vorgänger<br />
ganz und an seine Stelle trat ein Neubau,<br />
im vierten entstand das neue Schloss<br />
neben der mittelalterlichen Anlage, die<br />
man einfach stehen liess. Wir werden drei<br />
dieser Landsitze aus dem 16., 17. und<br />
18. Jh. besuchen:<br />
Schloss Burgistein ist eine gewachsene<br />
Schlossanlage in landschaftlich grossartiger<br />
Lage. Die Burg des 13. Jh. ist verschwunden,<br />
an ihrer Stelle erhebt sich<br />
die heutige Anlage mit architektonischen<br />
Hauptelementen des 15. und 16. Jh. sowie<br />
wertvoller Ausstattung. Der Erker<br />
und eine Loggia auf Rundbogen geben<br />
dem Hof sein in der bernischen Architekturgeschichte<br />
einmaliges Gesicht.<br />
Das Hofgut Gümligen ist in seiner Gesamtanlage<br />
mit der Verschmelzung von<br />
Architektur und Gartengestaltung eine<br />
Schöpfung des bernischen Spätbarocks,<br />
ein um 1745 für Beat Fischer errichteter<br />
Neubau an der Stelle des mittelalterlichen<br />
Hofguts des unmittelbar daneben gelegenen<br />
Schlosses Gümligen. Aussergewöhnlich<br />
ist die illusionistische Bemalung der<br />
Hoffassaden.<br />
Der Bautenkomplex mit dem Alten und<br />
Neuen Schloss Oberdiessbach zeigt in<br />
exemplarischer Weise die Entwicklung<br />
des Herrschaftshauses von der Burg zur<br />
Campagne. Das Neue Schloss entstand<br />
als Neubau einige Meter neben dem spätgotischen<br />
Alten Schloss (dessen mittelalterlicher<br />
Vorgänger als Höhenburg<br />
sich auf einem Hügel über der heutigen<br />
Schlossanlage erhob). Das neue Schloss<br />
ist ein Hauptwerk des bernischen Profanbaus<br />
(M. 17. Jh.) und der erste fran<br />
zösisch geprägte Landsitz in der Region.<br />
Die im ganzen Schloss erhaltenen Wandund<br />
Deckenverkleidungen gehören zu<br />
den wichtigsten Louis XIII und Louis<br />
XIVAusstattungen in der Schweiz.<br />
Programm<br />
8.45 Uhr:<br />
Treffpunkt Bahnhofplatz Thun, Carparkplatz<br />
(Ankunft aus Basel, Zürich und Bern<br />
8.21/8.24 Uhr)<br />
9.15 Uhr:<br />
Schloss Burgistein (Privatbesitz)<br />
11.30 Uhr:<br />
Mittagessen in Gümligen,<br />
Restaurant acappella<br />
13.30 Uhr:<br />
Hofgut Gümligen (Privatbesitz)<br />
15.30 Uhr:<br />
Neues Schloss Oberdiessbach (Privatbesitz)<br />
Ca. 17.20 Uhr:<br />
Exkursionsende Bahnhof Thun<br />
Abfahrt Zug Richtung Bern, Basel und<br />
Zürich 17.33 bzw. 18.04 Uhr<br />
Regenschutz mitnehmen.<br />
Führungen:<br />
Dr. Armand Baeriswyl (Archäologischer<br />
Dienst Kanton Bern) und<br />
Dr. Jürg Schweizer (ehem. Denkmalpfleger<br />
Kanton Bern)<br />
Übernachtung:<br />
Die Reservation und Abrechnung für<br />
die Übernachtung vom 29. auf den<br />
30. August erfolgt direkt durch die Teilnehmenden.<br />
Bitte um rechtzeitige Zimmerreservation<br />
über ein Ihnen bekanntes<br />
Hotel oder über<br />
Thun TourismusOrganisation<br />
Bahnhof, Postfach 2582,<br />
CH3601 Thun<br />
Tel.: +41 (0)33 225 90 00<br />
Fax: +41 (0)33 225 90 09<br />
EMail: thun@thunersee.ch<br />
Tagungskosten:<br />
Exkursion Sa, 29.8.<strong>2009</strong> Fr. 30.–<br />
(Eintritt, Führungen, Transfer Thun<br />
Steffisburg)<br />
Nachtessen 29.8.<strong>2009</strong> Fr. 40.–<br />
Exkursion So, 30.8.<strong>2009</strong> Fr. 130.–<br />
(Exkursionsleitung, Fahrt und Mittagessen<br />
exkl. Getränke)<br />
Für die Anmeldung zum Programm vom<br />
Samstag und/oder Sonntag benützen Sie<br />
bitte den beiliegenden Anmeldetalon. Mit<br />
der Teilnahmebestätigung erhalten Sie<br />
die Rechnung für die Exkursionskosten.
Anmeldeschluss: Mittwoch, 19.8.<strong>2009</strong><br />
Anmeldung und weitere Informationen:<br />
Geschäftsstelle des Schweizerischen<br />
<strong>Burgenverein</strong>s, Blochmonterstrasse 22,<br />
4054 Basel<br />
Tel. 061 361 24 44<br />
Fax 061 363 94 05<br />
EMail: info@burgenverein.ch<br />
Für die Exkursion am Sonntag ist die Teilnehmerzahl<br />
auf 33 Personen beschränkt.<br />
Anmeldungen werden in der Reihenfolge<br />
des Posteinganges berücksichtigt.<br />
<strong>Schweizerischer</strong> <strong>Burgenverein</strong><br />
Jahresrechnung 2008<br />
Bilanz vom 31. Dezember 2008<br />
Traktanden der statutarischen Jahresversammlung<br />
vom 29. August <strong>2009</strong>,<br />
17.00 Uhr, im Höchhus Steffisburg BE<br />
1. Protokoll der Jahresversammlung<br />
2008* in Bischofszell<br />
2. Jahresbericht 2008 der Präsidentin<br />
3. Jahresrechnung/Bilanz 2008<br />
4. Festsetzen des Jahresbeitrages 2010<br />
5. Budget 2010<br />
6. Mitteilungen<br />
7. Verschiedenes<br />
Vereinsmitteilungen<br />
*) Eine Kopie des Protokolls der JV 2008<br />
kann bei der Geschäftsstelle angefordert<br />
werden.<br />
Herbstexkursion<br />
25.–27. September <strong>2009</strong><br />
Puschlav und Veltlin in <strong>Mittelalter</strong><br />
und früher Neuzeit<br />
Das Puschlav<br />
Die Geschichte des Puschlavs als Seitental<br />
des Veltlins ist anfänglich eng verknüpft<br />
Ausgaben Fr. Einnahmen Fr.<br />
Tagungen, Vortragsreihe 1'762.40 Mitgliederbeiträge 105'706.75<br />
Zeitschrift "<strong>Mittelalter</strong>" 74'256.50<br />
Inventar Kulturgüter 55'910.40 Subventionen:<br />
Schiffsfunde 2008/35 100'867.10 - SAGW für Jahresgaben 24'000.00<br />
- SAGW für <strong>Mittelalter</strong> 22'000.00<br />
Auflösung Rückstellungen 0.00 - SAGW für Burgenkarte 0.00 46'000.00<br />
Burgenkalender 0.00<br />
Mobiliar, div. 1'346.65 Zahlungen für "<strong>Mittelalter</strong>" 16'250.59<br />
GV, Veranstaltungen 21'857.30 Freiwillige Beiträge/Spenden 1'000.00<br />
Filme, Fotos, Bibliothek 157.35 A.o. Ertrag 0.00<br />
Beiträge an Vereine 1'400.00 Sonderbeiträge Jahresgabe 32'000.00<br />
Miete Archivräume 5'796.60 Inventar EOS 59'085.00<br />
Versicherungen 294.00 Verkauf Jahresgaben + Burgenkarten 18'444.40<br />
Abgaben an Swisstopo (Burgenkarte) -12'720.70<br />
Allg. Unkosten: Bücherverkauf 7'781.95<br />
- Vorstand 3'402.25 Burgenfahrten, GV, Veranstaltungen 18'765.00<br />
- Saläre, Buchhaltung Eigenleistungen (inkl. Burgenkarten) 21'000.00<br />
Sekretariat 28'975.05 Zinsen + Kursdifferenzen -1'470.47<br />
- Bürospesen, Drucksachen, Verkauf Burgenkalender 102.00<br />
Porti, Telefon 7'634.17 Total Einnahmen 311'944.52<br />
- Werbung, Prospekte, Internet 7'629.50 47'640.97 Mehreinnahmen 2008 655.25<br />
Total Ausgaben 311'289.27 311'289.27<br />
Aktiven EUR Fr. Passiven Fr.<br />
Kassa ZH 642.55 Kreditoren 59'879.20<br />
Kassa BS 0.00 Rückstellung für Erhaltungsarbeiten 27'500.00<br />
Postcheck ZH 83'808.58 Rückstellung Jubiläumsspende 25'000.00<br />
Postcheck BS 9'843.46<br />
Postcheck Euro 17'466.86 25'994.18 Rückstellung für internationale<br />
Sparkonto UBS 4'303.38 Zusammenarbeit 5'000.00<br />
KK Th.B. (EUR Deutschl.) 823.83 1'226.02 Rückst. Jugendanlass 15'000.00<br />
Guthaben SAGW <strong>Mittelalter</strong> 2008 22'000.00 Rückst. Burgenkalender 0.00<br />
Guthaben SAGW Schiffsfunde 2008 24'000.00 Rückstellung Reorganisation<br />
Guthaben <strong>Mittelalter</strong> div. 6'800.00 und Werbung 27'500.00<br />
Guthaben Schiffsfunde div. 27'000.00 Trans. Passiven 31'689.25<br />
Debitoren 2'665.25<br />
Trans. Aktiven 807.00<br />
Verrechnungssteuer-Guthaben 144.66<br />
Vorräte Schriften 1.00 Eigene Mittel 1.1.2008 17'014.38<br />
Mobiliar und Einrichtungen 1.00 Mehreinnahmen 2008 655.25<br />
Burgruine Zwing Uri 1.00 Eigene Mittel 31.12.2008 17'669.63 17'669.63<br />
209'238.08 209'238.08<br />
<strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong>/2 63
Vereinsmitteilungen<br />
mit dem Los des südlichen Nachbarn.<br />
Sowohl die Besiedlung wie die Romanisierung<br />
und Christianisierung erfolgten<br />
von Süden her. Im <strong>Mittelalter</strong> war die<br />
Talschaft Poschiavo umstrittenes Gebiet<br />
zwischen den Bischöfen von Como und<br />
Chur. Die Talschaft Poschiavo schloss<br />
sich 1408 dem Gotteshausbund an und<br />
wurde damit Teil des Freistaats der Drei<br />
Bünde. Auch Reformation und Gegenreformation<br />
kamen von Süden und brachten<br />
dem Tal langandauernde Konflikte<br />
und Spannungen (Bündner Wirren, Veltliner<br />
Mord). 1803 trat das Puschlav mit<br />
dem neuen Kanton Graubünden in die<br />
Schweizerische Eidgenossenschaft ein<br />
und teilte von da an dessen Schicksal.<br />
Aus diesen Gründen beginnen wir die<br />
Exkursion mit einem Rundgang zu den<br />
Bau und Kunstdenkmälern in Poschiavo.<br />
Das Veltlin<br />
Das Veltlin ging im 8. Jh. durch eine<br />
Schenkung Karl des Grossen an die Abtei<br />
StDenis bei Paris. Die Landeshoheit<br />
blieb mehrheitlich beim Bischof von<br />
Como. Die Talschaften Chiavenna, Poschiavo<br />
und Bormio waren jedoch umstrittenes<br />
Gebiet zwischen den Bischöfen<br />
von Como und Chur. Vom 11. bis ins<br />
13. Jh. entstanden deshalb zahlreiche<br />
Burgen und Wohntürme als regionale<br />
und lokale Herrschaftszentren der beiden<br />
Konkurrenten. 1348 übernahm das Herzogtum<br />
Mailand das ganze Veltlin inklusive<br />
Chiavenna, Bormio und Poschiavo,<br />
wodurch einige der Burgen ihre Bedeutung<br />
verloren, andere aber erst in dieser<br />
Zeit entstanden.<br />
Schon 1486 versuchten die Drei Bünde<br />
die Kontrolle über das Veltlin zu erlangen.<br />
Im Jahr 1487 wurde Tirano durch<br />
die Bündner eingenommen und teilweise<br />
zerstört, worauf Herzog Ludovico il<br />
Moro den massiven Ausbau der Stadtbefestigung<br />
veranlasste. Erst 1512 gelang<br />
den Bündnern im Zuge der Mailänderkriege<br />
die Eroberung der drei Talschaften<br />
Chiavenna, Veltlin und Bormio, die in<br />
der Folge ein Untertanenland des Freistaates<br />
der Drei Bünde bildeten. Die zentrale<br />
Verwaltung der Bündner Untertanenlande<br />
lag in den Händen eines Gouverneurs,<br />
der in Sondrio residierte. In den<br />
einzelnen Terzieri des Veltlins übte je ein<br />
Podestà die Herrschaftsgewalt der Bünde<br />
aus. Der einheimische Adel, der zu Zeiten<br />
der mailändischen Herrschaft die Verwaltung<br />
besetzt hatte, verschwand nicht<br />
ganz von der politischen Bühne, denn die<br />
unteren Posten der Verwaltung blieben<br />
seine Domäne. Einzelne Burgen oder<br />
64 <strong>Mittelalter</strong> 14, <strong>2009</strong> /2<br />
Wohntürme überlebten deshalb diese<br />
Zeit der Bündner Herrschaft. In den<br />
grösseren Orten wie Tirano bauten sich<br />
zudem die durch die Herrschaft reich gewordenen<br />
Bündner Familien teilweise<br />
beeindruckende Palazzi.<br />
Als Mailand 1535 habsburgisch wurde,<br />
erlangte das Veltlin für die damalige<br />
Weltmacht Habsburg höchste strategische<br />
Bedeutung als Verbindung zwischen<br />
Tirol und Oberitalien. Dementsprechend<br />
versuchten die Habsburger das Veltlin<br />
in ihren Machtbereich einzugliedern. In<br />
der Zeit der Reformation blieb das Veltlin<br />
mehrheitlich katholisch, während in<br />
einigen Teilen der Drei Bünde sich die<br />
Reformation ausbreitete. Den daraus<br />
resultierenden konfessionellen Konflikt<br />
zwischen katholischen Untertanen und<br />
reformierten Bündner Herren versuchten<br />
sich die katholischen Habsburger nutzbar<br />
zu machen, insbesondere während<br />
des Dreissigjährigen Kriegs. Im «Veltliner<br />
Mord» wurden 1620 reformierte<br />
Familien im Veltlin ermordet und damit<br />
die Reformation gestoppt. Die Bündner<br />
verloren daraufhin bis 1639 die Kontrolle<br />
über das aufständische Veltlin an<br />
Spanien. Nachdem die Bündner auf die<br />
habsburgische Seite gewechselt waren,<br />
gaben ihnen die Spanier das Veltlin wieder<br />
zurück. Conrad Ferdinand Meyer<br />
verarbeitet diese Auseinandersetzungen<br />
in seinem Roman «Jürg Jenatsch».<br />
Am Samstag besuchen wir Kirchen und<br />
Burgen zwischen Tirano und Grosio<br />
(Madonna di Tirano, Palazzi in Tirano<br />
und Mazzo, die beiden Burgruinen von<br />
Grosio/Grosotto und div. Wohntürme).<br />
Für den Sonntag ist ein Besuch in Teglio<br />
(diese Ortschaft gab dem Tal den Namen)<br />
und Sondrio vorgesehen, mit einem Abstecher<br />
zur Doppelburg von Grumello.<br />
Sonntag um 16 Uhr endet die Exkursion<br />
in Poschiavo, so dass die Teilnehmenden<br />
noch genügend Zeit zur Rückkehr ins<br />
Unterland haben.<br />
Freitag, 25.9.<strong>2009</strong><br />
Individuelle Anreise nach Poschiavo<br />
15.15 Uhr:<br />
Treffpunkt Piazza Poschiavo<br />
Rundgang durch Poschiavo<br />
19.00 Uhr:<br />
Gemeinsames Nachtessen<br />
(21.35 Uhr: Letzte Ankunftsmöglichkeit<br />
für Teilnehmende)<br />
Samstag, 26.9.<strong>2009</strong><br />
8.30 Uhr:<br />
Treffpunkt Bahnhof Poschiavo<br />
Fahrt mit Bus ins Veltlin<br />
(Tirano, Mazzo, Grosio, Serravalle)<br />
Mittagessen unterwegs<br />
18.00 Uhr:<br />
Rückkehr nach Poschiavo<br />
und individuelles Nachtessen<br />
Sonntag, 27.9.<strong>2009</strong><br />
8.30 Uhr:<br />
Treffpunkt Bahnhof Poschiavo<br />
Fahrt mit Bus ins Veltlin<br />
(Teglio, Sondrio, Grumello)<br />
Mittagessen unterwegs<br />
16.00 Uhr:<br />
Zurück in Poschiavo<br />
16.35 Uhr:<br />
Individuelle Rückreisemöglichkeit mit<br />
Bahn ab Poschiavo<br />
Änderungen im Programm vorbehalten.<br />
Wanderschuhe und Regenschutz mitnehmen.<br />
Reisekosten: 375.– pro Person<br />
Darin inbegriffen sind: Busfahrten,<br />
1 Nachtessen, 2 Mittagsverpflegungen,<br />
Eintritte, Reiseleitung und Reisedokumentation.<br />
Führungen:<br />
Dr. Hans Rutishauser (ehem. Denkmalpfleger<br />
Kanton Graubünden)<br />
Übernachtung:<br />
Die Reservation und Abrechnung für<br />
die Übernachtung vom 25.–27.9.<strong>2009</strong><br />
erfolgt direkt durch die Teilnehmenden.<br />
Bitte um rechtzeitige Zimmerreservation<br />
bei<br />
Ente Turistico Valposchiavo<br />
7742 Poschiavo<br />
Tel. 081 844 05 71<br />
Fax 081 844 10 27<br />
info@valposchiavo.ch<br />
www.valposchiavo.ch<br />
Anmeldeschluss:<br />
Freitag, 4.9.<strong>2009</strong> (Poststempel)<br />
Anmeldung und weitere Informationen:<br />
Geschäftsstelle des Schweizerischen<br />
<strong>Burgenverein</strong>s, Blochmonterstrasse 22,<br />
4054 Basel<br />
Tel. 061 361 24 44<br />
Fax 061 363 94 05<br />
EMail: info@burgenverein.ch<br />
Teilnehmerzahl beschränkt auf 33 Personen,<br />
Anmeldungen werden in der Reihenfolge<br />
des Posteinganges berücksichtigt.
PUBLIKATIONEN DES SCHWEIZERISCHEN BURGENVEREINS<br />
Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des <strong>Mittelalter</strong>s (SBKAM)<br />
Band 1, 1974<br />
Werner Meyer, Alt-Wartburg im Kanton Aargau.<br />
Band 2, 1975 (vergriffen)<br />
Jürg Ewald (u.a.), Die Burgruine Scheidegg bei Gelterkinden.<br />
Band 3, 1976 (vergriffen)<br />
Werner Meyer (u.a.), Das Castel Grande in Bellinzona.<br />
Band 4, 1977 (vergriffen)<br />
Maria-Letizia Boscardin, Werner Meyer, Burgenforschung<br />
in Graubünden, Die Grottenburg Fracstein und ihre Ritzzeichnungen.<br />
Die Ausgrabungen der Burg Schiedberg.<br />
Band 5, 1978 (vergriffen)<br />
Burgen aus Holz und Stein, Burgenkundliches Kolloquium<br />
Basel 1977 − 50 Jahre <strong>Schweizerischer</strong> <strong>Burgenverein</strong>.<br />
Beiträge von Walter Janssen, Werner Meyer, Olaf Olsen,<br />
Jacques Renaud, Hugo Schneider, Karl W. Struwe.<br />
Band 6, 1979 (vergriffen)<br />
Hugo Schneider, Die Burgruine Alt-Regensberg im Kanton<br />
Zürich.<br />
Band 7, 1980 (vergriffen)<br />
Jürg Tauber, Herd und Ofen im <strong>Mittelalter</strong>.<br />
Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archäologischen<br />
Material vornehmlich der Nordwestschweiz (9.−14. Jahrhundert).<br />
Band 8, 1981 (vergriffen)<br />
Die Grafen von Kyburg. Kyburger Tagung 1980 in Winterthur.<br />
Band 9/10, 1982<br />
Jürg Schneider (u. a.), Der Münsterhof in Zürich. Bericht<br />
über die vom städtischen Büro für Archäologie durchgeführten<br />
Stadtkernforschungen 1977/78.<br />
Band 11, 1984<br />
Werner Meyer (u. a.), Die bösen Türnli. Archäologische<br />
Beiträge zur Burgenforschung in der Urschweiz.<br />
Band 12, 1986 (vergriffen)<br />
Lukas Högl (u.a.), Burgen im Fels. Eine Untersuchung<br />
der mittelalterlichen Höhlen-, Grotten- und Balmburgen<br />
in der Schweiz.<br />
Band 13, 1987<br />
Dorothee Rippmann (u. a.), Basel Barfüsserkirche.<br />
Grabungen 1975−1977.<br />
Band 14/15, 1988<br />
Peter Degen (u.a.), Die Grottenburg Riedfluh Eptingen BL.<br />
Band 16, 1989 (vergriffen)<br />
Werner Meyer (u.a.), Die Frohburg. Ausgrabungen<br />
1973−1977.<br />
Band 17, 1991<br />
Pfostenbau und Grubenhaus − Zwei frühe Burgplätze in der<br />
Schweiz. Hugo Schneider, Stammheimerberg ZH. Bericht<br />
über die Forschungen 1974−1977. Werner Meyer, Salbüel<br />
LU. Bericht über die Forschungen von 1982.<br />
Band 18/19, 1992<br />
Jürg Manser (u.a.), Richtstätte und Wasenplatz in Emmenbrücke<br />
(16.−19. Jahrhundert). Archäologische und historische<br />
Untersuchungen zur Geschichte von Strafrechtspflege und<br />
Tierhaltung in Luzern.<br />
Band 20/21, 1993/94<br />
Georges Descoeudres (u.a.), Sterben in Schwyz. Berharrung<br />
und Wandel im Totenbrauchtum einer ländlichen Siedlung<br />
vom Spätmittelalter bis in die Neuzeit. Geschichte − Archäologie<br />
− Anthropologie.<br />
Band 22, 1995<br />
Daniel Reicke, «von starken und grossen flüejen». Eine<br />
Untersuchung zu Megalith- und Buckelquader-Mauerwerk<br />
an Burgtürmen im Gebiet zwischen Alpen und Rhein.<br />
Band 23/24, 1996/97<br />
Werner Meyer (u.a.), Heidenhüttli. 25 Jahre archäologische<br />
Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum.<br />
Band 25, l998<br />
Christian Bader, Burgruine Wulp bei Küsnacht ZH.<br />
Band 26, 1999<br />
Bernd Zimmermann, <strong>Mittelalter</strong>liche Geschossspitzen.<br />
Typologie − Chronologie − Metallurgie.<br />
Band 27, 2000<br />
Thomas Bitterli, Daniel Grütter, Burg Alt-Wädenswil.<br />
Vom Freiherrenturm zur Ordensburg.<br />
Band 28, 2001<br />
Burg Zug. Archäologie – Baugeschichte – Restaurierung.<br />
Band 29, 2002<br />
Wider das «finstere <strong>Mittelalter</strong>» – Festschrift Werner Meyer<br />
zum 65. Geburtstag.<br />
Band 30, 2003<br />
Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung<br />
im <strong>Mittelalter</strong>. Archäologische und historische Studien zum<br />
Wachstum der drei Zähringerstädte Burgdorf, Bern und<br />
Freiburg im Breisgau.<br />
Band 31, 2004<br />
Gesicherte Ruine oder ruinierte Burg?<br />
Erhalten – Instandstellen – Nutzen.<br />
Band 32, 2005<br />
Jakob Obrecht, Christoph Reding, Achilles Weishaupt,<br />
Burgen in Appenzell. Ein historischer Überblick und Berichte<br />
zu den archäologischen Ausgrabungen auf Schönenbühl und<br />
Clanx.<br />
Band 33, 2006<br />
Reto Dubler, Christine Keller, Markus Stromer, Renata<br />
Windler, Vom Dübelstein zur Waldmannsburg. Adelssitz,<br />
Gedächtnisort und Forschungsprojekt.<br />
Band 34, 2007<br />
Georges Descoeudres, Herrenhäuser aus Holz. Eine mittelalterliche<br />
Wohnbaugruppe in der Innerschweiz.<br />
Band 35, 2008<br />
Thomas Reitmaier, Vorindustrielle Lastsegelschiffe in der<br />
Schweiz.
<strong>Mittelalter</strong> · Moyen Age ·<br />
Medioevo · Temp medieval,<br />
die Zeitschrift des Schweize-<br />
rischen <strong>Burgenverein</strong>s,<br />
veröffentlicht Ergebnisse<br />
aktueller Forschungen zur<br />
Kulturgeschichte und<br />
Archäologie des <strong>Mittelalter</strong>s<br />
in der Schweiz. Schwer-<br />
punkte bilden die Burgen-<br />
forschung,Siedlungsarchäo- logie sowie Untersuchungen<br />
zur mittelalterlichen Sach-<br />
kultur.<br />
ISSN 1420-6994<br />
<strong>Mittelalter</strong> · Moyen Age ·<br />
Medioevo · Temp medieval.<br />
La revue de l’Association<br />
Suisse Châteaux forts<br />
publie les résultats d’études<br />
menées en Suisse dans<br />
le domaine de l’archéologie<br />
et de l’histoire médiévales.<br />
Les travaux de castellologie<br />
et d’archéologie des habitats,<br />
ainsi que les études relatives<br />
à la culture matérielle,<br />
constituent ses principaux<br />
domaines d’intérêt.<br />
<strong>Schweizerischer</strong><br />
Association Suisse<br />
Associazione Svizzera<br />
Associaziun Svizra<br />
<strong>Mittelalter</strong> · Moyen Age ·<br />
Medioevo · Temp medieval,<br />
la rivista dell’Associazione<br />
Svizzera dei Castelli, pub-<br />
blica i risultati delle ricerche<br />
attuali in Svizzera nel campo<br />
della storia della cultura e<br />
dell’archeologia del medio-<br />
evo. I punti focali sono la<br />
ricerca concernente i castelli,<br />
le indagini archeologiche<br />
degli insediamenti come<br />
anche lo studio della cultura<br />
medioevale.<br />
<strong>Burgenverein</strong><br />
Châteaux forts<br />
dei Castelli<br />
da Chastels<br />
<strong>Mittelalter</strong> · Moyen Age ·<br />
Medioevo · Temp medieval,<br />
la revista da l’Associaziun<br />
Svizra da Chastels, publi-<br />
tgescha ils resultats da<br />
perscrutaziuns actualas<br />
davart l’istorgia culturala e<br />
l’archeologia dal temp<br />
medieval en Svizra. Ils<br />
accents da la revista èn la<br />
perscrutaziun da chastels,<br />
l’archeologia d’abitadis<br />
e las retschertgas davart la<br />
cultura materiala dal temp<br />
medieval.