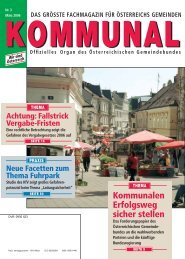Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 11C<br />
Nov. 2004<br />
DAS GRÖSSTE FACHMAGAZIN FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN<br />
KOMMUNAL<br />
Wir sind<br />
Österreich<br />
DVR: 0930 423<br />
Offizielles Organ des Österreichischen Gemeindebundes<br />
P.b.b. Verlagspostamt · 1014 Wien 02 Z 032902M ISSN: 1605-1440<br />
THEMA<br />
Knalleffekt zu Beginn des <strong>Kommunal</strong>-Kongresses<br />
Finanzausgleich<br />
Einigung<br />
Mitten in die Eröffnung des <strong>Kommunal</strong>-Kongresses platzte<br />
die befreiende Nachricht: Der Finanzausgleich steht!<br />
Buchstäblich in letzter Minute einigten sich Bund und<br />
Länder auf ein Gesundheitspaket<br />
KOMMUNAL bringt die Details der Verhandlungen:<br />
Gemeinden gewinnen praktisch „durch die Bank“<br />
ab SEITE 9<br />
KOMMUNALMESSE / Public Services<br />
Riesenerfolg<br />
Lebensminister Josef Pröll<br />
eröffnete KOMMUNALMESSE<br />
Größte kommunale Fachmesse<br />
zum zweiten Mal in Wien<br />
Über 200 Aussteller aus elf<br />
Ländern auf 15.000 m2 ab SEITE 57
Sie haben die Präsentation<br />
per E-Mail geschickt?<br />
E-Mail geht heut aber nicht.<br />
Manager mit messerscharfem Verstand<br />
sind auf jede Situation vorbereitet.<br />
Zum Beispiel mit dem Victorinox<br />
USB-Taschenmesser. Das hat nicht nur<br />
Schere und Nagelfeile, sondern einen<br />
128 MB USB-Speicher. Genug Platz<br />
für Audio-Videodateien oder ganze<br />
Firmenpräsentationen. Jetzt mit dem<br />
3-Monats-Abo vom WirtschaftsBlatt.<br />
Bestellen Sie mit dem Kennwort<br />
„<strong>Kommunal</strong>“ unter 01/60 117-242 oder<br />
per E-Mail: abo@wirtschaftsblatt.at.<br />
Sie haben es in der Hand.<br />
3 Monate<br />
WirtschaftsBlatt<br />
+<br />
Victorinox USB<br />
Taschenmesser<br />
um nur<br />
€ 99,–<br />
Die Zusendung des Taschenmessers erfolgt nach verbuchtem Zahlungseingang und solange der Vorrat reicht. Nicht auf bestehende Abos anrechenbar.
ab Seite 57 Die Highlights<br />
KOMMUNAL<br />
THEMEN<br />
Gemeindepolitik<br />
6 Finanzausgleich: Die Vernunft hat gesiegt<br />
8 Postämter: Gemeindebund droht mit Klagen<br />
9 Finanzausgleich: Einigung in letzter Minute –<br />
Die Katastrophe wurde abgewendet<br />
11 Die Details zum neuen Finanzausgleich<br />
16 <strong>Kommunal</strong>net: Start in eine europaweit<br />
einzigartige Zukunft<br />
24 Preis der Kommunen 2004 verliehen<br />
Recht & Verwaltung<br />
18 Adress-GWR-Online: Meldeschiene der Zukunft<br />
21 Vergaberecht „light“: Entlastung für Gemeinden<br />
Gemeindefinanzen<br />
14 Gemeindeertragsanteile: 2,1 Prozent mehr sind<br />
gute Zuwächse für die Gemeinden<br />
Europapolitik<br />
28 Neue Europa-Initiative für den Gewässerschutz:<br />
Hochwasserschutz kennt keine Grenzen<br />
32 Kommune 2015: 10 Thesen sollen die<br />
kommunale Wettbewerbsfähigkeit steigern<br />
Alles über die KOMMUNALMESSE/Public<br />
Services 2004 – Die Firmen – Die Produkte –<br />
Der große Messerundgang<br />
KOMMUNAL<br />
KONGRESS<br />
43 5 Seiten Bericht über die Gemeindebund-Tagung<br />
zu „Katastrophenschutz – Katastrophenbewältigung“<br />
49 Das Projekt MeteoRisk<br />
52 Die „Flood Risk Studie“<br />
54 Feuerwehrauszeichnungen<br />
KOMMUNAL<br />
MESSE KOMMUNAL<br />
KOMMUNAL<br />
CHRONIK<br />
112 Geschichte für Gemeinden: Baustein<br />
für ein Marketing-Konzept<br />
115 Österreichs jüngster Bürgermeister:<br />
In der Ruhe liegt die Kraft<br />
118 Aus den Bundesländern<br />
122 Der Südtioler Gemeindenverband<br />
Inhalt<br />
KOMMUNAL 3
Eine exklusive Nacht oder doch...<br />
CDO-ET CDO-TT<br />
....ein ganz besonderer Tag?<br />
Mehr Lebensqualität und Wohlbefinden<br />
- perfektes Ambiente durch<br />
weißes, tageslichtähnliches<br />
Licht der MASTER CDO<br />
MASTER City White CDO-ET & -TT.<br />
Die MASTER CDO Lampen von Philips schaffen eine einzigartige<br />
Atmosphäre unter wirtschaftlichen Bedingungen - z.B. durch eine<br />
sehr lange mittlere Lebensdauer, eine extrem niedrige<br />
Frühausfallrate oder durch eine sehr hohe Farbstabilität über die<br />
gesamte Lebensdauer.<br />
Noch Fragen?<br />
Service-Nummer: 0810 - 001 098
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Österreichischer Gemeindebund,<br />
Löwelstraße 6, 1010 Wien<br />
Medieninhaber:<br />
Österreichischer <strong>Kommunal</strong>-Verlag GmbH.,<br />
Löwelstr. 6/5, Pf. 201,1014 Wien,<br />
Tel. 01/532 23 88,<br />
Fax 01/532 23 77,<br />
E-Mail:kommunalverlag@kommunal.at<br />
Geschäftsführung:<br />
Bgm. a.D. Prof. Walter Zimper<br />
Walter Zimper jun.<br />
Sekretariat: Patrizia Poropatits<br />
E-Mail: patrizia.poropatits@kommunal.at<br />
www.kommunal.at<br />
Redaktion:<br />
Mag. Hans Braun - DW 16 (Leitung)<br />
Walter Grossmann - DW 15<br />
Tel.: 01/ 532 23 88<br />
e-mail: redaktion@kommunal.at<br />
Anzeigenberatung:<br />
Tel.: 01/532 23 88<br />
Johanna K. Ritter – DW 11 (Leitung)<br />
johanna.ritter@kommunal.at<br />
Mag. Sabine Brüggemann – DW 12<br />
sabine.brueggemann@kommunal.at<br />
Franz Krenn – DW 13<br />
franz.krenn@kommunal.at<br />
Gerhard Klodner – DW 14<br />
gerhard.klodner@kommunal.at<br />
Grafik:<br />
Österreichischer <strong>Kommunal</strong>-Verlag GmbH.,<br />
Ernst Horvath<br />
grafik@kommunal.at<br />
Fotos: Bilder-Box<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Mag. Ewald Buschenreiter (Verbandsdirektor<br />
der sozialdemokratischen Gemeindevertreter NÖ),<br />
Mag. Nicolaus Drimmel<br />
(Österreichischer Gemeindebund),<br />
Dr. Gustav Fischer (BM für Land- und Forstwirtschaft,<br />
Umwelt und Wasserwirtschaft),<br />
Mag. Michael Girardi (BM für Inneres),<br />
Gerald Grosz (BM für soziale Sicherheit und<br />
Generationen),<br />
Dr. Roman Häußl (Experte f. Gemeinderecht),<br />
Dr. Robert Hink (Generalsekretär des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Mag. Christoph Hörhan (BM für<br />
Gesundheit und Frauen),<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer (Präsident des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Dietmar Pilz (Finanzexperte des<br />
Österreichischen Gemeindebundes),<br />
Univ. Prof. Dr. Reinbert Schauer<br />
(Johannes Kepler-Universität Linz),<br />
Mag. Barbara Schüller (Bundeskanzleramt)<br />
Prof. Walter Zimper (Verleger),<br />
Walter Zimper jun. (Geschäftsführer).<br />
Hersteller:<br />
Leykam, Wr. Neustadt<br />
Persönlich gezeichnete Artikel fallen unter die<br />
Verantwortlichkeit des Autors und müssen<br />
sich nicht unbedingt mit der Meinung von<br />
KOMMUNAL decken.<br />
Mit E.E. gekennzeichnete Artikel sind bezahlte<br />
Wirtschaftsinfos und fallen nicht in die Verantwortlichkeit<br />
der Redaktion.<br />
Druckauflage:<br />
35.199 (Halbjahresschnitt 2004)<br />
Teilen dieser Ausgabe liegen Informationen<br />
der Firma RKM Rasenpflege & <strong>Kommunal</strong>maschinen<br />
sowie dem Forum<br />
Mobilkommunikation bei.<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Editorial<br />
Die Regie des Zufalls hätte nicht besser inszeniert werden können und hinterlässt<br />
eine tiefe Symbolik: Mitten in die Eröffnung der größten <strong>Kommunal</strong>messe Österreichs<br />
platzte die befreiende Nachricht, dass die politischen Querelen um den<br />
neuen Finanzausgleich beendet werden konnten und Österreichs Gemeinden ab<br />
dem nächsten Jahr tatsächlich mit einer spürbaren Verbesserung ihrer finanziellen<br />
Situation rechnen können.<br />
Diese Nachricht erleichterte die <strong>Kommunal</strong>politiker ebenso wie die Vertreter der<br />
Wirtschaft, die zu Recht hoffen, dass ihre hervorragenden kommunalen Produkte<br />
und Dienstleistungen in Hinkunft wieder verstärkt abgesetzt werden können. Das<br />
gemeinsame Aufatmen aber war sichtbarer Ausdruck des zwanghaften Umstandes,<br />
wonach sich das Wechselspiel zwischen Kommunen und Wirtschaft exakt so verhält<br />
wie die natürliche Gegenläufigkeit von kommunizierenden Gefäßen: was in einem<br />
abgeht, das füllt das andere.<br />
Mit KOMMUNAL stehen wir in der Mitte dieses Geschehens und helfen mit, das<br />
Funktionieren dieser Wechselhaftigkeit aufrecht zu erhalten. Sowohl unser Magazin<br />
als auch die gemeinsam mit REED-Messen veranstaltete Leistungsschau im<br />
neuen Wiener Messezentrum sind die mit Abstand größten Anbieter in diesem<br />
Branchensegment unserer Republik. Die erfolgreiche Bündelung dieser Kräfte mit<br />
den Interessen des Österreichischen Gemeindebundes, den Anliegen der europäischen<br />
Eurocities, der Wiener MA 48 und der österreichischen Abfallwirtschaft oder<br />
auch der Einsatzorganisationen wie Feuerwehr und Rotes Kreuz schafft die Einmaligkeit<br />
dieser Ereignisse und die unnachahmlichen Chancen für alle Beteiligten.<br />
Daher ist das Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen 2004 nicht nur ein<br />
erfreuliches Resultat für Österreichs Gemeinden, sondern ein wichtiger Beitrag für<br />
die notwendige Stärkung der gesamten Wirtschafts- und Leistungskraft unseres<br />
Landes. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass es nur die Gemeinden sind, die<br />
als größter öffentlicher Investor eine flächendeckende Belebung unserer Wirtschaft<br />
und eine dezentrale Sicherung der Arbeitsplätze in allen Regionen sichern können.<br />
Dass auch die Verhandlungen um die Aufteilung der öffentlichen Mittel für die<br />
nächsten vier Jahre von diesen Überzeugungen geleitet waren, spricht für die<br />
Argumentationskraft der kommunalen Interessensvertreter ebenso wie für die<br />
Qualität des politischen Handelns in Österreich. Schlussendlich sind diese Überlegungen<br />
von allen Gebietskörperschaften und allen relevanten politischen Kräften<br />
dieser Republik geteilt worden und die kurzfristige Verzögerung erwies sich lediglich<br />
als mäßig taugliches Mittel politischer Taktik.<br />
Wenn allerdings im Rahmen des großen <strong>Kommunal</strong>kongresses in Wien zugleich<br />
über alle Aspekte des Katastrophenschutzes diskutiert und dabei die hohe Kompetenz<br />
der Kommunen für die Vorsorge, Verantwortung und Haftung bei Schadensereignissen<br />
hervorgestrichen wurde, dann war das gleichzeitig ein Beweis für die<br />
enorme politische Bedeutung der Gemeinden.<br />
Österreich ist in der glücklichen Lage, dass sich alle politisch Verantwortlichen des<br />
hohen Stellenwertes der lokalen Selbstverwaltung für Demokratie, Dezentralisierung,<br />
Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung bewusst sind und die Bevölkerung<br />
– wie aus allen Umfragen hervorgeht – die Arbeit unserer Bürgermeister<br />
und Gemeindevertreter sehr zu schätzen weiß. Europa ist in seiner Gesamtheit<br />
noch nicht ganz so weit, doch immerhin haben die Grundsätze dieser politischen<br />
Geistigkeit Eingang gefunden in den neuen Verfassungsentwurf der Union und in<br />
einer Charta des Europarates, die von den meisten Ländern unseres Kontinents<br />
bereits ratifiziert wurde.<br />
Österreich gilt schon lange als Pionier für eine starke Autonomie der Gemeinden.<br />
Es ist schön, dass es diese Rolle mit dem Ergebnis der FAG-Verhandlungen 2004<br />
wieder erfolgreich verteidigt hat.<br />
Prof. Walter Zimper<br />
Verleger und Vizepräsident des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
KOMMUNAL 5
Blindtext Kommentar & Blindtext<br />
Erleichterung nach Einigung über Finanzausgleich<br />
Vernunft hat gesiegt<br />
Es waren noch viele Verhandlungsrunden<br />
notwendig, um doch noch<br />
eine Mehrheit für das von den<br />
Vertretern des Bundes, der Länder und<br />
der Gemeinden geschnürte Paket für<br />
den Finanzausgleich zu finden. Jetzt<br />
hat dieses Paktum mit dem Gesundheitsreformpapier<br />
den Ministerrat passiert<br />
und wird hoffentlich im Parlament<br />
mit einer entsprechenden Mehrheit<br />
beschlossen. Es hat offensichtlich doch<br />
in letzter Minute die Vernunft gesiegt.<br />
Nämlich die Vernunft, dass die Gemeinden<br />
nicht nur eine gesicherte wirtschaftliche<br />
Basis, sondern auch Rechtssicherheit<br />
brauchen. Und gerade deshalb<br />
wäre es sinnvoll, wenn im Nationalrat<br />
auch das Paktum mit einer Verfassungsmehrheit<br />
abgesichert würde.<br />
Erfreulich für die Gemeinden ist, dass<br />
das vor allem für die kleineren Gemeinden<br />
erfolgreiche Finanzierungspaket<br />
nicht mehr aufgeschnürt wurde und<br />
somit eine wesentliche Verbesserung in<br />
finanzieller Hinsicht erreicht wurde.<br />
Von den 100 Millionen Euro im Jahr<br />
mehr entfallen auf die Gemeinden<br />
unter 10.000 Einwohner rund 80 Millionen.<br />
Damit ist ein ganz entscheidender<br />
Beitrag zur Stärkung und zu mehr<br />
Gerechtigkeit für diese Gemeinden<br />
erreicht worden.<br />
Wir werden in den kommenden Tagen<br />
die genauen Berechnungen für jede<br />
einzelne Gemeinde durchführen und<br />
das Ergebnis unseren Landesverbänden<br />
mitteilen. Auch der zukünftige einheitliche<br />
Beteiligungsschlüssel an allen<br />
Steuern ist für die Zukunft der Gemeinden<br />
eine gute Basis für mehr Gerechtigkeit<br />
und Partnerschaft mit dem Bund.<br />
Und schließlich entlastet die Spitalsreform<br />
die Gemeinden noch<br />
einmal mit einem Betrag von<br />
rund 70 Millionen Euro. Damit ist<br />
sicher das Problem der Finanzierung<br />
auf Dauer nicht gelöst, sondern es<br />
bedarf natürlich einer großen Strukturreform,<br />
um die hervorragende Qualität<br />
der Gesundheitsversorgung zu erhalten.<br />
Ich habe auch immer unmissverständlich<br />
klargestellt, dass die Gemeinden<br />
mit der Finanzierung und dem<br />
Betrieb von Krankenhäusern überlastet<br />
sind und diese Aufgabe sicher eine<br />
6 KOMMUNAL<br />
überregionale ist. Deshalb begrüße ich<br />
auch die Bemühungen von Niederösterreich,<br />
wo das Land die Gemeindekrankenhäuser<br />
übernimmt.<br />
Den Gemeinden wird mit dem neuen<br />
Finanzausgleich eine bessere wirtschaftliche<br />
Basis geboten. Das ist gut<br />
und wird sich auch in der Investitionstätigkeit<br />
der Kommunen positiv auswirken.<br />
Erste Anzeichen dafür gab es<br />
auf der großen <strong>Kommunal</strong>messe im<br />
Wiener Messezentrum, wo über 200<br />
Aussteller die neuesten Entwicklungen<br />
auf dem <strong>Kommunal</strong>sektor präsentierten.<br />
Die Besucher erlebten nicht nur<br />
interessante Angebote, sondern auch<br />
bei der Tagung zur Katastrophenvorsorge<br />
interessante Erkenntnisse aus den<br />
vergangenen Katastrophen. Ich möchte<br />
allen, die an diesem kommunalen<br />
Großereignis mitgewirkt haben, ein<br />
ganz herzliches Dankeschön sagen.<br />
Dass die Sorgen der Gemeinden<br />
mit dem positiven Abschluss des<br />
Finanzausgleiches kein Ende finden,<br />
ist mit der Diskussion über die<br />
Schließung der Postämter sehr deutlich<br />
geworden. Auch hier wird sich der<br />
Österreichische Gemeindebund massiv<br />
dafür einsetzen, dass der ländliche<br />
Raum nicht reinen wirtschaftlichen<br />
Überlegungen geopfert wird. Die Post<br />
hat einen klaren Versorgungsauftrag<br />
und der Gemeindebund wird dafür sorgen,<br />
dass dieser auch nach Punkt und<br />
Beistrich der Universaldienstverordnung<br />
eingehalten wird. Notfalls werden<br />
wir bei Verstößen auch rechtliche<br />
Schritte einleiten. Denn der Gemeindebund<br />
ist nicht nur eine Interessensvertretung,<br />
sondern auch der Anwalt für<br />
die kleineren und mittleren Gemeinden.<br />
Und diesen Auftrag werden wir<br />
sehr ernst nehmen.<br />
Helmut Mödlhammer<br />
Präsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
»<br />
Den Gemeinden wird<br />
mit dem neuen Finanzausgleich<br />
eine bessere<br />
wirtschaftliche Basis<br />
geboten. Das ist gut<br />
und wird sich auch in<br />
der Investitionstätigkeit<br />
der Kommunen<br />
positiv auswirken.<br />
«
KOMMUNAL<br />
THEMEN<br />
EU-Konvergenzbericht 2004: Weitere Anstrengungen notwendig<br />
Neue Mitglieder nicht Euro-tauglich<br />
Die Kommission hat Mitte<br />
Oktober den Konvergenzbericht<br />
2004 angenommen, der<br />
die Fortschritte Tschechiens,<br />
Estlands, Zyperns, Lettlands,<br />
Litauens, Ungarns, Maltas,<br />
Polens, Sloweniens, der Slowakei<br />
und Schwedens bei der<br />
Erfüllung der WWU-Konvergenzkriterien<br />
unter die Lupe<br />
nimmt. Der Bericht geht der<br />
Frage nach, ob die Mitgliedstaaten<br />
ohne Opt-Out-Regelung<br />
die Konvergenzkriterien<br />
für die Preisstabilität, die<br />
Öko: „grünstadtgrau“<br />
„Natur findet<br />
Stadt“<br />
Im Rahmen der europäischenNachhaltigkeitsstrategie<br />
stellt die Umsetzung von<br />
Klimaschutzstrategien die<br />
Gemeinden vor neue Anforderungen.<br />
Mit der Initiative<br />
„grünstadtgrau“ eröffnete<br />
das Lebensministerium<br />
gemeinsam mit dem Naturschutzbund<br />
und dem<br />
Umweltbundesamt ein<br />
Forum, das eine Trendumkehr<br />
bei wichtigen Parametern<br />
bringen soll.<br />
www.naturschutzbund.at<br />
Finanzlage der öffentlichen<br />
Hand, den Wechselkurs und<br />
die Zinsen erfüllen und ihre<br />
Rechtsvorschriften an die für<br />
eine Euro-Teilnahme geltenden<br />
Vorgaben angepasst<br />
haben. Dem Bericht zufolge<br />
erfüllt zum jetzigen Zeitpunkt<br />
keines der geprüften Länder<br />
alle Voraussetzungen für die<br />
Einführung des Euro. Angesichts<br />
dessen gelangt die<br />
Kommission zu dem Ergebnis,<br />
dass der Status der elf<br />
geprüften Länder als „Mit-<br />
Infrastruktur: Europa Region Mitte<br />
„Verländerung“ der Schienen?<br />
„Niederösterreich mit seiner<br />
Vielzahl von Nebenbahnen,<br />
die für Güter- und Personenverkehr<br />
große Bedeutung<br />
haben, ist nach Ansicht der<br />
Industriellenvereinigung (IV)<br />
NÖ dafür prädestiniert, Landesschienenstrecken<br />
zu<br />
Umwelt: Regionen werden Sanierungsgebiete<br />
Filterpflicht & Tempolimits<br />
Alljährlich im Herbst gibt es<br />
die ersten Grenzüberschreitungen<br />
bei den Schadstoffen<br />
in der Luft. In Tirol und<br />
auch in der Steiermark wurden<br />
die Feinstaub-Sanierungsgebiete<br />
ausgeweitet.<br />
So sind allein in Tirol das<br />
gesamte untere Inntal von<br />
Kufstein bis zur Hälfte des<br />
Oberlandes betroffen. Das<br />
sind 69 Gemeinden auf<br />
einer Strecke von 120 Kilo-<br />
metern. Das Sanierungsgebiet<br />
wurde damit praktisch<br />
verdoppelt.<br />
In der Steiermark wurden<br />
neben Graz auch Hartberg,<br />
Voitsberg und Köflach sowie<br />
kleine Gemeinden in Graz-<br />
Umgebung zu Staubproblemlagen<br />
erklärt.<br />
Mit den Sanierungen reagieren<br />
die Landesregierungen<br />
auf die Belastungen des<br />
Jahres 2002.<br />
gliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung<br />
gilt“, nicht<br />
geändert werden sollte.<br />
EU-Kommissar Joaquin<br />
Almunia, dessen Dienste den<br />
Bericht erstellt haben, dazu:<br />
„Die Erfüllung der Beitrittskriterien<br />
hat allen neuen Mitgliedstaaten<br />
enorme Kraftanstrengungen<br />
abverlangt. Die<br />
Konvergenzfortschritte sind<br />
beachtlich, doch für die Einführung<br />
des Euro müssen<br />
noch weitere Anstrengungen<br />
unternommen werden.“<br />
betreiben. Die Diskussion<br />
von Bund, Ländern, Gemeinden<br />
und Verkehrsunternehmen<br />
sollte bald beginnen“,<br />
meinte laut APA kürzlich IV-<br />
Landesgeschäftsführer NÖ,<br />
Dr. Fritz Wehdorn.<br />
Fritz Neugebauer<br />
Foto: © European Community, 2004<br />
„Das Ergebnis ist ein<br />
voller gewerkschaftlicher<br />
Erfolg am Verhandlungstisch.“<br />
So<br />
kommentierte GÖD-<br />
Chef Fritz Neugebauer<br />
den kürzlich<br />
vereinbarten Gehaltsabschluss<br />
für 2005 im<br />
öffentlichen Dienst.<br />
Der Abschluss<br />
gewährleistet die<br />
volle Inflationsabgeltung<br />
und gibt den<br />
Joaquin Almunia, EU-Kommissar<br />
für Wirtschaft und<br />
Währung.<br />
ASFINAG: Protest<br />
Keine Änderung<br />
der Widmung<br />
Der Gemeindebund protestiert<br />
gegen den Entwurf<br />
eines Gesetzes, mit dem das<br />
ASFINAG-Gesetz und das<br />
ASFINAG-Ermächtigungsgesetz<br />
geändert werden. Vor<br />
allem die Gemeinden des<br />
Tiroler Wipptales würden<br />
massiv benachteiligt, da mit<br />
der Änderung die Mauteinnahmen<br />
nicht mehr diesen<br />
finanzschwachen Gemeinden<br />
zu Gute kommen.<br />
Gemeinde-Personal: Gehalt & Pension<br />
Verhandlungen geglückt<br />
Gemeindebediensteten<br />
einen gerechten<br />
Anteil am Wirtschaftswachstum.<br />
Am 1. Jänner<br />
2005 steigen<br />
damit die Gehälter<br />
der öffentlich Bediensteten<br />
staffelwirksam<br />
um 2,3 Prozent inklusive<br />
aller Zulagen und<br />
Nebengebühren.<br />
KOMMUNAL berichtet<br />
im Dezember ausführlich.
Postämter<br />
Stehen die Postämter vor dem Aus?<br />
Gemeindebund<br />
droht mit Klage<br />
Härtesten Widerstand kündigt Gemeindebund-Präsident<br />
Helmut Mödlhammer gegen die geplante Schließung von<br />
rund 400 Postämtern an. Bei ungerechtfertigten<br />
Schließungen wären sogar Klagen möglich.<br />
◆ Daniel Kosak<br />
„Es wird mit Sicherheit keine einzige<br />
Postamtsschließung geben, ohne dass<br />
die Post nachweisen kann, dass der<br />
jeweilige Standort über Jahre hinweg<br />
nicht kostendeckend war und auch<br />
keine Aussicht auf eine wirtschaftliche<br />
Führung in den kommenden Jahren<br />
besteht“, stellt Mödlhammer klar.<br />
„Sollte sich die Post nicht an die in der<br />
Universaldienstordnung festgeschriebenen<br />
Regeln und Pflichten halten, dann<br />
wird der Gemeindebund klagen“.<br />
Unterschriftenaktion in<br />
Kärnten<br />
„Der Gemeindebund wird als Vertreter<br />
der kleineren Gemeinden härtesten<br />
Widerstand gegen die Pläne der Post,<br />
wonach 400 der 1.640 Postämter im<br />
kommenden Jahr geschlossen werden<br />
sollen, leisten“, kündigte Mödlhammer<br />
an. Erst kürzlich hat der Kärntner<br />
◆ Daniel Kosak ist Pressesprecher<br />
des österreichischen Gemeindebundes<br />
8 KOMMUNAL<br />
Gemeindebund eine diesbezügliche Resolution<br />
verabschiedet und eine Unterschriftenaktion<br />
ins Leben gerufen. Einer<br />
der ersten Unterstützer war Gemeindereferent<br />
Landesrat Ing. Reinhart Rohr, der<br />
mit seiner Unterschrift die Petition des<br />
Kärntner Gemeindebundes stärkte, die<br />
sich gegen weitere Schließungen von<br />
Postämtern ausspricht. In einer landesweiten<br />
Aktion werden in den Kärntner<br />
Städten und Gemeinden Unterschriften<br />
gesammelt, um den weiteren Abbau von<br />
Infrastruktur im ländlichen Raum zu verhindern.<br />
Allein in Kärnten sollen 30 bis<br />
40 Postämter von der Schließung bedroht<br />
sein.<br />
Alternativen vorlegen<br />
Mödlhammer hatte erst jüngst in einem<br />
Gespräch mit Post-Vorstandsdirektor<br />
Herbert Götz, die Position der österreichischen<br />
Gemeinden deponiert. „Ich<br />
habe ihm klipp und klar gesagt, dass<br />
die Pläne der Post in dieser Art und<br />
Weise sicher nicht realisiert werden“, so<br />
Mödlhammer. „Wir verlangen, dass bei<br />
gefährdeten Postämtern der jeweils<br />
zuständige Bürgermeister zwingend in<br />
die Gespräche und<br />
Überlegungen der<br />
Post eingebunden<br />
wird und Alternativen<br />
zum Zusperren<br />
vorgelegt werden“,<br />
so der Gemeindebundpräsident.<br />
„Bevor man über<br />
Schließungen nachdenkt,<br />
sollte man<br />
»<br />
Ich habe ihm klipp<br />
und klar gesagt, dass<br />
die Pläne der Post<br />
in dieser Art und<br />
Weise sicher nicht<br />
realisiert werde<br />
Helmut Mödlhammer<br />
über sein Gespräch mit Post-<br />
Vorstandsdirektor Herbert Götz<br />
Der Präsident des Kärntner Gemeindebundes,<br />
Bgm. Hans Ferlitsch (hier mit<br />
Landesrat Reinhart Rohr) , bringt die Forderung<br />
der Kärntner Kommunen auf<br />
den Punkt: „Jede Gemeinde muß zumindest<br />
über ein Postamt verfügen.“<br />
über alternative Möglichkeiten, die ein<br />
Postamt aufwerten nachdenken. Es<br />
wäre zu überlegen, welche Dienste und<br />
Services von Postämtern zusätzlich<br />
angeboten werden können, damit das<br />
Amt auf Dauer wirtschaftlich sinnvoll<br />
geführt werden kann.“<br />
Enormer Widerstand in<br />
den Bundesländern<br />
„Ich kann der Österreichischen Post nur<br />
dringend empfehlen, die Universaldienstordnung<br />
ernst zu nehmen und<br />
einzuhalten. Anson-<br />
«<br />
sten wird der ÖsterreichischeGemeindebund<br />
den Klagsweg<br />
beschreiten“, so<br />
Mödlhammer. Schon<br />
jetzt sei der Widerstand<br />
gegen die Post-<br />
Pläne in allen Bundesländern<br />
enorm.<br />
„Für viele Gemeinden
Wo es um Universaldienste geht, müssen<br />
den Menschen in benachteiligten Regionen,<br />
vor allem im ländlichen Raum faire<br />
Bedingungen eingeräumt werden.<br />
ist das eigene Postamt extrem wichtig“,<br />
betont Mödlhammer. „Ich habe Verständnis<br />
dafür, dass man auch die Wirtschaftlichkeit<br />
berücksichtigen muss, ich<br />
glaube aber nicht daran, dass alle nun<br />
bedrohten Postämter tatsächlich unwirtschaftlich<br />
arbeiten. Es wurden ja erst<br />
vor wenigen Jahren österreichweit hunderte<br />
Postämter aufgelassen, die unrentabelsten<br />
sind demnach ja schon aufgelassen<br />
worden.“ Der Gemeindebund<br />
werde Seite an Seite mit den Bürgermeistern<br />
um jeden einzelnen Standort<br />
kämpfen und dafür auch die Unterstützung<br />
und Hilfe der Politik suchen.<br />
Neuer Pressesprecher beim<br />
Gemeindebund<br />
Daniel Kosak folgt<br />
auf Petra Schröder<br />
Mit 1. November folgte Daniel<br />
Kosak (32) Dr. Petra Schröder als<br />
Pressesprecher des Gemeindebundes<br />
nach.<br />
Der ausgebildete Journalist<br />
begann seine Karriere u.a. bei der<br />
Tageszeitung „Die Presse“. Mitte<br />
der 90er Jahre wechselte Kosak in<br />
die Politik.<br />
„Ich freue mich auf diese Aufgabe,<br />
der Gemeindebund ist die wichtigste<br />
Schnittstelle zwischen den<br />
Kommunen, der Politik und der<br />
Wirtschaft“, so Kosak. „Gerade die<br />
vergangenen Wochen, die ganz im<br />
Zeichen der Finanzausgleichsverhandlungen<br />
standen, haben<br />
bewiesen, wie viel eine starke<br />
Interessensvertretung der Gemeinden<br />
und Kommunen wert ist und<br />
wie viel sie bewegen kann.“<br />
Daniel Kosak ist verheiratet und<br />
Vater von zwei Kindern.<br />
„Die Verhandlungen waren wirklich an<br />
der Kippe“, berichtet Gemeindebund-<br />
Präsident und Mitverhandler Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer.<br />
„Das waren mit<br />
Abstand die schwierigstenVerhandlungen,<br />
die ich je erlebt<br />
habe.“<br />
Die Chronologie der<br />
Ereignisse: Die Einigung<br />
über den<br />
Finanzausgleich<br />
2005 bis 2008 kam<br />
Finanzausgleich<br />
Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden und Gemeindebundpräsident Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer demonstrierten im Verlauf der eben erst glücklich abgeschlossenen Verhandlungen<br />
(hier bei einer Pressekonferenz Anfang August) die enge Zusammenarbeit<br />
von Gemeinde- und Städtebund.<br />
Finanzausgleich: Einigung in letzter Minute<br />
Katastrophe<br />
abgewendet<br />
Wochenlang diskutierten und stritten die politischen<br />
Parteien und den Finanzausgleich und das darin enthaltene<br />
Gesundheitspaket. Die nun erfolgte Einigung kam für die<br />
österreichischen Gemeinden buchstäblich in letzter Minute.<br />
»<br />
Das waren mit<br />
Abstand die<br />
schwierigsten<br />
Verhandlungen,<br />
die ich je erlebt<br />
habe.<br />
Helmut Mödlhammer<br />
Gemeindebundpräsident<br />
und FAG-Verhandler<br />
in der Tat spät. Nach wochenlangem<br />
Ringen zwischen Bund, Ländern und<br />
Gemeinden hatte man sich in der<br />
Nacht zum National-<br />
«<br />
feiertag auf ein<br />
gemeinsames Paket<br />
geeinigt, das auch von<br />
den Hauptverhandlern<br />
unterschrieben worden<br />
war. Von Seiten der<br />
Länder waren dies der<br />
Wiener Vizebürgermeister<br />
Sepp Rieder und<br />
der Vorarlberger Lan-<br />
KOMMUNAL 9
Finanzausgleich<br />
Ein für die Gemeinden extrem wichtiges<br />
Thema ist die Siedlungswasserwirtschaft.<br />
Die Sicherung der Bundesmittel dafür<br />
wurde im Finanzausgleich grundsätzlich<br />
vereinbart.<br />
deshauptmann Herbert Sausgruber.<br />
Der Gemeindebund war mit Bgm.<br />
Mödlhammer und Gemeindebund-<br />
Vize Bernd Vögerle in die Verhandlungen<br />
eingebunden, der Städtebund<br />
entsandte den Salzburger Bürgermeister<br />
Heinz Schaden und den Grazer<br />
Bürgermeister Siegfried Nagl. Finanzminister<br />
Karl-Heinz Grasser und sein<br />
Staatssekretär Alfred Finz verhandelten<br />
für die Bundesseite.<br />
Einigung stand in Frage<br />
In der Nacht zum Nationalfeiertag<br />
kam also die lang erwartete Eini-<br />
»<br />
gung, die sich nur wenige Tage später<br />
als Trugschluss herausstellen sollte.<br />
Nach den entsprechenden Sitzungen<br />
der diversen Gremien stellte sich heraus,<br />
dass wichtige Verhandlungsparteien<br />
dem Ergebnis nun doch nicht<br />
zustimmen wollten. Einen „Keulenschlag<br />
der Enttäuschung“ nannte<br />
Mödlhammer den Bruch der erzielten<br />
10 KOMMUNAL<br />
Die Verhandlungen zum<br />
Finanzausgleich und Stabilitätspakt<br />
haben für die<br />
Gemeinden ein hervorragendes<br />
Ergebnis gebracht<br />
Bgm. Bernd Vögerle<br />
Gemeindebund-Vizepräsident und<br />
FAG-Verhandler<br />
Beim Auftakt zu den Verhandlungen im März (das Bild zeigt die erste Sitzung unter Vorsitz<br />
von Staatssekretär Finz) ahnte noch niemand, wie hart es diesmal zugehen würde.<br />
Im Hintergrund das Gemeindebund-Verhandlungsteam mit Präsident Mödlhammer,<br />
Finanzexperte Dietmar Pilz, Bgm. Hermann Kröll, 1. Vizepräsident, Bgm. Alfred Riedl (mit<br />
Brille), Bgm. Bernd Vögerle (verdeckt) und „General“ Robert Hink (rechts hinten).<br />
Einigung kurze Zeit später. Konkret<br />
stemmten sich SPÖ und die Regierungspartei<br />
FPÖ gegen die vereinbarten<br />
Maßnahmen im Gesundheitsbereich.<br />
Zähes Ringen um<br />
Gesundheitspaket<br />
Erneut ein Verhandlungsmarathon,<br />
dieses Mal zwischen Vertretern der<br />
politischen Parteien. Nächtelange Sitzungen,<br />
zähes Ringen um gemeinsame<br />
Vorschläge zur Finanzierung des<br />
Gesundheitspakets, zahlreiche Vertagungen.<br />
Tagelang<br />
waren keine Fortschritte<br />
sichtbar, keine der Parteien<br />
wollte von ihrer<br />
Position abweichen.<br />
Buchstäblich in letzter<br />
«<br />
Minute dann die Einigung.<br />
Mit moderaten<br />
Erhöhungen, einer<br />
Erhöhung der Tabaksteuer<br />
und Leistungseinschränkungen<br />
beim<br />
Brillenersatz ging das<br />
Gesundheitspaket durch<br />
und damit auch der gesamte Finanzausgleich.<br />
Alle Gemeinden<br />
bekommen mehr Geld<br />
„Die Einigung kam für die Gemeinden<br />
wirklich in allerletzter Minute“, so<br />
Mödlhammer. „Die Kommunen konnten<br />
bis dahin ihre Budgets für das kommende<br />
Jahr nicht erstellen und standen<br />
damit knapp vor der Katastrophe“, sagte<br />
der Gemeindebundpräsident in seiner<br />
Rede am <strong>Kommunal</strong>kongress des<br />
Gemeindebundes. „Ich bin froh, dass<br />
Die Finanzen der kleinen und<br />
finanzschwachen Gemeinden<br />
sind mit zusätzlichen mehr als<br />
340 Millionen Euro sichergestellt.<br />
Und mit der Installierung<br />
des einheitlichen Verteilungsschlüssels<br />
ist die größte<br />
Systemänderung der letzten<br />
Jahrzehnte gelungen.<br />
Bgm. Mag. Alfred Riedl<br />
Vorsitzender des Finanzausschusses des<br />
Österreichischen Gemeindebundes und Präsident<br />
des nö. Gemeindevertreterverbandes VP<br />
schwer wiegende Budget- und Planungsprobleme<br />
damit im letzten Augenblick<br />
abgewendet werden konnten.“ In<br />
Summe ist der Gemeindebund-Präsident<br />
mit dem Ergebnis für die Gemeinden<br />
zufrieden. „Alle Gemeinden bekommen<br />
mehr Geld, in Summe rund 100<br />
Millionen Euro jährlich mehr, damit ist<br />
die für die Wirtschaft wichtige Investitionstätigkeit<br />
der Kommunen gesichert.“<br />
Daniel Kosak<br />
«
Am Zustandekommen des vor allem für<br />
die Gemeinden bis 10.000 Einwohner<br />
erfreulichen Ergebnisses haben der Präsident<br />
des Österreichischen Gemeindebundes,<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer,<br />
sowie der Vizepräsident Bgm. Bernd<br />
Vögerle großen Anteil, die unter Vorsitz<br />
von Bundesminister Karl-Heinz Grasser<br />
am Verhandlungstisch saßen.<br />
Die Schwerpunkte der Forderungen der<br />
österreichischen Gemeinden an den<br />
kommenden Finanzausgleich – diese<br />
wurden in einem gemeinsamen Papier<br />
des Österreichischen Gemeindebundes<br />
und des Österreichischen Städtebundes<br />
in die Finanzausgleichsverhandlungen<br />
eingebracht – waren zweifellos die<br />
Erhöhung der Gemeindefinanzmasse<br />
aus Bundesmittel, ein einheitlicher Verteilungsschlüssel<br />
für die gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben beziehungsweise<br />
für einige ausschließliche Bundesabgaben,<br />
zusätzliche Mittel für die Spitalsfinanzierung,Sicherung<br />
der Dotierung<br />
der Siedlungswasser-<br />
wirtschaft bzw. die<br />
Ermächtigung für privatrechtlicheVereinbarungen<br />
zur Verteilung<br />
von Gemeindeabgaben(<strong>Kommunal</strong>steuer<br />
– interkommunalerFinanzausgleich).<br />
Diese zentralen Forderungen<br />
und einige<br />
weitere nicht unwesentliche<br />
Änderungen<br />
wurden von den<br />
Finanzausgleichspartnern am 25. Oktober<br />
2004 paktiert.<br />
Das Maßnahmenpaket<br />
Die Finanzausgleichsperiode wurde<br />
einvernehmlich für vier Jahre festgesetzt<br />
und endet somit am 31.12.2008.<br />
Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel:<br />
Der unterste Vervielfältiger beim<br />
abgestuften Bevölkerungsschlüssel<br />
(Gemeinden bis 10.000 Einwohner)<br />
wird von 1 1 /3 auf 1 1 /2 angehoben (die<br />
Einschleifregelung bleibt unberührt).<br />
Dies bewirkt eine Verschiebung der<br />
Finanzmasse von rund 114 Millionen<br />
Euro zu den Gemeinden bis 10.000<br />
Einwohner. Im Gegenzug wird der<br />
Sockelbetrag abgeschafft – dies bedeutet<br />
eine Gegenfinanzierung von rund<br />
53 Millionen Euro. Der Verlust von 61<br />
Millionen für die Gemeinden mit über<br />
10.000 Einwohnern<br />
wird aus Bundesmitteln<br />
ausgeglichen. Da<br />
der Bund sich bereit<br />
erklärt hat, jährlich<br />
100 Millionen Euro<br />
aus eigenen Mitteln<br />
zur Verfügung zu stellen,<br />
werden vereinbarungsgemäß<br />
die verbleibenden<br />
39 Millionen<br />
Euro zu gleichen<br />
Teilen zwischen Städten<br />
und Gemeinden<br />
unter 10.000 Einwohnern<br />
und über 10.000<br />
Einwohnern geteilt.<br />
Finanzausgleich<br />
Bund stärkt Gemeinden – jährlich zusätzlich 100 Millionen Euro<br />
Finanzausgleich bis<br />
2008 paktiert<br />
Trotz des knappen budgetären Spielraums des Bundes wurden nach schwierigen Verhandlungen<br />
der Finanzausgleichspartner die zentralen Forderungen der österreichischen<br />
Gemeinden an den künftigen Finanzausgleich mit dem Paktum zum FAG 2005<br />
erfüllt. KOMMUNAL bringt die Details.<br />
◆ Dietmar Pilz<br />
Die Anhebung des<br />
untersten Vervielfältiger<br />
beim abgestuften<br />
Bevölkerungsschlüssel<br />
von 1 1 /3 auf 1 1 /2 bewirkt<br />
eine Verschiebung der<br />
Finanzmasse von rund<br />
114 Millionen Euro zu<br />
den Gemeinden bis<br />
10.000 Einwohner.<br />
Gemeinden bis 10.000<br />
Einwohner<br />
Die Gemeinden bis 10.000 Einwohner<br />
erhalten somit jährlich zur Stärkung<br />
deren Finanzkraft zusätzliche Finanzmittel,<br />
und zwar 60,2 Millionen Euro,<br />
durch die Änderung beim abgestuften<br />
Schlüssel und durch die Abschaffung<br />
des Sockelbetrages.<br />
Zusätzlich<br />
stellt der Bund<br />
noch jeweils<br />
19,5 Millionen<br />
für die Gemeinden<br />
unter<br />
10.000 Einwohner<br />
und für die<br />
Gemeinden über<br />
10.000 Einwohner<br />
als Bedarfszuweisung<br />
zur<br />
Verfügung.<br />
Den Gemeinden<br />
über 10.000<br />
Einwohner werden<br />
die Verluste<br />
aus der Regelung<br />
abgestufter<br />
Bevölkerungsschlüssel/Sockelbetrag zur<br />
Gänze abgegolten. Zusätzlich erhalten<br />
die Gemeinden über 10.000 Einwohner<br />
ebenfalls 19,5 Millionen Euro aus Bundesmittel,<br />
deren Verteilung noch nicht<br />
endgültig fixiert ist.<br />
Die Länder<br />
Die Gemeinden<br />
bis 10.000 Einwohner<br />
erhalten durch<br />
die Änderung beim<br />
abgestuften Schlüssel<br />
und durch die<br />
Abschaffung des<br />
Sockelbetrages jährlich<br />
zusätzliche 60,2<br />
Millionen Euro.<br />
Infolge der Änderung beim abgestuften<br />
Bevölkerungsschlüssel erhalten die<br />
KOMMUNAL 11
Finanzausgleich<br />
Abgeltung der Verluste<br />
und zusätzliche Mittel<br />
Gemeinden über<br />
10.000 Einwohner<br />
Bgld + 74<br />
Ktn + 1.352<br />
Nö + 4.249<br />
Oö + 3.669<br />
Sbg + 1.288<br />
Stmk + 1.937<br />
Tirol + 1.070<br />
Vbg + 1.010<br />
Wien + 4.850<br />
Summe + 19.500<br />
Alle Beträge in 1000 Euro.<br />
Die angeführten Daten beruhen auf<br />
einer Städtebund-Variante.<br />
Bundesländer (außer Wien) in der so<br />
genannten „Oberverteilung“ Bedarfszuweisungsmittel,<br />
die sich auf die einzelnen<br />
Länder wie in unserer Grafik<br />
ersichtlich verteilen.<br />
Einheitlicher<br />
Verteilungsschlüssel<br />
Viele Reformen (Steuerreformen, Budgetbegleitgesetze<br />
etc.) haben zu einer<br />
Verschiebung des Gesamtabgabenertrages<br />
zugunsten des Bundes und zu<br />
Lasten der Länder und Gemeinden<br />
geführt, da der Bund seine steuerpolitischen<br />
Maßnahmen so ausgerichtet hat,<br />
dass er das Aufkommen<br />
bei<br />
jenen Abgaben,<br />
an denen er<br />
Nicht einbezogen<br />
in den einheitlichen<br />
Schlüssel werden die<br />
Werbeabgabe, die<br />
Grunderwerbssteuer<br />
und die Bodenwertabgabe,<br />
die durch den<br />
hohen Anteil der<br />
Gemeinden an diesen<br />
Abgaben wie Gemeindeanteile<br />
wirken.<br />
hoch beteiligt<br />
ist (vertikaler<br />
Finanzausgleich),entsprechend<br />
beeinflusst hat.<br />
Mit dem paktierteneinheitlichenVerteilungsschlüssel<br />
wurde nicht<br />
nur eine<br />
langjährige Forderung<br />
der<br />
Gemeinden<br />
erfüllt, sondern<br />
werden mit diesem<br />
einheitlichen Schlüssel auch dem<br />
„grauen Finanzausgleich“ gewisse<br />
Schranken gesetzt.<br />
Die Umrechnung auf den einheitlichen<br />
12 KOMMUNAL<br />
Die länderweise Verteilung<br />
der zusätzlichen Mittel<br />
Gemeinden bis<br />
10.000 Einwohner<br />
Bgld + 3.516<br />
Ktn + 7.225<br />
Nö + 17.540<br />
Oö + 16.484<br />
Sbg + 6.608<br />
Stmk + 15.185<br />
Tirol + 8.632<br />
Vbg + 4.492<br />
Summe + 79.681<br />
Alle Beträge in 1000 Euro<br />
Schlüssel wird auf Basis der Rechnungsabschlüsse<br />
2004 ertragsneutral<br />
vorgenommen. Folgende Abgaben<br />
unterliegen künftighin bei der vertikalen<br />
Verteilung dem einheitlichen Verteilungsschlüssel:<br />
Den bisherigen verbundenen Abgaben<br />
wie Einkommensteuer, Körperschaftssteuer,<br />
Umsatzsteuer, Schaumweinsteuer,<br />
Alkoholsteuer, Mineralölsteuer,<br />
Erbschafts- und Schenkungssteuer,<br />
KFZ-Steuer, motorbezogene Versicherungssteuer,<br />
Kunstförderungsbeitrag<br />
sowie den<br />
bisherigen ausschließlichen Bundesabgaben<br />
wie Tabaksteuer, Kapitalverkehrssteuer,<br />
Energieabgaben, Normverbrauchsabgabe,Versicherungssteuer,<br />
Konzessionsabgabe wird ein<br />
einheitlicher Verteilungsschlüssel<br />
zugeordnet.<br />
Nicht einbezogen in den einheitlichen<br />
Schlüssel werden die Werbeabgabe, die<br />
Grunderwerbssteuer und die Bodenwertabgabe,<br />
die durch den hohen<br />
Anteil der Gemeinden an diesen Abgaben<br />
wie Gemeindeanteile wirken.<br />
Die ertragsneutrale Umrechnung ergibt<br />
auf Basis der Ertragsanteil-Prognose<br />
2004 nachstehende vorläufige vertikale<br />
Verteilung:<br />
Bund 73,223 %<br />
Länder 15,196 %<br />
Gemeinden 11,581 %<br />
Die endgültige Schlüsselberechnung<br />
wird mit Verordnung des Bundesministers<br />
für Finanzen mit Ende des Jahres<br />
2005 verlautbart, wobei für das Jahr<br />
2005 im Rahmen der Zwischenabrechnung<br />
eine Rückaufrollung erfolgt. Da<br />
die Schlüsselumrechnung ertragsneutral<br />
vorgenommen wird, werden sich<br />
im Rahmen der Rückaufrollung keine<br />
Bedarfszuweisung<br />
Bedarfszuweisungsmittel<br />
Bgld + 694<br />
Ktn + 73<br />
Nö + 2.111<br />
Oö + 1.134<br />
Sbg + 80<br />
Stmk + 1.166<br />
Tirol + 715<br />
Vbg – 64<br />
Wien – 5.908<br />
Alle Beträge in 1000 Euro.<br />
signifikanten Differenzen ergeben.<br />
Ebenfalls als ertragsneutral wird auch<br />
die horizontale Verteilung (Ländertöpfe)<br />
berechnet und ebenfalls mit der<br />
Verordnung des Bundesministers kundgemacht.<br />
Die Transfers (exklusive<br />
Wohnbauförderung und der entsprechenden<br />
Bedarfszuweisungen) und<br />
diverse Vorwegabzüge werden ebenfalls<br />
ertragsneutral auf eine neue Basis<br />
umgestellt.<br />
Bedarfszuweisungen<br />
§ 12 FAG 2001<br />
Die Bedarfszuweisungen (12,7 % der<br />
ungekürzten Ertragsanteile - ausgenommen<br />
Werbeabgabeanteil) werden<br />
im § 12 FAG 2001 mit einem Klammerausdruck<br />
als „(zweckgebundene Landesmittel)“<br />
bezeichnet. Mit dem FAG<br />
2005 erfolgt eine ertragsneutrale<br />
Umbenennung in „(Gemeinde-Bedarfszuweisungen)“.<br />
Siedlungswasserwirtschaft<br />
Die Dotierung (Barwertförderung) der<br />
Siedlungswasserwirtschaft wird auch<br />
für die kommende Finanzausgleichsperiode<br />
gesichert. Die im Rahmen der im<br />
Jahre 2003 durchgeführten Investitionskostenabschätzung<br />
für die aus der
Umsetzung des Wasserrechtes und insbesondere<br />
der Wasserrahmenrichtlinie<br />
resultierenden Investitionserfordernisse<br />
in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft<br />
werden betragsmäßig im<br />
Umweltförderungsgesetz bzw. im FAG<br />
2005 berücksichtigt werden.<br />
Mit der Festlegung der Zusagerahmen<br />
für die Jahre 2005 bis 2008 wird die<br />
Kontinuität in der Siedlungswasserwirtschaftsförderung<br />
sichergestellt werden.<br />
Interkommunaler<br />
Finanzausgleich<br />
Mit dem FAG 2005 wird für die<br />
Gemeinden das Instrument einer<br />
öffentlich-rechtlichen interkommunalen<br />
Vereinbarung geschaffen, die es<br />
Gemeinden künftighin ermöglichen<br />
wird, das <strong>Kommunal</strong>steuermehraufkommen<br />
bei Betriebsansiedlungen auf<br />
die zum Beispiel an<br />
den Infrastrukturkosten<br />
beteiligten<br />
Gemeinden abwei-<br />
chend vom Verteilungssystem<br />
des<br />
<strong>Kommunal</strong>steuergesetzeszuzuweisen.<br />
Das den einzelnen<br />
beteiligten Gemeinden<br />
auf Basis der<br />
Vereinbarung<br />
Mit dem FAG<br />
2005 wird für die<br />
Gemeinden das<br />
Instrument einer<br />
öffentlich-rechtlicheninterkommunalen<br />
Vereinbarung<br />
geschaffen.<br />
zustehende <strong>Kommunal</strong>steuermehraufkommen<br />
erhöht dann bei jeder dieser<br />
beteiligten Gemeinden im Ausmaß<br />
ihres Anteils die Finanzkraft.<br />
Gemeindeabgaben<br />
◆ Die Parkometergebühren werden in<br />
den freien Beschlussrechtskatalog der<br />
Gemeinden aufgenommen werden. In<br />
Kraft treten soll diese Regelung jedoch<br />
erst ab 1.1.2006.<br />
◆ Die von den Gemeinden geforderte<br />
Lenkungsabgabe auf Handymasten<br />
wird in einer Arbeitsgruppe noch erörtert<br />
werden.<br />
Wohnbauförderung<br />
Die Mittel aus der Wohnbauförderung<br />
werden den Ländern in ungekürztem<br />
Ausmaß weiterhin zur Verfügung stehen.<br />
Die Mittel sollen verstärkt für<br />
Kyoto-Ziele Verwendung finden.<br />
Weiters werden die bisherigenWohnbauförderungsmittel<br />
entsprechend ihrer Ver-<br />
wendung umbenannt in<br />
„Investitionsbeitrag für Wohnbau,<br />
Umwelt und Infrastruktur“.<br />
Stabilitätspakt<br />
Die Finanzausgleichspartner<br />
vereinbarten im Rahmen des<br />
Finanzausgleich<br />
innerösterreichischenStabilitätspakts<br />
einen<br />
gesamtstaatlichenausgeglichenenHaushalt<br />
über den<br />
Konjunkturzyklus - also bis zum Jahr<br />
2008 gemäß den Regeln des ESVG 95<br />
zu erbringen.<br />
Der Beitrag der österreichischen<br />
Gemeinden wird wieder mit einem<br />
„Null-Defizit“ festgesetzt. Dies bedeutet<br />
faktisch für die österreichischen<br />
Gemeinden eine Fortschreibung ihrer<br />
Null-Defizitquote.<br />
Gesundheitsreform<br />
Die von den<br />
Gemeinden geforderte<br />
Lenkungsabgabe auf<br />
Handymasten wird in<br />
einer Arbeitsgruppe<br />
noch erörtert werden.<br />
Der Bund und die Ländervertreter werden<br />
im Rahmen der Gesundheitsreform<br />
noch über Maßnahmen zur Kostendämpfung<br />
bzw. zur Effizienzsteigerung<br />
beraten. Über die Bedeckung der<br />
zusätzlichen Dotierung für die Krankenanstalten<br />
(150 Mio. Euro jährlich<br />
für die Länder bzw. für die Sozialversicherungsträger)<br />
sind die Verhandlungen<br />
zum Zeitpunkt der Drucklegung<br />
noch nicht endgültig abgeschlossen.<br />
Nach der Kundmachung des FAG 2005<br />
werden die einzelnen Detailmaßnahmen<br />
in KOMMUNAL noch eingehender<br />
erläutert werden.<br />
KOMMUNAL 13
Finanzen<br />
Das Körperschaftsteueraufkommen<br />
ist noch rückläufig.<br />
Gegenüber dem Rückgang<br />
im ersten Halbjahr von -25,8<br />
Prozent ist auch hier eine<br />
Verbesserung festzustellen.<br />
Gute Zuwächse der Gemeindeertragsanteilvorschüsse<br />
Gemeinden verbuchen<br />
plus 2,1 Prozent<br />
In den ersten drei Quartalen 2004 hat sich der Abgabenerfolg des Bundes mit<br />
rund -0,9 Prozent (nach Bereinigung der abgeschafften Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung)<br />
leicht rückläufig entwickelt. Die österreichischen Gemeinden können<br />
dem gegenüber eine Steigerung ihrer Ertragsanteile von +2,1 Prozent verbuchen.<br />
◆ Dietmar Pilz<br />
Die ungleichen Dynamiken sind vor<br />
allem auf die nicht identen Aufkommens-<br />
bzw. Zuteilungszeiträume<br />
zurückzuführen.<br />
An die österreichischen Gemeinden<br />
gelangten in den Monaten Jänner bis<br />
November 2004 5.483,1 Millionen<br />
Euro an Ertragsanteilvorschüssen<br />
einschließlich der Zwischenabrechnung<br />
2003, dem Getränkesteuerausgleich<br />
und dem Gemeindeanteil an<br />
◆ Dietmar Pilz ist Finanzexperte des<br />
Österreichischen Gemeindebundes<br />
14 KOMMUNAL<br />
der Werbeabgabe zur Anweisung<br />
(Zuwachs gegenüber den Vergleichszeitraum<br />
2003 +2,1 Prozent).<br />
Der Abgabenerfolg des Bundes für die<br />
ersten drei Quartale 2004 ist mit<br />
38.957,8 Millionen Euro rein nominell<br />
um +4,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum<br />
2003 gestiegen.<br />
Die Abschaffung der<br />
Umsatzsteuersondervorauszahlung<br />
mit<br />
Ende des Jahres 2003<br />
im Ausmaß von rund<br />
1,4 Mrd. Euro verwandelt<br />
den Zuwachs des<br />
Abgabenerfolges des<br />
Bundes in einen leichten<br />
Rückgang von -0,9<br />
Prozent. Die Ursache<br />
der negativen Abgabenentwicklung<br />
ist zum Teil konjunkturbedingt,<br />
zum Teil hausgemacht. Einerseits<br />
dämpft der schwache Privatkonsum<br />
das Umsatzsteueraufkommen,<br />
andererseits vermindern Maßnahmen<br />
der Konjunkturpakete I und II (insbesondere<br />
die Investitionszuwachsprä-<br />
Für das Jahr 2005<br />
wird für Österreich<br />
ein Zuwachs des BIP<br />
von 2,5 Prozent<br />
prognostiziert.<br />
mie) und die erste Etappe der Steuerreform<br />
2004 das Aufkommen der Einkommen-<br />
und Körperschaftsteuer.<br />
Negativen Einfluss auf die Abgabenentwicklung<br />
hat auch die Energieabgaberückvergütung<br />
(Rückgang des<br />
Aufkommens an Energieabgabe -10,1<br />
Prozent) und die relativ hohen<br />
Abzüge für das<br />
Gesundheits- und<br />
Sozialsystem (Steige-<br />
rung der Beilhilfen für<br />
das GSBG +9,8 Prozent).<br />
Die internationale<br />
Konjunktureinschätzung<br />
ist derzeit aber<br />
optimistisch, nicht<br />
zuletzt durch die<br />
Wachstumszunahme<br />
in USA, Osteuropa und Asien. Als Risikofaktoren<br />
sind aber die steigenden<br />
Ölpreise sowie der Euro/Dollarwechselkurs<br />
zu nennen.<br />
Für das Jahr 2005 wird für Österreich<br />
ein Zuwachs des BIP von 2,.5 Prozent<br />
prognostiziert.
Abgabenerfolg der aufkommensstärksten gemeinschaftlichen<br />
Bundesabgaben<br />
Gegenüberstellung der Monatserfolge zweier Finanzjahre<br />
Abgabenart 2003<br />
Jänner –<br />
September<br />
2004<br />
Jänner –<br />
September<br />
+/-<br />
%<br />
Gemeindeanteil<br />
FAG in %<br />
Einkommensteuer 1.498,6 1.540,2 2,8 13,168 1)<br />
Körperschaftsteuer 2.661,1 2.456,3 -7,7 13,168 1)<br />
Lohnsteuer 12.302,0 12.524,1 1,8 13,168 1)<br />
KESt I 377,1 429,9 14,0 13,168 1)<br />
KESt II 484,4 452,8 -6,5 20,000<br />
Umsatzsteuer 12.052,4 13.497,2 12,0 14.222 2)<br />
Biersteuer 149,9 145,8 -2,7 18,939<br />
Alkoholsteuer 88,0 91,3 3,7 19,936<br />
Mineralölssteuer 2.183,2 2.473,2 8,7 2,134<br />
Grunderwerbsteuer 340,0 383,1 12,7 96,000<br />
Werbeabgabe 64,9 71,3 9,9 86,917<br />
Alle Beträge in Millionen Euro<br />
1) Verteilungsschlüssel für 2002 bis 2004<br />
2) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ab 1.1.2001 mit 14,222 % festgesetzt (bisher<br />
12,371 %). Die Differenz entspricht dem Aufkommen für die Getränkeabgabeausgleichsregelung.<br />
Ertragsanteilvorschüsse der<br />
Gemeinden (§ 13 FAG 2001) 3)<br />
Einkommenssteuer: Aufkommen: 1.540,2<br />
Millionen Euro: Zuwachs +2,8 Prozent<br />
Die noch nicht einsetzende Konjunktur mit<br />
den Maßnahmen des Bundes (z.B. die Konjunkturpakete,<br />
insbesondere die Investitionszuwachsprämie)<br />
schwächen die Entwicklung<br />
der Einkommensteuer. Ob im moderaten<br />
Zuwachs von 2,8 Prozent bereits ein Trend<br />
abgelesen werden kann, bleibt abzuwarten.<br />
Körperschaftsteuer: Aufkommen: 2.456,3<br />
Millionen Euro: Rückgang -7,7 Prozent<br />
Das Körperschaftsteueraufkommen ist noch<br />
rückläufig. Gegenüber dem Rückgang im<br />
ersten Halbjahr von -25,8 Prozent ist auch<br />
hier ein positiver Trend festzustellen. Möglicherweise<br />
beeinflusst die bei den Kapitalgesellschaften<br />
stärker in Anspruch genommene<br />
Investitionszuwachsprämie die Aufkommensentwicklung.<br />
Lohnsteuer: Aufkommen: 12.524,1 Millionen<br />
Euro: Zuwachs +1,8 Prozent<br />
Januar bis Januar bis %<br />
September September<br />
2003 2004<br />
Burgenland 141,3 145,3 2,87<br />
Kärnten 347,0 353,8 1,98<br />
Niederösterreich 884,6 901,3 1,89<br />
Oberösterreich 844,1 861,7 2,08<br />
Salzburg 370,3 378,0 2,10<br />
Steiermark 689,3 697,6 1,21<br />
Tirol 460,2 473,1 2,81<br />
Vorarlberg 252,2 256,1 1,51<br />
Wien 1.380,5 1.416,2 2,59<br />
Summe 5.369,50 5.483,1 2,12<br />
Erläuterungen zum Abgabenerfolg Jänner bis September 2004<br />
Das Aufkommen an Lohnsteuer liegt leicht<br />
unter den Prognosen bzw. unter dem Bundesvoranschlag.<br />
KESt I: Aufkommen: 429,9 Millionen Euro:<br />
Zuwachs +14,0 Prozent<br />
Das Aufkommen ist vom Ausschüttungsverhalten<br />
der Kapitalgesellschaften abhängig und<br />
hat daher unterjährig keine Aussagekraft.<br />
KEST II: Aufkommen: 452,8 Millionen<br />
Euro: Rückgang -6,5 Prozent<br />
Das derzeit international historisch niedrige<br />
Zinsniveau drückt das Aufkommen der KESt II.<br />
Umsatzsteuer: Aufkommen: 13.497,2 Millionen<br />
Euro: Zuwachs +12,0 Prozent<br />
Dieser Zuwachs ist um die Umsatzsteuersondervorauszahlung,<br />
die mit Ende des Jahres<br />
2003 als eine der Maßnahmen der 1. Etappe<br />
der Steuerreform 2004 abgeschafft wurde, im<br />
Ausmaß von rund 1,4 Milliarden Euro zu<br />
bereinigen. Tatsächlich ist bei der Entwicklung<br />
Finanzen<br />
Abgabenerfolg des Bundes<br />
ausschließliche und gemeinschaftliche<br />
Bundesabgaben §§ 8 und 9 FAG 2001<br />
Jänner bis September<br />
2003 2004 +/- %<br />
37.189,5 38.957,8 4,8<br />
Beitrag Europäische Union<br />
Überweisung Jänner bis September<br />
2003 2004 +/- %<br />
1.453,5 1.802,2 24,0<br />
3) Mit dem Aufkommen<br />
der gemeinschaftlichenBundesabgaben<br />
für den September<br />
2004 ergeben<br />
sich nach § 13 FAG<br />
2001 die Gemeindeertragsanteilvorschüsse<br />
für Jänner<br />
bis November 2004.<br />
Alle Beträge in<br />
Millionen Euro<br />
der Umatzsteuer ein Rückgang von etwa -0,9<br />
Prozent festzustellen. Eine der Ursachen des<br />
Umsatzsteuerrückganges ist der schwache Privatkonsum.<br />
Grunderwerbsteuer: Aufkommen: 383,1<br />
Millionen Euro: Zuwachs +12,7 Prozent<br />
Das Grunderwerbsteueraufkommen hat sich<br />
im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin stabilisiert<br />
und weist bereits durchaus zufrieden stellende<br />
Zuwächse – vor allem im Hinblick auf<br />
die Gemeindebeteiligung von 96 Prozent - auf.<br />
EU-Beitrag: Von den Gebietskörperschaften<br />
wurden für den EU-Beitrag in den Monaten<br />
Jänner bis September 2004 1.802,2 Millionen<br />
Euro aufgebracht.<br />
Die Höhe der Überweisung bestimmt sich<br />
durch die von der EU abberufenen Mittel bei<br />
einem beim BMfF eingerichteten Konto (dieses<br />
wird gespeist von Bund, Ländern und<br />
Gemeinden in Höhe des im FAG 2001 paktierten<br />
Beitragsanteils).<br />
KOMMUNAL 15
<strong>Kommunal</strong>net<br />
Die Partner von <strong>Kommunal</strong>net: Anton Steinringer von Telekom Austria, Gemeindebundpräsident Bgm. Helmut Mödlhammer,<br />
„Gemeindeminister“ Dr. Ernst Strasser, Dr. Reinhard Platzer, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der <strong>Kommunal</strong>kredit Austria<br />
und Mag. Erhard Schmidt vom Bundesrechenzentrum präsentierten die E-Government Plattform www.kommunalnet.at<br />
<strong>Kommunal</strong>net: Start in eine europaweit einzigartige Zukunft<br />
Enormes Potential<br />
für jede Gemeinde<br />
Mit Freude und merklich auch mit Stolz präsentierten am 8. November der Österreichische<br />
Gemeindebund und seine Partner mit kommunalnet.at der Öffentlichkeit ihre<br />
europaweit einzigartige Internet-Plattform für alle österreichischen Gemeinden.<br />
Die Bedeutung von kommunalnet.at für<br />
die österreichischen Gemeinden, aber<br />
auch für deren Bürger, wurde von allen<br />
Beteiligten an<br />
der Präsentation<br />
in hohem<br />
Ausmaß<br />
gewürdigt.<br />
„Gemeindeminister“<br />
Ernst Strasser<br />
bedankte sich<br />
beim Österreichischen<br />
»<br />
Gemeinde-<br />
Endlich gleiche<br />
bund für die<br />
Schaffung<br />
Voraussetzungen<br />
«<br />
dieser Platt-<br />
für alle Gemeinden. form, „mit<br />
der zum<br />
Helmut Mödlhammer<br />
ersten Mal<br />
Gemeindebundpräsident<br />
alle Informationen<br />
für<br />
jede Gemeinde gebündelt zur Verfügung<br />
stehen.“ Er verwies auf die Wichtigkeit<br />
der Gemeinden als „erste<br />
Andockstellen“ für den Bürger und<br />
zeigte sich überzeugt, dass mit kommu-<br />
16 KOMMUNAL<br />
nalnet.at durch Kostenersparnis für die<br />
Kommunen und Effizienz- und<br />
Geschwindigkeitssteigerung in den Verwaltungsabläufen<br />
das Service für den<br />
Bürger erhöht wird.<br />
Gemeindebundpräsident Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer skizzierte das enorme<br />
Potential, das für jede Gemeinde in<br />
kommunalnet.at steckt. Durch die<br />
Schaffung dieser Plattform sei es nunmehr<br />
jeder Gemeinde unabhängig von<br />
ihrer Größe und der<br />
damit verbundenen<br />
finanziellen Basis möglich,<br />
einfach und rasch<br />
Zugang zu allen gemeinderelevantenInformationen<br />
zu erhalten. Auch<br />
wenn keinerlei Verpflichtung<br />
bestünde, an kommunalnet.atteilzunehmen,<br />
ist Mödlhammer<br />
sicher, dass jede<br />
Gemeinde erkennen<br />
wird, wie unverzichtbar<br />
kommunalnet.at für eine<br />
moderne Verwaltung sei.<br />
Er betonte, dass mit<br />
Mit einer<br />
Flächendeckung von<br />
Breitbandanbindung<br />
von österreichweit<br />
86 Prozent hat Telekom<br />
Austria wesentlichen<br />
Anteil daran,<br />
dass die Daten rasch<br />
und sicher fließen<br />
können.<br />
kommunalnet.at nun für alle Gemeinden<br />
die gleichen Voraussetzungen<br />
geschaffen seien. Und das bei sehr<br />
geringen Kosten weniger als 50 Euro<br />
pro Gemeinde und Monat.<br />
Dr. Reinhard Platzer, Generaldirektor<br />
und Vorstandsvorsitzender der <strong>Kommunal</strong>kredit<br />
Austria, wichtiger Finanzpartner<br />
nicht nur bei diesem gemeinsamen<br />
Projekt, berichtete vom großen Interesse,<br />
den kommunalnet.at in ganz<br />
Europa bereits vor seinem<br />
Start hervorgerufen<br />
habe. Mit kommunalnet.at<br />
sei ein inter-<br />
national herzeigbares,<br />
vorbildhaftes System<br />
geschaffen worden,<br />
das nicht nur in<br />
Europa, sondern auch<br />
in Kanada und Russland<br />
Interessenten<br />
gefunden habe.<br />
„Österreichs Gemeinden<br />
sind nun erfolgreicher<br />
Vorreiter in der<br />
Verwaltung.“ Schon<br />
jetzt sieht Platzer
Funktionen von www,kommunalnet.at<br />
Die Startseiten von <strong>Kommunal</strong>net<br />
sind auf das einzelne<br />
Bundesland abgestimmt. Alle<br />
beginnen mit dem jeweiligen<br />
Landeswappen und einem<br />
Begrüßungswort des Präsidenten<br />
des jeweiligen Landesverbandes<br />
des Österreichischen<br />
Gemeindebundes. Und<br />
natürlich führt ein Link direkt<br />
zu der Homepage des Verbandes,<br />
wie links anhand<br />
Vorarlbergs demonstriert.<br />
kommunalnet.at ist eine gemeinsame<br />
Plattform des Österreichischen Gemeindebundes,<br />
seiner Landesverbände und<br />
der <strong>Kommunal</strong>kredit Austria. Realisiert<br />
in Kooperation mit der Bundesrechenzentrum<br />
IT-Solutions GmbH<br />
(BIT-S) und Telekom Austria AG.<br />
Ziel von kommunalnet.at ist es,<br />
Österreichs Gemeinden kostengünstig<br />
den Einstieg ins E-Government zu<br />
ermöglichen und darüber hinaus die<br />
interkommunale Zusammenarbeit zu<br />
erleichtern: über gebündelte Information,<br />
direkte Kommunikation und Interaktion zwischen<br />
Gemeinden, Bund und Ländern sowie<br />
Produkt- und Serviceleistungen von Unternehmen.<br />
Zahlreiche nützliche Anwendungen stehen den Gemeinden über <strong>Kommunal</strong>net<br />
gebündelt zur Verfügung. Beispielsweise ist es nur ein Klick zur Grundstücksdatenbank.<br />
<strong>Kommunal</strong>net<br />
einen enormen Gewinn an Effizienz für<br />
die Verwaltungsabläufe in den Gemeinden.<br />
Zudem könne das System beispielsweise<br />
in Katastrophenfällen rasch<br />
für Rettung und Feuerwehr freigeschalten<br />
werden und so als zentrale Kommunikationsplattform<br />
zur raschen Hilfe für<br />
die Bevölkerung genutzt werden.<br />
Mag. Erhard Schmidt vom Bundesrechenzentrum,<br />
dessen Tochterfirma BIT-S<br />
GmbH für die störungsfreie Nutzung<br />
der Technik von kommunalnet.at verantwortlich<br />
zeichnet, berichtete von der<br />
großen Akzeptanz unter den Bürgermeistern<br />
an den seit 15. September freigeschaltenen<br />
Diensten von kommunalnet.at:<br />
„<strong>Kommunal</strong>net ist ein Meilen-<br />
»<br />
Österreichs<br />
Gemeinden sind<br />
nun erfolgreicher<br />
Vorreiter in der<br />
Verwaltung.<br />
Reinhard Platzer<br />
Generaldirektor der<br />
<strong>Kommunal</strong>kredit Austria<br />
stein in der Zukunft des eGovernments<br />
und trägt sehr positiv zum guten Ranking<br />
Österreichs in Europa bei. Wir<br />
vom Bundesrechenzentrum sind stolz,<br />
dass wir unser Know-how für dieses<br />
Projekt zur<br />
Verfügung stellen<br />
dürfen.“<br />
Als weiterer<br />
wichtiger Partner<br />
von kommunalnet.at<br />
unterstrich<br />
Anton Steinringer<br />
von<br />
Telekom Austria<br />
die Wichtigkeit<br />
von<br />
„nachhaltiger<br />
und breiter<br />
Anbindung an<br />
das Internet“.<br />
«<br />
» <strong>Kommunal</strong>net ist<br />
ein Meilenstein in<br />
der Zukunft des<br />
eGovernments und<br />
trägt sehr positiv<br />
zum guten Ranking<br />
Österreichs in<br />
Europa bei.<br />
Erhard Schmidt<br />
Bundesrechenzentrum<br />
Mit einer Flächendeckung von Breitbandanbindung<br />
von österreichweit 86<br />
Prozent hat Telekom Austria wesentlichen<br />
Anteil daran, dass die Daten rasch<br />
und sicher fließen können. Zum Thema<br />
Sicherheit strich Steinringer die<br />
Bemühungen der Telekom Austria um<br />
die digitale Signatur heraus, mit deren<br />
Hilfe Amtswege gesichert erfolgen können<br />
und der Datenaustausch von Dokumenten<br />
mit 100-prozentiger Sicherheit<br />
möglich sei.<br />
Walter Grossmann<br />
KOMMUNAL 17<br />
«
Recht & Verwaltung<br />
Adress-GWR-Online: eine Meldeschiene für die Zukunft<br />
Registerzählung löst<br />
Volkszählung ab<br />
Am 22. November 2004 nimmt das Adress-GWR-Online, die Gesamtösterreichische<br />
Lösung für Bund, Länder und Gemeinden, den Vollbetrieb auf. Seit 8. November steht<br />
den Gemeinden das System im Testbetrieb zur Verfügung. KOMMUNAL stellt das System<br />
mit seinen vielfältigen Möglichkeiten vor.<br />
◆ Dr. Norbert Rainer<br />
Was ist das Adress-GWR-Online?<br />
Das Adress-GWR-Online ist eine<br />
moderne Internet-Meldeschiene, die<br />
von der Statistik Austria in Zusammenarbeit<br />
mit dem Bundesamt für Eichund<br />
Vermessungswesen entwickelt<br />
wurde und die es den Gemeinden<br />
ermöglicht, zwei getrennte Register in<br />
einem Arbeitsschritt zu warten:<br />
◆ das vom Bundesamt für Eich- und<br />
Vermessungswesen geführte Adressregister<br />
(AR) sowie<br />
◆ das bei der Statistik Austria eingerichtete<br />
Gebäude- und Wohnungsregister<br />
(GWR).<br />
Die gesetzliche Grundlage für das<br />
Adress-GWR-Online bilden einerseits<br />
das Vermessungsgesetz (§ 44) und<br />
andererseits das Gebäude- und Wohnungsregistergesetz<br />
(§ 5), BGBl. I Nr.<br />
9/2004.<br />
Das Adressregister enthält einen österreichweiten<br />
authentischen Adressbestand<br />
mit einheitlichem Aufbau, der –<br />
◆ Hofrat Dr. Norbert Rainer ist Leiter<br />
der Abteilung Register, Klassifikationen<br />
und Methodik in der Statistik Austria<br />
18 KOMMUNAL<br />
im Sinne von E-Government – sowohl<br />
eine wichtige Grundlage für die<br />
gesamte Verwaltung darstellt als auch<br />
von der Wirtschaft und der allgemeinen<br />
Öffentlichkeit genutzt<br />
werden kann. Das<br />
Gebäude- und Wohnungs-<br />
register enthält darüber<br />
hinaus Strukturdaten von<br />
Gebäuden-, Wohnungen<br />
und anderen Nutzungseinheiten<br />
sowie die Adressen<br />
der Wohnungen und anderen<br />
Nutzungseinheiten.<br />
Da das Adressregister im<br />
Gegensatz zum Gebäudeund<br />
Wohnungsregister<br />
öffentlich zugänglich ist,<br />
sind aufgrund der unterschiedlichen<br />
Zugriffsrechte<br />
beide Register getrennt zu<br />
führen. Die Gemeinden haben Daten,<br />
die in beide Register fließen, jedoch<br />
nur einmal über die gemeinsame Meldeschiene<br />
„Adress-GWR-Online“ zu<br />
erfassen. Diese gemeinsame Meldeschiene<br />
dient nicht nur der Entlastung<br />
der Gemeinden, sondern sie stellt auch<br />
sicher, dass Adressen von Gebäuden<br />
konsistent mit den Strukturdaten der<br />
Gebäude geführt werden können.<br />
Zugang zum<br />
Adress-GWR-Online<br />
Einer Gemeinde stehen zwei Möglichkeiten<br />
zur Verfügung mit dem Adress-<br />
GWR-Online zu arbeiten:<br />
◆ Die Adressen und Gebäudedaten<br />
können direkt über die HTML-Oberfläche<br />
des Adress-GWR-Online in die<br />
Register einpflegt werden.<br />
◆ Eine spezielle XML-Schnittstelle<br />
ermöglicht es die<br />
Register auch<br />
über individuelle<br />
Das Adressregister<br />
enthält einen österreichweiten<br />
authentischen<br />
Adressbestand mit<br />
einheitlichem Aufbau,<br />
der eine wichtige Grundlage<br />
für die gesamte<br />
Verwaltung darstellt.<br />
Gemeindsoftware<br />
zu warten.<br />
Der Zugang zum<br />
Adress-GWR-<br />
Online erfolgt in<br />
beiden Fällen<br />
über das Portal<br />
Austria. Ein<br />
kostenloser<br />
Zugang zu diesem<br />
Portal wird<br />
allen Gemeinden<br />
für die Benutzung<br />
dieser Meldeschiene von der Statistik<br />
Austria zur Verfügung gestellt.<br />
Abläufe im Adress-GWR<br />
Auch wenn großer Wert darauf gelegt<br />
wurde, die Bedienung des Adress-<br />
GWR-Online für die Gemeinden so einfach<br />
wie nur möglich zu gestalten, laufen<br />
im Hintergrund und unbemerkt<br />
von den Benutzern eine ganze Reihe<br />
weiterer Prozesse ab.<br />
So besteht die Möglichkeit Geocodierungen<br />
vorzunehmen. Eine vom Bundesamt<br />
für Eich- und Vermessungswesen<br />
entwickelte Software („Geocodierungsclient“),<br />
die innerhalb der Applikation<br />
aufgerufen werden kann,<br />
ermöglicht es unentgeltlich Geokoordi-
Schematische Überblicke über das Adress-GWR-Online<br />
Ablaufschema Adresseingabe<br />
Bevor eine Adresse oder ein Gebäude in den Registern verspeichert werden kann,<br />
erfolgt eine automatische Prüfung der Eingaben (z.B. Grundstücksnummer, …)<br />
in der Digitalen Katastralmappe. Wenn diese Prüfung positiv verläuft, gehen die<br />
Daten in das Adressregister (AR) und das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)<br />
über. Alle 30 Sekunden erfolgt auch eine Weitergabe der neuen oder geänderten<br />
Adressen an das Zentrale Melderegister II (ZMR II). Natürlich stehen den Gemeinden<br />
alle Änderungen und Ergänzungen des Bestandes sofort zur Verfügung.<br />
Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten des GWR<br />
Durch die Einführung des Adress-GWR-Online ergeben sich für die Gemeinden<br />
zahlreiche Nutzen und Vorteile. So können unter anderem die Gemeinden mittels<br />
Adress-GWR-Online alle bundesgesetzlichen Meldeverpflichtungen betreffend<br />
der Adressdaten erfüllen. Und Gemeindeinterne Registerauswertungen können<br />
von den Gemeinden selbst vorgenommen werden und durch die Koppelung<br />
GWR - Zentrales Melderegister II (ZMR II) wird die Qualität der Meldeadressen<br />
verbessert.<br />
Recht & Verwaltung<br />
naten für jede Adresse und jedes<br />
Gebäude zu bestimmen. Außerdem<br />
können die Adressen und Gebäude<br />
Grundstücken zugeordnet werden. Im<br />
Hintergrund dieser Geocodierung stehen<br />
die Digitale<br />
Katastralmappe<br />
(DKM) und die<br />
Grundstücksdatenbank<br />
(GDB).<br />
Bevor eine<br />
Adresse oder ein<br />
Gebäude in den<br />
Registern verspeichert<br />
werden<br />
kann, erfolgt eine<br />
automatische<br />
Prüfung der Eingaben<br />
(z.B.<br />
Grundstücksnummer,<br />
…) in der<br />
Digitalen Katastralmappe.<br />
Wenn<br />
Den Gemeinden<br />
steht jederzeit<br />
der tagesaktuelle<br />
Stand an Gebäuden<br />
und Wohnungen<br />
innerhalb des<br />
eigenen Gemeindegebietes<br />
zur<br />
Verfügung.<br />
diese Prüfung positiv verläuft, gehen<br />
die Daten in das Adressregister (AR)<br />
und das Gebäude- und Wohnungsregister<br />
(GWR) über. Alle 30 Sekunden<br />
erfolgt auch eine Weitergabe der neuen<br />
oder geänderten Adressen an das Zentrale<br />
Melderegister II (ZMR II). Natürlich<br />
stehen den Gemeinden alle Änderungen<br />
und Ergänzungen des Bestandes<br />
sofort zur Verfügung.<br />
GWR im Zentrum vielfältigster<br />
Anforderungen<br />
Das Gebäude- und Wohnungsregister<br />
als eines der zentralen Register im Rahmen<br />
zukünftiger E-Government Prozesse<br />
ist die Basis für eine Reihe verschiedenster<br />
Anforderungen:<br />
◆ Die bisherige Wohnbaustatistik, in<br />
der nur Gebäude mit Wohnungen<br />
eine Rolle spielten, wird durch eine<br />
Baumaßnahmenstatistik abgelöst,<br />
die auch neu errichtete Gebäude<br />
ohne Wohnungen berücksichtigt.<br />
◆ Verpflichtende Meldungen an die EU<br />
bezüglich der aktuellen Baumaßnahmen<br />
können direkt aus dem Register<br />
abgeleitet werden.<br />
◆ Den Gemeinden steht jederzeit der<br />
tagesaktuelle Stand an Gebäuden<br />
und Wohnungen innerhalb des eigenen<br />
Gemeindegebietes zur Verfügung.<br />
Zusätzliche gemeindespezifische<br />
Merkmale können von den<br />
Gemeinden in das Register eingepflegt<br />
und für interne Verwaltungszwecke<br />
genützt werden.<br />
◆ Die Statistik Austria nützt das<br />
Gebäude- und Wohnungsregister für<br />
die Erstellung von Gebäude- und<br />
Wohnungsstatistiken, die der politi-<br />
KOMMUNAL 19
Recht & Verwaltung<br />
schen Entscheidungsfindung, der<br />
Raumplanung, etc. dienen.<br />
◆ Die Klassifikation der Gebäude, die<br />
im Gebäude- und Wohnungsregister<br />
vorgenommen wird, wird dem<br />
Adressregister übermittelt.<br />
◆ Es besteht eine direkte Beziehung<br />
zwischen dem Gebäude- und Wohnungsregister<br />
und dem Meldewesen<br />
(Wohnungsadresse).<br />
Das GWR im Zentrum verschiedenster<br />
Nutzungen<br />
Nutzen und Vorteile:<br />
Durch die Einführung des Adress-GWR-<br />
Online ergeben sich für die Gemeinden<br />
zahlreiche Nutzen und Vorteile:<br />
◆ Die Gemeinden erfüllen mittels<br />
Adress-GWR-Online alle bundesgesetzlichen<br />
Meldeverpflichtungen<br />
betreffend der Adressdaten.<br />
◆ Durch die laufende Wartung des<br />
Adress-, GebäudeundWohnungsbestandes<br />
werden<br />
aufwändige Voll-<br />
erhebungen (wie<br />
z.B. zuletzt die<br />
Gebäude- und<br />
Wohnungszählung<br />
2001), die<br />
bisher von den<br />
Gemeinden<br />
durchgeführt wurden,<br />
abgelöst.<br />
◆ Die Erfassung der<br />
Baumaßnahmenmeldungen<br />
erfolgt nur mehr<br />
elektronisch über<br />
das Adress-GWR-<br />
Online.<br />
◆ Gemeindeinterne<br />
Registerauswertungen können von<br />
den Gemeinden selbst vorgenommen<br />
werden.<br />
◆ Durch die Koppelung GWR – Zentrales<br />
Melderegister II (ZMR II) wird<br />
die Qualität der Meldeadressen verbessert.<br />
Erstbefüllung der Register.<br />
Zum Zeitpunkt des Echtbetriebes des<br />
Adress-GWR-Online werden die<br />
Gemeinden keine leeren Register vorfinden,<br />
welche zur Gänze neu befüllt<br />
werden müssen, sondern vielmehr<br />
Register, die so gut es eben möglich<br />
war, mit Daten vorbefüllt sind.<br />
Die Erstbefüllung des Adressregisters<br />
besteht im Wesentlichen aus dem<br />
Adressteil des bisher von der Statistik<br />
Austria geführten Gebäuderegisters<br />
und der darin enthaltenen Kennziffern<br />
20 KOMMUNAL<br />
(z.B. Ortschaftskennziffer,Adresscode,<br />
…). Dieser<br />
Bestand wurde<br />
mit den Adressen<br />
des Bundesamts<br />
für Eich- und Vermessungswesen<br />
abgeglichen und<br />
um die dort vorhandenen<br />
GIS-<br />
Koordinaten<br />
sowie die Grundstücksnummern<br />
erweitert. Ferner<br />
wurden – soweit<br />
vorhanden – die<br />
Zum Zeitpunkt des<br />
Echtbetriebes des<br />
Adress-GWR-Online<br />
werden die Gemeinden<br />
keine leeren Register<br />
vorfinden, sondern<br />
vielmehr solche, die so<br />
gut es eben möglich<br />
war, mit Daten<br />
vorbefüllt sind.<br />
Im Adress-GWR-<br />
Online werden<br />
erstmalig auch die<br />
Adressen von<br />
Nutzungseinheiten<br />
(z.B. Wohnungen,<br />
Geschäftslokale,<br />
Arztpraxen, …)<br />
geführt.<br />
Adressen der sonstigen Baulichkeiten<br />
in die Erstbefüllungsdaten aufgenommen.<br />
Im Adress-GWR-Online werden<br />
erstmalig auch die Adressen von Nutzungseinheiten<br />
(z.B. Wohnungen,<br />
Geschäftslokale, Arztpraxen, …)<br />
geführt. Da dies auch in Zusammenhang<br />
mit dem Meldewesen<br />
von unmittelbarer<br />
Bedeutung ist, wurden<br />
im Vorfeld Abglei-<br />
che mit dem Bestand<br />
des Zentralen Melderegisters<br />
durchgeführt.<br />
Die Erstbefüllung des<br />
Gebäude- und Wohnungsregisters<br />
mit<br />
Gebäuden und Nutzungseinheiten<br />
wurde<br />
vor allem aufgrund der<br />
Angaben bei der<br />
Gebäude- und Wohnungszählung<br />
2001<br />
(GWZ 2001) sowie der<br />
bisherigen Wohnbaustatistik<br />
vorgenommen.<br />
Mit dem Adress-GWR-<br />
Online auf dem Weg in die Zukunft.<br />
In einem Ministerratsbeschluss vom 27.<br />
Juni 2000 wurde festgelegt, dass die<br />
Großzählung 2001 die letzte traditionelle<br />
Großzählung in Österreich gewesen<br />
sein sollte. Zukünftig sollen Zählungen<br />
dieser Art durch Registerzählungen<br />
ersetzt werden.<br />
Dieser Beschluss ist durch folgende<br />
Gründe motiviert:<br />
◆ Hohe Kosten der bisherigen<br />
Großzählungen<br />
◆ Unverhältnismäßig hohe Belastung<br />
für Gemeinden und Bürger<br />
◆ Zeitaufwändige Aufbereitung der<br />
Daten und damit verbunden späte<br />
Verfügbarkeit der Ergebnisse<br />
◆ Zeitgemäße Internetanwendungen<br />
ersetzen Papierfragebogen<br />
◆ Verfügbarkeit von Daten in verschiedenen<br />
administrativen Registern<br />
◆ Verkürzung der bisherigen 10-<br />
Jahres Intervalle wäre viel zu<br />
teuer<br />
Die Statistik Austria arbeitet<br />
derzeit mit Priorität an der<br />
Umsetzung der im Ministerratsbeschluss<br />
geforderten Umstellung<br />
auf künftige Registerzählungen.<br />
Eine wesentliche Basis<br />
hierfür ist die Errichtung eines<br />
modernen Gebäude- und Wohnungsregisters.<br />
Die Statistik<br />
Austria ist überzeugt, dass dieses<br />
Register nicht nur den Registerzählungen<br />
dienen wird, sondern<br />
dass bereits vorweg die<br />
Gemeinden vielfachen Nutzen daraus<br />
ziehen werden.<br />
Unterstützungsmaßnahmen<br />
der Statistik Austria<br />
Schulungsversion<br />
erhältlich<br />
Zur Unterstützung der Gemeinden<br />
wurde von der Statistik Austria<br />
bereits eine eigene Hotline<br />
eingerichtet. Unter der Wiener<br />
Telefonnummer 01-71128-7900<br />
beantworten speziell geschulte<br />
Mitarbeiter der Statistik Austria<br />
den Gemeinden von Montag bis<br />
Freitag zwischen 7.00 und 16.00<br />
Uhr Fragen das Adress-GWR-<br />
Online betreffend.<br />
Darüber hinaus stellt die Statistik<br />
Austria eine Schulungsapplikation<br />
zur Verfügung, welche eine<br />
Spiegelung des Echtdatenbestandes<br />
der jeweiligen Gemeinden<br />
enthält und dieselben Funktionalitäten<br />
bietet wie die eigentliche<br />
Applikation. Die Schulungsversion<br />
ermöglicht es, Arbeitsschritte<br />
zunächst auszuprobieren, ohne<br />
dass die dort geänderten Daten in<br />
den tatsächlichen Bestand des<br />
Adressregisters bzw. Gebäudeund<br />
Wohnungsregisters aufgenommen<br />
werden. In der Applikation<br />
selbst sind Hilfetexte zu den<br />
einzelnen Merkmalen enthalten.<br />
Weiters bietet die Statistik Austria<br />
unter www.statistik.at/adressgwr-online<br />
allgemeine Informationen<br />
über das Projekt sowie<br />
zahlreiche Arbeitsunterlagen<br />
(Benutzerhandbuch, Merkmalskatalog,<br />
etc.) für die Gemeinden an.
Das Bundesvergabegesetz 2002 in den Gemeinden<br />
Die Geltung der materiellen Bestimmungen<br />
des BVergG 2002 für Landesund<br />
Bundesbeschaffungen ist das<br />
Ergebnis langer Diskussionen um die<br />
Vereinheitlichung des Vergaberechts,<br />
dem Recht der Vergabe öffentlicher<br />
Aufträge.<br />
Vergaberechtsschutz neu<br />
– 9 Landesgesetze<br />
Neben dem ab 1.7.2002 spätestens in<br />
allen Bundesländern zur Anwendung<br />
gelangenden BVergG 2002 traten neun<br />
Vergaberechtschutzgesetze in Kraft. Je<br />
nachdem welche Gemeinde oder welcher<br />
Gemeindeverband eine Leistung<br />
1 Nach Art 151 Abs 27 B-VG traten die Landes-Vergabegesetze<br />
spätestens mit 30.6.2003<br />
außer Kraft, weshalb ein unterschiedliches In-<br />
Kraft-Treten des BVergG 2002 in den Bundesländern<br />
erfolgte: Burgenland (1.7.2003),<br />
beschaffen möchte, gelangen ua zur<br />
Überprüfung von Auftraggeberentscheidungen<br />
entweder das<br />
◆ Burgenländische Vergabe-Nachprüfungsgesetz<br />
(VNPG),<br />
◆ Kärntner Vergaberechtschutzgesetz<br />
(K-VergRG),<br />
◆ Niederösterreichische Vergabenachprüfungsgesetz<br />
(NÖVergNG),<br />
◆ Oberösterreichisches Vergabenachprüfungsgesetz<br />
(OÖVergNG),<br />
◆ Salzburger Vergabekontrollgesetz<br />
(S.VKG),<br />
◆ Steiermärkisches Vergabe-Nachprüfungsgesetz<br />
(StmkVergNG),<br />
◆ Tiroler Vergabenachprüfungsgesetz<br />
2002 (TirVergNG),<br />
◆ Vorarlberger Vergabe-Nachprüfungs-<br />
Kärnten (1.7.2003), Niederösterreich<br />
(1.3.2003), Oberösterreich (1.1.2003), Salzburg<br />
(1.1.2003), Steiermark (1.7.2003), Tirol<br />
(1.1.2003), Vorarlberg (1.1.2003) und Wien<br />
(1.7.2003).<br />
Recht & Verwaltung<br />
Das Bundesvergabegesetz (BVergG 2002) trat am 1.9.2002 auf Bundesebene in Kraft<br />
und gilt spätestens seit 1.7.20031 auch einheitlich in allen Bundesländern und damit<br />
auch in den Gemeinden. KOMMUNAL berichtet über die Auswirkungen auf die Vergabe<br />
öffentlicher Aufträge durch die Gemeinden.<br />
◆ Dr. Katharina Hahnl<br />
Ein Vergaberecht light für den Unterschwellenbereich<br />
soll den Anforderungen<br />
an eine leichtere Vergabe von Aufträgen<br />
mit einem geringeren Beschaffungsvolumen<br />
sichern.<br />
Vergaberecht „light“<br />
entlastet Gemeinden<br />
gesetz (VbgVergNG) oder<br />
◆ das Wiener Vergaberechtschutzgesetz<br />
(WVRG)<br />
zur Anwendung.<br />
Die Landes-Vergaberechtschutzgesetze<br />
lehnen sich im wesentlichen an das im<br />
BVergG 2002 für den Bund zugrunde<br />
◆ Dr. Katharina Hahnl ist Lektorin an<br />
der Fachhochschule Wiener Neustadt<br />
für Wirtschaft und Technik<br />
KOMMUNAL 21
Recht & Verwaltung<br />
gelegte Rechtschutzsystem an, wobei<br />
insbesondere auf die Unterscheidung<br />
zwischen gesondert und verbunden<br />
anfechtbaren Entscheidungen, wie auch<br />
die Festlegung von sogenannten Präklu-<br />
Die Landes-Vergaberechtschutzgesetze<br />
lehnen sich im<br />
wesentlichen an das im BVergG<br />
2002 für den Bund zugrunde<br />
gelegte Rechtschutzsystem an.<br />
sionsfristen zu verweisen ist.<br />
Auf Bundesebene weiterhin zuständig<br />
ist das – seit 1.9.2002 neu eingerichtete<br />
– Bundesvergabeamt, in den Ländern<br />
sind<br />
◆ in Wien der Wiener Vergabekontrollsenat,<br />
◆ in Salzburg der Salzburger Vergabekontrollsenat,<br />
und in den Bundesländern<br />
◆ Burgenland, Kärnten, Niederösterreich,<br />
Oberösterreich Steiermark,<br />
Tirol und Vorarlberg die Unabhängigen<br />
Verwaltungssenate<br />
zur nachprüfenden Kontrolle von Auftraggeberentscheidungen<br />
im Vergabeverfahren<br />
berufen.<br />
Unterschwellenbereich<br />
vom BVergG erfasst<br />
Neu ist ebenfalls, dass nicht nur Aufträge<br />
über einen geschätzten Auftragswert<br />
ohne USt (Bau- und Baukonzessionsaufträge<br />
von mindestens fünf Millionen<br />
Euro, Liefer-, Dienstleistungs- und<br />
Dienstleistungskonzessionsverträge ab<br />
200.000 Euro) im Oberschwellenbereich<br />
dem BVergG 2002 unterliegen,<br />
sondern auch sogenannte Beschaffungen<br />
im „Unterschwellenbereich“ nach<br />
einem im BVergG 2002 normierten Verfahren<br />
zu vergeben sind.<br />
Nach der bisherigen Rechtslage unterlagen<br />
Auftragsvergaben im Unterschwellenbereich<br />
durch Verbindlicherklärung<br />
der ÖNORM A 2050 einer materiellen,<br />
vergaberechtlichen Regelung und<br />
waren die ordentlichen Gerichte zur<br />
nachprüfenden Kontrolle berufen. Aufgrund<br />
der Judikatur des Verfassungsge-<br />
2 Siehe jüngst Bericht des Bundesministeriums<br />
für Wirtschaft und Arbeit über die Auswirkungen<br />
des Rechtsschutzes auf den Bereich<br />
unterhalb der Schwellenwerte (E 133-NR/XXI.<br />
GP; E-178-BR/2002).<br />
22 KOMMUNAL<br />
richtshofes sah es der Gesetzgeber als<br />
erforderlich an, auch den Unterschwellenbereich<br />
dem BVergG 2002 zu unterwerfen<br />
und dem verwaltungsbehördlichen<br />
Vergaberechtschutz 2 zugänglich zu<br />
machen (dh statt Zuständigkeit der<br />
ordentlichen Gerichte, Anrufung der<br />
Vergabekontrollbehörden).<br />
Sämtliche Beschaffungen der öffentlichen<br />
Auftraggeber und damit auch der<br />
Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
(§ 7 Abs 1 Z 1 BVergG 2002 iVm<br />
Art 14b Abs 2 Z 2 lit a B-VG) unterliegen<br />
damit dem Anwendungsbereich<br />
des BVergG 2002 (zu den Ausnahmen<br />
siehe § 6 BVergG 2002). Das BVergG<br />
2002 unterscheidet jetzt ausdrücklich<br />
zwischen Ober- und Unterschwellenbereich.<br />
Den Erfordernissen an ein vereinfachtes<br />
Vergaberegime für Beschaffungen mit<br />
einem geringeren Auftragswert wurde<br />
insofern Rechnung getragen, als zB die<br />
Wahl der jeweiligen Verfahrensart<br />
erleichtert wurde und auch generell<br />
kürzere Fristen im Unterschwellenbereich<br />
vorgesehen wurden:<br />
Vergabeverfahren light<br />
für Beschaffungen im<br />
Unterschwellenbereich<br />
Wahl der Verfahrensart: Grundsätzlich<br />
kann im Unterschwellenbereich wie<br />
auch im Oberschwellenbereich frei zwischen<br />
dem offenen Verfahren und dem<br />
nicht offenen Verfahren mit vorheriger<br />
Bekanntmachung 3 gewählt werden.<br />
„Erleichternd“ kommt im Unterschwellenbereich<br />
jedoch hinzu, dass bei Nichterreichen<br />
bestimmter Schwellenwerte<br />
neben den für den Oberschwellenbereich<br />
geregelten Fällen (§ 25 BVergG<br />
2002) in weiteren Konstellationen Verfahren<br />
ohne vorherige Bekanntmachung<br />
zulässig sind:<br />
◆ So können etwa Bauaufträge, die den<br />
geschätzten Auftragswert ohne USt<br />
von 120.000 Euro nicht erreichen, im<br />
nicht offenen Verfahren ohne vorherige<br />
Bekanntmachung vergeben werden,<br />
sofern dem Auftraggeber genügend<br />
geeignete Unternehmer<br />
3 Im offenen Verfahren wird eine unbeschränkte<br />
Anzahl von Unternehmen öffentlich<br />
zur Abgabe von Angeboten aufgefordert (§ 23<br />
Abs 2 BVergG). Bei nicht offenen Verfahren<br />
mit vorheriger Bekanntmachung werden,<br />
nachdem eine unbeschränkte Anzahl von<br />
Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen<br />
aufgefordert wurde, ausgewählte<br />
Bewerber zur Abgabe von Angeboten<br />
aufgefordert (§ 23 Abs 3 BVergG).<br />
bekannt sind, um einen freien und<br />
lauteren Wettbewerb sicher zu stellen<br />
(§ 26 Abs 1 Z 1 BVergG 2002).<br />
◆ Weiters können Bauaufträge, die<br />
einen Schwellenwert von 80.000<br />
Euro nicht erreichen im Verhandlungsverfahren<br />
ohne vorherige<br />
Bekanntmachung vergeben werden<br />
(§ 26 Abs 3 Z 1 BVergG 2002).<br />
◆ Überhaupt können Bauaufträge bis<br />
zu 20.000<br />
Euro<br />
direkt ver-<br />
geben<br />
werden (§<br />
27 Abs 1<br />
Z 2<br />
BVergG<br />
2002).<br />
Auf die<br />
Möglichkeit<br />
der Durchführung<br />
einer elektronischen<br />
Auktion zur<br />
Vergabe von<br />
Bauaufträge, die<br />
einen Schwellenwert<br />
von 80.000 Euro<br />
nicht erreichen.<br />
können im Verhandlungsverfahren<br />
ohne<br />
vorherige Bekanntmachung<br />
vergeben<br />
werden.<br />
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen<br />
über standardisierte Leistungen bis zu<br />
einem Schwellenwert von 40.000 Euro,<br />
wie auch den Abschluss von Rahmenvereinbarungen,<br />
wird an dieser Stelle
Bauaufträge, die den geschätzten Auftragswert ohne USt von 120.000 Euro nicht erreichen,<br />
können im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben<br />
werden, sofern dem Auftraggeber genügend geeignete Unternehmer bekannt<br />
sind, um einen freien und lauteren Wettbewerb sicher zu stellen.<br />
verwiesen.<br />
Zwar gelten die Bestimmungen des<br />
BVergG 2002 generell für alle Auftragsarten<br />
ungeachtet ihres Auftragswertes,<br />
doch gibt es Abweichungen zwischen<br />
Ober- und Unterschwellenbereich<br />
betreffend die Bekanntmachung und<br />
die einzuhaltenden Fristen:<br />
◆ Im Unterschwellenbereich hat keine<br />
Bekanntmachung im Amtsblatt der<br />
Europäischen Gemeinschaften zu<br />
erfolgen, sondern entsprechend den<br />
Verordnungen des Bundeskanzlers<br />
und der Landesregierungen (§ 44<br />
Abs 2 BVergG 2002) in nachstehenden<br />
Medien:<br />
➢ Bund: Amtlicher Lieferungsanzeiger<br />
(Wiener Zeitung);<br />
➢ Burgenland: Landesamtsblatt für<br />
das Burgenland;<br />
➢ Kärnten: Kärntner Landeszeitung<br />
– Amtsblatt für das Land Kärnten<br />
oder im Internet;<br />
➢ Niederösterreich: Amtliche Nachrichten<br />
der niederösterreichischen<br />
Landesregierung;<br />
➢ Oberösterreich: Amtliche Linzer<br />
Zeitung oder im Internet;<br />
➢ Salzburg: im Internet unter der<br />
Adresse www.salzburg.gv.at;<br />
➢ Steiermark: Grazer Zeitung –<br />
Amtsblatt für die Steiermark oder<br />
im Internet;<br />
➢ Tirol: Bote für Tirol;<br />
➢ Vorarlberg: Amtsblatt für das Land<br />
Vorarlberg oder im Internet;<br />
➢ Wien:<br />
www.gemeinderecht.wien.at.<br />
◆ Auch sieht § 50 BVergG 2002 für den<br />
Unterschwellenbereich im Vergleich<br />
zum Oberschwellenbereich kürzere<br />
(Mindest-)Fristen für die Bewerbungs-<br />
und Angebotsabgabe vor:<br />
1. Offenes Verfahren<br />
Angebotsfrist<br />
a) Normales Verfahren: mindestens 22<br />
Tage<br />
b) Verkürzung der Frist in besonders<br />
begründeten Fällen, insbesondere bei<br />
Dringlichkeit<br />
2. nicht offenes Verfahren mit vorheriger<br />
Bekanntmachung<br />
Eingang der Teilnahmeanträge: minde-<br />
stens 14 Tage Angebotsfrist<br />
a) Normales Verfahren: mindestens 22<br />
Tage<br />
b) Verkürzung der Frist in besonders<br />
begründeten Fällen, insbesondere bei<br />
Dringlichkeit<br />
3. nicht offenes Verfahren ohne vorherigeBekanntmachung<br />
Gemeinden haben<br />
bei der Vergabe von<br />
Aufträgen generell das<br />
BVergG 2002 zu beachten,<br />
und zwar auch bei<br />
Beschaffungen im Unterschwellenbereich,<br />
zu<br />
deren Nachprüfung<br />
nunmehr die jeweiligen<br />
Landes-Vergabekontrollbehörden<br />
berufen sind.<br />
Recht & Verwaltung<br />
Angebotsfrist<br />
a) NormalesVerfahren:mindestens<br />
22<br />
Tage<br />
b) Verkürzung<br />
der<br />
Frist in<br />
besonders<br />
begründeten<br />
Fällen,<br />
insbesondere<br />
bei<br />
Dringlichkeit<br />
4. Verhandlungsverfahren mit vorheriger<br />
Bekanntmachung<br />
Eingang der Teilnahmeanträge: mindestens<br />
14 Tage<br />
Angebotsfrist: keine gesetzliche Regelung<br />
Schlussbemerkung<br />
Gemeinden haben bei der Vergabe von<br />
Aufträgen generell das BVergG 2002<br />
zu beachten, und zwar auch bei<br />
Beschaffungen im Unterschwellenbereich,<br />
zu deren Nachprüfung nunmehr<br />
die jeweiligen Landes-Vergabekontrollbehörden<br />
berufen sind. Ein Vergaberecht<br />
light für den Unterschwellenbereich<br />
soll den Anforderungen an eine<br />
leichtere Vergabe von Aufträgen mit<br />
einem geringeren Beschaffungsvolumen<br />
sichern.<br />
Zur Person Katharina Hahnl<br />
Die mehrfach ausgewiesene Expertin<br />
für Vergaberecht arbeitet neben ihrer<br />
Tätigkeit als Lektorin an der Fachhochschule<br />
Wiener Neustadt für<br />
Wirtschaft und Technik seit kurzem<br />
auch für die rennomierte Rechtsanwaltskanzlei<br />
Karasek & Wietrzyk.<br />
Sie entwickelt dort gemeinsam mit<br />
spezialisierten Juristen vor allem auf<br />
den Gebieten Gesellschafts-, Wettbewerbs-,<br />
finanzierungs-, Bau- und<br />
Umweltrecht maßgeschneiderte<br />
Lösungen für Klienten.<br />
KOMMUNAL 23
Gemeindebund<br />
Michael Häupl und Helmut Mödlhammer<br />
überreichen Prof. Dr. Arno Kahl von der<br />
Uni Innsbruck die Sieger-Urkunde für<br />
seine Arbeit.<br />
„Ich danke den Preisträgern für ihre<br />
großen wissenschaftlichen Anstrengungen<br />
im Dienste der Allgemeinheit. Als<br />
Städtebund-Präsident bin ich stolz auf<br />
das hohe Niveau der kommunalen Forschung<br />
in Österreich. Mit dem Preis der<br />
Kommunen wollen wir diese außerordentlichen<br />
Leistungen gebührend anerkennen“,<br />
meinte Bürgermeister Michael<br />
Häupl bei der Verleihung des diesjährigen<br />
<strong>Kommunal</strong>preises im Wiener Rathaus.<br />
Dieses Jahr wurden vier Akademiker<br />
unter 40 Jahren in den drei Kategorien<br />
Diplomarbeit, Dissertation, Habilitation<br />
mit Preisen im Gesamtrahmen von 7000<br />
Euro geehrt. Insgesamt 26 Einreichungen<br />
mit zusammen mehreren 1000 Seiten<br />
wurden von der Jury unter dem Vorsitz<br />
von Univ.-Prof. Theo Öhlinger bewertet.<br />
24 KOMMUNAL<br />
Die Sieger des „Preises der Kommunen<br />
2004“: Gabriele Stoisser, Michael Einböck,<br />
Kim Meyer-Cech und Arno Kahl mit den<br />
beiden Präsidenten der beiden kommunalen<br />
Verbände, die den Preis der Kommunen<br />
2002 ins Leben berufen haben.<br />
„Preis der Kommunen 2004“ verliehen<br />
Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer<br />
bezog sich in seiner Ansprache<br />
auf vor allem auf die Tatsache, dass die<br />
schwierige Arbeit der Gemeindevertreter<br />
durch diese wissenschaftlichen Arbeiten<br />
aufgearbeitet würden.<br />
„Mit ihren Leistungen<br />
bestärken sie die Gemein-<br />
demandatare in ihrer täglichen<br />
Arbeit. Sie begleiten,<br />
ermutigen und<br />
bestärken sie in ihrem<br />
täglichen Kampf zum<br />
Wohle der Bürger.“<br />
Univ.-Prof. Öhlinger hob<br />
die schwierigen Bedingungen<br />
in der Forschung<br />
hervor, es werde für die<br />
Wissenschaft „immer<br />
„Ihre Arbeit wird die Gemeinden in ihrem<br />
täglichen Kampf für die Bürger begleiten,<br />
ermutigen und bestärken.“ Helmut Mödlhammer<br />
in seiner Dankesrede.<br />
Wissenschaft im Dienst<br />
der Gemeinden<br />
Der Dank für wissenschaftlichen Einsatz im Dienste der Allgemeinheit stand im<br />
Vordergrund, als die vier Preisträger des Wissenschaftspreises 2004 prämiert wurden.<br />
KOMMUNAL war im Wiener Rathaus dabei.<br />
Insgesamt 26<br />
Arbeiten mit<br />
zusammen mehreren<br />
1000 Seiten wurden<br />
von der Jury unter<br />
dem Vorsitz von<br />
Univ.-Prof. Theo<br />
Öhlinger bewertet.<br />
enger“, um so höher seien die Leistungen<br />
der Geehrten einzuschätzen. Im Mittelpunkt<br />
der Ehrung durch Laudator<br />
Öhlinger standen die vier ausgezeichneten<br />
AutorInnen, deren Forschungsspektrum<br />
von der zukünftigen<br />
rechtlichen Ausgestaltung<br />
der Daseinsvorsorge bis<br />
hin zu Fragestellungen im<br />
Umfeld einer älter werdenden<br />
Gesellschaft<br />
reichte.<br />
Gabriele Stoiser beschäftigte<br />
sich in ihrer Dissertation<br />
mit der Thematik<br />
Lebensqualität und Ortsverbundenheit,<br />
dargestellt<br />
am Beispiel der Landeshauptstadt<br />
Klagenfurt.<br />
Fotos: Ernst Horvath
»<br />
Lebensqualität und Attraktivität einer<br />
Stadt entscheiden heute wesentlich mit<br />
über deren Entwicklung als zukunftsträchtiger<br />
Standort. “Lebensqualität ist<br />
ein multidimensionaler Begriff. Lebensqualität<br />
entsteht durch die optimale<br />
Abdeckung der Bedürfnisse der Einwohner.<br />
Sie leitet sich dem Freizeit- und Bildungsangebot,<br />
aus den Umweltbedingungen,<br />
aber auch aus der konkreten<br />
Wohngegend ab“, meinte Stoiser am<br />
Rande des Festaktes.<br />
Die mit der Frage des „Ageing“ verbundene<br />
Entwicklung des Controlling in<br />
Alten- und Pflegenheimen rückte Michael<br />
Einböck ins Zentrum seiner Diplomarbeit.<br />
Einböck diagnostiziert in seiner<br />
Untersuchung erheblichen Nachholbedarf<br />
im Einsatz von Controlling-Instrumenten.<br />
Gerade die demografische Entwicklung<br />
legt<br />
die Ausschöpfung<br />
aller<br />
betriebswirtschaftlichen<br />
Methoden<br />
nahe.<br />
„Was macht<br />
touristische<br />
Themenstraßenerfolgreich?“<br />
war<br />
die Ausgangsfrage<br />
von Kim<br />
Meyer-Cech.<br />
«<br />
Die Autorin<br />
empfiehlt eine<br />
verstärkte<br />
Kooperation<br />
der Organisatoren<br />
– in vielen<br />
Fällen Kommunen – eine Professionalisierung<br />
des Managements und die Einführung<br />
eines Qualitätssiegels.<br />
Für seine Habilitationsschrift wurde<br />
Univ.-Prof. Arno Kahl ausgezeichnet. Er<br />
fokussierte in seiner Arbeit auf das<br />
Thema „Öffentlicher Personennahverkehr“<br />
und zeichnete den Weg vom<br />
Monopol zum Wettbewerb nach. Dieser<br />
Wettbewerb ist ein direktes Ergebnis der<br />
diesbezüglichen Beschlüsse auf europäischer<br />
Ebene. Die rechtswissenschaftliche<br />
Untersuchung macht auf den Änderungsbedarf<br />
hinsichtlich des österreichischen<br />
Kraftfahrlinienrechts aufmerksam.<br />
Dies bilde die Voraussetzung für die<br />
Sicherstellung einer Versorgung der<br />
Bevölkerung mit entsprechenden Dienstleistungen<br />
auf hohem Niveau. „Städte<br />
und Gemeinden begleiten den Menschen<br />
vom Kindergarten bis zum Altenheim.<br />
Daher kann die Bedeutung der Kommunen<br />
für die Allgemeinheit nicht hoch<br />
genug eingeschätzt werden“, so Kahl in<br />
seiner Dankesrede.<br />
Städte und<br />
Gemeinden begleiten<br />
den Menschen<br />
vom Kindergarten<br />
bis zum Altenheim.<br />
Daher kann die<br />
Bedeutung der<br />
Kommunen für die<br />
Allgemeinheit nicht<br />
hoch genug eingeschätzt<br />
werden.<br />
Dr. Arno Kahl<br />
in seiner Dankesrede<br />
Foto: ORF/ Milenko Badzic<br />
Wie bereits mehr als hundert andere<br />
Gemeinden zuvor entschied sich auch<br />
St. Gotthard im Mühlkreis, das attraktive<br />
Angebot einer ORF-Backstage-<br />
Führung anzunehmen. Im Rahmen<br />
eines Gemeindeausflugs wollten Bürgermeister<br />
Johannes Rechberger, Vizebügermeister<br />
Gerhard Erlinger und<br />
Amtsleiter Johann Haudum gemeinsam<br />
mit den Gemeindebediensteten einen<br />
Blick hinter die Kulissen des Österreichischen<br />
Rundfunks werfen. Unter<br />
den freundlichen Kindergärtnerinnen<br />
und fleißigen Mitarbeitern des Bauhofs:<br />
Reinhard Nimmervoll. Der in der<br />
Gemeinde unter anderem für Baubewilligungen<br />
und die EDV zuständige<br />
Hobbyfotograf hatte das große Los<br />
gezogen. Als 3.000 Besucher der heurigen<br />
Aktion von Gemeindebund und<br />
ORF durfte er sich nicht nur über<br />
Geschenke aus dem ORF-Shop (überreicht<br />
von ORF-Marketingleiter Thomas<br />
Prantner) freuen. Als besonderes<br />
Gemeindebund<br />
Großer Erfolg der ORF-Backstage-Aktion<br />
Reinhard Nimmervoll<br />
inmitten seiner<br />
Kollegen und<br />
Kolleginnen aus<br />
St. Gotthard, flankiert<br />
von Wolfram Pirchner,<br />
Gemeindebund-<br />
Präsident Helmut<br />
Mödlhammer und<br />
ORF-Marketingchef<br />
Thomas Prantner.<br />
Faszinierender<br />
Blick hinter<br />
die Kulissen<br />
Die ORF-Backstage-Sonderaktion für Gemeinden erwies<br />
sich als großer Hit. Mitte Oktober empfing ORF-Star<br />
Wolfram Pirchner mit Reinhard Nimmervoll aus<br />
St. Gotthard im Mühlkreis bereits den 3.000ten Besucher.<br />
Zuckerl erlebte er als „stummer Gast“<br />
Fernsehen in der Sendung „Willkommen<br />
Österreich“ hautnah. Doch<br />
zunächst genoss er gemeinsam mit den<br />
anderen Gemeindebediensteten den<br />
von Brigitte Glaser kompetent geführten<br />
und von Wolfram Pirchner charmant<br />
begleiteten Rundgang durch die<br />
Sendestudios am Küniglberg. Wegen<br />
des großen Erfolges kommen interessierte<br />
Gemeinden noch bis Ende des<br />
Jahres in den Genuss, zu besonders<br />
günstigen Konditionen die faszinierende<br />
Welt des Fernsehens zu erleben.<br />
Fixpunkt jeder Führung ist das Erlebnisstudio,<br />
in dem allerlei Tricks selbst<br />
ausprobiert werden dürfen. Eine am<br />
Schluss der Führung überreichte Videokassette<br />
lässt das Erlebte auch zurück<br />
in der Heimat Revue passieren.<br />
Walter Grossmann<br />
Information und Anmeldung:<br />
backstage.orf.at, Tel.: 01/ 877 99 99<br />
KOMMUNAL 25
Europa<br />
Europa und der Wein<br />
„Es wird a<br />
Wein sein ...“<br />
Rechtzeitig zu Herbstbeginn hat die EU-Kommission in<br />
punkto Rebensaft von sich hören lassen und somit auch<br />
die europäische Dimension des Weinbaus in Erinnerung<br />
gerufen.<br />
◆ Mag. Daniela Fraiss<br />
Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik<br />
besteht eine umfangreiche gemeinsame<br />
Marktordnung für Wein, die neben<br />
klassischen Aspekten jeder Marktorganisation<br />
auch Spezifika des Weinbausektors<br />
detailgenau regelt.<br />
Allgemein bekannt wurde diese Marktordnung<br />
vor allem durch die Förderung<br />
der Stilllegung von Flächen, die sogenannte<br />
Rodungsprämie. Gefördert wird<br />
jedoch nicht nur die Aufgabe von Weinbauflächen,<br />
sondern auch die Umstellung<br />
und Umstrukturierung bestehender<br />
Flächen. Sinn beider Maßnahmen ist es,<br />
einen nachfragegerechten Anbau zu fördern<br />
und europäische Weine im internationalen<br />
Vergleich wettbewerbsfähig zu<br />
machen.<br />
Wie die Europäische Kommission<br />
Anfang Oktober mitgeteilte, werden für<br />
das Wirtschaftsjahr 2004/05 rund 7,2<br />
Millionen Euro für Umstrukturierungsund<br />
Umstellungsmaßnahmen nach<br />
Österreich fließen. Betroffen davon ist<br />
eine Gesamtfläche von 1.270 ha, wo die<br />
◆ Mag. Daniela Fraiß ist Leiterin des<br />
Brüsseler Büros des Österreichischen<br />
Gemeindebundes<br />
26 KOMMUNAL<br />
Qualität der Trauben bzw. des daraus<br />
produzierten Weins entweder durch Sortenumstellungen,<br />
Umpflanzung von<br />
Rebflächen oder Ver-<br />
besserung der Weinbautechnikengehoben<br />
werden soll. Die<br />
Unterstützung von<br />
Seiten der EU<br />
erfolgt durch Entschädigungen<br />
für im<br />
Zuge der UmstrukturierungentstehendeEinkommenseinbußen<br />
sowie<br />
durch Zuschüsse zu den Umstrukturierungsmaßnahmen<br />
selbst. Der Gemeinschaftszuschuss<br />
beträgt maximal 50 Prozent<br />
der entstehenden Kosten.<br />
Wissenswertes zum<br />
Weinbau in Europa<br />
Gefördert wird<br />
jedoch nicht nur die<br />
Aufgabe von Weinbauflächen,<br />
sondern auch<br />
die Umstellung und<br />
Umstrukturierung<br />
bestehender Flächen.<br />
Die europäische Rebanbaufläche macht<br />
ungefähr 45 Prozent der weltweiten<br />
Gesamtrebfläche aus, selbst wenn sie seit<br />
den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts,<br />
nicht zuletzt aufgrund der von der<br />
EU bezahlten Stilllegungsprämien, stetig<br />
zurückgegangen ist. 60 Prozent des weltweiten<br />
Weinkonsums entfallen auf die<br />
Europäische Union und die EU ist sowohl<br />
größter Weinexporteur als auch weltweit<br />
größter Importeur. Die durchschnittlich in<br />
Europa erzeugte Menge betrug in den<br />
letzten Jahren ca. 155 Millionen Hektoliter,<br />
ca. 80 Prozent davon werden in<br />
Europa selbst konsumiert.
Beihilfen für den Agrarsektor<br />
De-minimis-Hilfen<br />
ermöglichen<br />
flexible Reaktion<br />
Die EU-Kommission hat Anfang Oktober<br />
eine Verordnung über neue Beihilfen<br />
im Agrarsektor angenommen, die<br />
insbesondere in Krisensituationen zum<br />
Einsatz kommen sollen. Die neue<br />
rechtliche Regelung über De-minimis-<br />
Beihilfen in der Landwirtschaft erlaubt<br />
den Mitgliedstaaten, Landwirten und<br />
Fischern Beihilfen von bis zu 3000<br />
Euro über einen Zeitraum von drei<br />
Jahren zu gewähren, ohne dies zuvor<br />
der Kommission mitzuteilen.<br />
Damit wird den nationalen Entscheidungsträgern<br />
ein flexibles Instrument<br />
in die Hand gegeben, welches Ausgleichszahlungen<br />
zum Beispiel für kleinere<br />
Ernteausfälle erlaubt, ohne jedes<br />
Mal die Europäische Kommission anzurufen.<br />
In Österreich könnte damit vor<br />
allem auf Hagel-, Unwetter- und<br />
Schlechtwetterschäden reagiert werden.<br />
Die konkreten Bedingungen für die<br />
Gewährung der Beihilfen und die Form<br />
der Beihilfen müssen jedoch von der<br />
Bundesregierung beschlossen werden,<br />
grundsätzlich ausgeschlossen ist aber<br />
zum Beispiel die Stützung von Exporten.<br />
Die<br />
Summe<br />
der mög-<br />
lichenZahlungen<br />
wird<br />
für jeden<br />
Mitgliedstaat<br />
von<br />
der<br />
Kommissionfestgesetzt,<br />
die<br />
Obergrenze<br />
darf 0,3<br />
Prozent<br />
des Produktionswertes der Landwirtschaft<br />
nicht überschreiten. Für Österreich<br />
ergibt sich für die nächsten drei<br />
Jahre ein Betrag von 17, 2 Millionen<br />
Euro.<br />
Die neue Regelung<br />
erlaubt den Mitgliedsstaaten,<br />
Landwirten und<br />
Fischern Beihilfen von bis<br />
zu 3000 Euro über einen<br />
Zeitraum von drei Jahren<br />
zu gewähren, ohne dies<br />
zuvor der Kommission<br />
mitzuteilen.<br />
http://europa.eu.int/rapid/<br />
pressReleasesAction.do?reference=<br />
IP/04/1188&format=HTML&aged=<br />
0&language=DE&guiLanguage=en<br />
Ausschreibung Städtepartnerschaften<br />
EU gibt drei Ziele vor<br />
Die Europäische Kommission hat am<br />
11. Oktober auf ihrer Homepage<br />
http://europa.eu.int die Aufforderung<br />
zur Einreichung von Vorschlägen für<br />
Städtepartnerschaften für das Jahr<br />
2005 veröffentlicht.<br />
Diese Veröffentlichung ist noch nicht<br />
ganz vollständig und insbesondere auch<br />
noch nicht im EU-Amtsblatt erfolgt, die<br />
für die Antragstellung erforderlichen<br />
Basisdokumente finden sich jedoch im<br />
Internet.<br />
Neu an der diesjährigen Aufforderung<br />
ist, dass diese im Gegensatz zum letzten<br />
Jahr keinen ausführlichen Katalog von<br />
Prioritäten enthält, stattdessen werden<br />
für Begegnungen zwischen Bürgerinnen<br />
und Bürgern drei Ziele vorgegeben.<br />
Jeder Antrag muss an diesen Zielvorgaben<br />
ausgerichtet sein, die Verwirklichung<br />
dieser Ziele wird<br />
jedoch (noch) nicht näher<br />
definiert. (Der Benutzerleit-<br />
faden wird nachgereicht,<br />
dort sollte eine praxisnahe,<br />
gute Anleitung für die<br />
Antragstellung zu finden<br />
sein). Antragsteller für Partnerschaftsaktionen<br />
zwischen<br />
dem 15. März und 30. April<br />
2005 müssen ihre Unterlagen<br />
jedoch bis zum 15.<br />
November 2004 einreichen<br />
und werden den Benutzerleitfaden<br />
womöglich erst im Nachhinein<br />
zu Gesicht bekommen. Gerade diese<br />
Gemeinden dürfen keinesfalls auf die<br />
Berücksichtigung europäischer Themen<br />
bei der Programmgestaltung vergessen.<br />
Konkret werden Förderungen vergeben,<br />
wenn die Partnerschaftsaktionen dazu<br />
beitragen, die Bürger eng in Debatten<br />
zum Aufbau der Europäischen Union<br />
einzubeziehen, die Beziehungen und<br />
den Austausch der Bevölkerung zu<br />
intensivieren und die Werte und Ziele<br />
der Europäischen Union zu fördern und<br />
zu verbreiten.<br />
Zusätzlich zu diesen Hauptkriterien<br />
werden Veranstaltungen bevorzugt, die<br />
Zur Vorbereitung oder zum Abschluss<br />
neuer Städtepartnerschaften dienen;<br />
◆ Unter Beteiligung von mehr als zwei<br />
Gemeinden stattfinden;<br />
◆ Überwiegend auf Jugendliche oder<br />
benachteiligte Gruppen ausgerichtet<br />
sind;<br />
Europa<br />
◆ Eine ausgewogene Beteiligung von<br />
Männern und Frauen gewährleisten.<br />
Es gibt natürlich keine Standardformel<br />
dafür, was europäisches Bewusstsein<br />
oder Zugehörigkeitsgefühl zur Europäischen<br />
Union sind. Gemäß der Programmausschreibung<br />
werden aber nur<br />
Aktionen gefördert, welche diese<br />
„Gefühle“ stärken. Geschehen soll dies<br />
durch Information der Bevölkerung<br />
sowie durch gemeinsame Aktivitäten<br />
im Rahmen von Partnerschaftsaktionen.<br />
Die Aktivitäten können sich beispielsweise<br />
um eher abstrakte Themen<br />
wie die europäische Verfassung, aber<br />
auch um konkreteres und greifbareres<br />
wie die Umsetzung europäischer Politiken<br />
auf lokaler Ebene drehen. Der<br />
„europäischen“ Phantasie sind kaum<br />
Grenzen gesetzt,<br />
wichtig bei allen<br />
Aktionen aber ist<br />
ein politischer<br />
Hintergrund. Rein<br />
touristische oder<br />
folkloristische<br />
Aktionen haben<br />
keine Chance auf<br />
Unterstützung seitens<br />
der Kommission.<br />
Der so gern strapazierte„europäische<br />
Mehrwert“ eines Projekts bedeutet<br />
demnach nichts anderes, als dass jedes<br />
Programm auch Bildungselemente enthalten<br />
soll. Ob dies nun ein Workshop<br />
zum lokalen Abfallmanagement, eine<br />
Diskussion mit dem regionalen Europaabgeordneten<br />
oder ein gemeinsames<br />
Bildungsprojekt der beteiligten<br />
Gemeinden über Vorteil und Nutzen<br />
der europäischen Verfassung ist, bleibt<br />
Geschmackssache. Wichtig ist, dass das<br />
Programm dazu beiträgt, die Kenntnisse<br />
der Bürger über die Europäische<br />
Union zu verbessern.<br />
Durch die immer knapper werdenden<br />
Finanzmittel, die für dieses Programm<br />
zur Verfügung stehen, wird es nicht<br />
leichter, Unterstützung zu erhalten.<br />
Das Budget für 2005 wird aller Voraussicht<br />
nach nur noch 12 Mio. € für 25<br />
Mitgliedstaaten betragen, die Zahl der<br />
zuschussfähigen Projekte dürfte 1.500<br />
nicht überschreiten.<br />
Rein touristische<br />
oder folkloristische<br />
Aktionen haben keine<br />
Chance auf Unterstützung<br />
seitens der<br />
Kommission.<br />
KOMMUNAL 27
Europa<br />
Neue Europa-Initiative für den Wasser- und Hochwasserschutz<br />
Hochwasserschutz<br />
kennt keine Grenzen<br />
Wasser liegt den Österreichern am Herzen, und Wasser- und Gewässerschutzpolitik<br />
haben in Österreich eine lange und erfolgreiche Tradition. Österreichs Gemeinden<br />
waren und sind nicht nur mitten drin in dieser Politik, sondern haben die Erfolge ganz<br />
wesentlich mitgetragen und mitgestaltet. Erst Mitte Oktober gab es eine neue Wasserund<br />
Hochwasserinitiative der Europäischen Kommission. KOMMUNAL berichtet darüber<br />
aus erster Hand.<br />
◆ Dr. Helmut Blöch<br />
Österreich und seine Gemeinden liegen<br />
im Herzen Europa und damit auch im<br />
Einzugsgebiet von drei großen europäischen<br />
Flussgebieten – Donau, Rhein<br />
»<br />
und Elbe.<br />
Daher<br />
Wasser ist keine<br />
haben sie<br />
Handelsware wie auch leidvolle<br />
jede andere, sondern<br />
Erfahrun-<br />
ein ererbtes Gut, das gen mit<br />
geschützt werden<br />
«<br />
diesem<br />
Element.<br />
muss ...<br />
Gewässer<br />
Anfangssatz der EUkennen<br />
keine<br />
Wasserrahmenrichtlinie<br />
Grenzen,<br />
weder<br />
beim Hochwasser noch bei der Verschmutzung.<br />
Dieser Beitrag will einen<br />
aktuellen Überblick geben über die<br />
◆ Dr. Helmut<br />
Blöch ist Abteilungsleiter in der Generaldirektion<br />
Umwelt der Europäischen<br />
Kommission in Brüssel.<br />
28 KOMMUNAL<br />
gemeinsame europäischen Bemühungen<br />
◆ zu Hochwasservermeidung und<br />
Hochwasserschutz.<br />
◆ zur Reinhaltung unserer Gewässer<br />
Hochwasserschäden<br />
dramatisch angestiegen<br />
Hochwässer hat es immer gegeben,<br />
und wird es auch künftig geben. Hochwässer<br />
werden dort zu Katastrophen,<br />
wo sie Menschenleben kosten, Menschen<br />
um ihr Hab<br />
und Gut bringen oder<br />
Infrastruktur zer-<br />
stören. Und diese<br />
Schäden sind in den<br />
letzten Jahrzehnten<br />
drastisch angestiegen,<br />
nicht zuletzt durch<br />
menschliches Handeln<br />
◆ Abschneiden von<br />
Flüssen von ihren<br />
natürlichen Überflutungsgebieten<br />
◆ Begradigung und<br />
Kanalisierung von<br />
Flüssen<br />
◆ Ausweisung von<br />
Wohngebieten, Gewerbe – und Industriegebieten<br />
in Hochwasserabflussgebieten.<br />
Seit 1998 haben<br />
bei Hochwasserkatastrophen<br />
in<br />
Europa 700 Menschen<br />
ihr Leben und 500.000<br />
ihr Zuhause verloren –<br />
der Gesamtschaden<br />
wird auf 25 Milliarden<br />
Euro geschätzt.<br />
So hat Europa zwischen 1998 und<br />
2002 unter mehr als 100 größeren<br />
Hochwasserereignissen mit Schäden<br />
gelitten, einschließlich der katastrophalen<br />
Fluten im Einzugsgebiet der Flüsse<br />
Donau und Elbe im Jahre 2002. Seit<br />
1998 haben Hochwasserereignisse<br />
etwa 700 Menschenleben gefordert,<br />
etwa eine halbe Million Menschen<br />
haben ihr Zuhause verloren, und rund<br />
25 Milliarden Euro allein an versicherten<br />
Schäden wurden verursacht. Die<br />
Vermögenswerte, die einer Gefahr von<br />
Hochwasserereignissen ausgesetzt sind,<br />
können enorm sein – so leben allein<br />
mehr als 10 Millionen<br />
Menschen entlang des<br />
Rheins in Bereichen mit<br />
extremem Hochwasserrisiko,<br />
und das potentielle<br />
Schadenrisiko beträgt<br />
165 Milliarden Euro.<br />
Im August 2004 hat<br />
KOMMUNAL Nr. 7/8<br />
(„Europas Aktionsplan<br />
gegen Hochwasser“)<br />
über die Mitteilung der<br />
Europäischen Kommission<br />
zur Hochwasserproblematik<br />
1 vom Juli 2004<br />
berichtet; sie<br />
◆ stellt die Hochwasserproblematik<br />
dar,<br />
◆ schlägt gemeinsame konzertierte<br />
Aktion von Mitgliedstaaten und<br />
Kommission vor.
Europa und seine Flüsse<br />
Allein das Einzugsgebiet der Donau (ganz oben eine Aufnahme des Hochwassers<br />
2002 in Linz) umfasst mehr als 800.000 Quadratkilometer und reicht<br />
über 18 Länder. Und dann gibt es noch ähnlich große Flüsse wie den Rhein und<br />
die Elbe, um nur zwei zu nennen.<br />
„Noch“ EU-<br />
UmweltkommissarinMargot<br />
Wallström<br />
hat auf die im<br />
Oktober vorgestellteWasserschutz-Initiative<br />
der EU-<br />
Umweltministeruneingeschränkt<br />
positiv<br />
reagiert.<br />
Foto: © European Community, 2004<br />
Europa<br />
Wasserschutz-Initiative<br />
der EU-Umweltminister<br />
Bereits im Oktober 2004 hat der Ministerrat<br />
seine politischen Beratungen<br />
dazu abgeschlossen; am 14. Oktober<br />
2004 haben die Umweltminister einstimmig<br />
◆ die Analyse der Kommission begrüßt<br />
und unterstützt und sich für gemeinsames<br />
Handeln ausgesprochen,<br />
◆ die Notwendigkeit der Berücksichtigung<br />
insbesondere lokaler und regionaler<br />
Besonderheiten und das Subsidiaritätsprinzip<br />
unterstrichen und<br />
◆ die Kommission ersucht, einen Vorschlag<br />
für eine europäische Regelung<br />
(zur Diskussion und Beschlußfassung<br />
durch Europäisches Parlament und<br />
Ministerrat) zu erarbeiten.<br />
Umweltkommissarin Margot Wallström<br />
hat darauf uneingeschränkt positiv reagiert.<br />
Als Strategie um künftige Schäden zu<br />
vermeiden oder zumindest zu minimieren,<br />
zeichnet sich – wie schon in der<br />
Mitteilung vom Juli 2004 dargelegt –<br />
die gemeinsame Ausarbeitung von<br />
flussgebietsweiten Hochwasserrisiko-<br />
1 Mitteilung der Kommission vom<br />
12.07.2004 an Europäisches Parlament, Rat,<br />
Ausschuß der Regionen und Wirtschafts- und<br />
Sozialausschuß, KOM(2004)472 „Hochwasserrisikomanagement:<br />
Vermeidungs-, Schutzund<br />
Minderungsmaßnahmen“<br />
KOMMUNAL 29
Europa<br />
karten und Hochwasseraktionsplänen<br />
und<br />
deren schrittweise Verwirklichung<br />
ab. Gleichzeitig<br />
soll aber das<br />
Schutzniveau (Schutz<br />
gegen 5jähriges,<br />
500jähriges usw. Hochwasser)<br />
vor Ort – in<br />
den Regionen, in den<br />
(Teil)Flussgebieten –<br />
entschieden werden,<br />
gemeinsam mit den<br />
Partnern flussaufwärts<br />
und flussabwärts, und<br />
selbstverständlich auch die dafür sinnvollsten<br />
Maßnahmen.<br />
Österreich steht gemeinsam mit seinen<br />
Partnern im Donaueinzugsbereich kurz<br />
vor der Fertigstellung eines Donau-<br />
Hochwasseraktionsplanes, der im Rahmen<br />
der Internationalen Donauschutzkommission<br />
mit Sitz in Wien erarbeitet<br />
worden ist.<br />
Mit solchem gemeinsamen Planen und<br />
Handeln zum Thema Hochwasser sollen<br />
damit nicht bloß künftige Opfer<br />
und Schäden vermieden werden, sondern<br />
auch allen Beteiligten – von der<br />
lokalen und regionalen bis zur europäischen<br />
Ebene – eine langfristige und<br />
verlässliche Grundlage gegeben werden<br />
für ihre politischen, finanziellen und<br />
technischen Entscheidungen.<br />
Wasserrahmenrichtlinie:<br />
Grundsätze aus Österreich<br />
Mit der Wasserrahmenrichtlinie 2 hat die<br />
EU ihre Wasser- und Gewässerschutzpolitik<br />
neu ausgerichtet, vielfach<br />
aufbauend auf Grundsätzen wie in<br />
Österreich 3 , und diese weiterentwickelnd:<br />
◆ Gewässerschutz für alle Gewässer,<br />
Grundwasser und Oberflächengewässer<br />
◆ guter Zustand für alle Gewässer; dieser<br />
‘gute Zustand’ ist umfassend definiert<br />
- für Oberflächengewässer über<br />
Biologie (Mikrofauna, Mikroflora,<br />
Fischfauna), Chemie und Morphologie,<br />
für Grundwasser über Chemie<br />
2 Richtlinie 2000/60/EG „Wasserrahmenrichtlinie“,<br />
einschließlich umfangreicher Dokumentation<br />
im Internet verfügbar unter<br />
http://europa.eu.int/comm/ environment/water/water-framework/<br />
3 Wasserrechtsgesetz 1959 i.d.g.F., vgl. insbesondere<br />
nach der Novelle 1990: Kombination<br />
von Emissions- und Immissionskriterien; Programme<br />
zur Verwirklichung der Ziele bei<br />
Grundwässern und Fließgewässern; sektorale<br />
30 KOMMUNAL<br />
Gleichzeitig mit der<br />
Verabschiedung der Wasserrahmenrichtlinie<br />
haben sich,<br />
in einer bislang beispiellosen<br />
Aktion, Europäische<br />
Kommission und Mitgliedstaaten<br />
geeinigt, eine<br />
Strategie für die Umsetzung<br />
der Richtlinie zu entwickeln<br />
und zu beschließen.<br />
und Quantität<br />
(Gleichgewicht<br />
zwischen Dargebot<br />
und Entnahmen)<br />
◆ Wasserwirtschaft<br />
auf<br />
Grundlage von<br />
Flusseinzugsgebieten,<br />
über Verwaltungs-<br />
und<br />
politische Grenzen<br />
hinaus<br />
◆ Preise für wasserbezogene<br />
Dienstleistungen wie Trinkwasser und<br />
Abwasser, die das Kostendeckungsprinzip<br />
widerspiegeln und damit den sorgsamen<br />
Umgang mit Wasser unterstützen<br />
◆ Einbindung von Bürgern,<br />
Gemeinden und Betroffenen<br />
in Planungs- und Entscheidungsprozesse<br />
bei der Ausar-<br />
beitung der Flussgebietspläne<br />
Die Wasserrahmenrichtlinie<br />
gibt es ambitioniertes Ziel vor -<br />
in der Regel soll das Ziel bis<br />
2015 erreicht sein; sie schafft<br />
aber auch einen kontinuierlichen<br />
und transparenten Prozess<br />
für Planen und Handeln:<br />
2003: formale Umsetzung in<br />
nationale Gesetzgebung (Artikel<br />
24); Ausweisung der<br />
Außengrenzen der Flussgebiete und der<br />
zuständigen Behörden (Artikel 3)<br />
2004: erste Bestandsaufnahme und ökonomische<br />
Analyse (Artikel 5 und<br />
Anhänge II+III); Verzeichnis der Schutzgebiete<br />
(Artikel 6)<br />
2006: Mess- und Überwachungssystem<br />
(Artikel 8); Spätestbeginn für Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
(Artikel 14)<br />
2008: Entwurf der Flussgebietspläne<br />
2009: endgültige Flussgebietspläne und<br />
Maßnahmenprogramme (Artikel 13)<br />
2015 bzw. 2015+: Umweltschutzziel<br />
erreicht, ggf. nach Fortschreibung der<br />
Flussgebietspläne und Maßnahmenprogramme<br />
4<br />
Umsetzung in der Praxis<br />
nur mit den Beteiligten<br />
Gleichzeitig mit der Verabschiedung der<br />
Wasserrahmenrichtlinie haben sich, in<br />
einer bislang beispiellosen Aktion,<br />
Europäische Kommission und Mitgliedstaaten<br />
geeinigt, eine Strategie für die<br />
Umsetzung der Richtlinie zu entwickeln<br />
Emissionsverordnungen schon seit 1991 4 alle Termine zu lesen als „22. Dezember“<br />
Umweltminister Pröll präsentierte am 3. Novem<br />
neue Erkenntnisse zu Ursachen und Auswirkun<br />
nannten „Flood Risk Studie“ lesen Sie auf den<br />
Österreich steht<br />
gemeinsam mit seinen<br />
Partnern im<br />
Donaueinzugsbereich<br />
kurz vor der Fertigstellung<br />
eines Donau-<br />
Hochwasseraktionsplanes.
er bei einer Pressekonferenz eine Studie über<br />
gen des Hochwassers 2002. Details zur soge-<br />
Seiten 52 und 53 dieser Ausgabe.<br />
Die Hochwasserereignisse<br />
wurden 2002 in Österreich<br />
auch aus Sicht der Raumordnung<br />
betrachtet. Im Gewässerverlauf<br />
sollten so an<br />
geeigneten Stellen Retentionsräume<br />
geschaffen werden,<br />
die einerseits im<br />
Bedarfsfall Wasser aufnehmen<br />
können und die andererseits<br />
auch zur „Entschleunigung“<br />
beitragen.<br />
Foto: BMLFUW /Kern<br />
und zu beschließen, und eine umfassende<br />
Zusammenarbeit für alle wesentlichen<br />
Aspekte der Richtlinie in die Wege<br />
zu leiten. Nur vier Monate nach Veröffentlichung<br />
der Richtlinie ist diese Strategie<br />
verabschiedet worden [3]. Von<br />
Anfang an war eine Einbindung der<br />
beteiligten und betroffenen Interessensvertretungen,<br />
der Umweltschutzorganisationen<br />
auf europäischer Ebene, aber<br />
auch der Länder, die 2004 neue EU-Mitglieder<br />
wurden, sichergestellt.<br />
Auch auf nationaler und regionaler<br />
Ebene sind die Wasserrahmenrichtlinie<br />
eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtend<br />
vor. Sie soll nicht nur eine bestmögliche<br />
Nutzung von vorhandenem<br />
Wissen und Erfahrung sichern, sondern<br />
räumt Gemeinden auch eine breite Mitsprache<br />
ein.<br />
Umfassende Diskussion<br />
nach der ersten<br />
Bestandsaufnahme<br />
Die erste Bestandaufnahme wird Ende<br />
2004 vorliegen, gefolgt von ihrer Präsentation<br />
und Diskussion mit Entscheidungsträgern<br />
und Betroffenen. Eine differenzierte<br />
Betrachtung wird dabei sowohl für<br />
die fachlich-technischen wie die politische<br />
Diskussion unabdingbar sein.<br />
Für Österreich werden sich dabei ohne<br />
Zweifel die enormen Leistungen und<br />
Erfolge bei den Punktquellen und nur<br />
mehr geringe chemische Belastung der<br />
Oberflächengewässer widerspiegeln. Herausforderungen<br />
werden dagegen die<br />
Gewässermorphologie und Längsdurchgängigkeit<br />
sein (aber auch dies gegen<br />
den Hintergrund der vielfachen<br />
Bemühungen zur Revitalisierung von<br />
Flüssen), sowie in bestimmten Bereichen<br />
die Grundwasserbelastung durch diffuse<br />
Belastungen besonders aus der Landwirtschaft.<br />
Die bisherigen Erfolge Österreich, auch<br />
und gerade von Österreichs Gemeinden<br />
getragen, spiegeln sich sowohl in österreichischen<br />
wie europäischen Berichten<br />
wider<br />
◆ Gewässerschutzbericht des Lebensministeriums<br />
2002, Wien 2003<br />
◆ Berichte der Europäischen Kommission<br />
„Umsetzung der Richtlinie kommunale<br />
Abwasserbehandlung“ und „Qualität<br />
der Badegewässer“, beide Brüssel Mai<br />
2004<br />
Förderungen ab 2006 als<br />
Chance für Gewässerschutz<br />
Ein wesentlicher Punkt bei der künftigen<br />
Umsetzung wird schließlich die<br />
Europa<br />
bestmögliche Nutzung von Förderungsinstrumenten<br />
sein, sowohl bei der Planungs-/Vorbereitungsphase<br />
wie bei der<br />
Verwirklichung. Wegen der wesentlichen<br />
Reform der EU Agrarpolitik und<br />
ihres Förderungsinstrumentariums 5<br />
ergeben sich gerade für den ländlichen<br />
Raum umfassend neue Möglichkeiten.<br />
Nun werden – im Gegensatz zur bisherigen<br />
Regelung – Maßnahmen zur Verwirklichung<br />
verpflichtender Umweltvorgaben<br />
im ländlichen Raum förderungsfähig<br />
sein. Die Mitgliedstaaten<br />
werden – gerade in einer wichtige<br />
Phase der Umsetzung – die Möglichkeit<br />
haben, Schwerpunkte zum Beispiel im<br />
Gewässerschutzbereich zu setzen. Die<br />
Reform der Regionalförderung für die<br />
Zeit nach 2006<br />
ist noch endgültig<br />
zu ent-<br />
scheiden; die<br />
Vorschläge der<br />
Kommission 6<br />
sehen eine solcheFörderungsfähigkeit<br />
vor, die Entscheidung<br />
ist<br />
von EuropäischemParlament<br />
und<br />
Ministerrat<br />
noch zu treffen.<br />
Schließlich<br />
sind für eine<br />
Die bisherigen<br />
Erfolge Österreichs,<br />
auch und gerade von<br />
Österreichs Gemeinden<br />
getragen, spiegeln<br />
sich sowohl in österreichischen<br />
wie<br />
europäischen Berichten<br />
wider.<br />
naturnähere Gestaltung unserer Gewässer<br />
– für sie gibt es in allen Bundesländern<br />
richtungweisende erfolgreiche<br />
Projekte - Förderungsmöglichkeiten<br />
auch im Europäischen Fischereifond 7<br />
vorgeschlagen, unter anderem für<br />
Fischtreppen für Wanderfischarten.<br />
Dieser Beitrag stellt die Meinung des Verfassers<br />
dar, und nicht unbedingt jene der<br />
Europäischen Kommission.<br />
5 Verordnungen 1782/2003/EG und<br />
1783/2003/EG<br />
6 Vorschläge der Kommission vom 14.07.2003<br />
für die Verordnung zur Kohäsionspolitik: Allgemeine<br />
Verordnung KOM(2004)492,<br />
Europäischer Regionalentwicklungsfonds<br />
KOM(2004)495, Kohäsionsfonds<br />
KOM(2004)494 und European Gruppierung<br />
von grenzüberschreitender Zusammenarbeit<br />
KOM(2004)496<br />
7 Europäische Kommission, Vorschlag für<br />
einen Europäischen Fischereifonds vom<br />
14.7.2004, KOM(2004) 497<br />
KOMMUNAL 31
Europa<br />
Kommune 2015 – Die Zukunft der Gemeinden<br />
10 Thesen steigern die<br />
Wettbewerbsfähigkeit<br />
Der folgende Beitrag ist ein Auszug eines Vortrages auf einer Tagung des Hessisches<br />
Städtetages vom September. Kernthema war „Die Zukunft der Kommunen“. Die dabei<br />
erarbeiteten „zehn Thesen zu Trends und Entwicklungen von Kommunen“ könnten ein<br />
Leitfaden auch für die österreichschen Gemeinden sein.<br />
◆ Dieter Lindauer<br />
These 1: Früherkennung erhöht die<br />
Heilungschance<br />
Es gilt Veränderungen rund um den Wirtschaftsstandort<br />
frühzeitig zu erkennen<br />
und sie im Sinne der Kommune zu antizipieren.<br />
Dies aber ist oft schwer zu<br />
bewerkstelligen, da die Unternehmen erst<br />
nach der Entscheidungsfindung auf die<br />
Wirtschaftsförderung zukommen, also<br />
nachdem sie bereits die Verlagerung ihres<br />
Firmenstandorts beschlossen haben.<br />
In früheren Zeiten wurde der Strukturwandel<br />
sozial begleitet. Die Intention lag<br />
also nicht in der Früherkennung des<br />
Strukturwandels, um mit den Hebeln der<br />
Kommune gegensteuern zu können.<br />
Heute liegt im Fokus der Gemeinden und<br />
Städte zumeist die Ansiedelung von<br />
Unternehmen, da diese Erfolge medienpolitisch<br />
verwertbar sind. Künftig aber<br />
muss die Bindung von Gewerbebetrieben<br />
an die Kommune Priorität vor der Ansiedlung<br />
von Unternehmen haben (Abb. 1).<br />
Das heißt, abwanderungsbereite Unternehmen<br />
müssen durch ein angemessenes<br />
◆ Dipl. Bw.<br />
Dieter Lindauer ist Spezialist für Versorgungs-,<br />
Entsorgungs-, <strong>Kommunal</strong>und<br />
Immobilienwirtschaft in Mainz<br />
32 KOMMUNAL<br />
Frühwarnsystem zeitig erkannt werden,<br />
um die Betreuung der Betriebe gezielt<br />
intensivieren zu können.<br />
Hierfür sind unter anderem Standortzufriedenheit<br />
und Standortloyalität der<br />
Unternehmen zu messen. Zusätzlich zu<br />
Standortloyalität und Standortzufriedenheit<br />
gilt es zudem, die<br />
Marktstärke der Unternehmen<br />
einzuschätzen.<br />
Denn was nützt es den<br />
Kommunen in Österreich,<br />
Deutschland und<br />
sonst auf der Welt,<br />
wenn die ortsansässigen<br />
Betriebe zwar standortloyal<br />
sind, jedoch<br />
vor dem Verkauf oder<br />
Konkurs stehen.<br />
These 2: Demografische<br />
Entwicklung<br />
gestalten<br />
Die demografische Entwicklung<br />
in Österreich<br />
und Deutschland führt<br />
zu einer Alterung unserer Gesellschaft.<br />
Nicht nur der Anteil der älteren Menschen<br />
wird zunehmen, nein, wir werden<br />
auch absolut älter. Demografen wie Prof.<br />
Dr. em. Herwig Birg, Universität Bielefeld,<br />
prognostizieren daher eine Abnahme der<br />
Bevölkerung, eine Zunahme des Anteils<br />
älterer Menschen und Wanderungs- und<br />
Zuzugsbewegungen.<br />
Durch Wanderungsbewegungen wird es<br />
sowohl Gewinner als auch Verlierer<br />
geben. Das heißt, qualifizierte Arbeitnehmer<br />
und Familien mit Kindern wandern<br />
in Regionen ab, die Arbeit und Wohlstand<br />
Was nützt es<br />
den Kommunen in<br />
Österreich, Deutschland<br />
und sonst auf der<br />
Welt, wenn die ortsansässigen<br />
Betriebe<br />
zwar standortloyal<br />
sind, jedoch vor dem<br />
Verkauf oder Konkurs<br />
stehen.<br />
versprechen. Es wird folgerichtig zu einer<br />
Entsiedelung bestimmter Regionen kommen.<br />
Durch die Alterung der Gesellschaft<br />
werden ferner unsere Sozialsicherungssysteme<br />
„gesprengt“. Geschätzte 30 Prozent<br />
werden später für die private Altersvorsorge<br />
ausgegeben werden; Geld, das wiederum<br />
für Investitionen<br />
und den Konsum fehlt.<br />
Auch Alterserkrankun-<br />
gen werden zunehmen<br />
und zusätzlich unsere<br />
sozialen Sicherungssysteme<br />
belasten.<br />
Was bedeutet das im<br />
Aktionsradius der Kommunen?<br />
Nicht mehr die<br />
Bedarfsdeckung des<br />
Wohnraumangebotes<br />
steht im Vordergrund,<br />
sondern das zielgruppengerechte<br />
Angebot an<br />
Wohnraum, etwa für<br />
Wohlhabende oder für<br />
pflegebedürftige Menschen<br />
Wohnungen müssen<br />
auch für Menschen im Alter<br />
erschwinglich und beherrschbar bleiben.<br />
These 3: <strong>Kommunal</strong>es Produktmanagement<br />
kommt<br />
Die Kommunen und Regionen stehen im<br />
Wettbewerb um Familien mit Kindern,<br />
Einwohner mit höherem Qualifikationsniveau,<br />
lukrative Bevölkerungsschichten<br />
(Menschen mit Kaufkraft) und um hohe<br />
Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität. Sie<br />
stehen ferner im Wettbewerb um Unternehmen<br />
und innovatives Unternehmertum.<br />
Das heißt, künftig werden Kommu-
Die 10 Thesen<br />
Das „Lindauer Frühwarnmodell“<br />
zum Erhalt des Wirtschaftsstandortes<br />
einer Kommune (These 1).<br />
Entwicklung der Personenzahl je<br />
Haushalt in Deutschland von 1871<br />
bis 1998 mit Vorausberechnung bis<br />
2050 (These 2).<br />
Ergebnisdarstellung im Rahmen<br />
einer Verwaltungsstrukturanalyse<br />
im Bereich Kindergarten – Verhältnis<br />
der Prozesse zueinander dargestellt<br />
in Personen-jahren (ähnlich<br />
zu vollbeschäftigte Einheiten (VBE)<br />
(These 5).<br />
„Leben Sie gerne in ... oder würden<br />
Sie lieber woanders wohnen, wenn<br />
Sie es sich aussuchten könnten?“ –<br />
Affinität von Städten bei Einwohnern<br />
(These 8).<br />
nen, ihre Gesellschaften und Drittbeauftragte<br />
Produkte kreieren und diese den<br />
Kunden (= die Bürger und die Unternehmen)<br />
anbieten.<br />
These 4: Von einzelnen Sternen zur<br />
Raumkrümmung<br />
Nach allgemeinem Demokratieverständnis<br />
sind dezentrale Räume mit vielen<br />
Gebietskörperschaften wünschenswert,<br />
da sie Bürgernähe praktizieren. Ob aber<br />
diese dezentralen, machtdispersiven<br />
Strukturen auch wettbewerbsfähig<br />
gegenüber zentralen, machtkonzentrierten<br />
Demokratien (Großraum Paris)<br />
sein können, ist eine spannende<br />
Frage. In den nächsten Jahren wird<br />
der Markt die Antwort geben. Absehbar<br />
ist: Die einzelne Kommune muss<br />
sich künftig in vielerlei Hinsicht den<br />
Regionalvorstellungen unterordnen.<br />
Und die Kommunen müssen sich verstärkt<br />
in größere Gebilde „einklinken“.<br />
These 5: Verwaltungen richten sich verstärkt<br />
prozess- und kundenorientiert aus<br />
Organigramme sagen dem Betrachter<br />
nicht die<br />
ganze<br />
Wahrheit,<br />
so auch in<br />
<strong>Kommunal</strong>-verwaltungen.<br />
Arbeit<br />
wandert in<br />
Organisationen<br />
immer<br />
dahin, wo<br />
sie erledigt<br />
wird. Dies führt teilweise zu „komischen“<br />
Aufgabenzuschnitten, die durch Eingruppierungsnotwendigkeiten<br />
und durch Aufgabendelegation<br />
historisch gewachsen<br />
sind. Auch findet in vielen privatwirtschaftlichen<br />
und öffentlichen Organisationen<br />
eine Beschäftigung „um die Kernaufgabe,<br />
den Kernprozess herum“ ihres Aufgabenbereichs<br />
statt. Die Verwaltungsstrukturanalyse<br />
analysiert die<br />
Geschäftsprozesse innerhalb der Verwaltung<br />
und im Stadtkonzern und<br />
bringt die verdeckten Potenziale zum<br />
Vorschein. Die zentrale Frage lautet<br />
hierbei: Wie würde man die Verwaltung<br />
heute ausrichten, wenn man sie<br />
neu gründen würde?<br />
Die Verwaltungen stehen außerdem<br />
vor der Aufgabe, Kosten- und Leistungsrechnung<br />
einzuführen und auf<br />
der anderen Seite betriebliche Teile der<br />
Stadtverwaltung mehr und mehr auszugliedern.<br />
Um die Kosten- und Erlösentwicklung<br />
effektiv zu gestalten, erlangt<br />
Europa<br />
das Controlling mit dem Finanz- und<br />
Rechnungswesen mehr an Gewicht.<br />
These 6: Vertrieb in Kommunen wird<br />
alltäglich sein<br />
Kommunen werden nicht nur im Bürgerbüro<br />
bürger-/kundenorientiert sein, sondern<br />
künftig vertriebs-/verkaufsorientiert<br />
agieren, ob im Rahmen der Verwaltung<br />
oder in ausgegliederten Einheiten. Die<br />
Wirtschaftsförderung organisiert und<br />
unterstützt nicht nur bei Unternehmensansiedelungen,<br />
sie bindet<br />
auch die<br />
Unternehmen<br />
an den<br />
Standort<br />
und sorgt<br />
noch stärker<br />
als bisher für<br />
Netzwerke<br />
auf kommunaler<br />
Ebene.<br />
Das Engagement<br />
für<br />
eine Stadt<br />
wird künftig<br />
aktiv gebündelt<br />
und<br />
Kommunen werden<br />
nicht nur im Bürgerbüro<br />
bürger-/kundenorientiert<br />
sein, sondern künftig<br />
vertriebs-/verkaufsorientiert<br />
agieren, ob im<br />
Rahmen der Verwaltung<br />
oder in ausgegliederten<br />
Einheiten.<br />
gesteuert, so die Vereinsaktivitäten, die<br />
Bürgerstiftungsaktionen, das Ehrenamt,<br />
die temporäre Unterstützung im Einzelfall,<br />
um Engagement ergebnisorientiert<br />
für die Qualität der Stadt einzusetzen.<br />
These 7: Die Beteiligung an kommunalen<br />
Unternehmen wird zunehmen<br />
Die Kommunen gründen mehr und mehr<br />
Eigengesellschaften, die als Kapitalgesellschaften<br />
den Regie- und Eigenbetrieben<br />
beigestellt werden, sowie <strong>Kommunal</strong>unternehmen<br />
(Anstalt öffentlichen Rechts),<br />
die selbst im Wettbewerb tätig werden<br />
dürfen und beteiligungsfähig sind. Die<br />
Beteiligung an diesen Unternehmen wird<br />
stark zunehmen. Dies liegt in den öffentlichen<br />
Tarifstrukturen, in der Verarmung<br />
der Kommunen, die zunehmend ihr<br />
„Tafel-silber“ verkaufen werden sowie in<br />
der zunehmenden Liberalisierungsdiskussion<br />
auf EU-Ebene begründet.<br />
These 8: Bürgerstiftungen werden als<br />
Freunde der Kommunen akzeptiert sein<br />
Ein wichtiges Kennzeichen der <strong>Kommunal</strong>politik<br />
ist die Bürgernähe. Hierbei wirken<br />
sich einerseits die Entscheidungen<br />
der Politik auf das Leben der Bürger aus,<br />
andererseits haben die Bürger in Demokratien<br />
das Recht, durch Bürgerengagement<br />
die <strong>Kommunal</strong>politik aktiv mitzugestalten.<br />
Es geht dabei nicht um eine<br />
Unterschriftendemokratie, sondern um<br />
Bürgerpartizipation. Städte und Gemeinden<br />
sind hierbei die „Schulen“ dieser Bür-<br />
KOMMUNAL 33
Europa<br />
gerdemokratie. Die Bürger werden weniger<br />
Geld haben, die Bereitschaft, sich einzubringen<br />
ist dennoch vorhanden. Folglich<br />
wird auf der einen Seite der Austritt<br />
aus monetären Zwangssolidargemeinschaften<br />
stehen, auf der anderen Seite<br />
der Eintritt in Systeme mit verursachungsgerechter<br />
Abrechnung und gleichzeitig<br />
verstärktes bürgerliches Engagement.<br />
Um dieses Engagement zu wecken,<br />
muss die so genannte 4i-Treppe beschritten<br />
werden, Information – Integration –<br />
Identifikation – Initiative.<br />
These 9: Bau- und Facility-Management<br />
bietet erhebliche Einsparpotenziale<br />
Zwei Hauptkostenblöcke kennzeichnen<br />
die kommunale Verwaltung, das Bauund<br />
Facility-Management sowie die Personalkosten.<br />
Im ersteren liegen erhebliche<br />
Einsparpotenziale in der Zusammenführung<br />
und Straffung von Funktionen,<br />
Büroflächenmanagement zur Reduzierung<br />
des Raumbedarfs, in der gezielten<br />
Fremdvergabe, durch den Nachweis der<br />
Mittelbewirtschaftung und durch Projektsteuerung.<br />
These 10: Über die Wahlperiode hinaus<br />
strategisch kommunal handeln<br />
Die tatsächlich drohenden Lasten werden<br />
unterschätzt, da die heute geplanten<br />
Infrastrukturmaßnahmen nicht mit der<br />
nötigen Stringenz auf Basis kommender<br />
Entwicklungen<br />
entschieden werden.<br />
Ein Beispiel<br />
aus einer Studie<br />
der Deutschen<br />
Bank verdeutlicht<br />
die Schwierigkeiten:Angenommen,<br />
die Kommune<br />
A mit 1250<br />
Einwohnern muss<br />
im Jahr 2004 eine<br />
neue Kläranlage<br />
finanzieren. Es stehen<br />
zwei Modelle<br />
zur Auswahl: Das<br />
Modell A hat fixe<br />
Kosten in Höhe<br />
von 1.000 Euro und variable Kosten von<br />
einem Euro pro Einwohner. Das Modell B<br />
ist kleiner, die fixen Kosten belaufen sich<br />
daher nur auf 500 Euro. Dafür sind die<br />
variablen Kosten mit 1,50 Euro pro Einwohner<br />
höher. Bei einer gleich bleibenden<br />
Einwohnerzahl von 1250 wäre<br />
Modell A günstiger, da die Gesamtkosten<br />
um gut fünf Prozent unter denen der<br />
Anlage B liegen. Sinkt aber die Einwohnerzahl<br />
um 40 % auf 750, wird Anlage B<br />
um rund sieben Prozent günstiger als<br />
Anlage A, da die Fixkosten niedriger sind.<br />
Das heißt, die Kommune müsste sich<br />
34 KOMMUNAL<br />
Zwei Hauptkostenblöcke<br />
kennzeichnen die<br />
kommunale<br />
Verwaltung, das<br />
Bau- und Facility-<br />
Management<br />
sowie die<br />
Personalkosten.<br />
Die demografische Entwicklung in Österreich und Deutschland führt zu einer Alterung<br />
unserer Gesellschaft. Nicht nur der Anteil der älteren Menschen wird zunehmen,<br />
nein, wir werden auch absolut älter.<br />
heute für die teuere, aber strategisch richtige<br />
Variante entscheiden.<br />
Kommune 2015:<br />
Es ist wenig, wie es war<br />
Die Kommune ist prozessorientiert organisiert,<br />
hat die Kostentreiber durch<br />
Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling<br />
im Griff. Die Kosten sind transparent.<br />
Die Kommune hat sich verschlankt<br />
und viele Teile der Verwaltung bzw.<br />
der operativen Einheiten sind outgesourct,<br />
fremdvergeben und/oder<br />
in eine Gesellschaft mit Partner<br />
überführt. Insbesondere das Controlling<br />
wird zur Schlüsselaufgabe.<br />
Letzte öffentliche Monopolbastionen<br />
wie die Abwasser- und Abfallwirtschaft<br />
sind weitgehend durch<br />
Ausschreibungen von Gebietskonzessionen<br />
liberalisiert. Der Kampf<br />
um jede Tonne hat sich nicht durchgesetzt.<br />
Die Wirtschaftsförderung<br />
hat sich zu einem Vertrieb für die<br />
Stadt und deren Dienstleistungen<br />
gewandelt; sie bilden innerstädtische<br />
Netzwerke, veranstalten<br />
Tagungen und verschaffen den<br />
Menschen in der Stadt Wohn- und<br />
Lebensqualität. Es entstehen „Unorte“,<br />
soziale Spannungen erhöhen sich.<br />
Europäische Länder werden noch mehr<br />
zu Einwanderungsländern mit oder ohne<br />
Einwanderungsgesetz, letzteres siehe<br />
Deutschland, da die 2/3 Mehrheit im<br />
Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes<br />
für ein Einwanderungsgesetz nicht<br />
zustande kommt. Arbeitslosigkeit auf<br />
höherem Niveau bleibt bestehen, da Einwanderer<br />
nicht die notwendigen Qualifikationen<br />
mitbringen. „Gated Communities“<br />
und Ruhesitze wie in Florida haben<br />
sich etabliert. Der Stadtumbau ist in<br />
vollem Gange. Im ländlichen Raum werden<br />
einzelne Höfe aus Kostengründen<br />
nicht mehr infrastrukturell erschlossen<br />
und intelligente Bussysteme (nach Fahrgastzahl)<br />
werden sich etablieren. Öffentliche<br />
Aufgabenwahrnehmung wird unter<br />
Beibehaltung der Tarifstrukturen zunehmend<br />
gestreckt und in weiten Teilen privatisiert<br />
wahrgenommen. Gebühren und<br />
Satzungen wie beispielsweise für Abfall,<br />
Stadtreinigung, Wasser, Entwässerung,<br />
Friedhof gehören der Vergangenheit an.<br />
Verursachungsgerechte Abrechnung<br />
erfolgt. Bildungssysteme haben sich komplett<br />
gewandelt. Es findet eine intensive<br />
außerschulische und universitäre Bildung<br />
statt. Bildungseinrichtungen werden<br />
mehrere Niveaus abdecken. Bildung wird<br />
jedoch trotz niedrigerer Schüler- und Studentenzahlen<br />
nicht kostengünstiger, da<br />
die monetären Mittel in die Erhöhung<br />
und Aufrechterhaltung des Bildungsniveaus<br />
fließen. Bestimmte Kommunen<br />
haben ihre Chance ergriffen und sich<br />
optimal im Wettbewerb positioniert.<br />
Diese florieren als Gewinner.<br />
Wenig bleibt, wie es war. Aber jedem<br />
Anfang wohnt bekanntlich – nach Hermann<br />
Hesse – ein Zauber inne.<br />
Quellen<br />
Dr. Birg, Herwig, Prof. em.: „Die<br />
demografische Zeitenwende“, C. H.<br />
Beck, München, 2003<br />
Sinn, Hans-Werner: „Ist Deutschland<br />
noch zu retten“, Econ Verlag, 2004<br />
Walter, Norbert: „Demografie Spezial“,<br />
Deutsche Bank Research, 2004
In Österreich tut sich die Baubranche<br />
zunehmend schwer. Billigstofferte ausländischer<br />
Bauunternehmer, vor allem aus<br />
Deutschland, liegen um bis zu 40 Prozent<br />
unter den Gestehungskosten heimischer<br />
Bieter. Die Vereinigung Industrieller Bauunternehmen<br />
Österreichs (VIBÖ) kritisiert<br />
daher die Vergabepraxis in Österreich.<br />
Das Billigstbieterprinzip,<br />
also dem<br />
günstigsten Angebot<br />
den Zuschlag zu<br />
geben, sei kurzsichtig.<br />
Firmen würden zu<br />
knapp kalkulieren,<br />
während des Baus oft<br />
in den Konkurs schlittern<br />
und die Bauzeiten<br />
dadurch unnötig verlängert<br />
werden, was<br />
wiederum Geld koste.<br />
Für Aufregung sorgt<br />
nun der Europäische<br />
Gerichtshof (EuGH).<br />
Er hat entschieden,<br />
dass Italien das Billigstbieterprinzip<br />
nicht wie bisher abstrakt<br />
und allgemein vorschreiben dürfe. Denn<br />
– so der EuGH – dies „nimmt den öffentlichen<br />
Auftraggebern die Möglichkeit, die<br />
Art und die Besonderheiten der Aufträge<br />
im Einzelnen zu berücksichtigen, indem<br />
sie für jeden von ihnen das Kriterium<br />
wählen, das am besten geeignet ist, die<br />
Auswahl des besten Angebots zu gewährleisten.“<br />
Anlass für die Entscheidung ist ein Vorabentscheidungsverfahren<br />
zu einer nationalen<br />
Vergaberechtsvorschrift Italiens. Sie<br />
verpflichtet öffentliche Auftraggeber zur<br />
Wahl des Billigstbieterprinzips. Eine solche<br />
Bestimmung ist allerdings mit der<br />
europäischen Baukoordinierungsrichtline<br />
(Artikel 30 Abs 1 der RL 93/37/EWG),<br />
die die Zuschlagskriterien regelt, unvereinbar,<br />
sagt nun der EuGH.<br />
„Von dieser Entscheidung ist auch Österreich<br />
betroffen, denn auch hierzulande<br />
schreibt das Bundesvergabegesetz<br />
(BVergG) in § 67 Abs 3 BVergG allgemein<br />
und abstrakt vor, in<br />
welchen Fällen das Biligstoder<br />
das Bestbieterprinzip<br />
herangezogen werden<br />
muss,“ sagt Dr. Matthias<br />
Öhler von der auf Vergaberecht<br />
spezialisierten Kanzlei<br />
Schramm Öhler Rechtsanwälte.<br />
„Fraglich ist, ob es nach dieser<br />
Entscheidung den<br />
öffentlichen Auftraggebern<br />
überlassen bleiben muss,<br />
zwischen dem Kriterium des<br />
niedrigsten Preises, also<br />
dem Billigstbieterprinzip<br />
und dem Kriterium des<br />
wirtschaftlich vorteilhaftesten<br />
Angebots, dem Bestbieterprinzip, zu<br />
wählen, oder ob anstelle des Auftraggebers<br />
auch eine gesetzliche Regelung wie<br />
in § 67 Abs 3 BVergG eine solche Wahl<br />
allgemein und abstrakt treffen kann“, so<br />
Öhler. In letzterem Fall wäre § 67 Abs 3<br />
des Österreichischen Bundesvergabegesetzes<br />
(BVergG) unzulässig. Dort ist eine<br />
Beschränkung für die Wahl des Billigstbieterprinzips<br />
vorgesehen. Dieses darf<br />
nur bei der Ausschreibung hoch standardisierter<br />
Leistungen angewandt werden.<br />
„Gerade für die heimische Baubranche<br />
wäre dies ein bedrohliches Szenario“, wie<br />
Dr. Öhler ausführt. „Bis jetzt hatten die<br />
Unternehmer noch die Chance, mit<br />
Recht & Verwaltung<br />
EuGH: Zwang zur Billigstbietervergabe unzulässig<br />
Freies Wahlrecht des<br />
Auftraggebers<br />
Ausschreibungen der öffentlichen Hand sind ein gutes Geschäft. Sie machen rund<br />
16 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU aus, also rund 1500 Milliarden Euro jährlich.<br />
KOMMUNAL berichtet über eine EuGH-Entscheidung zum Bestbieterprinzip.<br />
◆ Dr. Matthias Öhler<br />
Der EuGH hat<br />
entschieden, dass<br />
Italien das Billigstbieterprinzip<br />
nicht wie<br />
bisher abstrakt und<br />
allgemein vorschreiben<br />
dürfe. Davon<br />
könnte auch Österreich<br />
betroffen sein.<br />
einem qualitativ hochwertigen Angebot<br />
zum Zug zu kommen. Wäre der öffentliche<br />
Auftraggeber aber frei, zwischen den<br />
Best- und den Billigstbieterprinzip zu<br />
wählen, ist zu erwarten, dass öffentliche<br />
Aufträge praktisch nur noch nach dem<br />
Billigstbieterprinzip vergeben werden<br />
und der Vergabewettbewerb auf ein reines<br />
Preisdumping hinausläuft.“<br />
Entscheidung liegt beim<br />
Verwaltungsgerichtshof<br />
Ob § 67 Abs 3 BVergG aber nun tatsächlich<br />
unzulässig ist und der Gesetzgeber<br />
das BVergG ändern muss, ist abzuwarten,<br />
so Matthias Öhler. Denn vieles spricht<br />
dafür, dass es dem EuGH nur um die Vergleichbarkeit<br />
der Angebote geht. Bei<br />
komplexen Aufträgen sind qualitativ<br />
unterschiedliche Angeboten nur unter<br />
Zugrundelegung des Bestbieterprinzips<br />
vergleichbar. Der Zwang des § 67 Abs 3<br />
BVergG zum Bestbieterprinzip bei komplexen<br />
Aufträgen kann daher durchaus in<br />
der Intention des EuGH liegen.<br />
◆ Dr. Matthias Öhler ist Spezialist<br />
für Vergaberecht in der Kanzlei<br />
Schramm Öhler Rechtsanwälte<br />
KOMMUNAL 35
Bits und Bytes gegen Stress<br />
Der Computer<br />
als Helfer<br />
Am Linzer Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung<br />
(IBE) wurde ein Computerprogramm zum<br />
Aufspüren von psychosozialen Belastungen am<br />
Arbeitsplatz entwickelt.<br />
„Es gibt einige Computerprogramme,<br />
mit denen die körperlichen Belastungen<br />
am Arbeitsplatz untersucht werden<br />
können”, sagt Mag. Iris Ratzenböck<br />
vom Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung<br />
(IBE) an der<br />
Universität Linz. „Dagegen gibt es nur<br />
wenig, um auch die psychischen Bela-<br />
stungen im beruflichen Alltag zu erheben.”<br />
Um diese Lücke zu schließen,<br />
wurde vom IBE gemeinsam mit dem<br />
Bildungsinstitut pro mente das Projekt<br />
“Psychosoziale Gesundheit am Arbeitsplatz”<br />
ins Leben gerufen, das zur Hälfte<br />
vom Fonds Gesundes Österreich finanziert<br />
wurde.<br />
Methodenmix. Zunächst ging es<br />
darum, geeignete Verfahren für die<br />
Erhebung der psychosozialen Belastungen<br />
im Arbeitsalltag zu finden. Mag.<br />
Ratzenböck: „Wir haben die einschlägigen<br />
Techniken analysiert, doch keine<br />
davon hat den Erwartungen völlig entsprochen.”<br />
Also wurde aus den bekannten<br />
Methoden eine völlig neue entwickelt,<br />
in die auch Anregungen von<br />
ExpertInnen von Arbeiter- und Wirt-<br />
36 KOMMUNAL<br />
»<br />
schaftskammer, der AUVA und von PersonalleiterInnen<br />
aus der Privatwirtschaft<br />
eingeflossen sind.<br />
Das angesammelte Know-how wurde<br />
schließlich in ein Computerprogramm<br />
integriert. Mit anonymer Daten- und<br />
Faktensammlung hat das Projekt allerdings<br />
nichts zu tun. Im Gegenteil. “Wir<br />
sind mit<br />
einem<br />
Laptop in<br />
Firmen<br />
gegangen,<br />
die sich als<br />
Testunternehmen<br />
für<br />
dieses Pro-<br />
«<br />
jekt zur Verfügung<br />
gestellt<br />
haben, und<br />
haben die<br />
MitarbeiterInnengebeten,<br />
die Fragen über ihre persönliche<br />
Situation am Arbeitsplatz zu beantworten”,<br />
erzählt Mag. Ratzenböck. Rund<br />
eine dreiviertel Stunde dauerte das<br />
Frage-und-Antwort Spiel mit dem Computer.<br />
Erhoben wurde etwa, wie groß<br />
der autonome Handlungsspielraum der<br />
MitarbeiterInnen ist, wie hoch die<br />
Arbeitsbelastung ist, wie familienfreundlich<br />
die Arbeitszeiten sind oder<br />
auch, wie die Zusammenarbeit und der<br />
Informationsfluss mit KollegInnen und<br />
den ChefInnen funktioniert. Schließlich<br />
wurde noch nach dem körperlichen<br />
Befinden gefragt. „Bei vielen Menschen,<br />
die über Magenprobleme oder<br />
Herz-Kreislauf-Beschwerden klagen,<br />
gibt es eine psychologische Komponente<br />
der Erkrankung”, so Mag. Ratzenböck.<br />
Bei dem Projekt stellte sich heraus,<br />
dass hohe Arbeitsbelastung,<br />
schwierige Arbeitszeiten oder<br />
andere belastende Faktoren<br />
als kaum problematisch<br />
erlebt werden, wenn nur das<br />
Betriebsklima in Ordnung ist.<br />
Mag. Iris Ratzenböck<br />
über die Ergebnisse des Pilotversuchs<br />
Aufgrund der in den Computer eingegebenen<br />
Antworten wurden sofort<br />
nach Abschluss des Frageprogramms<br />
die „Belastungsspitzen” analysiert. „So<br />
konnten wir den MitarbeiterInnen<br />
genau sagen, wo der Schuh drückt und<br />
was sie unternehmen können, um die<br />
Lage zu verbessern”, beschreibt Mag.<br />
Ratzenböck die Vorgangsweise. Durchgeführt<br />
wurden diese Interventionen<br />
durch ausgebildete PsychologInnen<br />
vom Bildungsinstitut der pro mente.<br />
Auch eine Analyse der Gesamtsituation<br />
im Betrieb war dank der EDV-gestützten<br />
Befragung möglich. So konnten<br />
auch strukturelle Probleme, die alle<br />
MitarbeiterInnen betreffen, sichtbar<br />
gemacht werden.<br />
Wo der Schuh drückt. Im Rahmen des<br />
Pilotversuches wurden mehr als 150<br />
Personen in fünf Firmen befragt. Aus<br />
den so gesammelten Daten lassen sich<br />
einige Rückschlüsse auf die größten<br />
psychosozialen Belastungsfaktoren am<br />
Arbeitsplatz ziehen. Den meisten Stress<br />
verursacht demnach die Veränderungsdynamik<br />
in den Betrieben. Mag. Ratzenböck:<br />
„Die Firmen müssen sich laufend<br />
an sich ändernde Rahmenbedingungen<br />
anpassen und daher auch<br />
intern die Arbeitsaufteilung immer wieder<br />
umschichten.” Doch auch wer sich<br />
dieser Herausforderung offensiv stellen<br />
möchte, stößt an enge Grenzen. „Die<br />
gebotenen Entwicklungsmöglichkeiten<br />
werden als zu gering wahrgenommen”,<br />
berichtet Mag. Ratzenböck. Umgekehrt<br />
stellte sich bei dem Projekt heraus, dass<br />
hohe Arbeitsbelastung, schwierige<br />
Arbeitszeiten oder andere belastende<br />
Faktoren als kaum problematisch erlebt<br />
werden, wenn nur das Betriebsklima in<br />
Ordnung ist. Als wichtigster Indikator
Die gesammelten Erfahrungen zum<br />
Aufspüren und Beseitigen von Stressfaktoren<br />
am Arbeitsplatz wurde in<br />
einem Endbericht zusammengefasst.<br />
Dieser ist sowohl auf der Homepage der<br />
IBE als auch direkt beim IBE zu beziehen.<br />
dafür konnte Mag. Ratzenböck die<br />
interne Kommunikation ausmachen.<br />
„Wer genug Information bekommt, um<br />
seine Arbeit gut zu erledigen, wer sich<br />
auch mit den KollegInnen austauschen<br />
kann, der ist meist recht zufrieden mit<br />
seiner Situation im Betrieb.”<br />
Die gesammelten Erfahrungen zum<br />
Aufspüren und Beseitigen von Stressfaktoren<br />
am Arbeitsplatz wurde in<br />
einem Endbericht zusammengefasst.<br />
Dieser ist sowohl auf der Homepage<br />
der IBE als auch direkt beim IBE zu<br />
beziehen. Zielpublikum sind die AkteurInnen<br />
des ArbeitnehmerInnenschutzes<br />
wie etwa Sicherheitsvertrauenspersonen,<br />
Sicherheitsfachkräfte, ArbeitsmedizinerInnen<br />
und auch<br />
ArbeitsinspektorInnen.<br />
Information & Kontakt<br />
Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung<br />
(IBE):<br />
Mag. Iris Ratzenböck,<br />
Tel: 0732/60 93 13-13,<br />
www.ibe.co.at<br />
pro mente: Irmgard Haringer,<br />
Tel: 0732/60 88 99,<br />
www.bildungsinstitut.at<br />
Kontakt<br />
Fonds Gesundes Österreich,<br />
Mariahilferstraße 176,<br />
A-1150 Wien, Tel. 01/8950400,<br />
Fax: 01/8950400-20,<br />
gesundes.oesterreich@fgoe.org<br />
Gemeindebund und FGÖ startet Wettbewerb<br />
Gesunde MitarbeiterInnen<br />
– Starke Gemeinden<br />
Aktivitäten zur Gesundheitsförderung<br />
speziell für MitarbeiterInnen gewinnen in<br />
Österreich im öffentlichen wie im privaten<br />
Sektor zunehmend an Bedeutung.<br />
Kein Wunder – denn von dieser modernen<br />
Strategie, mit der Krankheiten an<br />
Arbeitsplatz vorgebeugt und das Wohlbefinden<br />
von MitarbeiterInnen gesteigert<br />
werden sollen, profitieren Arbeitnehmer<br />
Innen und ArbeitgeberInnen:<br />
◆ gesundheitliche Risiken werden reduziert<br />
◆ das individuelle Wohlbefinden verbessert<br />
sich<br />
◆ Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation<br />
und Betriebsklima werden optimiert<br />
◆ krankheitsbedingte Fehlzeiten und<br />
Fälle von Frühinvalidität werden reduziert.<br />
Das alles gilt natürlich auch für Gemeindebedienstete.<br />
In vielen Gemeinden entstehen<br />
daher immer mehr Ideen und<br />
Initiativen, die dazu beitragen sollen, die<br />
Gesundheit der eigenen MitarbeiterInnen<br />
gezielt zu fördern. Die Maßnahmen sind<br />
vielfältig und reichen von regelmäßigen<br />
Lauftreffs über Rückentrainings oder<br />
ergonomische Maßnahmen bis hin zu<br />
Gesundheitszirkeln, in denen Verbesserungsvorschläge<br />
für die Arbeitsbedingungen<br />
entwickelt werden.<br />
Um derartige Ideen und Initiativen zu<br />
fördern, initiieren der Österreichische<br />
Gemeindebund und der Fonds Gesundes<br />
Österreich einen Wettbewerb zum Thema<br />
Gesundheitsförderung, der in Zukunft<br />
alle zwei Jahren duchgeführt werden soll.<br />
Mit dieser Aktion sollen Gemeinden motiviert<br />
werden, Aktivitäten zur Gesundheitsförderung<br />
für ihre Bediensteten<br />
umzusetzen. Die besten Ideen und Initiativen<br />
werden prämiert und bekannt<br />
gemacht.<br />
Der Wettbewerb<br />
Ausgezeichnet werden Ideen und Initiativen<br />
von österreichischen Gemeinden,<br />
die auf Gesundheitsförderung für ihre<br />
MitarbeiterInnen in den Gemeindeämtern<br />
und Bauhöfen abzielen.<br />
Teilnahmeberechtigt sind die österreichischen<br />
Gemeinden mit Ausnahme<br />
der Landeshauptstädte und der Bundeshauptstadt.<br />
Bewertet werden die Einrichtungen von<br />
einer hochkarätigen Jury unter der<br />
Schirmherrschaft<br />
von Bundesministerin<br />
Maria Rauch-<br />
Kallat.<br />
Preisträger sind<br />
maximal drei<br />
Gemeinden pro<br />
Bundesland. Aus<br />
diesen werden<br />
anschließend<br />
die österreichischen<br />
TOP TEN<br />
ermittelt.<br />
Verliehen werden<br />
an die<br />
Gewinner<br />
Gesundheits-<br />
Statuetten<br />
sowie Anerkennungsurkunden.<br />
Geehrt werden die Preisträger im Rahmen<br />
einer Gala-Veranstaltung im Juni<br />
2005<br />
Begleitet wird die Initiative durch<br />
Medienberichte über vorbildliche Aktionen<br />
und Projekte in österreichischen<br />
Gemeinden.<br />
So machen Sie mit<br />
Für Gemeinden, die sich an diesem Wettbewerb<br />
beteiligen, wurden Einreichungsunterlagen<br />
samt Fragebogen entwickelt,<br />
die Ihnen die Teilnahme und der Jury<br />
eine einheitliche Bewertung der Einrichtungen<br />
erleichtern sollen. Hier erhalten<br />
Sie die Einreichungsunterlagen:<br />
Preissekretariat, B&K – Bettschart &<br />
Kofler Medien- und Kommunikationsberatung<br />
GmbH, Porzellangasse 35/Top 3,<br />
1090 Wien, Tel.: (01) 319 43 78-0,<br />
Fax: (01) 319 43 78-20<br />
gesunde.mitarbeiter@<br />
gemeindebund.gv.at<br />
zum Download:<br />
www.gemeindebund.gv.at,<br />
www.fgoe.org<br />
Einreichschluß für den Wettbewerb<br />
ist der 15. April 2005.<br />
KOMMUNAL 37
Lebensministerium-Gemeindeservice<br />
CommunalAudit – Projektberichte an sechs Gemeinden übergeben<br />
<strong>Kommunal</strong>e<br />
Standortentwicklung<br />
Das Projekt CommunalAudit geht auf eine Initiative des Lebensministeriums zur<br />
Stärkung des ländlichen Raums zurück. Es wurde im Herbst 2003 in 50 Gemeinden<br />
des ländlichen Raums in insgesamt 8 österreichischen Bundesländern gestartet.<br />
Mit der Umsetzung des<br />
Projektes wurden die<br />
Unternehmen Finadvice<br />
(internationaler betriebswirtschaftlicher<br />
Berater)<br />
und WDL Wasserdienstleistungs<br />
GmbH (als Knowhow<br />
Träger im Bereich der<br />
kommunalen Wasser- und<br />
Abwasserwirtschaft)<br />
beauftragt. Weitere Experten<br />
decken im Projektteam<br />
insbesondere die weiteren<br />
Infrastrukturbereiche, ökologische<br />
Themen und<br />
rechtliche Fragestellungen<br />
ab. Die Projektabwicklung<br />
erfolgt unter enger Einbindung der<br />
betroffenen Gemeinden. Der letzte Meilenstein<br />
für dieses Großprojekt war die<br />
Vorstellung und Übergabe der Projektberichte<br />
an 6 Gemeinden durch Bundesminister<br />
Josef Pröll auf der <strong>Kommunal</strong>messe<br />
Pollutec in Wien.<br />
Rahmenbedingungen<br />
Im Projekt CommunalAudit sollen<br />
Lösungsansätze für die immer schwierigeren<br />
Rahmenbedingungen, mit denen<br />
gerade Gemeinden im ländlichen Raum<br />
konfrontiert sind, erarbeitet werden.<br />
Mit dem Projekt CommunalAudit werden<br />
u.a. folgende Zielsetzungen verfolgt:<br />
◆ Objektive Darstellung der Stärken<br />
und Schwächen des Standortes<br />
„Gemeinde“ aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln:<br />
◆ Erarbeitung von Ansatzpunkten zur<br />
Verbesserung der Standortqualität bzw.<br />
zur Steigerung der Effizienz bei der<br />
kommunalen Leistungserbringung<br />
◆ Hilfestellung für kommunale Entscheider<br />
bei der Priorisierung von<br />
38 KOMMUNAL<br />
Überblick über Projektinhalte und Projektablauf beim CommunalAudit<br />
Umsetzungsmaßnahmen<br />
Durch die vorgeschlagenen Lösungen<br />
soll sichergestellt werden, dass die<br />
Standortattraktivität in den untersuchten<br />
Gemeinden verbessert wird und<br />
dass gleichzeitig die kommunale Infrastruktur<br />
auch langfristig finanzierbar<br />
bleibt. Bei der Ausarbeitung von<br />
Lösungsvorschlägen wird vor allem<br />
Wert auf umsetzbare, praxisgerechte<br />
Lösungen gelegt. Ein wesentlicher Projektbestandteil<br />
ist dabei auch die<br />
Begleitung der Projektrealisierung von<br />
besonders innovativen Optimierungsvorschlägen,<br />
die bei der Projektbearbeitung<br />
gefunden werden (siehe auch<br />
KOMMUNAL Sept. 2004, Seite 26 bis<br />
28). BM Pröll fasst das Projektziel wie<br />
folgt zusammen: „Ziel des Projektes ist<br />
es, die Wettbewerbskraft und die<br />
Standortattraktivität für Gemeinden im<br />
ländlichen Raum zu verbessern. Wir<br />
müssen alle uns zur Verfügung stehenden<br />
Mittel einsetzen, um den Dienst<br />
am Bürger noch effizienter erbringen<br />
zu können. Durch das Projekt CommunalAudit<br />
soll die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums maßgeblich mitgestaltet<br />
werden“ Aus Sicht des<br />
Lebensministeriums sollen<br />
die im Projekt erarbeiteten<br />
Lösungen zu einer<br />
„Initialzündung“ für die<br />
Entwicklung in den untersuchten<br />
Gemeinden<br />
führen und darüber hinaus<br />
im Idealfall eine<br />
Modell- bzw. Vorbildwirkung<br />
für ähnlich gelagerte<br />
Probleme in anderen<br />
Gemeinden des ländlichen<br />
Raums bekommen.<br />
Datenerhebung<br />
Die Datenerhebung in den Projektgemeinden<br />
wird im wesentlichen in drei<br />
Schritten durchgeführt. Im ersten<br />
Schritt erfolgt eine Analyse der von der<br />
Gemeinde zur Verfügung gestellten<br />
Unterlagen (Rechnungsabschlüsse,<br />
Budgets/Finanzplanungen, Flächenwidmungspläne,<br />
technische Pläne von<br />
Infrastrukturanlagen, etc.). In einem<br />
zweiten Schritt erfolgt eine detaillierte<br />
Erhebung über den Zustand und die<br />
Leistungsfähigkeit der kommunalen<br />
Infrastruktur und der Organisation der<br />
kommunalen Leistungserbringung mittels<br />
eines eigens entwickelten Erhebungsbogens.<br />
Die Erhebung wird in<br />
einem dritten und letzten Schritt (je<br />
nach Bedarf) durch Gespräche mit Bürgermeister,<br />
Amtsleiter und anderen<br />
Gemeindebediensteten abgerundet.<br />
Maßgeschneiderte<br />
Optimierungsansätze<br />
Bei der Erarbeitung von Optimierungsansätzen<br />
werden maßgeschneidert auf<br />
die speziellen Charakteristika und<br />
Lebensministerium im Internet: http://www.lebensministerium.at
Bedürfnisse der einzelnen<br />
Gemeinden Empfehlungen<br />
abgeleitet. Die im Zuge des Projektes<br />
CommunalAudit entwickelten<br />
Optimierungsansätze<br />
zielen dabei auf zwei Bereiche<br />
ab. Zum einen werden Vorschläge<br />
erarbeitet, die die<br />
Gemeinden aus eigener Kraft<br />
umsetzen können. Oftmals<br />
greift jedoch, gerade im Bereich<br />
der kommunalen Infrastruktur<br />
eine isolierte Betrachtung der<br />
Gemeinde zu kurz. Deshalb<br />
wird zusätzlich untersucht, in<br />
welchen Bereichen durch<br />
gemeindeübergreifende, interkommunale<br />
Kooperationen Vorteile<br />
für die beteiligten Gemeinden<br />
erzielt werden können. BM<br />
Pröll unterstreicht die Bedeutung<br />
der interkommunalen<br />
Zusammenarbeit wie folgt: „Der ländliche<br />
Raum braucht starke Gemeinden.<br />
Oftmals können jedoch die Gemeinden<br />
die ihnen übertragenen Aufgaben mit<br />
den zur Verfügung stehenden Mitteln<br />
nicht mehr optimal erfüllen. Aus diesem<br />
Grund ist es unabdingbar notwendig,<br />
Kooperationen zwischen den<br />
Gemeinden zu stärken.“<br />
Naturgefahren sind extreme Ereignisse,<br />
die menschliches Leben, ihre Siedlungen,<br />
Verkehrswege und den Wirtschaftsraum<br />
bedrohen. Von den Naturgefahren,<br />
welche durch Bewegung von Wasser,<br />
Schnee, Erd- oder Felsbewegungen<br />
verursacht werden, gehen vielseitige<br />
Bedrohungen für die Daseinsgrundfunktionen<br />
Wohnen, Arbeiten, Erholung<br />
und vieles mehr aus.<br />
In der Österreichischen Verfassung<br />
wurde der Schutz vor Wildbächen und<br />
Lawinen zu einer Aufgabe des Bundes<br />
von gesamtstaatlicher Bedeutung<br />
erklärt. Im diesem Sinne werden einerseits<br />
Investitionen für die Durchführung<br />
von präventiven Schutzmaßnahmen<br />
getätigt, andererseits über das Instrument<br />
der Gefahrenzonen-Planung steuernd<br />
in die Raumordnung eingegriffen.<br />
Trotzdem trifft BürgerInnen, welche in<br />
dem von Naturgefahren bedrohten<br />
Raum leben, grundsätzlich die Eigenverantwortung<br />
für ihre Sicherheit.<br />
Das Ziel der Gefahrenzonenplanung<br />
Bundesminister Josef Pröll bei der Übergabe des<br />
ersten CommunalAudit-Berichts im Innviertel in<br />
Oberösterreich. Von links nach rechts: Bgm.<br />
Fischer (St. Marienkirchen), Bgm. Wohlmuth<br />
(Brunnenthal), Bgm. Seitz (Suben), Minister Pröll,<br />
Bgm. Gruber (Taufkirchen), Bgm. Ing. Angerer<br />
(Schärding), Bgm. Maringer (St. Florian am Inn)<br />
Folgeevaluierung (auf<br />
Wunsch der Gemeinden)<br />
Beim Projekt CommunalAudit handelt<br />
es sich um eine Bestandsaufnahme der<br />
Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt.<br />
Um Veränderungen der Stärken<br />
und Schwächen des Standortes im Zeitablauf<br />
betrachten zu können, empfiehlt<br />
Wildbach- und Lawinenverbauung<br />
Gefahrenzonenplan<br />
und Eigenvorsorge<br />
der Wildbach-<br />
und<br />
Lawinenverbauung<br />
bestand und<br />
besteht<br />
darin, den<br />
gefährdeten<br />
Raum zu<br />
erkennen,<br />
planlich darzustellen<br />
und geeignete<br />
Maßnahmen zu ergreifen. Entweder<br />
konnte der gefährdete Bereich<br />
unter Auflagen und Eigenmaßnahmen<br />
für die Bebauung genutzt werden, oder<br />
er musste auf Grund der extrem starken<br />
Gefährdung durch Lawinen, Wildbäche<br />
und Erosion gemieden werden.<br />
Die rechtliche Grundlage des Gefahrenzonenplanes<br />
findet sich im Forstgesetz<br />
von 1975. Bei der Erstellung des Gefahrenzonenplanes<br />
der WLV werden die<br />
BürgerInnen und BürgermeisterInnen<br />
sich die Durchführung einer Folgeevaluierung<br />
nach 3 Jahren. Bei der<br />
Durchführung der Folgeevaluierung<br />
können bereits die ersten Auswirkungen<br />
der im Rahmen der Erstevaluierung<br />
definierten Maßnahmen<br />
beobachtet werden.<br />
Ausblick<br />
Das Projekt CommunalAudit wird in 50<br />
österreichischen Gemeinden des ländlichen<br />
Raums bis Mitte 2005 abgeschlossen<br />
werden. Die Gemeinden selbst werden<br />
dadurch in die Lage versetzt, ihre<br />
Positionierung im Quervergleich zu<br />
sehen und Maßnahmen zur Verbesserung<br />
selbst in Angriff zu nehmen. Besonders<br />
innovative Projekte werden den<br />
Teilnehmern, im Rahmen einer in Aufbau<br />
befindlichen Wissensplattform zur<br />
Verfügung gestellt. Der vorliegende Artikel<br />
bildet den Auftakt einer Artikelserie<br />
zum Projekt CommunalAudit. In den<br />
nächsten Ausgaben von <strong>Kommunal</strong> werden<br />
erste Ergebnisse und Schlussfolgerungen<br />
aus den einzelnen Themenbereichen<br />
des Projektes dargestellt. Dabei<br />
kommen auch die Bürgermeister der<br />
CommunalAudit Gemeinden zu Wort.<br />
Mag. Reinhard Schwendtbauer<br />
planungsbetroffener Gemeinden intensiv<br />
in die Überprüfungsverfahren eingebunden.<br />
Die Genehmigung erfolgt<br />
durch den Bundesminister für Landund<br />
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.<br />
Lebensministerium im Internet: http://www.lebensministerium.at<br />
KOMMUNAL 39
Europa und seine Jugend<br />
Das Weißbuch Jugend – Neuer Schwung für die Jugend Europas<br />
Jugend und Europa<br />
Im erweiterten Europa leben 75 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren.<br />
Und die Jugendlichen bringen klar zum Ausdruck: sie wollen gehört und als vollwertige<br />
Gesprächspartner behandelt werden, sie wollen am Aufbau Europas mitwirken,<br />
sie wollen die Debatte über seine Zukunft beeinflussen.<br />
Europas Jugend will gehört werden und die Zukunft mitbestimmen. Das Weißbuch<br />
Jugend unterstützt sie dabei.<br />
Es ist an der Zeit, die Jugendlichen als<br />
Kraft zu sehen, die zum Aufbau Europas<br />
beitragen kann, und nicht als Problem,<br />
mit dem es umzugehen gilt. So<br />
ist es notwendig, eine stärkere Beteiligung<br />
der jungen Menschen in Europa<br />
an jenen Entscheidungen, die sie<br />
betreffen, zu fördern und einen neuen<br />
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen<br />
den verschiedenen Akteuren im<br />
Jugendbereich zu schaffen.<br />
Weißbuch Jugend<br />
Grundlage dafür ist das Weißbuch<br />
Jugend - Neuer Schwung für die<br />
Jugend Europas, das im November<br />
2001 beschlossen wurde.<br />
Ausgangspunkt dieses Weißbuchs war<br />
40 KOMMUNAL<br />
eine Konsultation, die im Zeitraum von<br />
Mai 2000 bis März 2001 stattfand und<br />
bei der Jugendliche unterschiedlichster<br />
Herkunft, Jugendorganisationen, die<br />
wissenschaftliche Gemeinschaft, die<br />
politischen Verantwortlichen und die<br />
Verwaltungen befragt wurden.<br />
Jugendkonsultation in<br />
Österreich<br />
„Gewinner gesucht“ – Diese Konsultation<br />
ist durch ihr Ausmaß, ihre Dauer,<br />
die breite Streuung der konsultierten<br />
Personen und die Vielfalt der Ergebnisse<br />
etwas in Europa noch nie Dagewesenes.<br />
Für einige Mitgliedstaaten<br />
stellte sie auch eine Premiere dar. Die<br />
Anzahl der in ihrem Rahmen durchgeführten<br />
Veranstaltungen war beträchtlich.<br />
Ziel der Kampagne „Gewinner<br />
gesucht“ war es, alle Jugendlichen in<br />
Österreich über die Möglichkeit zu<br />
informieren, ihre Meinungen und<br />
Ideen zur Zukunft der EU-Jugendpolitik<br />
in den Weißbuch-Prozess einzuspeisen.<br />
Kommentare, Meinungen<br />
und Ideen konnten per Post bzw. per<br />
Email eingesendet werden. Als Anreiz<br />
für das Übermitteln von Texten wurde<br />
der Gewinn von 6 Paris-Reisen angeboten.<br />
Inhalte des Weißbuch<br />
Jugend<br />
Die wesentlichen Botschaften des Weißbuchs<br />
Jugend sind:<br />
◆ Jugendliche informieren<br />
◆ Jugendliche mitreden lassen<br />
◆ Einbeziehung der Jugendlichen in<br />
das öffentliche Leben<br />
◆ Mehr Wissen über die jugendlichen<br />
Bedürfnisse<br />
◆ Verstärkte Berücksichtigung der<br />
Jugend in allen Politikbereichen<br />
◆ Umsetzung des Programms Jugend<br />
In einer ersten Phase wurden die Themenbereiche<br />
Partizipation, Information,<br />
Freiwilligenarbeit und „Mehr Wissen<br />
über die Jugend“ bearbeitet.<br />
Von der europäischen Kommission wurden<br />
Fragebögen an alle Mitgliedsstaaten<br />
ausgeschickt, die Beantwortungen<br />
wurden gesammelt, ausgewertet und in<br />
den jeweiligen Entschließungen des<br />
Rates die zukünftige Weiterarbeit in<br />
den jeweiligen Themenbereichen kundgetan.<br />
www.weißbuch.at – www.yap.at – www.jugendinfo.at –www.bmsg.gv.at
Reges Interesse bei der <strong>Kommunal</strong>messe am Audit des BMSG<br />
Das Audit unterstützt die Gemeinde<br />
dabei, ihre Familien- und Kinderfreundlichkeit<br />
systematisch zu überprüfen,<br />
gezielt weiterzuentwickeln und nach<br />
außen hin zu dokumentieren. Mit dem<br />
Audit können vor allem junge Menschen<br />
bei kommunalen<br />
Projekten beteiligt werden.<br />
Das Audit ist sehr benutzerfreundlich<br />
gestaltet und<br />
kann in Eigenregie umgesetzt<br />
werden. Lediglich für<br />
die Begutachtung durch<br />
eine/n Gutachter/in fallen<br />
am Verfahrensende Kosten<br />
an.<br />
„Dieses Audit ist ein<br />
wesentlicher Beitrag für<br />
eine positive Zukunft für<br />
alle Gemeindebürgerinnen<br />
und Gemeindebürger“ sagt<br />
die zuständige Staatssekretärin<br />
Ursula Haubner.<br />
Der Weg zum Zertifikat für<br />
Familien- und Kinderfreundlichkeit<br />
ist einfach<br />
und klar strukturiert. Der<br />
Bürgermeister bekundet<br />
das Interesse am Audit<br />
und nimmt mit dem<br />
BMSG Kontakt auf. Der<br />
nächste Schritt ist das verpflichtendeRegionalseminar<br />
für die angemeldete<br />
Gemeinde.<br />
Regionalseminar für die<br />
Gemeinde<br />
Das Regionalseminar dient der Vorstellung<br />
der Zielsetzung und der Instrumente<br />
des Audits familien- und kinderfreundliche<br />
Gemeinde und<br />
ist jedenfalls<br />
verpflichtend<br />
für die<br />
Gemeinde.<br />
Das erste<br />
Regionalseminar,<br />
an dem die<br />
Gemeinden<br />
Attendorf,<br />
Gabersdorf,<br />
Gleisdorf,<br />
Köflach und<br />
Lassing teilgenommen<br />
haben, fand<br />
Anfang November<br />
in der Steiermark<br />
statt.<br />
Im Rahmen<br />
«<br />
dieses Regionalseminars<br />
wird der<br />
Gemeinde das<br />
Audit familienundkinderfreundliche<br />
Gemeinde vorgestellt,<br />
Zielsetzung sowie Vorgehensweise<br />
werden abgeklärt.<br />
Beim Regionalseminar wird auch<br />
der Werkzeugkoffer an die<br />
Gemeinde übergeben.<br />
Gemeinde-Audit<br />
Familien- und kinderfreundliche<br />
Gemeinde<br />
Zahlreiche <strong>Kommunal</strong>politiker haben sich bei der KOMMUNALMESSE am<br />
Messestand des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und<br />
Konsumentenschutz darüber informiert, wie man das entwickelte Audit<br />
familien- und kinderfreundliche Gemeinde in Anspruch nehmen kann.<br />
»<br />
Dieses Audit ist<br />
ein wesentlicher<br />
Beitrag für eine<br />
positive Zukunft für<br />
alle Gemeindebürgerinnen<br />
und<br />
Gemeindebürger.<br />
Ursula Haubner<br />
Die TeilnehmerInnen des ersten Regionalseminars,<br />
das Anfang November in<br />
der Steiermark stattgefunden hat.<br />
Dieser beinhaltet:<br />
◆ Infobroschüren<br />
◆ Rahmenrichtlinie<br />
◆ Projektbericht<br />
◆ Handlungsfeldermatrix<br />
◆ Plakate<br />
◆ Vereinbarung betreffend Teilnahme<br />
am Audit familien- und kinderfreundliche<br />
Gemeinde<br />
◆ Verzeichnis der zugelassenen Gutachter/innen<br />
Die Anmeldung zum Regionalseminar<br />
ist mittels formlosen E-Mail an manuela.marschnig@bmsg.gv.at<br />
zu richten.<br />
Informationen:<br />
Bundesministerium für soziale<br />
Sicherheit, Generationen und<br />
Konsumentenschutz, Abteilung V/7<br />
Franz-Josefs-Kai 51, 1010 Wien<br />
Projektleitung:<br />
Dr. Angelika Schiebel<br />
Auskunft: Mag. Manuela Marschnig<br />
Tel.: 01/71100/3296<br />
Fax: 01/7189470/2223<br />
manuela.marschnig@bmsg.gv.at<br />
www.gemeindeaudit.bmsg.gv.at<br />
KOMMUNAL 41
Statistische Informationen für Österreichs Gemeinden<br />
Nur ein paar<br />
Mausklicks entfernt<br />
Statistik Austria hält auf ihrer Homepage einen umfangreichen und regional tief<br />
gegliederten Datenschatz für Städte und Gemeinden bereit. Mit www.statistik.at<br />
erschließen Sie sich mit wenigen Mausklicks eine breite Palette statistischer<br />
Informationen über unser Land, unsere Wirtschaft und Gesellschaft.<br />
Die Großzählung 2001<br />
Die Hauptergebnisse der Großzählung<br />
2001 wurden von der Statistik Austria in<br />
56 Printpublikationen veröffentlicht. Alle<br />
Publikationen können auf der Homepage<br />
(„Neuerscheinungen“) unentgeltlich eingesehen<br />
werden. Daten zu den Gemeinden<br />
finden sich vor allem in den jeweiligen<br />
Bundesländerheften.<br />
Volkszählung 2001:<br />
27 Bände, davon 18 allein mit<br />
Gemeindeergebnissen<br />
Gebäude- und Wohnungszählung 2001:<br />
Hauptergebnisse in neun Bundesländerund<br />
einem Österreichband<br />
Arbeitsstättenzählung 2001:<br />
Hauptergebnisse in neun Bundesländerund<br />
einem Österreichband<br />
Ortsverzeichnis 2001:<br />
Neun Bundesländerbände und Österreich<br />
auf CD-ROM: gesamte Siedlungsgliederung<br />
(Zahl der Gebäude, Wohnungen,<br />
Haushalte, Einwohner und Arbeitsstätten)<br />
Standardmäßig liegt jeder Publikation<br />
eine CD-ROM bei, auf der die gesamte<br />
Publikation als <strong>PDF</strong>-File und die Tabellen<br />
zusätzlich in EXCEL-Format enthalten ist.<br />
42 KOMMUNAL<br />
Ob es sich um die neuesten Entwicklungen<br />
(„Presseinformationen“; „Ergebnisse“),<br />
die umfassenden Ergebnisse<br />
der Großzählung 2001, die neuesten<br />
Publikationen („Neuerscheinungen“),<br />
die Strukturdaten in<br />
individueller Detailtiefe<br />
(„Datenbank<br />
ISIS“) oder um das<br />
Spezialinfopaket für<br />
Österreichs Gemeinden<br />
(„Statistische<br />
Informationen für<br />
alle 2359 Gemeinden“)<br />
handelt, Sie<br />
werden von der Vielfalt<br />
der Informationen<br />
begeistert sein<br />
und damit „Österreich<br />
besser verstehen“.<br />
Und was sie<br />
noch überraschen<br />
wird, fast alles wird<br />
unentgeltlich angeboten.<br />
Ein Blick auf<br />
die Gemeinde<br />
»<br />
„Ein Blick auf die<br />
Gemeinde …“: eine<br />
laufend aktualisierte<br />
Zusammenstellung<br />
der wesentlichen Daten aus den verschiedensten<br />
Fachbereichen für jede<br />
einzelne Gemeinde. Die auf der Homepage<br />
unentgeltliche Version enthält<br />
Daten der Großzählung 2001 sowie<br />
Daten zur Bevölkerungsentwicklung,<br />
Wenn es um Fakten<br />
geht, gibt es wenig,<br />
das wir nicht beantworten<br />
können.<br />
Dr. Gabriela Petrovic<br />
Kaufmännische General-<br />
direktorin der Statistik Austria<br />
STATISTIK AUSTRIA - www.statistik.at<br />
Land- und Forstwirtschaft, Gebarungen<br />
und Steuereinnahmen.<br />
Darüber hinaus kann auf Bestellung<br />
eine rund 70-seitige Farbbroschüre (mit<br />
Diskette) geliefert werden, die mit über<br />
50 Datenblättern aus<br />
den Bereichen Bevölkerung,<br />
Haushalte<br />
und Familien,<br />
Gebäude und Wohnungen,Arbeitsmarkt,<br />
Arbeitsstätten,<br />
Landwirtschaft, Tourismus,Gemeindegebarung<br />
und Nationalratswahlen<br />
das<br />
breite Spektrum des<br />
auf Gemeindeebene<br />
verfügbaren Datenangebots<br />
umfasst.<br />
In dieser Broschüre<br />
werden die Daten auf<br />
verschiedene Arten<br />
präsentiert (zum Beispiel<br />
Kennziffer, Veränderungsraten,<br />
Pro-<br />
«<br />
Kopf-Werte und ähnliche<br />
Maßzahlen), um<br />
es Ihnen zu ermöglichen<br />
sich rasch einen<br />
Überblick über die<br />
wesentlichsten Aussagen<br />
zu machen. Zahlreiche<br />
Tabellen der<br />
wichtigsten Ergebnisse werden zusätzlich<br />
auch als Diagramme aufbereitet.<br />
Zum Vergleich sind in der Broschüre<br />
auch die analogen Daten des jeweiligen<br />
Politischen Bezirks und des Bundeslandes<br />
enthalten.
KOMMUNAL<br />
KONGRESS<br />
E-Government Staatspreis 2004: Steirischer „Katastrophenschutz Online“<br />
Ein deutliches „Mehr“ an Sicherheit<br />
Im Rahmen des Österreichischen<br />
Staatspreises 2004 hat<br />
die Fachabteilung Katastrophenschutz<br />
und Landesverteidigung<br />
(FA7B) der Steiermärkischen<br />
Landesregierung zwei<br />
Staatspreise für E-Government<br />
gewonnen. Das Internetportal<br />
„Katastrophenschutz<br />
Online“ konnte die Jury nicht<br />
nur in der Kategorie „Government<br />
to Government“, sondern<br />
auch in der Gesamtkategorie<br />
„E-Government“ überzeugen.<br />
„E-Government im<br />
besten Sinn ist nach unserem<br />
Verständnis, wenn wir das<br />
Zusammenwirken von Behörden,<br />
Einsatzorganisationen<br />
Katastrophenschutz: Was sagt das Gesetz<br />
Bürgermeister sind zuständig<br />
„Die Gemeinden haben für die<br />
Vorbereitung und Durchführung<br />
der Abwehr und der<br />
Bekämpfung von Katastrophen<br />
nach den Bestimmungen der<br />
hierfür maßgeblichen Gesetze<br />
zu sorgen. Die Leitung der<br />
Abwehr und der Bekämpfung<br />
von Katastrophen im Gemeindegebiet<br />
obliegt somit dem Bürgermeister<br />
als Gemeinde-Ein-<br />
Der Satellit IKONOS zeigt die<br />
Stadtkerne aller neun Landeshauptstädte<br />
in feinauflösenden<br />
Satellitenbildern.<br />
sowie Bevölkerung erleichtern<br />
und damit ein deutliches<br />
Mehr an Sicherheit schaffen“,<br />
beschreibt Dr. Kurt Kalcher,<br />
Leiter der FA7B, die Zielsetzung<br />
von Katastrophenschutz<br />
Online. Diese Homepage ist<br />
ein in Europa einzigartiges,<br />
innovatives Projekt, das sich<br />
mit mehreren vernetzten<br />
Plattformen an unterschiedliche<br />
Zielgruppen wendet: Der<br />
satzleiter. Der Bürgermeister<br />
hat dazu auch eine Gemeindeeinsatzleitung<br />
zu bilden, diese<br />
soll den Gemeinde-Einsatzleiter<br />
beratend und unterstützend<br />
zur Seite stehen.“<br />
Soweit das Gesetz, das jeder<br />
Bürgermeister kennt. Was es<br />
in der Realität heißt, behandelt<br />
der Katastrophenschutz-<br />
Kongress am 11. November.<br />
öffentliche Bereich bietet Bürgern<br />
und Medien umfassende<br />
Inhalte über Gefahren und<br />
Katastrophenfälle sowie<br />
Schutzmaßnahmen und Empfehlungen<br />
bei möglichen Krisen-Szenarien.<br />
Intranet sowie Extranet dienen<br />
darüber hinaus als hochverfügbare,<br />
geschützte Kommunikationsplattform<br />
aller<br />
beteiligten Behörden und Einsatzkräfte.<br />
Es erlaubt von der<br />
Landeswarnzentrale ausgehend<br />
die computergestützte<br />
Koordinierung in Echtzeit.<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.katastrophenschutz.<br />
steiermark.at/<br />
Information<br />
Satellitenbilder: Hilfe im Katastrophenfall<br />
High Tech aus dem Weltraum<br />
Der „Österreich Satelliten<br />
Bildatlas“ zeigt flächendeckende<br />
Aufnahmen Österreichs.<br />
Das Land wird darin<br />
zur Gänze in Satellitenbildern<br />
und Karten dargestellt, dazu<br />
werden die Stadtkerne aller<br />
Landeshauptstädte in feinauflösenden<br />
Satellitenbildern<br />
vom Erdbeobachtungssatelliten<br />
IKONOS präsentiert. Top<br />
aktuelle Satellitenbilder sind<br />
auch für den Einsatz bei<br />
Naturkatastrophen ein<br />
bestens geeignetes Mittel, um<br />
In eigener Sache<br />
Auf den folgenden Seiten finden<br />
Sie einen detaillierten<br />
Bericht über den „<strong>Kommunal</strong>-<br />
Kongress“ zum Thema „Katastrophenschutz“.<br />
In den kommenden<br />
Ausgaben wird<br />
KOMMUNAL die einzelnen<br />
Referate ausführlicher vorstellen,<br />
da die Fülle der Informationen<br />
den Rahmen dieser<br />
Ausgabe sprengen würde.<br />
betroffene Gebiete zu erfassen,<br />
Schäden zu quantifizieren<br />
und schnelle Hilfe zu<br />
ermöglichen. Beim Hochwasser<br />
2002 oder beim Erdbeben<br />
von Bam (Iran) im Dezember<br />
2003 wurde von den Hilfskräften<br />
mit aktuellen hochauflösenden<br />
Satellitenbildern<br />
gearbeitet. Damit war es in<br />
kürzester Zeit möglich das<br />
jeweilige Schadensausmaß zu<br />
erheben und effizient Hilfsmaßnahmen<br />
zu koordinieren.<br />
Web-Tipp: www.geospace.at<br />
Über den<br />
Kongress<br />
KOMMUNAL 43<br />
Dr. Robert<br />
Hink, Generalsekretär<br />
des ÖsterreichischenGemeindebundes<br />
Messe & Kongress<br />
voller Erfolg<br />
Zu einem vollen Erfolg wurde die<br />
KOMMUNALMESSE / Public Services<br />
Mitte November in Wien. Parallel<br />
zur Messe fanden am Messegelände<br />
Wien der Kongress zum<br />
Thema „Katastrophenschutz“ statt,<br />
der ebenfalls als voller Erfolg verbucht<br />
werden konnte. Hunderte<br />
Entscheidungsträger aus den Kommunen<br />
informierten sich über notwendige<br />
und vorbeugende Maßnahmen.<br />
Durch erstklassige Referate<br />
von anerkannten Experten und<br />
Profis konnten sich alle Teilnehmer<br />
einen guten Überblick verschaffen.<br />
Auch die <strong>Kommunal</strong>messe selbst<br />
war an allen drei Tagen ausgezeichnet<br />
besucht. Besonders bemerkenswert<br />
war der Ansturm zahlreicher<br />
ausländischer Gäste, vor allem aus<br />
den östlichen Nachbarstaaten<br />
Österreichs. Die KOMMUNAL-<br />
MESSE als Kongress- und Kontaktmesse<br />
erfüllte damit ihren Zweck<br />
voll und schuf eine Reihe von wichtigen<br />
Gesprächsplattformen und<br />
Gesprächen. Der Österreichische<br />
Gemeindebund war gemeinsam mit<br />
KOMMUNAL und seiner E-Government-Plattform<br />
„kommunalnet.at“<br />
bestens vertreten, der gemeinsame<br />
Stand war einer der am stärksten<br />
frequentierten Treffpunkte unter<br />
den über 200 Ausstellern.<br />
Ich freue mich, dass diese Messe<br />
und die daran angeschlossenen Veranstaltungen<br />
so gut angenommen<br />
werden und zum Fixpunkt im Terminkalender<br />
vieler Kommunen und<br />
Gemeinden zählen.<br />
Herzlichst Robert Hink
Vorbeugen ist besser als hinterher Schäden zu beheben<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
gibt Richtung vor<br />
Mit einer Reihe von prominenten Referenten tagte parallel zur KOMMUNALMESSE der<br />
<strong>Kommunal</strong>kongress zum Thema„Katastrophenschutz“, zu dem der Österreichische<br />
Gemeindebund geladen hatte. „Vorbeugen ist besser und billiger, als wenn man hinterher<br />
Schäden beheben muss“.<br />
Mit sehr persönlichen Worten und Erinnerungen<br />
eröffnete Gemeindebund-<br />
Präsident Bgm. Helmut Mödlhammer<br />
den Kongress vor rund 300 Delegierten.<br />
„Ich kann mich sehr genau erinnern,<br />
am Tag meiner Wahl zum Präsidenten<br />
des Gemeindebundes ereignete<br />
sich das Lawinenunglück von Galtür.<br />
Wie das ganze Land stand damals auch<br />
ich unter einem großen Schock angesichts<br />
der dramatischen Ereignisse und<br />
der furchtbaren Schicksale von Betroffenen<br />
und Angehörigen der Opfer“.<br />
Unglücke wie diese, aber<br />
auch Katastrophen wie<br />
in Kaprun oder das Jahrhundert-Hochwasser<br />
würden verdeutlichen,<br />
wie wichtig vorbeugender<br />
Katastrophenschutz<br />
für die österreichischen<br />
Gemeinden sei, so Mödlhammer.<br />
„Die Gemeinden wissen<br />
aus eigener Erfahrung,<br />
dass Vorbeugen besser<br />
ist, als Schäden wieder<br />
gut zu machen. Prävention<br />
ist das Schlagwort,<br />
44 KOMMUNAL<br />
»<br />
das in allen Lebenslagen zählt. Auch<br />
Gemeinden haben sich dem Präventionsgedanken<br />
zu stellen, denn die Formen<br />
der Krise, die eine Gemeinde treffen<br />
können, sind vielfältig“, sagte der<br />
Gemeindebund-Präsident.<br />
Katastrophen sind nicht<br />
die einzige Bedrohung<br />
Dr. Kurt Kalcher, Leiter der Fachabteilung<br />
Katastrophenschutz und Landesverteidigung<br />
beim Amt<br />
der SteiermärkischenLandesregierung,<br />
nahm<br />
zu Beginn<br />
des Kongresses<br />
die Definition<br />
des<br />
Alle Szenarien, auf die<br />
wir uns vorbereiten,<br />
mögen uns verschonen.<br />
Dr. Heinrich Hoffschulte<br />
1. Vizepräsident des RGRE und<br />
Gastredner beim Kongress<br />
«<br />
Begriffs<br />
„Katastrophe“<br />
vor.<br />
„Von einer<br />
Katastrophe<br />
spricht man<br />
Fotos: Boltz<br />
Die Eröffnung des <strong>Kommunal</strong>-Kongresses:<br />
Zwiespältige Gefühle herrschten<br />
zu diesem Zeitpunkt bei Helmut<br />
Mödlhammer vor. Sehr persönliche<br />
Erinnerungen an das Unglück von Galtür<br />
überschatteten die Meldung von<br />
der überaschenden und glücklichen<br />
Einigung beim Finanzausgleich, die<br />
knapp vor Beginn der Tagung bekannt<br />
wurde.<br />
dann, wenn rund 30 Menschen oder<br />
größere Sachwerte gefährdet sind“, so<br />
Kalcher. Oftmals sei aber nicht nur die<br />
Katastrophe selbst eine Bedrohung, in<br />
vielen Fällen seien Desinteresse,<br />
Ignoranz und zum Teil sogar offene<br />
Ablehnung mindestens genauso<br />
schlimm, wie die Katastrophe selbst.<br />
Kalcher zeigte in seiner Einleitung auch<br />
die Vielfältigkeit von Katastrophen auf.<br />
„Man darf diesen Begriff nicht nur auf<br />
Naturkatastrophen einschränken. Ich<br />
erinnere dabei etwa an die Terroranschläge<br />
von New York oder Madrid,<br />
auch das waren gewaltige Katastrophen,<br />
das Bedrohungsbild hat sich in den letzten<br />
Jahren also stark erweitert.“ Katastrophenschutz<br />
sei eine dynamische<br />
Sache, die sich ständig entwickle und<br />
regelmäßig die Überarbeitung der Vorbereitungen<br />
darauf erfordere.<br />
Siedlungsräume schützen<br />
In Vertretung von Lebensminister Josef<br />
Pröll, der zu diesen Zeitpunkt bei der Budgetdebatte<br />
im Nationalrat festsaß, referierte<br />
Sektionsschef Wolfgang Stalzer, ein<br />
anerkannter Experte aus dem Lebensmini-
sterium, über<br />
die Ergebnisse<br />
der Flood-Risk-<br />
Studie (Details<br />
über die Studie<br />
auf den Seiten<br />
52 und 53 die-<br />
»<br />
Es ist die höchste<br />
Kunst des Teufels,<br />
uns davon zu<br />
überzeugen, dass<br />
es ihn nicht gibt.<br />
Hofrat Dr. Kurt Kalcher<br />
zur Vorsorge für<br />
Katastrophen<br />
ser Ausgabe). „Im Bereich der Vorbeugung<br />
von Hochwasser-Katastrophen ist es<br />
extrem wichtig, die gefährdeten Naturund<br />
Siedlungsräume lückenlos zu definieren,<br />
um daraus die entsprechenden Maßnahmen<br />
abzuleiten“, so Stalzer. Dieser<br />
Definition müsse man dann beispielsweise<br />
auch Raumordnung und Widmung vieler<br />
Flächen anpassen.<br />
„Wir müssen<br />
gewisse<br />
Räume in weiterer<br />
Folge auch<br />
von hochwertiger<br />
Nutzung<br />
freihalten, denn<br />
es wird immer<br />
Bereiche geben,<br />
die dauerhaft<br />
hochwassergefährdet<br />
sind.“<br />
Dort, wo schon<br />
Siedlungen<br />
bestünden,<br />
müsse man<br />
diese Siedlungen<br />
bestmöglich<br />
schützen. In<br />
Tirol etwa habe<br />
man mit Investitionen<br />
von<br />
rund zwei Millionen Euro einen Hochwasserschaden<br />
in der Höhe von 40 Millionen<br />
Euro verhindern können. Das Lebensministerium<br />
investiere, so Stalzer, jährlich<br />
annähernd 100 Millionen Euro in Maßnahmen<br />
zum Katastrophenschutz. „Es ist<br />
auch wichtig, und im europäischen Vergleich<br />
bei weitem nicht selbstverständlich,<br />
dass Österreich über einen Katastrophenfonds<br />
verfüge, der nicht nur bei akuten<br />
Notfällen beansprucht wird, sondern auch<br />
bei vorbeugenden Maßnahmen mit hilft.<br />
Vorbeugen ist immer besser und im Normalfall<br />
auch erheblich billiger, als wenn<br />
man im Falle eines Unglücks dann die<br />
Schäden beheben muss.“<br />
Am wichtigsten, so Stalzer, sei jedoch die<br />
Frage, wie man in der Bevölkerung und in<br />
den Gemeinden die Gefahrenkenntnis<br />
und das Bewusstsein für mögliche Katastrophen<br />
schärfen könne. „Die Folgen und<br />
die Möglichkeit der Gefahr werden leider<br />
sehr schnell vergessen, es wird vergessen,<br />
dass trotz aller vorbeugenden Maßnahmen<br />
auch immer ein Restrisiko besteht.<br />
Eine Katastrophe kann heute oder morgen<br />
schon jede Gemeinde in unserem<br />
Land treffen.“<br />
«<br />
Wichtige Freiwilligen-<br />
Arbeit<br />
Dr. Peter Widermann von der Generaldirektion<br />
für die öffentliche Sicherheit<br />
wies einerseits auch auf die veränderten<br />
Bedrohungsszenarien hin,<br />
erwähnte andererseits auch die Fortschritte<br />
auf<br />
europäischer<br />
Ebene. „Die EU-<br />
Solidaritätsklausel<br />
enthält die<br />
Verpflichtung<br />
anderen Mitgliedsstaaten<br />
im<br />
Falle einer Katastrophe<br />
zu helfen.<br />
Europa wächst<br />
also auch in diesem<br />
Bereich<br />
zusammen“,<br />
»<br />
Den Katastrophenschutz<br />
braucht eigentlich niemand –<br />
«<br />
bis die Katastrophe da ist.<br />
Gemeindeminister Ernst Strasser<br />
nennt ein gefährliches Vorurteil<br />
berichtete Widermann.Grundsätzlich<br />
müsse man<br />
bei der Bekämpfung<br />
der Folgen<br />
einer Katastrophe<br />
die Verantwortung<br />
sinnvoll aufteilen.<br />
„Es muss<br />
jeweils Vorkehrungen der Behörde, Vorkehrungen<br />
der Einsatzorganisationen,<br />
aber natürlich auch Vorkehrungen der<br />
Bürger selbst geben“, so Widermann.<br />
Generell sei Österreich gerade bei den<br />
Hilfsorganisationen in einer beneidenswerten<br />
Situation. „Ich kenne kein anderes<br />
europäisches Land, in dem die Tradition<br />
der freiwilligen Helfer in den<br />
diversen Organisationen, wie der Feuerwehr<br />
oder dem Roten Kreuz, so ausgeprägt<br />
ist. Bei uns sind rund vier Prozent<br />
der Bevölkerung in freiwilligen<br />
Hilfsorganisationen tätig, das ist gewaltig.“<br />
Freiwillige sind<br />
unersetzbar<br />
Die Vertreter und Referenten der Hilfsorganisationen,<br />
Präsident Ing. Manfred<br />
Seidl vom Bundesfeuerwehrverband<br />
sowie Dr. Werner Kerschbaum vom<br />
Roten Kreuz, unterstrichen die Bedeutung<br />
der freiwilligen Helfer. „In Summe<br />
ist jeder 25. Österreicher Mitglied einer<br />
Feuerwehr“, berichtete Seidl. Der<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
Mannschaftsstand betrage<br />
fast 300.000 Personen,<br />
dazu kämen noch mehr als<br />
23.000 Jugendliche zwischen<br />
zehn und 16 Jahren.<br />
„Der Freiwilligendienst ist<br />
damit in hohem Maße<br />
auch ein Kostenfaktor, denn diesen Personalstand<br />
könnte sich keine Kommune<br />
dauerhaft leisten“, so Seidl.<br />
214 Millionen Euro an<br />
freiwilliger Hilfe<br />
„Das Rote Kreuz subventioniert die<br />
Republik indirekt mit rund 214 Millionen<br />
Euro im Jahre“, so die pointierte<br />
Rechnung von Kerschbaum. Diese<br />
Organisationsstrukturen<br />
Die rechtlichen<br />
Grundlagen<br />
Dr. Peter Widermann, Innenministerium<br />
Dr. Peter Widermann, Bereichsstellvertreter<br />
der Sektion II (Öffentliche Sicherheit) im<br />
Innenministerium, zeichnet unter anderem<br />
für Staatliches Krisenmanagement verantwortlich.<br />
Nachdem er auf das (weltweit)<br />
geänderten Sicherheitsumfeld hingewiesen<br />
und die neue europäische Sicherheitsdoktrin<br />
(auch Solana-Doktrin) skizziert hatte, ging<br />
er nicht nur auf die derzeit gültigen Organisationsstrukturen<br />
im Katastrophenfall ein,<br />
sondern legte das Hauptaugenmerk auf<br />
geplante Verbesserungen und Strukturänderungen.<br />
Als wichtigste Voraussetzung nannte<br />
Widermann die zentrale Bundeswarn- und -<br />
leitstelle im Innenministerium, über die in<br />
Zukunft die Kommunikation gebündelt für<br />
mehr Effizienz beim Einsatz sorgen wird.<br />
Auch beim Österreich-Konvent wird an der<br />
Verbesserung der Zuständigkeiten im Katastrophenschutz<br />
gearbeitet. Kompetenzen sollen<br />
danach klar verteilt sein, um das kräfteraubende<br />
Ringen um Zuständigkeit zwischen<br />
den Gebietskörperschaften hintanzustellen.<br />
Mit Sicherheit wird die EU-Komponente<br />
im Katastrophenschutz in Zukunft<br />
mehr Bedeutung erhalten.<br />
KOMMUNAL 45
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
Moderator Dr. Robert Kalcher, Gemeindebundvizepräsident Prof. Walter Zimper, Sektionschef<br />
Wolfgang Stalzer, Dr. Peter Widermann, Manfred Seidl und Dr. Werner Kerschbaum<br />
bestritten den ersten Teil des <strong>Kommunal</strong>-Kongresses.<br />
Summe ergebe sich aus den Rund 10,7<br />
Millionen Stunden an Leistung, die die<br />
rund 300.000 freiwilligen Helfer des<br />
ÖRK dieser größten humanitären Organisation<br />
des Landes jährlich leisten.<br />
Gerade im Bereich der Katastrophenhilfe<br />
habe sich das Rote Kreuz in den<br />
vergangenen Jahren immer mehr national<br />
und international engagiert. „Wir<br />
haben zu vielen großen Katastrophen<br />
weltweit<br />
unsere Spe-<br />
zial-Teams<br />
geschickt“,<br />
berichtete<br />
Kerschbaum.<br />
Unter anderem<br />
sind bei<br />
Erdbeben-<br />
Katastrophen<br />
die europaweitstandar-<br />
disierten Einsatz-Teams, so genannte<br />
„Emergency Response Units“ gefragte<br />
46 KOMMUNAL<br />
»<br />
Dr. Werner Kerschbaum, stellvertretender<br />
Generalsekretär des Österreichischen<br />
Roten Kreuzes<br />
„Die Lebensqualität von Menschen in Not<br />
durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern“.<br />
So lautet das „Mission Statement“<br />
der weltumspannenden Rot Kreuz<br />
(RK) Bewegung. Werner Kerschbaum ist<br />
stellvertretender GS des ÖRK und schilderte<br />
– nach einem kurzen historischen<br />
Rückblick – Aufgaben und Herausforde-<br />
Pressesprecher vorzuschicken,<br />
ist fatal. Weil<br />
dann ‘versteckt’ sich<br />
der Verantwortliche.<br />
«<br />
Daniel Kapp<br />
über den Umgang mit Medien<br />
und willkommene Unterstützung.<br />
Acht Thesen zu den<br />
Haftungsfragen<br />
Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Kerschners (er<br />
zählt zu jenen Autoren, die KOMMU-<br />
NAL-Leser gut kennen) Thema war<br />
eines der dringendst erwartete des Kongresses.<br />
Das Hochwasser<br />
2002 mit seinen<br />
dramatischen Folgen<br />
und die derzeit laufenden<br />
einschlägigen<br />
gerichtlichen Schadenersatzverfahren<br />
haben<br />
eine weitgehende<br />
Rechtsunsicherheit bei<br />
Haftung für Naturkatastrophenschäden<br />
zu<br />
Tage gebracht.<br />
„Die Haftungshauptfragen bestehen<br />
nun darin, dass Gefährdungen, Risken<br />
für Leben, Gesundheit und Eigentum /<br />
Vermögen durch Naturkatastrophen<br />
durch menschliches Zutun verändert,<br />
vielfach verringert, aber auch erhöht<br />
worden sind. So sind etwa hochwasser-<br />
, bzw lawinen- und hangrutschgefährdete<br />
Gebiete besiedelt worden.“ Die<br />
bisher durchgeführten Vorstudien hätten<br />
immerhin bereits eines deutlich<br />
gemacht: Die vor dem Hochwasser<br />
2002 ergangene Rechtsprechung ist<br />
außerordentlich streng gegenüber möglichen<br />
(Mit-) Verursachern. Würde man<br />
diese Judikatur unreflektiert fortschreiben<br />
und konsequent und unverändert<br />
anwenden, wäre das Haftungsrisiko<br />
vieler, gerade jenes auch von Gebietskörperschaften<br />
kaum mehr beherrschbar.<br />
Vor allem nämlich auch im Amtshaftungsbereich<br />
weitet die Rechtsprechung<br />
ganz allgemein und im Besonderen<br />
bei spezifischen Staatsaufgaben<br />
übergebührlich aus, so dass schon vielfach<br />
eine überbordende Sozialisierung<br />
privater Risken eingetreten ist. Insbesondere<br />
also bei der Staatshaftung -<br />
aber nicht nur dort - geht es um eine<br />
sachlich sinnvolle und notwendige<br />
Grenzziehung, um ein nicht mehr<br />
gerechtfertigtes Ausufern der Haftung<br />
zu verhindern.<br />
Umgang mit Medien<br />
Mit der Rolle und dem richtigen<br />
Umgang mit Medien beschäftigte sich<br />
Daniel Kapp, vom Lebensministerium.<br />
Krisenbewältigung bestehe im professionellen<br />
und zielgerichteten Umgang<br />
mit den organisatorischen und rechtlichen<br />
sowie – genauso wesentlich – den<br />
medialen und politischen Auswirkungen<br />
einer akuten Problemsituation:<br />
Das Österreichische Rote Kreuz – 125 Jahre im Dienst der Menschen<br />
„Emergency Response Units“<br />
helfen weltweit<br />
rungen des RK im 21. Jahrhundert.<br />
Spontan verbindet jeder Österreicher und<br />
jede Österreicherin das RK mit dem Rettungs-<br />
und Krankentransportdienst.<br />
Weniger bekannt sind da schon die vielfältigen<br />
anderen Aufgaben, die das RK in<br />
Österreich und international wahrnimmt:<br />
Gesundheits- und Sozialdienste für Ältere<br />
und Schwerkranke, Blutspendewesen,<br />
Katastrophenvorsorge, Katastrophenhilfe,<br />
Suchdienste für Vermisste, Verbreitung<br />
des humanitären Völkerrechts sowie die<br />
Breitenausbildung der Bevölkerung in<br />
Erster Hilfe und Krankenhilfe.<br />
Im Rahmen der internationalen Hilfe –<br />
das Rote Kreuz und der Rote Halbmond<br />
sind in 181 Staaten der Welt vertreten –<br />
hat sich das Österreichische Rote Kreuz<br />
auf schnell einsetzbare und europaweit<br />
standardisierte Sondereinheiten, sogenannte<br />
„Emergency Response Units“, für<br />
die Bereiche „Trinkwasseraufbereitung“,<br />
„Suchhundestaffeln“ und „Telekommunikationssysteme“<br />
spezialisiert, um z.B. bei<br />
Erdbebenkatastrophen rasch und wirkungsvoll<br />
Hilfe leisten zu können.
„Journalisten brauchen Geschichten.<br />
Wenn sie ihnen nicht geliefert werden,<br />
holen sie sich welche.“ Man dürfe<br />
denoch nicht den Fehler begehen, die<br />
Medien als Feindbild zu betrachten.<br />
Vielmehr könne die angespannte<br />
Atmosphäre durch konstruktive Zusammenarbeit<br />
entschärft werden. .<br />
Entscheidend ist die<br />
Bereitschaft<br />
„Katastrophenbewältigung ist eine Aufgabe,<br />
die vor allem die Gemeinden in<br />
besonderer Weise fordert.“ Mit diesen<br />
Worten leitete Dr. Hans Lintner, Bürgermeister<br />
der Tiroler Stadtgemeinde<br />
Schwaz, sein mit Spannung erwartetes<br />
Referat über die Rolle des Bürgermeisters<br />
im Katastrophenfall ein. Da er<br />
selbst die Erfahrung einer Katastrophe<br />
in seiner Gemeinde, in der Stadt<br />
Schwaz, im Jahre 1999 erleben musste,<br />
stellte er auf der Grundlage dieser<br />
Erfahrungen die Aufgaben des Bürgermeisters<br />
und die Arbeit der Gemeinde<br />
bei der Bewältigung einer Katastrophe<br />
dar. Entscheidend sei die Bereitschaft<br />
des Bürgermeisters, die Möglichkeiten<br />
des Katastrophen-Hilfsdienst-Gesetzes<br />
auszuschöpfen.<br />
Um der Kata-<br />
strophe – in<br />
Schwaz bestand<br />
sie in der drohenden<br />
Gefahr<br />
eines Felssturzes<br />
für 300 Einwohnern,<br />
die für<br />
mehrer Monate<br />
ihre Häuser ver-<br />
»<br />
Katastrophenbewältigung<br />
ist eine Aufgabe, die vor<br />
allem die Gemeinden in<br />
besonderer Weise fordert.<br />
«<br />
Bgm. Hans Lintner<br />
generell zur Katastrophenbewältigung<br />
Manfred Seidl, Präsident des Österreichischen<br />
Bundesfeuerwehrverbandes<br />
(ÖBFV) gab in seinem Referat einen Leistungs-Überblick<br />
der Feuerwehren.<br />
Die 2.359 österreichischen Gemeinden<br />
verfügen über insgesamt 4.555 Feuerwehren,<br />
die sich bis auf sechs Berufsfeuerwehren<br />
allesamt aus Freiwilligen rekrutieren.<br />
Hinzu kommen noch 327 Betriebsfeuerwehren.<br />
Der Gesamtmannschaftsstand<br />
aller Feuerwehren beträgt fast 300.000<br />
Personen. Jede(r) 25. Österreicher(in) ist<br />
demnach Mitglied einer Feuerwehr. Durch<br />
die Besorgung des Feuerwehrwesens auf<br />
Gemeindeebene verfügt Österreich über<br />
ein flächendeckendes, relativ dicht<br />
geknüpftes Netz an Feuerwehren. Dies<br />
lassen und darum<br />
zittern mussten,<br />
jemals wieder<br />
zurückzukehren –<br />
bestmöglich zu<br />
begegnen, sei eine<br />
strikte Organisation<br />
der Einsatzkräfte mit<br />
dem Bürgermeister<br />
Die Gemeinden, ihre Feuerwehren und der Katastrophenschutz<br />
2359 Gemeinden und 4555 Feuerwehren<br />
wiederum ermöglicht sehr kurze Interventionszeiten,<br />
und kurze Interventionszeiten<br />
sind Voraussetzung für Schadensund<br />
auch Leidensminimierung.<br />
Die Feuerwehren in Österreich bestehen<br />
zu 99 Prozent aus ehrenamtlich tätigen<br />
Freiwilligen und nur zu einem Prozent<br />
aus hauptberuflichen Mitarbeitern.<br />
Zusammenfassend hielt Seidl fest: Die<br />
österreichischen Feuerwehren – getragen<br />
von den Gemeinden, organisiert nach<br />
Bundesländern und zusammengefasst<br />
durch den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband<br />
(ÖBFV) – stellen nicht nur<br />
die größte Katastrophenhilfeorganisation<br />
dieses Staates dar, sondern sie erledigen<br />
die ihnen zukommenden Aufgaben zur<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
Krisenkommunikation<br />
Professionelle Medienarbeit<br />
immer wichtiger<br />
"Katastrophen lösen Betroffenheit, Neugier<br />
und Interesse aus – Medien bedienen<br />
dieses menschliche Bedürfnis und<br />
tragen somit zur Entwicklung des Krisengeschehens<br />
bei," so Daniel Kapp, Pressesprecher<br />
von Bundesminister Josef Pröll.<br />
Die Voraussetzung erfolgreicher Krisenkommunikation<br />
liege in guter Vorbereitung.<br />
Diese muss von Beginn an vernetzt<br />
werden mit den übrigen Anstrengungen<br />
zur Krisenbewältigung.<br />
Spätestens mit dem Aufkommen von privaten<br />
Medienanstalten sei ein wahrer<br />
Nachrichtenmarkt entstanden. Medienanstalten<br />
investierten beträchtliche Summen,<br />
um im Wettlauf um Exklusivbeiträge<br />
die Nase vorne zu haben. Dabei<br />
sei der Druck auf Journalisten enorm,<br />
die hohen Kosten für technisches Equipment<br />
(bis zu 10.000 Euro am Tag) durch<br />
„Storys“ wieder herein zu spielen. Besonders<br />
wichtig sei laut Kapp ehrliche<br />
Medienarbeit.<br />
Nur<br />
abgesicherte<br />
Informationen<br />
sollten<br />
weitergeben<br />
werden, keinesfallsSpekulationen.<br />
Man solle<br />
immer die<br />
Wahrheit Daniel Kapp, Pressesprecher<br />
sagen, aber von Lebensminister Pröll<br />
die Privatsphäre<br />
der Opfer schützen. Indem man<br />
stetigen und aktuellen Informationsfluss<br />
sicherstelle und Geschichten anbiete,<br />
verhindere man, dass sich Journalisten<br />
auf die Suche nach einer solchen<br />
machen, und dabei leider in einigen Fällen<br />
Grenzen überschreiten, was zu<br />
zusätzlichem Leid führe.<br />
an der Spitze notwendig. Regelmäßige<br />
Information an die betroffene Bevölkerung<br />
und psychologische Betreuung<br />
waren in Schwaz Voraussetzung für die<br />
Vermittlung von Hoffnung. „Ordnung<br />
statt Chaos“, so Lintner, konnte Schlimmeres<br />
verhindern. Lintners Resümee:<br />
Das Katastrophen-Hilfsdienst-Gesetz<br />
gibt dem Bürgermeister fast unum-<br />
Manfred Seidl, Präsident des Österreichischen<br />
Bundesfeuerwehrverbandes<br />
Bewältigung von Naturkatastrophen oder<br />
technischen Katastrophen auf international<br />
anerkanntem Niveau und mit einem<br />
Organisationsmodell, das sich für den<br />
öffentlichen Haushalt als das bei weitem<br />
kostengünstigste erweist.<br />
KOMMUNAL 47
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
schränkte Macht, die notwendigenEntscheidungen<br />
zu treffen und auch<br />
durchzusetzen.<br />
Für ein sicheres<br />
Europa<br />
Gemeindeminister Dr.<br />
Ernst Strasser befasste<br />
sich mit der Zusammenarbeit<br />
mit den Gemeinden.<br />
Seit Mai 2003 ist<br />
das Bundesministerium Bürgermeister<br />
für Inneres, auch Dr. Hans Lintner.<br />
„Gemeindeministerium“,<br />
sowohl für die Koordination in Angelegenheiten<br />
des staatlichen Katastrophenschutzmanagements,<br />
als auch für<br />
die des Krisenmanagements und der<br />
internationalen Katastrophenhilfe<br />
zuständig.<br />
„Das Innenministerium ist ein Starker<br />
Partner für die Gemeinden. Diese stellen<br />
mit ihren Hilfs- und Rettungsorganisationen<br />
das Rückgrat unseres österreichischen<br />
Zivilschutzes dar,“ so Strasser.<br />
„Es ist unser gemeinsames Anliegen,<br />
die Sicherheit für unsere Bürger<br />
weiterhin im Vorfeld von Ereignissen<br />
Haftung bei Naturkatastrophen<br />
Ungelöste Fragen<br />
beherrschen Diskussion<br />
Die Haftungshauptfragen<br />
bestehen darin,<br />
dass Gefährdungen,<br />
Risken für<br />
Leben, Gesundheit<br />
und Eigentum<br />
/ Vermögen<br />
durch Naturkatastrophen<br />
durch<br />
menschliches<br />
Zutun verändert,<br />
vielfach verringert,<br />
aber auch<br />
Univ. Prof. Dr. erhöht worden<br />
Ferdinand Kerschner<br />
sind. So sind<br />
etwa hochwasser-<br />
, bzw lawinen- und hangrutschgefährdete<br />
Gebiete besiedelt worden. Menschlich<br />
geschaffene Anlagen haben nachteilig<br />
in natürliche Wirkungszusammenhänge<br />
eingegriffen und damit etwa die<br />
natürlichen Abflussverhältnisse nachteilig<br />
beeinflusst. Wird die Hochwassergefahr<br />
durch Schutzbauten am Ort A verringert,<br />
kann diese dadurch am Ort B vergrößert<br />
48 KOMMUNAL<br />
Katastrophenschutz - Katastrophenbewältigung<br />
Die Rolle des Bürgermeisters<br />
Der Bürgermeister als Einsatzleiter<br />
sei in allen Katastrophenfällen<br />
erste Instanz, soweit von<br />
einer Katastrophe nur das<br />
eigene Gemeindegebiet betroffen<br />
ist. Fragen der rechtlichen<br />
Absicherung und des Schutzes<br />
eines Bürgermeisters seien in<br />
diesem Fall nur teilweise ausreichend<br />
geklärt.<br />
Neben der fachlichen Entscheidungs-Letztkompetenz<br />
und<br />
Verantwortung obliege ihm<br />
natürlich auch die politische<br />
Verantwortung, die mit der rein sachlich,<br />
fachlichen Arbeit nicht vollständig<br />
abgedeckt werden könne.<br />
Es werde auch in unserem Land<br />
immer wieder Katastrophen geben.<br />
Entscheidend bei der Bewältigung dieser<br />
Katastrophen sei es, dass der Einsatzleiter<br />
auf ein gut strukturiertes<br />
System zurückgreifen könne, dass die<br />
entsprechenden Einsatzorganisationen<br />
und -kräfte vorhanden seien, besonders<br />
aber dass er als Einsatzleiter,<br />
wenn er als Bürgermeister diese Funktion<br />
ausüben müsse, mit einer klaren<br />
und auch sehr offenen Weise nach<br />
außen und gegenüber den Betroffe-<br />
worden sein.<br />
Die bisher durchgeführten Vorstudien<br />
(vgl zusammenfassend Kerschner, Zivilrechtliche<br />
Haftungsfragen bei Hochwasser,<br />
RFG 2004, 141 ff) haben immerhin<br />
bereits eines deutlich gemacht: Die vor<br />
dem Hochwasser 2002 ergangene Rechtsprechung<br />
ist außerordentlich streng<br />
gegenüber möglichen (Mit-) Verursachern.<br />
Würde man diese Judikatur unreflektiert<br />
fortschreiben und konsequent<br />
und unverändert anwenden, wäre das<br />
Haftungsrisiko vieler, gerade jenes auch<br />
von Gebietskörperschaften kaum mehr<br />
beherrschbar. Vor allem nämlich auch im<br />
Amtshaftungsbereich weitet die Rechtsprechung<br />
ganz allgemein und im Besonderen<br />
bei spezifischen Staatsaufgaben<br />
übergebührlich aus, so dass schon vielfach<br />
eine überbordende Sozialisierung<br />
privater Risken eingetreten ist. Insbesondere<br />
also bei der Staatshaftung – aber<br />
nicht nur dort – geht es um eine sachlich<br />
sinnvolle und notwendige Grenzziehung,<br />
um ein nicht mehr gerechtfertigtes Ausufern<br />
der Haftung zu verhindern.<br />
nen auftrete.<br />
In allen Fällen einer Katastrophe<br />
werde von den unmittelbar Betroffenen<br />
zuerst ein Schuldiger gesucht. Die<br />
Schuldfrage sei jener psychologisch<br />
sehr entscheidende Faktor, der in diesem<br />
ersten Zeitraum nach dem<br />
Schock des Ereignisses auch im Mittelpunkt<br />
der Fragen der Medien stehe.<br />
Diese Frage zu klären sei auch Mitaufgabe<br />
der Einsatzleitung, wenngleich<br />
die endgültige Klärung dieser Frage ja<br />
nur von weiteren Entwicklungen und<br />
von Experten beantwortet werden<br />
könne. Entscheidend dabei sei aber<br />
das Verhalten des Bürgermeisters als<br />
Einsatzleiter, wie er und vor allem wie<br />
offen er allen Angriffen und Fragen<br />
gegenüberstehe, und wie er in solchen<br />
Situationen auftrete. Die Menschen<br />
bräuchten zum einen Vertrauen, und<br />
dieses Vertrauen könne nur gewonnen<br />
werden, indem nichts verschleiert<br />
würde. Der Bürgermeister besitze das<br />
Vertrauen der Bevölkerung, seine<br />
Handlungen müssten diesem Vertrauen<br />
entsprechen. Deshalb seien<br />
Offenheit und Transparenz wesentliche<br />
Elemente seines Handelns.<br />
optimal zu gewährleisten. Unsere<br />
Bevölkerung muss sich bewusst sein,<br />
wie sie sich in derartigen Notfallsituationen<br />
verhalten soll.“<br />
Information<br />
Die in diesem Beitrag zusammengefassten<br />
Referate wurden aus<br />
Platzgründen stark<br />
gekürzt. In der<br />
Gemeindebund-<br />
Schriftenreihe<br />
„Katastrophenschutz“,<br />
die demnächst<br />
vorliegt,<br />
werden alle Referate<br />
in der vollen<br />
Länge abgedruckt.BestellhinweisSchriftenreihe„Katastrophenschutz“:<br />
MANZ Bestellservice:<br />
Tel.: (01) 531 61-100<br />
Fax: (01) 531 61-455<br />
E-Mail: bestellen@manz.at<br />
ISBN: 3-214-14481-2<br />
MANZ’ sche Verlags- und Univeristätsbuchhandlung<br />
GmbH<br />
Kohlmarkt 16<br />
1014 Wien
Das Projekt Meteorisk: Für verbesserte Wetterwarnung<br />
◆ Dr. Michael Staudinger<br />
Extreme meteorologische Ereignisse entstehen<br />
oft südlich der Alpen und greifen<br />
dann über den Alpenhauptkamm auf<br />
den Norden über. Auswirkungen dieser<br />
Ereignisse sind Überschwemmungen,<br />
Muren, Lawinen und andere Naturgefahren,<br />
die außerhalb der Alpen nicht in<br />
dieser Form auftreten.<br />
Die Vorhersage dieser Ereignisse ist<br />
durch die unterschiedlichen Organisationsstrukturen<br />
der Wetterdienste in den<br />
Alpen und durch das Fehlen von direkten<br />
Online Daten stark limitiert.<br />
Die Ziele von Meteorisk<br />
Zusammen mit einer verbesserten Interpretation<br />
von kleinräumigen meteorologischen<br />
Modellen und verbesserten<br />
Kommunikationswegen zwischen den<br />
Meteorologen in den einzelnen Ländern<br />
können die Öffentlichkeit und die Zivilschutzbehörden<br />
mit besseren Vorhersagen<br />
in Extremsituationen versorgt werden.<br />
Gut aufbereitetes und geeignetes Informationsmaterial<br />
für die Öffentlichkeit<br />
und Zivilschutzbehörden sind weitere<br />
Mittel um die verbesserten Vorhersagen<br />
an alle Nutzer zu verbreiten. Eine statistische<br />
Analyse von extremen Ereignissen<br />
der Vergangenheit war die Basis für<br />
die meteorologischen Untersuchungen.<br />
Hintergrund<br />
Die Wettervorhersage von Extremereignisse<br />
in den Alpen ist durch die Topographie<br />
des Gebirges sehr stark eingeschränkt.<br />
Die numerischen meteorologischen<br />
Modelle berücksichtigen diesen<br />
Effekt nur teilweise, da auch bei den<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
Auswirkungen von extremen<br />
meteorologischen Ereignisse (hier<br />
Niederschlagsmengen) sind Überschwemmungen,<br />
Muren, Lawinen<br />
und andere Naturgefahren,<br />
die außerhalb der Alpen nicht in<br />
dieser Form auftreten.<br />
Gute Datenpolitik ist<br />
vorrangig wichtig<br />
Ziel des Projekts METEORISK ist es, ein Netzwerk von automatischen meteorologischen<br />
Stationen zu errichten, die die Daten von allen Orten der Alpen an die regionalen<br />
Zentren weiterleiten. Durch diese verbesserte länderübergreifende Kommunikation<br />
können sowohl Öffentlichkeit als auch Zivilschutzbehörden mit besseren Vorhersagen<br />
in Extremsituationen versorgt werden.<br />
kleinräumigen Modellen die Topographie<br />
sehr stark von den wirklichen Gegebenheiten<br />
in den Zonen direkt am Alpenhauptkamm<br />
abweicht.<br />
Die lokalen Erfahrungen der Meteorologen<br />
haben aus diesem Grund einen sehr<br />
◆ Dr. Michael Staudinger ist<br />
Projektleiter „Meteorisk“<br />
KOMMUNAL 49
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
starken Einfluss auf<br />
die Qualität der Vorhersagen.Andererseits<br />
unterscheiden<br />
sich die Strukturen<br />
der Wetterdienste entlang<br />
der Alpen sehr<br />
deutlich, da unterschiedlichemeteorologische<br />
Interessen<br />
durch diese Wetterdienste<br />
abgedeckt<br />
werden, dabei reichen die Betätigungsfelder<br />
von Umweltfragen bis zu hydrographischen<br />
Problemstellungen. Derzeit ist<br />
die Kommunikation zwischen den einzelnen<br />
Stellen durch fehlende Strukturen für<br />
den Erfahrungsaustausch nicht so sehr<br />
entwickelt, wie man sich das wünschen<br />
würde.<br />
Die Ausstattungen dieser Wetterzentralen<br />
mit Stationen unterschiedlichen Standards<br />
und unterschiedlicher Anzahl<br />
Datenbanksystemen, Datenleitungen etc.<br />
unterscheidet sich in den einzelnen Ländern<br />
im gleichem Maß wie dfer Zugang<br />
der Wetterdienste zur Öffentlichkeit und<br />
zu den Gemeinden, die an erster Stelle<br />
mit den Auswirkungen von extremen<br />
Wetterereignissen zu kämpfen haben.<br />
Hauptziel des Projekts METEORISK sind<br />
die Verbesserung der Fähigkeit für Wetterwarnungen<br />
in 14 alpinen Regionen<br />
und der Transfer von Know How zwischen<br />
den beteiligten Organisationen.<br />
Dadurch kann die Sicherheit der Bevölkerung<br />
der in den alpinen Gemeinden deutlich<br />
erhöht werden.<br />
Eine gut strukturierte Datenpolitik hat<br />
dabei Vorrang. Derzeit werden Daten in<br />
verschiedenen Zentren in Datenbanken<br />
gespeichert. Eine gemeinsamen Platform<br />
und zwei redundante Datenbanken unter<br />
50 KOMMUNAL<br />
Hauptziel des Projekts<br />
METEORISK sind die Verbesserung<br />
der Wetterwarnungen<br />
in 14 alpinen Regionen.<br />
Dadurch kann die Sicherheit<br />
der Bevölkerung der in den<br />
alpinen Gemeinden deutlich<br />
erhöht werden.<br />
Nutzung von Internettechnologien<br />
werden die Infrastruktur<br />
vor allem<br />
bei Extremereignissen<br />
für alle beteiligten<br />
Partner deutlich<br />
verbessern.<br />
Öffentliche Stellen<br />
waren bereits bei<br />
der Planungsphase<br />
des Projekts und bei<br />
dem bereits teilweise abgeschlossenen<br />
Teil der statistischen Auswertungen mitbeteiligt.<br />
Die Projektergebnisse in Form<br />
von verbesserten Vorhersagen und von<br />
aktuellen Daten werden den öffentlichen<br />
Stellen direkt zur Verfügung gestellt. Die<br />
einzelnen Arbeitspakete umfassen folgende<br />
Schritte:<br />
Netzwerk der<br />
Beobachtungsstationen<br />
Das gegenwärtige Beobachtungsnetzwerk<br />
unterscheidet sich derzeit in den einzelnen<br />
Teilen der Alpen<br />
sehr stark je nach<br />
Betreiber in Hinblick<br />
auf Dichte, Qualität<br />
und Messparameter<br />
auf beiden Seiten<br />
des Alpenhauptkamms.<br />
Um die<br />
Qualität der lokalen<br />
Vorhersagen zu verbessern<br />
und Kalibrierungen<br />
für die<br />
Radarmessungen<br />
möglich zu machen,<br />
ist es notwendig,<br />
neue Stationen auf<br />
Das gegenwärtige<br />
Beobachtungsnetzwerk<br />
unterscheidet sich in<br />
den einzelnen Teilen<br />
der Alpen sehr stark je<br />
nach Betreiber in Hinblick<br />
auf Dichte, Qualität<br />
und Messparameter<br />
auf beiden Seiten<br />
des Alpenhauptkamms.<br />
geeigneten Standorten aufzustellen. Die<br />
Daten dieser Stationen werden online zu<br />
den zwei Datenzentren übertragen.<br />
Verbesserte Nutzung der<br />
Radar Daten<br />
Die Radar Daten der einzelnen Betreiber<br />
der Radarstationen unterscheiden sich<br />
in Auflösung, bezüglich Raum und Zeit<br />
und weiteren technischen Spezifikationen.<br />
Aufgabe dieses Arbeitsabschnittes<br />
ist es alle Radar Daten auf das gleiche<br />
technische Niveau zu bringen, die Daten<br />
der einzelnen Datenbestände auszutauschen<br />
und zusammengesetzte Bilder<br />
mit allen Input Daten zu erzeugen.<br />
Meteorologische<br />
Netzwerke<br />
Nowcasting als Kurzfristprognose hängt<br />
hauptsächlich von der Verfügbarkeit<br />
gut aufbereiteter Daten ab. Nur so<br />
kann eine direkte und hochwertige Diskussion<br />
zwischen den<br />
einzelnen Partnern bei<br />
den Telefonkonferenzen<br />
geführt werden. Derzeit<br />
sind die Daten nicht bei<br />
allen Partnern in der gleichen<br />
Form verfügbar.<br />
Numerische<br />
Wettermodelle<br />
Numerische meteorologische<br />
Modelle bedürfen<br />
einer Verifikation um die<br />
Vor- und Nachteile ein-
zelner Modelle im Alpenraum genau<br />
quantifizieren zu können. Ein vereinheitlichtes<br />
Verifikationsschema wird<br />
innerhalb von Meteorisk erlaubt eine<br />
Selektion verschiedener Modelle für<br />
Extremsituationen. Der Vergleich der<br />
Ergebnisse der verschiedenen Modelle<br />
gibt den einzelnen Wetterzentralen ein<br />
entscheidendes Werkzeug auch für den<br />
Neuerwerb von Modellen von anderen<br />
Wetterdiensten.<br />
Verwendung von GIS<br />
Die Präsentation von meteorologischen<br />
Vorhersagen wird derzeit textlich und<br />
mit Grafiken gemacht, die zumeist<br />
nicht in andere Systeme wie Hochwassermodelle<br />
integriert werden können.<br />
Zweck dieses Arbeitspaketes ist die<br />
Schaffung einer Online GIS Platform<br />
für Niederschlagsvorhersagen mit verschiedenen<br />
Input Möglichkeiten von<br />
Modellen und manuell aufbereiteten<br />
und optimierten Datenfeldern. Mit diesem<br />
Werkzeug können Zivilschutzbehörden<br />
und die Öffentlichkeit mit<br />
genauen flächenbezogenen Informationen<br />
versorgt werden.<br />
Statistik und Analyse<br />
Die statistische Analyse von extremen<br />
Wetterereignissen zeigt den möglichen<br />
Zusammenhang zwischen Aktivitäten<br />
wie Tourismus, Landwirtschaft und<br />
Verkehr von einzelnen Wetterfaktoren.<br />
Die Daten von verschiedenen Quellen<br />
wie Wetterdiensten, Energieversorgungsunternehmen,Zivilschutzbehörden<br />
etc., werden mit mathematisch -<br />
statistischen Methoden wie Gumbel<br />
Verteilungen bearbeitet. Fallstudien<br />
brachten einen Vergleich<br />
der kritischen Wetterparameter<br />
in den einzelnen<br />
Regionen der Ostalpen.<br />
Interne<br />
Kommunikation<br />
Derzeit werden meteorologische<br />
Vorhersagen in<br />
den einzelnen Partnerregionen<br />
sehr unterschiedlich<br />
gehandhabt, da es<br />
keine vereinheitlichten<br />
Grenzwerte für Warnungen<br />
gibt. In Fällen von Extremereignissen<br />
werden die Defizite fehlender Kommunikation<br />
am stärksten deutlich,<br />
wenn die Analyse der einzelnen Vorhersagen<br />
zeigt, dass Ressourcen und Know<br />
How zu konkreten Vorhersagen in<br />
Nachbarregionen ungenützt blieben.<br />
Hauptgrund dafür sind fehlende Kommunikationskanäle<br />
und teilweise auch<br />
Sprachprobleme.<br />
Geplant sind innerhalb von METEO-<br />
RISK vereinheitlichte Grenzwerte für<br />
Warnungen zum besseren Austausch<br />
und Vergleich der Warnungen in Grenzregionen.<br />
Weiters werden gemeinsam<br />
veranstaltete Seminare den Wissensaustausch<br />
zwischen den einzelnen<br />
Meteorologen fördern und Sprachprobleme<br />
minimieren. Gemeinsame Telefonkonferenzen<br />
zwischen den Partnern<br />
im Falle von Extremereignissen oder<br />
für die Nachanalyse sind zentraler<br />
Punkt der Projektabwicklung.<br />
Externe Kommunikation<br />
Die Qualität der Warnungen der Zivil-<br />
Derzeit werden<br />
meteorologische<br />
Vorhersagen in den<br />
einzelnen Partnerregionen<br />
sehr unterschiedlichgehandhabt,<br />
da es keine<br />
vereinheitlichten<br />
Grenzwerte für<br />
Warnungen gibt.<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
schutzbehörden und der<br />
Öffentlichkeit hängt<br />
hauptsächlich von den<br />
Kommunikationskanälen<br />
zwischen den Wetterdiensten<br />
und ihren Nutzern<br />
ab. Außerhalb der<br />
meteorologischen<br />
Gemeinschaft ist das<br />
Wissen um die Genauigkeit<br />
der Warnungen und<br />
der damit zusammenhängendenUnsicherheiten<br />
nur in geringer Form<br />
vorhanden, zudem sind<br />
hier in den einzelnen<br />
Ländern größere Unterschiede gegeben.<br />
Eine genaue Analyse der Bedürfnisse<br />
der einzelnen Gruppen, die Warnungen<br />
erhalten sind dabei notwendig.<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit muss daher für<br />
die unterschiedlichen Nutzergruppen<br />
abgestimmt werden, um die Informationen<br />
für Zivilschutz, Medien und allgemeine<br />
Öffentlichkeit zu optimieren.<br />
Wer ist Meteorisk<br />
Partner des METEORISK Projekts:<br />
◆ Österreich: ZAMG, Regionalstelle<br />
für Salzburg und Oberösterreich,<br />
Tirol und Kärnten<br />
◆ Meteoschweiz,<br />
◆ Wetterdienst Slovenien,<br />
◆ Italien: Wetterdienste von<br />
Friaul, Veneto, Südtirol-Trentino,<br />
Lombardei, Piemont,<br />
Aosta,<br />
◆ DWD Bayern,<br />
Infos über Meteorisk auf der<br />
Homepage www.meteorisk.info<br />
KOMMUNAL 51
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
FloodRisk: Die Analyse der Hochwasserereignisse vom August 2002<br />
Handeln! Denn das<br />
nächste kommt sicher<br />
Die Katastrophenhochwässer vom August 2002 führten in Österreich zu grundlegenden<br />
fachlichen und politischen Diskussionen, wie in Zukunft mit derartigen Naturereignissen<br />
umgegangen werden sollte. KOMMUNAL berichtet über die Ergebnisse.<br />
In einer Kooperation zwischen dem<br />
Österreichischen Lebensministerium,<br />
der Schweizer Organisation für Entwicklung<br />
und Zusammenarbeit (DEZA)<br />
sowie dem Bundesministeriums für Verkehr,<br />
Innovation und Technologie<br />
(BMVIT), wurde das Projekt „Analyse<br />
des Hochwassers vom August 2002 –<br />
FloodRisk“ ins Leben gerufen.<br />
Die Ziele der Analyse<br />
◆ Darstellung der Erkenntnisse aus<br />
dem Hochwasser 2002 (Ursache-Wirkungs-Analyse)<br />
◆ Diskussion der bestehenden Defizite<br />
◆ Beschreibung der Handlungsmöglichkeiten<br />
◆ Ableitung von Strategien zur Umsetzung<br />
der Handlungsmöglichkeiten<br />
(technisch / naturwissenschaftlich,<br />
sozioökonomisch, rechtlich, politisch)<br />
Erste Erkenntnisse<br />
Bei einem derartigen Extremereignis,<br />
wo sich das Hochwasser 2002 zumindest<br />
regional katastrophal auswirkte,<br />
ist eine Ursache-Wirkungs-Analyse auf<br />
Basis einer Dokumentation unumgänglich.<br />
Die wesentliche Problemstellung<br />
liegt dabei in der Analyse der naturwissenschaftlichen,<br />
technischen, sozioökonomischen,<br />
ökologischen und politisch/rechtlichen<br />
Defizite, die sich aus<br />
dem Ereignisablauf feststellen lassen,<br />
sowie der Erarbeitung von daraus<br />
abgeleiteten „lessons learned“.<br />
In vielen Bereichen zeigt die Entwicklung<br />
der letzten Jahrzehnte (zum Beispiel<br />
hinsichtlich Verbauung der Abflussflächen),<br />
dass nach früheren Hochwässern<br />
(wie 1965/66) trotz der erkannten<br />
Problemstellungen offenbar vielfach<br />
nicht ausreichende Konsequenzen gezo-<br />
52 KOMMUNAL<br />
gen wurden. Daraus resultierte auch<br />
eine verschärfte Situation beim Hochwasser<br />
2002, wo diese Mängel wieder<br />
deutlich aufgezeigt<br />
wurden. Dabei ist<br />
anzumerken, dass<br />
in jenen Gebieten,<br />
wo die Bemessungsgrößen<br />
nicht<br />
überschritten wurden,<br />
die durchgeführtenHochwasserschutzmaßnahmen<br />
positiv wirkten<br />
und ihren<br />
Erwartungen entsprachen.Probleme<br />
gab es in<br />
jenen Regionen –<br />
und hier besonders<br />
hervorzuheben die<br />
Regionen des<br />
Mühl- und Weinviertels – wo die Niederschläge<br />
und die daraus resultierenden<br />
Abflüsse deutlich über einem 100-jährlichen<br />
Ereignis lagen und damit ein teilweises<br />
Versagen der Anlagen mit nicht<br />
genau vorhersehbaren Überflutungen<br />
sowie sehr kurzen Vorwarnzeiten verbunden<br />
war.<br />
Ergebnisse aus Untersuchungen über<br />
eine Verbesserung der meteorologischen<br />
Vorhersage und der damit verbundenen<br />
Anforderungen wurden aus<br />
dem bereits abgeschlossenem Projekt<br />
„StartClim“ übernommen und als<br />
Grundlage für weitere Analysen, besonders<br />
im Bereich der Hydrologie herangezogen.<br />
Es zeigte sich, dass die derzeit<br />
bestehenden Modelle in der bestehenden<br />
Konstellation nicht ausreichend<br />
sind, um die erforderlichen Vorwarnzeiten<br />
bezüglich Ort und Menge der Niederschläge<br />
zu ermöglichen. Vorschläge<br />
in technischer Hinsicht zur Verbesse-<br />
In vielen Bereichen<br />
zeigt die Entwicklung<br />
der letzten Jahrzehnte,<br />
dass nach<br />
früheren Hochwässern<br />
trotz erkannter Problemstellungenvielfach<br />
nicht ausreichende<br />
Konsequenzen<br />
gezogen wurden.<br />
rung als auch die Anforderungen an<br />
eine verbesserte institutionelle Abstimmung<br />
der einzelnen in die Vorhersage<br />
eingebundenen Organisationen<br />
werden gegeben, wobei<br />
hier anzumerken ist, dass<br />
derzeit einer gesicherte Niederschlagsvorhersage,<br />
auch<br />
wenn sie nur einen kurzen<br />
Zeitraum umfasst, Modellen<br />
mit einer längeren Vorhersage,<br />
aber größeren Unsicherheiten<br />
noch der Vorzug<br />
zu geben ist.<br />
Hydrologische und geomorphologischeUntersuchungen<br />
brachten neue Erkenntnisse<br />
in den modellhaften<br />
Ansätzen, die als Grundlage<br />
für den konstruktiven Hochwasserschutz<br />
dienen. Untersuchungen<br />
ergaben, dass<br />
durch Umlagerungen in der Flusssohle<br />
während eines Hochwassers sich die<br />
Wasserspiegellagen verändern, was<br />
unmittelbaren Einfluss auf die berechneten<br />
Dammhöhen und damit dem<br />
Schutzgrad der umliegenden Landschaften<br />
und Siedlungen hat.<br />
Schwebstoffe, die einen wesentlichen<br />
Beitrag an der Schadensbildung hatten,<br />
deren Ursprung und Transport, waren<br />
nicht alleine auf die landwirtschaftliche<br />
Nutzungsänderung in den vergangenen<br />
Jahrzehnten zurückzuführen, wie sehr<br />
oft vermutet wurde. Hier sind noch<br />
weitere Vorgänge involviert, die einer<br />
weiteren Untersuchung bedürfen.<br />
Nachdem im Zuge des Hochwassers<br />
2002 an verschiedenen Flüssen signifikante<br />
Laufverlagerungen, Erosionen<br />
und Anlandungen mit daraus resultierenden<br />
Schäden zu beobachten waren,<br />
kommt der Geomorphologie in Zukunft<br />
verstärkte Bedeutung zu. Die im Zuge
FloodRisk – die Studie<br />
Bei einem derartigen Extremereignis,<br />
wo sich das Hochwasser 2002<br />
zumindest regional katastrophal<br />
auswirkte, ist eine Ursache-Wirkungs-Analyse<br />
auf Basis einer<br />
Dokumentation unumgänglich.<br />
Die wesentliche Problemstellung<br />
liegt dabei in der Analyse der<br />
naturwissenschaftlichen, technischen,<br />
sozioökonomischen, ökologischen<br />
und politisch/rechtlichen<br />
Defizite, die sich aus dem Ereignisablauf<br />
feststellen lassen.<br />
Zerstörter Eisenbahndamm im<br />
Kamptal<br />
Aufräumarbeiten nach der Flut<br />
Hochwasser in Schwertberg<br />
Resümee<br />
Ziel muss es nun sein, die in dem<br />
Synthesebericht vorgeschlagenen<br />
Maßnahmen und Empfehlungen<br />
möglichst rasch in die Tat umzusetzen,<br />
da die nächsten Extremhochwässer<br />
mit Sicherheit auftreten<br />
werden.<br />
von FloodRisk gemachten<br />
Erkenntnisse führen zu<br />
Handlungsmöglichkeiten, die<br />
von verbesserten Planungen<br />
bis hin zur Berücksichtigung<br />
bei der Umsetzung reichen.<br />
Hier ist der Querbezug zur<br />
Ökologie unerlässlich, da<br />
Hochwässer den ökologischen<br />
Zustand erheblich mit<br />
beeinflussen<br />
und<br />
ökologisch<br />
orientierte<br />
Maßnahmen<br />
sich<br />
durch<br />
Extremereignisse<br />
insbesondere infolge<br />
morphologischer<br />
Prozesse verändern<br />
(z.B. große Sohleintiefungen).<br />
Das Versagen von<br />
Bauwerken (z.B.<br />
Dämme) bedingt ein Hinterfragen der<br />
technischen Planungsgrundlagen und<br />
Ausführungen sowie den Einschluss der<br />
Restrisikofrage.<br />
Die „Restrisko-Frage“<br />
Fragen des Restrisikos wurden vor dem<br />
Hochwasser 2002 kaum diskutiert.<br />
Besonders beim Baurecht und bei den<br />
Raumordnungsgesetzen, wurde in zwei<br />
vergleichenden Studien die doch zum<br />
Teil erheblichen Unterschiede in der<br />
Auslegung dieser Gesetztesmaterien im<br />
Bezug auf Naturgefahren aufgezeigt.<br />
Weiters wird in diesem Zusammenhang<br />
die Bedeutung einer weiteren Intensivierung<br />
der Zusammenarbeit<br />
zwischen<br />
Landes- und Bundesbehördenhingewiesen.<br />
Grundlage für<br />
zukünftige Planungen<br />
sind sicherlich die<br />
Gefahrenzonenpläne<br />
der Bundeswasserbauverwaltung<br />
sowie<br />
der Wildbach- und<br />
Lawinenverbauung.<br />
Hier zeigte sich, dass<br />
es in den einzelnen<br />
Bundesländern<br />
erheblichen Nachholbedarf gibt, was<br />
die flächendeckende Ausweisung von<br />
Gefahrenzonen betrifft. Generell sei<br />
hier angeführt, dass der überörtlichen<br />
Raumplanung, bzw. der Raumplanung<br />
insgesamt, eine stärkere Rolle bei der<br />
Gefahrenvermeidung eingeräumt werden<br />
muss.<br />
Aus Sicht des<br />
Katastrophenschutzes<br />
konnte durch<br />
die gute<br />
Zusammenarbeit<br />
zwischen<br />
den einzelnen<br />
am Einsatz<br />
beteiligten<br />
Behörden und<br />
Organisationen<br />
sicherlich<br />
der Verlust an<br />
weiteren Menschenleben<br />
als<br />
auch noch<br />
größere Schänden an Sachgütern verhindert<br />
werden. Dennoch wurde durch<br />
das Land Oberösterreich eine kritische<br />
Betrachtung des Katastropheneinsatzes<br />
durchgeführt, um aus den Erfahrungen<br />
zu lernen und für einen zukünftigen<br />
Einsatz noch besser vorbereitet zu sein.<br />
Besonders die Kommunikation zwischen<br />
den der behördlichen und einsatztechnischen<br />
Ebene betreffend,<br />
wurde im Land Oberösterreich auf die<br />
Ereignisse mit der Installierung eines<br />
vorbildlichen Krisenmanagementsystems<br />
reagiert, durch dessen Implementierung<br />
eine Verbesserung der<br />
Handlungsabläufe während des Einsatzes<br />
erwartet wird. Grundlage dafür<br />
sollte, nicht nur für Oberösterreich, ein<br />
verpflichtendes Schulungsprogramm<br />
der bei einem Einsatz involvierten VerantwortungsträgerInnen<br />
sein, denn es<br />
zeigte sich, dass die Qualität der Ausbildung<br />
nicht überall auf gleichem<br />
Niveau war.<br />
Als ein weiteres Ziel aus Sicht des Katastrophenschutzes<br />
sollte die Schaffung<br />
einer österreichweit einheitlichen Organisationsstruktur<br />
für die Zusammenarbeit<br />
zwischen den Behörden und Einsatzorganisationen<br />
angestrebt werden,<br />
um bei Katastrophenereignissen eindeutige<br />
Zuordnungen für Zuständigkeiten<br />
und Kompetenzen zu erreichen.<br />
Als ein weiteres Ziel<br />
aus Sicht des Katastrophenschutzes<br />
sollte die<br />
Schaffung einer österreichweit<br />
einheitlichen<br />
Organisationsstruktur für<br />
die Zusammenarbeit zwischen<br />
den Behörden und<br />
Einsatzorganisationen<br />
angestrebt werden.<br />
<strong>Kommunal</strong>-Kongress<br />
Abschlussbemerkung<br />
Auf Basis von 46 Teilprojekten konnten<br />
im Projekt „Analyse der Hochwasserereignisse<br />
vom August 2002 - FloodRisk“<br />
wesentliche Erkenntnisse, Defizite und<br />
der daraus folgende Handlungsbedarf<br />
für ein zukunftsorientiertes integriertes<br />
Hochwassermanagement definiert werden.<br />
Ziel muss es nun sein, die in diesem<br />
Synthesebericht vorgeschlagenen<br />
Maßnahmen und Empfehlungen möglichst<br />
rasch in die Tat umzusetzen, da<br />
die nächsten Extremhochwässer mit<br />
Sicherheit auftreten werden.<br />
KOMMUNAL 53
Auszeichnungen<br />
Im Land der tausend Feuerwehrauszeichnungen<br />
Barocke Vielfalt oder<br />
Ordensdschungel<br />
Wir Österreicher sind Identifikationskünstler, es gelingt uns mit Leichtigkeit, uns für<br />
eine Sache zu entflammen, wir schaffen es, unser Tagespensum von fünf Stammtischen<br />
und entsprechender Löschung des Dursts zu erfüllen, wir sind Mitglied bei elf Vereinen<br />
oder mehr, Musikalität, Schach- oder Fachwissen sind kaum erforderlich, Fußball- oder<br />
Klarinettenkenntnisse manchmal erwünscht. Doch Identifikation ist alles.<br />
◆ Mag. Nicolaus Drimmel<br />
Wir identifizieren die Mitglieder der gleichen<br />
Alpenvereinssektion am Hutschmuck<br />
und erkennen kommunale<br />
Amts- und Leidensgenossen an der formschönen<br />
Gemeindetagsnadel 1998. Im<br />
zivilen Leben legen wir Wert auf den Steireranzug,<br />
oder noch ziviler auf das unvermeidliche<br />
Revers des Straßenanzuges.<br />
Dieses erlaubt nämlich in gänzlich unaufdringlicher<br />
Weise zu signalisieren, dass<br />
man stolzer Besitzer einer Rosette ist,<br />
etwa des japanischen Spiegelordens oder<br />
einer niederösterreichischen Feuerwehrmedaille.<br />
Ein leeres Revers gibt es nicht,<br />
andernfalls heißt es, ich habe noch nichts,<br />
bzw. ich hätt´ noch gern. Fragen Sie sich<br />
auch, ob Sie den oder jenen österreichischen<br />
Würdenträger jemals ohne „Rosetten-Distinktion“<br />
gesehen haben? Na eben.<br />
Da könnte man ja gleich nackt gehen.<br />
Und wie das Alter eines Baumes durch<br />
seine Jahresringe bestimmbar wird, wird<br />
auch die Eminenz der österreichischen<br />
◆ Reg. Rat Mag. Nicolaus Drimmel<br />
ist Jurist beim Österreichischen<br />
Gemeindebund<br />
54 KOMMUNAL<br />
Persönlichkeit neben dem Bauchumfang<br />
durch die getragenen Ab- und Auszeichnungen<br />
für den Normalbürger handfest.<br />
Man übe sich daher beim Besuch eines<br />
Feuerwehrballes in der Faustregel: kein<br />
Orden – Rekrut, ein Orden –<br />
arbeitende Klasse, viele Reihen<br />
– Veteran.<br />
Aber keine Regel ohne Ausnahme,<br />
wir können es heutzutage<br />
auch mit menschlichen<br />
Exemplaren zu tun bekommen,<br />
die auf Grund ihrer<br />
Dekorationen an allen Kriegsschauplätzen<br />
der letzten<br />
Kriege gewesen sein mussten,<br />
- es aber nicht waren. Wie so<br />
etwas möglich ist?<br />
In Österreich gibt es nicht nur<br />
ein G´riß (alte Rechtschreibung,<br />
da Dialektwort) um die<br />
Ehrungen, sondern auch um<br />
das Recht, solche zu verleihen.<br />
Schon der Österreichische Verfassungsgerichtshof<br />
musste sich im Falle der Verleihung<br />
von Feuerwehrmedaillen mit einem<br />
Machtwort einschalten. Der Kompetenzkonflikt<br />
zwischen Bund und Ländern<br />
wurde zu Gunsten der Länder entschieden.<br />
Österreichischer<br />
Ehrenwettbewerb<br />
Wer glaubt, dass damit das brennende<br />
Interesse zur Verleihung dieser Art von<br />
Anerkennung gedämpft werden konnte,<br />
der irrt, auch vor einer Flut von Hochwasserschutzmedaillen<br />
ist man nicht sicher.<br />
Denn die Österreicher haben nicht nur<br />
einen funktionierenden Katastrophenschutz,<br />
sie stellen sich auch der Frage der<br />
Repräsentation. In<br />
protokollarischen Fragen<br />
sind die Österrei-<br />
cher nämlich auch<br />
vorbildlich, es hat sich<br />
ein richtiggehender<br />
Ehrenwettbewerb etabliert,<br />
der alle Bedingungen<br />
der EU-Generaldirektion<br />
für Binnenmarkt<br />
und Wettbewerb<br />
erfüllen würde.<br />
Die Brüsseler Bürokraten<br />
haben die Skills<br />
des Alpenvolkes einfach<br />
noch nicht<br />
erfasst, und sie hätten<br />
auch ihre Freude<br />
damit, dass die Fülle der Verleiher eine<br />
staatliche Lenkung (in unserem Land<br />
begegnet uns diese zB in der guten alten<br />
Interkalarfrist) regelmäßig aus den<br />
Angeln heben. Nur durch diese Umschiffung<br />
ist es diesem Volk eines gebirgigen<br />
Binnenlandes möglich, einen Schatz an<br />
Ordenszeichen zu akkumulieren.<br />
Es ist daher nicht nur wissenswert, wer<br />
von einem solchen Ehrenbuschen mehr<br />
oder weniger unerwartet getroffen wird,<br />
sondern es ist bedeutend, welche Einrichtungen<br />
die Ehrungen oder Erinnerungen<br />
verleihen, kurz wer den Medaillenregen<br />
oder den Sternenhagel auslösen kann.<br />
In Österreich ist es<br />
bedeutend, welche<br />
Einrichtungen die<br />
Ehrungen oder Erinnerungen<br />
verleihen,<br />
kurz wer den<br />
Medaillenregen oder<br />
den Sternenhagel<br />
auslösen kann.
Die Feuerwehrorden<br />
Im folgenden stellen wir eine sehr kleine Auswahl<br />
der Orden und Auszeichnungen vor, die<br />
die Landesverbände der Feuerwehren in<br />
Österreich vergebn können.<br />
Das Große SilberneEhrenzeichen<br />
am Bande<br />
des Landesfeuerwehrverbandes<br />
Steiermark<br />
(Halsdekoration).<br />
Ehrenkreuz in<br />
Gold des Landesverbandes<br />
Tirol (Steckdekoration).<br />
Verdienstzeichen<br />
des NiederösterreichischenLandesfeuerwehrverbandes<br />
(2. Klasse).und des Landesfeuerwehrverbandes<br />
Salzburg (1. Klasse).<br />
An dieser Stelle bleibt nur Platz, dies<br />
anhand der Feuerwehren zu klären. Da<br />
sind einmal die Landesmedaillen für die<br />
verschiedenen Dienstjahre. Daneben gibt<br />
es vom Land die Ehrenkreuze für besondere<br />
Leistungen im Feuerwehrverdienst,<br />
zuweilen auch abgestuft als Feuerwehrverdienstkreuz<br />
1.-3. Klasse als Steckdekoration<br />
und am Dreiecksband. Verschiedene<br />
Medaillen aus Anlass größerer<br />
Einsätze runden das Bild ab. Hat das<br />
Land alle Register der Feuerwehrauszeichnungen<br />
erschöpft, bietet sich noch<br />
an, in die Lade der allgemeinen Ehrenzeichen<br />
für das Bundesland<br />
zu greifen, Feuerwehr<br />
und Rettungswe-<br />
sen sind ja immerhin<br />
Landessache.<br />
Aber trotzdem kann<br />
auch der Bund die Feuerwehrleute<br />
ehren. Die<br />
Leser werden sofort einwenden,<br />
dass aber doch<br />
das Höchstgericht<br />
damals im Jahr 1950<br />
die Eingebung hatte und das Erkenntnis<br />
des Verfassungsgerichtshofes ja zugunsten<br />
der Länder ausschlug .... (KOMMU-<br />
NAL Nr. 4/2004)<br />
Wenn man glaubt, hier besteht die allei-<br />
Das modern<br />
gestylte Bundesehrenzeichen<br />
ist<br />
der Piccolo, also<br />
eher für´s Revers<br />
Großes Verdienstkreuz<br />
des Bundesfeuerwehrverbandes<br />
(Halsdekoration).<br />
nigePrärogative des<br />
Landeshäuptlings,<br />
seine Schützlinge<br />
auszuzeichnen,<br />
so ist der Irrtum groß.<br />
Denn nicht nur auf dem Bereich der Rettungsabzeichen<br />
ist es ungeklärt, ob nicht<br />
Bund und Land gemeinsam verleihen<br />
können. Hier gilt aber weniger der Vorrang<br />
des Zuerstkommenden, sondern die<br />
für den Retter durchaus erfreuliche Kulminationsregel.<br />
In den Fällen einzelner<br />
Medaillen, hier ist Salzburg anzuführen,<br />
wurde jedoch Ausschließlichkeit gesetzlich<br />
normiert. Damit versuchte man die<br />
Ordensflut etwas einzudämmen.<br />
Dennoch können für allgemeine stattliche<br />
Ehrenzeichen auch etwas anders gelagerte<br />
Verdienste als Begründung angegeben<br />
werden. Für den Feuerwehrangehörigen<br />
kann daher durchaus auch eine allgemeine<br />
Ehrung durch den Bundespräsidenten<br />
winken, zum Beispiel mit dem<br />
Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik<br />
Österreich, ein gefragter und hübscher<br />
Bundesorden in Silber oder Gold.<br />
Seit dem Jahr 2002 mischt auch der Bundeskanzler<br />
mit, er bringt sich mit dem<br />
modern gestylten Bundesehrenzeichen ins<br />
Spiel, verglichen mit einem heimischen<br />
Kartenspiel ist dieses Abzeichen aber ein<br />
Piccolo, also eher etwas für das Revers.<br />
Wir sind noch nicht am Ende, es geht<br />
auch um Gerechtigkeit. Manche Länder<br />
fanden es nicht angebracht, wegen eines<br />
kleineren Einsatzes eine eigene Medaille<br />
zu stiften, andere hingegen schon. In<br />
Tirol oder in Niederösterreich gibt es eine<br />
allgemeine Einsatzmedaille, wodurch<br />
man weniger in Verlegenheit<br />
gerät. In der Steiermark hingegen<br />
gibt es nur eine allgemeine<br />
Hochwassermedaille (in Gold-<br />
Silber-Bronze und eine für<br />
1958), aber keine Katastrophenmedaille<br />
generell. Dennoch<br />
ereignen sich in der Steiermark<br />
leider auch andere, etwa Brand-<br />
Katastrophen. Für ein Gedenkzeichen<br />
kann zum Beispiel der<br />
Bundesfeuerwehrverband einspringen,<br />
er verleiht neben diesem<br />
Gedenkzeichen (auch für Auslandseinsätze)<br />
übrigens noch drei Stufen<br />
eines Verdienstzeichens, ein Großes Verdienstkreuz<br />
und einen Bruststern.<br />
Auszeichnungen<br />
Und ähnlich wie in allen anderen<br />
Bundesländern, ausgenommen<br />
Oberösterreich, können auch die Landesfeuerwehrverbände<br />
den Leistungen<br />
ihrer Mitglieder im Stab und an der Basis<br />
Anerkennung zollen. Dem Landesfeuerwehrverband<br />
in der Steiermark steht<br />
dabei eine Vielfalt an Ehrenkombinationen<br />
offen. Zum Beispiel die Ehrenzeichen<br />
mit Stern und am Halsband, jeweils in<br />
Gold und Silber, die Großen Verdienstzeichen,<br />
auch wieder in Gold und Silber,<br />
sowie die übrigen Verdienstzeichen in<br />
drei Klassen. Die neunstufige Vielfalt soll<br />
aber nicht täuschen. Diese Auszeichnungen<br />
kommen nur für steirische Feuerwehrangehörige<br />
höherer Dienstränge<br />
und mit dem jeweiligen Dienstalter in<br />
Frage.<br />
Kahlfläche oder Dschungel<br />
in Oberösterreich ?<br />
Gibt es aber wirklich einen weißen Fleck<br />
auf der Karte oberösterreichischen Feuerwehrverbandsehrungen?<br />
Hier hat sich<br />
zwar kein Ehrenzeichen<br />
des Landesfeuerwehrverbandesent-<br />
wickelt, doch<br />
haben sich hier<br />
bereits Pflanzen<br />
gebildet, die<br />
schon einen dichten<br />
Bewuchs, ja<br />
ein Dickicht auf<br />
der vermeintlichen Kahlfläche bilden.<br />
Österreich bleibt<br />
ein Land der barocken<br />
Vielfalt, ohne Orden<br />
wär ma´s net.<br />
Hier werden Medaillen auf Bezirksebene<br />
verliehen, die zumeist dreistufig sind und<br />
eine gewisse Differenzierung zulassen.<br />
Der steiermärkische Landesfeuerwehrverband<br />
kennt aber außerdem mit jenen in<br />
Burgenland, Kärnten und Salzburg eine<br />
Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit.<br />
Sie kann in der Steiermark an Inund<br />
Ausländer verliehen werden, die sich<br />
„Verdienste in der Pflege der Feuerwehrkameradschaft,<br />
im Gedankenaustausch<br />
oder in sonstigen dem Feuerwehrwesen<br />
dienlichen Hilfestellungen“ erworben<br />
werden.<br />
Schier unerreichbar für unsere österreichischen<br />
Feuerwehrangehörigen ist die<br />
Medaille für internationale Feuerwehrkameradschaft,<br />
sie kann nur an Personen<br />
verliehen werden, die nicht österreichische<br />
Staatsbürger sind und ihren ordentlichen<br />
Wohnsitz auch nicht auf österreichischem<br />
Boden haben. Doch immer<br />
bescheiden bleiben, man muss ja auch<br />
verzichten können. Österreich bleibt dennoch<br />
ein Land der barocken Vielfalt, ohne<br />
Orden wär ma´s net. Und das ist ja<br />
immerhin sehr repräsentabel.<br />
KOMMUNAL 55
Hilfe für den Nächsten<br />
Folgen für Kinder manchmal nicht verkraftbar<br />
Armut kann<br />
jeden treffen<br />
Kinder sind überdurchschnittlich von Armut betroffen. Etwa ein Drittel der<br />
Armutsbevölkerung in Österreich sind Kinder. Mit der Kinderzahl erhöht sich die<br />
Armutsgefährdung der Familien, denn Kinder sind eine Quelle wirtschaftlicher<br />
Benachteiligung. Und Elternarmut ist immer auch Kinderarmut.<br />
Über Armut wird in Österreich nicht<br />
geredet. Armsein ist peinlich, denn es<br />
gilt als Ausdruck des Versagens. Eine<br />
Folge davon ist, dass Kinder zwar den<br />
innerfamiliären Druck spüren und Fragen<br />
aufwerfen, darauf aber keine<br />
befriedigenden Antworten erhalten. Sie<br />
werden mit dem Problem allein gelassen.<br />
Armut stigmatisiert und das Kind<br />
verliert Selbstvertrauen und Selbstwert.<br />
In unserer konsumorientierten Gesellschaft<br />
stiften Geld und Vermögen Identität,<br />
ideelle Werte hingegen werden<br />
sehr leicht übersehen. Geld zu haben<br />
oder nicht kann daher die Entwicklung<br />
des Kindes sehr bestimmend beeinflussen.<br />
Manche Kinder halten den Druck<br />
der Not nicht aus und werden schon<br />
früh zu Außenseitern.<br />
Projekte der Caritas<br />
bieten Hilfe<br />
Die Caritas bemüht sich, in ihren unterschiedlichen<br />
Projekten auch diesen<br />
Mädchen und Buben eine Chance auf<br />
ein halbwegs normales Leben zu<br />
geben. Sensibilität und kleine Hilfen<br />
können viel bewirken.<br />
Familienzentren<br />
In den Sozialberatungsstellen und<br />
Familienzentren bietet die Caritas Familien<br />
mit Sozial-, Geld- und Wohnungsproblemen<br />
unmittelbare Hilfe: Unbürokratisch<br />
und flexibel. Mit praktischen<br />
Anleitungen in Haushaltsangelegenheiten,<br />
Begleitung bei Amtswegen und<br />
Unterstützung in erzieherischen Angelegenheiten<br />
wird versucht, die Selbstständigkeit<br />
und Selbstwert der Familie<br />
56 KOMMUNAL<br />
wieder herzustellen. In den Beratungsstellen<br />
erhalten die Familien auch<br />
finanzielle Unterstützung für notwendige<br />
Anschaffungen. Besonders am<br />
Schulanfang bekommen die Kinder hier<br />
Schultaschen, Geld für Schulaktivitäten,<br />
Turnschuhe und Kleidung. Auch<br />
für wichtige Therapien wird den Familien<br />
finanziell unter die Arme gegriffen.<br />
Familienhilfe<br />
Bei der Familienhilfe kommt eine<br />
Betreuerin direkt in die Familie und<br />
unterstützt sie in ihrer gewohnten<br />
Umgebung. Bei Überlastung und<br />
Erschöpfung, dem Tod eines Elternteils,<br />
Schwangerschaft, Erkrankung oder<br />
Betreuung eines Kindes mit Behinderung<br />
bieten Familienhelferinnen eine<br />
Überbrückung dieser Krisensituationen.<br />
Sie arbeiten stellvertretend, entlastend<br />
Werfen Sie ihr altes Handy nicht weg.<br />
Wie Sie damit Gutes für Kinder in Not<br />
tun können, erfahren Sie unter:<br />
http://www.handy4help.at/<br />
und unterstützend. Kompetent<br />
betreuen sie die Kinder, organisieren<br />
den Haushalt und stabilisieren die<br />
Familie. Derzeit sind 259 Familienhelferinnen<br />
im Einsatz.<br />
Mutter-Kind-Häuser<br />
In Mutter-Kind-Häusern können Frauen<br />
in Not mit ihren Kindern bis zu zwei<br />
Jahre lang ein Zuhause finden. Dort<br />
bekommen sie viel menschliche<br />
Zuwendung und finden immer ein offenes<br />
Ohr für ihre Sorgen und Nöte.<br />
Durch die professionelle Betreuung und<br />
Begleitung wird den Müttern geholfen,<br />
schlimme Erlebnisse aufzuarbeiten, mit<br />
Enttäuschungen fertig zu werden und<br />
sich auf die Rolle als Mutter vorzubereiten.<br />
Notschlafstellen für<br />
Jugendliche<br />
In Notschlafstellen für Jugendliche in<br />
Salzburg und Graz finden obdachlose<br />
Jugendliche Unterschlupf. Alle 14-21<br />
Jährigen, die Zuhause weggelaufen<br />
sind oder rausgeworfen wurden,<br />
haben in diesen „Schlupfhäusern“ ein<br />
Bett für die kommende Nacht und<br />
erhalten eine warme Mahlzeit. Hier<br />
können sie sich ausruhen, duschen und<br />
ihre Wäsche waschen. Zusätzlich stehen<br />
die Mitarbeiter der Notschlafstellen<br />
gerne für Gespräche zur Verfügung und<br />
bieten umfassende Informationen.<br />
Auch der Kontakt zu den Eltern oder<br />
dem Jugendamt kann jederzeit hergestellt<br />
werden. Mit viel Einfühlungsvermögen<br />
wird dann zwischen Behörden,<br />
Eltern und Kindern vermittelt.
KOMMUNAL<br />
MESSE<br />
Blitzbesuch von Bgm. Michael Häupl am KOMMUNAL-Stand<br />
Ein Cartoon bei Blunz’n und Most<br />
„Ja seid’s ihr narrisch!“ Dieser Ausruf von Wiens Bürgermeister und Städtebundpräsident Michael<br />
Häupl war nicht nur auf dem KOMMUNAL-Stand zu hören. KOMMUNAL-Chef Prof. Walter<br />
Zimper (Mitte) hatte Häupl zu einem Besuch eingeladen, um ihm das letzte Werk des KOM-<br />
MUNAL-“Haus und Hof“-Zeichners Bruno Haberzettl zu überreichen (zu sehen auf Seite 59). Häupls<br />
Geständnis nachher: „Über den Cartoon hab’ ich in der Früh schon gelacht.“<br />
Mit Wiens Stadtoberhaupt freuten sich Reinhard Platzer von der <strong>Kommunal</strong>kredit, Johanna K.<br />
Ritter vom KOMMUNAL, Matthias Limbeck von den Reed Messen sowie Robert Hink und Bgm.<br />
Helmut Mödlhammer vom Gemeindebund.<br />
7. Europäische Konferenz der <strong>Kommunal</strong>wirtschaft<br />
Garanten für mehr Lebensqualität<br />
Den Vorsitz über ein hochkarätiges Experten-Podium führte<br />
Gemeindebundvizepräsident Bgm. Bernd Vögerle bei der<br />
7. Europäischen Konferenz der kommunalen Unternehmen.<br />
Unter „seiner Federführung“ diskutierten unter anderem Manfred<br />
Novy, Vizepräsident der UITP aus Brüssel (2.v.l.) und Catarina<br />
Segersten Larrson (5.v.l.) vom AdR, die schwedische Berichterstatterin<br />
zum Grünbuch PPP, über „Selbstverwaltung der<br />
Gebietskörperschaften versus EU-Rechtsrahmen: Zwei unvereinbare<br />
Ziele?“<br />
Chance nutzen<br />
Kärntner wissen,<br />
wie’s läuft<br />
Siegfried Kampl, Bürgermeister-Ikone<br />
aus Gurk, war nicht<br />
der einzige, aber einer der<br />
ersten Bürgermeister, der die<br />
Chance nutzte. Noch vor der<br />
Eröffnung der Messe durch<br />
Lebensminister Josef Pröll<br />
sprach er diesen an, um den<br />
Minister noch mehr für die<br />
Anliegen der Bürgermeister<br />
zu „sensibilisieren“. Er fand<br />
auch offene Ohren.<br />
Fotos: Boltz/Horvath/Braun/Grossmann<br />
Walter Zimper,<br />
KOMMUNAL-<br />
Geschäftsführer<br />
Kräftiges Lebenszeichen<br />
Gemeinden haben<br />
starke Partner<br />
Mit fast 5.000 Besuchern hat die<br />
heurige KOMMUNALMESSE im<br />
Messezentrum Wien einmal<br />
mehr ein kräftiges Lebenszeichen<br />
von sich gegeben. Mehr als<br />
200 Aussteller aus elf Ländern<br />
haben den kommunalen Entscheidungsträgern<br />
aus Österreich<br />
und den benachbarten EU-Mitgliedsländern<br />
ihre Leistungen<br />
und Produkte präsentiert.<br />
KOMMUNAL hat als Europas<br />
führendes Fachmagazin für<br />
Gemeinden diesen kommunalen<br />
Großevent als offizielles und<br />
exklusives Messemedium drei<br />
Tage lang begleitet. Unser Messestand<br />
war traditionell wieder<br />
beliebter Treffpunkt für Gäste<br />
aus Politik und Wirtschaft. Wir<br />
konnten unserer Rolle als Vermittler<br />
zwischen dem Auftraggeber<br />
Gemeinde und der Wirtschaft<br />
wieder voll gerecht werden.<br />
Mit jährlichen Ausgaben<br />
von mehr als 13 Mrd. Euro sind<br />
Österreichs Gemeinden die mit<br />
Abstand größten öffentlichen<br />
Investoren – und die heurige<br />
Messeveranstaltung hat in beeindruckender<br />
Art und Weise dokumentiert,<br />
dass die Partnerschaft<br />
zwischen Gemeinden und Wirtschaft<br />
nicht nur bestens funktioniert,<br />
sondern im Interesse der<br />
Bürgerinnen und Bürger auch<br />
laufend weiterentwickelt wird.
KOMMUNALMESSE<br />
Mehr als 200 Aussteller aus elf Ländern und fast 5000 Besucher<br />
Riesenerfolg für<br />
KOMMUNALMESSE ‘04<br />
„Die Public Services/KOMMUNALMESSE vom 10. bis 12. November 2004 im Messezentrum<br />
Wien Neu war erfolgreich.“ Dieses Fazit zog nicht nur Messechef Matthias Limbeck.<br />
Auch viele Aussteller und die fast 5000 Besucher waren seiner Meinung: Die Messe hat<br />
erfolgreich die Brücke zwischen dem Auftraggeber Gemeinde und den leistungsstarken<br />
Partnern aus der Wirtschaft geschlagen.<br />
Eines hatte die „Public Services/ <strong>Kommunal</strong>messe“<br />
gemeinsam mit der „Pollutec“<br />
2004 jedenfalls gezeigt: Wien ist<br />
als interregionale Drehscheibe für kommunale<br />
Verwaltung und Umweltschutz<br />
bestens etabliert.<br />
40 Prozent Fachbesucher<br />
aus dem Ausland<br />
Die vom 10. bis 12. November im Messezentrum<br />
Wien durchgeführte zweite<br />
Ausgabe des Fachmesse-Duos „Pollutec<br />
East & Central Europe“, Internationale<br />
Fachmesse für Umwelttechnik, und<br />
„Public Services/ KOMMUNALMESSE“,<br />
58 KOMMUNAL<br />
die Internationale Fachmesse für<br />
öffentliche Verwaltung, Infrastruktur<br />
und kommunale Ausstattung, war nach<br />
Informationen von<br />
Messeorganisator<br />
Reed Exhibitions<br />
Messe Wien ein<br />
Erfolg. Dieser hat<br />
sich nicht nur in<br />
einer Gesamtbesucherzahl<br />
von rund<br />
5000 gezeigt, sondern<br />
auch im hohen<br />
Anteil ausländischer<br />
Fachbesucher. Denn<br />
vier von zehn Fachbesucher<br />
waren aus<br />
«<br />
den Nachbarländern nach Wien<br />
gekommen.<br />
„Für die rund 200 Aussteller aus dem<br />
In- und Ausland<br />
Für die rund 200 Aussteller<br />
aus dem In- und Ausland<br />
hat sich das Messezentrum<br />
Wien mit der<br />
„Public Services/ KOM-<br />
MUNALMESSE“ als echte<br />
interregionale Ost-/West-<br />
Drehscheibe erwiesen.<br />
Dipl. Ing. Matthias Limbeck<br />
Reed Messe Wien Geschäftsführer<br />
Lebensminister Dipl. Ing.<br />
Josef Pröll eröffnete die<br />
KOMMUNALMESSE 2004.<br />
Bei der Eröffnung : „Wir<br />
müssen Österreich und<br />
seine Gemeinden moderner<br />
und fit für die Zukunft<br />
machen, um den neuen<br />
Herausforderungen<br />
gewachsen zu sein.“<br />
«<br />
hat sich das Messezentrum<br />
Wien mit<br />
der „Pollutec East<br />
& Central Europe“<br />
und „Public Services/<br />
KOMMUNAL-<br />
MESSE“ als echte<br />
interregionale Ost-<br />
/West-Drehscheibe<br />
erwiesen,“ freut<br />
sich DI Matthias<br />
➢➢weiter auf Seite 60
„Wien ist anders – auch für Österreichs Bürgermeister.“<br />
Zeichnung: Bruno Haberzettl<br />
Cartoon<br />
KOMMUNAL 59
«<br />
KOMMUNALMESSE<br />
Limbeck, für den Bereich New Business<br />
und CEE verantwortlicher Geschäftsführer<br />
bei Reed Exhibitions Messe<br />
Wien, über die enorme Resonanz aus<br />
dem benachbarten Ausland. Diese habe<br />
auch gezeigt, „welch ungeheure Dynamik<br />
die neuen Märkte charakterisiert“.<br />
Potenziale für Kommunen<br />
im In- und Ausland<br />
Österreichs Bürgermeister und Amtsleiter<br />
stehen in den nächsten Jahren rund<br />
13 Milliarden Euro jährlich an Investitionsvolumen<br />
zur Verfügung. „Gerade<br />
weil Budgetdisziplin angesagt ist, sind<br />
innovative, effiziente und Kosten sparende<br />
Lösungen und Technologien<br />
gefragt“, erklärt DI Limbeck. „Um den<br />
Know-how-Transfer auf höchstem und<br />
aktuellem Niveau zu fördern, haben<br />
wir als zweite Säule des Fachmesse-<br />
Doppels ein umfangreiches Kongressund<br />
Rahmenprogramm angeboten, das<br />
auch sehr intensiv von den Besuchern<br />
genutzt wurde.“<br />
Dazu gehörten der vom Österreichischen<br />
Gemeindebund gemeinsam mit<br />
dem Manz-Verlag veranstaltete <strong>Kommunal</strong>kongress<br />
zum Thema „Katastrophenschutz“<br />
(siehe auch Bericht ab der<br />
Seite 44 dieser Ausgabe), das „Praxisforum<br />
Umwelt und Kommune“ oder der<br />
„Forum Land Bürgermeisterkongress“<br />
(siehe auch Bericht auf der Seite 62).<br />
Auf dem Jahrestreffen der „Eurocities“,<br />
der Vereinigung der größten Städte<br />
93,4 Prozent waren<br />
mit der Messe insgesamt<br />
zufrieden, und<br />
96,7 Prozent bewerteten<br />
das Ausstellungsangebot<br />
als<br />
repräsentativ für<br />
die Branche.<br />
Messeleiter Ing.<br />
Wolfgang Ambrosch<br />
zu den Ergebnissen der<br />
Besucherbefragung<br />
Europas, ging es unter anderem darum,<br />
wie Städte die sozialen und wirtschaftlichen<br />
Aspekte der europäischen Integration<br />
vernetzen können.<br />
Besonderer Dank gilt laut Matthias<br />
Limbeck und dem Reed-Messeteam den<br />
involvierten Organisationspartnern.<br />
„Die begleitenden Kongresse und<br />
Workshops konnten nur in Kooperation<br />
60 KOMMUNAL<br />
«<br />
Mit mehr als 200 Ausstellern aus elf Ländern<br />
präsentierte sich die heurige KOM-<br />
MUNALMESSE internationaler als je<br />
zuvor. Lebensminister Josef Pröll eröffnete<br />
am 10. November offiziell mit<br />
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer<br />
und Matthias Limbeck die<br />
kommunale Großveranstaltung.<br />
mit Institutionen wie dem Forum Land,<br />
der FH Burgenland und Donauuniversität<br />
Krems, dem Lebensministerium,<br />
der Stadt Wien, dem Umweltbundesamt<br />
und dem Österreichischen Gemeindebund<br />
realisiert werden. Dafür möchten<br />
wir uns an dieser Stelle recht herzlich<br />
bedanken.“<br />
Zufriedene Besucher<br />
Der Erfolg der „Public Services/ KOM-<br />
MUNALMESSE“ 2004 kommt auch in<br />
den Ergebnissen der unabhängigen Fachbesucherbefragung<br />
zum Ausdruck. Wie<br />
Messeleiter Ing. Wolfgang Ambrosch<br />
berichtet, zeigten sich 93,4 Prozent der<br />
Befragten mit der Messe insgesamt<br />
zufrieden, und 96,7 Prozent bewerteten<br />
das Ausstellungsangebot als repräsentativ<br />
für die Branche.<br />
Als vorherrschende Motive für den<br />
Messebesuch ergeben sich aus der<br />
Umfrage der Überblick über<br />
Markt und Anbieter (73,4 Prozent),<br />
Informationsbeschaffung<br />
(62,5 Prozent), Information über<br />
neue Produkte und Technologien<br />
(32 Prozent), Treffen bestimmter<br />
Aussteller (23,4 Prozent), Suche<br />
nach Lösungen für konkrete<br />
Anliegen (15,2 Prozent) sowie<br />
Kontaktpflege und -suche (14,1<br />
Prozent). Das Interesse der Fachbesucher<br />
aus dem In- und Ausland<br />
galt laut Umfragedaten insbesondere<br />
den Themen Abfall/<br />
Recycling (51,4 Prozent), Wasser/<br />
Abwasser (34,4 Prozent), Energie<br />
(19,1 Prozent) sowie Abgasreinigung/<br />
Luftreinhaltung (8,7 Prozent).<br />
Der beruflichen Herkunft nach waren<br />
die Sparten Industrie (29,3 Prozent),<br />
Dienstleistungen (26,1 Prozent),<br />
Gewerbe (22,3 Prozent), öffentliche<br />
Verwaltung (11,4 Prozent) und Handel<br />
(10,3 Prozent) am stärksten unter den<br />
Besuchern vertreten. „Was uns besonders<br />
freut“, erklärt Wolfgang Ambrosch,<br />
„ist nicht nur die hohe Entscheiderqua-<br />
lität der Fachbesucher, sondern auch<br />
die Tatsache, dass jeder siebente Fachbesucher<br />
ein politischer Mandatar war.<br />
Das bedeutet, dass mehr als 700 Bundes-,<br />
Landes- und <strong>Kommunal</strong>politiker<br />
diese Messe besucht haben.“<br />
Keimzelle und Rückgrat<br />
des Landes<br />
DI Josef Pröll, Bundesminister für<br />
Land- und Forstwirtschaft, Umweltund<br />
Wasserwirtschaft (Lebensministerium),<br />
weiß von der Stärke und Bedeutung<br />
der 2.350 Gemeinden in Österreich.<br />
„Sie sind Rückgrat und Keimzelle<br />
des Landes. Die Erfolgsstory Österreichs<br />
wurde und wird wesentlich von<br />
den Gemeinden geschrieben“. Für ihn<br />
sind die Gemeindeverantwortlichen die<br />
ersten<br />
Ansprechpartner<br />
für<br />
die BürgerInnen,<br />
sie<br />
sind<br />
Dienstleister<br />
und<br />
stellen eine<br />
hohe Zahl<br />
an Arbeitsplätzen<br />
zur<br />
Verfügung.<br />
Die<br />
«<br />
Mehr als 700<br />
Bundes-, Landes- und<br />
<strong>Kommunal</strong>politiker<br />
haben diese<br />
Messe besucht.<br />
Messeleiter Ing.<br />
Wolfgang Ambrosch<br />
über die „berufliche<br />
Herkunft“ der Besucher<br />
Gemeinde sei mehr als nur eine Gruppe<br />
von Menschen mit einem Bürgermeister<br />
an der Spitze. Gemeinden müssten<br />
den Konzentrationen in der Wirtschaft<br />
vernünftig begegnen und zusammenarbeiten.<br />
Die Strukturen der Regionen<br />
seien neu zu definieren (Stichwort:<br />
Strukturpaket Europa), die Städte seien<br />
lebenswerter zu gestalten (Stichwort:<br />
Stadtökologie) und die ländliche Entwicklung<br />
müsse dynamisch voranschreiten“,<br />
so Josef Pröll, der den<br />
Gemeinden ein kritisches Durchleuchten<br />
des Ist-Zustandes empfiehlt.<br />
Aussteller mit Verlauf<br />
zufrieden<br />
Dem Thema Umwelttechnologien widmeten<br />
sich auch zahlreiche Aussteller<br />
der „Public Services/ KOMMUNAL-<br />
MESSE“. Für die Firma Austrowaren<br />
beispielsweise hat sich der Messeauftritt<br />
gelohnt. „Unsere Erwartungen<br />
wurden erfüllt“, freut sich Verkaufsleiter<br />
Robert Docekal. Die gezielt eingeladenen<br />
Kunden informierten sich am<br />
Stand tiefgehend unter anderem über<br />
Müllpressen, oder Müllumlade- und<br />
Zerkleinerungsanlagen.<br />
«
«<br />
Ebenso erfreulich verlief das Messedoppel<br />
für Doppstadt, ein deutsches<br />
Unternehmen, das Maschinen für die<br />
Umwelttechnik produziert. Betriebsleiter<br />
Andreas Kühtreiber weiß Fachmessen<br />
zu<br />
schätzen.<br />
„Wir<br />
führen<br />
gezielte<br />
Kundengespräche,<br />
können<br />
die Vorteileunserer<br />
«<br />
Unsere Erwartungenwurden<br />
erfüllt.<br />
Robert Docekal<br />
Verkaufsleiter von<br />
Austrowaren<br />
«<br />
Maschinen entsprechend darstellen<br />
und treffen zudem die Kunden von<br />
morgen. Auch hier wurden Kunden im<br />
Vorfeld der Messe angesprochen und<br />
sie sind der Einladung gefolgt.“<br />
Die Firma MLU-Monitoring für Leben<br />
und Umwelt stellt Messgeräte für Gase<br />
und Luft her. Die einzelnen Komponenten<br />
werden in den USA und in Schweden<br />
gefertigt, MLU führt die Komponenten<br />
zu Systemen zusammen. Ing.<br />
Christian Jellinek, Product Manager<br />
bei MLU, lobt die qualitativ hochwertigen<br />
Kontakte, die er anlässlich der<br />
Fachmessen hatte. „Die Entwicklung<br />
unserer Systeme geht laufend voran,<br />
nicht zuletzt auch aufgrund gesetzlicher<br />
Vorschriften. Die Fachbesucher<br />
möchten dazu umfassende Informationen".<br />
Die interessanten Fachgespräche hob<br />
auch die Firma Grundfos hervor, die<br />
sich als Partner der Wasserwirtschaft<br />
auf der „Pol-<br />
lutec East &<br />
Wir führen gezielte Central<br />
Kundengespräche, Europe“<br />
sowie „Public<br />
können die Vorteile Services/<br />
unserer Maschinen <strong>Kommunal</strong>messe“prä-<br />
entsprechend darsentierte.stellen und treffen Ing. Walter<br />
Maurer, bei<br />
zudem die Kunden<br />
«<br />
Grundfos<br />
von morgen.<br />
zuständig für<br />
die Bereiche<br />
Andreas Kühtreiber<br />
Technik und<br />
Betriebsleiter der Firma Verkauf:<br />
Doppstadt<br />
"Auch unsere<br />
Messezielsetzung<br />
konnten wir erreichen. Für uns<br />
sind nur Fachmessen interessant, denn<br />
hier treffen wir exakt auf unsere Kunden".<br />
Auf den folgenden Seiten berichten wir<br />
ausführlich über die Messe und die Angebote<br />
der Firmen.<br />
KOMMUNALMESSE<br />
Die KOMMUNAL-Mädels und das Fachmagazin waren permanent präsent.<br />
Ein Rundgang durch die KOMMUNALMESSE<br />
Schauen Sie<br />
sich das an ...<br />
Über 200 Aussteller haben ihre Produkte und Leistungen<br />
vorgestellt. Auf den folgenden Seiten können Sie sich<br />
selbst ein Bild von der 3-Tages-Messe machen.<br />
Wie immer war einer der frequentiertesten Stände jener der <strong>Kommunal</strong>kredit Austria.<br />
Generaldirektor Reinhard Platzer (2.v.l.) begrüßt Städtebundpräsident Bgm. Michael<br />
Häupl. Mit dabei waren Gemeindebund „General“ Robert Hink, Präsident Bgm.<br />
Helmut Mödlhammer und Matthias Limbeck.<br />
➢➢weiter auf Seite 63<br />
KOMMUNAL 61
KOMMUNALMESSE<br />
1. Bürgermeisterkongress diskutiert Zukunft des ländlichen Raums<br />
Für kluge Verteilung<br />
der Infrastruktur<br />
Das FORUM LAND warnte beim 1. Bürgermeisterkongress zum Thema „Gemeinden mit<br />
Zukunft“ anlässlich der <strong>Kommunal</strong>messe davor, eindimensional auf Kosten der Infrastruktur<br />
im ländlichen Raum zu sparen. Zusperren – ganz egal ob Spitäler oder Postämter<br />
– alleine sei ganz sicher keine sinnvolle Alternative.<br />
„Es geht vorrangig darum, Schwerpunkte<br />
in der Infrastruktur zu bilden und so zu<br />
einer klugen Verteilung zu kommen“<br />
sagte FORUM LAND-Geschäftsführer<br />
Matthias Thaler vor rund 200 Bürgermeisterinnen<br />
und Bürgermeistern aus ganz<br />
Österreich. Gerade bei den Verhandlungen<br />
zum Finanzausgleich sei eine gute<br />
Lösung gefunden worden. Thaler: „Damit<br />
wurde ein wichtiges Signal an die Bürgermeister<br />
gegeben, dass die Gemeinden<br />
nicht im Stich gelassen und auch nicht zu<br />
Almosenempfängern degradiert werden.<br />
Infrastrukturelle Fortschritte müssen auch<br />
mit finanziellen Fortschritten verbunden<br />
sein“.<br />
Gemeinden machen<br />
Lebensqualität<br />
Thaler betonte, dass sowohl der Bauernbund<br />
als auch FORUM LAND sich weiter<br />
massiv auf politischer Ebene für die Interessen<br />
der Gemeinden einsetzen werden.<br />
„Denn die Gemeinden sind nicht nur die<br />
Ansprech- und Servicestelle Nummer 1<br />
für die Bürger, sondern stellen auch das<br />
zur Verfügung, was wir im weitesten Sinn<br />
unter Lebensqualität verstehen – ob<br />
Alten- oder Kinderbetreuung, Infrastruktur<br />
oder Freizeiteinrichtungen. Außerdem<br />
sind sie die Managementstelle für<br />
das Vereinswesen in Österreich“, so der<br />
62 KOMMUNAL<br />
FORUM LAND-Geschäftsführer.<br />
Lebensminister Josef Pröll bezeichnete<br />
die Gemeinde als Keimzelle des Landes<br />
und würdigte die Rolle der Gemeinden<br />
als zentrale Dienst-<br />
leister im ländlichen<br />
Raum. „Die<br />
Gemeinden sind<br />
nicht nur erster<br />
Ansprechpartner<br />
für den Bürger,<br />
sondern als größte<br />
Investoren auch<br />
Motor für Arbeitsplätze<br />
im ländlichen<br />
Raum“ sagte<br />
der Minister. Pröll<br />
forderte die Kongressteilnehmer<br />
auf, neue Formen der kommunalen<br />
Zusammenarbeit zu suchen und das<br />
„Kirchturm-Denken“ hinten anzustellen.<br />
Im Anschluss an seine Eröffnungsrede<br />
übergab Lebensminister Josef Pröll das<br />
Communal Audit an sechs Bürgermeister.<br />
«<br />
Gemeindebund gegen<br />
Postamtsschließungen<br />
Gemeindebund-Präsident Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer nahm im Rahmen eines<br />
Interviews mit KOMMUNAL-Geschäftsführer<br />
Walter Zimper jun. zur aktuellen<br />
Diskussion um die geplante Schließung<br />
von Postämtern Stellung. Es werde<br />
keine weiteren Postamtsschließungen<br />
geben, ohne dass davor mit den<br />
Gemeinden darüber<br />
verhandelt worden<br />
ist. Ein Postamt<br />
dürfe nur geschlossen<br />
werden, wenn<br />
die Erbringung des<br />
Universaldienstes<br />
durch die Postgeschäftsstelle<br />
oder<br />
durch Landzusteller<br />
gewährleistet ist.<br />
Mödlhammer:<br />
„Finanzielle Einsparungen<br />
und Filialschließungen<br />
zu<br />
Lasten des Universaldienstes und der<br />
flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung<br />
werden wir nicht akzeptieren.<br />
Das ist ja nicht zuletzt eine Frage, wie<br />
man in Zukunft mit den Anforderungen<br />
im ländlichen Raum umzugehen<br />
gedenkt. Am Land ist die Postinfrastruktur<br />
eine wichtige Sache und dazu stehen<br />
wir“ gab sich der Gemeindebund-Präsident<br />
kämpferisch.<br />
Zur Zukunft des ländlichen Raumes<br />
meinte Mödlhammer, es sei Aufgabe<br />
und Pflicht der Politik, diesem jede nur<br />
erforderliche Unterstützung zu geben.<br />
Mödlhammer: „Das fängt eben bei den<br />
Die Gemeinden sind<br />
nicht nur erster<br />
Ansprechpartner für den<br />
Bürger, sondern als<br />
größte Investoren auch<br />
Motor für Arbeitsplätze<br />
im ländlichen Raum.<br />
Lebensminister Josef Pröll«
LR Wolfgang Sobotka und Gemeindebund-Präsident<br />
Helmut Mödlhammer<br />
im Gespräch mit Walter Zimper jun.<br />
Postämtern an, geht aber natürlich weiter<br />
beim Straßenbau, der Siedlungswasserwirtschaft,<br />
der Infrastruktur für Konsumenten,<br />
damit die Menschen auch<br />
weiterhin in ihrem eigenen Lebensraum<br />
einkaufen können. Nicht zuletzt ist das<br />
ja auch alles eine Frage von Arbeitsplätzen.<br />
Ich muss Arbeitsplätze dort schaffen,<br />
wo die Menschen leben“.<br />
Gesundheitszentren statt<br />
Krankenhäuser<br />
NÖ-Finanzlandesrat Mag. Wolfgang<br />
Sobotka nahm zur Übernahme von<br />
Spitälern durch das Land NÖ Stellung<br />
und meinte, dass sich das Land als verlässlicher<br />
Dienstgeber behauptet hat. Den<br />
Gemeinden wurde mit der Übernahme<br />
der Spitäler eine große finanzielle Last<br />
von rund 60 Mio Euro für 2005 abgenommen.<br />
Sobotka forderte ein Umdenken<br />
in der Gesundheitspolitik und<br />
meinte: „Unsere Krankenhäuser müssen<br />
zu Gesundheitszentren werden“. Dem<br />
Land gehe es darum, eine hohe medizinische<br />
Versorgung auf hohem Niveau<br />
sicherzustellen und gleichzeitig Synergien<br />
zu nutzen. Was die Zukunft des ländlichen<br />
Raumes betrifft, meinte LR Sobotka,<br />
man müsse Chancengleichheit und neue<br />
Ideen forcieren. Es gehe um eine verstärkte<br />
Zusammenarbeit zwischen den<br />
Kommunen und um die Erhöhung der<br />
Bildungschancen im ländlichen Raum.<br />
Nicht nur die „KOMMUNAL-Mädels“ waren<br />
von den Angeboten der Aussteller begeistert.<br />
Die technischen Neuerungen wie hier die<br />
„Kanal-Kamera“ der Vorarlberger Firma iPEK<br />
Spezial TV GmbH waren vor allem für die<br />
<strong>Kommunal</strong>politiker faszinierend.<br />
KOMMUNALMESSE<br />
KOMMUNAL-Fotograf<br />
Raimund Boltz<br />
und „Kamera-Assistent“<br />
Manfred Stöhr<br />
(ganz links), eigentlich<br />
kaufmännischer<br />
Leiter von iPEK, bei<br />
der Arbeit. (unten)<br />
Michael Plötzeneder<br />
und Mark André<br />
Kastinger von der<br />
Firma Günther Kasper<br />
aus Schwanenstadt<br />
präsentieren den<br />
Schachtrahmenheber<br />
SRH 05.<br />
Mitten in ein Beratungsgespräch „platzte“ KOMMUNAL beim Stand der Firma ESCH-<br />
Technik Maschinenhandel. Berater Michal Trapper (links) erläuterte Wassermeister Franz<br />
Kurzreiter aus der Gemeinde Hainfeld im niederösterreichischen Traisental die Vorzüge<br />
des Kubota-<strong>Kommunal</strong>baggers.<br />
KOMMUNAL 63
KOMMUNALMESSE<br />
<strong>Kommunal</strong>e Prominenz am Stand der Firma Willibald.<br />
Robert Hink und Helmut Mödlhammer informieren<br />
sich bei Hanns-Thomas Teubel über das Angebot.<br />
64 KOMMUNAL<br />
Kurt Fleischhacker (links) nutzte den Besuch der KOMMUNALMESSE, um<br />
von Reinhard Hinterseer einen brandneuen Egholm 2100 mit An- und Aufbaugeräten<br />
in Empfang zu nehmen. KOMMUNAL war dabei.<br />
Die sicher „schwersten<br />
Brocken“ stellt Doppstadt<br />
aus. Der „Häcksler“<br />
schafft auch<br />
Bäume mit 90 cm<br />
Durchmesser, drei tonnen<br />
gewicht und dreieinhalb<br />
Meter Länge.<br />
Unten: Andreas Kühtreiber<br />
und Werner<br />
Doppstadt im Gespräch<br />
mit interessierten<br />
Besuchern.<br />
Ein „G’riss“ herrschte um Bgm. Michael<br />
Häupl – auf gut wienerisch gesagt – bei<br />
seinem Blitzbesuch auf der Messe.<br />
Neben „seinen 48-ern“ stattete er u.a.<br />
auch der APA einen Besuch ab.<br />
Neben dem Gemeinschaftsstand<br />
der französischenHandelskammer<br />
– übrigens<br />
eine Premiere in Wien<br />
– war der Citroen-<br />
Stand einer der Blickfänge.<br />
Davon überzeugte<br />
sich Citroen-<br />
Frankreich-Chef Michele<br />
Legrand (rechts),<br />
hier mit Oliver Rosteck<br />
und Michael Kulhavy<br />
von Citroen Österreich.
Gelöste Stimmung am Stand von Komptech-Farwick:<br />
Gemeindebundpräsident<br />
Helmut Mödlhammer informierte sich bei<br />
Ing. Josef Heissenberger (rechts) von<br />
Komptech.<br />
Die Strasswalchener Firma Stangl die<br />
Besucher präsentierte ihre Produktpalette.<br />
Traditionell war der KOMMUNAL Stand<br />
Treffpunkt für Politik und Wirtschaft.<br />
Während – im Vordergrund – Dr. Josef<br />
Taus mit Brauereichef Frank Schmitt von<br />
Piestinger Bier plauderte, fand – im Hintergrund<br />
– eine „politische“ Besprechung<br />
statt. Helmut Mödlhammer traf auf<br />
Dr. Heinrich Hoffschulte, 1. Vizepräsident<br />
des RGRE mit Gattin. Mit dabei Mag. Nicolaus<br />
Drimmel, Daniel Kosak und Robert<br />
Hink vom Gemeindebund sowie KOM-<br />
MUNAL-Chef Prof. Walter Zimper.<br />
➢➢weiter auf Seite 68<br />
KOMMUNALMESSE<br />
Der Stand der E-Werke-Wels war auch heuer<br />
besonders auffällig. Im Energy-Bus präsentierten<br />
die oberösterreichischen „Strom-Meister“<br />
Modelle, die das Thema Strom „greifbar“<br />
machten. Hans Grassegger, Verkaufsleiter<br />
der E-Werke, mit den „Strom-Blitzen“. Viel<br />
Zeit hatte er zum demonstrieren allerdings<br />
nicht, denn schon wartete eine der zahlreichen<br />
ungarischen Delegationen (unten).<br />
KOMMUNAL 65
„Wirtschaft in der Region“ zeichnet die 30 Bundessieger aus<br />
WiR machen weiter –<br />
zur Stärkung unserer<br />
Regionen<br />
1000 Gäste, über 900 Projekte, 30 Sieger. Bei der Abschlussgala des Österreichweiten<br />
Wirtschaftsbund-Wettbewerbes „WiR - Wirtschaft in der Region“ im Wiener Messezentrum<br />
am ersten Abend der KOMMUNALMESSE wurden die Bundessieger für die besten<br />
Projekte regionaler Zusammenarbeit gebührend gefeiert und mit Preisen ausgezeichnet.<br />
„Die Unternehmerinnen und Unternehmer<br />
in den Städten und Gemeinden<br />
sind der Beweis dafür, dass gemeinsames<br />
Handeln für die Wirtschaft und die<br />
Regionen gut ist“, sagte Wirtschaftsbund-Präsident<br />
Christoph Leitl in seiner<br />
Laudatio. Und<br />
Generalsekretär<br />
Karlheinz Kopf<br />
ergänzte: „Wir<br />
machen weiter,<br />
WiR wird auch<br />
künftig zur Stärkung<br />
der regionalen<br />
Wirtschaft beitragen.“<br />
Der Wettbewerb<br />
WiR startete dieses<br />
Jahr im März<br />
und zeichnete<br />
Projekte Wirtschaftstreibender<br />
und von Gemeinden<br />
aus, die zur<br />
Steigerung der<br />
Attraktivität lokalerWirtschaftsstandorte<br />
in Städ-<br />
Christoph Leitl<br />
ten, Bezirken,<br />
Gemeinden und Regionen beitragen.<br />
Die Teilnehmer konnten in drei Kategorien<br />
mitmachen: in die Kategorie A fallen<br />
Projekte lokaler Kooperationen von<br />
Unternehmern, Gemeinden oder Wirtschaftsvereinen,<br />
Kategorie B widmet<br />
sich der thematischen regionalen<br />
66 KOMMUNAL<br />
»<br />
Es geht auch um<br />
soziale Komponenten,<br />
wie die Einkaufsmöglichkeiten<br />
für Familien,<br />
für Leute ohne Auto,<br />
für ältere Menschen.<br />
Zusammenarbeit, etwa zur Schaffung<br />
gemeinsamer Marken und Dienstleistungen,<br />
Kategorie C schließlich hat die<br />
Aufgabe eines Ideen-Pools übernommen,<br />
worin sich noch nicht realisierte<br />
Projekte wiederfinden. Alle Eingaben<br />
wurden von einer Jury<br />
unter der Leitung des<br />
ehemaligen Bürgermeisters<br />
von<br />
Steinbach/Steyr Karl<br />
Sieghartsleitner bewertet,<br />
der u.a. auch die<br />
Bundesminister Martin<br />
Bartenstein und Josef<br />
Pröll angehörten.<br />
Initiator der Aktion ist<br />
der Österreichische<br />
Wirtschaftsbund mit<br />
Präsident Christoph<br />
Leitl an der Spitze.<br />
„Durch diesen Wettbewerb<br />
kommen Initiativen<br />
vor den Vorhang,<br />
«<br />
die sonst im Verborgenen<br />
geblieben wären.<br />
Sie sind Ansporn für<br />
Gemeinden und Gewerbetreibende,<br />
besonders<br />
für Nahversorger, die Kooperation<br />
wesentlich auszubauen und zu vertiefen.<br />
Gerade in einer Zeit der fortschreitenden<br />
Globalisierung braucht es ein<br />
starkes Gegengewicht, um die Lebensqualität<br />
im Lebensumfeld zu erhalten<br />
und wenn möglich noch zu verbessern“<br />
meint Jury-Vorsitzender Karl Sieghartsleitner.<br />
Erfahrung mit den Problemen, vor<br />
denen Gemeinden, klein- und mittelständische<br />
Betriebe und Nahversorger<br />
stehen, hat auch Präsident Leitl aus seiner<br />
Zeit in der oberösterreichischen<br />
Landesregierung. „Gerade die Nahversorgung<br />
ist es, was die Menschen für<br />
die Sicherung ihrer Lebensqualität<br />
brauchen. Da geht es nicht nur um die<br />
Sicherung unternehmerischer Existenzen.<br />
Es geht auch um soziale Komponenten,<br />
wie die Einkaufsmöglichkeiten<br />
für Familien, für Leute ohne Auto, für<br />
ältere Menschen“ so Leitl.<br />
Regionale<br />
Zusammenarbeit<br />
Über den Wettbewerb „Wirtschaft in der<br />
Region“ soll die regionale Zusammenarbeit<br />
gefördert werden. Die Gemeinden<br />
sind Heimat für die Menschen. Sie<br />
errichten Ausbildungs-, Sozial- und<br />
Infrastruktureinrichtungen, unterstützen<br />
Vereine und gestalten so maßgeblich<br />
den Lebensraum der Menschen. Kleinund<br />
Mittelbetriebe prägen die regionale<br />
Entwicklung. Die Verbundenheit der<br />
Wirtschaftstreibenden mit ihrer unmittelbaren<br />
Umgebung und ihre Unterstützung<br />
der regionalen Entwicklung gibt<br />
ihnen eine unverzichtbare Bedeutung<br />
für die Gemeinden und Regionen.
Gemeindebund- „General“ Robert Hink,<br />
KOMMUNAL-Verleger Prof. Walter Zimper,<br />
Wirtschaftsbund-Chef Christoph<br />
Leitl, Jury-Vorsitzender Karl Sieghartsleitner<br />
und Helmut Mödlhammer,<br />
Gemeindebundpräsident freuten sich<br />
mit den Siegern des WiR-Wettbewerbs.<br />
Im Bemühen um die Stärkung der<br />
Wirtschaftsstrukturen ist regionale<br />
Zusammenarbeit angesagt. Lokaler<br />
Egoismus hat oft zur wirtschaftlichen<br />
Entsiedelung der Ortszentren und zu<br />
Die 30 Siegerprojekte<br />
Kategorie A: Initiativen in der<br />
Gemeinde<br />
◆ Grieskirchner Handwerker-Gruppe<br />
OÖ<br />
◆ Kooperatives Innenstadtprojekt<br />
„Obere Altstadt Lienz“, T<br />
◆ Weinerlebnis Purbach, B<br />
◆ SOMA – Sozialmarkt für Menschen<br />
mit geringem Einkommen, OÖ<br />
◆ Ortskernbelebung St. Marienkirchen/Sch.,<br />
OÖ<br />
◆ WIRTE 3100, St. Pöltner Gastronomiebetriebe,<br />
NÖ<br />
◆ Bergpower Hotels „Wellness Alpin“, T<br />
◆ Wiederbelebung des Freihausviertels,<br />
W<br />
◆ Multifunktionaler Nahversorger,<br />
Gemeinde St. Koloman, S<br />
◆ Die Wiener Einkaufsstrassen, W<br />
Kategorie B: Initiativen in der Region<br />
◆ Oststeirische Städtekooperation, Tourismusverband<br />
Feldbach, Stmk.<br />
◆ Alpine Drive Center Lungau, S<br />
◆ ARGE Mittleres Enns- und Paltental,<br />
Stmk.<br />
◆ Netzwerk „Mölltaler Almlärchenholz“,<br />
K<br />
ungerechter Verteilung der Steuereinnahmen<br />
beigetragen. WiR will mit dem<br />
Wettbewerb dieser Entwicklung entgegenwirken<br />
und einen Beitrag zur Stärkung<br />
der Wirtschaftsentwicklung und<br />
Lebensqualität aller leisten.<br />
◆ Stärkung kleinregionaler Zentren<br />
Stainz, Stmk.<br />
◆ SBS Plattform, S<br />
◆ Kremstaler Technische Lehrakademie,<br />
OÖ<br />
◆ Interkommunales Betriebsgebiet<br />
Hürm, NÖ<br />
◆ Gewerbe- und Industriepark Althofen,<br />
K<br />
◆ Schneebergland-Qualitätsbetriebe,<br />
NÖ<br />
Kategorie C: Ideenpool<br />
◆ Plattform zur Entlastung von Umwelt<br />
und Verkehr in Ballungszentren, W<br />
◆ Güssinger Online Shopping Mail, B<br />
◆ Vienna Tunes, W<br />
◆ IT Region Tennengau, S<br />
◆ Xundwärts Lauf- und Bewegungszentrum,<br />
NÖ<br />
◆ Tourismus ARGE 50plus, Stmk.<br />
◆ Hauseigentümer-Genossenschaften,<br />
OÖ<br />
◆ Tullner Masterplan, NÖ<br />
◆ Meister-stueck, Netzwerk für feinste<br />
Maßarbeit, NÖ<br />
◆ Dienstleistungszentrum im Ortszentrum<br />
von Pichl/Wels, OÖ<br />
Gemeinden größte<br />
öffentliche Investoren<br />
Gemeindebund-Präsident Bgm. Helmut<br />
Mödlhammer, der auch an der großen<br />
WiR-Gala im Messezentrum Wien teilnahm,<br />
freut sich, dass die Wirtschaft<br />
einen Wettbewerb zur Förderung kommunaler<br />
Zusammenarbeit durchführt.<br />
Mödlhammer: „Die Gemeinden Österreichs<br />
sind nicht nur die bürgernächsten<br />
Einrichtungen, sondern auch die<br />
mit Abstand größten öffentlichen Investoren.<br />
Rund zwei Drittel des gesamten<br />
öffentlichen Auftragsvolumens werden<br />
von den Gemeinden vergeben und<br />
davon wiederum 80 Prozent an die<br />
regionalen Betriebe in einem Umkreis<br />
von rund 20 Kilometern von der jeweiligen<br />
Gemeinde. Bei einem immer<br />
größer werdenden Druck der Globalisierung<br />
wird es immer notwendiger,<br />
einerseits die Attraktivität der lokalen<br />
Wirtschaftsstandorte zu stärken, andererseits<br />
die kommunale Zusammenarbeit<br />
so zu verbessern, dass es nicht<br />
Gemeinden unterschiedlicher Kategorien<br />
gibt, nämlich ganz wenige, die<br />
immer reicher und viele arme, die<br />
immer ärmer werden“.<br />
Information<br />
Alle Sieger des WiR-Wettbewerbs<br />
und Eindrücke von der großen<br />
WiR-Gala im Messezentrum Wien<br />
finden Sie im Internet:<br />
www.wirtschaftinderregion.at<br />
KOMMUNAL 67
KOMMUNALMESSE<br />
Polit-Prominenz am Stand der Bank<br />
Austria Creditanstalt: Wiens Bürgermeister<br />
Michael Häupl mit dem obersten<br />
„<strong>Kommunal</strong>-Berater“ der Bank, Günter<br />
Mack (rechts), und seinem Team.<br />
Zufrieden mit der Messe war auch Austrowaren.<br />
Otto Beste, Franz Grohs und<br />
Katharina Azarpour berieten die interessierten<br />
Kunden über das Angebot.<br />
<strong>Kommunal</strong>net auch „Hundebörse“?<br />
Dass kommunalnet.at, die neue E-Government-<br />
Plattform für Gemeinden, eine echte Innovation<br />
ist, weiß man bereits. Dass man damit aber<br />
auch Hunde kaufen kann, ist allerdings neu. So<br />
geschehen am ersten Messetag: Die Bürgermeisterin<br />
aus Lofer, Bettina Dürnberger, kaufte<br />
direkt am kommunalnet-Terminal einen<br />
schwarzen Hund für ihre Tochter. Gemeindebund-Präsident<br />
Helmut Mödlhammer ist sichtlich<br />
begeistert und drängte die Frau Bürgermeister,<br />
den Hund sofort zu taufen. Ein kurzes<br />
Telefonat mit der Tochter brachte Klarheit: der<br />
neue Hund heißt „Blacky“. Robert Reiter, Bürgermeister<br />
von Rauris, und Peter Mitterer, Bürgermeister<br />
von Saalbach-Hinterglemm, übernahmen<br />
übrigens spontan die Hunde-Patenschaft.<br />
Sie wollen für Hundeschule, Verpflegung<br />
und eine entsprechende Ausbildung sorgen. Bei<br />
soviel Bürgermeister-Unterstützung kann<br />
„Blacky“ einem erfüllten und gesicherten<br />
Hunde-Leben entgegenbellen.<br />
68 KOMMUNAL<br />
Das Angebot der Initiative WiR „fesselte“ auch die Prominenz dieser Messe. So verfolgten<br />
Prof. Walter Zimper, KOMMUNAL-Chef, Lebensminister Josef Pröll, WiR - Wirtschaft<br />
in der Region-Geschäftsführer Christian Kunstmann und Walter Zimper jun.,<br />
Geschäftsführer von KOMMUNAL, gebannt die Vorführung auf dem Bildschirm.<br />
KOMMUNAL, die Brücke zwischen Gemeinden und Wirtschaft: Werner Nekam, Manfred<br />
Feistmantl, Hans Grassegger (E-Werke Wels), Mag. Sabine Brüggemann, Mark<br />
André Kastinger (Fa. Günther Kasper), Johanna Ritter und Fritz Kampl (E-Werke-Wels)<br />
informieren sich mit Wirtschaftsbund-Chef Christoph Leitl und Präsident Helmut Mödlhammer<br />
über die News in KOMMUNAL.<br />
Einen kompetenteren Berater<br />
konnte sich Bgm. Bernd Vögerle,<br />
Vizepräsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes und Präsident<br />
des sozialdemokratischen<br />
Gemeindevertreterverbandes Niederösterreichs,<br />
nicht wünschen.<br />
Mag. Stefan Primosch vom Kärntner<br />
Gemeindebund erläuterte<br />
professionell das „Einloggen“ bei<br />
der neuen Gemeindeplattform<br />
www.kommunalnet.at.
Schubert & Franzke, Hersteller von Karten und Plänen,<br />
verzeichnete starke Besucherfrequenz (oben).<br />
So kamen unter anderem Prof. Walter Zimper und<br />
Dr. Josef Taus, die sich von Vertriebschef Josef Scheibenreif<br />
den aktuellen Plan von Mödling zeigen<br />
ließen (Foto rechts) .<br />
Lebensminister Josef<br />
Pröll besuchte bei seinem<br />
Messerundgang<br />
mit Matthias Limbeck<br />
und Walter Zimper jun.<br />
natürlich auch „seinen<br />
eigenen“ Stand. Hier<br />
traf er u.a. DI Franz<br />
Schmid (2.v.l.), den stellvertrenden<br />
Leiter der<br />
Abteilung IV/5 - Wildbach-<br />
und Lawinenverbauung<br />
und Gefahrenzonenplanung.<br />
KOMMUNALMESSE<br />
Schon am ersten Tag der Messe wurde der Stand der niederösterreichischen<br />
gemdat nahezu „gestürmt“. Im Bild links<br />
erläutert Franz Mandl die Gemeinde-Lösungen für Mag. Christian<br />
Schneider, Landesgeschäftsführer des nö. Gemeindevertreterverbandes<br />
der VP und Gemeindebund „General“<br />
Robert Hink. Am zweiten Tag kam das Unternehmen mit<br />
Gemeindeminister Ernst Strasser zu „Minister-Ehren“ (oben).<br />
KOMMUNAL 69
KOMMUNALMESSE<br />
Erfreut begrüßt Michael Novak, Leitender<br />
Sekretär der Gewerkschaft der<br />
Gemeindebediensteten, Minister Pröll.<br />
Zeit für ein „Vier-Augen-Gespräch“:<br />
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer<br />
bespricht mit DI Klaus Brenner<br />
von Veolia Water die Zukunft der Wasserversorgung<br />
in Österreich.<br />
Sein Besuch diente nicht der Überprüfung der Verkehrssicherheit: Minister<br />
Ernst Strasser ließ sich von Johann Kreuzberger (3.v.l.) von Liebherr die Funktion<br />
und flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Liebherrr-Geräte demonstrieren.<br />
Mit am Stand auch Christian Kahlbacher (2.v.l.)<br />
70 KOMMUNAL<br />
Beeindruckt von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der John Deere Geräteträger<br />
zeigten sich Minister Pröll und Reed-Chef Limbeck.<br />
Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen präsentierte das Audit<br />
familien- und kinderfreundliche Gemeinde. Mag. Manuela Marschnig von der zuständigen<br />
Abteilung V/7 im Ministerium (Mitte) freut sich über den Besuch von Bundesminister<br />
Josef Pröll, Reed Messen-Geschäftsführer Matthias Limbeck und der KOM-<br />
MUNAL-Geschäftsführer Prof. Walter Zimper und Walter Zimper jun.<br />
Neben dem Lebensministerium und<br />
dem Bundesministerium für soziale<br />
Sicherheit und Generationen präsentierte<br />
auch das Bundeskanzleramt seine Angebote<br />
für Gemeinden und Bürger. Hier<br />
informiert sich Lebensminister Pröll bei<br />
Otto Aigner vom BKA über die vielfältigen<br />
Möglichkeiten, die die Website<br />
www.help.gv.at bietet. help.gv war nicht<br />
nur ein Vorreiter des E-Government, sie<br />
ist auch aus dem täglichen Arbeitsablauf<br />
der Gemeinden heute nicht mehr wegzudenken.
Sag zum Abschied leise „Servus“: Ob kommunale Entscheidungsträger,<br />
Partner aus der Wirtschaft oder Mitarbeiter – ein<br />
herzliches Dankeschön an alle, die zum neuerlichen Erfolg dieser<br />
Leitmesse für Österreichs Gemeinden beigetragen haben.<br />
Österreichisches Wasser PR-Know-how erhielt<br />
beim IWA-Weltwasserkongress Anerkennung<br />
Das Lebensministerium sah<br />
das von der UNO ausgerufene<br />
internationale Jahr<br />
des Wassers 2003 als<br />
Chance eine Vielfalt an<br />
Aktivitäten zu setzen, um<br />
der Bevölkerung die<br />
Bedeutung und Qualität<br />
des österreichischen Wassers<br />
zu verdeutlichen.<br />
Auch die österreichischen<br />
Freut sich über die Anerkennung<br />
ihrer Arbeit:<br />
Mag. Susanne Brandstetter<br />
(Lebensministerium) im<br />
Bild mit dem IWA-PR-<br />
Chairman DI Walter Kling<br />
Gemeinden haben sich<br />
am „Jahr des Wassers“<br />
sehr aktiv eingebracht<br />
haben (Gemeindefeste<br />
und der Wettbewerb zum<br />
Jahr des Wassers).<br />
◆◆◆◆◆<br />
Internationale Auszeichnung<br />
für „Jahr des Wassers“<br />
Foto: ÖVGW<br />
Wie sich am vierten „IWA-<br />
Weltwasserkongress“ in<br />
Marrakesch/Marokko<br />
zeigte, fanden die<br />
Bemühungen auch internationale<br />
Anerkennung.<br />
So erhielt das Lebensministerium<br />
(unterstützt von<br />
der Agentur ECC Publico)<br />
für seine Kampagne „Jahr<br />
des Wassers 2003“ in der<br />
Kategorie „Best beworbene<br />
Wasserschutzaktivität“ die<br />
Auszeichnung „Highly<br />
commended“, was der Silbermedaille<br />
entspricht!<br />
„Höchst empfohlen“ wurden<br />
auch das Projekt der<br />
Budapester Wasserwerke<br />
und jenes des Brüsseler<br />
Wasserversorgungsunternehmens<br />
CIBE. Die Goldmedaille<br />
erhielt das Stockholmer<br />
Wasserwerk für<br />
seine Kampagne zur Vermeidung<br />
von Abfällen in<br />
der Toilette.<br />
Die Auszeichnung der<br />
Lebensministeriums Kampagne<br />
zum Jahr des Wassers<br />
2003 zeigt, dass Wasser-Know-how<br />
„Made in<br />
Austria“, auch was die<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
betrifft, keinen internationalen<br />
Vergleich scheuen<br />
muss.<br />
Wirtschafts-Info<br />
MAASTRICHT<br />
SERVICE<br />
Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen<br />
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialisten<br />
für kommunale Leasingprojekte.<br />
E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at<br />
www.kommunal-leasing.at<br />
KOMMUNAL 71
Feuerwehrbekleidung: Schutz für die Schützer<br />
Damit das Feuer keine<br />
Chance hat<br />
Am 11. November wird die Rolle der freiwilligen Feuerwehren diskutiert. Das hohe<br />
Ansehen in der Bevölkerung, die Einsatz-Bereitschaft, der Mut und das Können der<br />
Freiwilligen – all das steht außer Zweifel. Aber welchen Schutz haben die Wehren<br />
selbst? Was tragen sie, damit sie heil aus einer Flammenhölle kommen oder bei einer<br />
Bergung auf der Autobahn in stockfinsterer Nacht nicht selbst zu Opfern werden?<br />
Eine Reportage von Mag. Hans Braun.<br />
Eigentlich tun mir die Männer und<br />
Frauen der Freiwilligen Feuerwehr<br />
Amstetten leid. Da komme ich und will<br />
von ihnen, dass sie mir<br />
ihre Einsatzkleidung<br />
bei einer Übung vor-<br />
führen und das Thermometer<br />
zeigt ausgerechnet<br />
an diesem Tag<br />
35 Grad Celsius! Und<br />
das um sechs Uhr<br />
Abends.<br />
Als sie in ihre Overalls<br />
schlüpfen, verursacht<br />
allein das Schweißausbrüche<br />
– bei ihnen und<br />
bei mir. Aber, wie FF-Kommandant Armin<br />
Blutsch sagt: „Es hilft ja nichts. Wir können<br />
uns nicht aussuchen, wann es wo<br />
brennt oder wann auf der nahen West<br />
(der A1 Westautobahn) wieder einmal ein<br />
Unfall ist.“ Und es passiert in der<br />
Bereichsalarmzentrale Amstetten oft<br />
etwas, bis zu 600 Einsätze verzeichnen sie<br />
hier im Schnitt jährlich.<br />
72 KOMMUNAL<br />
Wirtschaftlichkeit,Funktionalität<br />
und Tragekomfort<br />
sind heute wichtige<br />
Kriterien der<br />
Anschaffung.<br />
An diesem Abend haben wir uns getroffen,<br />
um über die Einsatzkleidung der Feuerwehren<br />
zu sprechen. Ein Thema, das<br />
außerhalb der Wehren oder<br />
der zuständigen Beschaffer<br />
nur selten besprochen wird.<br />
Da geht es meistens um<br />
einen neuen Einsatzwagen<br />
oder das Gerätehaus. Aber<br />
die Kleidung? Was anziehen,<br />
wenn man/frau einem Feuer<br />
mit (in Spitzenfällen) einigen<br />
hundert Grad gegenübersteht?<br />
Und gleichzeitig ist<br />
durch den Sprühregen des<br />
Löschwassers alles klatschnass.<br />
Wie müssen die Textilien aushalten,<br />
was müssen sie „können“?<br />
Ein Anforderungsprofil<br />
Für die Freiwilligen oder die Berufsfeuerwehren<br />
steht heute meistens nicht nur<br />
der Schutz gegen Flammen auf dem<br />
Anforderungsblatt. Der ist schon selbst-<br />
verständlich (und wird durch jede Menge<br />
Normen und technische Regeln abgehandelt).<br />
Heutzutage sind Wirtschaftlichkeit, Funktionalität<br />
und Tragekomfort wichtige Kriterien<br />
der Anschaffung.<br />
Es gibt neben<br />
den „klassischen“Feuerwehreinsätzen<br />
mit einem<br />
Löschauftrag<br />
oder einem<br />
Schutzauftrag<br />
nach einem<br />
Hochwasser<br />
eine Reihe von<br />
Situationen,<br />
die zum normalenFeuerwehralltag<br />
gehören, auch<br />
ihre Gefahren<br />
bergen und<br />
bei der<br />
Heutzutage bieten<br />
Markenhersteller<br />
Kleidung an, die „auf<br />
dem Stand der Technik“<br />
sind. Sie können auch<br />
bei kleineren Mengenbestellungen<br />
auf individuelle<br />
Anforderungen<br />
eingehen und dabei<br />
trotzdem ein optimales<br />
Preis-Leistungs-<br />
Verhältnis bieten.
Beschaffung berücksichtigt werden<br />
müssen:<br />
◆ Gute Sichtbarkeit bei Nacht oder in<br />
verqualmten Räumen;<br />
◆ Schutz gegen Verlust der Körperwärme<br />
(wer einmal für ein paar Stunden auf<br />
einer winterlichen Straße oder Autobahn<br />
bei Bergearbeiten geholfen hat, weiß, wie<br />
wichtig das ist.);<br />
◆ die Kleidung sollte einen optimalen<br />
Nässeschutz bieten, und das auch nach<br />
starker Nutzung oder längerer Lagerung;<br />
◆ der Körper muss vor übermäßigem<br />
Wasserverlust geschützt werden. Zuviel<br />
Schwitzen sollte vermieden werden, die<br />
Einsatz-Garnituren sollten einen optimalen<br />
Wasserhaushalt des Körpers unterstützen.<br />
◆ aus wirtschaftlicher Sicht müssen die<br />
Garnituren extreme Trage-Belastungen<br />
„wegstecken“ können. Der schönste<br />
Anzug nützt nichts, wenn er nach zehn<br />
Mal Tragen kaputt ist.<br />
Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen,<br />
aber schon diese wenigen Punkte<br />
zeigen, dass gute Einsatzkleidung nicht<br />
gleich Einsatzkleidung ist. Zu vielseitig<br />
sind die Anforderungen, die es zu erfüllen<br />
gilt. Gefragt ist eine multifunktionale<br />
Kleidung.<br />
Heutzutage bieten Markenhersteller Kleidung<br />
an, die „auf dem Stand der Technik“<br />
ist. Sie können – auch bei kleineren<br />
Mengenbestellungen – auf individuelle<br />
Anforderungen eingehen und dabei trotzdem<br />
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis<br />
bieten.<br />
Der Amstettener<br />
Feuerwehr-Overall<br />
Die Anschaffung neuer Feuerwehrkleidung<br />
für die Amstettener Wehr wurde<br />
notwendig, weil die alten klassischen<br />
braunen Garnituren nicht mehr am letzten<br />
Stand waren. Also nutzte Armin<br />
Blutsch die Gunst der Stunde und beriet<br />
sich außer mit einer internen „Beschaffungsarbeitsgruppe“<br />
(fünf bis sechs seiner<br />
Grundtenor des KOMMUNAL-Gesprächs<br />
mit Ursula Puchebner, Vizebürgermeisterin<br />
von Amstetten, war die Einsatzbereitschaft<br />
der Feuerwehr. Denn die Bedeutung<br />
und die Wichtigkeit einer Freiwilligen<br />
Feuerwehr für eine Gemeinde waren<br />
von vornherein so offensichtlich, dass darüber<br />
nur wenig geredet werden musste.<br />
KOMMUNAL: Wie ist die Feuerwehr in<br />
Amstetten organisiert?<br />
Ursula Puchebner: Entsprechend der<br />
Ortsteile haben wir in Amstetten fünf<br />
Freiwillige Wehren. Hier in Amstetten<br />
selbst ist das<br />
gleichzeitig die<br />
Alarmeinsatzzentrale.<br />
Wir gehören<br />
zum Magistrat<br />
Waidhofen im<br />
Bezirk Scheibbs.<br />
Wie ist die Vorstellung<br />
„Gemeinde<br />
ohne Feuerwehr“<br />
für Sie? Kann es<br />
das geben?<br />
Nein. Allein aus<br />
dem Grund, dass<br />
die öffentliche<br />
Sicherheit immer<br />
Priorität haben<br />
muss. Eine<br />
Gemeinde ohne<br />
Freiwillige Feuer-<br />
wehr will ich mir nicht vorstellen. Ich<br />
weiß wohl, dass es vor allem in größeren<br />
Städten mehr Berufsfeuerwehren gibt,<br />
aber auf dem Land ginge das nicht. So<br />
geben wir im Schnitt um die 600.000<br />
Euro jährlich für diese öffentliche Sicherheit<br />
aus. Wir sind ja für die Feuerwehr<br />
die Trägergemeinde.<br />
Einsatzkleidung<br />
Die Gemeinde und ihre Feuerwehr<br />
Was es wert ist, eine zu haben<br />
«<br />
Wir geben im<br />
Schnitt 600.000<br />
Euro jährlich für<br />
die Freiwillige<br />
Feuerwehr aus.<br />
Ursula Puchebner<br />
Vizebürgermeisterin von<br />
Amstetten<br />
Vizebürgermeisterin Puchebner: „Wir<br />
geben im Schnitt jährlich 600.000 Euro<br />
für die Feuerwehren, also die öffentliche<br />
Sicherheit aus.“<br />
Ist also alles „eitel Wonne“ oder gibt es<br />
auch Probleme?<br />
Na Ja. Ich will es nicht als Problem<br />
bezeichnen, aber die Freistellung durch<br />
Firmen für Feuerwehr-Einsätze ist<br />
manchmal etwas schwierig.<br />
Wieso ist die Freistellung ein kritischer<br />
Punkt?<br />
Weil es natürlich für die Firmen schwierig<br />
ist, wenn die Leute tagsüber die Sirene<br />
hören und alles liegen und stehen lassen.<br />
Ich kann doch nicht einfach Leute an der<br />
Kasse stehen lassen. Auch bei Einsätzen,<br />
die die ganze Nacht dauern, leidet<br />
die Firma. Mit wenig bis gar<br />
keinem Schlaf ist es schwierig,<br />
konzentriert zu arbeiten. Wir<br />
haben das in der Gemeinde flexibel<br />
gelöst, je nach Einsatz können<br />
die Leute weg und es gibt<br />
auch eine Ruhezeitenregelung.<br />
Das sollte ja alles irgendwie<br />
selbstverständlich sein.<br />
In den kleinen Gemeinden ist<br />
das auch noch so. Da kennt<br />
jeder jeden, das „Gemeinwohl“<br />
«<br />
hat einen anderen Stellenwert,<br />
es ist mehr Verständnis dafür da.<br />
Wir leiden hier schon unter<br />
einer gewissen Anonymität.<br />
Kurioserweise ist dieses Verständnis<br />
durch das große Hochwasser<br />
1992 wieder etwas<br />
zurückgekehrt. Das hat uns übrigens<br />
2002 geholfen: Die Rückhaltebecken, die<br />
damals angelegt wurden, haben das<br />
schlimmste verhindert. Aber als halb<br />
Amstetten unter Wasser war, haben alle<br />
gesehen, was „Freiwillige Feuerwehr“<br />
bedeutet. Und was es wert ist, wenn man<br />
eine hat.<br />
KOMMUNAL 73
Einsatzkleidung<br />
74 KOMMUNAL<br />
Ein weiterer Vorteil<br />
der High-Tech-Produkte:<br />
Das Gewicht<br />
ist äußerst gering,<br />
wie sich der Autor<br />
selbst überzeugte.<br />
erfahreneren Leuten)<br />
auch mit den<br />
ortsansässigen Konfektionären.Zumindest<br />
eine Entscheidung<br />
war schnell<br />
getroffen: Overalls<br />
sollten es sein. So<br />
geschnitten sollten<br />
sie sein, dass die<br />
Hosen über die Stiefel<br />
getragen werden<br />
(damit keine Glut<br />
oder heiße Asche in<br />
die Stiefel fallen kann).<br />
Details der Verarbeitung des Overalls<br />
standen schnell fest: eine passende Tasche<br />
für die Funkgeräte mit einer genau<br />
schließenden Klappe inklusive Aussparung<br />
für die Antenne zum Beispiel.<br />
Eine bittere Erfahrung spielte bei einem<br />
Punkt auch mit. Ein Mann der Amstettener<br />
Feuerwehr brach vor Jahren bei<br />
einem Brandeinsatz durch eine Dachkuppel.<br />
Trotz aller Versuche, ihn herauszuziehen,<br />
hing er zu lange festgeklemmt in<br />
dem Loch. Seine Kameraden fanden einfach<br />
nichts, wo sie ihn anpacken konnten.<br />
Am Ende starb er sechs Tage später an<br />
seinen Verletzungen. Das Resultat dieser<br />
traurigen Erfahrung war, dass auf den<br />
neuen Overalls kräftige Schulterklappen<br />
mit Klett-Verschluss sind, die auch das<br />
volle Gewicht eines Mannes tragen können.<br />
So kann auch ein Verletzter relativ<br />
problemlos angehoben und aus der<br />
Gefahrenzone transportiert werden.<br />
Für das Material der Overalls griff man<br />
auf ein High-Tech-Markenprodukt zurück.<br />
Diese Stoffe gewährleisten eine ergonomische<br />
Schnittführung und damit eine bessereBewegungsfreiheit<br />
und – auch nicht<br />
unwichtig – ein sehr<br />
ansprechendes<br />
Design. Die Sachen<br />
sollen ja auch gerne<br />
getragen werden.<br />
Und auf jeden Fall<br />
gewährleisten Markenprodukte<br />
in<br />
Punkto Hitzeschutz,<br />
Isolation, Nässeschutz<br />
und Atmungsaktivität<br />
beste Ergebnisse.<br />
Das Resultat war ein<br />
Anzug, der in Tests<br />
Temperaturen von<br />
bis zu 1000 Grad Celsius<br />
zumindest für<br />
einige Sekunden aushielt.<br />
So lange, dass<br />
ein Mann „aus der<br />
Gefahrenzone springen“<br />
kann. Und<br />
«<br />
genau für solche Situationen trainieren<br />
die Freiwilligen ja auch regelmäßig. Auch<br />
das sogenannte „Hot-Fire-Training“ wurde<br />
mit den Overalls absolviert: bei 500 bis<br />
700 Grad für 20 Minuten in einem Container.<br />
Das will einmal ausgehalten sein!<br />
Die Übung<br />
In die neuen Overalls<br />
sind auch traurige Erfahrungen<br />
eingeflossen. An<br />
diesen Schulterklappen<br />
kann beispielsweise ein<br />
Mann problemlos aus<br />
einer Gefahrenzone<br />
gezogen werden.<br />
Armin Blutsch<br />
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr<br />
Amstetten<br />
Für diesen Tag stand eine Räumungsübung<br />
im örtlichen Einkaufszentrum auf<br />
dem Programm: starke Rauchentwicklung<br />
im Kaufhaus mit geordneter Evakuierung,<br />
Auffinden des Rauch-Herdes.<br />
Mit vollem Programm fuhren die Einsatzwägen<br />
zum Einsatzort – sie schafften<br />
es erstaunlicherweise gleichzeitig, dass<br />
der Verkehr mehr oder<br />
weniger ungehindert<br />
weiterfahren konnte –<br />
und bauten in kürze-<br />
ster Zeit eine funktionierende<br />
mobile Einsatzzentrale<br />
auf. Das<br />
Gebäude wurde evakuiert<br />
– nur ein paar<br />
Jugendliche mussten<br />
erst vom Ernst so<br />
einer Übung überzeugt<br />
werden – und<br />
dann ging es erst richtig<br />
los.<br />
Alle Lifte abgedreht –<br />
hinein in die beiden<br />
mehrstöckigen Komplexe<br />
– starke Sichtbehinderung<br />
durch dichten<br />
Rauch verwirrte anfangs – Armin<br />
Blutsch in Höchstform: Der Anpfiff für<br />
einen Jungmann ließ sich hören. Aber:<br />
„Er muss auch in solchen Situationen<br />
eine eigenständige<br />
«<br />
Auch das<br />
sogenannte<br />
„Hot-Fire-Training“<br />
wurde mit<br />
den Overalls<br />
absolviert: bei<br />
500 bis 700 Grad<br />
Celsius für 20<br />
Minuten in einem<br />
Container.<br />
Entscheidung treffen<br />
können. Und das<br />
schnell, sonst wird’s<br />
eng.“ Endlich: der<br />
Ausgangspunkt der<br />
Rauchentwicklung<br />
ist gefunden – das<br />
Problem wird beseitigt.<br />
Eine knappe Stunde<br />
später war alles vorbei,<br />
die Übung gut<br />
abgelaufen. Und für<br />
den „Feuerwehrhäuptling“<br />
Blutsch<br />
und seine Leute die<br />
beiden wichtigsten<br />
Punkte: die neuen<br />
Overalls hatten<br />
ihren Zweck erfüllt<br />
und die Leute konnten<br />
eine wirklichkeitsnahe<br />
Übung<br />
durchführen.
Wirtschafts-Info<br />
Öko-Förderungen der Länder<br />
Ideal für das Fertighaus<br />
Über 5.500 neue Fertighäuser werden im<br />
Schnitt pro Jahr in Österreich errichtet.<br />
Somit ist jedes dritte Ein- oder Zweifamilienhaus<br />
ein „industriell vorgefertigtes“<br />
Fertighaus. Gründe gibt es viele, warum<br />
sich immer mehr Österreicherinnen und<br />
Österreicher für die Fertigbauweise entscheiden:<br />
Die kurze Bauzeit, die einfache<br />
Abwicklung des Bauprojekts, der garantierte<br />
Fixpreis, die hohen Qualitätsstandards<br />
– und nicht zuletzt: Die hervorragenden<br />
Energiekennzahlen dieser Häuser.<br />
Die österreichischen Bundesländer richten<br />
die finanziellen Förderungen für den<br />
privaten Ein- und Zweifamilienhausbau<br />
immer stärker nach ökologischen<br />
Gesichtspunkten aus. Speziell gefördert<br />
werden alle Objekte, die wenig Energie<br />
verbrauchen und alternative Energieformen.<br />
Allein die in den Förderungsrichtlinien<br />
angegeben U-Werte können problemlos<br />
unterboten werden. Der Schritt<br />
zum Passivhaus ist da nur mehr ein kleiner.<br />
Bei solchen Rahmenbedingungen ist<br />
es nicht weiter verwunderlich, dass auch<br />
immer mehr kommunale und private<br />
76 KOMMUNAL<br />
Bauträger die Fertigbauweise für Reihenhausanlagen,<br />
mehrgeschossige<br />
Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten,<br />
Krankenhäuser und Bürogebäude entdeckt<br />
haben. Das Energieeinsparungspotenzial,<br />
die rasche Bauzeit und die<br />
Kosteneffizient überzeugen also nicht<br />
nur den privaten Bauplaner. 2002 wurden<br />
über 120 kommunale Gebäude, Reihenhausanlagen<br />
und Wohnhäuser in<br />
Fertigbauweise errichtet. Tendenz: steigend.<br />
„Förderungswürdige“<br />
Wärmedämmung<br />
Die Wärmedämmung ist bei allen Fertighäusern<br />
vorbildhaft: Werte zwischen<br />
0,15 und 0,25 W/m2 K für Außenwände<br />
sind heute bereits Durchschnitt.<br />
Fertighäuser können aufgrund der<br />
guten Wärmedämmung problemlos mit<br />
allen alternativen Energietechnologien<br />
ausgestattet werden. Das Spektrum<br />
reicht von passiver und aktiver Sonnen-<br />
Fertighaus von Griffner.<br />
energienutzung über Biomasse bis zu<br />
Wärmepumpen. Daher erfüllen Fertighäuser<br />
relativ leicht die Anforderungen<br />
der Eigenheimförderungen, die sich<br />
zumeist an den Energiekennzahlen des<br />
Hauses orientiert. Die Mitgliedsfirmen<br />
des Österreichischen Fertighausverbandes<br />
stellen ihren Kunden den für die<br />
Einreichung erforderlich Energieausweis<br />
aus und geben alle notwendigen<br />
Informationen.<br />
Informationen:<br />
Österreichischer Fertighausverband<br />
www.fertighaus.org<br />
E.E.<br />
Foto: Fertighausverband
Kostenlose Teilnahme für Fachbesucher am 20. Jänner 2005 in Flachau<br />
AZ-Tech Wintertagung 2005<br />
Der Winterdienst steht bei jedem Wintereinbruch<br />
im Blickpunkt der Öffentlichkeit,<br />
da jeder Bürger als Verkehrsteilnehmer<br />
unmittelbar von dem Ereignis<br />
betroffen ist. Bei Schneefall oder<br />
überfrierender Nässe ist die Effizienz<br />
der Winterdienstorganisation auf „dem<br />
öffentlichen Prüfstand“. Die Qualität<br />
des Winterdienstes stellt einen Kompromiss<br />
zwischen den Mobilitätsansprüchen<br />
der Gesellschaft und dem<br />
finanziell noch Vertretbaren dar.<br />
Bei der AZ-Tech Wintertagung im<br />
Flachauer Gutshof, beleuchten die Firmen<br />
AZ-Tech und die Firma KMV<br />
Bogner 2-Erfolgsfaktoren für den Winterdienst.<br />
◆ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
durch den Einsatz der passgenauen<br />
Maschinen und des passenden<br />
Zubehörs.<br />
◆ Umweltschutz auch im Winterdienst<br />
– Basis für den Erfolg der österreichischen<br />
Fremdenverkehrsgemeinden.<br />
AZ-Tech lädt Sie zu dieser Tagung herzlich<br />
ein. Die Teilnahme ist für Fachbesucher<br />
kostenlos.<br />
www.pewag.com<br />
MEHR BISS<br />
pewag Gleitschutzketten für jeden Einsatz geeignet<br />
wirtschaftlich – rasch – sicher<br />
Information und Anmeldung:<br />
Wirtschafts-Info<br />
Zeit: 20. Jänner 2005 von 10:00-16:00 Uhr<br />
Ort: Flachauer Gutshof, Pichlgasse 15,<br />
5542 – Flachau<br />
10:00 – 11:00: Eintreffen der Teilnehmer –<br />
„rustikales Salzburger Bauernfrühstück“<br />
11:00 – 11:45: Tagungseröffnung<br />
Begrüßung durch Ing. Michael Buchbauer,<br />
Grußworte des Flachauer Bürgermeisters Johann<br />
Weitgasser; Fachvorträge und Vorführungen zu<br />
folgenden Themen: Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch den „maßgeschneiderten<br />
Maschinenpark“; ISEKI <strong>Kommunal</strong>traktoren von 20 – 45 PS in Kombination mit<br />
Fräse/ Schneepflug/Streuer/Sprüher; MULTICAR Programm – Geräteträger mit<br />
Fräse/Pflug /Streuer; Fa. KMV Bogner – Beilhack-Schneepflüge für Österreichs<br />
Gemeinden; AEBI RASANT „Aus Österreich für Österrreich“; „Umweltschutz im Winterdienst“<br />
11.45 – 14.00: Praktische Demonstration der Maschinen und der Anbaugeräte im<br />
speziellen Testgelände<br />
ISEKI – MULTICAR – AEBI RASANT – BEILHACK (KMV Bogner)<br />
mit Sonderschau: Handgeführte CANADIANA Schneefräsen Modellvorschau für den<br />
Winter 2006<br />
14:00 – 16:00: Branchentreff-Winterdienst und Diskussion „Von Profi zu Profi“<br />
14:30: Flachauer Gutshof Schmankerl – mit musikalischer Begleitung<br />
Weitere Informationen unter http://www.az-tech.at<br />
Teilnahme kostenlos<br />
Anmeldung:<br />
02732/893-2310<br />
Hr. Riesenhuber<br />
KOMMUNAL 77
Wirtschafts-Info<br />
Thun: Gepflegtes Äußeres als Markenzeichen der Stadt<br />
Sauberkeit und Hygiene<br />
Sauberkeit und Hygiene gewinnen<br />
immer mehr an Bedeutung. Dessen<br />
werden sich zunehmend auch Leute<br />
bewusst, die nicht primär mit der Branche<br />
zu tun haben.<br />
Pflege des<br />
öffentlichen Raums<br />
Für die Verantwortlichen im Thuner<br />
Straßeninspektorat jedenfalls gehört<br />
78 KOMMUNAL<br />
Sauberkeit zum festen Bestandteil im<br />
Erscheinungsbild ihrer Stadt. Die Thuner<br />
Region gehört zu einer besonders<br />
beliebten Touristendestinationen der<br />
Schweiz. Die Stadt Thun hat über<br />
40.000 Einwohner. „Unsere Stadt halten<br />
wir nicht nur wegen der vielen Touristen<br />
sauber. Sauberkeit und Hygiene<br />
haben auch für uns alle in der Region<br />
Lebende einen besonderen Stellenwert“,<br />
betont Paul Flück, Straßeninspektor<br />
im Tiefbauamt der Stadt Thun.<br />
����<br />
����� ���<br />
����<br />
�� ��� ���������<br />
���������� ��<br />
���� ��������������� ��<br />
��������������������� �������<br />
������������������� ��<br />
�������������������<br />
���������� ��<br />
���������� �������<br />
�������������� ��<br />
���������������������<br />
���������� ��<br />
���� ����� ���� ��<br />
������������ �������<br />
��� �������������� ��<br />
Paul Flück, Straßeninspektor der Stadt<br />
Thun, im Gespräch mit Thomas Leben,<br />
Verkaufsberater bei Kärcher.<br />
Zusammen mit seinem Team von rund<br />
40 Mitarbeitern ist er u.a. für die<br />
Straßenreinigung, Abfallentsorgung,<br />
die Pflege von öffentlichen Räumen<br />
und den baulichen Unterhalt verantwortlich.<br />
Es wird täglich gereinigt<br />
und gepflegt. Das Ziel<br />
ist dabei, die vielseitigen Aufgaben<br />
möglichst effizient,<br />
wirtschaftlich und ohne Belästigung<br />
der Bewohner und<br />
Touristen zu erledigen.<br />
Damit sie ihre Aufgaben<br />
optimal ausführen können,<br />
stehen den Teams des<br />
Straßeninspektorats mehrere<br />
Maschinen und Geräte zur<br />
Verfügung. Zum technischen<br />
Equipment des Thuner Tiefbauamtes<br />
gehören seit<br />
geraumer Zeit auch zwei<br />
Kärcher-Saugkehrmaschinen<br />
vom Typ ICC 1 und ICC 2.<br />
Der Entscheid für diese Industrie-<br />
und City-Cleaner (ICC)<br />
fiel laut Flück aufgrund eines<br />
umfassenden Evaluationsverfahrens.<br />
Flück dazu: „Die<br />
Anforderungen wechseln oft<br />
und verlangen nach einem<br />
Gerät, das sich flexibel<br />
unterschiedlichen Gegebenheiten<br />
anpasst: auf Trottoirs<br />
sowie in Quartierstrassen.“<br />
Dabei müssen Hindernisse<br />
umfahren und Engpässe passiert<br />
werden, ohne dass<br />
Schmutz dort liegen bleibt.<br />
„Für Gemeinden und Städte,<br />
die sehr große Flächen kehren<br />
müssen, sind die beiden<br />
Industrie- und City-Cleaner<br />
ICC 1 und ICC 2 eine saubere<br />
Lösung“, hält Thomas<br />
Leben, Verkaufsberater bei<br />
Kärcher, fest. Sie seien<br />
besonders komfortabel in der<br />
Bedienung und zudem<br />
höchst wirtschaftlich und<br />
robust.<br />
Mehr auf:<br />
www.kaercher.at
Forum Rohstoffe entwickelte einzigartige Lehrkampagne<br />
Rohstoffgewinnung<br />
macht Schule<br />
Mineralische Rohstoffe bilden heute einen unverzichtbaren Bestandteil unserer<br />
Zivilisation. Jedoch die wenigsten Menschen wissen, wie umfassend der Einsatz<br />
unserer heimischen Bodenschätze ist und wie sie gewonnen werden.<br />
Die Unternehmen im Fachverband<br />
der Stein- und keramischen Industrie<br />
arbeiten deshalb seit einigen Jahren<br />
an Bildungsprojekten mit österreichischen<br />
Schulen, die den Schülern<br />
einen Einblick in die Welt der mineralischen<br />
Rohstoffe eröffnen.<br />
Durch Lehrbehelfe<br />
Öffentlichkeit schaffen<br />
Die gemeinsam mit dem WWF entwickelten<br />
Lehrbehelfe „Spuren im<br />
Sand“ und „Das Geheimnis vom<br />
Schwarzen Teich“ zeigen das Leben<br />
bedrohter Tierarten in aufgelassenen<br />
Sand- und Kiesgruben sowie Steinbrüchen,<br />
die dort neuen Lebensraum<br />
gefunden haben. Die erarbeiteten<br />
Schulpakete sollen Lehrer in die Lage<br />
versetzen, ihren Schülern alle Aspekte<br />
des Kreislaufes „Kulturlandschaft –<br />
Rohstoffgewinnung – Kulturlandschaft“<br />
näher zu bringen und die unterschiedlichsten<br />
Einsatzmöglichkeiten von<br />
mineralischen Rohstoffen aufzuzeigen.<br />
Vorzeigeprojekt in<br />
Kirchdorf an der Krems<br />
Foto: BG Kirchdorf<br />
Ein weiteres Schulprojekt wurde in<br />
Kirchdorf an der Krems gestartet. Wie<br />
spannend die Auseinandersetzung mit<br />
Rohstoffen und den im Bezirk Kirchdorf<br />
ansässigen Bergbauunternehmen<br />
sein kann, haben hier rund 60 Schülerinnen<br />
und Schüler des Gymnasiums<br />
Kirchdorf in den vergangenen Monaten<br />
bewiesen. Gemeinsam mit den<br />
Unternehmen Bernegger Bau, voestalpine<br />
Kalkwerk Steyrling und dem<br />
Kirchdorfer Zementwerk wurde ein<br />
Schulprojekt im Bundesoberstufenreal-<br />
Schüler des BG Kirchdorf auf Exkursion im Steinbruch.<br />
gymnasium Kirchdorf initiiert, das den<br />
Schülern der 5. bis 7. Klasse Oberstufe<br />
ermöglichte, sich mit verschiedensten<br />
Fragestellungen rund um das Thema<br />
„Rohstoffe“ intensiv auseinander zu<br />
setzen. So wurden die Schüler zu<br />
Betriebsbesichtigungen eingeladen,<br />
konnten Exkursionen in Steinbrüche<br />
unternehmen und mit Mitarbeitern der<br />
Unternehmen in Kontakt treten.<br />
Konkrete Projektergebnisse<br />
Die Schüler verarbeiteten ihre Eindrücke<br />
in sieben verschiedenen Unterrichtsfächern<br />
zu Vorträgen, Arbeitsmodellen,<br />
Ausstellungen und einem<br />
Video-Clip. Die Ergebnisse der insgesamt<br />
16 Einzelprojekte wurden vor<br />
versammelter Elternschaft und interessierten<br />
Gästen in der Aula des Gymnasiums<br />
präsentiert. Unter den prominenten<br />
Gästen befanden sich auch<br />
Nationalratsabgeordnete Dr. Maria<br />
Fekter und der Rektor der Montanuni-<br />
Wirtschafts-Info<br />
versität Leoben, Dr. Wolfhard<br />
Wegscheider.<br />
Praxisnähe und<br />
Karrierechancen<br />
Ziel dieses einzigartigen Bildungsprojektes<br />
ist die Förderung<br />
der praxisorientierten Projektarbeit<br />
in Schulen in Zusammenarbeit<br />
mit lokalen Wirtschaftsunternehmen,<br />
und die Aufklärung<br />
über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten<br />
in Rohstoffgewinnungs-<br />
und -verarbeitungsunternehmen<br />
in Österreich.<br />
Neuer Schulbehelf zum<br />
Thema Geologie<br />
Da sich die Aktivitäten im Rahmen der<br />
Bewusstseinsbildung rund um das<br />
Thema mineralische Rohstoffe als sehr<br />
erfolgreich und für beiden Seiten<br />
gewinnbringend erwiesen haben, hat<br />
das Forum Rohstoffe bereits das nächste<br />
Projekt in Angriff genommen. Mit<br />
dem vor kurzem vorgestellten neuen<br />
Schulbehelf zum Themenschwerpunkt<br />
Geologie können im Rahmen des<br />
Unterrichts Inhalte wie erdgeschichtliche<br />
Entwicklung, Vorkommen der Rohstoffe,<br />
Mengen und Einsatzmöglichkeiten<br />
ausführlich behandelt werden.<br />
Informationen:<br />
Forum Rohstoffe<br />
(Fachverband der Stein- und<br />
keramischen Industrie)<br />
Wiedner Hauptstraße 63<br />
1045 Wien<br />
Tel.: 0590 900 - 35 34<br />
KOMMUNAL 79<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
®<br />
HYDROVAR<br />
Spiralgehäusepumpen<br />
Block- und Inline Pumpen<br />
Mehrstufenpumpen<br />
Tauchmotorpumpen<br />
Druckerhöhungsanlagen<br />
Hydrovar Pumpenregler<br />
Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH<br />
A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2<br />
Telefon 02266/604, Telefax 02266/65311<br />
www.vogel-pumpen.com<br />
www.hydrovar.com<br />
Quality & Innovation - Made in Austria<br />
80 KOMMUNAL<br />
Bioenergie NÖ in Kooperation mit AGRAR PLUS<br />
„Gemeinsame Energie“ –<br />
Eine Komplettlösung<br />
Die Heizkosten sowie High-Tech<br />
in der Entwicklung von Holzkessel<br />
haben zu einer Renaissance<br />
des Brennstoffes Holz geführt.<br />
Bioenergie NÖ setzt bewusst auf<br />
örtliche Wärmedienstleister und<br />
stärkt sie mit dem System<br />
„Gemeinsame Energie“ als professionelle<br />
Lösung für Errichtung<br />
und Betrieb von Bioenergieanlagen.<br />
Bioenergie NÖ arbeitet nach diesem<br />
von AGRAR PLUS entwickelten<br />
Qualitäs-Standard.<br />
Unter Einbeziehung von mittlerweilen<br />
100 Land- und Forstwirten wurden seit<br />
August 2003, 9 Projekte über Bioenergie<br />
NÖ umgesetzt. Langfristige Absicherung,<br />
Online-Störungsmeldesysteme,<br />
Partner vor Ort für Service und Wartung<br />
sowie eine ausgeklügelte Rohstofflogistik<br />
geben dem Kunden Komfort,<br />
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.<br />
Dadurch kann mit Bioenergie NÖ<br />
sichergestellt werden, dass die Wärmenutzung<br />
langfristig sicher, sehr bequem<br />
Brandschutz-Seminar von ACO-Passavant<br />
Wohnhausanlage in Texing.<br />
Teuren Folgen vorbeugen<br />
In einem kürzlich stattgefundenen Brandschutzseminar<br />
von ACO Passavant kamen<br />
Praktiker des vorbeugenden Brandschutzes<br />
zu Wort. Fachplaner der Haustechnik<br />
informierten sich über die Möglichkeiten,<br />
mit einfachen und kostengünstigen<br />
Vorkehrungen teuren Folgen im<br />
Brandfall vorzubeugen.<br />
Als Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung<br />
stellte Univ.-Lektor Dr. Otto Widetschek,<br />
Branddirektor der Stadt Graz a.D.,<br />
zur Diskussion, ob der Brandschutz in<br />
Österreich ein Stiefkind sei. Als „Todsünden<br />
des Brandschutzes“ wurden beispielsweise<br />
zu große Brandabschnitte, mangelnder<br />
baulicher Brandschutz sowie zu<br />
große Kunststoffanteile im Bauwerk<br />
genannt.<br />
Anschließend zeigte Ing. Alfred Pölzl,<br />
Referatsleiter der Feuerpolizei Graz, mit<br />
praktischen Beispielen die Möglichkeiten<br />
für den vorbeugenden Brandschutz auf.<br />
Im Mittelpunkt standen die Durchführungen<br />
von Rohren und Kabeln durch<br />
Brandschutzwände und Decken.<br />
DI Thomas Meyer, Produktmanager von<br />
ACO Passavant Gebäudeentwässerung,<br />
demonstrierte, wie einfach die Verwendung<br />
von geprüften Brandschutzboden-<br />
und kosteneffizient erfolgt.<br />
Rufen Sie uns an, wir bieten Ihnen<br />
Kompetenz, Erfahrung und Know-how.<br />
Informationen:<br />
Bioenergie NÖ reg. GenmbH<br />
„Gemeinsame Energie“<br />
c/o AGRAR PLUS GmbH<br />
Bräuhausgasse 3<br />
3100 St. Pölten<br />
Ing. Josef Streißelberger<br />
Ing. Christian Mayerhofer<br />
Tel.: 02742/352234 Fax.: DW 4<br />
abläufen ist.<br />
Damit werden<br />
die vorgefertigten<br />
Löcher in<br />
der Brand- Das ACO FIT IN Einbau-Set<br />
abschnittsdecke<br />
zuverlässig gegen Rauch- und<br />
Brandübertragung geschützt. Interessiert<br />
aufgenommen von den Fachplanern<br />
wurde die Möglichkeit, über die Verwendung<br />
von Brandschutzkartuschen und -<br />
geruchsverschlüssen rasch und kostengünstig<br />
bestehende Bodenabläufe von<br />
ACO Passavant brandschutzsicher bis F90<br />
zu machen.<br />
Die Veranstaltung zeigte, dass im Bereich<br />
Brandschutz ein enormer Aufholbedarf<br />
besteht. Insbesondere der Schutz von<br />
Deckendurchbrüchen aufgrund Bodenabläufe<br />
wurde bis jetzt unterschätzt. Mit<br />
einfachen Mitteln ist dies nun jedoch<br />
ermöglicht worden, passende Einbausets<br />
sparen darüber hinaus Zeit auf der Baustelle.<br />
Fachartikel zu der Veranstaltung stehen<br />
als Download auf www.aco-passavant.at<br />
zur Verfügung.<br />
E.E.
Sportbetrieb braucht Engagement der Funktionäre<br />
Sport Cristall-Gala<br />
„Engagierte Funktionäre<br />
ermöglichen einen funktionierendenSportbetrieb“,<br />
so Ernst H. Aichinger,<br />
Obmann des Bundes-<br />
Foto: gepa<br />
gremiums des Sportartikelhandels<br />
der Wirtschaftskammer<br />
Österreich<br />
(WKÖ). Der WKÖ-Vertreter<br />
überreichte gemeinsam<br />
mit Franz Löschnak, Präsident<br />
der Bundes-Sportorganisation<br />
(BSO), die vom Sportartikelhandel<br />
gestiftete Sport Cristall-Trophäe in der<br />
Kategorie „Funktionär des Jahres 2004“<br />
an Leo Wallner, Präsident des Österreichischen<br />
Olympischen Comités<br />
(ÖOC) und Mitglied des Internationalen<br />
Olympischen Comités (IOC). Die<br />
Sport Cristall-Gala wurde von der Bundes-Sportorganisation<br />
und dem Staatssekretariat<br />
für Sport bereits zum sechsten<br />
Mal veranstaltet. Insgesamt wurde<br />
der Sport Cristall 2004 in 5 Kategorien<br />
vergeben.<br />
Neben Leo Wallner wurden damit ausgezeichnet:<br />
Leo Wallner wurde als<br />
„Funktionär des Jahres<br />
2004“ ausgezeichnet.<br />
Einzigartig bei Österreichs Fastenspezialisten<br />
Gratispaket für „Gesundheit und<br />
Schönheit von innen“<br />
Die RING<br />
Gesundheitsund<br />
Schönheits-<br />
Hotels befassen<br />
sich schon seit<br />
rund 30 Jahren<br />
mit Übergewicht<br />
und Fettleibigkeit,<br />
Grund für<br />
viele ernsthaften<br />
Erkrankungen.<br />
Dabei konnte<br />
bereits vielen<br />
Menschen der<br />
Weg zu einer<br />
gesünderen Gesund und schön.<br />
Lebensweise aufgezeigt<br />
und so zu einem Lebensstil mit<br />
mehr Gesundheit und Wohlbefinden<br />
verholfen werden.<br />
Um noch mehr Menschen einen preisgünstigen<br />
Zugang zu den einzigartigen<br />
Gesundheitsangeboten zu ermöglichen,<br />
gibt es ab sofort ein „Gratispaket für<br />
Gesundheit und Schönheit von innen“,<br />
◆ Margit Rader, Obfrau der<br />
Sportunion Villach, Mitglied<br />
der Sportunion-Bundesleitung<br />
und Bundesreferentin für Fitness,<br />
Wellness und Gesundheitssport<br />
sowie Mental- und<br />
Koordinationstrainerin des<br />
Auswahlteams im Kärntner<br />
Fußballverband, als „Top-<br />
Funktionärin des Jahres 2004“<br />
◆ Der SVS Schwechat als<br />
„Top-Verein 2004“: Er weist mit Athletinnen<br />
und Athleten wie Karin Mayr-<br />
Krifka, Markus Rogan, Werner Schlager,<br />
Leo Hudec u.a. die österreichweit höchste<br />
Dichte an Ausnahmesportlern auf.<br />
◆ Als „Top-Trainerpersönlichkeiten<br />
2004“ Georg Fundak, Jan Steven<br />
Johannessen, Günter Amesberger und<br />
Florian Pernhaupt, das Coaching-Team<br />
der erfolgreichen österreichischen<br />
Segelmannschaft.<br />
◆ Die Auszeichnung für Top-Frauenpower<br />
im Sport ging an den Wiener Fußballverband<br />
für die Durchführung des<br />
2. Wiener Tages des Mädchenfußballs.<br />
Mehr auf www.wko.at<br />
in dem verschiedene medizinische<br />
Maßnahmen und Therapien nach F.X.<br />
Mayr im Wert von rund € 190/Woche<br />
inkludiert sind. Es ist erwiesen, dass<br />
eine Fasten- und Ernährungsumstellung<br />
mit RING Vollwert-Glyxdiät zusammen<br />
mit den verschiedenen Möglichkeiten<br />
nach F.X Mayr, sowie den vielen Fitness-<br />
und Bewegungsangeboten einen<br />
nachhaltigen Erfolg, ohne Jo-Jo-Effekt,<br />
bringen.<br />
Informationen:<br />
RING Gesundheitszentrum Hartberg<br />
A-8230 Hartberg<br />
Tel. 03332/ 608-0<br />
Fax: 03332/ 608-550<br />
hartberg@ringzentrum.at<br />
RING Gesundheitszentrum<br />
Sonntagsberg<br />
A-8271 Bad Waltersdorf<br />
Tel. 03333/ 2981-0<br />
Fax: 03333/ 2981-550<br />
badwaltersdorf@ringzentrum.at<br />
E.E.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Umwelt. Energie.<br />
Betrachten Sie<br />
besser beides.<br />
08. bis 11. März 2005<br />
Besuchen Sie zwei richtungsweisende<br />
Fachmessen in den Bereichen Umwelt<br />
und Energie für Kommunen, Behörden<br />
und öffentliche Verwaltungen.<br />
Neben den Ausstellungen erwartet Sie<br />
ein hochwertiges, internationales Fachprogramm<br />
u.a. zum Erfahrungsaustausch<br />
zwischen West- und Osteuropa.<br />
Kontakt: Robert Mittermann<br />
Telefon: + 43 (0)1 - 285 75 85-0<br />
E-Mail: mittermann@A1.net<br />
KOMMUNAL 81
Wirtschafts-Info<br />
Große Akzeptanz für kommunalnet.at<br />
Innovatives Intranet für<br />
Österreichs Gemeinden<br />
Bereitstellung, Benutzerverwaltung und Betrieb kommen von der Bundesrechenzentrum<br />
IT-Solutions GmbH.<br />
Der offizielle Launch von kommunalnet.at,<br />
dem Intranet der österreichischen<br />
Gemeinden, ging Mitte September diesen<br />
Jahres über die Bühne. „Mittlerweile<br />
kann die Plattform von allen Bürgermeistern<br />
und Amtsleitern genutzt werden<br />
und erfreut sich großer Akzeptanz“,<br />
berichtet der Geschäftsführer der Bundesrechenzentrum<br />
IT-Solutions GmbH<br />
(BIT-S), Albert Kronberger.<br />
Albert Kronberger, Geschäftsführer der<br />
Bundesrechenzentrum IT-Solutions<br />
GmbH (BIT-S).<br />
Das große Interesse verwundert nicht,<br />
denn kommunalnet.at, so Kronberger,<br />
bringt den Gemeinden eine Reihe von<br />
Vorteilen: „Dieses Portal eröffnet allen<br />
Bürgermeistern und befugten<br />
Gemeinde-Mitarbeitern Zugang zu wichtigen<br />
behördlichen Datenbanken. So<br />
kann über kommunalnet.at z.B. auf das<br />
zentrale Melderegister, auf das Grundbuch,<br />
das Gewerberegister, aber auch<br />
auf Angebote Dritter wie z.B. die Services<br />
des Kreditschutzverbandes zugegriffen<br />
werden. Früher war dafür jeweils<br />
82 KOMMUNAL<br />
ein eigener Account nötig – jetzt läuft<br />
alles über einen einzigen Zugang – über<br />
kommunalnet.at.“<br />
In den regionalisierten Bereichen gibt es<br />
außerdem Angebote, die auf die jeweilige<br />
Region, in der sich die Gemeinde<br />
befindet, zugeschnitten sind. In den<br />
Fach- und Diskussionsforen können die<br />
Gemeinden ihre Erfahrungen über<br />
diverse Projekte austauschen und Problemstellungen<br />
diskutieren. Weiters gibt<br />
es Steuer-Tipps, Veranstaltungskalender,<br />
Routenplaner, ein Adressbuch und noch<br />
Vieles mehr. Zusammengefasst ermöglicht<br />
kommunalnet.at den Gemeinden<br />
einen kostengünstigen Einstieg ins<br />
E-Government und erleichtert die interkommunale<br />
Zusammenarbeit. Für nur<br />
49,50 Euro im Monat können die<br />
Gemeinden zahlreiche E-Government<br />
Anwendungen und Datenbanken nutzen.<br />
Fünf Zugänge zum Intranet-Arbeitsplatz<br />
stehen dabei jeder Gemeinde zur<br />
Verfügung.<br />
Das Bundesrechenzentrum ist der<br />
E-Government Partner der österreichischen<br />
Verwaltung. Der Schwerpunkt der<br />
Geschäftstätigkeit des Tochterunternehmens<br />
BIT-S GmbH liegt im Bereich von E-<br />
Government Services für Gemeinden und<br />
beinhaltet die Bereitstellung, Benutzerverwaltung<br />
und den Betrieb von kommunalnet.at.<br />
Die BIT-S GmbH kann dabei<br />
auf die langjährige Erfahrung und die<br />
Ressourcen der BRZ GmbH zurückgreifen.<br />
„Als Betreiber dieser Lösung können<br />
wir das E-Government Geschehen in<br />
allen österreichischen Gemeinden maßgeblich<br />
unterstützen“, freut sich Albert<br />
Kronberger. „Wir stellen den Gemeinden<br />
einen Standard-Intranet-Arbeitsplatz zur<br />
Verfügung. Dieses Projekt ist europaweit<br />
einzigartig und stellt einen wesentlichen<br />
Schritt in Richtung gelebtes E-Government<br />
in der <strong>Kommunal</strong>verwaltung dar“,<br />
so Kronberger weiter.<br />
Die BIT-S GmbH hat es sich zur Aufgabe<br />
gemacht, für die österreichischen<br />
Gemeinden die Durchgängigkeit des<br />
E-Government von der Bundesverwaltung<br />
bis zum Bürger in den Gemeinden<br />
sicherzustellen. Die Kooperation im Rahmen<br />
von kommunalnet.at ist ein Meilenstein<br />
zur Realisierung dieses Zieles.<br />
Für die Bereitstellung und den Betrieb<br />
von kommunalnet.at setzt die BIT-S<br />
GmbH auf moderne Technologien, die<br />
sich bereits beim „Portal Austria Service“<br />
bewährt haben.<br />
Weiters sorgt die BIT-S GmbH dafür,<br />
dass Gemeinden einen Zugang zu den<br />
Bundesapplikationen erhalten und<br />
zusätzliche Services weiterer Anbieter<br />
implementiert werden können.<br />
<strong>Kommunal</strong>net.at wurde von den Umsetzungspartnern<br />
<strong>Kommunal</strong>net E-Government<br />
Solutions GmbH, BIT-S GmbH und<br />
Telekom Austria AG dezidiert für die<br />
Gemeinden realisiert. Darüberhinaus ist<br />
auch der Nutzen für die Bürger hervorzuheben:<br />
Verwaltungsabläufe können<br />
einfacher und schneller durchgeführt<br />
werden. Dieser positive „Nebeneffekt“<br />
wurde bei der Projektpräsentation<br />
Anfang November auch von Innen- und<br />
Gemeindeminister Dr. Ernst Strasser<br />
betont.<br />
Information<br />
BRZ IT-Solutions GmbH, Hintere<br />
Zollamtsstraße 4, 1030 Wien<br />
Tel: 01/71123 3636<br />
Fax: 01/71123 3600<br />
www.bit-s.at<br />
office@bit-s.at<br />
E.E.
Telekom Austria mit Messeauftritt sehr zufrieden<br />
Mit der KOMMUNALMESSE und dem<br />
Interesse der kommunalen Entscheidungsträger<br />
sehr zufrieden ist die Telekom<br />
Austria, die auf ihrem Messestand<br />
über den bargeldlosen Zahlungsverkehr<br />
in der öffentlichen Verwaltung informierte.<br />
Gäste beim Telekom Austria -<br />
Stand waren neben zahlreichen <strong>Kommunal</strong>politikern<br />
u.a. die Bundesminister<br />
Josef Pröll und Ernst Strasser sowie<br />
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer.<br />
Mit neuen, komfortablen Zahlungsmitteln<br />
soll der Zahlungsvorgang<br />
zwischen Bürger und Verwaltung<br />
ermöglicht und die Durchführung von<br />
Verwaltungsverfahren auf voll elektronischem<br />
Wege zugelassen werden.<br />
Mit Datacash und Aircash bietet die<br />
Telekom Austria die<br />
Komplettlösung auch für<br />
Gemeinden an. Die Bankomat-Kassen<br />
sind<br />
bereits in einigen<br />
Gemeinden und Stadtgemeinden<br />
im Einsatz,<br />
z.B. im Fundamt, Passamt,<br />
der Bücherei, im<br />
Bereich der Stadtpolizei,<br />
der Kulturzentren oder<br />
zum Einheben verschiedenster<br />
Gebühren.<br />
Unter dem Motto „Mehr<br />
Bürgernähe – mehr Servicequalität“<br />
werden<br />
Zahlungsvorgänge zwischen<br />
der Gemeinde<br />
und dem Bürger komfortabler<br />
und einfacher.<br />
Mehr Bürgernähe und<br />
Servicequalität<br />
Bargeldlos zahlen mit Datacash und<br />
Aircash der Telekom Austria bringt eine<br />
Reihe von Vorteilen auch für die kommunale<br />
Verwaltung: bargeldlos zahlen<br />
bedeutet mehr Service am Bürger, es<br />
bedeutet weniger Aufwand und mehr<br />
Sicherheit durch die elektronische<br />
Abwicklung, es erspart das Hantieren<br />
Wirtschafts-Info<br />
Mobile Bankomat-Kasse<br />
für die Gemeinde<br />
Aircash, die mobile Bankomat-Kasse.<br />
Die IT-Sektion des Finanzministeriums<br />
Die IT-Sektion des Bundesministeriums<br />
für Finanzen ist für den gesamten Zahlungsverkehr<br />
des Bundes zuständig und<br />
schließt für bargeldlose Zahlungsformen<br />
Verträge mit den Zahlungsmittelanbietern<br />
und Providern für die öffentliche<br />
Verwaltung ab. Bund, Länder,<br />
Städte, Gemeinden und sonstige öffentliche<br />
Rechtsträger können diese zu den<br />
günstigen Konditionen nützen. Im<br />
Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs<br />
wurden u.a. Vereinbarungen mit<br />
verschiedenen Kartenorganisationen<br />
sowie der Telekom Austria abgeschlossen.<br />
Seit geraumer Zeit werden auf Basis<br />
dieser Vereinbarungen in vielen Dienststellen<br />
der öffentlichen Verwaltung<br />
Debit- und Kreditkarten akzeptiert<br />
(siehe www.bmf.gv.at -> E-Government<br />
-> E-Zahlungsverkehr der<br />
öffentlichen Verwaltung).<br />
Organmandate<br />
Durch die Koordination des Bundesministeriums<br />
für Finanzen akzeptieren die<br />
gesamte Exekutive für Organmandate,<br />
Sicherheitsleistungen und sonstige Verwaltungsübertretungen<br />
seit dem Jahre<br />
Auch der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes,<br />
Bgm. Helmut Mödlhammer, und sein Generalsekretär, HR<br />
Dr. Robert Hink, besuchten den Stand von Telekom Austria.<br />
mit Bar- und Wechselgeld und man hat<br />
durch automatisierte Kartenumsätze<br />
mehr Überblick.<br />
Aircash hat jetzt ein besonderes<br />
Angebot: 3 Terminals zum Preis von<br />
2, gültig bis 31.12.2004, maximal für<br />
zehn Bankomat-Kassen je Kunde.<br />
Mehr Informationen erhalten Sie<br />
unter 0800 100 800 oder<br />
http://business.telekom.at<br />
2002 Kreditkartenzahlungen!<br />
Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb<br />
über ein halbes Jahr bei der Polizeidirektion<br />
Wien, der Verkehrsabteilung<br />
Imst und dem Gendarmerieposten Sollenau<br />
ist nunmehr in Zusammenarbeit<br />
mit dem Innenministerium und den<br />
Ländern der Einsatz von über 1.000<br />
mobilen Bankomat-Kassen bei der<br />
Exekutive geplant.<br />
Informationen:<br />
zahlungsverkehr@bmf.gv.at<br />
KOMMUNAL 83
Wirtschafts-Info<br />
Jede Gemeinde soll ein SIZ werden<br />
Drei Jahre Dach der Sicherheit<br />
Immer mehr Gemeinden entscheiden<br />
sich für ein Sicherheitsinformationszentrum.<br />
Und die etablierten „SIZ“ werden<br />
immer besser! Zum dritten<br />
Jahrestag des Projekts fällt<br />
diese Bilanz mehr als positiv<br />
aus.<br />
Leben für die<br />
Sicherheit<br />
Jeden Tag stellen Zehntausende<br />
hauptberufliche und<br />
freiwillige Profis ihr Können<br />
und oft auch ihr Leben in den<br />
Dienst der Sicherheit. Sie<br />
machen damit Österreich zu dem, was<br />
es ist: zu einem der sichersten Länder<br />
Europas.<br />
Allerdings: So unschätzbar der Einsatz<br />
von 35.000 Beamten und der professionellen<br />
Helfer aller anderen Sicherheitsund<br />
Hilfsorganisationen ist, so sehr<br />
muss uns bewusst sein, dass Sicherheit<br />
und Hilfe gesamtgesellschaftliche Aufga-<br />
84 KOMMUNAL<br />
ÖZSV-Präsident Anton<br />
Gaál: „Vorsorgen heißt<br />
Leben retten!“<br />
Innenminister Dr. Ernst Strasser:<br />
„Information und Wissen<br />
sind der beste Schutz!“<br />
ben sind. Aus diesem Grund hat Bundesminister<br />
Strasser vor drei Jahren die<br />
Profis des Österreichischen Zivilschutzverbandes<br />
mit der Organisation und<br />
Betreuung der „Sicherheits-Informations-Zentren“,<br />
kurz SIZ, beauftragt. „Wir<br />
sehen als verlängerter Arm des BM.I<br />
unsere Aufgabe darin, in allen 2359<br />
österreichischen Gemeinden SIZ als<br />
Info-Points für die Bürger zu allen<br />
Fragen der Sicherheit einzurichten“,<br />
erklärt Präsident Anton Gaál, „wobei<br />
der Schwerpunkt in der Hilfestellung<br />
bei den einzelnen Landesverbänden<br />
liegt.“<br />
Sicherheit-<br />
Informations-Zentren<br />
Der Schlüssel dazu aber sind die SIZ,<br />
in denen jeder Österreicher Rat und<br />
Information zu allen Sicherheitsfragen<br />
erhält. Erfolgreich vermarktet<br />
werden die SIZ unter einem bundesweiteinheitlichem<br />
Logo und<br />
mit Europas größter<br />
Sicherheitsdatenbank<br />
im Internet:<br />
www.siz.cc<br />
Informationen:<br />
www.zivilschutzverband.at<br />
Transporte<br />
Entsorgung<br />
Kanalservice<br />
Fam. Hödl Ges.m.b.H.<br />
Kanal und Tankkesselreinigung<br />
Behebung von Verstopfungen<br />
Senkgrubenreinigung<br />
Öl und Benzinabscheiderreinigung<br />
Kläranlagenbetreuung<br />
Tel.02215/2214 Fax<br />
DW 21<br />
0-24 h Notruf<br />
0664/1313804<br />
www.hoedl-wittau.at<br />
<br />
E.E.
Als mutigen und zukunftsweisenden<br />
Schritt feierten im Juli 2001 Medien<br />
und Wirtschaft den Schritt der Stadt Villach<br />
ihre städtischen Entsorgungsbetriebe<br />
aus der Verwaltung auszugliedern.<br />
In Kooperation mit dem größten<br />
privaten Entsorger Österreichs der Saubermacher-AG<br />
aus Graz wurde das<br />
Unternehmen „Villacher Saubermacher<br />
GmbH“ gegründet.<br />
Qualität garantiert<br />
Villachs Bürgermeister Helmut Manzenreiter<br />
initiierte dieses PPP-Modell, in<br />
dem beide Partner zu 50% vertreten<br />
sind, mit der Absicht, gegenüber künftigen<br />
EU-Bestimmungen in der Abfallwirtschaft<br />
besser gerüstet zu sein. „Der<br />
hohe Servicegrad eines kommunalen<br />
Dienstleisters wurde verbunden mit privatwirtschaftlichem<br />
Know-how“, erklärt<br />
Bürgermeister Manzenreiter das Erfolgsgeheimnis.<br />
Neue Technik als<br />
Erfolgsfaktor<br />
Der neue Schörling Müllwagen von GAT<br />
erledigt zukünftig ein Achtel der rund<br />
575 000 Entleerungen und gewährleistet<br />
bei den Gewerbebetrieben zusätzlich eine<br />
sofortige Verwiegung vor Ort von 120-<br />
Liter-Behältern bis zu 5-Kubikmeter-Containern.<br />
Darüber hinaus ladet das Fahrzeug<br />
bis zu 14000 kg Restabfall und das<br />
äußerst leise, da der Aufbau der EU<br />
Wirtschafts-Info<br />
Erfolgreiches Publice-Private-Partnership in Villach<br />
Besser gerüstet in der Abfallwirtschaft<br />
Norm 2000/14 entspricht. Die Gewerbekunden<br />
des Saubermacher loben den<br />
Einsatz dieses modernen Müllwagens.<br />
Neue Geschäftsfelder<br />
Die Villacher Saubermacher haben sich<br />
am Markt bereits nicht nur behauptet,<br />
sondern sind dabei Ihre Geschäftsfelder<br />
im Oberkärntner Raum auszubauen. Die<br />
neue GmbH ist bereits Regionalpartner<br />
der ARGE-V und positioniert sich zunehmend<br />
als Entsorger von betrieblichen<br />
Abfällen und Problemstoffen. Weitere<br />
Geschäftsfelder sind die Kanalreinigung,<br />
Fäkalienabfuhr sowie die Grünschnittkompostierung<br />
und Erzeugung von<br />
Komposterde. Gemeinsam mit den 60<br />
Mitarbeitern sind die Weichen auf<br />
Expansionskurs gestellt.<br />
Informationen:<br />
V.l.n.r.: GF Mag. Michael Überbacher,<br />
GAT GesmbH<br />
Wolf-Dieter Primavesi, Bürgermeister<br />
1220 Wien - Percostrasse 22<br />
Helmut Manzenreiter, GF Mag. Walter<br />
Tel: 0043-1-258 9990 Fax -9<br />
Eggerund drei Mitarbeiter der Villacher<br />
E-Mail: office@gat.at<br />
Saubermacher GmbH. E.E.<br />
VA TECH ELIN EBG<br />
ENERGIEVERSORGUNG – VERKEHRSTECHNIK – UMWELTTECHNIK<br />
KOMMUNALE<br />
INFRASTRUKTUR<br />
Das moderne Leben bedient sich vieler Netzwerke. Verkehr, Energie, Kommunikation, Ver- und Entsorgung. Das Know-how,<br />
das wir als Infrastrukturpartner dazu anbieten, hat sich im In- und Ausland bestens bewährt. Wir haben die Erfahrung und die<br />
Dienstleistungskompetenz für wirtschaftliche Lösungen. Und wir haben die Energiemanagement- und Betriebsführungssysteme<br />
dazu. Vernetztes Denken schafft neue Perspektiven. Power on. www.vatechelinebg.at<br />
sustainable solutions. for a better life.
Wirtschafts-Info<br />
Communication Systems Mussnig<br />
Info-Systeme mit neuer DOT-LED-Technologie<br />
C-S-M ist ein junges, dynamisches<br />
Unternehmen, verfügt<br />
aber bereits über vielfältige<br />
Erfahrungen im Elek-<br />
Bei Ihren<br />
Mazda-Partnern.<br />
www.mazda.at<br />
86 KOMMUNAL<br />
tronikbereich.Verantwortlich dafür zeichnet ein<br />
Team, das schon seit 6 Jahren<br />
erfolgreich auf diesem<br />
Gebiet tätig<br />
ist. Durch den<br />
hohen Wissensstand<br />
und<br />
das umfangreicheKnowhow<br />
kann<br />
jeder Kunde<br />
kompetent<br />
beraten werden.<br />
Durch die<br />
Entwicklung<br />
der neuen<br />
DOT-LED –<br />
Technologie<br />
ist es gelungen,entscheidende<br />
Vorteile<br />
bestehender<br />
Anzeigesysteme<br />
zu bündeln<br />
und dadurch eine optimale<br />
Lesbarkeit bei Tag und<br />
bei Nacht zu erreichen. Der<br />
Vorteil dieser Technologie<br />
Außen hart, innen weich.<br />
liegt darin, dass jeder Bildpunkt<br />
zusätzlich mit einer<br />
superhellen Leuchtdiode<br />
ausgestattet wird, die auch<br />
bei diffusen Lichtverhältnissen<br />
und während der Nacht<br />
eine optimale Lesbarkeit<br />
garantiert.<br />
Ob Schnee oder Eis, Regen<br />
oder Nebel, Sonnenlicht oder<br />
Dunkelheit – die Dot-Led-<br />
Technologie von C-S-M hält,<br />
was andere versprechen!<br />
Informationen:<br />
Communication Systems<br />
Mussnig<br />
Wilhelm-Eich-Straße 2<br />
A-9500 Villach<br />
Tel.: 04242/30701-0<br />
Fax: 04242/30701-15<br />
E-Mail: office@c-s-m.at<br />
www.c-s-m.at<br />
Symbolfoto<br />
Mazda B-2500, der robuste Pickup mit komfortabler PKW-Atmosphäre. Jetzt schon ab e 13.200,- (exkl. MwSt.)<br />
E.E.
Team Ing. Gruber: Das junge Unternehmen aus Tulbing/NÖ<br />
Innovative Abfallaufbereitung<br />
Die Firma TEAM Ing. Gruber<br />
GmbH konnte im letzten<br />
Jahr wieder mehrere innovativeAbfallaufbereitungsanlagen<br />
errichten. Mitte 2003<br />
wurde die Sortieranlage der<br />
Firma Saubermacher in Graz<br />
mit einem Windsichter und<br />
Förderbändern für das Restmüllsplitting<br />
adaptiert. Ende<br />
2003 konnte die Aufberei-<br />
tungsanlage für die Firma<br />
A.S.A in Tainach erfolgreich<br />
in Betrieb genommen werden.<br />
Im Frühjahr 2004 folgte<br />
die Inbetriebnahme einer<br />
Splittinganlage für die Firma<br />
Häusle. Dort werden sogar<br />
fünf verschiedene Fraktionen<br />
bei einer Durchsatzleistung<br />
von 35 t/h erzeugt. Im Sommer<br />
2004 folgte der erfolg-<br />
reiche Umbau der<br />
Aufbereitungsanlage der<br />
AEVG Graz. Als besondere<br />
Innovation gilt sicher auch<br />
die Erweiterung der Papiersortieranlage<br />
der Firma EWB<br />
mit Scanner- Sortierautomaten.<br />
Zusammen ein beachtlicher<br />
Erfolg für das junge<br />
Unternehmen aus Tulbing/<br />
NÖ.<br />
Papiersortieranlage von Team Gruber.<br />
Umfassende Serviceleistungen der gemdat<br />
Mit innovativen Lösungen Kosten sparen<br />
Ein Netzwerk an Anbietern<br />
moderner und zukunftsorientierter<strong>Kommunal</strong>lösungen<br />
präsentierte auf der<br />
<strong>Kommunal</strong>messe eine breite<br />
Palette an interessanten Produkten.<br />
Bürgerportal<br />
Bürgerservice rund um die<br />
Uhr. www.buergerportal.at<br />
ist eine moderne und ausgereifteE-Government-Anwendung<br />
für Österreichs<br />
Gemeinden und Bürger. Das<br />
Portal ermöglicht es den<br />
Bürgern und der Wirtschaft<br />
Behördenwege<br />
online<br />
zu erledigen.<br />
Keine Vorschreibung<br />
auf Papier,<br />
kein Zahlschein<br />
flattert<br />
ins Haus,<br />
alles spielt<br />
www.buergerportal.at<br />
sich einschließlich der Überweisung<br />
über Internet ab.<br />
So werden Versand- und<br />
Portokosten gespart. Zahlreiche<br />
Online-Formulare ergänzen<br />
das Leistungsangebot.<br />
Software nutzen<br />
statt kaufen<br />
Software nutzen statt kaufen<br />
– bereits mehr als 150<br />
Gemeinden in Niederösterreich<br />
nutzen das ASP-Center<br />
der gemdat NÖ. Ob Lohnverrechnung,<br />
Buchhaltung,<br />
Meldewesen – die Vorteile<br />
zentraler Datenhaltung<br />
und Softwarebereitstellung<br />
liegen auf der Hand:<br />
Investitionsschutz,<br />
hohe Verfügbarkeit,<br />
Sicherheit auf allen<br />
Ebenen und vor<br />
allem Zeit- und<br />
Kosteneinsparungen.<br />
RIS-<strong>Kommunal</strong><br />
Umfassendes Bürgerservice<br />
umfasst auch eine<br />
professionelle Homepage,<br />
mit dem CMS RIS<br />
<strong>Kommunal</strong> der Firma RIS<br />
GmbH. präsentieren sich<br />
mittlerweile mehr als 800<br />
Gemeinden Österreichs im<br />
Internet.<br />
Geodaten<br />
Im Bereich geografischer<br />
Daten präsentierte die grafotech<br />
als Spezialist für Geodaten<br />
und Geografische<br />
Informationssysteme seine<br />
umfangreiche Leistungen.<br />
Von der Erstellung digitaler<br />
Grundkarten und Naturstandsdaten<br />
bis hin zu innovativenFinanzierungsformen<br />
durch Datenmehrfachnutzung<br />
sowie professionelles<br />
Projektmanagement<br />
reicht das qualitativ hoch-<br />
Informationen:<br />
TEAM ING. GRUBER<br />
GMBH<br />
Ing. Leopold Gruber<br />
Gewerbestraße 10<br />
A-3434 Tulbing<br />
Tel. : 02273/70075-0<br />
Fax: 02273/70075-5<br />
wertige<br />
Angebot.<br />
Für die<br />
Visualisierung,<br />
Analyse<br />
und Nutzung<br />
der<br />
Daten<br />
wird in rd. 950 österr.<br />
Gemeinden GemGIS der<br />
Firma Synergis eingesetzt.<br />
Weboffice mit Geodaten.<br />
Digitaler Ortsplan<br />
mit Web-City<br />
Bürgerservice wurde auch in<br />
Form von Orts- bzw. Themenplänen<br />
sowohl in analoger<br />
als auch in digitaler<br />
Form von der Gisdat GmbH.<br />
geboten. Das Angebot wird<br />
ergänzt durch Gemeindeplaner<br />
und ein Wirtschaftsspiel.<br />
Weitere Informationen<br />
unter: www.gemdatnoe.at<br />
E.E.<br />
E.E.
Kosten sparen mit Wien Energie<br />
Energiebuchhaltung<br />
Kostenkontrolle und Verbrauchsübersichten sind Basis für das Budget. Wie sieht es bei<br />
der Energie aus? Gibt es eine Dokumentation und Kontrolle über den Verbrauch und<br />
die Kosten? Wien Energie hat das perfekte Serviceangebot für Kommunen: Die<br />
Energiebuchhaltung.<br />
Die Energiebuchhaltung hilft aufzuzeigen,<br />
wo gespart werden kann. Dokumentation<br />
und Kontrolle über den Verbrauch<br />
und die Kosten der Energie hilft<br />
bei Einsparungen.<br />
Das alles bringt die<br />
Energiebuchhaltung<br />
Plant die Gemeinde Sanierungs- oder<br />
Umweltprojekte, liefert die Energiebuchhaltung<br />
die nötigen Entscheidungsgrundlagen.<br />
Die Beurteilung der<br />
ökologischen und ökonomischen Sinnhaftigkeit<br />
von Maßnahmen und die<br />
Erfolgskontrolle und Motivation von<br />
Nutzern wird möglich. Und die Erfolgskontrolle<br />
und Motivation von Nutzern<br />
mittels Reporting spornt Mitarbeiter an,<br />
beim Energieverbrauch bewusst und<br />
sparsam zu agieren. Die Energiebuchhaltung<br />
zeichnet Energieverbräuche,<br />
Kosten, Schadstoffemissionen und<br />
andere relevante Kenngrößen in regelmäßigen<br />
Abständen auf. Anschauliche<br />
und leicht verständliche Auswertungen<br />
verdeutlichen die Einflüsse der Gebäu-<br />
88 KOMMUNAL<br />
Aussagekräftige Reports<br />
nach Maß:<br />
◆ Energieverbrauchs-, Energiekostenstatistiken<br />
und Schadstoffbilanzen<br />
◆ Soll-/Istvergleiche und Abweichungsanalysen<br />
◆ Energiebenchmarks wie Kennzahlenberechnung,<br />
Vergleiche<br />
mit Sollwerten<br />
denutzung, Witterung und Anlagen.<br />
Die Auswirkungen auf Energiekosten<br />
und Schadstoffemissionen werden dargestellt.<br />
Erfolgskontrolle<br />
Bei der Energiebuchhaltung von Wien<br />
Energie wird die neueste Kommunikationstechnologie<br />
verwendet. Die<br />
Gemeinde kann die Energiebuchhaltung<br />
über www.wienenergie.at von<br />
jedem PC aus benutzen und Zähler-<br />
Mit der Energiebuchhaltung von<br />
Wien Energie haben Gemeinden<br />
ihre Kosten im Griff.<br />
stände eingeben. Die Auswertungen<br />
erfolgen individuell je nach den Anforderungen<br />
und kommen direkt auf den<br />
PC in der Gemeinde.<br />
Keine Investitionen<br />
Für diese modernste Art des Buchhaltung<br />
– der Energiebuchhaltung – sind<br />
keine Investitionen, keine Software-<br />
Installation, keine Software-Wartung<br />
notwendig. Der Zugriff zu den Daten<br />
ist rund um die Uhr, weltweit möglich.<br />
Informationen:<br />
Wenn Sie weitere Fragen zum<br />
Thema Energiebuchhaltung haben,<br />
informieren Sie gerne Ihre<br />
Wien Energie-Gemeindebetreuer<br />
Ing. Christian Peterka,<br />
Tel.: 01/97700-38170,<br />
christian.peterka@wienenergie.at,<br />
und Josef Spazierer,<br />
Tel.: 01/97700-38171,<br />
josef.spazierer@wienenergie.at<br />
E.E.
Fahnenmasten und Beflaggungssysteme vom Spezialisten<br />
10 Jahre Czerny<br />
Das Wiener Familienunternehmen feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.<br />
Ein schöner Anlass für eine Leistungsschau des Spezialisten für Masten, Fahnen und<br />
Beflaggungssysteme, der das Who-is-who heimischer Institutionen und viele<br />
Gemeinden zu seinen zufriedenen Kunden zählen darf.<br />
Es begann mit dem Wunsch beruflich<br />
neue Herausforderungen zu suchen und<br />
einem Skandinavienurlaub. Adolf<br />
Czerny erfuhr im Gespräch mit schwedischen<br />
Freunden, dass der schwedische<br />
Mastenproduzent TIDFLAG in<br />
Österreich eine Generalvertretung<br />
suchte. Adolf Czerny dachte an seine<br />
Von Czerny beflaggt: Das Arnold Schönberg Center, die Stadtgartendirektion und der<br />
Abwasserverband Trumau.<br />
vielen beruflichen Fahrten<br />
durch Österreich und wie<br />
viele öffentliche Plätze und<br />
Firmenstandpunkte es gab,<br />
die durch Fahnen und Flaggen<br />
noch besser zur Geltung<br />
kommen würden. Seit 1.<br />
August 1994 gibt es mittlerweile<br />
Kunden aus vielen Bereichen<br />
(OSCE Kongresszentrum, Militärkommando<br />
Wien, Tourismusverband Ötztal<br />
Arena, Stadtgemeinde Stockerau,<br />
Marktgemeinde Gurk, Freiwillige Feuerwehr<br />
Krusdorf, und viele mehr). Das<br />
Ob für die Gemeinde<br />
Podersdorf (Bild links),<br />
die Freiwillige Feuerwehr<br />
in Krusdorf oder<br />
den A1-Ring – Czerny<br />
bietet Ihnen die beste<br />
Lösung für Ihre Beflaggung.<br />
C reativ<br />
Z uverlässig<br />
E ngagiert<br />
R outiniert<br />
N ah am Kunden<br />
Y (i)nnovativ<br />
Geschäft lief gut an und<br />
1995 gab Adolfs Tochter,<br />
Cornelia Cermak, ihren<br />
sicheren Job auf, stellte sich<br />
der selben Herausforderung<br />
wie der Vater und trat ins<br />
Unternehmen ein. So wurde<br />
das „rustikale Flair“ von<br />
Adolf Czerny durch den Charme von<br />
Cornelia Cermak ausgeglichen. Sie ist<br />
für die Kundenbetreuung und den Key<br />
Account zuständig und hat viele prominente<br />
Projekte an Land gezogen. Hinter<br />
dem Erfolg steckt viel persönlicher Einsatz<br />
– bei einem Projekt ist<br />
man zirka achtmal vor Ort,<br />
um die Lösung zu finden, die<br />
sowohl optisch als auch allen<br />
Sicherheitsvorschriften entspricht.<br />
Czerny Geburtstagsaktion:<br />
20% Rabatt bei Mastenkauf<br />
von TIDAFLAG<br />
Informationen:<br />
Adolf CZERNY KG<br />
Ignaz-Köck-Straße 8/Top 8<br />
A-1210 Wien<br />
Tel.: 01/ 271 65 46-0<br />
Fax: 01/ 271 65 46-11<br />
E-Mail: czerny-beflaggung@aon.at<br />
KOMMUNAL 89<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Neues LED-Produkt zur Markierung gefährlicher Straßenstellen<br />
Aktives Licht erhöht Verkehrssicherheit<br />
SWAREFLEX ist eine Produktgruppe<br />
der Firma D.<br />
Swarovski & Co. in Wattens/Tirol<br />
und erzeugt seit<br />
mehr als 50 Jahren hochqualitativeGlasrückstrahler,<br />
welche auf Leitpfosten<br />
und in Leitschienen montiert<br />
werden.<br />
Im Straßenverkehr halten<br />
immer mehr LED-Produkte<br />
Einzug. Swareflex hat eine<br />
Reihe derartiger Produkte<br />
entwickelt: die elektronische<br />
Tunnelleiteinrichtung<br />
SWAROLINE, das Unterflurleitsystem<br />
LEVELITE<br />
oder die Blinkeinrichtung<br />
SIGNFLASH für Schutzwegverkehrszeichen.<br />
Mit geringstem Energie-Einsatz<br />
kann dabei eine effiziente Markierung<br />
erzielt werden.<br />
Solilite<br />
Ein weiteres Beispiel dieser LED-Produkte<br />
ist SOLILITE, ein solarbetriebe-<br />
90 KOMMUNAL<br />
Das solarbetriebene Solilite – ausgerüstet mit zwei hochintensiven<br />
LED – leuchtet ab Einbruch der Dämmerung.<br />
nes LED-Modul zur Leitführung. SOLI-<br />
LITE wird bei Verkehrsinseln, Kreisverkehren<br />
oder gefährlichen Kurven auf<br />
Leitschienen, Betonleitwänden, Randsteinen,<br />
etc. mittels mitgeliefertem,<br />
diebstahlsicherem Montagematerial<br />
befestigt. SOLILITE ist mit zwei hochintensiven<br />
LED ausgerüstet, die bei Dämmerung<br />
und Dunkelheit zu leuchten<br />
Solilite<br />
Solarbetriebenes LED-Modul zur Leitführung<br />
beginnen. Die Energieversorgung<br />
erfolgt über Solarenergie (keine<br />
Verkabelung notwendig).<br />
Gesicherte Energieversorgung<br />
Mehrwöchige Schlechtwetterphasen<br />
stellen in der Energiebilanz<br />
des Modules kein Problem dar,<br />
da sie durch einen eingebauten<br />
Akku überbrückt werden. SOLI-<br />
LITE ist mit weißen, roten, gelben,<br />
grünen oder blauen LED<br />
erhältlich.<br />
Informationen:<br />
D. SWAROVSKI & CO.<br />
Swareflex Division<br />
A-6112 Wattens/Austria<br />
Tel. 05224 500 2463<br />
Fax 05224 500 2370<br />
swareflex.office@swarovski.com<br />
www.swareflex.com<br />
• Zur Kenntlichmachung des Fahrbahnverlaufes und zur Markierung von<br />
gefährlichen Stellen während der Dunkelheit, z. B. bei Kurven mit engem<br />
Radius, bei nicht beleuchteten Kreisverkehren und Verkehrsinseln, etc.<br />
• Fixierung auf Leitschienen, Beton-Leitwänden, Randsteinen,<br />
etc. mittels diebstahlsicherem Montagematerial<br />
• Durch das Auftreffen des Scheinwerferlichtes auf den Sensor erhöht sich<br />
die Helligkeit von Solilite automatisch<br />
• Bei Tageslicht erfolgt selbsttätige Abschaltung der LED<br />
• Einfache Installation, keine Kabelverlegung notwendig<br />
D. Swarovski & Co<br />
Produktgruppe Swareflex<br />
A-6112 Wattens/Austria · Tel. 05224 500-2463 · Fax 05224 500-2370<br />
swareflex.office@swarovski.com · www.swareflex.com<br />
E.E.
Contracting mit E-Werk Wels senkt Energiekosten<br />
Der Geschäftsbereich E-Werk<br />
Wels Solutions ist besonders<br />
stolz, dass er von den Laakirch-<br />
nern als Partner ausgewählt<br />
wurde, denn diese haben sich<br />
ihre Entscheidung nicht leicht<br />
gemacht. Bereits 2001 wurden<br />
vier Contracting-Anbieter, darunter<br />
auch die Welser mit der<br />
Erstellung eines Grobkonzeptes<br />
beauftragt. „Nach genauer Prüfung<br />
durch den Energie-Ausschuss<br />
wurde das E-Werk als<br />
bester Anbieter ausgewählt, weil<br />
es uns neben einem Optimum an<br />
Energieeinsparung auch eine<br />
sorgfältige Gesamtplanung,<br />
abgestimmte Ausführung sowie<br />
Facility-Betreuung und laufende<br />
Energiekontrolle anbieten konnte“,<br />
erklärt Bürgermeister Silbermayr.<br />
Hohe Ansprüche erfüllt<br />
Die Ansprüche, die an die E-Werk-Sparten<br />
Solutions, <strong>Kommunal</strong>technik,<br />
Matrix 3000 und Wels Strom gestellt<br />
werden, sind vielfältig. So sollen<br />
Betriebs- und Energiekosten eingespart,<br />
die Belastung bei den Sanierungs- und<br />
Umbauarbeiten so gering wie möglich<br />
gehalten und auch das Gemeindebudget<br />
nicht belastet werden. Zusätzlich<br />
wird das Ortsbild im Zuge der Generalsanierung<br />
auch noch verschönert. Alle<br />
Optimierungsmaßnahmen rechnen<br />
sich. Durch Energiekosteneinsparung<br />
bis zu 20 % wird sich die Umstellung in<br />
20 Jahren ohne zusätzliche Geldmittel<br />
selbst finanzieren.<br />
Energieoptimierung und<br />
Generalsanierung<br />
Ende Jänner dieses Jahres wurde das<br />
Welser Unternehmen mit der Energieoptimierung<br />
bei insgesamt elf Gebäuden<br />
und der Generalsanierung der<br />
öffentlichen Straßenbeleuchtung bei<br />
einer Investitionssumme von mehr als<br />
einer Mio. € beauftragt. Nun steckt<br />
man bereits mitten in der Umsetzung.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Marktgemeinde<br />
Laakirchen setzt<br />
auf Energie-Sparkurs<br />
Ein großer Augenblick für die Marktgemeinde Laakirchen und auch für das Welser<br />
E-Werk: Mag. Erich Rondonell und Bürgermeister Klaus Silbermayr unterzeichneten ein<br />
Energie-Contracting, das sowohl die Energie- Optimierung in allen kommunalen<br />
Gebäuden bis Ende dieses Jahres und der öffentlichen Straßenbeleuchtung bis Ende<br />
2006 als auch Betreuung und Wartung für 18 bzw. 20 Jahre vorsieht.<br />
Foto: Erhardt<br />
Der Laakirchner Bürgermeister Klaus Silbermayr und EWW-<br />
Direktor Mag. Erich Rondonell bei der Contracting-Unterzeichnung.<br />
„Bis Ende des Jahres werden<br />
alle Gebäude, auch das Amtsgebäude,<br />
das mit einem Vollwärmeschutz<br />
versehen wird, abgeschlossen<br />
sein. Lediglich die<br />
Hauptschule kann erst 2005 fertig<br />
gestellt werden”, zeigt sich<br />
der Leiter des Projektes, Helmut<br />
Krenmair zuversichtlich.<br />
Sanierung der<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Bis Ende 2006 soll auch die<br />
Sanierung der Straßenbeleuchtung<br />
abgeschlossen werden. Hier<br />
wird bei den Schaltstellen ein<br />
Lichtmanagement eingebaut, die<br />
Altstadtleuchten mit Reflektoren nachgerüstet<br />
und das Gemeindegebiet mit<br />
dekorativen Lichtpunkten versehen und<br />
auch die Bundesstraße lichttechnisch<br />
saniert.<br />
Informationen:<br />
E-WERK WELS<br />
Pfarrgasse 1<br />
4602 Wels<br />
Tel.: 07242/ 493-101<br />
Fax.: 07242/ 493-102<br />
E-Mail: johann.reifeneder@eww.at<br />
www.eww.at<br />
KOMMUNAL 91<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Recyclingssystem für Glasverpackungen<br />
Indirekte Umweltaspekte<br />
Seit 2001 arbeitet Austria<br />
Glas Recycling (AGR) nach<br />
einem Umweltmanagementsystem<br />
gemäß EMAS. Besonderes<br />
Augenmerk gilt der<br />
positiven Beeinflussung der<br />
indirekten Umweltaspekte<br />
im gesamten Glaskreislauf.<br />
Im Netzwerk des österreichischen<br />
Altglassammelsystems<br />
agieren Kommunen, Abfallberater,<br />
private und öffentlicheEntsorgungsunternehmen,<br />
Transporteure, Lagerbetriebe,<br />
Glaswerke, Behörden<br />
und AGR. Vertreter aller<br />
Gruppen folgten der Einladung<br />
der AGR zu einem<br />
Workshop. Ergebnis ist ein<br />
Arbeitsprogramm für die<br />
positive Gestaltung der indirekten<br />
Umweltauswirkungen<br />
- schwerpunktmäßig in den<br />
Bereichen Stoffe (nachhaltige<br />
Verbesserung der Qualität<br />
des gesammelten Altglases),<br />
Transport (Reduzieung<br />
der Emissionen) und Lärm<br />
92 KOMMUNAL<br />
AGR achtet auf Umweltschutz<br />
im Glaskreislauf.<br />
(Lärmminimierung). Der<br />
wechselseitige Austausch<br />
trägt wesentlich zu einem<br />
gemeinsamen Bewusstsein<br />
der Stärken, Schwächen und<br />
Herausforderungen des<br />
österreichischen Glasrecyclingsystems<br />
bei.<br />
Informationen:<br />
Austria Glas Recycling<br />
GmbH (AGR)<br />
Obere Donaustraße 71<br />
1020 Wien, Austria<br />
Tel: +43/01/214 49 00<br />
Fax: +43/01/214 49 08<br />
E-Mail: agr@agr.at<br />
Web: www.agr.at<br />
E.E.<br />
Biomasse ersetzt fossilie Energieträger<br />
Energiecomfo<br />
Purkersdorf m<br />
Nach einer Bauzeit von nur rund acht Monaten – is<br />
in Purkersdorf feierlich in Betrieb genommen word<br />
Aussee und Tannheim/Tirol ein weiteres Biomasseh<br />
Die Überlegungen für<br />
umweltfreundliche Wärme<br />
aus naturbelassenen Hackschnitzeln<br />
sind bereits 2001<br />
entstanden, konnten aber<br />
aus wirtschaftlichen Überlegungen<br />
zu diesem Zeitpunkt<br />
nicht umgesetzt werden.<br />
Umweltfreundliche<br />
Wärme<br />
Aus diesem Grund hat das<br />
Unternehmen, ENERGIE-<br />
COMFORT Energie- und<br />
Gebäudemanagement<br />
GmbH eine Schritt-für-<br />
Schritt-Realisierung kreiert:<br />
Die zu dieser Zeit durch den<br />
Energiedienstleister errichteten<br />
kleineren konventionell<br />
(mit Gas) versorgten<br />
Nahwärmenetze sollten<br />
nach dem positiven Ergebnis<br />
einer neuerlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung<br />
in<br />
Biowärme-Netze umgewandelt<br />
werden. Dieses Konzept<br />
ist in vollem Umfang aufgegangen:<br />
Seit kurzem versorgt<br />
ein hochmoderner Biomasseheizkessel<br />
mit einer<br />
Leistung von 1.250 Kilowatt<br />
das 1,8 km lange Ortswärmenetz<br />
mit insgesamt 3,2<br />
Megawatt Anschlussleistung.<br />
Das Gesamtprojekt ist mit<br />
einer Investsumme von in<br />
etwa. 2 Mio EURO verwirklicht<br />
worden.<br />
ENERGIECOMFORT zeichnet<br />
für die Errichtung,<br />
Finanzierung und Betriebsführung<br />
verantwortlich und<br />
sorgt mit Wartung, Instandsetzung<br />
und dem Brennstoffmanagement<br />
- wie<br />
immer aus einer Hand -<br />
rund um die Uhr für eine
t wärmt<br />
it Biomasse<br />
t Ende Oktober ein neues Biomasse-Heizwerk<br />
en. ENERGIECOMFORT betreibt nun nach Bad<br />
eizwerk in der Umgebung Wiens.<br />
reibungslose Abwicklung für<br />
die an das Biowärmenetz<br />
angeschlossenen Purkersdorfer.<br />
Höhere Lebensqualität<br />
Den “Start-Brennstoff“, ca.<br />
3.000 Schüttraummeter Biomasse,<br />
liefern die Österreichischen<br />
Bundesforste,<br />
die mit ihrer Zentrale auch<br />
zu den Kunden der Biowärme<br />
zählen.<br />
Die Hackschnitzel und Rindenstücke<br />
sind nicht nur<br />
direkt aus der unmittelbaren<br />
Umgebung, sondern enthalten<br />
darüber hinaus qualitativ<br />
hochwertige Buche. In<br />
Zukunft wird auch der<br />
Strauchschnitt der Stadtgemeinde<br />
selbst als Energielie-<br />
ferant zum Tragen kommen.<br />
Purkersdorf als Klimabündnis-Gemeinde<br />
ist seit Jahren<br />
um Umweltschutz und die<br />
Reduktion von schädlichen<br />
Emissionen bemüht.<br />
Diesem Ziel ist die Stadtgemeinde<br />
nun mit dem nach<br />
neuestem Stand der Technik<br />
errichteten Biomasse-Heizwerk<br />
und der damit eingesparten<br />
1.500 Tonnen CO 2<br />
einen wesentlichen Schritt<br />
nähergekommen.<br />
Informationen:<br />
ENERGIECOMFORT<br />
Energie- und Gebäudemanagement<br />
GmbH<br />
Obere Donaustraße 63<br />
1020 Wien<br />
Tel: 01 31317-0<br />
www.energiecomfort.at<br />
E.E.<br />
Wirtschafts-Info<br />
KOMMUNAL 93
Wirtschafts-Info<br />
94 KOMMUNAL<br />
Medaillen und Auszeichnungen der Münze Österre<br />
Wir prägen Öste<br />
Die Münze Österreich prägt bereits seit mehr als 800 Jahren Münz<br />
Münzprägestätte Österreichs. Wir schmelzen für Sie aus den Komp<br />
Know-how und individueller künstlerischer Gestaltung jene ideale<br />
Auszeichnungen in den vielfältigsten Designs und Materialien anf<br />
Auszeichnungen und Anlassmedaillen<br />
Ob Medaillen, Orden oder<br />
Anstecknadeln, diese sollten dem<br />
Anlass gerecht werden, um so<br />
die Ausgezeichneten immer wieder<br />
an dieses Ereignis zu erinnern.<br />
Die verschiedensten Materialien,<br />
wie Bronze, Silber oder<br />
Gold geben Ihnen hier zusätzliche<br />
Möglichkeiten der Differenzierung.<br />
Jubiläumsmedaillen<br />
Feiert Ihre Gemeinde demnächste<br />
ein Jubiläum? Dann sollten<br />
Sie zu diesem großen Anlass mit einer schönen Medaille (die mit ihrem Nettoerlös<br />
des Verkaufs auch als<br />
Finanzierung dient) eine bleibende<br />
Erinnerung schaffen.<br />
Erinnerungsmedaillen<br />
Gastfreundliche Aufnahme in<br />
Ihrer Gemeinde, ein schöner<br />
Urlaub -vielleicht bereits<br />
mehrmals-, wer erinnert sich<br />
nicht gerne daran, wenn er die<br />
ihm geschenkte oder auch<br />
gekaufte Medaille wieder in<br />
die Hand nimmt, sie stolz<br />
Freunden und Bekannten zeigt<br />
und diesen Appetit macht,<br />
ebenfalls bei Ihnen schöne<br />
Ferien zu verbringen?<br />
Bausteine<br />
Eine Prägung verschiedenster<br />
Form kann aber auch ein<br />
„Dankeschön“ für eine
ich<br />
rreich<br />
en und Medaillen und ist auch die offizielle<br />
onenten Tradition, modernstem technischen<br />
Mischung, aus der wir Ihre Medaillen und<br />
ertigen.<br />
Spende für gemeinnützige<br />
Zwecke -<br />
z.B. Bau von Schulen,<br />
Kindergärten,<br />
Sportanlagen etc.sein.<br />
Durch den<br />
Erhalt dieses „Bausteins“<br />
wird für den<br />
Spender sichtbar<br />
dokumentiert, dass<br />
auch er seinen Beitrag<br />
zum Gelingen<br />
des Projektes geleistet<br />
hat.<br />
Noch viele Möglichkeiten<br />
könnten hier angeführt werden, doch eine persönliche<br />
Beratung zeigt Ihnen sicher auch jene Aspekte auf,<br />
durch die Sie neue Akzente in Richtung zufriedener Bürger<br />
und Mitarbeiter sowie wachsenden Fortschritt setzen<br />
können.<br />
Individuelle<br />
Beratung<br />
Kontaktieren Sie uns<br />
doch (siehe Informationen)<br />
und wir informieren<br />
Sie gerne über alle<br />
Möglichkeiten „IHRE“<br />
Medaille produzieren zu<br />
lassen.<br />
Informationen:<br />
Münze Österreich Aktiengesellschaft<br />
Am Heumarkt 1<br />
A-1031 Wien<br />
Tel.: 01/717 15/350<br />
Fax: 01/717 15/357<br />
E-Mail:<br />
Josef.Martinkowitsch@<br />
Austrian-Mint.at<br />
E.E.<br />
Wirtschafts-Info<br />
KOMMUNAL 95
Wirtschafts-Info<br />
Informationsmanagement hautnah:<br />
APA auf der<br />
<strong>Kommunal</strong> 2004<br />
Zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen <strong>Kommunal</strong>wirtschaft und Umwelttechnik<br />
präsentierten auf der diesjährigen <strong>Kommunal</strong>messe/Public Services ihre<br />
Angebote. Unter ihnen die APA - Austria Presse Agentur, deren Tochterunternehmen<br />
APA-DeFacto und APA OTS eine immer zentralere Rolle im<br />
Informationsmanagement von Gemeinden spielen.<br />
Die Anforderungen, die heute<br />
an moderne Gemeinden gestellt<br />
werden, sind in den letzten Jahren<br />
massiv gestiegen. Jene Zeiten,<br />
in denen Gemeinden ausschließlich<br />
mit den kommunalen<br />
Verwaltungsagenden<br />
betraut waren, scheinen endgültig<br />
vorbei zu sein. Immer<br />
mehr Kommunenvertreter setzen<br />
auf offensive Informationspolitik<br />
und nehmen so eine<br />
Mittlerrolle im kommunalen<br />
Umfeld mit Bürgern, Medien,<br />
Ländern und Bund ein.<br />
Gemeinden als<br />
Dienstleistungszentren<br />
„Gemeinden sehen sich heute als zeitgemäße<br />
Dienstleistungszentren, die<br />
Kommunikationsarbeit als einen Hauptbestandteil<br />
ihres Tätigkeitsfeldes definieren“,<br />
so APA-DeFacto Geschäftsführerin<br />
Waltraud Wiedermann. Demgemäß<br />
hat die APA ein auf kommunale Bedürfnisse<br />
maßgeschneidertes Paket ihrer<br />
Produkte und Dienstleistungen zusammengestellt<br />
und heuer auf der <strong>Kommunal</strong>messe<br />
präsentiert.<br />
Professionelle<br />
Kommunikationsarbeit<br />
Zahlreiche Besucher informierten sich<br />
während der Dauer der Messe am APA-<br />
Stand über die Möglichkeiten, ihre<br />
Kommunikationsarbeit auf professionellere<br />
Beine zu stellen. Der Online-Pressespiegel<br />
der APA-DeFacto, der Info-Profis<br />
96 KOMMUNAL<br />
Die APA bietet hochinteressante Produkte für Gemeinden.<br />
täglich um 8:00 Uhr morgens über relevante<br />
Themenmeldungen zu ihrer<br />
Gemeinde oder zu definierten Stichworten<br />
informiert, oder die DeFacto-Suchmaschine,<br />
eine Online-Mediendatenbank,<br />
die sämtliche Recherchewünsche<br />
abdeckt, sind nur zwei der Wege zu<br />
rechtssicher und zuverlässiger Informationsbeschaffung.<br />
Tagesaktuelle Pressemeldungen<br />
per Mausklick<br />
Das mühsame Ausschneiden von Presseartikeln<br />
gehört damit der Vergangenheit<br />
an. „Besonders die Vor Ort-Demonstration,<br />
wie APA-Kunden die Meldungen<br />
tagesaktuell per Mausklick auf den<br />
Computer erhalten und bei Bedarf auch<br />
rückwirkend recherchieren können, war<br />
ein voller Erfolg“, so Alexandra Buchl,<br />
Sales Managerin bei APA-DeFacto.<br />
Anliegen öffentlich<br />
machen<br />
Beeindruckt zeigten sich die Besucher<br />
des APA-Standes auch von<br />
den Möglichkeiten, die Gemeinde<br />
und ihre Anliegen in die mediale<br />
und vor allem öffentliche Diskussion<br />
einzubringen. APA OTS bietet<br />
dafür ein Verbreitungsservice, das<br />
die eigene Pressemeldung über<br />
die bewährten APA-Kanäle zur<br />
richtigen Zeit an die zuständigen<br />
Redaktionen weiterleitet. „Dass<br />
die APA so viel mehr ist als eine<br />
klassische Nachrichtenagentur,<br />
war mir neu“, so das Statement<br />
eines Messebesuchers.<br />
Neben der Möglichkeit, sich am APA-<br />
Stand mit dem breiten Spektrum professioneller<br />
Pressearbeit hautnah auseinanderzusetzen,<br />
winkten den Teilnehmern<br />
im Rahmen eines Gewinnspieles<br />
Informationsgutscheine und eine Reihe<br />
weiterer attraktiver Preise.<br />
Informationen:<br />
APA-DeFacto GmbH<br />
Alexandra Buchl<br />
Tel.: +43/1/360 60-5620<br />
E-Mail: alexandra.buchl@apa.at<br />
Web: http://www.apa-defacto.at<br />
http://www.defacto.at<br />
APA OTS Originaltextservice GmbH<br />
Karin Thiller<br />
Tel.: +43/1/360 60/5350<br />
E-Mail: karin.thiller@apa.at<br />
http://www.ots.at<br />
http://politikportal.at<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Komplett neu entwickelte Tauchmotorpumpen aus Cr Ni Mo Edelstahl Feinguss<br />
Neu! Vogel Tauchmotorenpumpen TVS<br />
Hauptziel der Entwicklung<br />
war unseren Kunden<br />
eine neue Tauchpumpenbaureihe<br />
zu<br />
bieten, die die Lebenszykluskosten<br />
stark<br />
reduziert und einen<br />
wesentlich verbesserten<br />
Nutzwert bietet.<br />
Da ein wesentlicher<br />
Anteil der Lebenszykluskosten<br />
der Energieverbrauch<br />
darstellt,<br />
war einer der Entwicklungsschwerpunkte,<br />
Pumpen mit bestmöglichen<br />
Wirkungsgraden<br />
bereitzustellen.<br />
Neue konstruktive<br />
Lösungen zur Optimierung der Bauteilgeometrie,<br />
des Gewichts und der Bearbeitung,<br />
ermöglichen, trotz Verwendung<br />
hochwertiger Werkstoffe, wie<br />
Gussteile aus austenitischen Cr Ni Mo<br />
Stahlguss 1.4408, Wellen, Kupplungen<br />
und Spannhülsen aus Duplex 1.4462<br />
Leistungsbereich:<br />
Fördermengen bis 170 m3/h<br />
Förderhöhen bis 500 m<br />
Motorleistungen bis 150 kW<br />
Drehzahlen 2900 min-1 / 50<br />
Hz (3600 min-1 / 60 Hz)<br />
als Standardausführung,<br />
ein gutes Preis<br />
/ Leistungsverhältnis zu<br />
erreichen, und durch<br />
die Eigenschaften der<br />
verwendeten Werkstoffe,<br />
die KorrosionsundVerschleißbeständigkeit<br />
gegenüber konventionellenAusführungen<br />
wesentlich<br />
zu verbessern.<br />
Die verwendeten Werkstoffe<br />
ermöglichen eine<br />
nahezu universelle<br />
Beständigkeit für einen<br />
breiten Anwendungsbereich,<br />
wie<br />
◆ Trinkwasserversorgung in Städten<br />
und Gemeinden<br />
◆ Brunnen in Wasserwerken und der<br />
Landwirtschaft<br />
◆ Wasserversorgung für Brauereien,<br />
Lebensmittelindustrie, Mineralwasserabfüllung<br />
◆ Brauch-, Nutz- und Kühlwasserförderung<br />
in der Industrie<br />
◆ Beregnung im Gartenbau, Land- und<br />
Forstwirtschaft, sowie Sportanlagen<br />
(Golfplätze)<br />
◆ Wasserumwälzung in der Fischzucht<br />
Druckerhöhungsanlagen in der Wasserversorgung<br />
und Industrie<br />
◆ Springbrunnen<br />
◆ Wasserhaltung im Tiefbau und<br />
Bergbau<br />
Die Kombination mit dem Hydrovar<br />
Regler ermöglicht es insbesondere bei<br />
zeitlich schwankenden Betriebsbedingungen<br />
den Betrieb an den jeweiligen<br />
Bedarf genau und automatisch anzupassen,<br />
wodurch eine weiters großes<br />
Energiesparpotential erzielt wird.<br />
Informationen:<br />
Pumpenfabrik Ernst Vogel GmbH<br />
Ernst Vogel Straße 2<br />
2000 Stockerau<br />
www.vogel.pumpen.com<br />
Spitzentechnologie zum Spitzenpreis für den Einsatz in der Gemeinde<br />
Ultraleichte MEGA-Nutzfahrzeuge<br />
Die Unternehmensgruppe AIXAM-<br />
MEGA verdankt ihren guten Ruf nicht<br />
nur ihrem technologischen Know-how,<br />
sondern auch der hohen Innovationskapazität.<br />
Nun wurde die bestehende Produktreihe<br />
durch ultraleichte MEGA-<br />
Nutzfahrzeuge erweitert.<br />
Exklusive Bauteile<br />
MEGA profitiert von modernsten Produktionsmethoden.<br />
Spitzentechnologie,<br />
moderne Produktionsanlagen – MEGA<br />
besitzt ein Know-how, das von einer<br />
langjährigen Erfahrung im Fahrzeugbau<br />
herrührt. Die ultraleichten Nutzfahrzeuge<br />
sind Beweis für die technische<br />
Kompetenz der Unternehmensgruppe.<br />
Sie bestehen aus exklusiv produzierten<br />
Bauteilen die speziell entwickelt<br />
wurden um den Leistungsanforderungen<br />
für die kommunale Nutzung<br />
gerecht zu werden.<br />
Das Fahrgestell aus Aluminiumguss ist<br />
leicht, widerstandsfähig und bietet eine<br />
besondere Stabilität. Die Karroserieteile<br />
werden aus hochwertigem ABS hergestellt.<br />
Sie erfüllen alle mechanischen<br />
und ästhetischen Anforderungen<br />
und vertragen kleinere<br />
Stöße ausgesprochen gut. Die<br />
ultraleichten Nutzfahrzeuge<br />
gibt es mit Diesel- oder Elektromotor.<br />
Auf ihrem einzigartigen<br />
patentierten Aluminium-Fahrgestell<br />
können die ultraleichten<br />
MEGA-Nutzfahrzeuge mit<br />
einem Pick-Up-Aufbau, als Pritschenwagen<br />
mit Bordwänden<br />
oder als Kastenwagen mit einer<br />
Ladekapazität von über 3m3<br />
ausgerüstet werden. Sie können auch<br />
als Fahrgestell mit Fahrerhaus ausgeliefert<br />
werden, auf dem alle möglichen<br />
Aufbauten angebracht werden können.<br />
Wendig und vielseitig<br />
Je nach Motorisierung und gesetzlichen<br />
Bestimmungen können sie mit oder<br />
ohne Führerschein gefahren werden.<br />
Mit einer Gesamtbreite von 1,50<br />
Metern können sie auch in normalerweise<br />
unzugänglichen Bereichen eingesetzt<br />
werden. Und das bei einer Nutzlast<br />
von 275-500 kg. Dank ihres gerin-<br />
Eine der vielen Aufbauvarianten.<br />
gen Gewichts sind die ultraleichten<br />
Mega-Nutzfahrzeuge wendig und schonen<br />
selbst empfindliche Rasenflächen.<br />
Informationen:<br />
AIXAM MEGA GmbH<br />
Carlbergergasse 66a<br />
1230 Wien<br />
Tel.: 01/ 867 36 02-0<br />
Fax: 01/ 867 36 02-12<br />
E-Mail: Aixam-Mega@gmx.net<br />
KOMMUNAL 97<br />
E.E.<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Raupen-Multitalent als wendiger Gemeindehelfer<br />
Der PRINOTH-Husky<br />
Der extra wendige, umweltschonende und sparsame Husky, das kleinste Mitglied<br />
der PRINOTH-Flotte, hat die Nase bei der winterlichen Schneeräumung von Wegen<br />
und Parks genauso vorn wie als multifunktionales Transportgerät im Sommer. So<br />
wird der Husky zum idealen Helfer, wenn es um die Gemeindeordnung geht.<br />
Der Husky, das kleinste Raupengerät<br />
aus der PRINOTH-Flotte, ist Multitalent,<br />
wenn man vom Spektrum der<br />
bewältigbaren Arbeiten ausgeht.<br />
Extrem wendig<br />
Seine kompakte Bauweise und das<br />
technologisch hoch entwickelte elektronische<br />
Steuerungssystem machen<br />
ihn besonders wendig, auch schmale<br />
Wege und Engstellen sind kein Problem.<br />
Zur großzügigen Ladefläche<br />
kommt die günstige Ladehöhe, die<br />
Transportarbeiten besonders einfach<br />
macht. Mit der Kombiraupe, einer Allround-Kette<br />
für jegliche Bodenbeschaffenheit,<br />
kann sich der Husky auf<br />
Schnee und Eis genauso wie auf<br />
Asphalt, Matsch, Geröll und Schlamm<br />
bewegen und ermöglicht den Ganzjahreseinsatz.<br />
Übrigens besonders bodenschonend,<br />
denn die Grasnarbe bleibt<br />
auch bei geringer Schneelage intakt.<br />
Weitere Argumente für den Einsatz des<br />
Husky sind der hohe Wirkungsgrad des<br />
130 kW (177 PS) starken, lärmarmen<br />
Mercedes-Dieselmotors, den geringer<br />
Verbrauch und minimierte Schadstoffemissionen<br />
auszeichnen. Zudem sen-<br />
98 KOMMUNAL<br />
Prinoth-Husky, der ideale Gemeindehelfer.<br />
ken lange Wartungsintervalle die Servicekosten<br />
stark. Ein weiteres Umweltplus:<br />
Die Hydraulikanlage kann mit biologisch<br />
abbaubarer Druckflüssigkeit<br />
betrieben werden.<br />
Individuell anpassbar<br />
Das Gerät verfügt serienmäßig über<br />
eine ROPS-überschlaggeprüfte Fahrerkabine<br />
und das PRINOTH-Zwischengetriebe<br />
START PLUS!, das optimales<br />
Startverhalten in jeder Höhe und Wettersituation<br />
garantiert. Dank des flexiblen<br />
Baukastensystems kann der<br />
Husky auf individuelle Anforderungen<br />
hin geliefert werden, in verschiedenen<br />
Fahrzeugbreiten genauso wie mit<br />
Zubehör für Standard- und Spezialaufgaben.<br />
Das 12-Wege-Fronträumschild,<br />
die Fräse, der schwenkbare Gelenkarm,<br />
der auch in Kurven für perfekte Spuren<br />
sorgt, Spurschlitten, Frontschleuder<br />
und Transportkabine für bis zu 14 Personen<br />
gehören zur Zubehör- und<br />
Optionalliste.<br />
Spezialanfertigung<br />
Auch spezielle Anfertigungen sind möglich:<br />
Im Mittelmeerparadies Zypern<br />
etwa wird ein speziell konstruierter<br />
Husky von der dortigen Polizei als „Rettungsraupe“<br />
bei Noteinsätzen in den<br />
Inselbergen verwendet.<br />
Informationen:<br />
PRINOTH GmbH<br />
Bahnhofstraße 37<br />
A-6170 Zirl<br />
Tel. +43 (0) 5238 53 500<br />
Fax. +43 (0) 5238 53 600<br />
prinoth.austria@prinoth.com<br />
www.prinoth.com<br />
Informationsveranstaltung des O.Ö. Energiesparverbandes am 9.12.2004 in Linz<br />
Hilfestellung für mehr Energieeffizienz im Büro<br />
„Energie sparen und<br />
Kosten senken durch<br />
mehr Energieeffizienz im<br />
Büro“ – unter diesem<br />
Motto steht die Informationsveranstaltung<br />
des O.Ö.<br />
Energiesparverbandes<br />
und des Ökoenergieclusters<br />
in Kooperation mit<br />
der Wirtschaftskammer<br />
am 9.12.2004 in Linz.<br />
O.Ö. Energiesparverband.<br />
Die Veranstaltung bietet einen<br />
Überblick, wie im Büroalltag mit<br />
geringem technischen und organisatorischen<br />
Aufwand Energieeffizienz<br />
und Kostenreduktion erreicht werden<br />
kann. Innovative Konzepte beim Neubau<br />
und der Sanierung von Büround<br />
Dienstleistungsgebäuden werden<br />
ebenso präsentiert, wie aktuelle Entwicklungen<br />
bei innovativen Lüftungsund<br />
Beleuchtungs-Technologien.<br />
Tipps und Tricks zum Energiesparen im<br />
Büro und Informationen zu sparsamen<br />
Bürogeräten runden das Programm ab.<br />
Information & Anmeldung:<br />
O.Ö. Energiesparverband<br />
Landstraße 45, A-4020 Linz<br />
T: +43-732-7720-14380,<br />
office@esv.or.at<br />
www.energiesparverband.at<br />
E.E.<br />
E.E.
Foto: EVN / Berger<br />
Budget schonende Beleuchtungs-Sanierung<br />
EVN Lichtservice<br />
Licht auf öffentlichen Straßen und Plätzen<br />
erhöht das Sicherheitsgefühl der<br />
Menschen und fördert die Verkehrssicherheit.<br />
Eine hochqualitative und<br />
zuverlässige öffentliche Beleuchtung<br />
hat wesentlichen Einfluss auf die<br />
Lebensqualität der Gemeindebürger.<br />
Doch gleichzeitig verursacht sie den<br />
Gemeinden hohe Kosten und viel<br />
Mühe.<br />
Schont das Budget<br />
Das EVN Lichtservice nimmt den<br />
Gemeinden alle Fragen rund um die<br />
Beleuchtung von Straßen und Plätzen<br />
ab und schont gleichzeitig die Gemeindefinanzen.<br />
Im Rahmen des Lichtservice saniert,<br />
erweitert und erneuert die EVN kommunale<br />
Beleuchtungsanlagen und<br />
übernimmt auch die laufende Energie-<br />
Wirtschafts-Info<br />
Das EVN Lichtservice bietet den Gemeinden eine attraktive Lösung für die Sanierung<br />
und Erweiterung ihrer Ortsbeleuchtung. Auch Josef Sturm, Bürgermeister von Stadt<br />
Haag, hat mit dem EVN Leistungspaket beste Erfahrungen gemacht.<br />
„Eine durchdachte Lösung mit vielen Vorteilen“<br />
Josef Sturm, Bürgermeister von Stadt Haag<br />
„Wie in vielen anderen Gemeinden war auch unsere<br />
Straßenbeleuchtung dringend sanierungsbedürftig. Aus<br />
Budgetgründen mussten wir das Projekt jedoch seit Jahren<br />
immer wieder verschieben. Mit dem EVN Lichtservice<br />
konnten wir nun die notwendige Erneuerung sowie den<br />
Neuausbau kurzfristig umsetzen.<br />
Dabei haben wir der EVN auch die gesamte Verantwortung<br />
für den Betrieb und die Instandhaltung für die<br />
Straßenbeleuchtung übertragen und wissen sie nun in<br />
kompetenten Händen.<br />
Ein wichtiger Punkt dabei war für uns auch, dass die EVN bei der Umsetzung mit<br />
unseren örtlich ansässigen Elektrikern kooperiert. So bleiben Wertschöpfung und<br />
Arbeitsplätze in unserer Stadt erhalten. Nicht zuletzt wirkt sich die neue Straßenbeleuchtung<br />
auch sehr positiv auf das Ortsbild in Haag aus.<br />
Alles in allem: Für uns hat sich das EVN Lichtservice als durchdachte Lösung mit<br />
vielen Vorteilen erwiesen.“<br />
Das EVN Lichtservice ist die ideale<br />
Komplettlösung für die öffentliche<br />
Beleuchtung.<br />
versorgung, die Betriebsführung,<br />
Instandsetzung und den Störungsdienst.<br />
Und bei Bedarf kann auch eine stilvolle<br />
Weihnachtsbeleuchtung in das Servicepaket<br />
integriert werden.<br />
Einfach und fair<br />
Abgerechnet werden die Leistungen<br />
des EVN Lichtservice in der Regel über<br />
ein vereinbartes Fixentgelt pro Lichtpunkt.<br />
Diese Verrechnungsart ist für die<br />
Gemeinden besonders vorteilhaft. Denn<br />
Investitionen, Betriebsführung und<br />
elektrische Energie werden dabei über<br />
mehrere Jahre verteilt abgegolten.<br />
Dadurch haben die Kommunen die<br />
Möglichkeit, ihre Beleuchtung kurzfristig<br />
zu erneuern und auszubauen, ohne<br />
das Budget mit einer Großinvestition<br />
zu belasten.<br />
Informationen:<br />
EVN AG - Energie-Versorgung<br />
Niederösterreich<br />
EVN Platz<br />
2344 Maria Enzersdorf<br />
Telefon: 0800 / 800 100<br />
Fax: 02236 / 200 – 2030<br />
e-mail: info @evn.at<br />
Homepage: www.evn.at<br />
KOMMUNAL 99<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
<strong>Kommunal</strong>traktore in der 40 PS-Klasse: STV32, STV36, STV40<br />
Die neuen von Kubota<br />
Kompaktes, robutes Design, leistungsstarke, umweltfreundliche Kubota-<br />
Dieselmotoren, komfortable Fahrerschutzkabinen mit ergonomisch angeordneten<br />
Bedienungselementen und Armaturen – das sind die besonderen Merkmale dieser<br />
neuen Kompakttraktoren-Serie von Kubota.<br />
Das 3-stufige Hydrostatgetriebe<br />
(von 0-30 km/h stufenlos),<br />
die Kraftabnahme<br />
für Zusatzgeräte von der<br />
Front-, Zwischenachs- und<br />
Heckzapfwelle (natürlich<br />
unter Last zuschaltbar), die<br />
leistungsstarke Hydraulikanlage,<br />
die hydraulische Lenkung,<br />
der Tempomat (um<br />
die Fahrgeschwindigkeit<br />
konstant zu halten) und der<br />
von Kubota patentierte Allradantrieb<br />
sind weitere Kon-<br />
100 KOMMUNAL<br />
struktionsmerkmale, die es<br />
möglich machen, dass die<br />
Kubota STV-Kompakttraktore<br />
im <strong>Kommunal</strong>bereich<br />
mit vielen Original Zusatzgeräten<br />
rund um das Jahr<br />
wirtschaftlich eingesetzt<br />
werden können.<br />
Winterdienst<br />
Die Original Zusatzgeräte<br />
(für den Winterdienst:<br />
Schneeschild, Schneefräse;<br />
STV 040 mit Zwischenachsmähwerk, Gras- und Laubsauger mit<br />
HochentleerungTraktoren.<br />
für die Rasenpflege: FrontoderZwischenachsmähwerk,<br />
Gras- und Laubsauger;<br />
für die Strassen- und<br />
Landschaftspflege: Strassenkehrmaschine,<br />
Frontlader,<br />
Transportanhänger) sind auf<br />
die Traktore optimal abgestimmt.<br />
Österreichs<br />
Nummer Eins<br />
Kubota ist weltweit der<br />
größte Hersteller von Kompakttraktoren.<br />
Auch in<br />
Österreich ist Kubota mit<br />
einem Marktanteil von über<br />
40% am Kompakttraktore<br />
Sektor die Nummer 1. In<br />
Österreich stehen ca. 5.000<br />
Kubota Kompakttraktore im<br />
Einsatz, etwa 50% davon<br />
sind mit Schneeschild,<br />
Schneefräse und Splittstreuer<br />
ausgerüstet, und<br />
bewähren sich so seit vielen<br />
Jahren auch unter härtesten<br />
Bedingungen im Winterdienst.<br />
ESCH-Technik und<br />
Kubota Vertriebspartner sind<br />
seit nahezu 25 Jahren der<br />
Garant, dass die Maschinen<br />
Service- und Ersatzteilmäßig<br />
optimal betreut werden.<br />
Die neuen Kubota STV-Kompakttraktore<br />
entsprechen<br />
den EU-Vorschriften und<br />
verfügen über eine EU-Typisierung<br />
bzw. Strassenzulassung.<br />
Informationen:<br />
ESCH-Technik GmbH,<br />
9300 St. Veit/Glan<br />
Tel.: 04212/2960-0 -<br />
1230 Wien<br />
Tel.: 01/6162300 oder<br />
4614 Marchtrenk/Linz,<br />
Tel.: 07243/51500<br />
www.esch-technik.at<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
Innovative Projekte von Telekom Austria<br />
Partner der Gemeinden<br />
Telekom Austria ist beim Ausbau von Breitband-Internet Partner der österreichischen<br />
Gemeinden. KOMMUNAL berichtete bereits von Projekten in Grafenwörth,<br />
St. Georgen, Perg und den Kärntner Gemeinden Nötsch, Feistritz/Gail und<br />
Hohenthurn. Die neuesten Projekte: „Buntes Fernsehen“ in Engerwitzdorf und<br />
ein innovatives Projekt mit der Gemeinde Arnoldstein.<br />
Mit „Buntes Fernsehen“ hat Telekom<br />
Austria in der oberösterreichischen<br />
Gemeinde Engerwitzdorf<br />
ein Innovationsprojekt entwickelt,<br />
das eine neue Dimension<br />
der regionalen TV-Nutzung über<br />
Breitband begründet. Jeder Bürger<br />
der Gemeinde Engerwitzdorf kann<br />
sich mit seinen eigenen Geschichten<br />
und Berichten in dieses Projekt<br />
einbringen, diese bearbeiten und<br />
dann auf eine Multimedia-Internet-<br />
Plattform laden. Die Benutzer des<br />
Mediums können sich dann aus den<br />
bereitgestellten Filmbeiträgen auf<br />
der Plattform jene auswählen, die<br />
sie gerne sehen möchten. Die<br />
besten Beiträge wurden bereits mit<br />
dem neu geschaffenen Medienpreis<br />
„Goldener Delfin“ ausgezeichnet.<br />
„Ich bin begeistert, mit welchem<br />
Engagement die Bürger von Engerwitzdorf<br />
diesem Pilotprojekt von<br />
Anfang an begegnet sind. Zudem gibt<br />
das ‚Bunte Fernsehen' einen wichtigen<br />
Impuls für die Stärkung der Wirtschaft<br />
in der Region Gusental“, ist sich Bürgermeister<br />
Johann Schimböck sicher.<br />
Basis: Breitband-Anschluss<br />
von Telekom Austria<br />
Möglich macht das „Bunte Fernsehen“<br />
die ADSL-Breitband-Technologie von<br />
Telekom Austria. Das Unternehmen hat<br />
bereits im Jahr 1999 die ADSL Technologie<br />
in Österreich eingeführt. Durch<br />
diese frühe Technologieeinführung gilt<br />
Österreich als Vorreiter in der internationalen<br />
ADSL-Entwicklung. In den vergangenen<br />
4 Jahren hat Telekom<br />
Austria insgesamt 780 Millionen Euro<br />
in den Ausbau der Breitband-Netze<br />
investiert. Jährlich kommen rund 140<br />
neue Vermittlungsstellen hinzu. So<br />
haben heute bereits 85 Prozent der<br />
102 KOMMUNAL<br />
Verleihung des Goldenen Delfins. Den Sonderpreis<br />
der Jury gewannen Felix Bauer und Bernhard<br />
Fürst (vorne v.l.). Im Hintergrund gratulieren<br />
Johann Schimböck, Bürgermeister Engerwitzdorf<br />
(v.l.n.r.), Manfred Moormann, Leiter Broadband<br />
Entertainment & Services Telekom Austria<br />
sowie der oö Landesrat Josef Stockinger.<br />
Haushalte in Österreich Zugang zu<br />
breitbandigem Internet über ADSL.<br />
Weitere Informationen zum „Bunten<br />
Fernsehen“ gibt es in der Postfiliale<br />
Gallneukirchen, auf dem Gemeindeamt<br />
Engerwitzdorf oder unter<br />
http://www.buntesfernsehen.at<br />
Glasfaserkabel für<br />
Arnoldstein<br />
Eine für Österreich bisher einzigartige<br />
Kooperation sind das Land Kärnten, die<br />
Gemeinde Arnoldstein und Telekom<br />
Austria eingegangen. Parallel mit der<br />
Verlegung der Fernwärmeleitungen in<br />
den nächsten drei Jahren installiert<br />
Telekom Austria im Rahmen dieses<br />
Pilotprojektes Glasfaserkabel. Diese<br />
neue Infrastruktur, die bis in die einzelnen<br />
Wohnungen verlegt wird („fibre to<br />
the home“), ermöglicht über ein und<br />
dasselbe Medium paralleles Surfen,<br />
Fernsehen und Telefonieren. „Mit den<br />
Übertragungsgeschwindigkeiten dieser<br />
Technologie werden völlig neue Dimensionen<br />
in der Internetnutzung erschlossen“,<br />
erklärt Telekom Austria Vorstandsdirektor<br />
Ing. Mag. Rudolf Fischer.<br />
„Ab jetzt stehen nur mehr die Inhalte<br />
und Anwendungen im Mittelpunkt,<br />
weil jegliche technische Beschränkungen<br />
auf der Übertragungsseite wegfallen.“<br />
Superschnell<br />
Über das Leitungsnetz werden im Endausbau<br />
rund 1.500 Haushalte mit sauberer<br />
Wärme und mit superschnellen<br />
Glasfaseranschlüssen versorgt sein. Mit<br />
diesen Lichtwellenleiteranschlüssen<br />
sind die Kunden mit der modernsten<br />
Infrastrukturtechnologie ausgestattet<br />
und damit sind für ein modernes Triple<br />
Play Service keine übertragungstechnischen<br />
Grenzen mehr gesetzt. Das Triple<br />
Play Angebot – Telefonie, Internet und<br />
TV – bietet den teilnehmenden Kunden<br />
in weiterer Folge innerhalb des lokalen<br />
Telekom Austria Mulitmedia Netzes<br />
kostenlose Sprachtelefonieübermittlung<br />
in Form von VoIP (Voice over IP).<br />
Diverse innovative und hochqualitative<br />
Internetdienste, beispielsweise aus dem<br />
eGovernment-Bereich sowie Security-<br />
Lösungen, sind in Vorbereitung. So soll<br />
Arnoldstein in Zukunft bei eGovernment-Projekten<br />
in Kärnten eine Vorreiterrolle<br />
übernehmen. Das innovative<br />
Mulitmedia Netzwerk in Arnoldstein<br />
wird alle Ansprüche erfüllen, die bereits<br />
heute ein wesentliches Kriterium für die<br />
Standortqualität sind.<br />
Informationen:<br />
Kostenlose Produktinfo Hotline von<br />
Telekom Austria: 0800 100 800<br />
Abfragetool für ADSL-Verfügbarkeit<br />
http://verfuegbarkeit.speed.at<br />
E.E.
Zentrallager von DEISS.<br />
DEISS Spezialsäcke<br />
Passend für<br />
jeden Müll<br />
Die Firma EMIL DEISS KG<br />
wurde 1931 als Sackfabrik<br />
in Hamburg gegründet. Die<br />
wichtigste Produktgruppe<br />
waren damals Jutesäcke zur<br />
Verpackung von z.B. Rohkaffee.<br />
Später erfolgte die<br />
Spezialisierung auf Müllsäcke<br />
und -beutel.<br />
Überr 3.500 verschiedene<br />
Artikel<br />
Heute ist DEISS Marktführer<br />
auf diesem Sektor. Über<br />
3.500 verschiedene Artikel<br />
führen wir in unserem Sortiment<br />
in gleich bleibender<br />
Qualität durch regelmäßige<br />
Produktion in Großchargen.<br />
Wenn es sich um den Müll-<br />
sack für die Gemeinde, die<br />
Straßenmeisterei, den<br />
Gebäudereiniger, den Entsorger,<br />
das Krankenhaus<br />
oder sonstige Spezialsäcke<br />
handelt, die Spezialisten<br />
von DEISS sind ihre kompetenten<br />
Ansprechpartner.<br />
Rasche<br />
Versorgung<br />
Das Lager in Wien bietet<br />
Ihnen:<br />
◆ geringen Kapital- und<br />
Platzeinsatz, da kurzfristige<br />
Abrufmöglichkeit<br />
vom Lager<br />
◆ Österreichweite<br />
Versorgung innerhalb von<br />
48 Stunden.<br />
Informationen:<br />
Wirtschafts-Info<br />
EMIL DEISS KG<br />
(GmbH & Co.)<br />
Altmannsdorfer Anger 63<br />
1120 Wien<br />
Tel.: 01/698 62 08 0 – Fax DW 44<br />
E-Mail: deiss@aon.at<br />
www.deiss.at<br />
KOMMUNAL 103<br />
E.E.
Wirtschafts-Info<br />
<strong>Kommunal</strong>kredit<br />
Gesundheitsfinanzierung<br />
Österreichs Gesundheitswesen ist europäische Spitze, doch der Finanzbedarf steigt<br />
von Jahr zu Jahr. Das Beispiel Landeskrankenhaus Vöcklabruck zeigt, wie innovative<br />
Finanzierungsmodelle unseren hohen Gesundheitsstandard auch in Zukunft<br />
finanzierbar machen.<br />
Der Standard der öffentlichen<br />
Gesundheitsversorgung in Österreich<br />
ist sehr hoch. Das zeigt<br />
eine von Eurostat veröffentlichte<br />
Befragung, wonach der Zufriedenheitsgrad<br />
mit der Gesundheitsversorgung<br />
in Österreich<br />
EU-weit am höchsten ist: Über<br />
80 % aller Österreicherinnen<br />
und Österreicher sind sehr<br />
zufrieden bzw. ziemlich zufrieden<br />
mit dem Gesundheitssystem.<br />
Diesen hohen Standard auch in<br />
Zukunft beizubehalten bzw.<br />
sogar zu verbessern stellt eine<br />
besonders große Herausforderung<br />
für die öffentliche Hand<br />
dar. Auf der Suche nach Kosten<br />
sparenden Alternativen kooperiert die<br />
öffentliche Hand immer öfter mit Privaten.<br />
Erste Beispiele zeigen das Potenzial<br />
derartiger Modelle in Österreich. Im<br />
heurigen Herbst wurde etwa das von<br />
104 KOMMUNAL<br />
Foto: Vamed<br />
Daten und Fakten zum<br />
LKH Vöcklabruck<br />
Das neue LKH Vöcklabruck<br />
verfügt über 35.000 m 2<br />
modernster medizinischer<br />
Ausstattung sowie 573 Betten.<br />
Jährlich können 180.000<br />
Untersuchungen bzw. Behandlungen,<br />
8.600 Planoperationen<br />
(zuzüglich Akut-Operationen<br />
und tagesklinische Eingriffe)<br />
sowie 25.000 stationäre Aufnahmen<br />
durchgeführt werden.<br />
Mit 1.200 Mitarbeitern zählt<br />
das LKH Vöcklabruck zu den<br />
größten Arbeitgebern in der<br />
Region. Die Gesamtkosten des<br />
Projekts beliefen sich auf EUR<br />
344 Mio.<br />
Das LKH Vöcklabruck bietet Medizinbetreuung am<br />
neusten Stand der Technik.<br />
der <strong>Kommunal</strong>kredit finanzierte Landeskrankenhaus<br />
(LKH) Vöcklabruck in<br />
Oberösterreich, eines der ersten großen<br />
heimischen PPP-Projekte im Krankenhausbereich,<br />
eröffnet.<br />
Beispiel<br />
LKH Vöcklabruck<br />
Die gesamte Abwicklung dieses Projektes<br />
von der Grundstücksbeschaffung<br />
über die Planung bis hin zur Auswahl<br />
des Finanzierungspartners erfolgte<br />
durch die Errichtungsgesellschaft LKV.<br />
Diese gehört zu 51 % der oberösterreichischen<br />
Wohnbaugesellschaft<br />
Lawog und zu 49 % dem privaten Projektpartner<br />
Vamed. Die Errichtungsgesellschaft<br />
übernahm beim Bau des<br />
Krankenhauses die volle Kosten-, Termin-<br />
und Qualitätsgarantie.<br />
Finanzierung des<br />
Projekts<br />
Gerade bei der Finanzierung ergänzen<br />
sich öffentliche und private Partner<br />
ideal: Weil die öffentliche Hand die<br />
Mittel nicht selbst aufnehmen muss,<br />
zählen diese nicht zur Maastricht-Verschuldung.<br />
Andererseits finanziert<br />
die Projektgesellschaft das Bauvorhaben<br />
durch die Bereitstellung einer<br />
Haftung durch den Krankenhausträger<br />
Gespag, einer 100%igen Tochter<br />
des Landes Oberösterreich, praktisch<br />
zu öffentlichen Konditionen.<br />
Die Finanzierung des LKH Vöcklabruck<br />
wurde von der Europäischen<br />
Investitionsbank (EIB), der <strong>Kommunal</strong>kredit<br />
und der Raiffeisen Landesbank<br />
Oberösterreich durchgeführt.<br />
Die <strong>Kommunal</strong>kredit hat dabei<br />
gemeinsam mit der LKV-Errichtungsgesellschaft<br />
ein spezifisches Finanzierungsmodell<br />
entwickelt, das durch die<br />
Verwendung strukturierter Produkte<br />
wesentliche Ersparnisse bei den Finanzierungskosten<br />
mit sich bringt.<br />
Raschere Abwicklung<br />
PPP-Projekte bringen neben finanziellen<br />
Vorteilen aber auch eine schnellere<br />
Abwicklung. In nur sechs Jahren wurde<br />
das LKH Vöcklabruck geplant,<br />
finanziert, errichtet und in Betrieb<br />
genommen.<br />
Informationen:<br />
Dipl.-Ing. Wolfgang Viehauser<br />
Abteilungsleiter-Stellvertreter<br />
Finanzierungen<br />
<strong>Kommunal</strong>kredit Austria AG<br />
Türkenstraße 9, 1092 Wien<br />
Tel.: 01/31 6 31-145<br />
Fax.: 01/31 6 31-99145<br />
E-Mail: w.viehauser@<br />
kommunalkredit.at<br />
www.kommunalkredit.at<br />
E.E.
Leonardo - Der österreichische<br />
Preis für Automatisierungslösungen<br />
wurde am 7.<br />
Oktober im Rahmen der<br />
Smart Automation in Linz<br />
vergeben. Der Leonardo-<br />
Award war heuer erstmals<br />
ausgeschrieben, um das Kreativpotential<br />
und Ingenieurswesen<br />
in der Automatisierungsbranche<br />
auszuzeichnen.<br />
Mit 61 Einreichungen wurden<br />
alle Erwartungen der Initiatoren<br />
weit übertroffen.<br />
Der EVVA-Maschinenbau musste<br />
sich mit namhaften österreichischen<br />
Top-Unternehmen<br />
der Maschinenbaubranche<br />
messen, wie TBM Automation<br />
& Anlagentechnik, Infineon<br />
Technologies, Chemserv Industrie,<br />
EMCO oder auch Sprecher<br />
Automation GmbH. Die<br />
3KS-Zylinderkernbearbeitungsmaschine<br />
holte sich aber mit<br />
hoher Punktezahl den Siegertitel.<br />
(3KS: 3-Kurven-System mit<br />
federnfreier Sperrstiftfunktion)<br />
Der Namensgeber dieses Preises<br />
ist Leonardo da Vinci, der<br />
mit seiner Definition schon vor<br />
500 Jahren den Begriff Automation<br />
treffend formulierte:<br />
"Prozesse vereinfachen und<br />
Maschinen effizienter gestalten".<br />
Genau dies ist auch der<br />
Angelpunkt der 3KS-Machine:<br />
mit 18 im Linear-Transfer-<br />
Prinzip miteinander verketteten<br />
Bearbeitungsstationen<br />
spart sie nicht nur sieben von<br />
Hand zu bedienende Einzelmaschinen<br />
ein, sondern auch<br />
die langen Durchlaufzeiten in<br />
der Fertigung, die Zwischenla-<br />
Wirtschafts-Info<br />
Gesucht war die beste Automatisierungslösung Österreichs<br />
EVVA: 1. Platz beim Leonardo Award<br />
gerung und die damit verbundenen<br />
logistischen Wege.<br />
Neben einer Qualitätssteigerung<br />
zeichnet sich diese<br />
Maschine durch hohe Leistung,<br />
Vollautomatisierung<br />
und große Zuverlässigkeit aus.<br />
Diese Maschine wurde zur<br />
Gänze in der Maschinenkonstruktion<br />
und Betriebelektrik<br />
der Konzernzentrale in Wien<br />
entwickelt in Anbetracht der<br />
neuesten Erkenntnisse der<br />
Steuerungs- und Robotertechnik.<br />
Der hauseigene Maschinen-<br />
und Werkzeugbau realisierte<br />
die gesamte Fertigung,<br />
Montage, Steuerungstechnik<br />
und Inbetriebnahme. Die<br />
Maschine läuft seit Juli 2003.<br />
KOMMUNAL 105
Wirtschafts-Info<br />
Aschach an der Donau: Paradebeispiel in der kommunalen Wasserwirtschaft<br />
Erfolgreiches Betriebsführungsmodell<br />
Im Jahr 2003 hat die Marktgemeinde<br />
Aschach/Donau (OÖ)<br />
die Betriebsführung der Wasserversorgung<br />
an die WDL-Wasserdienstleistungs<br />
GmbH ausgelagert.<br />
Die WDL ist seither für<br />
Wartung, Anlagenüberwachung,<br />
die Herstellung von Hausanschlüssen<br />
und für die Wasserzähler<br />
verantwortlich.<br />
Bgm. Rudolf Achleitner schildert<br />
die Situation wie folgt: „Für meine<br />
Gemeinde waren vor allem die hohen<br />
Qualitätsstandards zu leistbaren Kosten<br />
ausschlaggebend für die Auslagerung.<br />
Gerade die Versorgungssicherheit hat<br />
106 KOMMUNAL<br />
Bürgermeister<br />
Rudolf Achleitner<br />
nach den Erfahrungen des<br />
Hochwassers 2002 höchste<br />
Priorität.“<br />
Die WDL ist österreichweit<br />
bereits in einer Reihe von<br />
Gemeinden im Bereich Wasserver-<br />
und Abwasserentsorgung<br />
aktiv. Das Unternehmen<br />
bietet neben der Betriebsführung<br />
umfassendes Knowhow<br />
bei Planung, Neubau<br />
und Sanierung sowie speziell für die<br />
Kommunen entwickelte Finanzierungslösungen.<br />
Bgm. Achleitner zur bisherigen Zusammenarbeit<br />
„Wir haben als kleine<br />
Gemeinde mit der WDL einen fairen<br />
und verantwortungsbewußten Partner<br />
zur Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe<br />
gefunden, ohne dabei die wesentlichen<br />
Entscheidungen und die Gebührenhoheit<br />
aus der Hand zu geben.“<br />
Informationen:<br />
WDL-Wasserdienstleistungs GmbH<br />
Gruberstraße 40 - 42, A-4020 Linz<br />
Telefon: +43/732/3400-6392<br />
Mobil: +43/664/60 165 5407<br />
Fax: +43/732/3400 - 6252<br />
E-Mail: office@wdl.at<br />
E.E.
FMK rät zur Vorsicht: Betrug aufgeflogen<br />
Wirkungslose Chips<br />
gegen Elektrosmog<br />
Ein 56-jähriger Deutscher wurde jetzt<br />
vom Landgericht Gießen in 28 Fällen<br />
des gewerbsmäßigen Betrugs für<br />
schuldig befunden, weil er wirkungslose<br />
Aluminiumchips gegen Elektrosmog<br />
und Mobilfunkfelder verkauft<br />
hat. Der Mann wurde laut dpa zu<br />
sechs Jahren Haft verurteilt und war<br />
bereits einschlägig vorbestraft, weil er<br />
schwer krebskranken Menschen wirkungslose<br />
Tropfen verkauft hatte.<br />
Dass er nach einer deshalb verbüßten<br />
Haftstrafe gleich mit dem Vertrieb der<br />
so genannten „Feldprozessoren“<br />
begann, wurde dem Angeklagten vom<br />
Richter als erschwerend angelastet.<br />
Noch während seiner Bewährungszeit<br />
baute er mit „erheblicher krimineller<br />
Energie“ ein Vertriebsnetz für die dau-<br />
Verbindliche Grenzwerte machen Schutzprodukte<br />
gegen elektromagnetische<br />
Felder in der Mobiltelefonie überflüssig.<br />
mennagelgroßen Aluminiumplättchen<br />
auf, wie es in der Urteilsbegründung<br />
heißt. Die Plättchen verkaufte er für<br />
rund 300 Euro das Stück in ganz<br />
Deutschland. Laut einem gerichtlichen<br />
Gutachten sind die „Feldprozessoren“<br />
jedoch vollkommen wirkungslos<br />
und bestehen lediglich aus Aluminium<br />
und kupferfarbener Folie. „Der<br />
Angeklagte hat mit seinem pseudowissenschaftlichen<br />
Kauderwelsch<br />
Leute beeindruckt und ihnen das Geld<br />
abgenommen“, erklärte Staatsanwalt<br />
Lars Streiberger in seinem Plädoyer.<br />
Skepsis bestätigt<br />
Das Forum Mobilkommunikation<br />
(FMK) sieht sich anlässlich dieses<br />
Falls in seiner Skepsis gegenüber am<br />
Markt erhältlichen Schutzprodukten,<br />
die angeblich elektromagnetische Felder<br />
abschirmen oder neutralisieren,<br />
bestätigt. Gewebe, die Metall enthalten,<br />
verfügen zwar tatsächlich über<br />
eine gewisse abschirmende Wirkung -<br />
wer in seinem Haushalt auf Baldachine<br />
oder Tapeten dieser Art vertraut<br />
und in solchen Räumen mobil telefoniert,<br />
sollte aber bedenken, dass<br />
umgekehrt das Handy mehr Leistung<br />
benötigt, um zur nächsten Mobilfunkanlage<br />
zu senden.<br />
Keine abschirmende<br />
Wirkung<br />
Besonders kritisch bewertet das FMK<br />
vor allem Schutzprodukte wie Filzhüllen<br />
für Handys, kleine Schutzschilde,<br />
die auf das Handy geklebt werden,<br />
oder Metallringe, die um das Kabel<br />
eines Headsets gesteckt werden: In<br />
zahlreichen Tests solcher Produkte<br />
konnte die versprochene abschirmende<br />
Wirkung nicht bestätigt werden.<br />
Besonders schwierig zu bewerten<br />
sind eine ganze Reihe von<br />
„Chips“, die elektromagnetische Felder<br />
nicht abschirmen, sondern „neutralisieren“,<br />
also „schlechte“ Wellen in<br />
„gute“ Wellen umwandeln sollen: Ihre<br />
Wirkungsweise ist nach naturwissenschaftlichen<br />
Kriterien nicht nachvollziehbar,<br />
die Hersteller vermarkten<br />
ihre Produkte mit schwammigen,<br />
pseudowissenschaftlichen Erläuterungstexten,<br />
deren Wahrheitsgehalt<br />
ebenso schwer zu beweisen wie zu<br />
widerlegen ist. Insgesamt hält das<br />
FMK Schutzprodukte gegen elektromagnetische<br />
Felder des Mobilfunks<br />
für überflüssig: In Österreich gelten<br />
verbindlich die von der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) und der<br />
Europäischen Union (EU) empfohlenen<br />
und international weit verbreiteten<br />
Grenzwerte, die in der Praxis nur<br />
zu einem sehr geringen Teil ausgeschöpft<br />
werden. Und diese Grenzwerte<br />
schützen vor gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen sogar in dem<br />
theoretischen Maximalfall, dass man<br />
7 Tage pro Woche jeweils 24 Stunden<br />
mobil telefoniert.<br />
E.E.<br />
Wirtschafts-Info<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
T-Mobile<br />
Mag. Margit Kropik<br />
e-mail:<br />
environment@t-mobile.at<br />
Mobilkom Austria<br />
Mag. Claudia Übellacker<br />
e-mail:<br />
umwelt@mobilkom.at<br />
Connect Austria/one<br />
Ing. Johann Killian<br />
e-mail:external.affairs@one.at<br />
tele.ring<br />
Melpomene Kriz<br />
e-mail: melpomene.<br />
kriz@telering.co.at<br />
Hutchison 3G Austria<br />
Ernest Gabmann<br />
e-mail:<br />
ernest.gabmann@h3g.at<br />
Allgemeine Informationen:<br />
Forum Mobilkommunikation<br />
Mag. Thomas Barmüller<br />
Mariahilfer Straße 37-39<br />
A-1060 Wien<br />
Tel.: 01/588 39-14<br />
e-mail: barmueller@fmk.at<br />
www.fmk.at<br />
KOMMUNAL 107
Wirtschafts-Info<br />
Kosten sparen mit Kelag Dienstleistungen<br />
Gemeinde Velden<br />
erstrahlt in neuem Licht<br />
Die Vorteile sprechen für sich – Mehr Sicherheit, mehr Licht und dabei jährlich rund<br />
17.000,- Euro Einsparung.<br />
Die Gemeinde Velden hat sich entschlossen,<br />
das Projekt „Neue Straßenbeleuchtung“<br />
mit der Kelag gemeinsam<br />
umzusetzen. Aufgrund langjähriger<br />
Zusammenarbeit in vielen Bereichen,<br />
wandte sich die Gemeinde erneut an<br />
die Kelag und nahm deren Dienstleistungsangebot,<br />
das „EnergieMonitoring“<br />
in Anspruch. „Hier sind Leute am<br />
Werk, die ihre Sache verstehen“, vertraut<br />
Bürgermeister Ferdinand Vouk auf<br />
die Kelag.<br />
Full-Service<br />
Die Vorteile gegenüber anderen Anbietern<br />
liegen vor allem im Full-Service-<br />
Angebot der Kelag. So wird auf<br />
Wunsch der Gemeinde von der Analyse,<br />
über die Ausschreibung und<br />
Finanzierung bis hin zur Umsetzung<br />
von der Kelag alles durchgeführt. „Für<br />
uns war das Angebot der Kelag das<br />
Beste. Wir hatten keine zusätzlichen<br />
Aufwendungen, da die Kelag von der<br />
Datenaufnahme bis zur Umsetzung<br />
alles erledigt. Uns fehlen in der<br />
Gemeinde dafür die Fachleute. Bei<br />
anderen Unternehmen hätten wir diese<br />
Leistungen zukaufen müssen“, ist<br />
Bauingenieur Günter Ogris mit der<br />
kompetenten und umfassenden Betreuung<br />
zufrieden.<br />
Jährlich rund 17.000,-<br />
Euro gespart<br />
„Unsere Beleuchtung war schon renovierungsbedürftig.<br />
Bisher wurden<br />
immer wieder kleine Erneuerungen<br />
vorgenommen, die jedoch aufgrund der<br />
alten Lampentypen und der fehlenden<br />
Ersatzteile nicht zielführend waren,“<br />
beschreibt Betriebselektriker Walter<br />
Holzinger den Zustand der Straßen-<br />
108 KOMMUNAL<br />
Fotos: Kelag<br />
Mit der neuen Straßenbeleuchtung spart<br />
die Gemeinde Velden jährlich rund<br />
17.000,- Euro. (v. li) Bürgermeister Ferdinand<br />
Vouk, Alexander Errath (Kelag),<br />
Walter Holzinger und Günter Ogris.<br />
beleuchtung. Nach der gesamten<br />
Sanierung spart die Gemeinde Velden<br />
jährlich rund 17.000,- Euro. Auf<br />
Wunsch des Bürgermeisters werden<br />
auch die ortsansässigen Elektrikerbetriebe<br />
bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung<br />
mit einbezogen.<br />
Investitionskosten<br />
günstig finanziert<br />
Die Kelag bietet für Gemeinden Finanzierungen<br />
über Contracting. Die gesamten<br />
Investitionskosten werden von der<br />
Kelag vorfinanziert. Die Rückzahlungen<br />
finanzieren sich einerseits aus der Einsparung<br />
und andererseits über eine<br />
vereinbarte Rückzahlungsrate über<br />
einen bestimmten Zeitraum.<br />
Tourismus hat Tradition<br />
„Lebensader unserer Wirtschaft ist der<br />
Fremdenverkehr,<br />
und das schon<br />
seit 1864, als die<br />
Eisenbahn von<br />
Wien nach Triest<br />
gebaut wurde.<br />
Wir setzen zusätzlich<br />
zum Sommertourismus<br />
auf<br />
weitere Schienen.<br />
Einerseits bieten<br />
wir für Kongresse<br />
den geeigneten<br />
Rahmen mit unserer<br />
Infrastruktur<br />
und unseren Top-<br />
betrieben. Ein neues Veranstaltungszentrum<br />
ist geplant. Und andererseits ist<br />
der Veldener Advent ein Beispiel dafür,<br />
wie man auch abseits von Schipisten<br />
Interessantes in der Wintersaison bieten<br />
kann,“ berichtet Bürgermeister<br />
Vouk über die innovativen Ideen der<br />
Gemeinde. Wer einen schwimmenden<br />
Adventkranz am Wörthersee erleben<br />
möchte, muss in der Adventzeit nach<br />
Velden.<br />
Informationen:<br />
Bürgermeister Ferdinand<br />
Vouk vertraut<br />
auf die Kelag.<br />
Tel.: 0463/ 525-1644<br />
dienstleistungen@kelag.at<br />
www.kelag.at<br />
Foto: WTG<br />
E.E.
Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau<br />
Das ÖISS<br />
informiert<br />
Die Themen der nächsten Ausgabe umfassen: ÖISS-Richt-<br />
linien – in Überarbeitung, in Anwendung und druckfrisch<br />
– und die Standardisierung von Fluchtwegeprogrammen.<br />
Neue ÖISS Richtlinie für Indoor-<br />
Spiel- und Bewegungsräume<br />
Spiel- und Bewegungsräume in Kindergärten<br />
und Wohnhausanlagen haben Planer<br />
und Betreiber aber auch Inspektoren<br />
bisher vor zahlreiche offene Fragen<br />
gestellt. Unsicherheiten gab es einerseits<br />
in Hinblick auf eine sinnvolle und dem<br />
Alter der Nutzer entsprechendeAusstattung,<br />
aber auch hinsichtlich<br />
der Sicherheit<br />
dieser Räume. Bis dato<br />
standen zur Beurteilung<br />
nur die Spielgerätenormen<br />
und die Sporthallennorm<br />
zur Verfügung,<br />
welche jedoch die speziellen<br />
Anforderungen<br />
des Indoor- Spiel- und<br />
Bewegungsraumes<br />
nicht hinreichend erfassen.<br />
Dem interdisziplinär<br />
besetzten<br />
Arbeitskreis des ÖISS<br />
ist es nun gelungen,<br />
eine speziell auf diese<br />
Anforderungen abgestimmte<br />
Richtlinie zu<br />
verfassen. Diese beinhaltet<br />
Angaben<br />
◆ zu den Spiel- und<br />
Bewegungsbedürfnissen<br />
von Kindern und Jugendlichen,<br />
gegliedert nach Altersgruppen<br />
◆ zur Ausstattung, ebenfalls abgestimmt<br />
auf die Altersgruppen<br />
◆ zu den baulichen Anforderungen<br />
sowie wertvolle Hinweise für Betrieb,<br />
Die nächste Ausgabe der<br />
Inspektion und Wartung.<br />
chule- und Sportstätte<br />
rscheint am 17. Dezember<br />
»<br />
Die neue ÖISS Richtlinie<br />
kann zum Preis von elf<br />
Euro im ÖISS<br />
bestellt werden.<br />
Das ÖISS steht für<br />
Funktionalität,<br />
Effizienz und<br />
Qualität im<br />
Schul- und Sportstättenbau.<br />
DI Peter Gattermann<br />
Direktor des ÖISS<br />
Wieder Unfall mit Fußball-Tor!<br />
Durch die Verwendung nicht geeigneter<br />
mobiler Fußballtore kommt es in Österreich<br />
leider immer wieder zu schweren<br />
Unfällen. Den Pressemeldungen war zu<br />
entnehmen, dass eines dieser gefährlichen<br />
Tore beim Fußballtraining nun einen<br />
Teamspieler ernsthaft gefährdete.<br />
Insbesondere mobile<br />
Übungstore (Trainingstore),<br />
welche lediglich<br />
mit Erdhaken am<br />
Boden befestigt sind,<br />
stellen eine große,<br />
nicht einschätzbare<br />
Gefahr dar. Durch Tauwetter<br />
aufgeweichter<br />
Boden lässt das Tor<br />
selbst bei geringer seitlicher<br />
Belastung umfallen.<br />
Dies sollte beson-<br />
ders im Frühjahr<br />
beachtet werden.<br />
Schon seit Veröffentlichung<br />
einer speziellen<br />
ÖISS-Richtlinie von<br />
1986 fordert das ÖISS<br />
«<br />
die Produktion und<br />
Verwendung kippsicherer<br />
Fußballtore.<br />
Auf Basis dieser Richtlinie<br />
gelang es dem<br />
ÖISS in Zusammenarbeit<br />
mit dem Österreichischen Normungsinstitut,<br />
die ÖNORM S 4700 „Spielfeldgeräte<br />
– Fußballtore – Ergänzende<br />
Bestimmungen zur ÖNORM EN 748“ zu<br />
erarbeiten, die detaillierte Möglichkeiten<br />
zur Kippsicherheit für mobile freistehende<br />
Tore beschreibt. Ein vom ÖISS schon<br />
1983 in Zusammenarbeit mit der AUVA<br />
produzierter Warnkleber warnt zudem<br />
vor Verletzungsgefahren bei widmungswidrigem<br />
Gebrauch (z.B. Schaukeln an<br />
der Querlatte). Durch Einhaltung dieser<br />
Empfehlungen des ÖISS könnten viele<br />
Indoor-Spielangebote gewinnen an<br />
Bedeutung.<br />
jener Unfälle verhindert werden. So sind<br />
Betreiber wie Erhalter von Sportstätten<br />
neuerlich dazu aufgefordert zu überprüfen,<br />
ob die bei ihnen in Verwendung stehenden<br />
mobilen, freistehenden Tore wirklich<br />
kippsicher ausgebildet sind. Wenn<br />
nicht, sollten diese so rasch wie möglich<br />
durch kippsichere ersetzt werden.<br />
Vorsicht: Fluchtwegeprogramme<br />
Das ÖISS hat den europäischen Vorsitz<br />
über die Arbeitsgemeinschaft „Gestaltung<br />
und Anwendung von Fluchtwegeprogrammen“<br />
übernommen. Der Geschäftsführer<br />
der ÖISS-Datensysteme GesmbH,<br />
DI Peter Gattermann, wurde seitens der<br />
Ländervertreter Deutschlands und der<br />
Schweiz gebeten, die Fachgruppe zu leiten,<br />
in der eine europäische Richtlinie zur<br />
Zertifizierung von Fluchtwegeprogrammen<br />
erarbeitet werden soll. Aufgrund der<br />
Häufung von Anbietern von nicht zertifizierten<br />
Fluchtwegeprogrammen, die<br />
keine seriösen Ergebnisse für die Evaluierung<br />
von Fluchtwegen erlauben, sieht<br />
man sich gezwungen, in Österreich nur<br />
mehr Programme zuzulassen, die das<br />
Prüfzertifikat des ÖISS aufweisen. Die<br />
Fluchtwege-Berechnungen des ÖISS werden<br />
seit Jahren behördlich anerkannt<br />
und beruhen auf wissenschaftlich fundierten<br />
Erkenntnissen und erprobten<br />
Methoden. In letzter Zeit wurden die<br />
Stadthalle Wien, das Fußballstadion Salzburg,<br />
die Olympia-Eishalle Innsbruck und<br />
das Shopping Center Wien-Prater mit<br />
ÖISS-Programmen evaluiert.<br />
Österreichisches Institut für<br />
Schul- und Sportstättenbau<br />
Prinz-Eugen-Strasse 12, 1040<br />
Wien, Tel.: 01 505 88 99<br />
Fax: 01 505 88 99 20<br />
e-mail: office@oeiss.org<br />
url: www.oeiss.org<br />
Foto: Margarethe Tschannett<br />
E.E.
KOMMUNAL<br />
CHRONIK<br />
Gemeinde-Wachstuben: Unverzichtbar für die Sicherheit<br />
Ländle setzt auf regionale Struktur<br />
FELDKIRCH<br />
Beim Treffen der Gemeindesicherheitswachen<br />
Vorarlbergs<br />
Anfang Oktober in Feldkirch<br />
unterstrich Sicherheitslandesrat<br />
Schwärzler die Bedeutung<br />
dieser Einrichtungen für die<br />
Sicherheit in der Region: „Die<br />
Gemeindesicherheitswachen<br />
in Vorarlberg sind wichtige<br />
Exekutiv-, Informations- und<br />
Kontaktstelle für die Bürger,<br />
aber auch für die Bürgermeister<br />
in unseren Gemeinden.“<br />
Damit sind die Gemeindesicherheitswachenunverzichtbarer<br />
Teil der Vorarlberger Si-<br />
Neues Kapitel im „ewigen“<br />
Kärntner Streit um die zweisprachigen<br />
Ortstafeln.<br />
Zweisprachig: Erneut Beschwerde beim VfGH<br />
BLEIBURG<br />
Wegen der seiner Meinung<br />
nach fehlenden zweisprachigen<br />
Ortstafel in Bleiburg hat<br />
der Obmannstellvertreter des<br />
Rates der Kärntner Slowenen,<br />
Rudi Vouk, Mitte Oktober<br />
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof<br />
(VfGH) eingebracht.<br />
Der Verfassungsgerichtshof<br />
muss nun entscheiden, ob<br />
Bleiburg/Pliberk zweispra-<br />
Lärmschutz: Lebensqualität gestiegen<br />
NÖ Bahnanrainer atmen auf<br />
WIENER NEUSTADT<br />
Rund 50.000 Menschen<br />
sind in NÖ von<br />
Bahnlärm betroffen. Im<br />
Zuge des Bahnhofumbaus<br />
in Wiener Neustadt<br />
errichtet die ÖBB<br />
Lärmschutzwände mit<br />
einer Gesamtlänge von<br />
6,2 km. Projektleiter DI<br />
Reinhard Stradner<br />
über das Lärmschutzprojekt:<br />
„Die 3,8 Mio<br />
Euro-Investition bedeutet<br />
eine merkbar<br />
cherheitsarchitektur, so<br />
Schwärzler: „Sie haben gemeinsam<br />
mit der Gendarmerie<br />
wesentlichen Anteil am<br />
hohen Sicherheitsstatus unseres<br />
Landes.“ Erfreulich sei<br />
auch die gemeinsame Ausund<br />
Fortbildung sowie die<br />
gute Zusammenarbeit der Gemeindepolizisten<br />
mit der<br />
Gendarmerie. „Ich bin froh,<br />
dass die Gemeindesicherheitswachen<br />
ein hohes Vertrauen<br />
der Bevölkerung genießen<br />
und die Bürgermeister auch<br />
bereit sind, die Gemeindepolizisten<br />
in Wahrnehmung der<br />
höhere Lebensqualität<br />
für die Neustädter.“ Die<br />
Bauarbeiten entlang<br />
der Südbahn und Pottendorferlinie<br />
dauern<br />
noch bis Ende 2004.<br />
Mit über 35 Gemeinden<br />
wurden in NÖ bisher<br />
entsprechende Verträge<br />
geschlossen. Voraussetzung<br />
für die Realisierungentsprechender<br />
Maßnahmen ist<br />
der Schienenverkehrslärmkataster<br />
von 1993.<br />
öffentlichen Sicherheitsaufgaben<br />
gemeindeübergreifend<br />
einzusetzen. Vorarlberg wird<br />
auch weiterhin die Gemeindesicherheitswachenfinanziell<br />
unterstützen.“<br />
Schwärzler dankte auch dem<br />
scheidenden Landesobmann<br />
der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,Bundesrat<br />
Edgar Mayer, sowie dem<br />
Vorsitzenden der Sektion Sicherheitswache,Chefinspektor<br />
Ernst Böhler, namens des<br />
Landes für ihren besonderen<br />
Einsatz und die langjährige<br />
gute Zusammenarbeit.<br />
Keine Ruhe um Ortstafeln<br />
Lärmschutz hebt<br />
die Lebensqualität.<br />
chige Ortstafeln bekommt.<br />
Ein solches Verfahren läuft<br />
auch für die Ortschaft Loibach.<br />
Der Fall in Bleiburg ist laut<br />
Vouk ähnlich gelagert wie bei<br />
St. Kanzian, wo er vor drei<br />
Jahren Beschwerde einbrachte.<br />
In Bleiburg liege laut<br />
Volkszählung 2001 der Anteil<br />
der slowenischen Volksgruppe<br />
mit 16 Prozent sogar<br />
höher als in St. Kanzian.<br />
Spitäler: Hohe Einsparungen möglich?<br />
Allein in Wien 190 Millionen<br />
WIEN<br />
Eine vom Institut für<br />
Höhere Studien (IHS)<br />
angestellter Vergleich<br />
der Effizienz von<br />
Ordensspitälern und<br />
städtischen Krankenhäusern<br />
ergab allein<br />
in Wien ein Sparpotential<br />
von 190 Millionen<br />
Euro. Da die<br />
Ordensspitäler straff<br />
organisiert sind,<br />
gehen Einsparungen<br />
schneller, so das IHS.<br />
Gemeindesicherheitswachen<br />
geniessen nicht nur in Vorarlberg<br />
ein hohes Vertrauen<br />
der Bevölkerung.<br />
Südtirol: Nahversorger<br />
Spitzenreiter im<br />
Alpenraum<br />
BOZEN<br />
Bei der Nahversorgung ist<br />
Südtirol im Vergleich zum<br />
restlichen Alpenraum statistischer<br />
Spitzenreiter. Das geht<br />
aus einer Studie der Arge Alp<br />
hervor. In Südtirol kommen<br />
auf 1000 Einwohner zwölf<br />
„Einzelhandelspunkte“. In<br />
Tirol kommen auf 1000 Einwohner<br />
acht kleine Geschäfte,<br />
in Bayern rund fünf.<br />
Erschwerend wirkt<br />
bei den öffentlichen<br />
Spitälern, dass die<br />
Spitalfonds der Länder<br />
unterschiedliche<br />
Aufgaben haben. Das<br />
macht eine Vergleichbarkeit<br />
unmöglich.<br />
Einsparungen wären<br />
jedoch bei Zusammenlegungen<br />
von<br />
Labors, Kantinen und<br />
Gebäudeverwaltung<br />
locker möglich.
Geschichte<br />
Geschichte als Baustein im Marketing-Konzept<br />
Gemeinden sind auch<br />
„gelebte“ Geschichte<br />
Geschichte ist eine Brücke – eine Brücke vom Gestern zum Heute, eine Brücke vom<br />
Heute zum Morgen. „Runde“ Jahrestage wie „100 Jahre Markterhebung“ oder „75 Jahre<br />
Freiwillige Feuerwehr“ ebenso wie neue Tourismuskonzepte und Revitalisierungsprojekte<br />
wecken das Interesse an der Geschichte der Gemeinde, an der Geschichte einzelner<br />
kommunaler Einrichtungen. KOMMUNAL berichtet über das „Wie“.<br />
◆ Dr. Georg Lehner<br />
Ob zu einem ganz bestimmten Anlass<br />
oder ganz unabhängig von Jubiläen –<br />
das Wissen um (die eigene) Geschichte<br />
zeigt immer Wirkung. Nach außen dient<br />
Geschichte als Ausweis für Entwicklung<br />
und Beständigkeit, nach innen zur Stärkung<br />
der eigenen Identität.<br />
Die Möglichkeiten, Geschichte zu präsentieren,<br />
sind vielfältig:<br />
◆ In gedruckter Form: Die Bandbreite<br />
reicht von der Broschüre über eine<br />
detaillierte Chronik/Geschichte bis hin<br />
zu repräsentativen Bildbänden.<br />
◆ In Ausstellungen: von der kleinen Präsentation<br />
im Rahmen der Tourismusinformation<br />
bis hin zur Konzeption und<br />
Einrichtung oder Neugestaltung eines<br />
eigenen Museums)<br />
◆ Im Internet: von der Kurzpräsentation<br />
bis zum virtuellen Rundgang durch die<br />
Geschichte der eigenen Geschichte<br />
◆ Im Rahmen von Tourismusprojekten:<br />
Geschichte als Erlebnis im Rahmen<br />
◆ Dr. Georg Lehner ist geschäftsführender<br />
Gesellschafter von Lehner<br />
& Lehner. Historische Forschung<br />
112 KOMMUNAL<br />
regionaler Leitthemen (Präsentation<br />
eines für die Gemeinde/Region wichtigen<br />
Produkts, Geschichte eines Leitbetriebs<br />
in der Region, u.s.w.)<br />
Diese Darstellungsformen lassen sich<br />
individuell nach Bedarf sowohl unabhängig<br />
voneinander als auch in beliebiger<br />
Kombination<br />
einsetzen. Allen<br />
gemeinsam ist, dass<br />
sie sorgfältig<br />
geplant und professionell<br />
umgesetzt<br />
werden müssen.<br />
Dieser Prozess läuft<br />
in der Regel in drei<br />
Phasen ab:<br />
◆ Konzeption<br />
◆ Organisation<br />
◆ Realisation<br />
Diese Gliederung<br />
macht den Projektverlauf<br />
transparent,<br />
wodurch aufwändige<br />
Nachjustierungen vermieden werden<br />
können und ein termingerechter<br />
Abschluss gewährleistet wird.<br />
Die Geschichte einer<br />
Gemeinde<br />
Nach außen<br />
dient Geschichte<br />
als Ausweis für<br />
Entwicklung und<br />
Beständigkeit,<br />
nach innen zur<br />
Stärkung der<br />
eigenen Identität.<br />
Unabhängig vom Umfang der Darstellung<br />
sollte am Ende ein abgerundetes<br />
Bild stehen. Es soll kein Abschnitt der<br />
Geschichte bewusst ausgespart bleiben –<br />
Kriegszeiten, Phasen wirtschaftlicher<br />
Schwierigkeiten oder auch die Konfron-<br />
tation mit Naturkatastrophen sollen<br />
berücksichtigt werden, denn auch diese<br />
Zeitabschnitte und Ereignisse haben zu<br />
dem beigetragen, was eine Gemeinde<br />
heute prägt.<br />
Am Beginn stehen Fragen nach besonderen<br />
Schwerpunkten: Welches Ziel soll<br />
mit der Darstellung verfolgt werden?<br />
An welches Publikum richtet<br />
sich die Darstellung? Welche<br />
Quellen stehen zur Verfügung –<br />
vor Ort, in der Region, auf Landesebene?<br />
Was kann man tun,<br />
falls für einen längeren Zeitraum<br />
aussagekräftige Dokumente nicht<br />
(mehr) vorhanden sind? Soll die<br />
Bevölkerung vor Ort in das Projekt<br />
eingebunden werden (Oral<br />
history)?<br />
In der Regel soll die Präsentation<br />
der Geschichte eines Ortes<br />
sowohl die Bevölkerung vor Ort<br />
(Stärkung der Identität) als auch<br />
an interessierte „Außenstehende“<br />
ansprechen. Deshalb wird die Schwerpunktsetzung<br />
in der Regel von den vorhandenen<br />
beziehungsweise verfügbaren<br />
historischen Quellen (Akten, Urkunden,<br />
Karten und Pläne sowie alte Ansichten)<br />
mitbestimmt.<br />
In manchen Fällen steht vor einer Sichtung<br />
der Quellen die Ordnung des<br />
Gemeindearchivs, das zusammen mit<br />
dem Landesarchiv als eine Art „schriftliches<br />
Gedächtnis“ den Ausgangspunkt<br />
für Projekte dieser Art bildet.<br />
Kernelemente, die in einer Ortsgeschichte<br />
nicht fehlen dürften, sind die
Entwicklung von Natur- und Siedlungsraum,<br />
die erste urkundliche Erwähnung<br />
und die Entwicklung der rechtlichen<br />
Stellung des Ortes (gegebenenfalls<br />
Markt- beziehungsweise Stadtrecht).<br />
Damit verbunden ist meist eine Darstellung<br />
der Gemeindeverwaltung im Wandel<br />
der Zeiten. Die Darstellung wird<br />
lebendiger durch Angaben zum Leben<br />
der Bevölkerung im Wandel der Zeiten<br />
(Bevölkerungsentwicklung, soziale Verhältnisse,<br />
Schulwesen, Pfarre etc.).<br />
Dazu kommt die Darstellung des wirtschaftlichen<br />
Werdens der Gemeinde.<br />
Neben der historischen Entwicklung von<br />
Handwerk und Gewerbe, den Phasen<br />
der Industrialisierung und der touristischen<br />
Erschließung der jeweiligen<br />
Region zählt dazu auch die Geschichte<br />
der lokalen Infrastruktur (Entwicklung<br />
von Verkehrswegen, kommunalen Diensten,<br />
etc.).<br />
Bei der Darstellung der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung finden auch regionale Leitbetriebe<br />
und die heute selten gewordenen<br />
– für die Gemeinde seinerzeit aber<br />
„typischen“ – traditionellen Handwerke<br />
Beachtung. Ähnliches gilt für die Landwirtschaft<br />
(z.B. landwirtschaftliche Produkte,<br />
die eine Region geprägt haben<br />
oder noch immer prägen).<br />
Ein wesentliches Element jeder Ortsgeschichte<br />
sind Hintergrund und Entwicklung<br />
des lokalen Brauchtums und der<br />
örtlichen Vereine (Freiwillige Feuerwehr,<br />
Musikvereine, Sportvereine, etc.). Spezi-<br />
ell in diesem<br />
Bereich ist es sinnvoll,<br />
bei den<br />
Recherchen die<br />
Bevölkerung einzubinden.<br />
Es ist<br />
durchaus möglich, dass sich daraus<br />
Impulse für das gesellschaftliche Leben<br />
in der Gemeinde ergeben.<br />
Unabhängig vom Medium – ob Broschüre,<br />
Buch, Film, Dokumentation oder<br />
Web-Präsentation – sind Übersichtlichkeit<br />
und ein klar erkennbarer Bezug auf<br />
die Gegenwart oberste Prinzipien bei<br />
der Darstellung. Dazu gehört auch die<br />
Präsentation von Daten, die weitere<br />
Nachforschungen unterstützen können –<br />
z.B. Listen der Hausbesitzer, Angaben<br />
zur Entwicklung der Häusernummerierung<br />
und in Verbindung damit die (Um-<br />
)Benennung von Verkehrsflächen.<br />
Gerade diese Angaben haben einen klar<br />
erkennbaren Bezug zum Heute und<br />
erleichtern den Zugang zur eigenen<br />
Geschichte (z. B. im Rahmen familiengeschichtlicher<br />
Forschungen).<br />
Geschichte als<br />
Dienstleistung<br />
Die Geschichte einer<br />
Gemeinde kann auch in<br />
größerem – politischem<br />
und wirtschaftlichem –<br />
Zusammenhang gesehen<br />
werden. Nicht nur<br />
im Zuge der jüngsten<br />
EU-Erweiterung ist<br />
unter anderem auf<br />
regionaler und lokaler<br />
Ebene das Interesse an<br />
Geschichte<br />
Es soll kein Abschnitt der Geschichte bewusst ausgespart bleiben<br />
– Kriegszeiten, Phasen wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder auch<br />
die Konfrontation mit Naturkatastrophen sollen berücksichtigt<br />
werden, denn auch diese Zeitabschnitte und Ereignisse haben zu<br />
dem beigetragen, was eine Gemeinde heute prägt.<br />
grenzüberschreitender Kooperation deutlich<br />
geworden. Bei der Durchführung<br />
aktueller und zukunftsorientierter Projekte<br />
und Kooperationen (InterReg-Projekte,<br />
EuRegio-Projekte, etc.) eröffnet das<br />
Wissen um eine gemeinsame Vergangenheit<br />
durchaus<br />
ungeahnte Möglichkeiten<br />
und<br />
wichtige Impulse.<br />
Das Wissen um die<br />
eigene Geschichte<br />
kann auch bei der<br />
Erstellung von Nutzungskonzepten<br />
im<br />
Zusammenhang<br />
mit der Revitalisierung<br />
historischer<br />
Bauten (Schlösser,<br />
aufgelassene Klöster,Industriedenkmäler)<br />
sinnvoll eingesetzt<br />
werden.<br />
Auf diese Weise<br />
Das Wissen um die<br />
eigene Geschichte kann<br />
bei der Erstellung von<br />
Nutzungskonzepten im<br />
Zusammenhang mit der<br />
Revitalisierung historischer<br />
Bauten sinnvoll<br />
eingesetzt werden.<br />
Geschichte<br />
kann zum wertvollen<br />
Aktivposten<br />
werden, mit dem<br />
man den Anforderungen<br />
der Gegenwart<br />
begegnen und<br />
für die Zukunft<br />
planen kann.<br />
wird Geschichte zum Erlebnis und immer<br />
zum unverwechselbaren Markenzeichen<br />
(History Marketing, Corporate Reputation).<br />
Denn<br />
Geschichte „schlummert“<br />
überall: Durch<br />
fachkundige Beratung<br />
und Unterstützung<br />
werden dabei viele<br />
neue Perspektiven<br />
eröffnet: Geschichte<br />
wird so zum wertvollen<br />
Aktivposten, mit<br />
dem man den Anforderungen<br />
der Gegenwart<br />
begegnen und<br />
auch für die Zukunft<br />
planen kann.<br />
KOMMUNAL 113
Europäische Dorferneuerung<br />
„Der Europäische Dorferneuerungspreis 2004 geht an Ummendorf in Sachsen-Anhalt,<br />
das dem Wettbewerbsmotto „Aufbruch zur Einzigartigkeit“ durch eine vorbildhafte<br />
Bürgerbeteiligung und einen intelligenten Umgang mit den eigenen Stärken auf überzeugende<br />
Weise gerecht geworden ist..“ Mit diesem Worten überreichte der Vorsitzende<br />
der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung, Niederösterreichs<br />
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, den Dorferneuerungs-Preis 2004.<br />
Europas Dörfer unterwegs zur Einzigartigkeit<br />
Courage zum Aufbruch<br />
„Das knapp über 1000 EinwohnerInnen<br />
zählende Ummendorf liegt im nordwestlichen<br />
Teil der Magdeburger Börde rund<br />
zehn Kilometer von der ehemaligen innerdeutschen<br />
Grenze entfernt. Es startete<br />
unmittelbar nach der Grenzöffnung ein<br />
Dorferneuerungsprogramm, das über<br />
eine Vielzahl an aufeinander abgestimmten<br />
Maßnahmen, die alle Lebens- und<br />
Wirtschaftsbereiche umfassen, zu sozioökonomischer<br />
Stabilität und kultureller<br />
Aufbruchstimmung geführt hat. Ebenfalls<br />
am Siegerpodest finden sich das<br />
Steirische Vulkanland, Steiermark, das<br />
für eine einzigartige, kreative und zeitgemäße<br />
Entwicklung im regionalen Verbund<br />
steht, und die Gemeinde Heinerscheid,<br />
Luxemburg,<br />
als ein herausragendes<br />
Beispiel für nachhaltige,<br />
innovative<br />
kommunale Wertschöpfung“,<br />
erklärte<br />
der Vorsitzende der<br />
17-köpfigen, internationalenWettbewerbsjury,<br />
Univ.-Prof. Dipl.-<br />
Ing. Matthias Reichenbach-Klinke,Technische<br />
Universität München.<br />
Die Courage zum<br />
„Aufbruch zur Einzig-<br />
114 KOMMUNAL<br />
»<br />
Viele Bewohner der<br />
ländlichen Räume<br />
Europas haben<br />
bewiesen, dass sie<br />
über genug Kraft,<br />
Know-how und<br />
Courage verfügen,<br />
ihre Geschichte<br />
selbst zu schreiben.<br />
Dr. Erwin Pröll<br />
Landeshauptmann von<br />
Niederösterreich<br />
artigkeit haben neben den drei Finalisten<br />
auch alle anderen der insgesamt 32<br />
Teilnehmer aus ebenso vielen europäischen<br />
Ländern bzw. Regionen bewiesen.<br />
Unter vielen guten Projekten wurden die<br />
elf Besten mit einem „Europäischen Dorferneuerungspreis<br />
für ganzheitliche,<br />
nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung<br />
von herausragender Qualität“<br />
ausgezeichnet. 13 Teilnehmer dürfen<br />
sich über einen „Europäischen Dorferneuerungspreis<br />
für besondere Leistungen<br />
in mehreren Bereichen der Dorfentwicklung“,<br />
sieben über eine „Besondere<br />
Anerkennung“ freuen.<br />
Der Wettbewerb um den Europäischen<br />
Dorferneuerungspreis wurde 1990 von<br />
der Europäischen<br />
«<br />
ARGE Landentwicklung<br />
und Dorferneuerung<br />
mit dem<br />
Ziel, den Erfahrungsaustausch<br />
zu fördern<br />
und die gesamtgesellschaftliche<br />
Bedeutung der ländlichen<br />
Regionen der<br />
europäischen Öffentlichkeit<br />
bewusst zu<br />
machen, ins Leben<br />
gerufen. Er wird im<br />
Zwei-Jahre-Rhythmus<br />
veranstaltet und<br />
wurde heuer zum achten Mal vergeben.<br />
Bewertet wurden neben der äußeren<br />
Erscheinung vor allem die inneren Qualitäten<br />
der Dörfer. Fragen der Architektur,<br />
der Siedlungsentwicklung, der Ökologie<br />
und der Energieversorgung spielten<br />
dabei ebenso eine Rolle wie soziale<br />
Einrichtungen, kulturelle Initiativen und<br />
Bemühungen um eine regionsangepasste<br />
wirtschaftliche Entwicklung. Wesentlich<br />
dabei waren ein ganzheitlicher<br />
Ansatz, eine Orientierung in Richtung<br />
Nachhaltigkeit und eine von Bürgerbeteiligung,<br />
Eigeninitiaive und Kooperationsbereitschaft<br />
geprägte Methodik der<br />
Umsetzung. Nicht zuletzt ging es auch<br />
darum, dem Motto gerecht zu werden.<br />
„Der Wettbewerb um den Europäischen<br />
Dorferneuerungspreis 2004 hat ganz<br />
deutlich gezeigt: Viele Bewohnerinnen<br />
und VerantwortungsträgerInnen der<br />
ländlichen Räume Europas haben den<br />
Auftrag zur eigeninitiativen Zukunftsgestaltung<br />
angenommen und bewiesen,<br />
dass sie über genug Kraft, Know-how<br />
und Courage verfügen, ihre Geschichte<br />
selbst zu schreiben“, schloss Erwin Pröll.<br />
Dem Festakt in Raggal im Großen Walsertal<br />
wohnten zahlreiche hochrangige<br />
Persönlichkeiten und rund 800 Dorferneuerungsakteuren<br />
aus 15 europäischen<br />
Staaten bei.
Jüngster Bürgermeister in ältester Tiroler Höhensiedlung<br />
In der Ruhe liegt<br />
die Kraft<br />
Wie von einem jungen Mann erwartet, ist Bernd Huber viel unterwegs. Allerdings<br />
nicht von einem rauschenden Fest zum nächsten. Vielmehr „bereist“ er als jüngster<br />
österreichischer Bürgermeister seine Gemeinde Pfafflar in Tirol. Hier in der stillen<br />
Bergwelt bemüht er sich, die Jungen an den Ort zu binden.<br />
Die kleine Gemeinde Pfafflar im<br />
Bezirk Reutte, älteste Höhensiedlung<br />
Tirols, ist Heimat des jüngsten Bürgermeister<br />
Österreichs. Bernd Huber,<br />
23 Jahre jung, bekleidet dieses Amt<br />
seitdem er am 7. März 2004 zum<br />
Bürgermeister gewählt worden war.<br />
Arbeitsreich<br />
Er übt es aus zwei Gründen hauptberuflich<br />
aus. Zum einen bedarf die<br />
Bewältigung der Aufgaben des Bürgermeisters<br />
noch des Einlebens. Zum<br />
anderen ist Huber gleichzeitig als<br />
Gemeindeamtsleiter für seine Mitbürger<br />
tätig, nur Buchhaltung und Kassa<br />
gehören – auch aus rechtlichen<br />
Gründen – nicht zu seinem Aufgabengebiet,<br />
sodass es genug zu tun<br />
gibt. Später einmal wird er aber mit<br />
großer Wahrscheinlichkeit in seinen<br />
erlernten Beruf als Bautechniker<br />
zurückkehren und die Arbeit für die<br />
Gemeinde nebenberuflich erledigen.<br />
Zurück zu den Wurzeln<br />
Bürgermeister Bernd Huber wuchs in<br />
Pfafflar (eigentlich im Ortsteil Bschlabs,<br />
siehe Kasten „Ortsgeschichte“) auf, wo<br />
er auch die Volksschule besuchte. Nach<br />
dem Abschluss der Hauptschule in Elbigenalp<br />
besuchte Bernd Huber die HTL<br />
für Bautechnik in Imst. Für den Besuch<br />
der Schule verließ er Pfafflar, um acht<br />
Jahre später wiederzukehren und die<br />
Führung des Orts zu übernehmen.<br />
Zuvor besuchte er noch ein IT-Kolleg in<br />
Imst, leistete dort auch seinen Zivildienst<br />
beim Roten Kreuz und arbeitete<br />
als Bautechniker für eine Reuttener<br />
Baufirma. Größtes Anliegen des jungen<br />
Bernd Huber, mit 23 Jahren jüngster Bürgermeister<br />
Österreichs. Sein größtes Anliegen: das<br />
langsame Aussterben von Pfafflar zu stoppen.<br />
Den Jungen sollen Anreize geboten werden, im<br />
Ort zu bleiben.<br />
Die Gemeinde Pfafflar setzt sich aus<br />
drei Ortschaften zusammen: Boden,<br />
Bschlabs und Pfafflar. Die erste<br />
Erwähnung von Pafflar findet sich im<br />
Jahre 1288 als „Fafflar“. Im 13. und<br />
14. Jahrhundert wurden Schwaighöfe<br />
in diesem Gebiet vor allem von den<br />
Herrn von Starkenberg errichtet. Vor<br />
zweihundert Jahren endete die dauernde<br />
Besiedlung der Ortschaft und<br />
sie wurde wieder als Alm genützt.<br />
Erhalten aus der Zeit der dauernden<br />
Besiedlung sind 14 Holzhäuser, womit<br />
die Ortschaft als älteste fast erhaltene<br />
Höhensiedlung in Tirol gilt. Erst 1955<br />
konnte das letzte der Häuser in Pfaf-<br />
Porträt<br />
Bürgermeisters: Das langsame Aussterben<br />
des Ortes zu stoppen.<br />
Als einziger aus seinem Jahrgang im<br />
Ort Verbliebener möchte er für den<br />
Nachwuchs Anreize schaffen, in<br />
Pfafflar den Lebensmittelpunkt zu<br />
behalten.<br />
Bauplätze als Argument<br />
So sollen die Jungen durch die<br />
Schaffung von Bauplätzen die Möglichkeit<br />
erhalten, Häuser zu bauen.<br />
Dann könnte auch die Schließung<br />
der Volksschule in Bschlabs – jene in<br />
Boden wird wahrscheinlich in vier<br />
Jahren geschlossen – noch einmal<br />
verhindert werden. Der Kindergarten<br />
wird bald einmal, da kein Nachwuchs<br />
in Sicht ist, zusperren müssen.<br />
Walter Grossmann<br />
Ortsgeschichte der Gemeinde Pfafflar in Tirol<br />
flar elektrifiziert werden. Bschlabs<br />
wird bereits 40 Jahre früher urkundlich<br />
erwähnt, im Jahre 1448 als<br />
„Bislaves“. Bschlabs gehörte bis ins<br />
Jahre 1938 zur Gemeinde Imst. Um<br />
1640 wurde die Kaplaneikirche Maria<br />
Schnee gebaut, welche im 18. Jahrhundert<br />
vergrößert wurde. 1629<br />
wurde das Tal in einen Steuerbezirk<br />
zusammengefasst und dem Gericht<br />
Imst unterstellt. Erst in den Jahren<br />
1938 und 1947 kam Pfafflar zum<br />
Bezirk Reutte.<br />
Quelle: http://www.geschichtetirol.com<br />
KOMMUNAL 115
Porträt<br />
Sonja Ottenbacher, Psychotherapeutin und Bürgermeisterin<br />
„Du bist halt schon<br />
sehr sozial“<br />
Übernimmt eine Frau ein Amt, das fest in Männerhand gewesen war, dann hat sie mit<br />
Vorurteilen und um Anerkennung zu kämpfen. So auch Sonja Ottenbacher, berufswegen<br />
Kennerin der menschlichen Seele, die diesen Kampf mit ihrer herzlichen und offenen Art<br />
aber auch dank des „im Pinzgau sehr offenen Denken“ bald für sich entschieden hat.<br />
◆ Walter Grossmann<br />
1999 gewann die VP in der Gemeinde<br />
Stuhlfelden überraschend ein Mandat<br />
dazu und damit den Posten des Vizebürgermeisters.<br />
Dieses<br />
Amt übernahm die<br />
damalige Quereinstei-<br />
gerin in die Politik, die<br />
diplomierte Krankenschwester<br />
und Psychotherapeutin<br />
Sonja<br />
Ottenbacher. Fünf<br />
Jahre war sie als Vizebürgermeisterin<br />
aktiv<br />
und überzeugte die<br />
Leute in vielen<br />
Gesprächen und Kontakten,<br />
sodass sich<br />
diese durchaus eine „Frau Bürgermeisterin“<br />
vorstelllen konnten. Denn nach<br />
36 Jahren an der Spitze von Stuhlfelden<br />
war für den damaligen Bürgermeister<br />
Johann Steiner klar, dass die Zeit<br />
für eine Wachablöse gekommen sei.<br />
Dass diese Ablöse durch eine Frau<br />
erfolgte, ging dann zwar nicht ganz<br />
konfliktfrei über die Bühne, aber mit 81<br />
Prozent gewann Sonja Ottenbacher<br />
2004 die Wahl zur Bürgermeisterin eindrucksvoll.<br />
Gut, dass wir Dich haben<br />
Sonja Ottenbacher, die in Stuhlfelden<br />
geboren ist, aber dann den Ort verließ,<br />
um 16 Jahre lang in Salzburg als diplomierte<br />
Krankenschwester in der Landesnervenklinik<br />
zu arbeiten, absolvierte<br />
nebenbei die Ausbildung zur<br />
Psychotherapeutin. Sie kam nach<br />
116 KOMMUNAL<br />
Mit 81 Prozent<br />
der Stimmen gewann<br />
Sonja Ottenbacher<br />
die Wahl zur<br />
Bürgermeisterin<br />
eindrucksvoll.<br />
Stuhlfelden zurück und eröffnete eine<br />
Praxis für Psychotherapie in Mittersil.<br />
Sie engagierte sich im Ort – so ist sie<br />
beispielsweise die<br />
bereits zweite Periode<br />
im Pfarrgemeinderat –<br />
war fünf Jahre Vizebürgermeisterin<br />
und ist<br />
nunmehr seit acht<br />
Monaten Bürgermeisterin.<br />
Zwar gab es anfangs<br />
das eine oder andere<br />
Bedenken („Du bist halt<br />
schon sehr sozial“ oder<br />
die Vorstellung, dass<br />
„das baumäßige eher<br />
Männern zugedacht“<br />
wird) doch mittlerweile kommen Menschen<br />
auf sie zu und sagen: „Gut, dass<br />
wir Dich als Bürgermeisterin haben.“<br />
Zusammenarbeit<br />
Sonja Ottenbacher glaubt nicht, dass<br />
sie gewählt worden ist „weil ich eine<br />
Frau bin, sondern schon weil ich so bin<br />
wie ich bin.“ Es brauche für das<br />
Zusammenleben schon Männer und<br />
Frauen und in der Zusammenarbeit mit<br />
Männern habe sie sehr gute Erfahrungen.<br />
„Vor allem im Bezirk sind die Bürgermeisterkollegen<br />
derart unterstützend<br />
und kooperativ, es ist großartig“,<br />
gerät sie ins Schwärmen. Alle seien<br />
bereit jederzeit Unterstützung zu<br />
geben. „Das ist eine große Hilfe.“ Aber<br />
auch Land und Bezirk bieten Hilfe an.<br />
„Alle sind sehr zuvorkommend und<br />
haben mich positiv aufgenommen.“<br />
Frauenvernetzungsoffensive<br />
Wie ihre beiden Amtskolleginnen<br />
(KOMMUNAL brachte bereits Porträts<br />
von Helga Hammerschmied aus Leogang<br />
und Bettina Dürnberger aus<br />
Lofer) mit denen sie zu den überhaupt<br />
ersten Bürgermeisterinnen des Land<br />
Salzburg zählt, lobt sie den Pinzgau<br />
für sein sehr offenes Denken, spart<br />
Fotos: Walter Grossmann<br />
»<br />
Die Zeit der Einzelkämpfer<br />
allein auf weiter Flur ist<br />
vorbei und auch gar nicht<br />
finanzierbar.<br />
Sonja Ottenbacher<br />
Bürgermeisterin der Gemeinde Stuhlfelden<br />
bricht eine Lanze für gemeindeüber-<br />
greifendes Denken und Handeln<br />
«
aber auch nicht mit Komplimenten für<br />
ihren Ort: „Es ist toll, dass die Leute so<br />
offen sind und Toleranz haben und<br />
sagen ‘Wir trauen einer Frau das zu’.“<br />
Diese offene Art der Pinzgauer und<br />
auch gezielte Maßnahmen zur Stärkung<br />
der Frau in der Politik wie die<br />
Frauenvernetzungsoffensive machten<br />
im vergangenen März erstmals – eben<br />
gleich dreimal – Frauen als Bürgermeister<br />
möglich.<br />
„Das kann ich lernen“<br />
Als Bürgermeisterin stellte Sonja<br />
Ottenbacher freilich einen großen<br />
Unterschied zum Amt der Vizebürgermeisterin<br />
fest. „Aber auch wenn ich<br />
gemerkt habe, eine bestimmte Aufgabe<br />
ist mir nicht so geläufig, hatte ich<br />
immer das Gefühl, das kann ich lernen.“<br />
In ihrem Beruf als Psychotherapeutin<br />
musste sie vor allem zu Beginn<br />
ihre Amtszeit Abstriche machen. „Die<br />
Arbeit im Ort nimmt Unmengen von<br />
Zeit in Anspruch. Denn ich habe das<br />
Bedürfnis, alles sehr genau zu<br />
machen.“ Sie kümmert sich um alle<br />
Anliegen, vom Bau bis zum Sozialen.<br />
„Das sind oft traurige Sachen.“ Beispielsweise<br />
als einen Monat nach ihrer<br />
Wahl eine Tragödie Stuhlfelden<br />
erschütterte. Zwei Jungdliche waren<br />
tödlich verunglückt. „Hier war Handlungsbedarf<br />
dieses Unglück aufzuarbeiten.<br />
Das ist mein Bereich.“ Wieviel<br />
Arbeit ihr der neue Job als Bürgermeisterin<br />
auch mache, „ich erledige sie<br />
Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher (rechts das Gemeindeamt von Stuhlfelden) ist eine<br />
der ersten Frauen, die im Land Salzburg dieses Amt bekleiden. „Ich erledige meine<br />
Arbeit mit Begeisterung.“<br />
mit Begeisterung.“ Dabei komme ihr<br />
das eigene Naturell sehr entgegen.<br />
„Ich bin sehr kommunikativ, organisiere<br />
gerne. Die Aufgaben als Bürgermeisterin<br />
entspricht meiner Persönlichkeit.“<br />
Das dürften auch ihre Kolleginnen<br />
ähnlich sehen. Vor einem<br />
Monat wählten sie Sonja Ottenbacher<br />
zu Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen im<br />
Pinzgau.<br />
Vorhaben<br />
In den letzten Jahren wurde in Stuhlfelden<br />
viel geplant. Jetzt gehe es an die<br />
Umsetzung. Das Schwimmbad wurde<br />
bereits fertiggestellt („Jetzt gehen die<br />
Zahlungen los“), das Pfarrhaus und<br />
auch der Turnsaal der Volksschule müssen<br />
renoviert werden. Die Vorhaben<br />
beschränken sich jedenfalls nicht auf<br />
die eigene Gemeinde. „Gemeindeübergreifendes<br />
Denken wird immer wichtiger.<br />
Die Zeiten von Einzelkämpfern<br />
allein auf weiter Flur sind vorbei und<br />
auch gar nicht mehr finanzierbar.“<br />
Die Kontakte zu den Nachbargemeinden<br />
seien gut. Gemeinsam versuche<br />
man das Bestmögliche zu machen.<br />
Das beginnt bei der Ausbildung<br />
(Hauptschule in Mittersil) und geht bis<br />
zur Pflege und Betreuung von Senioren.<br />
Aber auch im Tourismus sei<br />
Zusammenarbeit der einzig gehbare<br />
Weg. Durch den Zusammenschluss zu<br />
Tourismusverbänden könne man<br />
gemeinsam viel werbewirksamer auftreten.<br />
Schon 963 wurde von einer<br />
Hube bei Stuolveldum geschrieben.<br />
Somit ist Stuhlfelden der älteste<br />
urkundlich erwähnte Ort im<br />
Oberpinzgau. Heute ist Stuhlfelden<br />
– Ausgangspunkt für viele schöne<br />
Wanderungen – eine wachsende<br />
Gemeinde mit vielen Zuzügen.<br />
Eine große Zahl von Vereinen<br />
bieten Kontakte und sorgen für<br />
das soziale Gefüge im Ort.<br />
Nationalpark<br />
Ende Juli wurde in einer Sitzung des<br />
Beirates der Nationalpark Zentrum<br />
GmbH die Errichtung des Nationalparkzentrums<br />
Mittersil/Stuhlfelden<br />
beschlossen. Als Standort des Zentrums<br />
einigte sich der Beirat, dem Stuhlfelden<br />
weiterhin angehört, auf Mittersil. Bürgermeisterin<br />
Ottenbacher: „Die Region<br />
steht dahinter. Es geht darum, das<br />
Beste für den Oberpinzgau zu erreichen.”<br />
Dadurch darf sich die Region<br />
zusätzliche Besucher und einen<br />
gestärkten Tourismus erwarten.<br />
KOMMUNAL 117
Aus den Bundesländern<br />
118 KOMMUNAL<br />
BURGENLAND<br />
Budgetkurs prolongiert<br />
Voranschlag für<br />
2005 steht<br />
EISENSTADT<br />
Nach zweitägiger Debatte<br />
wurde Mitte Oktober das Budget<br />
für das kommende Jahr<br />
beschlossen. Der Landesvoranschlag<br />
2005 weist wie in den<br />
vergangenen vier Jahren ein<br />
ausgeglichenes Ergebnis aus.<br />
Dem Burgenland stehen 2005<br />
Mittel von insgesamt 884,5<br />
Millionen Euro zur Verfügung<br />
(2004: 883,6 Millionen). Der<br />
Maastricht-Überschuss, den<br />
das Land im nächsten Jahr<br />
erwirtschaften will, ist mit<br />
29,9 Millionen Euro veranschlagt.<br />
Im Ordentlichen<br />
Haushalt sind 861,3 Millionen,<br />
im Außerordentlichen Haushalt<br />
23,2 Millionen Euro vorgesehen.<br />
Die Fondsgebarung<br />
ist mit je 27,3 Millionen Euro<br />
ebenfalls ausgeglichen.<br />
KÄRNTEN<br />
ST. VEIT<br />
Die Sanierung der St. Veiter<br />
Stadtmauer biegt in die Endphase.<br />
Bereits<br />
im Sommer<br />
2005<br />
wird das<br />
historische<br />
Gemäuer<br />
der Herzogstadt<br />
dann so<br />
richtig<br />
„aufblühen“.<br />
Seit Juli<br />
Die Stadtmauer<br />
wird aufblühen –<br />
dafür sorgen<br />
Guido Mosser und<br />
die vielen Arbeiter.<br />
wird an<br />
vielen<br />
Teilen<br />
der St.<br />
Veiter<br />
Stadtmauer<br />
kräftig gewerkelt. Der Grund<br />
für die rege Bautätigkeit<br />
rund um das alte Gemäuer<br />
Soziales Pilotprojekt<br />
Streetworker<br />
OBERWART/EISENSTADT<br />
Viele Kinder und Jugendliche<br />
müssen mit sich und ihren<br />
Problemen alleine zu Recht<br />
kommen. Manche brauchen<br />
dazu die Hilfe und Unterstützung<br />
der Gesellschaft. Eine<br />
spezielle Methode der Sozialarbeit<br />
„Streetwork“ arbeitet<br />
dort, wo immer mehr<br />
Jugendliche einen Großteil<br />
ihrer Sozialisation erfahren –<br />
auf der Straße, in Parks, in<br />
Gasthäusern. In Oberwart ist<br />
die Problematik von Kindern<br />
und Jugendlichen, die den<br />
Großteil ihrer Zeit auf der<br />
Straße verbringen, schon seit<br />
einiger Zeit bekannt.<br />
Gemeinsam mit dem Land<br />
und der Gemeinde konnte<br />
jetzt ein Pilotprojekt realisiert<br />
werden. Infos unter<br />
www.rettet-das-kindbgld.at<br />
Revitalisierung der alten Stadtmauern<br />
Hilfe von Langzeitarbeitslosen<br />
ist leicht erklärt: Die Stadtmauer<br />
wird revitalisiert,<br />
optisch noch besser sichtbar<br />
und schlussendlich für Bürger<br />
und Touristen über weite<br />
Strecken zugänglich<br />
gemacht. „Die historische<br />
Stadtmauer ist ein ganz<br />
wichtiger Teil unserer Stadt.<br />
Sie wirkt identitätsstiftend<br />
und soll nach den Umbauarbeiten<br />
auch erlebbar werden“,<br />
informiert der St. Veiter<br />
Bürgermeister Gerhard<br />
Mock. Damit dieses ambitionierte<br />
Vorhaben auch<br />
gelingt, sollen die Flächen<br />
rund um die Mauern<br />
begrünt und zu Parks umgewandelt<br />
werden. Wie bereits<br />
beim Umbau des Bürgerspitals<br />
kommen auch bei der<br />
Revitalisierung der Stadtmauer<br />
wieder einige Langzeitarbeitslose<br />
zum Einsatz.<br />
„Sie leisten, so wie alle anderen<br />
Beschäftigten vor Ort,<br />
wirklich gute Arbeit“, lobt<br />
Mosser.<br />
Schule und Kinderbetreuung nach Maß<br />
96 Prozent Personalkosten<br />
EISENSTADT<br />
Für das Jahr 2005 stehen im<br />
Bildungsressort, das auch das<br />
Kindergartenwesen beinhaltet,<br />
rund 117,2 Millionen Euro zur<br />
Verfügung. Davon sind allerdings<br />
rund 112,8 Millionen<br />
oder 96 Prozent durch Personalkosten<br />
gebunden. „Über<br />
das Personal hinaus müsste die<br />
Bildung dem Land noch mehr<br />
wert sein. Dies ist leider in<br />
„Zeiten des finanziellen Problems<br />
mit der Bank Burgenland“<br />
nicht möglich, was ich<br />
als Bildungslandesrätin sehr<br />
bedauere“, sagt die zuständige<br />
Mag. Michaela Resetar.<br />
„Ich werde daher mit den<br />
Gemeinden und den Bildungsinstitutionen<br />
partnerschaftlich<br />
versuchen, die freien, knappen<br />
finanziellen Mittel effizient<br />
und zielorientiert für die Aus-<br />
KLAGENFURT<br />
Medial geäußerten Befürchtungen,<br />
dass die Regionalverbände<br />
vor dem Aus stehen,<br />
erteilte Mitte Oktober<br />
Raumplanungsreferent<br />
LHStv. Karl Pfeifenberger<br />
eine klare Absage. Er unterstrich,<br />
dass ihm die Ortsund<br />
Regionalentwicklung<br />
Kärntens ein besonderes<br />
Anliegen sei. Laut Pfeifenberger<br />
sind bis zum Jahr<br />
2006 die Finanzierungsgrundlagen<br />
für das Regionalmanagement<br />
im Wege<br />
der EU-Programme LEADER<br />
sowie INTERREG III A – Italien,<br />
Österreich und Slowenien,<br />
gesichert.<br />
Die vier Regionalmanagements<br />
in den vier LEADER-<br />
Regionen Oberkärnten, Villach-Karnische<br />
Region, Mittelkärnten<br />
und Unterkärnten<br />
sind das Ergebnis einer<br />
Zusammenarbeit von zehn<br />
bildung und Betreuung unserer<br />
Kinder und Jugend einzusetzen“,<br />
betonte Resetar.<br />
Im Mittelpunkt stehe die Forderung,<br />
dass es in jeder<br />
Gemeinde eine Schule geben<br />
muss. Notwendig ist auch der<br />
weitere Ausbau der KinderundSchülerbetreuungsangebote<br />
am Nachmittag, die Förderung<br />
der Volksgruppensprachen<br />
und Mehrsprachigkeit.<br />
Das Budget ist zwar knapp,<br />
jedoch ist es möglich,<br />
zukunftsweisende Schritte zu<br />
setzen. Demnächst werde ich<br />
einen Entwurf einer Novelle<br />
des Kindergartengesetzes präsentieren,<br />
der darauf abzielt,<br />
die Vereinbarkeit<br />
von Familie und<br />
berufliche Tätigkeit<br />
weiter zu<br />
verbessern.<br />
Kein Aus für die Regionalverbände<br />
Orts- und Regionalentwicklung<br />
ist besonderes Anliegen<br />
Regionalverbänden in Kärnten.<br />
Laut Pfeifenberger laufen<br />
in Kärnten bereits jetzt<br />
die Vorbereitungen für die<br />
zukünftige Regionalentwicklung,<br />
um für die Zeit nach<br />
dem Ende der aktuellen EU-<br />
Programmperiode im Jahr<br />
2006, eine gute Grundlage<br />
zur Stärkung der Kärntner<br />
Regionen zu haben.<br />
Pfeifenberger lud gleichzeitig<br />
auch die Regionsobmänner<br />
Kärntens ein, gemeinsam ein<br />
zukünftiges Modell der<br />
Regionen mit dem Land<br />
Kärnten zu erarbeiten. Dabei<br />
werde vor allem die Synergie<br />
aller vorhandenen Potentiale<br />
im Bereich der Wirtschaftsentwicklung,<br />
der Tourismus-<br />
Agenden und weiterer regionaler<br />
Verbände und Zusammenschlüsse<br />
eine<br />
große Rolle spielen,<br />
sagte Pfeifenberger.
NIEDERÖSTERREICH<br />
Potentialanalyse für das Feistritztal<br />
Angebote verbessern<br />
KIRCHBERG/WECHSEL<br />
Innerhalb der LEADER+<br />
Region „NÖ Alpin<br />
Bergpanorama & Weltkulturerbe“<br />
stellt das<br />
Feistritztal mit den<br />
Gemeinden Kirchberg,<br />
Otterthal, Trattenbach<br />
und St. Corona eine<br />
entlegene Region<br />
abseits gewerblicher<br />
und industrieller Entwicklungsachsen<br />
dar.<br />
Zur Entwicklung von<br />
Zukunftsperspektiven<br />
wurde eine im<br />
Gemeindeamt von<br />
Kirchberg am Wechsel<br />
ansässige ARGE Wirtschaftsforum<br />
Feistritztal gegründet, die<br />
auch die touristische Angebotsentwicklung<br />
planen und die<br />
daraus folgenden Umsetzungsschritte<br />
begleiten soll.<br />
Für eine freizeittouristische<br />
Potenzialanalyse des Feistritz-<br />
Ernest<br />
Gabmann<br />
tals hat die Landesregierung<br />
nun auf Initiative von LR<br />
Ernest Gabmann bei<br />
ihrer letzten Sitzung<br />
eine Förderung bewilligt,<br />
die sich aus 5.760<br />
Euro Regional- und<br />
9.600 Euro EU-Fördermitteln<br />
aus dem<br />
EAGFL-Fonds/ LEA-<br />
DER+ Programm<br />
zusammensetzt. Insgesamt<br />
ist die Studie, die<br />
Ende 2005 fertig<br />
gestellt sein soll, mit<br />
Kosten von 19.200<br />
Euro verbunden. „Im<br />
Rahmen dieser Potenzialanalyse<br />
sollen durch<br />
externe Tourismusberater die<br />
derzeitigen ausflugstouristischen<br />
Angebote gesammelt<br />
und beurteilt sowie Verbesserungsmaßnahmen<br />
bzw. neue<br />
Projektideen entwickelt werden“,<br />
hält dazu Gabmann fest.<br />
OBERÖSTERREICH<br />
Projekt Gesunde Gemeinden in Oberösterreich<br />
Großartiger Erfolg<br />
LINZ<br />
Derzeit haben sich 301 oö.<br />
Gemeinden dem Netzwerk<br />
„Gesunde Gemeinden“<br />
angeschlossen. Das<br />
sind 2/3 der Gemeinden<br />
mit rund 1,1 Millionen<br />
Einwohnern.<br />
Mit einer Beteiligung<br />
von 100 Prozent<br />
nimmt Linz-Land den<br />
ersten Platz ein,<br />
gefolgt von den Bezirken<br />
Kirchdorf/ Krems<br />
(82,6 %) und Rohrbach<br />
(78,5 %). „Das<br />
bedeutet einen großartigen<br />
Erfolg für die<br />
Gesundheitsförderung in<br />
Oberösterreich“, freut sich<br />
Gesundheits-Landesrätin Dr.<br />
Silvia Stöger.<br />
Die Aktion „Gesunde Gemeinden“<br />
der Oö. Landessanitätsdirektion<br />
ist eine der tragenden<br />
Säulen in der Gesundheitsprävention.<br />
Das Netzwerk<br />
Landesrätin Dr.<br />
Silvia Stöger<br />
unterstützt eine Vielzahl von<br />
gesundheitsfördernden Aktionen<br />
und Vorsorgemaßnahmen<br />
und macht deren<br />
Realisierung vor<br />
Ort erst möglich.<br />
Immer bedeutender<br />
werden aber<br />
auch spezielle Projekte.<br />
So wird zum<br />
Beispiel das Jahr<br />
2005 dem Thema<br />
„Männergesundheit“<br />
gewidmet. Da<br />
leider noch immer<br />
sehr wenig Männer<br />
die Möglichkeit<br />
einer kostenlosen<br />
Gesundenuntersuchung nützen,<br />
werden im Rahmen der<br />
Aktion „Gesunde Gemeinden“<br />
verstärkt Männergesundheitstage<br />
veranstaltet. „Eine ideale<br />
Möglichkeit, männerspezifische<br />
Gesundheitsthemen ins<br />
Rampenlicht zu rücken“,<br />
bekräftigt Dr. Stöger.<br />
Heizkostenzuschuss<br />
85.000 Menschen<br />
begünstig<br />
ST. PÖLTEN<br />
Die Landesregierung hat einstimmig<br />
einen Heizkostenzuschuss<br />
von 50 Euro für<br />
bedürftige Landesbürger<br />
beschlossen. In den Genuss<br />
der Unterstützung können an<br />
die 85.000 Menschen in Niederösterreich<br />
kommen, sagte<br />
Familienlandesrätin Johanna<br />
Mikl-Leitner. Sie verwies darauf,<br />
dass die Heizkosten im<br />
Vergleich mit dem vergangenen<br />
Jahr um bis zu 45 Prozent<br />
gestiegen seien.<br />
Anträge können ab 15.<br />
November und bis 30. April<br />
2005 eingebracht werden. Die<br />
Auszahlung wird Mikl-Leitner<br />
zufolge rasch und unbürokratisch<br />
erfolgen. Formulare gibt<br />
es bei den Gemeindeämtern,<br />
auf Bezirkshauptmannschaften<br />
und beim Land NÖ (auch<br />
im Internet).<br />
LINZ<br />
Derzeit steht in der Landesregierung<br />
nur eine Frau acht<br />
männlichen Regierungsmitgliedern<br />
gegenüber und in<br />
den 445 Gemeinden gibt es<br />
nur elf Bürgermeisterinnen.<br />
„Obwohl sich Frauen qualifiziert,<br />
politisch interessiert<br />
und engagiert zeigen und in<br />
vielen politischen Bereichen<br />
einen Großteil der ehrenamtlichen<br />
politischen Arbeit leisten,<br />
sind sie im oberen<br />
Management in Wirtschaft<br />
und Politik kaum vertreten“,<br />
betont Frauen-Landesrätin<br />
Dr. Silvia Stöger anlässlich<br />
des nun gestarteten Mentoring-Programms<br />
„Frauen.Macht.Politik“.<br />
Ziel dieser Beratung- und<br />
Betreuungs-Weiterbildung ist<br />
es, engagierten Absolventinnen<br />
des erfolgreichen Polit-<br />
Trainings „Jetzt sind wir<br />
Frauen am Zug!“ zusätzliche<br />
Aus den Bundesländern<br />
Region NÖ Süd<br />
Tourismus<br />
trumpft auf<br />
GLOGGNITZ<br />
Die im südlichen Niederösterreich<br />
gelegenen Tourismusregionen<br />
konnten trotz der verregneten<br />
Sommersaison nicht<br />
weniger als 530.000 Nächtigungen<br />
verzeichnen. „Damit<br />
haben wir unsere Stellung als<br />
wesentlicher Player im nö.<br />
Tourismus unterstrichen“,<br />
freut sich der Sprecher der<br />
Region NÖ-Süd, der Gloggnitzer<br />
Tourismusmanager Erich<br />
Schabus. Die hier liegenden<br />
Urlaubsregionen haben klingende<br />
Namen bei Erholungssuchenden:<br />
„Semmering-Rax-<br />
Schneeberg“, „Bucklige Welt-<br />
Pittental-Hochwechsel“ und<br />
„Wr. Neustadt-Hohe Wand-<br />
Piestingtal“ lockten heuer<br />
trotz Regen an den<br />
Wochenenden TausendeErholungsuchende<br />
an.<br />
Weiterbildungsangebot für Frauen in der Politik<br />
„Frauen.Macht.Politik“<br />
Informationen für ihren weiteren<br />
Weg in die Politik zu<br />
geben. Zwölf hochkarätige<br />
Politikerinnen und Politiker<br />
werden bis Juni 2005 wertvolles<br />
Wissen und wichtige<br />
Kontakte an zwölf ausgewählte<br />
Frauen weitergeben.<br />
„Frauen.Macht.Politik“ soll<br />
zur Verbesserung der Chancen<br />
von Frauen beitragen,<br />
sich gesellschaftspolitisch zu<br />
engagieren bzw. eine politische<br />
Karriere einzuschlagen.<br />
„Umfragen belegen großes<br />
politisches Interesse von<br />
Frauen in Oberösterreich.<br />
Jede dritte Frau gibt an,<br />
großes Interesse zu haben<br />
und keineswegs der Meinung<br />
zu sein, Politik sei Männersache“,<br />
bekräftigt Dr. Stöger,<br />
die Initiatorin des Mentoring-<br />
Projektes, die Wichtigkeit<br />
von Frauenförderung<br />
in der<br />
Politik.<br />
KOMMUNAL 119
Aus den Bundesländern<br />
120 KOMMUNAL<br />
SALZBURG<br />
Salzburger Bergseen<br />
Ausflugsziel und<br />
Gen-Reservat<br />
SALZBURG<br />
Salzburg hat insgesamt 608<br />
Seen aller Größen. Der für<br />
den Gewässerschutz ressortzuständige<br />
HStv Othmar<br />
Raus hat eine Untersuchung<br />
der kleineren Seen, vor allem<br />
im Hochgebirge, in Auftrag<br />
gegeben. Erste Ergebnisse<br />
präsentierte Raus Mitte Oktober,<br />
in einem Informationsgespräch.<br />
Auch die kleinen<br />
Bergseen präsentieren sich<br />
vorwiegend in einem sehr<br />
guten Zustand. Zudem sind<br />
die Salzburger Bergseen seit<br />
dem Jahr 2001 Schauplatz<br />
eines Forschungsprojektes zur<br />
Herkunft der Seesaiblinge. Es<br />
ist bei den Saiblingen möglich,<br />
ursprüngliches genetisches<br />
Material aus Hochgebirgsseen<br />
für einen allfälligen<br />
Nachbesatz zu gewinnen.<br />
STEIERMARK<br />
LH Waltraud Klasnic, Bgm. Eva Leitold,<br />
Mag. Sigrid Schröpfer.<br />
Auszeichnung<br />
Netzwerk Gesunde<br />
Gemeinde<br />
KOBENZ<br />
Das Erntedankfest in der Gemeinde<br />
Kobenz bot Anfang Oktober den<br />
idealen Rahmen für die Verleihung<br />
der Auszeichnung „Gesunde<br />
Gemeinde“. Kobenz ist nun eine von<br />
neun steirischen Gemeinden, die ihre<br />
Gäste schon bei der Ortseinfahrt mit<br />
einer „Gesunde Gemeinde“-Tafel<br />
begrüßen können. Im Beisein von<br />
Landeshauptmann Waltraud Klasnic<br />
übergab Mag. Sigrid Schröpfer, Leiterin<br />
des Projektes „Gesunde<br />
Gemeinde“ bei Styria vitalis, die Tafel<br />
an Bürgermeisterin Eva Leitold.<br />
Kindergärten<br />
Gesundheit und<br />
Hygiene<br />
SALZBURG<br />
Derzeit finden in allen Salzburger<br />
Bezirken Informationsveranstaltungen<br />
für Kindergartenleiter/innen<br />
zum<br />
Thema „Gesundheit und<br />
Hygiene im Kindergarten“<br />
statt. „Nachdem immer wieder<br />
Fragen rund um die Thematik<br />
Hygiene und Gesundheit<br />
im Kindergarten aufgeworfen<br />
wurden, erstellte die<br />
Kindergarteninspektorin<br />
Maria Berktold eine Broschüre<br />
mit den wichtigsten<br />
Inhalten und Grundlagen,<br />
berichtete Landesrätin Doraja<br />
Eberle. Gerade der Kindergartenalltag<br />
biete zahlreiche<br />
Anknüpfungspunkte, um<br />
einen verantwortungsvollen<br />
Umgang mit den persönlichen<br />
Gesundheitsressourcen<br />
zu lernen.<br />
Foto: Dusek<br />
GRAZ<br />
Die Pensionen für jene<br />
aktiven und pensionierten<br />
Politiker, die einen Pensionsanspruch<br />
gemäß der<br />
vor 1997 gültigen Rechtslage<br />
erworben haben, setzen<br />
sich aus zwei Komponenten<br />
zusammen: aus<br />
dem Pensionsgesetz 1965,<br />
aus dem Bezügegesetz<br />
1973.<br />
Nach dem am 4. Oktober<br />
von Landeshauptmann<br />
Waltraud Klasnic (für die<br />
Bürgermeister der steirischen<br />
Gemeinden und<br />
Stadtsenatsmitglieder der<br />
Stadt Graz) und von Landesrat<br />
Hermann Schützenhöfer<br />
(für Landespolitiker)<br />
gemeinsam vorgelegten<br />
Sitzungsantrag<br />
werden folgende Maßnahmen<br />
dem Landtag als<br />
Regierungsvorlage vorgelegt:<br />
Im Pensionsgesetz wird<br />
Wintertourismus: Gemeinsames Marketing<br />
Jeder fünfte Gast aus NRW<br />
NEUSS BEI DÜSSELDORF<br />
In der Schihalle Neuss bei<br />
Düsseldorf, einem Herzstück<br />
der Tourismuskooperation<br />
zwischen den Ländern Nordrhein-Westfalen<br />
und Salzburg,<br />
präsentierten Tourismusreferent<br />
Wilfried Haslauer<br />
und Nordrhein-Westfalens<br />
Wirtschaftsminister Harald<br />
Schartau Anfang Oktober<br />
die Dachmarke für gemeinsam<br />
entwickelte Schi- und<br />
Schneesportangebote von<br />
SalzburgerLand, Skihalle<br />
Neuss und der Wintersport-<br />
Arena Sauerland. „Mit dem<br />
Programm „3S – dreifaches<br />
Schivergnügen“ wollen wir<br />
neue Besuchergruppen für<br />
den Schneesport gewinnen<br />
ein Pensionssicherungsbeitrag<br />
von 3,3 Prozent<br />
der Bemessungsgrundlage<br />
eingeführt und im Bezügegesetz<br />
wird ein Solidarbeitrag<br />
eingeführt. Dieser<br />
beträgt 4,7 Prozent für<br />
Pensionsbezieher unter<br />
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage,<br />
die derzeit<br />
3.450 Euro beträgt. Der<br />
Solidarbeitrag für Pensionsbezieher<br />
über der<br />
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage<br />
macht 11,7<br />
Prozent aus.<br />
Nach den bisherigen<br />
Berechnungen wären insgesamt<br />
117 Landespolitiker<br />
von dieser Maßnahme<br />
betroffen:<br />
◆ 87 Landtagabgeordnete<br />
(davon 20 Witwen)<br />
◆ 19 Regierungsmitglieder<br />
(davon sieben Witwen)<br />
◆ 11 Anwartschaften<br />
und bestehende reaktivieren“,<br />
berichtet Haslauer.<br />
Mehr als 20 Prozent der<br />
Salzburger Winterurlaubsgäste<br />
stammen aus Nordrhein-<br />
Westfalen, dem bevölkerungsreichsten<br />
Bundesland<br />
Deutschlands. Das 3S-Programm<br />
umfasst 15 Schi- und<br />
Schneesportangebote, die<br />
direkt bei den drei Partnern<br />
und auf einer eigenen Internetseite<br />
unter www.3s-skifahren.com<br />
(deutsch und<br />
niederländisch) buchbar<br />
sind. Für jede Zielgruppe –<br />
von Anfängern bis Profis,<br />
von Alleinreisenden<br />
bis Familien –<br />
ist das Richtige<br />
dabei.<br />
Politikerpensionen: Steiermark beschließt Solidarbeiträge<br />
224 Bürgermeister betroffen<br />
(Pensionsantrittsalter<br />
noch nicht erreicht)<br />
Für das Land würden<br />
dadurch Mehreinnahmen<br />
in Höhe von 384.000<br />
Euro pro Jahr entstehen.<br />
Die Daten für die Bürgermeister<br />
werden derzeit<br />
erhoben. Voraussichtlich<br />
wären von der geplanten<br />
Form 224 pensionierte<br />
bzw. aktive Bürgermeister<br />
(mit Anwartschaften)<br />
sowie 22 Stadtsenatsmitglieder<br />
der Stadt Graz<br />
betroffen. Infolge der<br />
geringen Bürgermeisterpensionen<br />
werden sich<br />
die planten Eingriffe in<br />
einem vertretbaren Rahmen<br />
bewegen. Die<br />
Novelle folgt im Wesentlichen<br />
jenen Maßnahmen,<br />
die auch der Bund und<br />
einige andere<br />
Bundesländer<br />
umsetzen werden.
TIROL<br />
Gleichbehandlung<br />
Übernahme von<br />
EU-Normen<br />
INNSBRUCK<br />
Ergänzungen im Landes-<br />
Gleichbehandlungsgesetz zur<br />
Verhinderung von Diskriminierungen<br />
aus Gründen des<br />
Geschlechts, der Rasse, der<br />
ethnischen Herkunft, der Religion<br />
oder Weltanschauung,<br />
einer Behinderung, des Alters<br />
oder der sexuellen Orientierung<br />
werden nach neuen<br />
Richtlinien in der Europäioschen<br />
Union nun auch ins<br />
Landes-Gleichbehandlungsgesetz<br />
übernommen. Dies sieht<br />
ein Antrag von LR Elisabeth<br />
Zanon und LR Anna Hosp vor.<br />
Zudem werden die ergänzten<br />
Grundsätze der EU auch ins<br />
Gleichbehandlungs-Gesetz für<br />
Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
auf Antrag von LR<br />
Anna Hosp übernommen.<br />
BREGENZ<br />
Beim Landesschulrat für Vorarlberg<br />
wurde eine Planungsgruppe<br />
eingerichtet, die sich<br />
mit der Frage der Positionierung<br />
der Hauptschule befasst.<br />
Dabei wurden Arbeitsgruppen<br />
eingesetzt und zwischenzeitlich<br />
eine Reihe von Maßnahmen<br />
gesetzt, die die Qualität<br />
und Bedeutung der Hauptschule<br />
in der Öffentlichkeit<br />
bekannter und bewusster<br />
machen. Ein Teil der Initiative<br />
ist auch das Wirtschaftsquiz<br />
der Vorarlberger Hauptschulen<br />
„Agent Economy“. Ziel des<br />
Quiz ist es, Vorarlberg spezifisches<br />
Geografie- und Wirtschaftswissen<br />
zu vermitteln<br />
Abwasseranlagen<br />
Finanzspritze für<br />
Gemeinden<br />
INNSBRUCK<br />
„Bedarfszuweisungen in der<br />
Gesamthöhe von 3,165 Millionen<br />
Euro dienen zur Teilfinanzierung<br />
wichtiger Vorhaben<br />
der Gemeinden. Bei dieser<br />
Auszahlung handelt es<br />
sich um Unterstützungen für<br />
insgesamt 180 Projekte von<br />
Tiroler Gemeinden ausschließlich<br />
zur Errichtung von<br />
Abwasserbeseitigungs- und<br />
Abwasserreinigungs-Anlagen“,<br />
erklärt LR Anna Hosp<br />
ihren beschlossenen Antrag.<br />
Die Auszahlung der jetzt neu<br />
zugesagten Bedarfszuweisungen<br />
erfolgt nach Prüfung des<br />
Aufwands auf Seite der<br />
Gemeinde und nach Maßgabe<br />
der im Gemeindeausgleichsfonds<br />
zur Verfügung<br />
stehenden Mittel.<br />
Vorarlberger Hauptschulkonzept<br />
Agent Economy – Das<br />
Hauptschul-Wirtschaftsquiz<br />
und zu vertiefen. Den Initiatoren<br />
ist es dabei wichtig, die<br />
Gemeinden und die Wirtschaft<br />
einzubinden, um mehr<br />
Verständnis für gesellschaftliche<br />
und ökonomische Zusammenhänge<br />
zu schaffen. In<br />
dem zu erstellenden Fragenpool<br />
sollen auch Fragen zu<br />
den einzelnen Gemeinden in<br />
Vorarlberg aufscheinen. Den<br />
Gemeinden wird gegen Entrichtung<br />
eines Sponsorenbeitrages<br />
die Möglichkeit geboten,<br />
Fragen zu ihrer<br />
Gemeinde zu formulieren und<br />
ihr Logo zu platzieren.<br />
Der Vorarlberger Gemeindeverband<br />
ersucht um Unterstützung<br />
dieses Projektes.<br />
Kitzbühels Bergbahnchef<br />
Mag.<br />
Manfred Filzer<br />
(l.)<br />
und Doppelmayr-Projektleiter<br />
Egon Böhler<br />
nahmen den<br />
Award in<br />
Empfang.<br />
LONDON/KITZBÜHEL<br />
Kitzbühel sorgt bereits vor<br />
Inbetriebnahme der Dreiseil-<br />
Umlaufbahn „3S“ zum<br />
Beginn der Wintersaison<br />
2004/05 weltweit für Aufsehen.<br />
So wurde das Tiroler Ort<br />
auf der größten Europäischen<br />
Wintersport-Messe für Konsumenten,<br />
der “Daily Mail Ski &<br />
Snowboard Show 2004“ in<br />
London mit dem „Best European<br />
Resort Development-<br />
VORARLBERG<br />
BREGENZ<br />
Die Vorarlberger Landesregierung<br />
hat Mitte Oktober,<br />
die Details für die<br />
Gewährung eines Heizkostenzuschusses<br />
im kommenden<br />
Winter fixiert, teilt Soziallandesrätin<br />
Greti Schmid<br />
mit. Anträge können von<br />
Montag, 8. November bis<br />
Donnerstag, 23. Dezember<br />
bei den Gemeindeämtern<br />
gestellt werden.<br />
Wie in den letzten Jahren<br />
sollen Personen mit geringem<br />
Einkommen einen einmaligen<br />
Zuschuss von 150<br />
Euro pro Haushalt erhalten,<br />
der selbstverständlich für<br />
alle Heizenergieträger<br />
gewährt wird, so LR<br />
Schmid. Der Heizkostenzuschuss<br />
soll jenen Menschen<br />
zu Gute kommen, die<br />
◆ ein monatliches Einkommen<br />
haben, das nicht<br />
höher ist als der ASVG-<br />
Aus den Wirtschafts-Info<br />
Bundesländern<br />
„3S“-Seilbahn ist Innovation des Jahres<br />
Ausgezeichnetes Kitzbühel<br />
Award“ ausgezeichnet. „Die<br />
neue Seilbahn leistet einen<br />
herausragenden Beitrag zur<br />
Verbesserung des Komforts<br />
und Vergnügens von Skifahrern<br />
und Snowboardern“,<br />
begründete Dave Watts, Chefredakteur<br />
des Britischen<br />
Wintersport-Magazins „Daily<br />
Mail Ski & Snowboard“<br />
die Entscheidung<br />
der Experten-<br />
Jury.<br />
Heizkostenzuschuss 2004/05 fixiert<br />
Anträge bei Gemeinden, das<br />
Land ersetzt die Kosten<br />
Ausgleichszulagenrichtsatz<br />
(Alleinstehende:<br />
653,19 Euro, Ehepaare/<br />
Lebensgemeinschaften:<br />
1.015 Euro Euro);<br />
◆ keine unterhaltspflichtigen<br />
Angehörigen haben,<br />
die einen entsprechenden<br />
Beitrag leisten könnten;<br />
◆ kein verwertbares Vermögen<br />
haben.<br />
Der Antrag auf Gewährung<br />
des Heizkostenzuschusses<br />
kann beim zuständigen<br />
Wohnsitzgemeindeamt eingebracht<br />
werden. Das Geld<br />
wird von den Gemeinden<br />
sofort direkt ausbezahlt. Das<br />
Land wird den Gemeinden<br />
die aufgewendeten Beträge<br />
ersetzen.<br />
KOMMUNAL 121
Südtirol<br />
Südtiroler Gemeindenverband feiert 50-Jahr-Jubiläum<br />
Starke Stimme für 116<br />
Südtiroler Gemeinden<br />
BOZEN<br />
Der Südtiroler Gemeindenverband feiert<br />
heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Ab dieser<br />
Ausgabe berichtet KOMMUNAL regelmäßig<br />
über jene Themen, die den Südtiroler<br />
Gemeinden unter den Nägeln<br />
brennen.<br />
Im Juni 1954 haben 47 Bürgermeister<br />
Der Rat der Gemeinden ist ein Beratungsorgan<br />
zwischen den Gemeinden<br />
und dem Südtiroler Landtag bzw. der<br />
Südtiroler Landesregierung. Er besteht<br />
aus 16 von der Versammlung der Bürgermeister<br />
der Gemeinden des Landes<br />
gewählten Mitgliedern.<br />
mit der Unterstützung von Südtiroler<br />
Vertretern im Parlament und im Regionalrat<br />
den Südtiroler<br />
Gemeindenverband<br />
gegründet. Dieser wurde<br />
als Dienstleistungsbetrieb<br />
und zum Zweck der „Vertretung<br />
und Verteidigung<br />
aller Interessen gegenüber<br />
staatlichen, regionalen,<br />
landes- und europäischen<br />
Körperschaften, Anstalten,<br />
Ämtern und Organen“<br />
konzipiert. Ein wichtiger<br />
Schritt der Anerkennung<br />
des Verbandes war die<br />
Übertragung der Verhandlungskompetenz<br />
zur Ausarbeitung<br />
der Arbeitsverträge der<br />
Gemeindebediensteten. Der Gemeindenverband<br />
vertritt bei den Kollektivvertragsverhandlungen<br />
die Seite der Arbeitgeber.<br />
Die Kernfragen des Verbandes<br />
betrafen und betreffen die Gemeindeselbstverwaltung<br />
und die Lokalfinanzen.<br />
Der Gemeindenverband ist stets gefordert,<br />
mit dem Land jene Absprachen zu<br />
treffen, welche eine gute und selbständige<br />
Verwaltung auf Gemeindeebene<br />
gewährleisten. Ein eigenes Komitee vereinbart<br />
jährlich die Finanzausstattung<br />
der Gemeinden, also die Zuweisung von<br />
122 KOMMUNAL<br />
Der Südtiroler<br />
Gemeindenverband<br />
ist heute die alleinige<br />
Interessensvertretung<br />
aller 116 Südtiroler<br />
Gemeinden und aller<br />
7 Bezirksgemeinschaften.<br />
Seiten der Landesverwaltung.<br />
Neu: Rat der Gemeinden<br />
Heute ist der Südtiroler Gemeindenverband<br />
die alleinige Interessensvertretung<br />
aller 116 Südtiroler Gemeinden<br />
und aller 7 Bezirksgemeinschaften. Als<br />
absolute Neuerung gilt die Einsetzung<br />
des Rates der Gemeinden (entspricht in<br />
etwa dem österreichischen Konsultationsmechanismus),<br />
der seine Tätigkeit<br />
seit Beginn dieses Jahres ausübt.<br />
Der Rat der Gemeinden ist ein Beratungsorgan<br />
zwischen den Gemeinden<br />
und dem Südtiroler Landtag bzw. der<br />
Südtiroler Landesregierung. Er besteht<br />
aus 16 von der Versammlung der Bürgermeister<br />
der Gemeinden des Landes<br />
gewählten Mitgliedern. Den Vorsitz<br />
führt der Präsident des Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes. Die Hauptaufgabe<br />
des Rates der Gemeinden besteht<br />
in der Begutachtung der Entwürfe von<br />
Gesetzen und Verordnungen, welche<br />
für die Gemeinden von Interesse sind,<br />
bevor sie vom Landtag bzw. von der<br />
Landesregierung verabschiedet<br />
werden.<br />
Neben seiner politischen<br />
Tätigkeit bietet der SüdtirolerGemeindenverband<br />
seinen Mitgliedern<br />
verschiedene Dienstleistungen<br />
an, die laufend<br />
verbessert und ausgebaut<br />
werden. Dazu<br />
gehören die EDV-Abteilung,<br />
die zentrale Beratungstätigkeit,<br />
die Verwaltungsschule<br />
zur laufenden<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
der Mitarbeiter<br />
in den Gemeinden und die zentrale<br />
Lohnverrechnung.<br />
Kontakt:<br />
Südtiroler Gemeindenverband<br />
Gen.m.b.H., Schlachthofstrasse 4<br />
I-39100 Bozen<br />
Tel.: 0039/471/304655<br />
Fax.: 0039/471/304625<br />
E-Mail: sgv@gvcc.net<br />
Web: www.gvcc.net<br />
Südtirol präsentiert sich<br />
Dieselben Themen<br />
brennen unter den Nägeln<br />
Der Südtiroler Gemeindenverband<br />
pflegt bereits seit Jahren<br />
gute Kontakte mit dem Österreichischen<br />
Gemeindebund. Anlässlich<br />
des heurigen<br />
„50-Jahr-<br />
Jubiläums“ des<br />
Südtiroler Gemeindenverbandes<br />
wurde die Idee<br />
geboren, die Zeitschrift<br />
KOMMU-<br />
NAL mit einer<br />
Rubrik von Südtiroler<br />
Themen zu<br />
bereichern.<br />
Wir sind stolz darauf,<br />
unseren Verband,<br />
unsere Tätigkeiten<br />
und Dienste<br />
in dieser und in<br />
den folgenden Ausgaben<br />
Ihrer Fachzeitschriftvorstellen<br />
zu dürfen. Wir<br />
werden uns weiters<br />
bemühen, Ihre<br />
Berichterstattung mit aktuellen<br />
kommunalpolitischen Themen der<br />
Südtiroler Gemeinden, auch im<br />
Sinne eines grenzüberschreitenden<br />
Sprachrohrs, zu ergänzen – denn<br />
seien wir ehrlich: hier wir dort brennen<br />
uns die dieselben Themen unter<br />
den Nägeln, stellen wir uns tagtäglich<br />
den Herausforderungen und<br />
Anforderungen der <strong>Kommunal</strong>verwaltungen<br />
und -politik. Wir sind<br />
sicher, dass wir gemeinsam einen<br />
erfolgreichen Weg einschlagen werden!<br />
Franz Alber<br />
Präsident des Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes<br />
Das Südtiroler<br />
Wappen<br />
Franz Alber,<br />
Präsident des<br />
Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes<br />
Das Logo des<br />
Südtiroler<br />
Gemeindenverbandes
Der Gemeinderat der Stadt Baden hat Bürgermeister Prof.<br />
August Breininger mit dem Ehrenring der Stadt Baden ausgezuzeichnet.<br />
Die Überreichung fand am 1. Oktober 2004<br />
im Rahmen der Ehrung verdienter Mitbürgerinnen und<br />
Mitbürger im Stadttheater Baden statt. Vizebgm. Dir. Franz<br />
Geiger überreichte den Ehrenring und strich in seiner Rede<br />
die Verdienste von Bgm. Prof. August Breininger für die<br />
Stadt Baden hervor.<br />
Amts-Jubiläum<br />
20 Jahre<br />
Bürgermeister<br />
SCHWARZENBACH<br />
Bundesrat Bürgermeister<br />
Johann Giefing beging<br />
Anfang Oktober sein 20-jährigesBürgermeisterjubiläum<br />
in<br />
Schwarzenbach<br />
(NÖ).<br />
Seit 1850 ist<br />
er somit der<br />
längst dienendeBürgermeister<br />
nach<br />
Johann Faber, der insgesamt<br />
14 Jahre dieses Amt von<br />
1920 bis 1935 ausgeübt hat.<br />
OÖ ehrt<br />
Die Verdienstmedaille des<br />
Landes Oberösterreich erhielt<br />
Helmut Commenda, ehem.<br />
Gemeindevorstand der<br />
Gemeinde Offenhausen. Landeshauptmann<br />
Dr. Josef<br />
Pühringer überreichte dem<br />
verdienten <strong>Kommunal</strong>funktionär<br />
die Auszeichnung Mitte<br />
Oktober im Linzer Landhaus.<br />
Termine<br />
31.1. - 1.2.2005<br />
„Erfolg und Akzeptanz mit<br />
Facility Management Kompetenz“<br />
– Facility<br />
(Gebäude) Management in<br />
den Kommunen“, Bad<br />
Schallerbach<br />
„Kommunikation und Konfliktlösung<br />
im Team für das<br />
Gemeindeamt“, Traunkirchen<br />
1. 3. 2005<br />
„Leistungsstark für Bürger/innen!<br />
– Wo bleibe ich?<br />
Mental fit im Gemeindeamt“,<br />
Regau<br />
Oberösterreichischer<br />
Gemeindebund, Gemeindeverwaltungsschule,<br />
4020<br />
Linz, Coulinstrasse 1, Telefon:<br />
0732/656516-0, Fax:<br />
0732/651151, post@ooegemeindebund.at<br />
Web: www.ooegemeindebund.at<br />
So sind Sie jederzeit über alles informiert<br />
Die KOMMUNAL-Ausgaben<br />
seit Jänner 2002 als <strong>PDF</strong><br />
www.kommunal.at<br />
Todesfälle<br />
JULBACH<br />
Verstorben ist Ende September<br />
Ök.R. Bgm.a.D.<br />
Alfred Fischer im 63.<br />
Lebensjahr.<br />
Alfred Fischer<br />
war 23 Jahre<br />
Bürgermeister<br />
der Gemeinde<br />
Julbach (OÖ)<br />
und wurde für<br />
seine Verdienste<br />
mit der Ehrenbürgerwürde<br />
ausgezeichnet.<br />
Jahrzehntelang<br />
stand er im<br />
Dienst der Öffentlichkeit<br />
als Landjugendreferent,<br />
Bauernbund- und Ortsbauernobmann,<br />
Obmann des<br />
Förderringes, Mitglied der<br />
Bezirksgrundverkehrskommission,<br />
Obmann der Telefongemeinschaft,<br />
Vorstand<br />
des Fremdenverkehrsverbandes<br />
und Obmann des<br />
Info-Mix<br />
Bürgermeister unerwartet gestorben<br />
In Memoriam Karl Oberndorfer<br />
ATTERSEE<br />
kennung wurde ihm<br />
Ende August ist der Bür- neben anderen Auszeichgermeister<br />
der Gemeinde nungen das Goldene Ver-<br />
Attersee (OÖ), Hofrat Dr. dienstzeichen der Repu-<br />
Karl Oberndorfer, völlig blik Österreich verliehen.<br />
unerwartet im 61. Karl Oberndorfer war in<br />
Lebens-<br />
zahlreichen örtlichen<br />
jahrver- Vereinen und Körperstorben.schaften<br />
tätig und er<br />
Bürger-<br />
hat für seine<br />
meister<br />
Gemeinde, um deren<br />
Obern-<br />
Wohl er stets bemüht<br />
dorfer<br />
war, noch viel vorge-<br />
übte das<br />
habt. Weitere Erfolge<br />
Amt 21<br />
waren ihm aber nicht<br />
Jahre<br />
vergönnt.<br />
lang<br />
Bürgermeister Karl<br />
aus. Karl Oberndorfer<br />
Oberndorfer war in<br />
Auch als<br />
seiner Gemeinde<br />
Bezirkshauptmann-Stell- wegen seiner Umsicht<br />
vertreter und Leiter der und Bürgernähe allge-<br />
Gewerbe-, Jugendwohlmein sehr geschätzt. Der<br />
fahrt- und Sozialabtei- Oberösterreichische<br />
lung der BH Vöcklabruck Gemeindebund wird Karl<br />
erwarb er sich große Ver- Oberndorfer stets ein<br />
dienste.<br />
ehrendes Andenken<br />
Als Zeichen hoher Aner- bewahren.<br />
Altbürgermeister Alfred Fischer verstorben<br />
23 Jahre im Dienst der Gemeinde<br />
Alfred Fischer<br />
Sozialsprengels. Bis zuletzt<br />
war er Obmann des Seniorenbundes<br />
Julbach (insgesamt<br />
23 Jahre). Durch<br />
seine Verdienste<br />
wurde Alfred<br />
Fischer vielfach<br />
ausgezeichnet,<br />
u.a. mit dem<br />
Goldenen Verdienstzeichen<br />
der Republik<br />
Österreich, dem<br />
Berufstitel Ökonomierat,<br />
der<br />
Verdienstmedaille<br />
des Landes<br />
Oberösterreich und<br />
der Goldenen Ehrennadel<br />
des Oö. Seniorenbundes.<br />
Das Begräbnis fand unter<br />
großer Anteilnahme der<br />
Bevölkerung und vieler<br />
Weggefährten des öffentlichen<br />
Lebens bzw.<br />
Ehrengästen in Julbach<br />
statt.<br />
KOMMUNAL 123
Info-Mix<br />
Gemeindepartnerschaft<br />
Italienische Gemeinde sucht<br />
OSTRA VETERE<br />
Die italienische Gemeinde<br />
Ostra Vetere, (Region Marche/<br />
Provinz Ancona) sucht<br />
eine österreichische Partner-<br />
Gemeinde. Ostra Vetere hat<br />
etwa 3.600 Einwohner und<br />
liegt etwa 50 km vom Adriahafen<br />
Ancona entfernt. Die<br />
Gemeinde ist landwirtschaftlich<br />
strukturiert, geprägt von<br />
Ackerbau, Weinbau und Olivenzucht.<br />
Klein- und Mittelunternehmen<br />
sind im<br />
wesentlichen in der Verarbeitung<br />
von Marmor und im<br />
Bereich von landwirtschaftliche<br />
Maschinen angesiedelt.<br />
Die Kontaktadresse ist:<br />
Cittá di Ostra Vetere,<br />
Partnerstadt gesucht<br />
ZLATÉ MORAVCE<br />
Die Stadt Zlaté Moravce in<br />
der Mittelslowakei mit<br />
14.000 Einwohner liegt in<br />
der Kleinregion Hlink nad<br />
Hronom, diese besteht aus 14<br />
Dörfern zwischen 500 und<br />
1800 Einwohnern. In der<br />
Region findet man vorwiegend<br />
Betriebe in der Aluminiumindustrie,<br />
in der Stadt<br />
direkt befindet sich ein Werk<br />
der Wienerberger Ziegelwerke.<br />
Als Sehenswürdigkeiten<br />
sind das Palais Migazzi,<br />
Vimperk sucht Partner<br />
VIMPERK<br />
Die Stadt Vimperk am Fusse<br />
am Boubín, die man dem Tor<br />
des Böhmerwaldes oder die<br />
Stadt unter Boubín oft nennt,<br />
liegt im geschlossenen Tal des<br />
Flusses Volyòka in der Seehöhe<br />
700m. Verwaltungsumfang<br />
überhäuft 21 Gemeinden<br />
und der Status der Stadt<br />
hat nur Vimperk. Die Anzahl<br />
der Einwohner zum Tag<br />
1.4.2004 ist 8095. Verwaltungsumfang<br />
hat die Fläche<br />
535,15 km2. Durch Vimperk<br />
geht der Hauptzug nach<br />
Deutschland durch den Grenzübergang<br />
Phillipsreut (<br />
StráΩn˝ ). In der Nähe der<br />
Stadt beginnt das Gebiet des<br />
124 KOMMUNAL<br />
Piazza Don Minzioni 1<br />
60010 Ostra Vetere (AN)<br />
Kontaktperson:<br />
Mauro Aquili<br />
Tel.: 0039-071/965072<br />
Fax: 0039-071/9645118<br />
Darüber hinausgehende<br />
Information und Unterstützung<br />
bei der Kommunikation<br />
mit der Gemeinde kann<br />
beim Österreichischen<br />
Gemeindebund und über die<br />
Italienische Sektion des<br />
Rates der Gemeinden und<br />
Regionen Europas (AICCRE,<br />
Piazza di Trevi 86, I - 00187<br />
ROMA, Tel.: 0039-06-699<br />
404 61, Fax: 0039-06-679<br />
3275) eingeholt werden.<br />
im Mittelpunkt der Stadt liegend,<br />
sowie das in der Nähe<br />
liegende Schloss Topolcianky,<br />
mit dem größten Gestüt der<br />
Slowakei, zu erwähnen. In<br />
der Region befindet sich auch<br />
ein Thermalbad und eine private<br />
Bierbrauerei. Detailinformationen<br />
der Stadt sowie<br />
Ansprechpartner gibt es beim<br />
Internationalen Interkommunalen<br />
Zentrum Groß-Siegharts<br />
(IIZ) unter:Tel.:<br />
02847/84198 oder E-Mail:<br />
iiz@siegharts.at<br />
Nationalparks und Naturschutzregion<br />
Böhmerwald<br />
( ˇumava ). Vimperk wurde<br />
mit der Glashütte und dem<br />
Druckerei berühmt, später<br />
mit der Textilindustrie, Elektronik<br />
und mit der Möbelindustrie.<br />
Jetzt sind hier die<br />
entwickelnde Fabriken<br />
Rohde&Schwarz, Vimperk<br />
Metzgerei, Glassfabrik Vimperk<br />
und paar kleinen<br />
Druckerei. In der Stadt sind 2<br />
Grundschulen, Gymnasium,<br />
Bauberufsschule und Forstberufsschule.Detailinformationen<br />
der Stadt sowie<br />
Ansprechpartner gibt es beim<br />
IIZ unter: Tel.: 02847/84198<br />
oder E-Mail: iiz@siegharts.at<br />
Steiermark<br />
Der 45. Titel „Schönstes Blumendorf der Steiermark“ ging an<br />
die Gemeinde Fernitz, die sich gegen 260 steirische Gemeinden<br />
durchsetzen konnte.<br />
Steirischer Blumenschmuckwettbewerb 2004<br />
Das „Schönste Dorf der<br />
Steiermark“<br />
FERNITZ<br />
Bereits seit 45 Jahren – seit<br />
dem Erzherzog-Johann-<br />
Gedenkjahr 1959 – wird der<br />
Steirische Blumenschmuckbewerb<br />
durchgeführt und jedes<br />
Mal bemühen sich Tausende<br />
Steirerinnen und Steirer,<br />
unser Land in ein Blütenmeer<br />
zu verwandeln.<br />
Insgesamt 30.000 Teilnehmer<br />
in 260 steirischen Gemeinden<br />
– eine Rekordzahl in der bisherigen<br />
Geschichte des Blumenschmuckwettbewerbes<br />
-<br />
haben sich heuer beteiligt. In<br />
14 Kategorien – vom schönsten<br />
Balkonschmuck bis zur<br />
schönsten Stadt – wurden die<br />
Preisträger von einer Jury<br />
ermittelt.<br />
In der Gemeinde Fernitz südlich<br />
von Graz können vor<br />
allem die gepflegte Parkanlage,<br />
der bepflanzte Brunnen<br />
hinter der Kirche sowie die<br />
Blütenpracht am Feuerwehrhaus<br />
und in den Gärten<br />
bewundert werden. Bürgermeister<br />
Karl Ziegler ist besonders<br />
stolz auf das „Herzstück“<br />
der Gemeinde, den Erzherzog-Johann-Park<br />
im Zentrum<br />
des Ortes. Gestaltet und<br />
bepflanzt wird die Anlage seit<br />
Jahren vom Obmann des<br />
Fremdenverkehrsvereins<br />
Ewald Ehgartner, der besonders<br />
auf die Sorten- und Farbenvielfalt<br />
Wert legt. Auch<br />
Gemeindegärtner Franz<br />
Fuchs kümmert sich mit viel<br />
Mühe und Zeitaufwand –<br />
allein zum Gießen benötigt er<br />
mindestens drei Stunden täglich<br />
– um die öffentlichen<br />
Blumenanlagen.<br />
Fernitz erhielt im Jahre 2000<br />
den Ortserneuerungspreis des<br />
Landes Steiermark und hat<br />
mittlerweile bereits den 4.<br />
Bauabschnitt beendet. Der<br />
Erfolg beim Blumenschmuckbewerb<br />
2004 ist letztlich auch<br />
auf diese kontinuierliche und<br />
zielstrebige Arbeit im Rahmen<br />
der „Ortserneuerung“<br />
zurückführen.<br />
Die weiteren Preisträger in<br />
der Kategorie „Schönstes<br />
Dorf“ sind auf dem zweiten<br />
Platz Wenigzell im Bezirk<br />
Hartberg und auf dem dritten<br />
Platz Donnersbach imBezirk<br />
Liezen.<br />
Die Kategorie „Das schönste<br />
Gebirgsdorf hat die Gemeinde<br />
Kraukaudorf im Bezirk Murau<br />
gewonnen, der Titel in der<br />
Kategorie „Der schönste<br />
Markt“ ging an Frauental an<br />
der Lassnitz. In der Kategorie<br />
„Die schönste Stadt gewann<br />
Voitsberg.<br />
Foto: Horst Kammeritsch
»<br />
Sehr beeindruckt von der Fülle der eingereichten Projekte zeigten<br />
sich die Ehrengäste des nö. Finales des WiR-Wettbewerbs..<br />
Konzepte zur Regionalentwicklung prämiert<br />
WiR: 184 Ideen für<br />
Niederösterreich<br />
PERNITZ<br />
In Pernitz im Piestingtal fand<br />
das Niederösterreich-Finale<br />
des Wettbewerbs „WiR- Wirtschaft<br />
in der Region“ statt.<br />
Bei diesem Wettbewerb des<br />
Wirtschaftsbundes nahmen<br />
Initiativen zur Steigerung der<br />
Attraktivität lokaler Wirtschaftsstandorte<br />
in Städten,<br />
Bezirken, Gemeinden und<br />
Regionen teil. In Niederösterreich<br />
wurden 184 Projekte<br />
eingereicht. „Als uns Präsi-<br />
Die Gemeinden brauchen<br />
die Wirtschaft –<br />
und umgekehrt. Die<br />
Aktion „Wirtschaft in<br />
der Region“ gibt<br />
einen hervorragenden<br />
neuen Impuls für<br />
die unverzichtbare<br />
Zusammenarbeit<br />
zwischen Kommunen<br />
und Betrieben im<br />
Interesse der<br />
Entwicklung<br />
unserer Regionen.<br />
Prof. Walter Zimper<br />
Vizepräsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes beim<br />
NÖ-Finalwettbewerb in Pernitz<br />
«<br />
dent Leitl seine Idee dieses<br />
Wettbewerbes vorstellte,<br />
konnte niemand ahnen, dass<br />
dieser Vorschlag geradezu<br />
eine Welle von Einreichungen<br />
aus unserem Bundesland<br />
auslöst. Darauf sind wir sehr<br />
stolz“, sagt NÖ Wirtschaftsbund-Direktor<br />
Herbert Lehner,<br />
der die erkrankte Landesgruppenobfrau<br />
Sonja<br />
Zwazl vertrat.<br />
Präsident Christoph Leitl<br />
betonte in seiner Ansprache<br />
die besondere Rolle, die den<br />
Unternehmern zukomme:<br />
„Sie sind die 'Humangärtner'<br />
für die Regionen. Ihnen müssen<br />
wir alle Unterstützung<br />
geben, damit sie auch weiterhin<br />
mit Freude unternehmerisch<br />
tätig sein können.“<br />
Lehner: „Eines sieht man<br />
deutlich: Es gibt viele Unternehmer,<br />
Unternehmervereine<br />
und Gemeinden, denen ihr<br />
Standort und ihre Region<br />
wirklich am Herzen liegt.“<br />
Reizthema<br />
Einkaufszentren<br />
Sonja Zwazl und der<br />
Obmann der Sparte Handel,<br />
Sepp Schirak haben beispielsweise<br />
immer wieder<br />
gegenüber den Verantwortlichen<br />
im Land Niederösterreich<br />
betont, dass der ungezügelte<br />
Bau von immer<br />
neuen Einkaufszentren auf<br />
der grünen Wiese endlich<br />
gestoppt werden muss. Ein<br />
wichtiger Schritt in diese<br />
Richtung ist der Entwurf zu<br />
einem neuen Raumordnungsgesetz,<br />
der mit Landesrat<br />
Wolfgang Sobotka ausverhandelt<br />
haben, und der<br />
noch heuer beschlossen werden<br />
soll. Dieses neue<br />
Raumordnungsgesetz wird<br />
es ermöglichen, dass es keine<br />
neuen Einkaufstempel mit<br />
allen Gütern des täglichen<br />
Bedarfes außerhalb der<br />
Stadtzentren mehr gibt.<br />
Die Finalteilnehmer aus Niederösterreich<br />
nahmen an der<br />
österreichweiten Schlussveranstaltung<br />
am 10. November<br />
in Wien teil (siehe auch<br />
Bericht auf den Seite 52 und<br />
53 dieser Ausgabe).<br />
Info-Mix<br />
Tulln gewinnt Bronze in Kanada<br />
TULLN / NIAGARA FALLS<br />
Die Stadtgemeinde Tulln hat<br />
sich beim alljährlich stattfindenden<br />
Wettbewerb „The<br />
International Awards for<br />
Liveable Communities“<br />
beteiligt. Insgesamt haben<br />
sich 458 Städte und Gemeinden<br />
aus Europa, Asien, Australien,<br />
Afrika und Amerika<br />
angemeldet, davon 48 in der<br />
Kategorie A (Gemeinden bis<br />
20.000 Einwohner).<br />
Mit den eingereichten Unterlagen<br />
und einer Präsentation<br />
mit anschließendem Hearing<br />
konnte die Stadt Tulln die<br />
fachlich hochkarätige und<br />
international besetzte Jury<br />
sowie die mitbewertenden<br />
Städte aus den anderen Kategorien<br />
von der hohen<br />
Lebensqualität in Tulln überzeugen.<br />
Bewertet wurden Initiativen<br />
aus den Bereichen Umweltschutz,<br />
Bürgerbeteiligung,<br />
Stadtbild und Landschaftsge-<br />
Krems feiert 700 Jahre<br />
KREMS<br />
Niederösterreich ist seit 1. Mai<br />
2004 wieder das Herz Europas.<br />
Beste regionale Kontakte<br />
sind die Zukunft des Landes.<br />
Städtepartnerschaften sind<br />
dazu besonders geeignet und<br />
werden auch von der EU<br />
gefördert, wenn sie sich den<br />
Europäischen Themen widmen.<br />
Krems, „Heimatgemeinde“ der<br />
Donau-Universität, folgt dieser<br />
EU-Initiative und nimmt das<br />
Jubiläum 700 Jahre Stadterhebung<br />
( 2005 ) zum Anlass,<br />
Städtepartnerschaften und<br />
deren Auswirkungen auf das<br />
öffentliche Leben wissenschaftlich<br />
zu durchleuchten.<br />
Die Donau-Universität Krems<br />
wird im Auftrag der Stadt<br />
europäische Konzepte von<br />
Städtepartnerschaften im<br />
Jahre 2005 im Hinblick auf<br />
„best practise“ untersuchen.<br />
Auftaktveranstaltung ist ein<br />
internationales Symposium<br />
am 6. Dezember 2004 in<br />
Krems. Ein „Städtepartnerschafts-Award“<br />
wird gestiftet<br />
staltung, das historische Erbe<br />
und die Zukunftsplanung.<br />
Besondere Aufmerksamkeit<br />
bei der Jury konnte mit der<br />
Für Tulln nahmen Stadtamtsdirektor<br />
Ing. Franz Lasser und<br />
Dipl.-Ing. Matthias Zawichowski<br />
den Preis entgegen.<br />
Präsentation des Erscheinungsbildes<br />
der Stadt mit<br />
Umwelt- und Ökomanagement<br />
erregt werden.<br />
und beim Abschlusssymposium<br />
2005 (im Rahmen der<br />
700 Jahr-Feiern) mit entsprechender<br />
Würdigung der Projekte<br />
und Präsentation der<br />
wissenschaftlichen Ergebnisse<br />
verliehen werden.<br />
Der Kongress am 6. Dezember<br />
2004 wird sich den Europäischen<br />
Themen widmen. Krems<br />
hat Städtepartnerschaften mit<br />
Passau und Böblingen (D),<br />
Kromeriz (Kremsier, CZ), Ribe<br />
(DK), Beaune (F) und Grapevine<br />
(Texas, USA), alle Partnerstädte<br />
werden mit Delegierten<br />
bei den Veranstaltungen vertreten<br />
sein und eingeladen, sich<br />
an dem Projekt durch Beiträge<br />
und Einreichungen zum Award<br />
etc. zu beteiligen.<br />
6. Dezember 2004, Haus der<br />
Regionen, Donaulände 56,<br />
3504 Krems-Stein<br />
Interessenten erhalten nähere<br />
Informationen bei Gernot Riesenhuber,<br />
Donau-Universität<br />
Krems, Tel. 02732-893-2310,<br />
gernot.riesenhuber@ donauuni.ac.at<br />
KOMMUNAL 125
Buch - Tipps<br />
Fachbuch Anthologie<br />
Denkmalschutzrecht<br />
Ein Kurzkommentar zum<br />
österreichischen Denkmalschutzrecht<br />
ist soeben in der<br />
Edition Juridica im Verlag<br />
MANZ erschienen. Er bietet<br />
auf 240 Seiten<br />
eine Gesamtdarstellung<br />
des Denkmalschutzrechts<br />
samt einschlägigen<br />
nationalen<br />
und gemeinschaftsrechtlichenVorschriften.<br />
In<br />
die<br />
umfängliche Kommentierung<br />
wurden die relevanten<br />
Gesetzeserläuterungen und<br />
die Judikatur eingearbeitet.<br />
Enthalten sind:<br />
◆ Denkmalschutzgesetz<br />
◆ Kulturgüterschutzrecht<br />
◆ Verordnung über den<br />
Denkmalbeirat<br />
◆ Verordnung über Kulturgüter,<br />
deren Ausfuhr keiner<br />
Bewilligung bedarf<br />
◆ Verordnung des Rates<br />
über die Ausfuhr von Kulturgütern<br />
◆ Durchführungsverordnung<br />
der Europäischen Kommission<br />
über die Ausfuhr von<br />
Kulturgütern<br />
Wie alle Juridica Kurzkommentare<br />
wendet sich auch<br />
dieser dezidiert an Praktiker<br />
und Nicht-Juristen, wie zum<br />
Beispiel die Kulturabteilungen<br />
in Kommunen.<br />
Das Buch<br />
Bazil/Binder-Krieglstein/<br />
Kraft, „Das österreichischeDenkmalschutzrecht“,<br />
Edition<br />
Juridica im Verlag<br />
MANZ 2004, 240 S.,<br />
42,00 Euro,<br />
ISBN 3-214-14563-0<br />
Kundenbestellungen<br />
telefonisch unter (01)<br />
531 61-100 oder an<br />
bestellen@manz.at<br />
126 KOMMUNAL<br />
Herbert Schambeck,<br />
Politik in Theorie und Praxis<br />
Diese Anthologie erschien<br />
anlässlich des siebzigsten<br />
Geburtstages von<br />
em.o.Univ.-Prof.<br />
Dr.Dr.h.c.mult.<br />
Herbert Schambeck<br />
und umfasst<br />
repräsentative<br />
Beispiele der Veröffentlichungen<br />
des Autors der<br />
letzten mehr als<br />
vierzig Jahre. Sie<br />
behandelt einen<br />
zentralen Arbeitsschwerpunkt<br />
von Herbert<br />
Schambeck, nämlich den<br />
Bereich der Politischen Wissenschaften.<br />
Weit entfernt<br />
von einem unpolitischen<br />
Wissenschaftlerdasein setzt<br />
sich der jahrzehntelange Parlamentarier<br />
und glühende<br />
Föderalist (Niederösterreicher<br />
mit Wiener Wohnsitz,<br />
Universitätsprofessor in Linz<br />
und jahrzehntelang Bundesrat<br />
mit Steirischem Mandat)<br />
in der ihm eigenen kritischen<br />
Distanz bei zugleich größter<br />
Nähe mit dem auseinander,<br />
was er als Politiker lebte und<br />
erlebte, vereinnahmt von<br />
Mit der Frische des Humors<br />
und mit hellem Weitblick liegen<br />
Helmut Habenichts Interessen<br />
in der Vorbeugung<br />
gegen und Verbesserung von<br />
Erschwernissen und Belastungen,<br />
wo immer solche<br />
der guten Entwicklung entgegenstehen,<br />
und worunter das<br />
Wohlergehen<br />
der Lebe-<br />
niemandem, aber gegründet<br />
auf tiefer Religiosität.<br />
Der in dieser<br />
Publikation enthaltene<br />
Querschnitt<br />
an ausgewählten<br />
Beiträgen spiegelt<br />
die besondere<br />
inhaltliche Bandbreite<br />
des umfangreichenwissenschaftlichenSchaffens,<br />
jedoch auch<br />
der praktischen<br />
politischen Tätigkeit<br />
des Verfassers wider.<br />
Das Buch<br />
Widder (Hg.): „Herbert<br />
Schambeck, Politik in<br />
Theorie und Praxis“,<br />
ISBN 3-7083-0075-0,<br />
491 Seiten, gebunden,<br />
58 Euro, Neuer Wissenschaftlicher<br />
Verlag,<br />
1040 Wien, Argentinierstraße<br />
42/6,<br />
Tel: 01/535 61 03/21<br />
Fax: 01/535 61 03/25<br />
klein@nwv.at<br />
www.nwv.at<br />
Literatur – Lyrik<br />
„schPANNE“ und „DAMALS“<br />
welt, also auch der Menschen<br />
leiden könnte. Darin findet er<br />
reichlich Stoff für Mitteilungen<br />
an alle, auch wenn man<br />
sagen könnte, die weite Welt<br />
und die Antipoden erfahren<br />
daraus die Inhalte aus dem<br />
Gewinn eines Europäers, also<br />
auch aus solcher Sichtweise.<br />
Das Buch<br />
Helmut Habenicht:,<br />
„„schPANNE“ (ISBN 3-<br />
86516-162-6) und „DA-<br />
MALS“ (ISBN 3-86516-<br />
161-8)Infos / Bestellen<br />
unter www.MeinBu.ch<br />
oder beim Autor unter<br />
Tel03577/81387<br />
Sachbuch<br />
„roadmap<br />
geistiges<br />
eigentum“<br />
Genau ein Jahr nach<br />
Erscheinen von „geistiges<br />
eigentum“ legt Intellectual<br />
Property (IP)-Spezialist<br />
Guido Kucsko nun ein<br />
Destillat seines vielgerühmten<br />
Standardwerks vor.<br />
Kucsko bietet in der „roadmap<br />
geistiges eigentum“<br />
einen einzigartigen, bunt<br />
bebilderten Überblick über<br />
das Marken-, Muster, Patentund<br />
Urheberrecht. Basis<br />
dafür ist der Abschnitt „must<br />
know“ aus „geistiges eigentum“<br />
(Manz 2003), der<br />
aktualisiert, erweitert und<br />
mit den Texten der vier<br />
wichtigsten<br />
Gesetze<br />
(Marken-,<br />
Musterschutz-<br />
Patent- und<br />
Urheberrechtsgesetz)<br />
ergänzt<br />
wurde.<br />
Geistiges<br />
Eigentum<br />
(Marken,<br />
Design, Patente, Leistungen<br />
der Urheber) zählt immer<br />
öfter zu den wichtigsten<br />
Unternehmenswerten. Das<br />
Immaterialgüterrecht ist<br />
daher zu einer zentralen<br />
wirtschaftsrechtlichen Materie<br />
geworden. Nationale,<br />
gemeinschaftsrechtliche und<br />
internationale Regelungswerke<br />
bilden einen nur noch<br />
schwer überblickbaren<br />
Dschungel.<br />
Das Buch<br />
Kucsko, „roadmap geistiges<br />
eigentum“, MANZ<br />
2004, XII, 256 S.,<br />
Brosch., 23,50 Euro,<br />
ISBN 3-214-00427-1<br />
Kundenbestellungen telefonisch<br />
unter (01) 531<br />
61-100 oder per Email<br />
an bestellen@manz.at
Das<br />
Wesentliche<br />
im Auge<br />
behalten<br />
Wir Gemeindebediensteten<br />
arbeiten in mehr als<br />
200 Berufsgruppen,<br />
an 365 Tagen,<br />
24 Stunden am Tag,<br />
bei jeder Witterung<br />
für die österreichische<br />
Bevölkerung.<br />
Und so soll es auch bleiben!<br />
Wir schauen<br />
auf Sie! www.gdg.at<br />
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten<br />
1090 Wien, Maria-Theresien-Strasse 11 ● 01/313 16/8300 ● gdg@gdg.oegb.or.at


![[PDF] Kommunal](https://img.yumpu.com/1766644/1/500x640/pdf-kommunal.jpg)