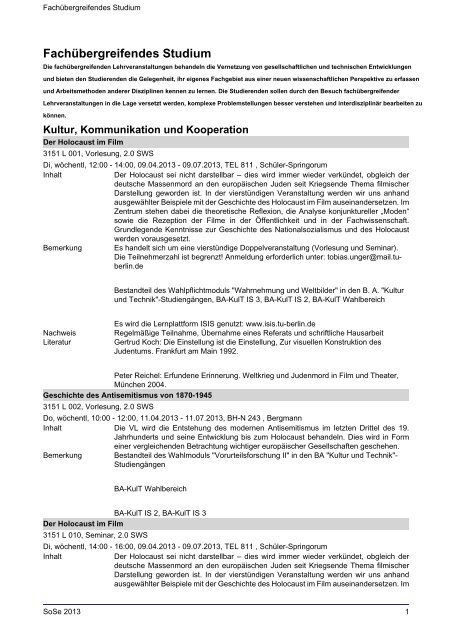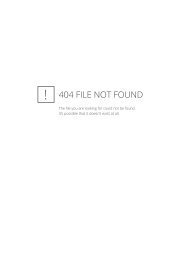Fachübergreifendes Studium - TU Berlin
Fachübergreifendes Studium - TU Berlin
Fachübergreifendes Studium - TU Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Die fachübergreifenden Lehrveranstaltungen behandeln die Vernetzung von gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen<br />
und bieten den Studierenden die Gelegenheit, ihr eigenes Fachgebiet aus einer neuen wissenschaftlichen Perspektive zu erfassen<br />
und Arbeitsmethoden anderer Disziplinen kennen zu lernen. Die Studierenden sollen durch den Besuch fachübergreifender<br />
Lehrveranstaltungen in die Lage versetzt werden, komplexe Problemstellungen besser verstehen und interdisziplinär bearbeiten zu<br />
können.<br />
Kultur, Kommunikation und Kooperation<br />
Der Holocaust im Film<br />
3151 L 001, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 12:00 - 14:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Schüler-Springorum<br />
Inhalt Der Holocaust sei nicht darstellbar – dies wird immer wieder verkündet, obgleich der<br />
deutsche Massenmord an den europäischen Juden seit Kriegsende Thema filmischer<br />
Darstellung geworden ist. In der vierstündigen Veranstaltung werden wir uns anhand<br />
ausgewählter Beispiele mit der Geschichte des Holocaust im Film auseinandersetzen. Im<br />
Zentrum stehen dabei die theoretische Reflexion, die Analyse konjunktureller „Moden“<br />
sowie die Rezeption der Filme in der Öffentlichkeit und in der Fachwissenschaft.<br />
Grundlegende Kenntnisse zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust<br />
werden vorausgesetzt.<br />
Bemerkung Es handelt sich um eine vierstündige Doppelveranstaltung (Vorlesung und Seminar).<br />
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung erforderlich unter: tobias.unger@mail.tuberlin.de<br />
Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 2, BA-KulT Wahlbereich<br />
Es wird die Lernplattform ISIS genutzt: www.isis.tu-berlin.de<br />
Nachweis Regelmäßige Teilnahme, Übernahme eines Referats und schriftliche Hausarbeit<br />
Literatur Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung, Zur visuellen Konstruktion des<br />
Judentums. Frankfurt am Main 1992.<br />
Peter Reichel: Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater,<br />
München 2004.<br />
Geschichte des Antisemitismus von 1870-1945<br />
3151 L 002, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, BH-N 243 , Bergmann<br />
Inhalt Die VL wird die Entstehung des modernen Antisemitismus im letzten Drittel des 19.<br />
Jahrhunderts und seine Entwicklung bis zum Holocaust behandeln. Dies wird in Form<br />
einer vergleichenden Betrachtung wichtiger europäischer Gesellschaften geschehen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlmoduls "Vorurteilsforschung II" in den BA "Kultur und Technik"-<br />
Studiengängen<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
Der Holocaust im Film<br />
3151 L 010, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 14:00 - 16:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Schüler-Springorum<br />
Inhalt Der Holocaust sei nicht darstellbar – dies wird immer wieder verkündet, obgleich der<br />
deutsche Massenmord an den europäischen Juden seit Kriegsende Thema filmischer<br />
Darstellung geworden ist. In der vierstündigen Veranstaltung werden wir uns anhand<br />
ausgewählter Beispiele mit der Geschichte des Holocaust im Film auseinandersetzen. Im<br />
SoSe 2013 1
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Zentrum stehen dabei die theoretische Reflexion, die Analyse konjunktureller „Moden“<br />
sowie die Rezeption der Filme in der Öffentlichkeit und in der Fachwissenschaft.<br />
Grundlegende Kenntnisse zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust<br />
werden vorausgesetzt.<br />
Bemerkung Es handelt sich um eine vierstündige Doppelveranstaltung (Vorlesung und Seminar).<br />
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung erforderlich unter: tobias.unger@mail.tuberlin.de<br />
Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT Wahlbereich<br />
Es wird die Lernplattform ISIS genutzt: www.isis.tu-berlin.de<br />
Nachweis Regelmäßige Teilnahme, Übernahme eines Referats und schriftliche Hausarbeit<br />
Literatur Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung, Zur visuellen Konstruktion des<br />
Judentums. Frankfurt am Main 1992.<br />
Peter Reichel: Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater,<br />
München 2004.<br />
Namenpolitik – Die Umbenennung von Straßen<br />
3151 L 011, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Straßennamen bilden eine Art historisches Gedächtnis. Politische Systemwechsel wie<br />
auch historische Lernprozesse schlagen sich in der Umbenennung von Straßen und<br />
Plätzen nieder. Diese Praxis und die dabei zu Tage tretenden Konflikte sind Gegenstand<br />
des SE.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Nation-Building und Nationalismus<br />
3151 L 013, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 16:00 - 18:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Thema des SE ist die neuere Forschung zu Nationenbildung und Nationalismus.<br />
Dabei werden ihre grundlegenden Konzepte vorgestellt und an konkreten historischen<br />
Fallanalysen exemplifiziert.<br />
Bemerkung Modul: BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen<br />
Konzepts, Frankfurt a.M.(New York 2/1993.<br />
Christian Jansen/Henning Borggräfe, Nation, Nationalität, Nationalismus, Frankfurt a.<br />
M. 2007.<br />
Antisemitismus ausstellen. Stategien und Paradoxien visueller Kommunikation des Antisemitismus<br />
3151 L 032, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 10:00 - 12:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Enzenbach, Funck<br />
Inhalt Ausstellungen sind Orte, welche jenseits von Moralisierung und Skandalisierung<br />
die Chance zur öffentlichen Auseinandersetzung mit Antisemitismus bieten. Wer<br />
jedoch Antisemitismus öffentlich auszustellen gedenkt, steht vor mehrfachen<br />
Herausforderungen, insbesondere der Frage, wie man vermeidet, selbst Teil<br />
einer antisemitischen Kommunikationsstruktur zu werden, indem man – auch<br />
SoSe 2013 2
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Bemerkung BA-KulT IS 3<br />
in kritischer Absicht – antisemitische Bilder und Zeichen reproduziert. Das<br />
Zentrum für Antisemitismusforschung plant ein Ausstellungsprojekt zu Alltagskulturen<br />
des Antisemitismus. In diesem Seminar werden theoretische Überlegungen zu<br />
diesem Projekt diskutiert und den Teilnehmern ggf. eine aktive Mitarbeit in<br />
dem Ausstellungsprojekt ermöglicht. Neben den theoretischen und methodischen<br />
Grundfragen der Visualisierung von Antisemitismus behandeln wir museumstheoretische<br />
und ausstellungspraktische Fragen, die in begleitenden Exkursionen vertieft werden.<br />
Auch die Arbeit am und mit dem Objekt wird Gegenstand des Seminars sein und in<br />
eigenständige Beiträge der Teilnehmer münden.<br />
Voraussetzung Voraussetzung für die Teilnahme sind die Bereitschaft zur kontinuierlichen Mitarbeit<br />
und die Teilnahme an zusätzlichen Veranstaltungen (Exkursionen) auch außerhalb des<br />
Seminarraums.<br />
Literatur Anke te Heesen: Theorien des Museums zur Einführung, Hamburg 2012.<br />
Gottfried Korff: Museumsdinge. Deponieren - exponieren. Hrsg. von Martina<br />
Eberspächer, Gudrun Marlene König, Bernhard Tschofen, Köln/Weimar/Wien 2002.<br />
Klamper, Elisabeth: Jüdisches Museum, Wien: Die Macht der Bilder. Antisemitische<br />
Vorurteile und Mythen, Wien 1995.<br />
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,<br />
in: Gesammelte Schriften Band I, Werkausgabe Band 2, hrsg. von Rolf Tiedemann und<br />
Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980, S. 471–508.<br />
Vergangenheitspolitik, Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik<br />
3151 L 034, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, TEL 811 , Kohlstruck<br />
Inhalt Erinnerungspolitik und sinnverwandte Bezeichnungen sind in den letzten Jahren zu<br />
häufig gebrauchten Vokabeln geworden, mit denen sich unterschiedliche Konzepte<br />
verbinden: Erinnerungspolitik kann als eigenes Politikfeld verstanden werden,<br />
Erinnerungspolitik kann die Befassung mit verbrecherischen Phasen der kollektiven<br />
Geschichte meinen und/ oder ein essentielles Moment in Prozessen politischen<br />
Systemwechsels sowie die fallweise Instrumentalisierung jedweden vergangenen<br />
Ereignisses für aktuelle politische Zwecke.<br />
Im Seminar werden verschiedene Konzepte und ihre Tauglichkeit zur Beschreibung und<br />
Erklärung von erinnerungspolitischen Phänomenen behandelt.<br />
Das endgültige Programm der Lehrveranstaltung wird in den ersten beiden Sitzungen<br />
diskutiert und festgelegt. Die Studierenden haben somit die Möglichkeit, ihre<br />
Themenwünsche einzubringen.<br />
Die Lehrveranstaltung wird die Lernplattform ISIS verwenden, Teilnehmer der<br />
Lehrveranstaltung müssen über eine Zugangsberechtigung verfügen. Zu den<br />
Teilnahmevoraussetzungen gehört die Bereitschaft, ein Referat zu übernehmen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 2, BA-KulT Wahlbereich<br />
Sprechstunde: Donnerstag, 14-16 Uhr (nach Voranmeldung)<br />
Literatur Edgar Wolfrum: Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung,<br />
Göttingen 2001<br />
Horst-Alfred Heinrich, Michael Kohlstruck (Hg.): Geschichtspolitik und<br />
sozialwissenschaftliche Theorie, Stuttgart 2008<br />
SoSe 2013 3
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Harald Schmid (Hg.): Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Erinnerungskulturen<br />
in Theorie und Praxis, Göttingen 2009<br />
Jahrbuch für Kulturpolitik 9 (2009), Themenschwerpunkt: Erinnerungskulturen und<br />
Geschichtspolitik<br />
Jahrbuch für Politik und Geschichte (2010ff.)<br />
„Kriegsgewalt“ - Sprachliche und bildliche Darstellung militärischer Gewalt im 19. und 20.<br />
Jahrhundert.<br />
3151 L 036, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Erb<br />
Inhalt Wie wird der Krieg in Literatur, Kunst und Wissenschaft wahrgenommen, dargestellt und<br />
in Museen ausgestellt? Das Seminar konzentriert sich auf militärische Gewalt, seiner<br />
sprachlichen und visuellen Repräsentation um dann die gesellschaftlichen, staatlichen<br />
und politischen Veränderungen in den Blick zu nehmen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Moduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur und<br />
Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 4, BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Lit.: Schlachtfelder. Codierung von Gewalt im medialen Wandel, hrsg. von Steffen<br />
Martus, Marina Münkler und Werner Röcke, <strong>Berlin</strong> 2003.<br />
Forschungskolloquium<br />
3151 L 040, Forschungscolloquium, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 18:00 - 20:00, 10.04.2013 - 10.07.2013, TEL 811 , Bergmann, Funck, Kohlstruck, Schüler-<br />
Springorum<br />
Inhalt Die Veranstaltung steht ohne Anmeldung allen wissenschaftlich Interessierten -<br />
unabhängig von einer Hochschulzugehörigkeit - offen, auch zum Besuch einzelner<br />
Termine. Bitte beachten Sie wegen eventueller Programmänderungen die Homepage<br />
des Instituts:<br />
http://www.tu-berlin.de/fakultaet_i/zentrum_fuer_antisemitismusforschung<br />
10.4.2013<br />
Evelyn Annuß, Bochum<br />
(An-)Ästhetisierung des Politischen? Zum Formwandel des nationalsozialistischen<br />
Massentheaters<br />
17.4.2013<br />
Tobias Kühne, <strong>Berlin</strong><br />
Das Netzwerk "Neu Beginnen" und die <strong>Berlin</strong>er SPD nach 1945<br />
24.4.2013<br />
Katharina Erbe, <strong>Berlin</strong><br />
Rebellin, Heldin, Geisteskranke. Die jüdische Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim und<br />
ihr Kampf gegen den Mädchenhandel<br />
8.5.2013<br />
(Bitte beachten Sie die veränderte Uhrzeit: 16:00-18:00)<br />
Péter Bihari, Budapest<br />
Systemwandel und die Juden im Ungarn des 20. Jahrhunderts (Vortrag in englischer<br />
Sprache)<br />
SoSe 2013 4
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
15.5.2013<br />
Mathias Berek, Leipzig/Tel Aviv<br />
Preußisch-jüdisches Deutschland. Der Protosoziologe Lazarus im 19. Jahrhundert<br />
22.5.013<br />
Alexandra Klei, <strong>Berlin</strong><br />
Ort - Ereignis - Erinnerung. Topographie und Architektur ehemaliger Konzentrationslager<br />
im Wandel<br />
29.5.2013<br />
Juliane Michael, Göttingen<br />
Osteuropäisch-jüdische Migranten in der <strong>Berlin</strong>er Unterhaltungskunst der 1920er- und<br />
1930er-Jahre<br />
5.6.2013<br />
Jennifer Steuer, Mannheim<br />
Günter Grass: „Was gesagt werden muss“ – literaturwissenschaftliche und politische<br />
Reaktionen<br />
12.6.2013<br />
Sina Arnold, <strong>Berlin</strong><br />
Antisemitismusdiskurse in der gegenwärtigen US-amerikanischen Linken<br />
19.6.2013<br />
Henning Fauser, Paris/Halle-Wittenberg<br />
Deutschlandbilder ehemaliger französischer KZ-Häftlinge<br />
26.6.2013<br />
Fabian Virchow, Düsseldorf<br />
Verbote rechtsextremer Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland 1951 bis 2011<br />
3.7.2013<br />
Lida Barner, London/<strong>Berlin</strong><br />
„Jüdische Patente sind zu arisieren“. Geistiges Eigentum von Juden im<br />
Nationalsozialismus<br />
10.7.2013<br />
Marcin Siadkowski, Warschau<br />
Die Emigration polnischer Juden und die internationale Politik zwischen 1918 und 1945<br />
(Vortrag in englischer Sprache)<br />
Gender & Diversity in der Gestaltung von Forschungsprojekten und Technologien<br />
3152 L 017, Projektkurs, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 09:00 - 12:00, 19.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Lucht<br />
Inhalt Das Abschlussprojekt ist ein Angebot für alle Studierenden, die ihre natur- oder<br />
ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit (BA/MA/Promotion) um Perspektiven der<br />
Gender Studies erweitern möchten.<br />
Die Lehrveranstaltung bietet die Möglichkeit,<br />
- eine natur- oder ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit (BA/MA/Promotion) in<br />
verschiedenen Stadien zu präsentieren und aus Perspektiven der Gender Studies zu<br />
reflektieren<br />
SoSe 2013 5
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
- zu klären, welche spezifischen Theorien, Kenntnisse und Methoden der Gender Studies<br />
relevant sind für eine Reflektion der Abschlussarbeit im Fachstudium – und diese<br />
individuell oder in der Gruppe zu erarbeiten,<br />
- gemeinsam zu erproben, wie relevante Theorien, Kenntnisse und Methoden der Gender<br />
Studies auf die Abschlussarbeit im Fachstudium übertragen werden können,<br />
- sich über Erfahrungen und ggf. Probleme des interdisziplinären Arbeitens<br />
auszutauschen, die bei diesen Vorhaben entstehen.<br />
Die Ergebnisse der Abschlussprojekte für das Zertifikat „Gender Pro Mint“ können auf<br />
einem Projekttag zum Ende des Semesters der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt<br />
werden.<br />
Bemerkung Lehrveranstaltung des Studieprogramm Gender Pro Mint<br />
Die Lehrveranstaltung findet im Raum MAR 2.009 statt!<br />
Was Sie schon immer über Geschlecht wissen wollten...und nie zu fragen wagten: EInführung in die<br />
Genderstudies<br />
3152 L 023, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 26.06.2013, MAR 0.016<br />
Do, Einzel, 12:00 - 14:00, 27.06.2013 - 27.06.2013, H 0111<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 04.07.2013 - 13.07.2013, MAR 0.016 , Lucht<br />
Inhalt Gender Studies fragen nach der Bedeutung von Geschlecht in Wissenschaft und<br />
Gesellschaft. Sie rücken die Kategorie Geschlecht in verschiedenen Bereichen<br />
(z. B. Arbeit, Technik, Organisationen, Politik) ins Zentrum ihrer Analysen.<br />
Gender Studies zeigen, wie sich Geschlechterverhältnisse historisch entwickelten<br />
und veränderten. Im Seminar werden theoretische, soziologische, methodische<br />
und historiographische Konzepte der Geschlechterforschung vorgestellt und an<br />
exemplarischen Gegenstandsfeldern diskutiert.<br />
Diese Lehrveranstaltung ist geeignet für Studierende aller Fächer und Studiengänge, die<br />
noch keine Kenntnisse in Frauen- und Geschlechterforschung haben. Die Teilnahme an<br />
dieser – oder einer vergleichbaren – Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch<br />
der weiteren Lehrveranstaltungen am ZIFG.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies) (Freie Profilbildung)<br />
MA-BIWI 7b (Bildungswissenschaft: Gender und Organisation)<br />
Transdisziplinäre Geschlechterstudien<br />
3152 L 026, Colloquium, 3.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 19:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Do, Einzel, 16:00 - 19:00, 27.06.2013 - 27.06.2013<br />
Inhalt Das Colloquium bietet die Möglichkeit, Dissertationen sowie Examensarbeiten (Magister/<br />
Magistra, Diplom, Staatsexamen, BA) im transdisziplinären Feld der Frauen- und<br />
Geschlechterforschung vorzustellen und zu diskutieren. Teilnahme nur nach persönlicher<br />
Anmeldung möglich.<br />
Bemerkung BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
SoSe 2013 6
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
Politik und Technik<br />
Projekt im Verkehrswesen M<br />
0551 L 002, Projekt, 4.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 10:00 - 14:00, 12.04.2013 - 12.07.2013, SG-04 505 , Leben<br />
Inhalt Das Projekt im Verkehrswesen M beschäftigt sich mit Fragen zum Schienengüterverkehr.<br />
Das genaue Thema entnehmen Sie bitte zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn<br />
Bemerkung Das Projekt beginnt im SoSe 2013 und wird im WiSe 2013/14 fortgeführt. Weitere<br />
Informationen im Internet, Direktzugang 25809.<br />
Nachweis Arbeitsauswand insgesamt 360 h, entspricht 12 LP nach 2 Semestern (1 LP für 30<br />
Arbeitsstunden)<br />
Kontaktzeiten: 60 h pro Semester (4 SWS, Plenumssitzung zur Abstimmung und<br />
Arbeitsorganisation)<br />
Zeiten für zu erbringende Einzelleistungen: 120 h pro Semester (Recherchearbeit,<br />
organisatorische Aufgaben, Vorbereitung von Plenumsmoderationen/ Sitzungsleitung,<br />
Vorbereitung auf Präsentationen, Verfassen von Einzelkapiteln für den<br />
Abschlussbericht, Vorbereitung des Betrags zum Kolloquium)<br />
Prüfungsäquivalente Studienleistungen: Anfertigen eines Protokolls (10 % der<br />
Gesamtnote), Durchführen einer Sitzungsmoderation (20 %), Beteiligung und<br />
Engagement (30 %), Verfassen des Endberichts (20 %), Teilnahme am Kolloquium (20<br />
%)<br />
Voraussetzung obligatorisch: Vordiplom oder Bachelor<br />
wünschenswert: fachliche Kenntnisse in der eigenen Studienrichtung, fachliche<br />
Kenntnisse zum Thema<br />
Literatur Seifert, Josef W.: Visualisieren Präsentieren Moderieren. Offenbach : GABAL Verlag,<br />
2006. ISBN 978-3-89749-721-4<br />
Peterßen, Wilhelm H.: Wissenschaftliche(s) Arbeiten : Eine Einführung für Schule und<br />
<strong>Studium</strong>. München : Oldenbourg, 1999. ISBN 3-486-11498-0<br />
Patzak, Gerold; Rattay, Günter: Projektmanagement : Leitfaden zum Management von<br />
Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen. Wien : Linde, 2004.<br />
ISBN: 3-7143-0003-1<br />
Das Normale und das Pathologische<br />
3152 L 016, Hauptseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 07.06.2013 - 07.06.2013, MAR 0.007<br />
Sa, Einzel, 12:00 - 16:00, 08.06.2013 - 08.06.2013, MAR 0.007<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 14.06.2013 - 14.06.2013, MAR 4.064<br />
Sa, Einzel, 12:00 - 16:00, 15.06.2013 - 15.06.2013, MAR 2.068<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 21.06.2013 - 21.06.2013, MAR 2.068<br />
Inhalt Die Unterscheidung zwischen dem Normalen und dem Pathologischen bildet die<br />
Grundlage medizinischer Diagnostik. Die Kriterien, unter denen etwas für normal oder<br />
pathologisch erklärt wird, entstammen jedoch nicht der Institution der Medizin allein,<br />
vielmehr lassen sich keine scharfen Grenzen zwischen medizinischen, biologischen und<br />
sozialen Normen ziehen. Zudem entfalten Definitionen von Normen und Pathologien eine<br />
gesellschaftliche Relevanz über den Horizont der Medizin und Biologie hinaus und sind<br />
nicht selten politisch umkämpft.<br />
SoSe 2013 7
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem hat sich diesen und<br />
anderen Problemen in seinem bekanntesten und nun in neuer Übersetzung vorliegenden<br />
Werk „Das Normale und das Pathologische“ gewidmet und dabei Fragen aufgeworfen,<br />
die bis heute aktuell sind: Wie ist das Verhältnis von medizinischer und sozialer Norm?<br />
Ist das Pathologische schlicht eine Abweichung von der Norm? Ist Gesundheit zugleich<br />
das Normale? Kann es mehrere Normen geben? Inwieweit fungiert die Medizin als eine<br />
Technik zur Herstellung von Normalität?<br />
In dem Lektüreseminar wollen wir in einem ersten Teil Auszüge aus Canguilhems Werk<br />
lesen und auf seine Aktualität hinsichtlich gegenwärtiger Formen von medizinischer<br />
Diagnostik und sozialer Normierung befragen. In einem zweiten Teil betrachten wir<br />
aktuelle Rezeptionslinien im Anschluss an Canguilhem und diskutieren die methodische<br />
und theoretische Bedeutung seiner Arbeiten u.a. für die kritische Wissenschaftsforschung<br />
und Medizingeschichte, die Gender Studies und die Disability Studies.<br />
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Voranmeldung bis zum 10.04.2013<br />
per E-Mail an: mike.laufenberg@tu-berlin.de<br />
Der 1. Termin findet am 19.April 2013 um 12 Uhr in Raum MAR 0.011 statt.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 5<br />
Ökologie und Technik<br />
Energieseminar<br />
0330 L 179, Integrierte LV (VL mit UE), 4.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 10:00 - 14:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, FH 314<br />
Mi, wöchentl, 10:00 - 14:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, MAR 4.064<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 14:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, FH 301<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 19:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, HFT-FT 617<br />
Mi, Einzel, 14:00 - 15:00, 29.05.2013 - 29.05.2013<br />
Inhalt In Projekten bearbeiten Studierende unterschiedlicher Fakultäten gemeinsam u.<br />
selbständig praxisorientierte Themen aus den Bereichen Energie und Umwelt (z.B:<br />
Regen. Energiesysteme, Energiekonzepte, angepasste Technologien). Neben techn.<br />
werden auch gesell. u. ökol. Aspekte in den Mittelpunkt gerückt.<br />
Bemerkung Vorstellung der Projekte und Terminabsprache in der 1. Vorlesungswoche Freitag<br />
16.00-18.00 Uhr. Details: http://www.energieseminar.de Bestandteil der Modulliste:<br />
"Ingenieurwissenschaftliche Wahlpflicht" Die LV wird für die meisten Studiengänge als<br />
Wahlfach bzw. Wahlpflichtfach anerkannt. Achtung: Zeitangaben sind vorläufig und<br />
werden erst am obigen Termin festgelegt.<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Labor zum Energieseminar<br />
0330 L 180, Praktikum, 4.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 19:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, MAR 0.001<br />
Mi, wöchentl, 10:00 - 14:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, HFT-FT 617<br />
Mi, wöchentl, 16:00 - 19:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, FH 315<br />
Mo, wöchentl, 16:00 - 19:00, 15.04.2013 - 13.07.2013, FH 302<br />
Fr, Einzel, 16:00 - 19:00, 05.07.2013 - 05.07.2013, KT 101<br />
Inhalt In Projekten bearbeiten Studierende im Team u. selbständig praxisorient. Themen.<br />
Schwerpunkt liegt auf der Planung u. Herstellung von Kleinstanlagen u. Modellen aus<br />
dem Bereich Energie u. Umwelt. Z.B. Solar- u. Biogasanlagen, Lehmbau, WKA. Die LV<br />
vermitt. teamorient. Lösungen ingenieurwiss. Probleme.<br />
Bemerkung Vorstellung der Projekte und Terminabsprache in der 1. Vorlesungswoche, Freitags<br />
16.00-18.00 Uhr. Bestandteil der Modulliste "EVT-Wahlpflichtlabor I" u.a. Die LV wird<br />
SoSe 2013 8
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
als Wahlpflichtlabor oder Wahlfach bei vielen Studiengängen anerkannt. Details und<br />
Raum für Projektvorstellung siehe http://www.energieseminar.de<br />
Unternehmensbezogene Umweltmanagementmethoden<br />
0333 L 417, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 18.04.2013 - 11.07.2013, H 1012 , Ackermann<br />
Inhalt Die Veranstaltung soll ermöglichen an Beispielen aus dem Bereich des<br />
Umweltmanagements selbstständig ein Angebot eines Umweltmanagementkonzeptes<br />
zu erarbeiten. Die Anwendungsbeispiele sind frei wählbar. Behandelt werden<br />
können z.B.: Ökoeffizienzanalyse für Unternehmen, betriebliche Ökobilanz, flexible<br />
Mechanismen zur Reduktion von Schadstoffen im Unternehmen (Joint implementation),<br />
Clean Development Mechanism (CDM) im Unternehmen, Gefahrstoffmanagement im<br />
Unternehmen, Umweltleistungsbewertung im Unternehmen, Umweltberichte für das<br />
Unternehmen. Diese Methoden werden bei Bedarf näher erläutert. Lernziel ist die<br />
selbstständige Erstellung dieses Konzeptes. In der Einführung werden neben der<br />
Vorstellung der Managementstrategie von Deming auch wichtige Elemente zur Erstellung<br />
eines Konzeptes und zum Verkauf von Methoden.<br />
Bemerkung Bei einer Teilnehmerzahl von weniger als 25 Personen findet die Veranstaltung im Z-<br />
Gebäude Raum Z113 statt.<br />
Nachweis Die Leistung wird als prüfungsäquivalente Leistung erbracht. Es muss ein Vortrag<br />
erstellt werden und eine Hausaufgabe geschrieben werden.<br />
Voraussetzung Voraussetzung ist der erfolgreiche Besuch von methodischen und systembezogenen<br />
Umweltmanagementveranstaltungen. Es soll methodisches Wissen aus diesem<br />
Bereich angewandt werden.<br />
Literatur http ://www.deming .<br />
MIT-Press, ISBN: 0-262-54116-5<br />
Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP); Jürgen Witt, Thomas Witt; Verlag<br />
Recht Und Wirtschaft GmbH; 2008;<br />
http://www.zeri-germany.de/ueber-zeri/<br />
Kunststoffrecycling - Probleme und technische Möglichkeiten<br />
0334 L 416, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 08:00 - 10:00, 16.04.2013 - 09.07.2013, WF 104 , Tartakowska<br />
Inhalt Im Rahmen der Vorlesung werden Begriffsdefinitionen zum Recycling, gesetzliche<br />
Verordnungen sowie der Stand, Probleme und technische Möglichkeiten beim Recycling<br />
von Kunststoffen behandelt. Umwelttechnische Überlegungen beim Recycling.<br />
Bemerkung Bestandteil der Module "Polymere Werkstoffe" und "Polymere Biomaterialien und<br />
Kunststoffrecycling". Offen für Interessierte aller Fachrichtungen.<br />
Grundlagen der Sicherheitstechnik<br />
0339 L 601, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 10:00 - 12:00, 10.04.2013 - 10.07.2013, TC 006 , Leimeister, Steinbach<br />
Mi, Einzel, 10:00 - 12:00, 10.04.2013 - 10.04.2013, H 2013<br />
Inhalt Grundbegriffe der Sicherheitstechnik, Gefahrenpotential, Risiko, Sicherheit;<br />
Sicherheitskonzepte für Anlagen mit Stoffumwandlung und solche mit<br />
Energieumwandlung, Grundlagen der fehlertoleranten Auslegung; Vorgehensweise für<br />
die Implementierung der Sicherheitstechnik in die Anlagentechnik; Grundlagen des Risk-<br />
Managements.<br />
Bemerkung Pflichtvorlesung für Energie- und Verfahrenstechnik im Hauptstudium Bestandteil<br />
des Moduls: "Prozess- und Anlagendynamik und Sicherheitstechnik" Bestandteil<br />
SoSe 2013 9
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
des Moduls: "Prozess- und Anlagentechnik" für Wi.-Ing. Bestandteil des Moduls:<br />
"Anlagensicherheit - Grundmodul" Bestandteil des Moduls: "Anlagensicherheit -<br />
Vertiefungsmodul"<br />
Nachweis Mündliche Prüfung<br />
Chemische Sicherheitstechnik<br />
0339 L 603, Integrierte LV (VL mit UE), 4.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 08:00 - 12:00, 12.04.2013 - 12.07.2013<br />
Inhalt Thermokinetik und Kalorimetrie, Thermische Auslegung kontinuierlicher und<br />
diskontinuierlicher Reaktoren,Gesetze zum Betrieb chem. Anlagen.<br />
Bemerkung Wahlpflichtveranstaltung für ET, VT, E + VT, Chemie-Dipl.-Ing., Wi.-Ing., ITMler.<br />
Ort : Vorlesung findet statt ab 8.30 Uhr im TK 028 , Zugang TK-Gebäude, Eingang 1.<br />
Eine Anmeldung im Sekretariat ist bis 1.4.2013 erforderlich.<br />
Nachweis Mündliche Prüfung<br />
Umweltgerechte Produktentwicklung in der Elektronik<br />
0431 L 718, Projekt, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, TIB17 -563 , Nissen, Middendorf<br />
Inhalt "Environmental Design of Electronic Products Project". Ziel der Projektarbeit Umwelt<br />
und Elektronik ist es, praktische Erfahrung bei der Einbeziehung von Umweltfragen<br />
zu sammeln. Dabei sollen elektronische Produkte zerlegt und analysiert, sowie<br />
umweltfreundliche Alternativen diskutiert werden.<br />
Bemerkung Studierende im Master/Hauptstudium. Wahlpflichtveranstaltung im Studienschwerpunkt<br />
Mikrosystemtechnik (Modul MS3). Nach drei Einführungsterminen findet der<br />
praktische Teil in kleinen Gruppen statt. Termine der Kleingruppen werden am 1.<br />
Einführungstermin vereinbart. Mögliche Kleingruppentermine sind zusätzlich im<br />
Zeitraum Montag 14 - 18 Uhr. Weitere Informationen: http://www.becap.tu-berlin.de<br />
Voraussetzung Empfohlen wird die Vorlesung: 0431 L 717 - Design umweltverträglicher elektronischer<br />
Produkte - 2.0 SWS - Lang, Nissen, Middendorf<br />
Wasserversorgung - Siedlungswasserwirtschaft I (ehemals: Grundlagen Siedlungswasserbau und<br />
Siedlungswasserwirtschaft (Wasser))<br />
06315100 L 10, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 08:00 - 10:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TIB13B -B , Barjenbruch<br />
Inhalt Grundlagen der Planung: wasserwirtschaftliche Rahmenplanung, Bauleitpläne;<br />
Wasserbedarf; Wasservorkommen und -erschließung<br />
Wassergewinnung: Brunnenberechnung und -bau; Wasserschutzgebiete; Aufbereitung<br />
Förderung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser: Bemessung von<br />
Pumpenanlagen<br />
Bemerkung Für Studiengänge Technischer Umweltschutz, Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
Geowissenschaften und weitere interessierte Fachbereiche. Weitere Auskünfte:<br />
lehre@siwawi.tu-berlin.de.<br />
Gehört zu dem Modul "Wasserversorgung - Siedlungswasserwirtschaft I" (ehemals<br />
"Grundlagen Siedlungswasserbau und Siedlungswasserwirtschaft (Wasser)") im<br />
Ergänzungsbereich MSc. Technischer Umweltschutz<br />
Ökologie und Gesellschaft II<br />
06341100 L 92, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 16:00 - 18:00, 15.04.2013 - 08.07.2013, BH-N 334 , Kaupenjohann, Wagner, Wessolek<br />
Inhalt Wirkmächtigkeit des Menschen, Risiko und gesellschaftliche Verantwortlichkeit der<br />
Umweltwissenschaften, jeweils an konkreten Beispielen aus den ökologischen<br />
Disziplinen.<br />
Bemerkung Wahlveranstaltung für Biologen, Landschaftsplaner, Stadtökologen, Umwelttechniker<br />
und andere Studiengänge<br />
Nachweis Prüfungsäquivalente Studienleistung<br />
SoSe 2013 10
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Wirtschaft, Management und Technik<br />
Projektkurs: Schutz von Erfindungen: Patent- und Lizenzrecht<br />
0339 L 431, Integrierte LV (VL mit UE), 4.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 08:00 - 12:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, H 3012<br />
Inhalt Die Studierenden sollen die Erlangung und Durchsetzung von Patenten an praktischen<br />
(verfahrenstechnischen) Beispielen erlernen und üben. U.a. soll die prägnante<br />
Formulierung des Kerns der Erfindung, die Vorbereitung und Durchführung von<br />
Patentanmeldungen, Probleme des Lizenzrechts und die Durchführung von Recherchen<br />
geübt werden.<br />
Bemerkung Modul: "Schutz von Erfindungen: Patent- und Lizenzrecht" Wahl - VL<br />
Eigener Laptop mit WLAN hilfreich<br />
Diversity Management in der Unternehmenspraxis<br />
0536 L 325, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, Einzel, 18:00 - 19:00, 16.04.2013 - 16.04.2013, Schraudner<br />
Block, 09:00 - 18:00, 24.05.2013 - 25.05.2013<br />
Inhalt Worum geht es? Diversity Management (DiM) zielt im Wesentlichen auf<br />
einen strategischen Umgang mit vielfältigen Talenten und Perspektiven in Denk-,<br />
Organisations- und Innovationsprozessen von Unternehmen, Universitäten und<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
Ziel des Seminars ist es, zu zwei DiM-Schwerpunkten zunächst theoretisches Wissen<br />
zu vermitteln, um anschließend den Transfer in die Praxis zu leisten.<br />
• Diversity Management: Was ist DiM? Wie sieht DiM in der unternehmerischen Praxis<br />
aus? Was tun Unternehmen, um unterschiedlichste Menschen zu fördern, um auf ihre<br />
individuellen Bedürfnisse einzugehen?<br />
• Diversity & Innovationen: Wie können unterschiedliche Disziplinen, Denkund<br />
Herangehensweisen genutzt werden, um neue Märkte zu erschließen und<br />
Innovationen zu generieren?´<br />
• Diversity-Strategie: Wie sehen aktuelle Diversity Management Strategien in<br />
Unternehmen aus? Vergleich und Erarbeitung einer eigenen Strategie<br />
Bemerkung Blockseminar am Freitag / Samstag 24. und 25. Mai 2013. Anmeldung und evt.<br />
Themenvergabe erfolgen bei der Vorbesprechung am Dienstag 16.04.2013, 18<br />
- 19 Uhr. Blockseminar und Vorbesprechung finden in den Räumen der Fraunhofer<br />
Gesellschaft, 5. OG, Hardenbergstr. 20, 10623 <strong>Berlin</strong> statt.<br />
Das Modul ist mit anderen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets kombinierbar. Das 3<br />
ECTS Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.<br />
Nachweis Die Note setzt sich aus der Bewertung folgender Leistungen zusammen<br />
(prüfungsäquivalente Studienleistungen ): Mündliche Mitarbeit und Präsentationen<br />
während der Veranstaltung, Seminararbeit zur Präsentation während des Seminars<br />
oder im Nachgang (richtet sich nach Anzahl der Teilnehmenden).<br />
Es besteht Teilnahmepflicht.<br />
Literatur • Cox, Taylor (1993): Cultural Diversity in Organizations. Theory, Research and<br />
Practice. San Francisco: BK.<br />
• Frohnen, A. (2005): Diversity in Action. Mulitnationalitaet in globalen Unternehmen<br />
am Beispiel Ford. transcript. Bielefeld<br />
SoSe 2013 11
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
• Köppel, Petra (2009): Diversity Management in Deutschland: Ein Benchmark<br />
unter den DAX 30-Unternehmen. URL: http://www.synergyconsult.de/pdf/<br />
Benchmark_Diversity_Management_DAX30.pdf<br />
• Krell, Gertraude/ Wächter, Hartmut (Hrsg.) (2006): Diversity Management: Impulse<br />
aus der Personalforschung. München/ Mering.<br />
• Leicht-Scholten, Carmen et. al. (Hrsg) (2010): Going Diverse: Innovative Answers to<br />
Future Challenges.<br />
• Schiebinger, L. (2008): Gendered Innovations in Science and Engineering. 1. Aufl.<br />
Stanford: Stanford University Press.<br />
• Schraudner, Martina (2010): Diversity im Innovationssystem. Stuttgart: Fraunhofer<br />
Verlag.<br />
Diversity – und Innovationsmanagement – für neue Märkte<br />
0536 L 343, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, Einzel, 18:00 - 19:00, 16.04.2013 - 16.04.2013<br />
Block, 09:00 - 18:00, 21.06.2013 - 22.06.2013<br />
Inhalt Diversity Management und Innovationsmanagement gewinnen zunehmend an<br />
Bedeutung. Schlagworte wie Globalisierung, Internationalisierung, Chancengleichheit,<br />
demographischer Wandel und Fachkräftemangel prägen einen Rahmen, in dem<br />
Diversity Management diskutiert wird, während Innovationsmanagement eher im Zuge<br />
von Wettbewerb, kurzen Produktlebenszyklen, Marktdynamik und –Orientierung an<br />
Beachtung gewinnt.<br />
Ziel des Seminars ist die Vermittlung von theoretischem Wissen und der praktischen<br />
Umsetzung zu Diversity & Innovationen - für einen strategischen Umgang mit Vielfalt und<br />
zur Generierung neuer Märkte:<br />
• Theorie: Aktuelle Studien und Literatur zu Diversity-Management als<br />
Innovationstreiber; Kenntnis von Innovationsmanagementgrundlagen<br />
• Praxis: Partizipative Ansätze in Forschung und Entwicklung, Kreativsession und<br />
Ausarbeitung eigener Innovationen<br />
• Kreativsession: Erarbeitung von innovativen Ideen basierend auf verschiedenen<br />
Kreativitätstechniken entlang der erlernten Theorie<br />
Bemerkung Blockseminar am 21. und 22. Juni 2013 (Freitag / Samstag). Anmeldung und evt.<br />
Themenvergabe erfolgen bei der Vorbesprechung am Dienstag 16.04.2013, 18<br />
- 19 Uhr. Blockseminar und Vorbesprechung finden in den Räumen der Fraunhofer<br />
Gesellschaft, 5. OG, Hardenbergstr. 20, 10623 <strong>Berlin</strong> statt.<br />
Das Modul ist mit anderen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets kombinierbar. Das 3<br />
ECTS Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.<br />
Nachweis Die Note setzt sich aus der Bewertung folgender Leistungen zusammen<br />
(prüfungsäquivalente Studienleistungen ): Mündliche Mitarbeit und Präsentationen<br />
während der Veranstaltung, Seminararbeit zur Präsentation während des Seminars<br />
oder im Nachgang (richtet sich nach Anzahl der Teilnehmenden).<br />
Es besteht Teilnahmepflicht.<br />
Literatur • Boschma, Ron A. (2005): Proximity and Innovations: A Critical Assessment. In:<br />
Regional Studies, Jg. 39, H. 1; 61–74<br />
• Nooteboom, B.; Van Haverbeke, W.P.; Duijsters, G.M.; Gilsing, V.; Van den Oord, A.<br />
(2007): Optimal cognitive distance and absorptive capacity. In: Research Policy, Jg.<br />
36, H. 7, 1016–1034<br />
• Page, Scott E. (2008): The difference. How the power of diversity creates better<br />
groups, firms, schools, and societies. 3. Aufl. Princeton<br />
• Schiebinger, L. (2008): Gendered Innovations in Science and Engineering. 1. Aufl.<br />
Stanford: Stanford University Press<br />
SoSe 2013 12
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
• Schraudner, M. (2010): Diversity im Innovationssystem. Stuttgart: Fraunhofer Verlag<br />
Einführung in die Volkswirtschaftslehre für Nichtökonomen<br />
0830 L 009, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, H 2053 , Goebel, Grabka, Holst, Wagner<br />
Inhalt Wirtschaftstheoretische Grundlagen, Volkswirtschaftliche Grundlagen (Angebot und<br />
Nachfrage, Produktion, Arbeitsteilung, Kreislauf), Externe Effekte, Arbeitsmarkt,<br />
Makroökonomie und Wirtschaftspolitik.<br />
Bemerkung Es sind alle Studiengänge möglich. Die Veranstaltung ist für Hörer aller Fachbereiche<br />
geeignet.<br />
Wirtschaftsprivatrecht<br />
0830 L 010, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, H 0105 , Hunscha<br />
Fr, wöchentl, 10:00 - 12:00, 12.04.2013 - 12.07.2013, H 2013 , Hunscha<br />
Inhalt Die Veranstaltung ist Teil des Moduls "Wirtschaftsprivatrecht" (6 ECTS); in der<br />
vierstündigen Vorlesung werden die Grundlagen des Wirtschaftsprivatrechts vermittelt<br />
(Akteure des Wirtschaftsprivatrechts nach BGB und HGB; Vertragsschluss inkl.<br />
der Bedeutung von Stellvertretung und AGB; Inhalt, Durchführung und Störung<br />
(vor-)vertraglicher Schuldverhältnisse, insb. anhand von Kauf- und Werkvertrag;<br />
Grundlagen der gesetzlichen Schuldverhältnisse sowie des Mobiliarsachenrechts; jeweils<br />
mit zugehörigen handelsrechtlichen Bezügen)<br />
Zur Vorlesung werden begleitende zweistündige Übungen angeboten, von denen eine<br />
zu besuchen ist.<br />
Bemerkung dazu nach Wahl eine der folgenden Übungen<br />
Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen<br />
0830 L 080, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, EB 301<br />
Inhalt Die Lehrveranstaltung richtet sich an alle, die sich für das Verstehen, Beurteilen und<br />
Management unternehmerischer Aufgaben interessieren. Sie bietet den Studierenden<br />
der Fakultäten I - VI Einblick in die Methoden des betrieblichen Management.<br />
Betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig.<br />
Bemerkung Das Modul wird mit einer Klausur abgeschlossen. Weitere Informationen unter:<br />
www.fues7.tu-berlin.de<br />
Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen<br />
(Gruppe 1)<br />
0830 L 081, Übung, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 10:00 - 12:00, 15.04.2013 - 13.07.2013, H 0107<br />
Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen<br />
(Gruppe 2)<br />
0830 L 082, Übung, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 15.04.2013 - 13.07.2013, EB 107<br />
Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen<br />
(Gruppe 3)<br />
0830 L 084, Übung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 24.04.2013 - 13.07.2013, H 0106<br />
Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen<br />
(Gruppe 4)<br />
0830 L 085, Übung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 14:00 - 16:00, 24.04.2013 - 13.07.2013, H 0112<br />
Betriebswirtschaftslehre & Management - Einführung für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen<br />
(Gruppe 5)<br />
0830 L 086, Übung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 08:00 - 10:00, 24.04.2013 - 13.07.2013, H 0107<br />
Arbeitsrecht<br />
SoSe 2013 13
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
0830 L 165, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 16:00 - 18:00, 10.04.2013 - 10.07.2013, H 0106 , Hunscha<br />
Inhalt Der Arbeitsvertrag, Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, Tarifvertrag und<br />
Betriebsverfassung, Störungen im Arbeitsverhältnis, Kündigung und Kündigungsschutz<br />
Gesellschafts- und Konzernrecht<br />
0830 L 230, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, H 1058 , Baumann<br />
Inhalt Recht der Personen- und Kapitalgesellschaften mit Konzernrecht<br />
PREPARE Praxismodul - berufsvorbereitende Lehrveranstaltung<br />
0831 L 088/1, Integrierte LV (VL mit UE), 6.0 SWS<br />
Inhalt Vermittlung berufsvorbereitender Managementkompetenzen sowie Praxisprojekte mit<br />
Unternehmen<br />
Woche 3 (Managementkompetenzen):<br />
bspw. Personalmanagement, Projektmanagement, Controllingkonzepte, Marketing &<br />
Sales Management<br />
Die Seminare zu den einzelnen Managementkompetenzen bilden die thematische<br />
Grundlage für das im Anschluss zu bearbeitende Praxisprojekt mit einem Unternehmen.<br />
Das Praxisprogramm kann mit 6 Credits im Rahmen der jeweiligen<br />
Prüfungsordnung anerkannt werden.<br />
Bemerkung PREPARE Summer School 2013 - Praxismodul<br />
3. PREPARE-Woche: 16.09. - 20.09.2013 (Blockseminar 5 Tage à 6 Stunden)<br />
PREPARE-Praxisprojekte: 23.09. - 13.12.2013 (überwiegend freie Zeiteinteilung)<br />
Bitte unbedingt Hinweise zu Teilnahme und Anmeldung unter www.career.tuberlin/prepare<br />
beachten!<br />
Nutzen Sie auch die Infoveranstaltung am 14.06.2013 | 10:30 bis 11:30 Uhr!<br />
Onlineanmeldung unter http://www.career.tu-berlin.de/menue/fuer_studierende/<br />
veranstaltungen/anmeldung/<br />
Technology Foresight in Practice - The Future of Learning Technologies<br />
0832 L 202, Seminar, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 08:00 - 12:00, 19.04.2013 - 12.07.2013, H 7112<br />
Fr, wöchentl, 12:00 - 14:00, 19.04.2013 - 12.07.2013, H 7112<br />
Inhalt<br />
29.04.2011 - H 7112 - 12:00-16:00 Uhr<br />
Kickoff-Veranstaltung<br />
06.05.2011 - H 3021 - 12:00-16:00 Uhr<br />
1. Vertiefungssitzung - wissenschaftliche Inputs durch Studenten sowie Verteilung der<br />
Case Studies<br />
27.05.2011 - H 7112 - 12:00-16:00 Uhr<br />
SoSe 2013 14
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Besprechung der Zwischenergebnisse<br />
24.06.2011 - H 7112 - 12:00-16:00 Uhr<br />
Zwischenpräsentation<br />
08.07.2011 - H 7112 - 12:00-16:00 Uhr<br />
Endpräsentation<br />
15.07.2011 - H 7112 - 12:00-16:00 Uhr<br />
Wrap-Up /<br />
Abgabe der schriftlichen Ausarbeitungen<br />
Nachweis Leistungen werden veranstaltungsbegleitende erbracht und bewertet.<br />
Wi-Ing.: prüfungsrelevante Studienleistung (Hinweis: Anmeldung auf dem Prüfungsamt<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginnn!)<br />
BWL: Schein<br />
Strategic Innovation Management<br />
0832 L 219, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 14:00 - 16:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, H 0107 , Gemünden<br />
Di, wöchentl, 10:00 - 12:00, 16.04.2013 - 13.07.2013, H 0106 , Gemünden<br />
Inhalt Building on the basic terminology and ideas of innovation management that were<br />
introduced in the Bachelor module „Organisation und Innovationsmanagement“, this<br />
module expands knowledge on the fundamentals of strategic innovation management.<br />
While the significance of innovation for companies is undisputed, the challenge lies in<br />
choosing the right innovation strategy, setting up appropriate organizational structures<br />
that support innovation, and managing the network of external collaboration partners.<br />
After completing this module students will have a deeper understanding of different<br />
innovation strategies and their consequences for managing innovation. Furthermore, they<br />
will know how to balance organizational requirements for strategies of exploitation (e.g.,<br />
the development and commercialization of incremental new products and services that<br />
build on existing competences) and exploration (e.g., the development of completely new<br />
competencies and new markets through radical innovation), which are both necessary for<br />
long-term growth and firm survival. Students will understand the importance of opening<br />
the innovation process and fostering collaboration with external stakeholders. They will<br />
have knowledge of the necessary skills and activities to manage the overall innovation<br />
network of a firm (i.e., network competence), which can comprise suppliers, customers,<br />
research institutes, complementary firms or even competitors. They will know how to<br />
identify and choose potentially valuable partners such as lead users or user communities<br />
and how to successfully integrate these actors in the innovation process.<br />
In the case seminar connected to the lecture, students will not only have gained a<br />
deeper understanding of the above mentioned topics. By discussing real firm cases, jointly<br />
working out possible solutions, and presenting results in a comprehensive way, they will<br />
also have developed analytic skills, the competence to work in teams under time pressure,<br />
and the capability to convincingly present recommendations as well as argue for their<br />
chosen approach.<br />
Bemerkung Es findet eine Einführungsveranstaltung zu dem gesamten Lehrprogramm und zu den<br />
Prüfungsmodalitäten (Belegungsmöglichkeiten, Anmeldung und Vergabeverfahren<br />
über die Onlineverwaltung, Klausuren etc.) des Lehrstuhls statt. Die Teilnahme wird<br />
dringend empfohlen. Termin und Ort s. 0832 L 200.<br />
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen des Lehrstuhls erfolgt über die TIM-<br />
Onlineverwaltung unter www.tim.tu-berlin.de. Die Plätze für Übungen und Seminare<br />
sind beschränkt.<br />
Nachweis Klausurtermine siehe 0832 L 290 "Klausur Technologie- und<br />
Innovationsmamagement"; der Stoff der Übung ist nicht klausurrelevant.<br />
Wi-Ing.: prüfungsrelevante Studienleistung (Hinweis: Anmeldung auf dem Prüfungsamt<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginnn!)<br />
BWL: Klausur<br />
Literatur u.a. Hauschildt und Salomo (2007): Innovationsmanagement, 4. Aufl., Vahlen.<br />
Case Seminar in Strategic Innovation Management<br />
0832 L 220, Übung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 14.07.2013<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 14.07.2013<br />
SoSe 2013 15
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Mi, wöchentl, 10:00 - 12:00, 17.04.2013 - 13.07.2013, H 7112 , Reimer<br />
Inhalt Die Übung beleuchtet fallstudienbezogen spezifische Fragestellungen des strategischen<br />
Innovationsmanagements.<br />
Bemerkung Es findet eine Einführungsveranstaltung zu dem gesamten Lehrprogramm und zu den<br />
Prüfungsmodalitäten (Belegungsmöglichkeiten, Anmeldung und Vergabeverfahren<br />
über die Onlineverwaltung, Klausuren etc.) des Lehrstuhls statt. Die Teilnahme wird<br />
dringend empfohlen. Termin und Ort s. 0832 L 200 Einführungsveranstaltung <strong>Studium</strong><br />
"Technologie- und Innovationsmanagement, Innovationsökonomie". Die Anmeldung<br />
für alle Veranstaltungen des Lehrstuhls erfolgt über die TIM-Onlineverwaltung unter<br />
www.tim.tu-berlin.de. Die Plätze für Übungen und Seminare sind beschränkt.<br />
Nachweis Leistungen werden veranstaltungsbegleitend erbracht und bewertet. Der Stoff der<br />
Übung ist nicht klausurrelevant für die dazu gehörige Vorlesung.<br />
Wi-Ing.: prüfungsrelevante Studienleistung (Hinweis: Anmeldung auf dem Prüfungsamt<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginnn!)<br />
BWL: Schein<br />
Technology Management<br />
0832 L 221, Vorlesung, 4.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 10:00 - 16:00, 12.04.2013 - 11.07.2013, HL 001<br />
Inhalt<br />
Dates<br />
•20.04: Exercise: Introduction to the technology foresight exercise<br />
•11.05: Students presentation: Technology status<br />
•16.05: Deliverables: students paper (in pdf) of technology status<br />
•22.05: Exercise: Introduction to the scenario analysis<br />
•22.06: Final presentation (part 1)<br />
•29.06: Final presentation (part 2)<br />
13.07: Deliverables: final reports<br />
Nachweis<br />
Voraussetzung<br />
Strategic Foresight and Scenario Analysis<br />
0832 L 224, Übung, 4.0 SWS<br />
Inhalt<br />
Nachweis For the lectures, a written exam of 90 minutes duration<br />
is intended. Exercises and seminars (participation, presentations and written<br />
assignments) will be assessed.<br />
Seminar zum Projektmanagement - Strategic Project Management (Seminar, in German)<br />
0832 L 235, Seminar, 4.0 SWS<br />
Do, Einzel, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 18.04.2013, H 2033<br />
Inhalt Im Seminar werden ausgewählte Fragestellungen aus den Themenbereichen der<br />
Vorlesung, d.h. hinsichtlich des operativen Projektmanagements, weiter vertieft.<br />
Bemerkung Es findet eine Einführungsveranstaltung zu dem gesamten Lehrprogramm und zu den<br />
Prüfungsmodalitäten (Belegungsmöglichkeiten, Anmeldung und Vergabeverfahren<br />
über die Onlineverwaltung, Klausuren etc.) des Lehrstuhls statt. Die Teilnahme wird<br />
SoSe 2013 16
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
dringend empfohlen. Termin und Ort s. 0832 L 200 Einführungsveranstaltung <strong>Studium</strong><br />
"Technologie- und Innovationsmanagement, Innovationsökonomie". Die Anmeldung<br />
für alle Veranstaltungen des Lehrstuhls erfolgt über die TIM-Onlineverwaltung unter<br />
www.tim.tu-berlin.de. Die Plätze für Übungen und Seminare sind beschränkt.<br />
Nachweis Leistungen werden veranstaltungsbegleitende erbracht und bewertet.<br />
Wi-Ing.: prüfungsrelevante Studienleistung (Hinweis: Anmeldung auf dem Prüfungsamt<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginnn!)<br />
BWL: Schein<br />
Projektmanagement - Project Management (lecture, in German)<br />
0832 L 236, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 10:00 - 12:00, 12.04.2013 - 12.07.2013, H 1012<br />
Inhalt Projektmanagement im Maschinen- und Anlagenbau sowie in<br />
Dienstleistungsunternehmen; Organisation und Aufgaben des Projektmanagements;<br />
Projektteam und Projektverantwortung; Produktstrukturierung und Projektplanung<br />
(Aufbau-, Ablauf-, Kapazitäts-, Termin- und Kostenplanung); Projektabwicklung,<br />
Projektphasen, Meilensteine; Werkzeuge der Projektplanung (Gantt u. a.); Grundlagen<br />
der Netzplantechnik (CPM, PERT, MPM u. a.); Regelkreis des Projektmanagements;<br />
Risikoanalyse von Projekten; Controlling und Projektabschluss<br />
Bemerkung Es findet eine Einführungsveranstaltung zu dem gesamten Lehrprogramm und zu den<br />
Prüfungsmodalitäten (Belegungsmöglichkeiten, Anmeldung und Vergabeverfahren<br />
über die Onlineverwaltung, Klausuren etc.) des Lehrstuhls statt. Die Teilnahme wird<br />
dringend empfohlen. Termin und Ort s. 0832 L 200 Einführungsveranstaltung <strong>Studium</strong><br />
"Technologie- und Innovationsmanagement, Innovationsökonomie".<br />
Nachweis Klausurtermine siehe 0832 L 290 "Klausur Technologie- und<br />
Innovationsmamagement"; Der Stoff der Übung ist nicht klausurrelevant.<br />
Wi-Ing.: prüfungsrelevante Studienleistung (Hinweis: Anmeldung auf dem Prüfungsamt<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginnn!)<br />
BWL: Klausur<br />
Literatur Burghardt, Manfred (1988): Projektmanagement, Siemens AG München.<br />
Litke,H.-D. (1993): Projektmanagement, Poeschel, Stuttgart.<br />
Weitere Literaturangaben auf Anfrage und unter http://www.tim.tu-berlin.de<br />
Projektmanagement - Rechnergestützt (MSc.,Hauptdiplom) - Project Management (Exercise, in<br />
German)<br />
0832 L 237, Übung, 2.0 SWS<br />
Do, Einzel, 14:00 - 16:00, 18.04.2013 - 18.04.2013, H 7112<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 25.04.2013 - 13.07.2013, H 7112 , Kock<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 25.04.2013 - 13.07.2013, H 7112 , Kock<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 25.04.2013 - 13.07.2013, H 7112<br />
Inhalt Die Übung zum Projektmanagement befasst sich mit den wesentlichen<br />
Managementaufgaben in den unterschiedlichen Phasen der Projektabwicklung. Dabei<br />
werden insbesondere die Methoden der Projektplanung und des Projektcontrollings<br />
anhand einer praxisnahen Fallstudie vertieft. Zum Einsatz kommt hierbei das<br />
Projektmanagement-Tool Microsoft Project, dessen Anwendungsmöglichkeiten die<br />
Studenten im Laufe der Veranstaltung kennen lernen sollen. Die Bearbeitung und<br />
Präsentation von Übungsaufgaben erfolgt in Gruppen zu jeweils 3 Personen.<br />
Bemerkung Es findet eine Einführungsveranstaltung zu dem gesamten Lehrprogramm und zu den<br />
Prüfungsmodalitäten (Belegungsmöglichkeiten, Anmeldung und Vergabeverfahren<br />
über die Onlineverwaltung, Klausuren etc.) des Lehrstuhls statt. Die Teilnahme wird<br />
dringend empfohlen. Termin und Ort s. 0832 L 200 Einführungsveranstaltung <strong>Studium</strong><br />
"Technologie- und Innovationsmanagement, Innovationsökonomie".<br />
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen des Lehrstuhls erfolgt über die TIM-<br />
Onlineverwaltung unter www.tim.tu-berlin.de. Die Plätze für Übungen und Seminare<br />
sind beschränkt.<br />
Nachweis Leistungen werden veranstaltungsbegleitend erbracht und bewertet. Der Stoff<br />
der Übung ist nicht klausurrelevant für die dazu gehörige Vorlesung. Wi-Ing.:<br />
prüfungsrelevante Studienleistung (Hinweis: Anmeldung auf dem Prüfungsamt<br />
innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginnn!)<br />
SoSe 2013 17
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Research Practice Seminar in Innovation Management<br />
0832 L 255, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 16.04.2013 - 15.07.2013<br />
Inhalt This research practice seminar will feature presentations, discussions and studies<br />
focusing on the role of leadership and culture within the domain of creativity and innovation<br />
management. Topics will include creativity and innovation, recent leadership approaches<br />
(especially authentic and humble leadership) and culture-related issues (organizational<br />
culture as well as national-level cultural differences). The purpose of the sessions is to<br />
discuss relevant research articles and methodological texts as well as students’ individual<br />
projects. Furthermore, the instructor will provide suggestions on how to proceed during<br />
the different stages of the research projects (literature review, data collection, data<br />
analysis, write-up).<br />
Systematische Bewertung med. Technologien/Health Technology Assessment (HTA Onlinekurs)<br />
0833 L 362, E-Learning-Kurs, 4.0 SWS<br />
Inhalt Qualifikationsziele: Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden einen fundierten Einblick<br />
in die Begrifflichkeiten, die Einbindung in das (deutsche) Gesundheitssystem und die<br />
Methodik der Erstellung von HTA zu vermitteln. Weiterhin wird die grundlegende Fähigkeit<br />
zur Erstellung von HTA-Berichten erworben.<br />
Lerninhalte: HTA bezeichnet eine systematische Bewertung medizinischer Technologien.<br />
Das Ziel von HTA ist hierbei die Unterstützung von Entscheidungen in Politik und<br />
Praxis. Der erste Teil der Veranstaltung beschäftigt sich mit den Grundbegriffen von<br />
HTA und seiner Einbindung in das Gesundheitssystem. Hierbei wird vor allem Wert<br />
auf die Erarbeitung der deutschen Rahmenbedingungen gelegt. Der zweite Teil widmet<br />
sich der Methodik der Erstellung von HTA-Berichten. Ziel ist hierbei, die grundlegende<br />
Kompetenz des Verfassens von HTA-Berichten zu erwerben. Die Methodik von HTA ist<br />
interdisziplinär.<br />
Der Kurs ist ein Blended-Learning-Kurs, dies heißt, er ist eine Kombination von Präsenzund<br />
Onlinelernen. Außer während der Präsenzveranstaltungen( jeweils 6 Stunden)<br />
müssen Sie nicht in der Universität sein, sondern können von überall teilnehmen, wo<br />
Sie Internetanschluss haben. Die tägliche Arbeitszeit während der Onlinephase sollten<br />
Sie mit 3 Stunden veranschlagen. Neben dem Erwerb von Kenntnissen über HTA und<br />
das deutsche Gesundheitssystem können Sie ebenfalls Erfahrungen mit E-Learning und<br />
Online-Kommunikation sammeln. Sie können einen Schein mit 6 Leistungspunkten oder<br />
#wenn Sie diesen nicht benötigen- ein Zertifikat, das Ihre Teilnahme bestätigt, erhalten.<br />
Bedingung für die Vergabe sind die Bearbeitung von Übungsaufgaben und die Teilnahme<br />
an einem (online durchgeführten) Abschlusstest.<br />
Bemerkung Der Kurs steht grundsätzlich allen Masterstudierenden der <strong>TU</strong>-<strong>Berlin</strong> offen. Unter<br />
Umständen können auch Studierende anderer Hochschulen an dem Kurs teilnehmen.<br />
Wir bitten im Einzelfall um Rücksprache. Die TeilnehmerInnenzahl ist auf 20 begrenzt,<br />
die nach der Reihenfolge der Anmeldungen gelistet werden. Deswegen bitten wir Sie,<br />
sich ab sofort über unser Anmeldeformular auf unserer Website http://www.mig.tuberlin.de/menue/teaching/weiterbildung/<br />
anzumelden.<br />
Anmeldeschluss ist der 05.04.2013. ING_707 im Modulkatalog der GKWi<br />
1. Präsenzveranstaltung: 19.04.2013<br />
2. Präsenzveranstaltung: 31.05.2013<br />
3. Präsenzveranstaltung: 12.07.2013<br />
Die Präsenztage dauern jeweils von 11.00 - 17:00 Uhr. Die Teilnahme am ersten<br />
Präsenztermin ist verpflichtend.<br />
SoSe 2013 18
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Online-Phase: 19.04.2013 - 14.07.2013 Aktuelles und die Raumnummer der<br />
Präsenzveranstaltung werden auf unserer Homepage bekanntgegeben.<br />
Technologiemanagement<br />
3536 L 242, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 16:00 - 18:00, 17.04.2013 - 10.07.2013, PTZ 307<br />
Inhalt Wechselwirkungen Management und Technologie, Wachstums- und<br />
Produktivitätsmanagement; Qualitätsmanagement; Gründungsmanagement;<br />
Innovationsmanagement; Wissensmanagement; Kooperation in Netzwerken;<br />
Qualifikationsmanagement; strategische Unternehmensplanung, Umweltmanagement.<br />
Bemerkung Für interessierte Studenten, Wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden<br />
Schienengüterverkehr<br />
0533 L 207, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 08:00 - 10:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, H 2053 , Siegmann<br />
Inhalt Organisation der Güterbeförderung, Produktionssysteme, Angebots- und<br />
Produktionsplanung, Kostenstruktur, Fahrzeuge und Anlagen, Zugbildungstechnologie,<br />
Verkehrstelematik und Automatisierung, Wege zur Verbesserung<br />
Nachweis Weitere Informationen in der Modulbeschreibung und auf der Website des<br />
Fachgebietes.<br />
Schienengüterverkehr<br />
0533 L 208, Übung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 10:00 - 12:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, H 2053 , Schönemann<br />
Bemerkung Die Teilnahme an der ersten Übung ist Pflicht!<br />
Nachweis Weitere Informationen in der Modulbeschreibung und auf der Website des<br />
Fachgebietes.<br />
Arbeit, Bildung und Technik<br />
Übung zum Arbeitsrecht<br />
0830 L 166, Übung, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 08:00 - 10:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, H 2053<br />
Inhalt Behandlung des Stoffes der Vorlesung Arbeitsrecht anhand praktischer Fälle.<br />
Interdisziplinäre Kommunikation: Präsentation, Diskussion, Integration<br />
3251 L 601, Workshop, 4.0 SWS<br />
wöchentl<br />
Do, Einzel, 18:00 - 21:00, 18.04.2013 - 18.04.2013, PTZ 407<br />
Sa, Einzel, 10:00 - 18:00, 01.06.2013 - 01.06.2013, PTZ 407<br />
So, Einzel, 10:00 - 18:00, 02.06.2013 - 02.06.2013, PTZ 407<br />
Mi, Einzel, 18:00 - 21:00, 05.06.2013 - 05.06.2013, PTZ 407<br />
Do, Einzel, 18:00 - 21:00, 06.06.2013 - 06.06.2013, PTZ 407<br />
Sa, Einzel, 10:00 - 18:00, 22.06.2013 - 22.06.2013, PTZ 407<br />
So, Einzel, 10:00 - 18:00, 23.06.2013 - 23.06.2013, PTZ 407<br />
Di, Einzel, 18:00 - 21:00, 25.06.2013 - 25.06.2013, PTZ 407<br />
Inhalt Interdisziplinärer Informationsaustausch scheitert oft an unbewussten<br />
Kommunikationsprozessen und psychologischen Grenzen. In Kommunikations-<br />
Experimenten werden diesbezügliche Erfahrungen gesammelt, in Arbeitsgruppen<br />
theoretisch aufbereitet und zu Konfliktstrategien für die Praxis entwickelt.<br />
Bemerkung Blockveranstaltung: Einführung (3 Std.), 3 Wochenenden (á 16 Std.), 3 Abende (á<br />
4 Std.), davon 1 Abend obligatorisch; Bewerbung erforderlich: goeres@hanumaninstitut.de.<br />
Wahlfach für Hörer aller Fakultäten (u.a. auch Physiker). Mündliche Prüfung<br />
nach Bedarf.<br />
Nachweis Teilnahmeschein oder mündliche Prüfung<br />
Voraussetzung Keine formalen Voraussetzungen, Bewerbung erforderlich. Neugier und Offenheit, sich<br />
selbst zu konfrontieren und kennenzulernen ausdrücklich erwünscht!<br />
Literatur Arnold Mindell: Mitten im Feuer, Hugendubel 1997<br />
Arnold Mindell: Der Weg durch den Sturm, ViaNova 1997<br />
SoSe 2013 19
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Keith Johnstone: Improvisation und Theater, Alexander-Verlag<br />
Elke Schlehuber/Rainer Molzahn: Die heiligen Kühe und die Wölfe des Wandels,<br />
Warum wir ohne kulturelle Kompetenz nicht mit Veränderungen klarkommen<br />
GABAL-Verlag 2007<br />
Soziologie des Ingenieurberufs I<br />
3500 L 003, Integrierte LV (VL mit UE), 2.0 SWS<br />
Block, 19.04.2013 - 13.07.2013, Neef<br />
Inhalt<br />
Bemerkung<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.zewk.tu-berlin.de/sozing/<br />
sozing@zewk.tu-berlin.de<br />
030 - 314 29765<br />
Soziologie des Ingenieurberufs II<br />
3500 L 006, Integrierte LV (VL mit UE), 2.0 SWS<br />
Block, 19.04.2013 - 14.07.2013, Neef<br />
Inhalt<br />
Bemerkung Begrenzte Teilnehmerzahl;<br />
Erscheinen zur Pflichtvorbesprechung erforderlich: Montag, 08.04.2013, 10:00 -<br />
12:00 Uhr, Raum FH 1004<br />
SoSe 2013 20
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Blockseminar: 07./08.06.13 und 21./22.06.13. Jeweils Freitags von 14:00 s.t. bis<br />
19:00 und Samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr<br />
http://www.zewk.tu-berlin.de/sozing/<br />
sozing@zewk.tu-berlin.de<br />
030 - 314 29765<br />
Kultur und Technik<br />
Seminar Mensch-Maschine-Systeme<br />
0532 L 069, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 17.04.2013 - 10.07.2013, MAR 3.025<br />
Inhalt Das Seminar gibt den Teilnehmer/innen einen Überblick über aktuelle Forschung im<br />
Bereich Mensch-Maschine-Systemtechnik. Dabei sind insbesondere die Behandlung von<br />
Gestaltungskriterien und Anforderungen sowohl aus ingenieurswissenschaftlicher als<br />
auch aus humanwissenschaftlicher Perspektive Gegenstand der Lehrveranstaltung. Für<br />
die Teilnahme ist eine Anmeldung bis eine Woche vor Vorlesungsbeginn über die Web-<br />
Seiten des FG MMS notwendig (http://www.mms.tu-berlin.de/lehre_mms_se.html).<br />
Geschichte der Automobilindustrie II<br />
0533 L 575, Integrierte LV (VL mit UE), 2.0 SWS<br />
Mo, 14tägl, 14:00 - 18:00, 08.04.2013 - 01.07.2013, TIB13 -336 , Sievers<br />
Inhalt Fußend auf Kurs I soll in dieser Veranstaltung die Entwicklung der europäischen<br />
Automobilindustrie von ihren Anfängen bis in unsere Zeit anhand ausgewählter Beispiele<br />
dargestellt werden: Der Wandel vom Handwerk hin zur industriellen Fertigung sowohl<br />
der Automobil- als auch der Motorrad- und Nutzfahrzeughersteller wird dabei genauso<br />
berücksichtigt wie der frühe Informationsfluß zwischen Wissenschaft und Industrie. Es<br />
werden Exkursionen angeboten.<br />
Bemerkung Jeweils montags, 14:00-18:00 Uhr (in der Regel 14-täglich)<br />
Termine:<br />
08.04.2013<br />
22.04.2013<br />
06.05.2013<br />
24.05.2013 Exkursion: 14:30 Uhr, BMW-Werk<br />
27.05.2013 entfällt!<br />
03.06.2013, ab 15:00 Uhr !<br />
10.06.2013 Exkursion: 14:00 Uhr, Depot Technik-Museum Schöneberg<br />
SoSe 2013 21
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
24.06.2013<br />
Der Termin für die im Sommersemster vorgesehene Exkursion (zum BMW-Werk in<br />
Spandau) wird zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle bekanntgegeben.<br />
Einführung in die Ethik<br />
3130 L 003, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 10:00 - 12:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, MA 043 , Gil<br />
Inhalt Die Vorlesung behandelt die Theorien des „guten Lebens“, die rechte- und<br />
prinzipienbasierten Ansätze sowie die folgenorientierten Theorien der Moral. In all diesen<br />
Positionen geht es um die Klärung der Frage, was praktisch gut ist. Bei der konkreten<br />
Klärung bringen die einzelnen Theorien und Ansätze unterschiedliche Perspektiven und<br />
Kriterien zur Geltung, die zu analysieren sein werden.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 1, 4<br />
BA-KulT IS 5<br />
Wahlbereich<br />
Probleme und Perspektiven der Gegenwartsphilosophie II<br />
3130 L 004, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 14:00 - 16:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, H 1058 , Abel<br />
Inhalt Systematische Erörterung zentraler Fragen gegenwärtiger Philosophie im Lichte der<br />
Herausforderungen an ein zeitgemäßes Denken: Was ist und was kann Philosophie<br />
heute? Wie könnte ein Philosophieren jenseits von Absolutheitsanspruch und<br />
Relativismus aussehen? Was sagt die Philosophie zum Verständnis von Sprache, Geist,<br />
Handlung und Welt? In welcher Verbindung stehen Philosophie und Wissenschaft? Ist<br />
Orientierung durch Philosophie möglich? Kann es eine Ethik ohne Metaphysik geben?<br />
Die Teilnahme an der Vorlesung "Probleme und Perspektiven der<br />
Gegenwartsphilosophie I" wird nicht vorausgesetzt.<br />
Bemerkung BA KulT 1, 3; Wahlbereich<br />
MA Phil 1, 2, 5<br />
Die Frage nach dem Selbst<br />
3130 L 008, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 14:00 - 16:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 2013 , Adolphi<br />
Inhalt ›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 1, 4, 5, Wahlbereich<br />
MA-Phil 5<br />
Émile Durkheim und das kollektive Bewusstsein<br />
3130 L 009, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, H 0110 , Wilkens<br />
Inhalt Émile Durkheim gilt als einer der Begründer der modernen Soziologie (nach Auguste<br />
Comte und mit Ansätzen bei Montesquieu). Er stützt sich hierbei nachhaltig und<br />
durchgehend auf den Bewusstseinsbegriff. Die Veranstaltung behandelt die Anfänge<br />
Durkheims in der Philosophie, sowie insbesondere seine Lehre des kollektiven<br />
Bewusstseins anhand der wesentlichen Schriften (Methodenlehre der Soziologie, Lehre<br />
zur Arbeitsteilung, Zur Differenz der individuellen und kollektiven Vorstellungen) und<br />
seine Lehre bezüglich Religion und Kultus. Es gilt weiterhin in exemplarischen Fällen<br />
seine Taxonomien nachzuvollziehen sowie seine Abgrenzung vom Pragmatismus<br />
(James) sowie vereinzelte Aufsätze zu Rousseau, Montesquieu, Tönnies zu behandeln.<br />
SoSe 2013 22
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Französischkenntnisse erwünscht, aber keine Vorbedingung.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 3, 5; Wahlbereich<br />
MA-Phil 2, 3<br />
Argumentationstheorie<br />
3130 L 030, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 10:00 - 12:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 3002 , Gil<br />
Inhalt Was ist ein Argument? Welche Arten bzw. Typen von Argumenten gibt es? Wie werden<br />
Argumente in konkreten Argumentationen kontextbezogen verwendet? Gibt es typische<br />
„wissenschaftliche“ Argumente? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich das<br />
Seminar, in dem die sogenannten „Gedankenexperimente“ als hypothetische Argumente<br />
im Mittelpunkt stehen werden.<br />
Bemerkung Begleitendes Tutorium: Timo Hinrichs<br />
BA KulT Phil 1, 2<br />
Wahlbereich<br />
Tutorium PS Argumentationstheorie<br />
3130 L 030, Tutorium<br />
Mi, wöchentl, 16:00 - 18:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 3008 , Hinrichs<br />
Inhalt Das Tutorium zum Seminar „Argumentationstheorie“ dient unter anderem dazu, die<br />
Themen und Texte des Seminars nachzubearbeiten und zu vertiefen. Darüber hinhaus<br />
können die Diskussionen des Seminars in ungezwungener Atmosphäre weitergeführt<br />
werden. Auch sollen die im Seminar erarbeiteten Theorien anhand von Alltagstexten<br />
aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft praktisch angewandt und überprüft werden.<br />
Einen Schwerpunkt stellen Gedankenexperimente als Argumente in wissenschaftlichen<br />
Disziplinen dar.<br />
Zu guter Letzt wird das Einüben von Vorträgen und Referaten, Verfassen von<br />
Hausarbeiten, sowie allgemeine Orientierungshilfe im bürokratischen Dschungel des<br />
Bachelor-<strong>Studium</strong>s angeboten.<br />
Selbstwissen und Selbstbewusstsein<br />
3130 L 032, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 10:00 - 12:00, 12.04.2013 - 13.07.2013, H 3021 , Tolksdorf<br />
Inhalt Philosophie und Common Sense gehen in der Regel, auf je eigene Weise, davon aus,<br />
dass rationale Akteure selbstbewusste Akteure sind. In einer Hinsicht bedeutet das,<br />
dass rationale Akteure einen besonderen Zugang zu ihren eigenen mentalen Zuständen<br />
haben, zu ihren Überzeugungen, Wünschen und Absichten.<br />
Das Seminar geht der Frage nach, wie dieser Zugang zu verstehen ist. Handelt es sich<br />
um eine besondere Form von Wissen, so genanntes Selbstwissen? Wenn ja, in welchen<br />
Hinsichten unterscheidet es sich dann von anderen Wissensformen, etwa unserem<br />
Wissen von der Außenwelt? Oder liegt am Ende gar kein epistemischer Zugang vor?<br />
Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum der Lehrveranstaltung.<br />
Gelesen und besprochen werden Texte u.a. von Descartes, Ryle, Shoemaker, Rorty,<br />
Davidson und Frank.<br />
Die Textgrundlage wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 3, 5<br />
Wahlbereich<br />
Tutorium zum PS Selbstwissen und Selbstbewusstsein<br />
SoSe 2013 23
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
3130 L 032, Tutorium, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 17.04.2013 - 12.07.2013, H 3008 , Atli<br />
Inhalt Details werden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben<br />
Einführung in die Erkenntnistheorie<br />
3130 L 033, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, H 3008 , Remmers<br />
Inhalt In der Erkenntnistheorie werden u.a. folgende Fragen gestellt: Wie funktioniert<br />
Erkenntnis? Was können wir wissen? Was ist Wissen? Braucht Erkenntnis eine Methode<br />
– und wenn ja: Welche Methode ist die richtige? Welche Bedeutung haben skeptizistische<br />
Probleme? Diese Fragen sind für die Philosophie zentral und bieten Anknüpfungspunkte<br />
z.B. für Wissenschaftstheorie, Logik und Philosophie der Wahrnehmung.<br />
Das Seminar bietet eine historisch-systematische Einführung anhand der Lektüre<br />
klassischer Texte. Ein Schwerpunkt liegt auf Theorien des Wissens (Wissensbegriff,<br />
Formen des Wissens usw.).<br />
Bemerkung Begleitendes Tutorium: Hadi Faizi<br />
Nietzsche II<br />
BA-KulT Phil 1, 3, 5<br />
Wahlbereich<br />
3130 L 034, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, H 6124 , Abel<br />
Inhalt Systematische Erörterung der grundlegenden Denkfiguren der Philosophie Nietzsches<br />
(Nihilismus; Wille zur Macht; Ewige Wiederkehr; Übermensch; Perspektivismus;<br />
Dionysos; Amor fati; Umwertung der Werte) in ihrer Bedeutung für die Auffassung von<br />
Mensch, Natur, Erkenntnis, Wissenschaft, Wahrheit, Kunst, Moral und Religion.<br />
Die Teilnahme an dem Seminar "Nietzsche I" wird nicht vorausgesetzt.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 1, 3, 5<br />
Wahlbereich<br />
Philosophiegeschichte<br />
3130 L 035, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 16:00 - 18:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 3004 , Adolphi<br />
Inhalt Zum <strong>Studium</strong> unserer Studiengänge gehört – diese Erfahrung wird jeder spätestens<br />
gemacht haben, wenn sich die Phase des Abschlusses nähert –, dass man doch<br />
zugleich auch über vieles Wissen verfügen muss, das über das hinausgeht, was man<br />
sich in den einzelnen besuchten Lehrveranstaltungen hat erarbeiten können. Diesem<br />
Unsicherheits-Gefühl, sich allzu lange nicht genügend orientiert zu fühlen und ohne<br />
genügende Vorstellung davon, wie man sich helfen kann, möchte das PS abhelfen. Es<br />
wird darum gehen, wie man sich das erforderliche Basis-Wissen in den großen Epochen<br />
der Philosophiegeschichte, in den hauptsächlichen Strömungen und Themen erarbeiten<br />
kann.<br />
In jeder Sitzung wird es um ein anderes solches Feld gehen, so dass am Ende ein<br />
gewisses Spektrum an Basis-Wissen (sowie Vertrautheit damit, wo man sich weiter<br />
orientieren könnte) herauskommen soll.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 1, 4, 5<br />
BA-KulT IS 5<br />
BA Wahlbereich<br />
SoSe 2013 24
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Philosophie der Kultur<br />
3130 L 039, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 12:00 - 14:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, H 3021<br />
Inhalt "Kulturphilosophie" ist in den letzten Jahren zu einem Modethema geworden. Doch<br />
das überbordende Interesse am Kulturbegriff hat leider nicht nur zu seiner Klärung<br />
beigetragen, – im Gegenteil. Trotzdem steht es außer Zweifel, dass der Kulturbegriff für<br />
heutiges Philosophieren (nach dem linguistic , dem semiotic und dem pragmatic turn )<br />
zentral ist. Im Seminar soll anhand ausgewählter Texte verschiedener Autoren des<br />
20. Jahrhunderts und der Gegenwartsphilosophie vor allem die epistemologische und<br />
normative Rolle von Kulturen sowie das Verhältnis von Individuum und Kultur untersucht<br />
und dabei hoffentlich auch eine Schärfung des Begriffes erreicht werden.<br />
Bemerkung Lehrperson: Astrid Wagner<br />
BA-KulT Phil 4, 5<br />
Wahlbereich<br />
Das Schöne als »Zweckmäßigkeit ohne Zweck« - Kants Kritik der Urteilskraft<br />
3130 L 040, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, H 3012 , Neuffer<br />
Inhalt In der Kritik der Urteilskraft (1790) schafft Immanuel Kant mit seiner Theorie des<br />
Geschmacksurteils eine Grundlegung moderner Ästhetik. Gleich der »kopernikanischen<br />
Wende« in der Kritik der reinen Vernunft vollzieht Kant auch in seiner Theorie des<br />
Schönen eine subjektive Wende: Schönheit gründet sich weder auf bestimmte Merkmale<br />
von Gegenständen noch auf Regeln und Gesetze, sondern liegt einzig und allein im<br />
»freien Spiel« unserer Erkenntniskräfte. Das Urteil über das Schöne gilt damit zwar<br />
bloß subjektiv, geht aber dennoch mit dem Anspruch allgemeiner Gültigkeit einher. Das<br />
Seminar konzentriert sich ganz auf das erste Buch der Kritik der Urteilskraft. Ziel ist,<br />
anhand einer genauen Textanalyse Kants Theorie des Schönen zu rekonstruieren. Dabei<br />
soll sowohl das systematische Anliegen Kants im Bezug auf seine kritische Philosophie,<br />
als auch das historische Umfeld ihrer Entstehung beleuchtet werden. Zugleich wollen wir<br />
Kants Theorie im Lichte zeitgenössische Debatten betrachten.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 4, 5<br />
Wahlbereich<br />
Deleuze: Bewegungs-Bild und Zeit-Bild. Film als Wissensform<br />
3130 L 057, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 14:00 - 16:00, 12.04.2013 - 19.07.2013, H 7112 , Remmers<br />
Fr, 14tägl, 16:00 - 19:00, 26.04.2013 - 19.07.2013, H 7112<br />
Inhalt In Gilles Deleuzes Kino-Büchern („Das Bewegungsbild“ (1983) und „Das Zeitbild“ (1985))<br />
geht es nicht so sehr um ästhetische Probleme oder um Filminterpretationen, sondern<br />
vielmehr um eine Untersuchung des Films als Gegenstand von Zeichenphilosophie,<br />
Bildtheorie und Philosophie des Geistes: „Das Kino ist eine neue Praxis der Bilder und<br />
Zeichen, und es ist Sache der Philosophie, zu dieser Praxis die Theorie (im Sinne<br />
begrifflicher Praxis) zu liefern.“ So kann Film eine besondere Rolle im Denken einnehmen,<br />
wodurch sich kritische Perspektiven für Philosophie und Filmtheorie eröffnen.<br />
Neben intensiver Lektüre und Diskussion steht im Mittelpunkt des Seminars die<br />
erkenntnistheoretisch motivierte Frage nach spezifischen Wissensformen des Films.<br />
Zusätzlich zu den Kino-Büchern werden vorbereitende und ergänzende Texte von Peirce,<br />
Bergson und anderen Autoren gelesen. Da Deleuze mit zahlreichen Beispielen arbeitet,<br />
wird eine möglichst umfassende Kenntnis der Filmgeschichte (bis 1984) vorausgesetzt.<br />
Achtung: Das Seminar findet jeden Freitag von 14-16 Uhr statt - die 14-tägigen Termiene<br />
von 16-18 Uhr sind nur optionale Ergänzungstermine für Filmsichtungen.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 3<br />
SoSe 2013 25
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
BA-KulT IS 4<br />
Wahlbereich<br />
Kants "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten<br />
können"<br />
3130 L 058, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 27.06.2013, H 2051 , Asmuth<br />
Inhalt »Meine Absicht ist, alle diejenigen, so es werth finden, sich mit Metaphysik zu<br />
beschäftigen, zu überzeugen, daß es unumgänglich nothwendig sei, ihre Arbeit vor<br />
der Hand auszusetzen, alles bisher Geschehene als ungeschehen anzusehen und vor<br />
allen Dingen zuerst die Frage aufzuwerfen: ob auch so etwas als Metaphysik überall<br />
nur möglich sei.« Mit den Prolegomena , den »Vorüberlegungen« zur Kritik der reinen<br />
Vernunft entwirft Kant den Plan dieser neuen Wissenschaft, allerdings erst, nachdem<br />
die Kritik bereits erschienen war. In drei Teilen beantwortet Kant, wie und ob Metaphysik<br />
möglich sei, erklärt dabei die wichtigsten Elemente der Kritik der reinen Vernunft . Dazu<br />
wendet Kant eine analytische Methode an, die seinem Anspruch nach die größtmögliche<br />
Deutlichkeit über sein Vorhaben verbreiten soll. Das Proseminar wird nah am Text bleiben<br />
und versuchen, die zentralen Aussagen gemeinsam zu diskutieren.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 1, 5<br />
Wahlbereich<br />
Literatur Lektürehinweis: Kants "Prolegomena". Ein kooperativer Kommentar. Herausgegeben<br />
von Holger Lyre und Oliver Schliemann. Frankfurt 2012.<br />
Einführung in die Hermeneutik<br />
3130 L 059, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 12:00 - 14:00, 12.04.2013 - 13.07.2013, H 3008 , Fricke<br />
Inhalt Diese Einführung wählt zwei Zugänge zur Hermeneutik: Anhand der Lektüre von<br />
Auszügen aus klassischen Werken (Gadamer, Ricoeur u.a.) wird ihr Doppelcharakter<br />
als Theorie des richtigen Interpretierens und als Philosophie der Grundlagen von<br />
Kommunikation und Weltbezug erarbeitet. Zweitens wird ihre aktuelle Bedeutung<br />
in Debatten über Objektivität und Relativismus, über Ideologiekritik und über<br />
Kulturphilosophie diskutiert.<br />
Bemerkung BA-KulT Phil 2, 4, 5<br />
BA-KulT IS 4<br />
Wahlbereich<br />
Literatur Vorbereitend werden zwei Bücher empfohlen:<br />
Grondin, J. - Hermeneutik, Vandenhoeck & Ruprecht 2009<br />
Jung, M. - Hermeneutik zur Einführung, Junius Verlag 2001<br />
Wissensformen: Glauben, Wissen, Erinnern (Hegel, Schelling, Ricoeur)<br />
3130 L 060, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 25.04.2013 - 05.06.2013, H 2051<br />
Do, Einzel, 14:00 - 16:00, 06.06.2013 - 06.06.2013, H 3008<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 13.06.2013 - 13.07.2013, H 2051<br />
Inhalt Was ist Wissen und welche Formen hat es bzw. kann es annehmen? Wie hängt das<br />
Objekt des Wissens von seiner Form ab? Wie spiegelt sich Wissen in seinen Formen<br />
wider? Was wissen wir, wenn wir uns erinnern? Was wissen wir, wenn wir glauben. Und<br />
was wissen wir, wenn wir wissen? Auf diese und andere Fragen suchen wir im Seminar<br />
nach Antworten, und zwar mit ausgewählten Hilfe von Texten von Hegel, Schelling und<br />
Ricœur.<br />
Bemerkung Lehrperson: Julia Wischke<br />
SoSe 2013 26
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
BA-KulT Phil 2, 4, 5<br />
BA-KulT IS 4<br />
Wahlbereich<br />
Freiheit: ein Problem auch im Verhältnis von Mensch und Tier<br />
3130 L 198, Projekt, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 10.07.2013, H 3008 , Adolphi<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 14.05.2013 - 14.05.2013, H 3013<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 28.05.2013 - 28.05.2013, H 3013<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 11.06.2013 - 11.06.2013, H 6124<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 25.06.2013 - 25.06.2013, H 3013<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 09.07.2013 - 09.07.2013, H 3013<br />
Inhalt Die Veranstaltung ist Teil eines studentischen Projekts unter dem Titel Bioethik: Mensch<br />
und Tier, in dem – an diesem Beispielfeld – die Vermittlung ethischer Sachverhalte in den<br />
Medien, speziell Radio, erarbeitet werden soll. Die Veranstaltung verbindet Theorieteile<br />
(Philosophie/Ethik) und Praxis (Recherche / Medientheorie / konkrete Praktika und<br />
Vorbereitung von Radiosendungen). Im SoSe 2013 wird es um das Problem von<br />
Gefangenschaft und Freiheit gehen.<br />
Lektürehinweise: Stefan Austermühle: Und hinter tausend Stäben keine Welt! Die<br />
Wahrheit über Tierhaltung im Zoo (1996). Steven Best (2004): Terrorists or Freedom<br />
Fighters?: Reflections on the Liberation of Animals (2004).Michael Haller: Recherchieren<br />
(2004).<br />
Die Veranstaltung des Semesters steht für sich als eine eigene abgeschlossene<br />
Lehrveranstaltung, kann also ohne Teilnahme an den anderen Themenschwerpunkten<br />
des Projekts in anderen Semestern besucht werden. Es können 3 LP erworben werden<br />
(wenn wesentlich nur der Theorie-Teil gemacht wird) oder 6 LP (wenn am Ende es über<br />
eine vollständige Sachrecherche bis zu einem eigenen Radio-Beitrag ausgearbeitet wird<br />
– der wird dann gesendet).<br />
Bemerkung Dozenten: Thomas Exner, Fritz Psiorz; Verantwortlich: Rainer Adolphi<br />
BA-KulT Phil 4,Wahlbereich<br />
MA Phil 4, 6, 7, Freie Profilbildung<br />
Lesekreis – Wilhelm Dilthey: Das Wesen der Philosophie<br />
3130 L 199, Arbeitsgemeinschaft, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 3013<br />
Inhalt Mit seiner hermeneutisch-lebensphilosophischen Begründung der Unterscheidung<br />
von Natur- und Geisteswissenschaften und seiner metaphysikkritischen<br />
Weltanschauungslehre ging Wilhelm Dilthey (1833-1911) in die Geschichte ein und steht<br />
auch heute noch u.a. in der Methodendebatte rund um "Erklären" und "Verstehen" im<br />
Fokus der kritischen Diskussion.<br />
In seiner Abhandlung über „Das Wesen der Philosophie“ (1907) versucht Dilthey<br />
einen Begriff der Philosophie unter Berücksichtigung ihrer historischen Vielfalt und<br />
ihrer Beziehungen zu anderen Aspekten der Kultur – wie etwa Religion, Kunst<br />
und Wissenschaft – herauszuarbeiten und die Aufgaben der Philosophie in der<br />
wissenschaftlich-technischen Welt neu zu bestimmen. Der Lesekreis wird sich zu Ehren<br />
von Diltheys 180. Geburtstag diesem Spätwerk ausführlichst widmen.<br />
SoSe 2013 27
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Bemerkung Leitung: Martin Klaus Günther<br />
Literatur Wilhelm Dilthey<br />
Das Wesen der Philosophie<br />
marixverlag 2008<br />
ISBN 978-3-86539-160-5<br />
5,00 €<br />
Wissenschaft und Technik im alten China<br />
3130 L 206, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.068 , Sternfeld<br />
Inhalt In dieser Einführungsveranstaltung wird ein Überblick über die wichtigsten<br />
philosophischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen im<br />
traditionellen China vermittelt.<br />
Bemerkung BA-KulT Wahlbereich: BA China 2<br />
BA-KulT WTG 2, 3, 4<br />
MA-GKWT 1/1<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Chinas Rohstoffsektor<br />
3130 L 210, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 16:00 - 18:00, 08.04.2013 - 13.07.2013, MAR 0.001 , Sternfeld<br />
Inhalt Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung ist Chinas Bedarf sowohl an Bodenschätzen<br />
als auch Agrarrohstoffen deutlich gestiegen. Dies hat Auswirkungen auf die globalen<br />
Rohstoffmärkte. Das Seminar vermittelt einen Überblick über Vorkommen und<br />
Verfügbarkeit von Rohstoffen in China, deren Gewinnung und Nutzung und den<br />
damit verbundenen geo-politischen, ökonomischen, ökologischen und technologischen<br />
Implikationen.<br />
Bemerkung BA-KulT Wahlbereich: BA China 2<br />
BA-KulT IS 5<br />
BA-KulT WTG 3, 4<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Einführung in die Chinawissenschaften für Nicht-Sinologen<br />
3130 L 211, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, MAR 0.010 , Mahltig<br />
Inhalt Das Seminar bietet eine Einführung in verschiedene Gebiete der wissenschaftlichen<br />
Wahrnehmung Chinas.<br />
Behandelt werden unter anderem geschichtliche, politische, geographische und<br />
kulturwissenschaftliche Aspekte.<br />
Bemerkung BA-KulT Wahlbereich: BA China 1, BA China 2<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Das weiße Fohlen: Sterben, Tod und Trauer in der chinesischen Geschichte und Gegenwart<br />
SoSe 2013 28
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
3130 L 212, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 14:00 - 16:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, MAR 0.007 , Becker-von Falckenstein<br />
Inhalt Der Titel der Veranstaltung bezieht sich auf eine Passage aus dem Buch Zhuangzi , in<br />
der die Flüchtigkeit des Lebens mit einem weißen Fohlen, das hinter einer Mauerritze<br />
vorbei galoppiert, verglichen wird. Sterben, Tod und Trauer waren und sind in China<br />
mit vielen Tabuisierungen im persönlichen und sozialen Bereich behaftet, nehmen<br />
aber trotzdem eine zentrale Rolle in der Geschichte und der ritenkonformen Haltung<br />
der Menschen ein. Die Veranstaltung soll in einer chronologischen Reihenfolge die<br />
Vorstellungen von Sterben, Tod und Trauer in der Geschichte Chinas bis heute erläutern,<br />
sowie die Einstellungen zur Vergänglichkeit und den „letzten Dingen“ des Lebens in<br />
den „drei Traditionen“, dem Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus, vorstellen und<br />
analysieren. Außerdem wird ein Blick auf die „Ethnologie des Todes“ geworfen, in der<br />
die Ahnenverehrung, Bestattungsbräuche und Trauerrituale, also die Elemente einer<br />
Sepulkralkultur, einen hohen Stellenwert haben. Zur Verdeutlichung dieses Bereiches<br />
werden auch die Befunde neuerer Ausgrabungen vorgestellt.<br />
Bemerkung BA-KulT Wahlbereich: China 1, 2<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Sprachen und Kulturen der Seidenstraße<br />
3130 L 228, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 10:00 - 12:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.071 , Meisterernst<br />
Inhalt Die Seidenstrasse, oder besser die Seidenstrassen stellen ein hervorragendes Beispiel<br />
für frühe globale Beziehungen dar. Sie entwickelten sich bereits in der Hanzeit<br />
(206 BCE – 200 CE) zu einem wichtigen Verbindungsweg Chinas mit dem Westen,<br />
auf dem nicht nur Waren, sondern auch verschiedene Sprachen und Religionen<br />
nach China transportiert wurden. Neben dem Buddhismus, der die wichtigste Religion<br />
war, die über die Seidenstrasse nach Osten wanderte, gelangten auch Religionen<br />
wie der Manichäismus und der Nestorianismus auf diesem Wege nach China. Ihre<br />
Zeugnisse, Manuskripte und Artefakte, haben sich sowohl an der nördlichen als<br />
auch an der südlichen Seidenstrasse manifestiert. Obwohl die Kultur des gesamten<br />
zentralasiatischen Gebiets sowohl vom Westen als auch chinesisch beeinflusst ist, lassen<br />
sich doch Unterschiede an der südlichen und der nördlichen Seidenstrasse feststellen; so<br />
herrschen in Dunhuang und an der südlichen Seidenstrasse der chinesische, tibetische<br />
und indische Einfluss (letzterer vor allem in der Gegend um Khotan) vor, während die<br />
Varietät an Sprachen und Kulturen an der nördlichen Seidenstrasse noch größer ist<br />
und neben dem Chinesischen, das Persische, Sogdische, Uigurische, und Indische,<br />
um nur die wichtigsten Sprachen zu nennen, einschließt. Die verschiedenen auf der<br />
Seidenstrasse vertretenen Sprachen und Religionen werden im Seminar anhand der in<br />
den Expeditionen des frühen 20. Jahrhunderts entdeckten und gesammelten Manuskripte<br />
und Artefakte vorgestellt. Ein Besuch im ‚Museum für Asiatische Kunst’ in Dahlem ist im<br />
Rahmen des Seminars geplant.<br />
Bemerkung BA-KulT China 2 (Wahlbereich)<br />
Technikgeschichte III (1760 – 1880)<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
SoSe 2013 29
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
3130 L 302, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 08.04.2013 - 13.07.2013, MA 042 , König<br />
Inhalt Überblick mit Schwerpunkt auf Mitteleuropa, Westeuropa und den USA: Industrielle<br />
Revolution, Textiltechnik, Chemie, Maschinenbau, Eisenhüttenwesen, Verkehrswesen<br />
usw.<br />
Bemerkung BA-KulT WTG 1, BA-KulT WTG 3, BA-KulT IS 5, BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1, MA-GKWT 3; Masterstudiengänge Freie Profilbildung<br />
Zur Bedeutung der Akademien für Wissenschaft und Forschung im Wandel der Zeit<br />
3130 L 303, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 08:00 - 11:00, 12.04.2013 - 13.07.2013, A 052 , Klein<br />
Inhalt Die deutschen Wissenschaftsakademien stammen aus dem 17./18. Jahrhundert.<br />
Während an den Universitäten gelehrt wurde, entwickelten sich die Akademien als sog.<br />
„Gelehrtengesellschaften“ zu Einrichtungen der Forschung, d.h. Akademien betrieben<br />
und betreiben i.d.R. keine wissenschaftliche Lehre.<br />
Vor dem Hintergrund der „Académie Plaonica“ wurde in Florenz 1444 die erste Akademie<br />
gegründet, weitere bedeutende Gründungen waren die „Académie Française“ zur Pflege<br />
der Sprache und Kultur im Jahre 1635, die (naturwissenschaftlich orientierte) Royal<br />
Society in London (1660) und die 'Académie des Sciences' wiederum in Frankreich (1666<br />
bzw. 1699).<br />
Die erste Akademie in Deutschland war ebenfalls naturwissenschaftlich orientiert –<br />
die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina aus dem Jahr 1652, die rund<br />
30 Jahre später von Kaiser Leopold zur Reichsakademie erhoben wurde und ihren<br />
Sitz in Halle hatte und hat. Die 1700 auf Initiative von Gottfried Wilhelm Leibniz<br />
eingerichtete Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften in <strong>Berlin</strong>, die spätere<br />
Preußische Akademie der Wissenschaften, wurde Vorbild für weitere Gründungen im<br />
deutschsprachigen Raum, so die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (1751),<br />
die Bayerische Akademie der Wissenschaft (1759), die Kurpfälzische Akademie in<br />
Mannheim (1763, ab 1909 die Heidelbergische Akademie der Wissenschaften) sowie die<br />
Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaft (1846). Ein Jahr später wurde die<br />
Österreichische Akademie der Wissenschaften durch kaiserlichen Erlass gegründet. Im<br />
Jahre 1893 schlossen sich die deutschen Akademien im sog. Kartell zusammen, u.a. um<br />
gemeinsam Forschungsvorhaben durchzuführen (das heutige „Akademienprogramm“).<br />
In der NS-Zeit wurde aus dem Kartell der „Reichsverband der deutschen Akademien“,<br />
womit auch die Akademien gleichgeschaltet waren.<br />
Im Westen wurde 1949 in der französischen Besatzungszone die „Akademie der<br />
Wissenschaften in Mainz“ gegründet, 1970 die Nordrhein-Westfälische Akademie<br />
der Wissenschaften und der Künste in Düsseldorf sowie 2004 die Akademie der<br />
Wissenschaften in Hamburg.<br />
In der Nachfolge des Kartells wurde 1949 die „Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen<br />
Akademien“ eingerichtet, ab 1967 „Konferenz der deutschen Akademien der<br />
Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland“, heute „Union der deutschen<br />
Akademien der Wissenschaften“. In der Sowjetischen Besatzungszone wurde 1945<br />
aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften die „Deutsche Akademie der<br />
Wissenschaften zu <strong>Berlin</strong>“, ab 1972 „Akademie der Wissenschaften der DDR“, einer<br />
Forschungsakademie sowjetischer Prägung mit verschiedenen Forschungsinstituten. Die<br />
Leopoldina gehörte nicht zur Akademie der Wissenschaften der DDR und konnte eine<br />
gewisse Unabhängigkeit bewahren.<br />
SoSe 2013 30
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Seit 2008 ist die Leopoldin auch die (gesamtdeutsche) Nationale Akademie der<br />
Wissenschaften, dazu acatech als nationale Akademie der Technikwissenschaften,<br />
die aus dem seit 1997 existierenden sog. „Konvent der Technikwissenschaften der<br />
deutschen Akademien der Wissenschaften“ entstand.<br />
Bemerkung Die Veranstaltung wird verlegt auf Freitag 8.30 - 10.45 Uhr.<br />
Termine:<br />
April: 12., 19.,<br />
Mai: 3., 10., 24.<br />
Juni: 7., 14.,<br />
Juli: 12.<br />
BA-KulT WTG 1, 2, 3, 4; BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1, 2, 3; Masterstudiengänge Freie Profilbildung<br />
Literatur Literatur:<br />
Conrad von Grau, Berühmte Wissenschaftsakademien. Von ihrem Entstehen und ihrem<br />
weltweiten Erfolg, 1998.<br />
Jürgen Kocka, Die <strong>Berlin</strong>er Akademien der Wissenschaften im geteilten Deutschland<br />
1945-1990, 2003.<br />
Katrin Joos, Gelehrsamkeit und Machtanspruch um 1700. Die Gründung der <strong>Berlin</strong>er<br />
Akademie der Wissenschaften im Spannungsfeld dynastischer, städtischer und<br />
wissenschaftlicher Interessen, 2012.<br />
Ruth Federspiel, Der Weg zur Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, 2011.<br />
Einführung in den Betrieb von Kolbendampfmaschinen<br />
3130 L 306, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 19.04.2013 - 19.04.2013, Forschner<br />
Inhalt Ein Schnupperkurs in die Praxis für Studierende der Technikgeschichte am<br />
Beispiel einer „Burrell“ Straßendampflokomotive. Die theoretischen Ausbildungsinhalte<br />
sind die Entwicklung der Dampfmaschine, Unterschiede bei Straßen- und<br />
Schienenfahrzeugen, Einführung in den Aufbau eines Stephenson Dampfkessels<br />
und die Sicherheitseinrichtungen des Dampfkessels (Hörsaal). Die praktischen<br />
Ausbildungsinhalte sind das Anheizen der Dampflok, Betrieb des Kessels und der<br />
Dampfmaschine, Wartungsarbeiten an der Dampfmaschine, Fahrübungen.<br />
Die Vorbesprechung und die Festlegung der Blockseminartermine findet am Fr.,<br />
19.04.2013 in der Bibliothek der China Arbeitsstelle, Raum MAR 2.034a , von 10 – 12<br />
Uhr statt.<br />
Bemerkung Da die Teilnehmerzahl auf zehn Personen beschränkt ist, bitte ich um Voranmeldung<br />
über E- Mail: g.forschner@gmx.de.<br />
SoSe 2013 31
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
BA KulT WTG 3, 4; Wahlbereich<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Konzepte der Globalisierung<br />
3130 L 307, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, EB 133C , König<br />
Inhalt Lektüre wichtiger Werke zur Geschichte und Interpretation der Globalisierung.<br />
Bemerkung BA-KulT WTG 3, 4; BA Wahlbereich, BA-KulT IS 5<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Exkursion: Industriekultur - Strukturwandel im Mitteldeutschen Industrierevier<br />
3130 L 308, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, Einzel, 12:00 - 14:00, 19.04.2013 - 19.04.2013, H 3013 , Marotz<br />
Inhalt Im Zentrum der Exkursion in das Mitteldeutsche Industrierevier steht der Strukturwandel,<br />
der Ostdeutschland insgesamt seit 1990 geprägt hat, der hier aber auf kleinem<br />
Raum im Bereich Halle, Leipzig, Bitterfeld, Dessau besonders gut sichtbar ist. Ganze<br />
Industriezweige wie die Carbochemie oder der Waggonbau sind verschwunden, andere<br />
wie das Automobil- und Logistikcluster im Norden Leipzigs sind völlig neu entstanden.<br />
Die architektonischen Spuren dieses Umbruchs zeigen sich unter anderem in neuen<br />
Nutzungen für alte Gebäude, in hoffnungsvoll errichteten, aber oft unterbelegten<br />
Gewerbeparks, aber auch in sehr unterschiedlichen Formen der Musealisierung oder<br />
in Industrieruinen. Diese Aspekte werden in vorbereitenden Sitzungen wie auch am<br />
Exkursionswochenende selbst vor Ort aufgegriffen und mittels Referaten in einen<br />
größeren Zusammenhang gestellt. Der Betrachtungshorizont liegt dabei nicht nur auf der<br />
ursprünglich vorhandenen Industrie, ihrer Architektur und Nachnutzung, sondern auch<br />
in den Chancen und Risiken, die der Umgang mit dem industriekulturellen Erbe für die<br />
Menschen vor Ort mit sich bringt.<br />
Das Exkursionsseminar bietet die Möglichkeit, die üblichen Kleinen und Großen<br />
Leistungen zu erwerben. Eine Einführung und die gemeinsame Festlegung<br />
weiterer Vorbereitungstermine findet am Freitag, 19.04.2013, 12–14 Uhr statt.<br />
Die Wochenendexkursion selbst startet freitagmorgens in der vorlesungsfreien Zeit<br />
(voraussichtlich 19.-21.07.2013).<br />
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10 Personen beschränkt (zwei VW-Unibusse).<br />
Anmeldung per email bis spätestens 15.04.2013 an: Post@Technikhistoriker.de.<br />
Bemerkung Lehrperson: Sören Marotz<br />
BA-KulT WTG 3, BA-KulT WTG 4; BA Wahlbereich, BA-KulT IS 5<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
VORANKÜNDIGUNG: Exkursion Italien: Technik der Griechen und Römer (WS 2013/14)<br />
3130 L 309, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, Einzel, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 18.04.2013, H 3013 , Kirstein<br />
Inhalt Ziel der Exkursion ist der Golf von Neapel, eine Region, die in der Antike sowohl von<br />
Griechen als auch von Römern besiedelt war. Hier haben zahlreiche archäologische<br />
Zeugnisse die Jahrtausende überdauert, die Aufschluss über Bautechnik, städtische<br />
Infrastruktur, Handwerk und Gewerbe oder Verkehrswesen beider Kulturen geben.<br />
Zudem weisen die archäologischen Befunde dieser Region oft einen sehr guten<br />
Erhaltungszustand auf. Das Besuchsprogramm umfasst u.a. die ehemalige griechische<br />
Stadt Poseidonia mit ihren nahezu vollständig erhaltenen Umgangstempeln, Pompeji,<br />
SoSe 2013 32
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
den römischen Ferienort Baiae, ein Zentrum des frühen (Massen-)Tourismus, sowie die<br />
Hafenanlagen des alten Neapolis, des zeitweise wichtigsten Kriegs- und Handelshafens<br />
des Imperiums.<br />
Die erste Vorbesprechung findet statt am Donnerstag, 18. April 2013, 12-14 Uhr.<br />
Die Exkursion erfolgt im Oktober. Sie gehört damit formal zum Wintersemester<br />
2013/14.<br />
Bemerkung BA-KulT WTG 3, 4; Wahlbereich<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Klassische Texte der Wissenschaftsgeschichtsschreibung<br />
3130 L 310, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, H 3012 , Rammer<br />
Inhalt Das Seminar widmet sich oft zitierten Bezugspunkten in der<br />
Wissenschaftsgeschichtsschreibung. Zentrale Texte von Canguilhem, Fleck, Kuhn,<br />
Foucault, Daston, Rheinberger und anderen werden diskutiert. Ziel des Seminars ist,<br />
verschiedene wichtige Positionen kennenzulernen, was Wissenschaftsgeschichte sein<br />
kann und wie man sie betreiben kann.<br />
Bemerkung Module: BA-KulT WTG 2, 4; BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Methodologien, Projekte, Institutionen – Wissenschaftskonzepte in der frühen Neuzeit<br />
3130 L 313, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 16:00 - 18:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 7112 , Rebohm<br />
Inhalt Die frühe Neuzeit gilt als eine Zeit des radikalen Wandels hinsichtlich des<br />
Verständnisses von „Wissenschaft“ in Europa. Dieser Umschwung soll erstens anhand<br />
von methodologischen Überlegungen als Schnittpunkt von erkenntnistheoretischen<br />
und praktischen Fragen erörtert werden. Zweitens sollen die Konzepte einzelner<br />
wissenschaftlicher Disziplinen wie Naturphilosophie oder Naturgeschichte betrachtet<br />
werden, die je eine eigene, gewissermaßen projektbezogene Programmatik hatten.<br />
Drittens wird der konzeptionelle Aspekt der Gründung wissenschaftlicher Institutionen<br />
thematisiert werden, der zudem die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und<br />
Gesellschaft umfasste.<br />
Bemerkung BA-KulT WTG 2, 4; BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Technikgeschichte im Museum<br />
3130 L 314, Proseminar<br />
Do, 14tägl, 10:00 - 14:00, 11.04.2013 - 13.07.2013, Schuster<br />
Inhalt Die Veranstaltung möchte Studierende mit der musealen Praxis bekannt machen. Am<br />
Beispiel des Deutschen Technikmuseums in <strong>Berlin</strong> werden wir vor Ort die wesentlichen<br />
musealen Arbeitsfelder kennen lernen und analysieren. Welche Variationsbreiten können<br />
Technikgeschichten in musealen Kontexten aufweisen, welche Ziele werden damit<br />
verfolgt?<br />
Anmeldung erbeten unter Email: schuster@sdtb.de<br />
Bemerkung BA-KulT WTG 3, 4; BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Wendepunkte in der Wissenschaft im 16. Jahrhundert - Das Beispiel Gerolamo Cardano<br />
SoSe 2013 33
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
3130 L 315, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 14:00 - 16:00, 08.04.2013 - 11.07.2013, H 3013<br />
Inhalt Den Namen Cardano (1501-1576) verbinden wir heute nur noch mit der Kardanwelle und<br />
der kardanischen Aufhängung, die aber nicht von ihm erfunden wurde. Der Mathematiker,<br />
Naturforscher, Arzt und Philosoph interessiert uns als wichtiger Universalgelehrter<br />
des 16. Jahrhunderts und besonders als wissenschaftlicher Entdecker. Obwohl er<br />
an mehreren Universitäten lehrte, zeigt er sich in seinem Werk als alternativer<br />
Denker, der dem Fortschritt begeistert zustimmte und in seinen theoretischen<br />
Schriften die wissenschaftlichen Revolutionen vorantrieb. Wir wollen uns in diesem<br />
Seminar anhand ausgewählter Schriften (in deutscher und englischer Übersetzung) der<br />
wissenschaftshistorisch relevanten Person Cardano und seinem Jahrhundert annähern.<br />
Bemerkung Module: BA-KulT WTG 2, 4; BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
BA-KulT IS 2, BA KulT IS 3<br />
Geschichte der Technikfolgenabschätzung<br />
3130 L 317, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 14:00 - 16:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, H 7112 , Haberland<br />
Inhalt Technik unterschiedlichster Art zieht stets Folgen nach sich. Dabei liegen gewollte<br />
und ungewollte Technikfolgen, wie bspw. flächendeckende Energieversorgung und<br />
die daraus resultierende Umweltbelastung durch Emissionen, oft eng beieinander.<br />
Umso wichtiger ist es für technische Entwickler und Entscheider, die Folgen ihrer<br />
Innovationen möglichst umfassend zu analysieren und zu bewerten. Dazu wurden seit<br />
den 1960er Jahren weltweit verschiedene Konzepte und Ideen diskutiert, um sich der<br />
Herausforderung zu stellen, Technikfolgen systematisch zu erfassen.<br />
Das Seminar wird auf Grundlage einschlägiger Quellen und Sekundärliteratur die<br />
Diskussion um das Konzept der Technikfolgenabschätzung (TA) im Kontext ihrer<br />
historischen Entwicklung behandeln. Die Studierenden übernehmen Referate über<br />
relevante Wegpunkte, Institutionen und Publikationen des TA-Konzepts, die im Anschluss<br />
gemeinsam diskutiert werden sollen.<br />
Bemerkung BA-KulT WTG 3, 4; BA Wahlbereich, BA-KulT IS 5<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge Freie Profilbildung<br />
Die Kontroversen um Funktion und Grenzen von Wissenschaft. Innovative<br />
wissenschaftstheoretische und methodologische Denkansätze im Denken der Aufklärung<br />
3130 L 318, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 12:00 - 14:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, H 3008 , Winter<br />
Inhalt Das wissenschaftliche Denken des 18. Jahrhunderts ist geprägt von grundlegenden<br />
wissenschaftlichen Kontroversen auf der Grundlage konkurrierender Denkmodelle.<br />
Dies gilt für neue Konzepte von Materie und Leben, Raum und Zeit ebenso<br />
wie für erkenntnistheoretische und wissenschaftsmethodologische Denkansätze. Ein<br />
Schwerpunkt liegt hierbei auf der zentralen Bedeutung des Experimenellen in<br />
Methodenentwürfen des 18. Jahrhunderts und auf den in der Aufklärung im Kontext<br />
hiermit kontrovers diskutierten Fragen nach der gesellschaftlichen Funktion und den<br />
Grenzen von Wissenschaft.<br />
Einen weiteren Schwerpunkt der Seminararbeit bildet die Fragestellung,<br />
inwieweit in aufklärerischen Denkansätzen bereits konstitutive Elemente aktueller<br />
Theoriediskussionen angesprochen werden.<br />
SoSe 2013 34
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Bemerkung Module: BA-KulT WTG 2, 4; BA Wahlbereich, BA-KulT IS 5<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Quanten-Dialoge: Ein besonderer Blick auf die Entwicklung der "Kopenhagen-Interpretation"<br />
3130 L 320, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, H 3002 , Wüthrich<br />
Do, Einzel, 16:00 - 18:00, 20.06.2013 - 20.06.2013, H 3021<br />
Inhalt Die sogenannte "Kopenhagen-Interpretation" sieht die Quantenmechanik als vollständige<br />
Theorie über die mikroskopischen Objekte wie Elektronen und Photonen an. Die Grenzen<br />
der Quantenmechanik, so sagen Vertreter dieser Position, seien die Grenzen unseres<br />
Erkenntnisvermögens in diesem Gebiet. Diese Position wurde vor allem von Niels Bohr<br />
(1885-1962), Werner Heisenberg (1901-1976) und Max Born (1882-1970) am Ende<br />
der 1920er Jahre entwickelt und vertreten. Die Position kannte ebenso prominente<br />
Gegner, unter anderen Albert Einstein (1879-1955). Allerdings erscheinen diese Kritiker<br />
im Rückblick oft verhaftet in überkommenen und in der modernen Physik nicht mehr<br />
haltbaren Vorstellungen. Mara Beller (1999) beurteilt dies anders. Aufgrund einer Analyse<br />
verschiedenster Arten von Dialogen zwischen den bekannten und weniger bekannten<br />
Akteuren kommt sie zum Schluss, dass die Kopenhagen-Interpretation sich viel mehr<br />
wegen des rhetorischen Geschicks seiner Vertreter durchgesetzt hat als wegen der<br />
Unhaltbarkeit der alternativen Ansichten. Im Seminar wollen wir Bellers dialogische<br />
Methode genauer kennenlernen und die daraus resultierenden Thesen anhand der<br />
Quellen, auf die sie sich stützt, kritisch überprüfen.<br />
Bemerkung Die Veranstaltung beginnt erst am 18.04.2013<br />
BA-KulT WTG 2, 4; BA-KulT IS 4, BA Wahlbereich<br />
MA-GKWT 1/1; Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Literatur Hauptsächliche Textgrundlage: Mara Beller: Quantum Dialogues. The Making of a<br />
Revolution. The University of Chicago Press (1999).<br />
Der Landschaftsgarten - ein Laboratorium der Künste<br />
3132 L 502, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 18:00 - 20:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, A 053 , von Buttlar<br />
Bemerkung BA-KulT KUWI 2, 3, 5, Wahlbereich, IS 2 , BA-KulT IS 3<br />
MA-KUWI 1, 2, 4, 8<br />
Geschichte des Antisemitismus von 1870-1945<br />
3151 L 002, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, BH-N 243 , Bergmann<br />
Inhalt Die VL wird die Entstehung des modernen Antisemitismus im letzten Drittel des 19.<br />
Jahrhunderts und seine Entwicklung bis zum Holocaust behandeln. Dies wird in Form<br />
einer vergleichenden Betrachtung wichtiger europäischer Gesellschaften geschehen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlmoduls "Vorurteilsforschung II" in den BA "Kultur und Technik"-<br />
Studiengängen<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
SoSe 2013 35
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Namenpolitik – Die Umbenennung von Straßen<br />
3151 L 011, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Straßennamen bilden eine Art historisches Gedächtnis. Politische Systemwechsel wie<br />
auch historische Lernprozesse schlagen sich in der Umbenennung von Straßen und<br />
Plätzen nieder. Diese Praxis und die dabei zu Tage tretenden Konflikte sind Gegenstand<br />
des SE.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
NS-Täterforschung<br />
3151 L 012, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 14:00 - 16:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Gegenstand des SE ist die ältere und neuere interdisziplinäre Täterforschung,<br />
die sich mit dem Verhältnis von persönlichen Dispositionen, Handlungssituationen,<br />
normativen Rahmenbedingungen und ideologischen Prägungen für Teilnahme an NS-<br />
Gewaltverbrechen beschäftigt.<br />
Bemerkung Module: BA-KulT IS 2, BA-KulT – IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich, Modul: Vorurteilsforschung<br />
Literatur Klaus Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hrsg.), Karrieren der Gewalt.<br />
Nationalsozialistische Täterbiographie, Darmstadt 2004.<br />
Christian Gerlach (Hrsg.), Durchschnittstäter. Handeln und Motivation, <strong>Berlin</strong> 2000.<br />
Gerhard Paul (Hrsg.), Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz<br />
normale Deutsche? Göttingen 2002.<br />
Christopher Browning, Judenmord. NS-Politik, Zwangsarbeit und das Verhalten der<br />
Täter, Frankfurt a. M. 2001.<br />
Nation-Building und Nationalismus<br />
3151 L 013, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 16:00 - 18:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Thema des SE ist die neuere Forschung zu Nationenbildung und Nationalismus.<br />
Dabei werden ihre grundlegenden Konzepte vorgestellt und an konkreten historischen<br />
Fallanalysen exemplifiziert.<br />
Bemerkung Modul: BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen<br />
Konzepts, Frankfurt a.M.(New York 2/1993.<br />
Christian Jansen/Henning Borggräfe, Nation, Nationalität, Nationalismus, Frankfurt a.<br />
M. 2007.<br />
„Der Gelbe Stern“. Die Kennzeichnung von Juden durch das NS-Regime<br />
3151 L 038, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Dörner<br />
SoSe 2013 36
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Inhalt Die Kennzeichnung von „Nichtariern“ und ihres Eigentums erfolgte während der NS-Zeit<br />
ab 1938 in mehreren Schritten. Seit dem 19. September 1941 mussten in Deutschland<br />
Jüdinnen und Juden ab dem Alter von 6 Jahren einen handtellergroßen gelben Davidstern<br />
sichtbar auf ihrer Kleidung tragen. Sie sollten im Vorfeld der reichsweiten Deportationen<br />
öffentlich erkennbar sein.<br />
In der Lehrveranstaltung soll der Prozess der Stigmatisierung der jüdischen Minderheit<br />
historisch untersucht werden. Dabei steht die Analyse der psychischen und sozialen<br />
Auswirkungen für die Betroffenen sowie der gesellschaftlichen Reaktionen im<br />
Vordergrund. Historische Quellen unterschiedlicher Provenienz (geheime Lageberichte,<br />
Tagebücher, Briefe, Fotographien etc.) werden hierbei ausgewertet. Die Befragung von<br />
Zeugen der nationalsozialistischen Herrschaft soll die Quellenanalyse ergänzen und<br />
vertiefen.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 2<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Konrad Kwiet: Nach dem Pogrom. Stufen der Ausgrenzung, in: Wolfgang Benz (Hg.):<br />
Die Juden in Deutschland 1933-1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft,<br />
München 1988, S. 614-631.<br />
Jens J. Scheiner: Vom gelben Flicken zum Judenstern? Genese und Applikation von<br />
Judenabzeichen im Islam und christlichen Europa (849-1941), Frankfurt a.M u.a. 2004.<br />
Otto Dov Kulka/Eberhard Jäckel (Hg): Die Juden in den geheimen NS-<br />
Stimmungsberichten 1933-1945, Düsseldorf 2004 (plus CD-ROM).<br />
Saul Friedländer: Die Jahre der Vernichtung. Das Dritte Reich und die Juden, Bd. 2:<br />
1939-1945, München 2006.<br />
Peter Longerich: „Davon haben wir nichts gewusst!“ Die Deutschen und die<br />
Judenverfolgung 1933-1945, München 2006.<br />
Forschungskolloquium<br />
3151 L 040, Forschungscolloquium, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 18:00 - 20:00, 10.04.2013 - 10.07.2013, TEL 811 , Bergmann, Funck, Kohlstruck, Schüler-<br />
Springorum<br />
Inhalt Die Veranstaltung steht ohne Anmeldung allen wissenschaftlich Interessierten -<br />
unabhängig von einer Hochschulzugehörigkeit - offen, auch zum Besuch einzelner<br />
Termine. Bitte beachten Sie wegen eventueller Programmänderungen die Homepage<br />
des Instituts:<br />
http://www.tu-berlin.de/fakultaet_i/zentrum_fuer_antisemitismusforschung<br />
10.4.2013<br />
Evelyn Annuß, Bochum<br />
(An-)Ästhetisierung des Politischen? Zum Formwandel des nationalsozialistischen<br />
Massentheaters<br />
17.4.2013<br />
Tobias Kühne, <strong>Berlin</strong><br />
Das Netzwerk "Neu Beginnen" und die <strong>Berlin</strong>er SPD nach 1945<br />
24.4.2013<br />
SoSe 2013 37
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Katharina Erbe, <strong>Berlin</strong><br />
Rebellin, Heldin, Geisteskranke. Die jüdische Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim und<br />
ihr Kampf gegen den Mädchenhandel<br />
8.5.2013<br />
(Bitte beachten Sie die veränderte Uhrzeit: 16:00-18:00)<br />
Péter Bihari, Budapest<br />
Systemwandel und die Juden im Ungarn des 20. Jahrhunderts (Vortrag in englischer<br />
Sprache)<br />
15.5.2013<br />
Mathias Berek, Leipzig/Tel Aviv<br />
Preußisch-jüdisches Deutschland. Der Protosoziologe Lazarus im 19. Jahrhundert<br />
22.5.013<br />
Alexandra Klei, <strong>Berlin</strong><br />
Ort - Ereignis - Erinnerung. Topographie und Architektur ehemaliger Konzentrationslager<br />
im Wandel<br />
29.5.2013<br />
Juliane Michael, Göttingen<br />
Osteuropäisch-jüdische Migranten in der <strong>Berlin</strong>er Unterhaltungskunst der 1920er- und<br />
1930er-Jahre<br />
5.6.2013<br />
Jennifer Steuer, Mannheim<br />
Günter Grass: „Was gesagt werden muss“ – literaturwissenschaftliche und politische<br />
Reaktionen<br />
12.6.2013<br />
Sina Arnold, <strong>Berlin</strong><br />
Antisemitismusdiskurse in der gegenwärtigen US-amerikanischen Linken<br />
19.6.2013<br />
Henning Fauser, Paris/Halle-Wittenberg<br />
Deutschlandbilder ehemaliger französischer KZ-Häftlinge<br />
26.6.2013<br />
Fabian Virchow, Düsseldorf<br />
Verbote rechtsextremer Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland 1951 bis 2011<br />
3.7.2013<br />
Lida Barner, London/<strong>Berlin</strong><br />
„Jüdische Patente sind zu arisieren“. Geistiges Eigentum von Juden im<br />
Nationalsozialismus<br />
10.7.2013<br />
Marcin Siadkowski, Warschau<br />
Die Emigration polnischer Juden und die internationale Politik zwischen 1918 und 1945<br />
(Vortrag in englischer Sprache)<br />
SoSe 2013 38
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Das Normale und das Pathologische<br />
3152 L 016, Hauptseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 07.06.2013 - 07.06.2013, MAR 0.007<br />
Sa, Einzel, 12:00 - 16:00, 08.06.2013 - 08.06.2013, MAR 0.007<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 14.06.2013 - 14.06.2013, MAR 4.064<br />
Sa, Einzel, 12:00 - 16:00, 15.06.2013 - 15.06.2013, MAR 2.068<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 21.06.2013 - 21.06.2013, MAR 2.068<br />
Inhalt Die Unterscheidung zwischen dem Normalen und dem Pathologischen bildet die<br />
Grundlage medizinischer Diagnostik. Die Kriterien, unter denen etwas für normal oder<br />
pathologisch erklärt wird, entstammen jedoch nicht der Institution der Medizin allein,<br />
vielmehr lassen sich keine scharfen Grenzen zwischen medizinischen, biologischen und<br />
sozialen Normen ziehen. Zudem entfalten Definitionen von Normen und Pathologien eine<br />
gesellschaftliche Relevanz über den Horizont der Medizin und Biologie hinaus und sind<br />
nicht selten politisch umkämpft.<br />
Der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem hat sich diesen und<br />
anderen Problemen in seinem bekanntesten und nun in neuer Übersetzung vorliegenden<br />
Werk „Das Normale und das Pathologische“ gewidmet und dabei Fragen aufgeworfen,<br />
die bis heute aktuell sind: Wie ist das Verhältnis von medizinischer und sozialer Norm?<br />
Ist das Pathologische schlicht eine Abweichung von der Norm? Ist Gesundheit zugleich<br />
das Normale? Kann es mehrere Normen geben? Inwieweit fungiert die Medizin als eine<br />
Technik zur Herstellung von Normalität?<br />
In dem Lektüreseminar wollen wir in einem ersten Teil Auszüge aus Canguilhems Werk<br />
lesen und auf seine Aktualität hinsichtlich gegenwärtiger Formen von medizinischer<br />
Diagnostik und sozialer Normierung befragen. In einem zweiten Teil betrachten wir<br />
aktuelle Rezeptionslinien im Anschluss an Canguilhem und diskutieren die methodische<br />
und theoretische Bedeutung seiner Arbeiten u.a. für die kritische Wissenschaftsforschung<br />
und Medizingeschichte, die Gender Studies und die Disability Studies.<br />
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Voranmeldung bis zum 10.04.2013<br />
per E-Mail an: mike.laufenberg@tu-berlin.de<br />
Der 1. Termin findet am 19.April 2013 um 12 Uhr in Raum MAR 0.011 statt.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 5<br />
Re-Lektüren: Feministische Theorie<br />
3152 L 024, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 27.06.2013 - 27.06.2013<br />
Inhalt In dieser Lehrveranstaltung lesen und erarbeiten wir gemeinsam thematisch gebündelte,<br />
aktuelle und immer noch zeitgemäße Beiträge zur feministischen Theorie. Große<br />
Bereitschaft zu intensiver Lektüre ist Teilnahmevoraussetzung.<br />
Bemerkung BA ab 2. Studienjahr / MA / Postgradual<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 4<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
Voraussetzung Große Bereitschaft zu intensiver Lektüre ist Teilnahmevoraussetzung.<br />
Geschlechterverhältnis und Technik<br />
Diversity – und Innovationsmanagement – für neue Märkte<br />
0536 L 343, Seminar, 2.0 SWS<br />
SoSe 2013 39
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Di, Einzel, 18:00 - 19:00, 16.04.2013 - 16.04.2013<br />
Block, 09:00 - 18:00, 21.06.2013 - 22.06.2013<br />
Inhalt Diversity Management und Innovationsmanagement gewinnen zunehmend an<br />
Bedeutung. Schlagworte wie Globalisierung, Internationalisierung, Chancengleichheit,<br />
demographischer Wandel und Fachkräftemangel prägen einen Rahmen, in dem<br />
Diversity Management diskutiert wird, während Innovationsmanagement eher im Zuge<br />
von Wettbewerb, kurzen Produktlebenszyklen, Marktdynamik und –Orientierung an<br />
Beachtung gewinnt.<br />
Ziel des Seminars ist die Vermittlung von theoretischem Wissen und der praktischen<br />
Umsetzung zu Diversity & Innovationen - für einen strategischen Umgang mit Vielfalt und<br />
zur Generierung neuer Märkte:<br />
• Theorie: Aktuelle Studien und Literatur zu Diversity-Management als<br />
Innovationstreiber; Kenntnis von Innovationsmanagementgrundlagen<br />
• Praxis: Partizipative Ansätze in Forschung und Entwicklung, Kreativsession und<br />
Ausarbeitung eigener Innovationen<br />
• Kreativsession: Erarbeitung von innovativen Ideen basierend auf verschiedenen<br />
Kreativitätstechniken entlang der erlernten Theorie<br />
Bemerkung Blockseminar am 21. und 22. Juni 2013 (Freitag / Samstag). Anmeldung und evt.<br />
Themenvergabe erfolgen bei der Vorbesprechung am Dienstag 16.04.2013, 18<br />
- 19 Uhr. Blockseminar und Vorbesprechung finden in den Räumen der Fraunhofer<br />
Gesellschaft, 5. OG, Hardenbergstr. 20, 10623 <strong>Berlin</strong> statt.<br />
Das Modul ist mit anderen Lehrveranstaltungen des Fachgebiets kombinierbar. Das 3<br />
ECTS Modul kann in einem Semester abgeschlossen werden.<br />
Nachweis Die Note setzt sich aus der Bewertung folgender Leistungen zusammen<br />
(prüfungsäquivalente Studienleistungen ): Mündliche Mitarbeit und Präsentationen<br />
während der Veranstaltung, Seminararbeit zur Präsentation während des Seminars<br />
oder im Nachgang (richtet sich nach Anzahl der Teilnehmenden).<br />
Es besteht Teilnahmepflicht.<br />
Literatur • Boschma, Ron A. (2005): Proximity and Innovations: A Critical Assessment. In:<br />
Regional Studies, Jg. 39, H. 1; 61–74<br />
• Nooteboom, B.; Van Haverbeke, W.P.; Duijsters, G.M.; Gilsing, V.; Van den Oord, A.<br />
(2007): Optimal cognitive distance and absorptive capacity. In: Research Policy, Jg.<br />
36, H. 7, 1016–1034<br />
• Page, Scott E. (2008): The difference. How the power of diversity creates better<br />
groups, firms, schools, and societies. 3. Aufl. Princeton<br />
• Schiebinger, L. (2008): Gendered Innovations in Science and Engineering. 1. Aufl.<br />
Stanford: Stanford University Press<br />
• Schraudner, M. (2010): Diversity im Innovationssystem. Stuttgart: Fraunhofer Verlag<br />
Ringvorlesung Partizipative Entscheidungsprozesse<br />
3500 L 004, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, 14tägl, 18:00 - 20:00, 25.04.2013 - 11.07.2013<br />
Inhalt Auch im Wintersemester 2012/13 veranstaltet der Bereich Partizipationsforschung des<br />
ZTG gemeinsam mit dem Center for Metropolitan Studies (CMS) der <strong>TU</strong> <strong>Berlin</strong> eine<br />
Ringvorlesung zum Thema "Partizipative Entscheidungsprozesse".<br />
Bemerkung<br />
Was Sie schon immer über Geschlecht wissen wollten ... und nie zu fragen wagten: Einführung in die<br />
Gender Studies<br />
3152 L 025, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 12:00 - 14:00, 16.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
SoSe 2013 40
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Mo, Einzel, 16:00 - 18:00, 13.05.2013 - 13.05.2013, MAR 2.068<br />
Inhalt Gender Studies fragen nach der Bedeutung von Geschlecht in Wissenschaft und<br />
Gesellschaft. Sie rücken die Kategorie Geschlecht in verschiedenen Bereichen<br />
(z. B. Arbeit, Technik, Organisationen, Politik) ins Zentrum ihrer Analysen.<br />
Gender Studies zeigen, wie sich Geschlechterverhältnisse historisch entwickelten<br />
und veränderten. Im Seminar werden theoretische, soziologische, methodische<br />
und historiographische Konzepte der Geschlechterforschung vorgestellt und an<br />
exemplarischen Gegenstandsfeldern diskutiert.<br />
Diese Lehrveranstaltung ist geeignet für Studierende aller Fächer und Studiengänge, die<br />
noch keine Kenntnisse in Frauen- und Geschlechterforschung haben.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies) (Freie Profilbildung)<br />
MA-BIWI 7b (Bildungswissenschaft: Gender und Organisation)<br />
Re-Lektüren: Feministische Theorie<br />
3152 L 024, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 27.06.2013 - 27.06.2013<br />
Inhalt In dieser Lehrveranstaltung lesen und erarbeiten wir gemeinsam thematisch gebündelte,<br />
aktuelle und immer noch zeitgemäße Beiträge zur feministischen Theorie. Große<br />
Bereitschaft zu intensiver Lektüre ist Teilnahmevoraussetzung.<br />
Bemerkung BA ab 2. Studienjahr / MA / Postgradual<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 4<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
Voraussetzung Große Bereitschaft zu intensiver Lektüre ist Teilnahmevoraussetzung.<br />
Transdisziplinäre Geschlechterstudien<br />
3152 L 026, Colloquium, 3.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 19:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Do, Einzel, 16:00 - 19:00, 27.06.2013 - 27.06.2013<br />
Inhalt Das Colloquium bietet die Möglichkeit, Dissertationen sowie Examensarbeiten (Magister/<br />
Magistra, Diplom, Staatsexamen, BA) im transdisziplinären Feld der Frauen- und<br />
Geschlechterforschung vorzustellen und zu diskutieren. Teilnahme nur nach persönlicher<br />
Anmeldung möglich.<br />
Bemerkung BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
Gender und Organisation<br />
3152 L 022, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 08.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Meißner<br />
Mo, Einzel, 12:00 - 14:00, 24.06.2013 - 24.06.2013, MAR 2.069<br />
Inhalt In kritischer Auseinandersetzung mit Auffassungen, dass die Geschlechtszugehörigkeit<br />
von Mitgliedern in Organisationen eigentlich irrelevant sei, hat die Frauen- und<br />
Geschlechterforschung darauf aufmerksam gemacht, dass Organisationen in ihrer<br />
Eingebundenheit in den gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden müssen, dass<br />
die Kategorie Geschlecht in Strukturen und Abläufen von Organisationen eingelassen<br />
ist und dass dadurch systematisch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen<br />
reproduziert werden. In diesem Seminar werden theoretische Perspektiven und<br />
empirische Untersuchungen zum Zusammenhang von Organisation und Geschlecht<br />
diskutiert. Anknüpfend an Debatten um Intersektionalität wird außerdem danach gefragt,<br />
wie neben Geschlecht auch andere soziale Kategorien in Organisationsstrukturen und<br />
SoSe 2013 41
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
-abläufen eingelassen sind. Mögliche Eingriffs- und Gestaltungsspielräume werden<br />
anhand der Konzepte von Gender Mainstreaming und Managing Diversity beleuchtet.<br />
Bemerkung MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies) (Freie Profilbildung)<br />
MA-BIWI 7b (Bildungswissenschaft: Gender und Organisation)<br />
Was Sie schon immer über Geschlecht wissen wollten...und nie zu fragen wagten: EInführung in die<br />
Genderstudies<br />
3152 L 023, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 26.06.2013, MAR 0.016<br />
Do, Einzel, 12:00 - 14:00, 27.06.2013 - 27.06.2013, H 0111<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 04.07.2013 - 13.07.2013, MAR 0.016 , Lucht<br />
Inhalt Gender Studies fragen nach der Bedeutung von Geschlecht in Wissenschaft und<br />
Gesellschaft. Sie rücken die Kategorie Geschlecht in verschiedenen Bereichen<br />
(z. B. Arbeit, Technik, Organisationen, Politik) ins Zentrum ihrer Analysen.<br />
Gender Studies zeigen, wie sich Geschlechterverhältnisse historisch entwickelten<br />
und veränderten. Im Seminar werden theoretische, soziologische, methodische<br />
und historiographische Konzepte der Geschlechterforschung vorgestellt und an<br />
exemplarischen Gegenstandsfeldern diskutiert.<br />
Diese Lehrveranstaltung ist geeignet für Studierende aller Fächer und Studiengänge, die<br />
noch keine Kenntnisse in Frauen- und Geschlechterforschung haben. Die Teilnahme an<br />
dieser – oder einer vergleichbaren – Lehrveranstaltung ist Voraussetzung für den Besuch<br />
der weiteren Lehrveranstaltungen am ZIFG.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies) (Freie Profilbildung)<br />
MA-BIWI 7b (Bildungswissenschaft: Gender und Organisation)<br />
Labore der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung: Welche Rolle spielt „Geschlecht“ in<br />
Experiment und Gestaltung?<br />
3152 L 015, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 18.04.2013 - 10.07.2013, MAR 2.013<br />
Inhalt Seit Ende der 1970er Jahre wird in der Wissenschaftsforschung der epistemologische<br />
Status des Experiments beginnend mit ethnographisch geschulten Laborstudien (Knorr<br />
Cetina 1981) und in praxisorientierten Arbeiten (Latour/Woolgar 1986) untersucht.<br />
Verschiedene Autor_innen konnten aufzeigen, dass dem Experiment entgegen<br />
dem bisherigen Verständnis eine eigenständige, schöpferische und generierende<br />
Rolle zukommt (Heidelberger/Steinle 1998). „Experimente kombinieren künstliche<br />
und natürliche, technische und wissenschaftliche, materielle und immaterielle<br />
Dinge“ (Schmidgen u.a. 2004:8) und bringen in diesem Prozess das Undefinierte und das<br />
Noch-nicht-Sichtbare als epistemisches Objekt hervor.<br />
Für uns stellt sich die Frage, welche Rolle dem Experiment bei der Konstruktion<br />
von Geschlecht zukommt. Wie wird die Differenz zwischen männlich und weiblich<br />
experimentell bzw. gestalterisch hergestellt, und wie wird das experimentell produzierte<br />
Wissen über Geschlecht stabilisiert? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Laborund<br />
experimentellen Anordnungen über die Disziplinen hinweg und wie wandeln sie sich<br />
in Abhängigkeit dessen, was disziplinär als Repräsentation von Geschlecht gilt?<br />
In dieser Veranstaltung werden wir mittels teilnehmender Beobachtung verschiedene<br />
natur- und technikwissenschaftliche Labore an der <strong>TU</strong> <strong>Berlin</strong> in den Blick nehmen, um<br />
diesen Fragen nachzugehen.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
SoSe 2013 42
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Diese LV kann als Vertiefungsmodul des Studienprogramm Gender Pro Mint belegt<br />
werden.<br />
Voraussetzung Eine einführende Veranstaltung zu den Gender Studies.<br />
Literatur Literaturhinweise:<br />
Beaufaÿs, Sandra / Krais, Beate (2005): "Doing Science – Doing Gender. Die<br />
Produktion von WissenschaftlerInnen und die Reproduktion von Machtverhältnissen im<br />
wissenschaftlichen Feld." In: Feministische Studien , 1/2005. S. 82 - 99.<br />
Heintz, Bettina / Merz, Martina / Schumacher, Christina (2004): Wissenschaft, die<br />
Grenzen schafft. Geschlechterkonstellationen im disziplinären Vergleich . Reihe<br />
Sozialtheorie. Bielefeld; Transcript. (Zur vorbereitenden Lektüre insbesondere<br />
empfohlen: S. 40 - 76.)<br />
Traweek, Sharon (1988): Beamtimes and Lifetimes . Cambridge MA/London: Harvard<br />
University Press. (Zur vorbereitenden Lektüre insbesondere empfohlen: S. 46 - 73.)<br />
Gender & Diversity in der Gestaltung von Forschungsprojekten und Technologien<br />
3152 L 017, Projektkurs, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 09:00 - 12:00, 19.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Lucht<br />
Inhalt Das Abschlussprojekt ist ein Angebot für alle Studierenden, die ihre natur- oder<br />
ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit (BA/MA/Promotion) um Perspektiven der<br />
Gender Studies erweitern möchten.<br />
Die Lehrveranstaltung bietet die Möglichkeit,<br />
- eine natur- oder ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit (BA/MA/Promotion) in<br />
verschiedenen Stadien zu präsentieren und aus Perspektiven der Gender Studies zu<br />
reflektieren<br />
- zu klären, welche spezifischen Theorien, Kenntnisse und Methoden der Gender Studies<br />
relevant sind für eine Reflektion der Abschlussarbeit im Fachstudium – und diese<br />
individuell oder in der Gruppe zu erarbeiten,<br />
- gemeinsam zu erproben, wie relevante Theorien, Kenntnisse und Methoden der Gender<br />
Studies auf die Abschlussarbeit im Fachstudium übertragen werden können,<br />
- sich über Erfahrungen und ggf. Probleme des interdisziplinären Arbeitens<br />
auszutauschen, die bei diesen Vorhaben entstehen.<br />
Die Ergebnisse der Abschlussprojekte für das Zertifikat „Gender Pro Mint“ können auf<br />
einem Projekttag zum Ende des Semesters der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt<br />
werden.<br />
Bemerkung Lehrveranstaltung des Studieprogramm Gender Pro Mint<br />
Clubtag Techno-Club<br />
Die Lehrveranstaltung findet im Raum MAR 2.009 statt!<br />
3152 L 020, Projektintegr. Veranstaltung, 2.0 SWS<br />
SoSe 2013 43
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Di, wöchentl, 16:00 - 20:00, 02.04.2013 - 30.09.2013, MAR 2.069 , Greusing<br />
Do, Einzel, 16:00 - 19:00, 23.05.2013 - 23.05.2013, MAR 0.001<br />
Mi, Einzel, 16:00 - 18:00, 12.06.2013 - 12.06.2013, MAR 2.071<br />
Fr, Einzel, 09:00 - 15:00, 12.07.2013 - 12.07.2013, MAR 2.072<br />
Di, Einzel, 14:00 - 20:00, 03.09.2013 - 03.09.2013, MAR 2.068<br />
Di, Einzel, 14:00 - 20:00, 03.09.2013 - 03.09.2013, MAR 2.071<br />
Inhalt An den Clubtagen, wie zum Beispiel dem Perspektivencafé, treffen sich die Schülerinnen<br />
AGs des Techno-Clubs. Zum Perspektivencafé sind Studentinnen aller Studiengänge<br />
herzlich eingeladen. Hier können sich Schülerinnen, Studentinnen, Ingenieurinnen<br />
und Naturwissenschaftlerinnen treffen, Kontakte knüpfen und über Berufsperspektiven<br />
austauschen. Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit von Ingenieurinnen und<br />
Naturwissenschaftlerinnen aus erster Hand aus ihrem Berufsalltag zu erfahren.<br />
Bemerkung Der Semesterauftakt findet am 19. März 2013 um 16.00 Uhr statt.<br />
Gender in neuen Welten. Frühneuzeitliche Geschlechterkonstruktionen und außereuropäische<br />
Räume.<br />
3152 L 014, Seminar, 2.0 SWS<br />
wöchentl<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 19.04.2013 - 19.04.2013, MAR 4.062 , Gleixner<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 26.04.2013 - 26.04.2013, MAR 4.062 , Gleixner<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 03.05.2013 - 03.05.2013, MAR 4.062 , Gleixner<br />
Inhalt Auch in der Frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert) werden außereuropäische<br />
Räume mit Geschlechterbildern verbunden und durch diese visualisiert wie<br />
konzipiert. Beispielsweise werden auf Landkarten Bewohnerinnen und Bewohner<br />
außereuropäischer Kontinente nicht selten über Nacktheit definiert und erkennbar<br />
gemacht. Das Seminar möchte an Hand von Originalquellen des 16.-18. Jahrhunderts<br />
den vielfältigen Verbindungen von Geschlechterkonstruktionen und außereuropäischen,<br />
kolonialen Räumen nachgehen. Dafür sollen sowohl bildliche als auch textuelle<br />
Darstellungen mit mit Hilfe eines kulturwissenschaftlichen Ansatzes interpretiert werden.<br />
Zu Beginn werden drei Freitagstermine an der <strong>TU</strong> (19.4., 26.4., 3.5.) in die Thematik<br />
einführen und dazu eine gemeinsame Lektüregrundlage geschaffen. Vom 13.5.bis 15.5.<br />
findet das Blockseminar an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel statt. Die<br />
Herzog August Bibliothek ist eine außeruniversitäre Forschungs- und Studienstätte<br />
für die europäische Kulturgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Die<br />
historischen Bestände der Bibliothek bilden ein in Breite und Tiefe einzigartiges Archiv<br />
des europäischen Wissens in seinen weltweiten Bezügen.<br />
Die Kosten für zwei Übernachtungen (2 Nächte mit Frühstück=40 EUR) in Wolfenbüttel<br />
sowie Hin- und Rückfahrt müssen vermutlich von den Teilnehmenden getragen werden.<br />
Bemerkung MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
Mensch und Maschine<br />
Seminar Mensch-Maschine-Systeme<br />
0532 L 069, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 17.04.2013 - 10.07.2013, MAR 3.025<br />
Inhalt Das Seminar gibt den Teilnehmer/innen einen Überblick über aktuelle Forschung im<br />
Bereich Mensch-Maschine-Systemtechnik. Dabei sind insbesondere die Behandlung von<br />
Gestaltungskriterien und Anforderungen sowohl aus ingenieurswissenschaftlicher als<br />
SoSe 2013 44
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Geschichte der Automobilindustrie II<br />
auch aus humanwissenschaftlicher Perspektive Gegenstand der Lehrveranstaltung. Für<br />
die Teilnahme ist eine Anmeldung bis eine Woche vor Vorlesungsbeginn über die Web-<br />
Seiten des FG MMS notwendig (http://www.mms.tu-berlin.de/lehre_mms_se.html).<br />
0533 L 575, Integrierte LV (VL mit UE), 2.0 SWS<br />
Mo, 14tägl, 14:00 - 18:00, 08.04.2013 - 01.07.2013, TIB13 -336 , Sievers<br />
Inhalt Fußend auf Kurs I soll in dieser Veranstaltung die Entwicklung der europäischen<br />
Automobilindustrie von ihren Anfängen bis in unsere Zeit anhand ausgewählter Beispiele<br />
dargestellt werden: Der Wandel vom Handwerk hin zur industriellen Fertigung sowohl<br />
der Automobil- als auch der Motorrad- und Nutzfahrzeughersteller wird dabei genauso<br />
berücksichtigt wie der frühe Informationsfluß zwischen Wissenschaft und Industrie. Es<br />
werden Exkursionen angeboten.<br />
Bemerkung Jeweils montags, 14:00-18:00 Uhr (in der Regel 14-täglich)<br />
Termine:<br />
08.04.2013<br />
22.04.2013<br />
06.05.2013<br />
24.05.2013 Exkursion: 14:30 Uhr, BMW-Werk<br />
27.05.2013 entfällt!<br />
03.06.2013, ab 15:00 Uhr !<br />
10.06.2013 Exkursion: 14:00 Uhr, Depot Technik-Museum Schöneberg<br />
24.06.2013<br />
Der Termin für die im Sommersemster vorgesehene Exkursion (zum BMW-Werk in<br />
Spandau) wird zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle bekanntgegeben.<br />
Freiheit: ein Problem auch im Verhältnis von Mensch und Tier<br />
3130 L 198, Projekt, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 10.07.2013, H 3008 , Adolphi<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 14.05.2013 - 14.05.2013, H 3013<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 28.05.2013 - 28.05.2013, H 3013<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 11.06.2013 - 11.06.2013, H 6124<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 25.06.2013 - 25.06.2013, H 3013<br />
Di, Einzel, 16:00 - 19:00, 09.07.2013 - 09.07.2013, H 3013<br />
Inhalt Die Veranstaltung ist Teil eines studentischen Projekts unter dem Titel Bioethik: Mensch<br />
und Tier, in dem – an diesem Beispielfeld – die Vermittlung ethischer Sachverhalte in den<br />
Medien, speziell Radio, erarbeitet werden soll. Die Veranstaltung verbindet Theorieteile<br />
(Philosophie/Ethik) und Praxis (Recherche / Medientheorie / konkrete Praktika und<br />
Vorbereitung von Radiosendungen). Im SoSe 2013 wird es um das Problem von<br />
Gefangenschaft und Freiheit gehen.<br />
Lektürehinweise: Stefan Austermühle: Und hinter tausend Stäben keine Welt! Die<br />
Wahrheit über Tierhaltung im Zoo (1996). Steven Best (2004): Terrorists or Freedom<br />
Fighters?: Reflections on the Liberation of Animals (2004).Michael Haller: Recherchieren<br />
(2004).<br />
Die Veranstaltung des Semesters steht für sich als eine eigene abgeschlossene<br />
Lehrveranstaltung, kann also ohne Teilnahme an den anderen Themenschwerpunkten<br />
des Projekts in anderen Semestern besucht werden. Es können 3 LP erworben werden<br />
(wenn wesentlich nur der Theorie-Teil gemacht wird) oder 6 LP (wenn am Ende es über<br />
eine vollständige Sachrecherche bis zu einem eigenen Radio-Beitrag ausgearbeitet wird<br />
– der wird dann gesendet).<br />
SoSe 2013 45
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Bemerkung Dozenten: Thomas Exner, Fritz Psiorz; Verantwortlich: Rainer Adolphi<br />
BA-KulT Phil 4,Wahlbereich<br />
MA Phil 4, 6, 7, Freie Profilbildung<br />
Industrial Design Engineering<br />
0334 L 035, Integrierte LV (VL mit UE), 4.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 14:00 - 16:00, 10.04.2013 - 13.07.2013, EB 133C<br />
Fr, wöchentl, 08:00 - 10:00, 12.04.2013 - 13.07.2013, EB 133C , Schmidt<br />
Inhalt Die Studierenden entwerfen in interdisziplinären Teams technische Produkte. Die zu<br />
bearbeitenden Themen werden je nach industrieller Relevanz aus den Bereichen<br />
Automotive, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Konsumgüterindustrie,<br />
Energietechnik sowie Robotik vom betreuenden Ingenieur gewählt. Der Schwerpunkt<br />
liegt in der Identifizierung der Anforderungen, Produktkonzeption und Vorentwurf sowie<br />
Auswahl der Werkstoffe unter Berücksichtigung moderner Leichtbaumaterialien und -<br />
strategien. Bei dem Entwurf steht nicht die Vermittlung detaillierten Fachwissens im<br />
Vordergrund sondern die Vertiefung methodischen Vorgehens bei der Produktkonzeption<br />
im Entwurfsprozess. Dabei wird eine pragmatische, lösungsorientierte Vorgehensweise<br />
verlangt.<br />
Bemerkung Da es sich um einen externen Lehrauftrag aus der Industrie handelt, muss die<br />
Veranstaltung u.U. in Blockseminaren oder zweiwöchentlich stattfinden (d.h. auch<br />
Termine am Wochenende möglich!). Eröffnungsveranstaltung: Gruppeneinteilung,<br />
Vergabe der Entwurfsthemen, evt. Änderung/Festlegung der weiteren Termine. Als<br />
Bewertungsgrundlage sind ein Abschlussbericht, Zwischen- und Endpräsentation zu<br />
erstellen. Umfang: 4 SWS / 6 LP.<br />
Wegen des Termins der Eröffnungsveranstaltung beachten Sie bite die<br />
Homepage des Fachgebiets Werkstofftechnik.<br />
Machine Intelligence II/Neuronale Informationsverarbeitung<br />
0434 L 867, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, MA 004 , Obermayer, Lochmann<br />
Inhalt This is the second of two consecutive courses on topics in machine learning and artificial<br />
neural networks. Areas covered: Component analysis, clustering and embedding, selforganizing<br />
maps, probabilistic methods II, resampling methods<br />
Machine Intelligence II/Neuronale Informationsverarbeitung<br />
0434 L 867, Übung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 11.04.2013 - 26.06.2013, MAR 0.002 , Lochmann<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 26.06.2013, MAR 4.063 , Lochmann<br />
Do, Einzel, 14:00 - 16:00, 27.06.2013 - 27.06.2013, MAR 2.071<br />
Do, Einzel, 16:00 - 18:00, 27.06.2013 - 27.06.2013, MAR 2.071<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 04.07.2013 - 11.07.2013, MAR 0.002<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 04.07.2013 - 11.07.2013, MAR 4.063<br />
Bemerkung Thursday 14:00 - 16:00 is for students of the Master Program Computational<br />
Neuroscience only.<br />
Thursday 16:00 - 18:00 is for all other students.<br />
Automationspsychologie<br />
0532 L 351, Integrierte LV (VL mit UE), 4.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 12:00 - 16:00, 12.04.2013 - 27.06.2013, MAR 0.017<br />
Fr, Einzel, 12:00 - 14:00, 14.06.2013 - 14.06.2013, MAR 0.002<br />
Fr, Einzel, 12:00 - 16:00, 28.06.2013 - 28.06.2013, H 3002<br />
Fr, Einzel, 12:00 - 16:00, 05.07.2013 - 05.07.2013, MAR 0.017<br />
SoSe 2013 46
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Inhalt Das Modul behandelt psychologisch relevante Aspekte, die es im Kontext der<br />
Automatisierung technischer Systeme zu berücksichtigen gilt.<br />
Bemerkung Voraussetzungen: aktive Mitarbeit, Englischkenntnisse, Übernahme von Referaten<br />
Medizintechnik Anwendungen<br />
0535 L 512, Integrierte LV (VL mit UE), 4.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 16:00, 10.04.2013 - 10.07.2013, SG-09 215 , Kraft<br />
Inhalt Defibrillatoren, Elektrotherapie, Herzunterstützungssysteme, Vaskuläre Implantate,<br />
Navigation und Robotik in der Medizin, Blutreinigungsverfahren.<br />
Vertiefung in Gruppenübungen: Elektrokardiogramm, Elektromyogramm,<br />
Nervenleitgeschwindigkeitsmessung, Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Intraaortale<br />
Ballonpumpe, Prüfung von Stenteigenschaften, Klinische Assistenzsysteme,<br />
Hämodialyse, Elektrophysiologie, Elektroden, Elektrotherapie, Strömungsmechanik<br />
Blutkreislauf, Festigkeitsberechnung von Stents.<br />
Bemerkung Voraussetzung: obligatorisch: Modul "Grundlagen der Medizintechnik" (GMT) oder<br />
Modul "Einführung Medizintechnik" (EMT); wünschenswert: Modul "Medizinische<br />
Grundlagen für Ingenieure" und "Chemie".<br />
Anmeldung in der 1. Vorlesungswoche unter www.medtech.tu-berlin.de notwendig,<br />
weiter ist eine Anmeldung der Prüfung über Qispos vor dem Erbringen der ersten<br />
Lestung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt!<br />
Nachweis Prüfungsform ist "Prüfungsäquivalente Studienleistungen". Die Leistungen werden im<br />
Semester in Form von Kurzvorträgen, Protokollen, Präsentationen und Hausaufgaben<br />
erbracht (50% der Modulnote), weiter gehen eine mündliche Rücksprache (25 % der<br />
Modulnote) und eine schriftliche Modulprüfung (25% der Modulnote) in die Bewertung<br />
ein. Die genaue Zusammensetzung und Gewichtung der einzelnen im Semester zu<br />
erbringenden Leistungen wird zu Beginn des ersten Termins der Veranstaltung bekannt<br />
gegeben.<br />
Alle Teilleistungen der Modulprüfung müssen bestanden werden (Note 4.0 oder<br />
besser), um das Modul erfolgreich abzuschließen.<br />
Voraussetzung a) obligatorisch: Modul "Grundlagen der Medizintechnik" (GMT) oder Modul "Einführung<br />
Medizintechnik" (EMT)<br />
b) wünschenswert: Modul "Medizinische Grundlagen für Ingenieure" und "Chemie"<br />
Literatur H. Hutten: Biomedizinische Technik, 4 Bände, Springer-Verlag/ Verlag TÜV Rheinland<br />
Köln; 1992<br />
R. Kramme: Medizintechnik, Verfahren, Systeme, Informationsverarbeitung, 2. Auflage;<br />
Springer-Verlag<br />
Medizinische Grundlagen für Ingenieure I<br />
0535 L 518, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 14:00 - 16:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, PTZ S001 , Scholz<br />
Inhalt Grundlegende Darstellungen der medizinischen Basiswissenschaften Anatomie,<br />
Physiologie und Biochemie aller Organsysteme unter besonderer Berücksichtigung der<br />
Beziehung Medizin und Technik. Möglichkeit praktischer Übungen in der Klinik.<br />
Bemerkung Lehrveranstaltung kann sowohl im SoSe als auch im WiSe begonnen werden.<br />
Lehrveranstaltung kann auch als Modulveranstaltung mit 6 Leistungspunkten über 2<br />
Semester belegt werden. Online-Anmeldung über http://biomed4.kf.tu-berlin.de/stuma/<br />
erforderlich!<br />
Technologietransfer und Internationales<br />
Seminar Mensch-Maschine-Systeme<br />
0532 L 069, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 12:00 - 14:00, 17.04.2013 - 10.07.2013, MAR 3.025<br />
Inhalt Das Seminar gibt den Teilnehmer/innen einen Überblick über aktuelle Forschung im<br />
Bereich Mensch-Maschine-Systemtechnik. Dabei sind insbesondere die Behandlung von<br />
Gestaltungskriterien und Anforderungen sowohl aus ingenieurswissenschaftlicher als<br />
auch aus humanwissenschaftlicher Perspektive Gegenstand der Lehrveranstaltung. Für<br />
die Teilnahme ist eine Anmeldung bis eine Woche vor Vorlesungsbeginn über die Web-<br />
Seiten des FG MMS notwendig (http://www.mms.tu-berlin.de/lehre_mms_se.html).<br />
SoSe 2013 47
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Geschichte der Automobilindustrie II<br />
0533 L 575, Integrierte LV (VL mit UE), 2.0 SWS<br />
Mo, 14tägl, 14:00 - 18:00, 08.04.2013 - 01.07.2013, TIB13 -336 , Sievers<br />
Inhalt Fußend auf Kurs I soll in dieser Veranstaltung die Entwicklung der europäischen<br />
Automobilindustrie von ihren Anfängen bis in unsere Zeit anhand ausgewählter Beispiele<br />
dargestellt werden: Der Wandel vom Handwerk hin zur industriellen Fertigung sowohl<br />
der Automobil- als auch der Motorrad- und Nutzfahrzeughersteller wird dabei genauso<br />
berücksichtigt wie der frühe Informationsfluß zwischen Wissenschaft und Industrie. Es<br />
werden Exkursionen angeboten.<br />
Bemerkung Jeweils montags, 14:00-18:00 Uhr (in der Regel 14-täglich)<br />
Termine:<br />
08.04.2013<br />
22.04.2013<br />
06.05.2013<br />
24.05.2013 Exkursion: 14:30 Uhr, BMW-Werk<br />
27.05.2013 entfällt!<br />
03.06.2013, ab 15:00 Uhr !<br />
10.06.2013 Exkursion: 14:00 Uhr, Depot Technik-Museum Schöneberg<br />
24.06.2013<br />
Der Termin für die im Sommersemster vorgesehene Exkursion (zum BMW-Werk in<br />
Spandau) wird zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle bekanntgegeben.<br />
Wissenschaft und Gesellschaft<br />
Geschichte der Entwicklung des Computers<br />
0434 L 390, Seminar, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 12:00 - 14:00, 12.04.2013 - 27.06.2013, MAR 0.010 , Zuse<br />
Fr, Einzel, 12:00 - 14:00, 28.06.2013 - 28.06.2013, H 3013<br />
Fr, wöchentl, 12:00 - 14:00, 05.07.2013 - 13.07.2013, MAR 0.010<br />
Inhalt Es hat vieler hervorragender Wissenschaftler, Ingenieure und Manager bedurft, den<br />
heutigen Computer bzw. den PC zu konstruieren und zu der heutigen Verbreitung zu<br />
verhelfen.<br />
In dem Seminar wird die spannende Geschichte der Entwicklung des Computers,<br />
der Software, der industriellen Entwicklung und der gesellschaftlichen Implikationen<br />
behandelt. Es ist ein Vortrag zu halten und eine ca. 10-15-seitige Ausarbeitung<br />
abzuliefern.<br />
Bemerkung anrechenbar im Wahlfach außerhalb der Informatik<br />
Survey Methodology I: Fragebogenkonstruktion (anrechenbar auf BA 15)<br />
06371600 L 42, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 08.04.2013 - 01.07.2013, FH 301 , Dziamski, Merkel, Post, Sezgin<br />
Mi, wöchentl, 14:00 - 16:00, 10.04.2013 - 03.07.2013, FH 313 , Dziamski, Merkel, Post, Sezgin<br />
Bemerkung Anmeldung erforderlich, Näheres siehe "Voraussetzungen".<br />
Nachweis Prüfungsäquivalente Studienleistungen<br />
Voraussetzung Voraussetzung für die Teilnahme:<br />
* Anmeldung bis zum 14.10.2008, Näheres siehe Link "Anmeldung"<br />
* regelmäßige und aktive Teilnahme an den Sitzungen<br />
* genügende Bearbeitung und rechtzeitige Abgabe von in der Veranstaltung gestellten<br />
Aufgaben<br />
* sorgfältige Vorbereitung auf Sitzungen<br />
* im Fall von Gruppenarbeit: aktive und eigenverantwortliche Mitarbeit in den Gruppen<br />
Kolloquium: Methoden der empirischen Sozialforschung<br />
06371600 L 99, Colloquium, 1.0 SWS<br />
SoSe 2013 48
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Sa, Einzel, 09:00 - 18:00, 27.04.2013 - 27.04.2013, FH 919<br />
Inhalt siehe Modulbeschreibung<br />
Bemerkung Anmeldung per E-Mail (rim.aouini@tu-berlin.de) erforderlich. Nähres siehe<br />
Modulbeschreibung.<br />
Nachweis siehe Modulbeschreibung<br />
Voraussetzung siehe Modulbeschreibung<br />
Literatur siehe ISIS<br />
Wissenschaft und Technik im alten China<br />
3130 L 206, Proseminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.068 , Sternfeld<br />
Inhalt In dieser Einführungsveranstaltung wird ein Überblick über die wichtigsten<br />
philosophischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen im<br />
traditionellen China vermittelt.<br />
Bemerkung BA-KulT Wahlbereich: BA China 2<br />
BA-KulT WTG 2, 3, 4<br />
MA-GKWT 1/1<br />
Masterstudiengänge: Freie Profilbildung<br />
Der Holocaust im Film<br />
3151 L 001, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 12:00 - 14:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Schüler-Springorum<br />
Inhalt Der Holocaust sei nicht darstellbar – dies wird immer wieder verkündet, obgleich der<br />
deutsche Massenmord an den europäischen Juden seit Kriegsende Thema filmischer<br />
Darstellung geworden ist. In der vierstündigen Veranstaltung werden wir uns anhand<br />
ausgewählter Beispiele mit der Geschichte des Holocaust im Film auseinandersetzen. Im<br />
Zentrum stehen dabei die theoretische Reflexion, die Analyse konjunktureller „Moden“<br />
sowie die Rezeption der Filme in der Öffentlichkeit und in der Fachwissenschaft.<br />
Grundlegende Kenntnisse zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust<br />
werden vorausgesetzt.<br />
Bemerkung Es handelt sich um eine vierstündige Doppelveranstaltung (Vorlesung und Seminar).<br />
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung erforderlich unter: tobias.unger@mail.tuberlin.de<br />
Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 2, BA-KulT Wahlbereich<br />
Es wird die Lernplattform ISIS genutzt: www.isis.tu-berlin.de<br />
Nachweis Regelmäßige Teilnahme, Übernahme eines Referats und schriftliche Hausarbeit<br />
Literatur Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung, Zur visuellen Konstruktion des<br />
Judentums. Frankfurt am Main 1992.<br />
Peter Reichel: Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater,<br />
München 2004.<br />
Geschichte des Antisemitismus von 1870-1945<br />
3151 L 002, Vorlesung, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, BH-N 243 , Bergmann<br />
Inhalt Die VL wird die Entstehung des modernen Antisemitismus im letzten Drittel des 19.<br />
Jahrhunderts und seine Entwicklung bis zum Holocaust behandeln. Dies wird in Form<br />
einer vergleichenden Betrachtung wichtiger europäischer Gesellschaften geschehen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlmoduls "Vorurteilsforschung II" in den BA "Kultur und Technik"-<br />
Studiengängen<br />
SoSe 2013 49
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
Der Holocaust im Film<br />
3151 L 010, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 14:00 - 16:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Schüler-Springorum<br />
Inhalt Der Holocaust sei nicht darstellbar – dies wird immer wieder verkündet, obgleich der<br />
deutsche Massenmord an den europäischen Juden seit Kriegsende Thema filmischer<br />
Darstellung geworden ist. In der vierstündigen Veranstaltung werden wir uns anhand<br />
ausgewählter Beispiele mit der Geschichte des Holocaust im Film auseinandersetzen. Im<br />
Zentrum stehen dabei die theoretische Reflexion, die Analyse konjunktureller „Moden“<br />
sowie die Rezeption der Filme in der Öffentlichkeit und in der Fachwissenschaft.<br />
Grundlegende Kenntnisse zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust<br />
werden vorausgesetzt.<br />
Bemerkung Es handelt sich um eine vierstündige Doppelveranstaltung (Vorlesung und Seminar).<br />
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Anmeldung erforderlich unter: tobias.unger@mail.tuberlin.de<br />
Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT Wahlbereich<br />
Es wird die Lernplattform ISIS genutzt: www.isis.tu-berlin.de<br />
Nachweis Regelmäßige Teilnahme, Übernahme eines Referats und schriftliche Hausarbeit<br />
Literatur Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung, Zur visuellen Konstruktion des<br />
Judentums. Frankfurt am Main 1992.<br />
Peter Reichel: Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater,<br />
München 2004.<br />
Namenpolitik – Die Umbenennung von Straßen<br />
3151 L 011, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 16:00 - 18:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Straßennamen bilden eine Art historisches Gedächtnis. Politische Systemwechsel wie<br />
auch historische Lernprozesse schlagen sich in der Umbenennung von Straßen und<br />
Plätzen nieder. Diese Praxis und die dabei zu Tage tretenden Konflikte sind Gegenstand<br />
des SE.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
NS-Täterforschung<br />
3151 L 012, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 14:00 - 16:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Gegenstand des SE ist die ältere und neuere interdisziplinäre Täterforschung,<br />
die sich mit dem Verhältnis von persönlichen Dispositionen, Handlungssituationen,<br />
normativen Rahmenbedingungen und ideologischen Prägungen für Teilnahme an NS-<br />
Gewaltverbrechen beschäftigt.<br />
Bemerkung Module: BA-KulT IS 2, BA-KulT – IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich, Modul: Vorurteilsforschung<br />
SoSe 2013 50
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Literatur Klaus Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hrsg.), Karrieren der Gewalt.<br />
Nationalsozialistische Täterbiographie, Darmstadt 2004.<br />
Christian Gerlach (Hrsg.), Durchschnittstäter. Handeln und Motivation, <strong>Berlin</strong> 2000.<br />
Gerhard Paul (Hrsg.), Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz<br />
normale Deutsche? Göttingen 2002.<br />
Christopher Browning, Judenmord. NS-Politik, Zwangsarbeit und das Verhalten der<br />
Täter, Frankfurt a. M. 2001.<br />
Nation-Building und Nationalismus<br />
3151 L 013, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 16:00 - 18:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Bergmann<br />
Inhalt Thema des SE ist die neuere Forschung zu Nationenbildung und Nationalismus.<br />
Dabei werden ihre grundlegenden Konzepte vorgestellt und an konkreten historischen<br />
Fallanalysen exemplifiziert.<br />
Bemerkung Modul: BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen<br />
Konzepts, Frankfurt a.M.(New York 2/1993.<br />
Christian Jansen/Henning Borggräfe, Nation, Nationalität, Nationalismus, Frankfurt a.<br />
M. 2007.<br />
Antisemitismus ausstellen. Stategien und Paradoxien visueller Kommunikation des Antisemitismus<br />
3151 L 032, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 10:00 - 12:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Enzenbach, Funck<br />
Inhalt Ausstellungen sind Orte, welche jenseits von Moralisierung und Skandalisierung<br />
die Chance zur öffentlichen Auseinandersetzung mit Antisemitismus bieten. Wer<br />
jedoch Antisemitismus öffentlich auszustellen gedenkt, steht vor mehrfachen<br />
Herausforderungen, insbesondere der Frage, wie man vermeidet, selbst Teil<br />
einer antisemitischen Kommunikationsstruktur zu werden, indem man – auch<br />
in kritischer Absicht – antisemitische Bilder und Zeichen reproduziert. Das<br />
Zentrum für Antisemitismusforschung plant ein Ausstellungsprojekt zu Alltagskulturen<br />
des Antisemitismus. In diesem Seminar werden theoretische Überlegungen zu<br />
diesem Projekt diskutiert und den Teilnehmern ggf. eine aktive Mitarbeit in<br />
dem Ausstellungsprojekt ermöglicht. Neben den theoretischen und methodischen<br />
Grundfragen der Visualisierung von Antisemitismus behandeln wir museumstheoretische<br />
und ausstellungspraktische Fragen, die in begleitenden Exkursionen vertieft werden.<br />
Auch die Arbeit am und mit dem Objekt wird Gegenstand des Seminars sein und in<br />
eigenständige Beiträge der Teilnehmer münden.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 3<br />
Voraussetzung Voraussetzung für die Teilnahme sind die Bereitschaft zur kontinuierlichen Mitarbeit<br />
und die Teilnahme an zusätzlichen Veranstaltungen (Exkursionen) auch außerhalb des<br />
Seminarraums.<br />
Literatur Anke te Heesen: Theorien des Museums zur Einführung, Hamburg 2012.<br />
Gottfried Korff: Museumsdinge. Deponieren - exponieren. Hrsg. von Martina<br />
Eberspächer, Gudrun Marlene König, Bernhard Tschofen, Köln/Weimar/Wien 2002.<br />
SoSe 2013 51
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Klamper, Elisabeth: Jüdisches Museum, Wien: Die Macht der Bilder. Antisemitische<br />
Vorurteile und Mythen, Wien 1995.<br />
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,<br />
in: Gesammelte Schriften Band I, Werkausgabe Band 2, hrsg. von Rolf Tiedemann und<br />
Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980, S. 471–508.<br />
Vergangenheitspolitik, Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik<br />
3151 L 034, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 11.04.2013 - 11.07.2013, TEL 811 , Kohlstruck<br />
Inhalt Erinnerungspolitik und sinnverwandte Bezeichnungen sind in den letzten Jahren zu<br />
häufig gebrauchten Vokabeln geworden, mit denen sich unterschiedliche Konzepte<br />
verbinden: Erinnerungspolitik kann als eigenes Politikfeld verstanden werden,<br />
Erinnerungspolitik kann die Befassung mit verbrecherischen Phasen der kollektiven<br />
Geschichte meinen und/ oder ein essentielles Moment in Prozessen politischen<br />
Systemwechsels sowie die fallweise Instrumentalisierung jedweden vergangenen<br />
Ereignisses für aktuelle politische Zwecke.<br />
Im Seminar werden verschiedene Konzepte und ihre Tauglichkeit zur Beschreibung und<br />
Erklärung von erinnerungspolitischen Phänomenen behandelt.<br />
Das endgültige Programm der Lehrveranstaltung wird in den ersten beiden Sitzungen<br />
diskutiert und festgelegt. Die Studierenden haben somit die Möglichkeit, ihre<br />
Themenwünsche einzubringen.<br />
Die Lehrveranstaltung wird die Lernplattform ISIS verwenden, Teilnehmer der<br />
Lehrveranstaltung müssen über eine Zugangsberechtigung verfügen. Zu den<br />
Teilnahmevoraussetzungen gehört die Bereitschaft, ein Referat zu übernehmen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Wahlpflichtmoduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur<br />
und Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 2, BA-KulT Wahlbereich<br />
Sprechstunde: Donnerstag, 14-16 Uhr (nach Voranmeldung)<br />
Literatur Edgar Wolfrum: Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung,<br />
Göttingen 2001<br />
Horst-Alfred Heinrich, Michael Kohlstruck (Hg.): Geschichtspolitik und<br />
sozialwissenschaftliche Theorie, Stuttgart 2008<br />
Harald Schmid (Hg.): Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Erinnerungskulturen<br />
in Theorie und Praxis, Göttingen 2009<br />
Jahrbuch für Kulturpolitik 9 (2009), Themenschwerpunkt: Erinnerungskulturen und<br />
Geschichtspolitik<br />
Jahrbuch für Politik und Geschichte (2010ff.)<br />
„Kriegsgewalt“ - Sprachliche und bildliche Darstellung militärischer Gewalt im 19. und 20.<br />
Jahrhundert.<br />
3151 L 036, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 08.04.2013 - 08.07.2013, TEL 811 , Erb<br />
Inhalt Wie wird der Krieg in Literatur, Kunst und Wissenschaft wahrgenommen, dargestellt und<br />
in Museen ausgestellt? Das Seminar konzentriert sich auf militärische Gewalt, seiner<br />
sprachlichen und visuellen Repräsentation um dann die gesellschaftlichen, staatlichen<br />
und politischen Veränderungen in den Blick zu nehmen.<br />
Bemerkung Bestandteil des Moduls "Wahrnehmung und Weltbilder" in den B. A. "Kultur und<br />
Technik"-Studiengängen, BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 4, BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Lit.: Schlachtfelder. Codierung von Gewalt im medialen Wandel, hrsg. von Steffen<br />
Martus, Marina Münkler und Werner Röcke, <strong>Berlin</strong> 2003.<br />
„Der Gelbe Stern“. Die Kennzeichnung von Juden durch das NS-Regime<br />
3151 L 038, Seminar, 2.0 SWS<br />
SoSe 2013 52
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Di, wöchentl, 16:00 - 18:00, 09.04.2013 - 09.07.2013, TEL 811 , Dörner<br />
Inhalt Die Kennzeichnung von „Nichtariern“ und ihres Eigentums erfolgte während der NS-Zeit<br />
ab 1938 in mehreren Schritten. Seit dem 19. September 1941 mussten in Deutschland<br />
Jüdinnen und Juden ab dem Alter von 6 Jahren einen handtellergroßen gelben Davidstern<br />
sichtbar auf ihrer Kleidung tragen. Sie sollten im Vorfeld der reichsweiten Deportationen<br />
öffentlich erkennbar sein.<br />
In der Lehrveranstaltung soll der Prozess der Stigmatisierung der jüdischen Minderheit<br />
historisch untersucht werden. Dabei steht die Analyse der psychischen und sozialen<br />
Auswirkungen für die Betroffenen sowie der gesellschaftlichen Reaktionen im<br />
Vordergrund. Historische Quellen unterschiedlicher Provenienz (geheime Lageberichte,<br />
Tagebücher, Briefe, Fotographien etc.) werden hierbei ausgewertet. Die Befragung von<br />
Zeugen der nationalsozialistischen Herrschaft soll die Quellenanalyse ergänzen und<br />
vertiefen.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 3, BA-KulT IS 2<br />
BA-KulT Wahlbereich<br />
Literatur Konrad Kwiet: Nach dem Pogrom. Stufen der Ausgrenzung, in: Wolfgang Benz (Hg.):<br />
Die Juden in Deutschland 1933-1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft,<br />
München 1988, S. 614-631.<br />
Jens J. Scheiner: Vom gelben Flicken zum Judenstern? Genese und Applikation von<br />
Judenabzeichen im Islam und christlichen Europa (849-1941), Frankfurt a.M u.a. 2004.<br />
Otto Dov Kulka/Eberhard Jäckel (Hg): Die Juden in den geheimen NS-<br />
Stimmungsberichten 1933-1945, Düsseldorf 2004 (plus CD-ROM).<br />
Saul Friedländer: Die Jahre der Vernichtung. Das Dritte Reich und die Juden, Bd. 2:<br />
1939-1945, München 2006.<br />
Peter Longerich: „Davon haben wir nichts gewusst!“ Die Deutschen und die<br />
Judenverfolgung 1933-1945, München 2006.<br />
Forschungskolloquium<br />
3151 L 040, Forschungscolloquium, 2.0 SWS<br />
Mi, wöchentl, 18:00 - 20:00, 10.04.2013 - 10.07.2013, TEL 811 , Bergmann, Funck, Kohlstruck, Schüler-<br />
Springorum<br />
Inhalt Die Veranstaltung steht ohne Anmeldung allen wissenschaftlich Interessierten -<br />
unabhängig von einer Hochschulzugehörigkeit - offen, auch zum Besuch einzelner<br />
Termine. Bitte beachten Sie wegen eventueller Programmänderungen die Homepage<br />
des Instituts:<br />
http://www.tu-berlin.de/fakultaet_i/zentrum_fuer_antisemitismusforschung<br />
10.4.2013<br />
Evelyn Annuß, Bochum<br />
(An-)Ästhetisierung des Politischen? Zum Formwandel des nationalsozialistischen<br />
Massentheaters<br />
17.4.2013<br />
Tobias Kühne, <strong>Berlin</strong><br />
Das Netzwerk "Neu Beginnen" und die <strong>Berlin</strong>er SPD nach 1945<br />
SoSe 2013 53
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
24.4.2013<br />
Katharina Erbe, <strong>Berlin</strong><br />
Rebellin, Heldin, Geisteskranke. Die jüdische Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim und<br />
ihr Kampf gegen den Mädchenhandel<br />
8.5.2013<br />
(Bitte beachten Sie die veränderte Uhrzeit: 16:00-18:00)<br />
Péter Bihari, Budapest<br />
Systemwandel und die Juden im Ungarn des 20. Jahrhunderts (Vortrag in englischer<br />
Sprache)<br />
15.5.2013<br />
Mathias Berek, Leipzig/Tel Aviv<br />
Preußisch-jüdisches Deutschland. Der Protosoziologe Lazarus im 19. Jahrhundert<br />
22.5.013<br />
Alexandra Klei, <strong>Berlin</strong><br />
Ort - Ereignis - Erinnerung. Topographie und Architektur ehemaliger Konzentrationslager<br />
im Wandel<br />
29.5.2013<br />
Juliane Michael, Göttingen<br />
Osteuropäisch-jüdische Migranten in der <strong>Berlin</strong>er Unterhaltungskunst der 1920er- und<br />
1930er-Jahre<br />
5.6.2013<br />
Jennifer Steuer, Mannheim<br />
Günter Grass: „Was gesagt werden muss“ – literaturwissenschaftliche und politische<br />
Reaktionen<br />
12.6.2013<br />
Sina Arnold, <strong>Berlin</strong><br />
Antisemitismusdiskurse in der gegenwärtigen US-amerikanischen Linken<br />
19.6.2013<br />
Henning Fauser, Paris/Halle-Wittenberg<br />
Deutschlandbilder ehemaliger französischer KZ-Häftlinge<br />
26.6.2013<br />
Fabian Virchow, Düsseldorf<br />
Verbote rechtsextremer Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland 1951 bis 2011<br />
3.7.2013<br />
Lida Barner, London/<strong>Berlin</strong><br />
„Jüdische Patente sind zu arisieren“. Geistiges Eigentum von Juden im<br />
Nationalsozialismus<br />
10.7.2013<br />
Marcin Siadkowski, Warschau<br />
SoSe 2013 54
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Die Emigration polnischer Juden und die internationale Politik zwischen 1918 und 1945<br />
(Vortrag in englischer Sprache)<br />
Gender in neuen Welten. Frühneuzeitliche Geschlechterkonstruktionen und außereuropäische<br />
Räume.<br />
3152 L 014, Seminar, 2.0 SWS<br />
wöchentl<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 19.04.2013 - 19.04.2013, MAR 4.062 , Gleixner<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 26.04.2013 - 26.04.2013, MAR 4.062 , Gleixner<br />
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 03.05.2013 - 03.05.2013, MAR 4.062 , Gleixner<br />
Inhalt Auch in der Frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert) werden außereuropäische<br />
Räume mit Geschlechterbildern verbunden und durch diese visualisiert wie<br />
konzipiert. Beispielsweise werden auf Landkarten Bewohnerinnen und Bewohner<br />
außereuropäischer Kontinente nicht selten über Nacktheit definiert und erkennbar<br />
gemacht. Das Seminar möchte an Hand von Originalquellen des 16.-18. Jahrhunderts<br />
den vielfältigen Verbindungen von Geschlechterkonstruktionen und außereuropäischen,<br />
kolonialen Räumen nachgehen. Dafür sollen sowohl bildliche als auch textuelle<br />
Darstellungen mit mit Hilfe eines kulturwissenschaftlichen Ansatzes interpretiert werden.<br />
Zu Beginn werden drei Freitagstermine an der <strong>TU</strong> (19.4., 26.4., 3.5.) in die Thematik<br />
einführen und dazu eine gemeinsame Lektüregrundlage geschaffen. Vom 13.5.bis 15.5.<br />
findet das Blockseminar an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel statt. Die<br />
Herzog August Bibliothek ist eine außeruniversitäre Forschungs- und Studienstätte<br />
für die europäische Kulturgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Die<br />
historischen Bestände der Bibliothek bilden ein in Breite und Tiefe einzigartiges Archiv<br />
des europäischen Wissens in seinen weltweiten Bezügen.<br />
Die Kosten für zwei Übernachtungen (2 Nächte mit Frühstück=40 EUR) in Wolfenbüttel<br />
sowie Hin- und Rückfahrt müssen vermutlich von den Teilnehmenden getragen werden.<br />
Bemerkung MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
Labore der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung: Welche Rolle spielt „Geschlecht“ in<br />
Experiment und Gestaltung?<br />
3152 L 015, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 10:00 - 12:00, 18.04.2013 - 10.07.2013, MAR 2.013<br />
Inhalt Seit Ende der 1970er Jahre wird in der Wissenschaftsforschung der epistemologische<br />
Status des Experiments beginnend mit ethnographisch geschulten Laborstudien (Knorr<br />
Cetina 1981) und in praxisorientierten Arbeiten (Latour/Woolgar 1986) untersucht.<br />
Verschiedene Autor_innen konnten aufzeigen, dass dem Experiment entgegen<br />
dem bisherigen Verständnis eine eigenständige, schöpferische und generierende<br />
Rolle zukommt (Heidelberger/Steinle 1998). „Experimente kombinieren künstliche<br />
und natürliche, technische und wissenschaftliche, materielle und immaterielle<br />
Dinge“ (Schmidgen u.a. 2004:8) und bringen in diesem Prozess das Undefinierte und das<br />
Noch-nicht-Sichtbare als epistemisches Objekt hervor.<br />
Für uns stellt sich die Frage, welche Rolle dem Experiment bei der Konstruktion<br />
von Geschlecht zukommt. Wie wird die Differenz zwischen männlich und weiblich<br />
experimentell bzw. gestalterisch hergestellt, und wie wird das experimentell produzierte<br />
Wissen über Geschlecht stabilisiert? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Laborund<br />
experimentellen Anordnungen über die Disziplinen hinweg und wie wandeln sie sich<br />
in Abhängigkeit dessen, was disziplinär als Repräsentation von Geschlecht gilt?<br />
In dieser Veranstaltung werden wir mittels teilnehmender Beobachtung verschiedene<br />
natur- und technikwissenschaftliche Labore an der <strong>TU</strong> <strong>Berlin</strong> in den Blick nehmen, um<br />
diesen Fragen nachzugehen.<br />
SoSe 2013 55
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Bemerkung BA-KulT IS 2<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
Diese LV kann als Vertiefungsmodul des Studienprogramm Gender Pro Mint belegt<br />
werden.<br />
Voraussetzung Eine einführende Veranstaltung zu den Gender Studies.<br />
Literatur Literaturhinweise:<br />
Beaufaÿs, Sandra / Krais, Beate (2005): "Doing Science – Doing Gender. Die<br />
Produktion von WissenschaftlerInnen und die Reproduktion von Machtverhältnissen im<br />
wissenschaftlichen Feld." In: Feministische Studien , 1/2005. S. 82 - 99.<br />
Heintz, Bettina / Merz, Martina / Schumacher, Christina (2004): Wissenschaft, die<br />
Grenzen schafft. Geschlechterkonstellationen im disziplinären Vergleich . Reihe<br />
Sozialtheorie. Bielefeld; Transcript. (Zur vorbereitenden Lektüre insbesondere<br />
empfohlen: S. 40 - 76.)<br />
Traweek, Sharon (1988): Beamtimes and Lifetimes . Cambridge MA/London: Harvard<br />
University Press. (Zur vorbereitenden Lektüre insbesondere empfohlen: S. 46 - 73.)<br />
Das Normale und das Pathologische<br />
3152 L 016, Hauptseminar, 2.0 SWS<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 07.06.2013 - 07.06.2013, MAR 0.007<br />
Sa, Einzel, 12:00 - 16:00, 08.06.2013 - 08.06.2013, MAR 0.007<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 14.06.2013 - 14.06.2013, MAR 4.064<br />
Sa, Einzel, 12:00 - 16:00, 15.06.2013 - 15.06.2013, MAR 2.068<br />
Fr, Einzel, 14:00 - 18:00, 21.06.2013 - 21.06.2013, MAR 2.068<br />
Inhalt Die Unterscheidung zwischen dem Normalen und dem Pathologischen bildet die<br />
Grundlage medizinischer Diagnostik. Die Kriterien, unter denen etwas für normal oder<br />
pathologisch erklärt wird, entstammen jedoch nicht der Institution der Medizin allein,<br />
vielmehr lassen sich keine scharfen Grenzen zwischen medizinischen, biologischen und<br />
sozialen Normen ziehen. Zudem entfalten Definitionen von Normen und Pathologien eine<br />
gesellschaftliche Relevanz über den Horizont der Medizin und Biologie hinaus und sind<br />
nicht selten politisch umkämpft.<br />
Der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem hat sich diesen und<br />
anderen Problemen in seinem bekanntesten und nun in neuer Übersetzung vorliegenden<br />
Werk „Das Normale und das Pathologische“ gewidmet und dabei Fragen aufgeworfen,<br />
die bis heute aktuell sind: Wie ist das Verhältnis von medizinischer und sozialer Norm?<br />
Ist das Pathologische schlicht eine Abweichung von der Norm? Ist Gesundheit zugleich<br />
das Normale? Kann es mehrere Normen geben? Inwieweit fungiert die Medizin als eine<br />
Technik zur Herstellung von Normalität?<br />
In dem Lektüreseminar wollen wir in einem ersten Teil Auszüge aus Canguilhems Werk<br />
lesen und auf seine Aktualität hinsichtlich gegenwärtiger Formen von medizinischer<br />
Diagnostik und sozialer Normierung befragen. In einem zweiten Teil betrachten wir<br />
aktuelle Rezeptionslinien im Anschluss an Canguilhem und diskutieren die methodische<br />
und theoretische Bedeutung seiner Arbeiten u.a. für die kritische Wissenschaftsforschung<br />
und Medizingeschichte, die Gender Studies und die Disability Studies.<br />
SoSe 2013 56
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Voranmeldung bis zum 10.04.2013<br />
per E-Mail an: mike.laufenberg@tu-berlin.de<br />
Der 1. Termin findet am 19.April 2013 um 12 Uhr in Raum MAR 0.011 statt.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 5<br />
Gender & Diversity in der Gestaltung von Forschungsprojekten und Technologien<br />
3152 L 017, Projektkurs, 2.0 SWS<br />
Fr, wöchentl, 09:00 - 12:00, 19.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Lucht<br />
Inhalt Das Abschlussprojekt ist ein Angebot für alle Studierenden, die ihre natur- oder<br />
ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit (BA/MA/Promotion) um Perspektiven der<br />
Gender Studies erweitern möchten.<br />
Die Lehrveranstaltung bietet die Möglichkeit,<br />
- eine natur- oder ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit (BA/MA/Promotion) in<br />
verschiedenen Stadien zu präsentieren und aus Perspektiven der Gender Studies zu<br />
reflektieren<br />
- zu klären, welche spezifischen Theorien, Kenntnisse und Methoden der Gender Studies<br />
relevant sind für eine Reflektion der Abschlussarbeit im Fachstudium – und diese<br />
individuell oder in der Gruppe zu erarbeiten,<br />
- gemeinsam zu erproben, wie relevante Theorien, Kenntnisse und Methoden der Gender<br />
Studies auf die Abschlussarbeit im Fachstudium übertragen werden können,<br />
- sich über Erfahrungen und ggf. Probleme des interdisziplinären Arbeitens<br />
auszutauschen, die bei diesen Vorhaben entstehen.<br />
Die Ergebnisse der Abschlussprojekte für das Zertifikat „Gender Pro Mint“ können auf<br />
einem Projekttag zum Ende des Semesters der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt<br />
werden.<br />
Bemerkung Lehrveranstaltung des Studieprogramm Gender Pro Mint<br />
Clubtag Techno-Club<br />
Die Lehrveranstaltung findet im Raum MAR 2.009 statt!<br />
3152 L 020, Projektintegr. Veranstaltung, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 16:00 - 20:00, 02.04.2013 - 30.09.2013, MAR 2.069 , Greusing<br />
Do, Einzel, 16:00 - 19:00, 23.05.2013 - 23.05.2013, MAR 0.001<br />
Mi, Einzel, 16:00 - 18:00, 12.06.2013 - 12.06.2013, MAR 2.071<br />
Fr, Einzel, 09:00 - 15:00, 12.07.2013 - 12.07.2013, MAR 2.072<br />
Di, Einzel, 14:00 - 20:00, 03.09.2013 - 03.09.2013, MAR 2.068<br />
Di, Einzel, 14:00 - 20:00, 03.09.2013 - 03.09.2013, MAR 2.071<br />
Inhalt An den Clubtagen, wie zum Beispiel dem Perspektivencafé, treffen sich die Schülerinnen<br />
AGs des Techno-Clubs. Zum Perspektivencafé sind Studentinnen aller Studiengänge<br />
herzlich eingeladen. Hier können sich Schülerinnen, Studentinnen, Ingenieurinnen<br />
und Naturwissenschaftlerinnen treffen, Kontakte knüpfen und über Berufsperspektiven<br />
austauschen. Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit von Ingenieurinnen und<br />
Naturwissenschaftlerinnen aus erster Hand aus ihrem Berufsalltag zu erfahren.<br />
Bemerkung Der Semesterauftakt findet am 19. März 2013 um 16.00 Uhr statt.<br />
SoSe 2013 57
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Gender und Organisation<br />
3152 L 022, Seminar, 2.0 SWS<br />
Mo, wöchentl, 12:00 - 14:00, 08.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Meißner<br />
Mo, Einzel, 12:00 - 14:00, 24.06.2013 - 24.06.2013, MAR 2.069<br />
Inhalt In kritischer Auseinandersetzung mit Auffassungen, dass die Geschlechtszugehörigkeit<br />
von Mitgliedern in Organisationen eigentlich irrelevant sei, hat die Frauen- und<br />
Geschlechterforschung darauf aufmerksam gemacht, dass Organisationen in ihrer<br />
Eingebundenheit in den gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden müssen, dass<br />
die Kategorie Geschlecht in Strukturen und Abläufen von Organisationen eingelassen<br />
ist und dass dadurch systematisch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen<br />
reproduziert werden. In diesem Seminar werden theoretische Perspektiven und<br />
empirische Untersuchungen zum Zusammenhang von Organisation und Geschlecht<br />
diskutiert. Anknüpfend an Debatten um Intersektionalität wird außerdem danach gefragt,<br />
wie neben Geschlecht auch andere soziale Kategorien in Organisationsstrukturen und<br />
-abläufen eingelassen sind. Mögliche Eingriffs- und Gestaltungsspielräume werden<br />
anhand der Konzepte von Gender Mainstreaming und Managing Diversity beleuchtet.<br />
Bemerkung MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies) (Freie Profilbildung)<br />
MA-BIWI 7b (Bildungswissenschaft: Gender und Organisation)<br />
Re-Lektüren: Feministische Theorie<br />
3152 L 024, Seminar, 2.0 SWS<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Do, wöchentl, 12:00 - 14:00, 27.06.2013 - 27.06.2013<br />
Inhalt In dieser Lehrveranstaltung lesen und erarbeiten wir gemeinsam thematisch gebündelte,<br />
aktuelle und immer noch zeitgemäße Beiträge zur feministischen Theorie. Große<br />
Bereitschaft zu intensiver Lektüre ist Teilnahmevoraussetzung.<br />
Bemerkung BA ab 2. Studienjahr / MA / Postgradual<br />
BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 4<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
Voraussetzung Große Bereitschaft zu intensiver Lektüre ist Teilnahmevoraussetzung.<br />
Was Sie schon immer über Geschlecht wissen wollten ... und nie zu fragen wagten: Einführung in die<br />
Gender Studies<br />
3152 L 025, Seminar, 2.0 SWS<br />
Di, wöchentl, 12:00 - 14:00, 16.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Mo, Einzel, 16:00 - 18:00, 13.05.2013 - 13.05.2013, MAR 2.068<br />
Inhalt Gender Studies fragen nach der Bedeutung von Geschlecht in Wissenschaft und<br />
Gesellschaft. Sie rücken die Kategorie Geschlecht in verschiedenen Bereichen<br />
(z. B. Arbeit, Technik, Organisationen, Politik) ins Zentrum ihrer Analysen.<br />
Gender Studies zeigen, wie sich Geschlechterverhältnisse historisch entwickelten<br />
und veränderten. Im Seminar werden theoretische, soziologische, methodische<br />
und historiographische Konzepte der Geschlechterforschung vorgestellt und an<br />
exemplarischen Gegenstandsfeldern diskutiert.<br />
Diese Lehrveranstaltung ist geeignet für Studierende aller Fächer und Studiengänge, die<br />
noch keine Kenntnisse in Frauen- und Geschlechterforschung haben.<br />
Bemerkung BA-KulT IS 2, BA-KulT IS 3<br />
BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies) (Freie Profilbildung)<br />
MA-BIWI 7b (Bildungswissenschaft: Gender und Organisation)<br />
Transdisziplinäre Geschlechterstudien<br />
3152 L 026, Colloquium, 3.0 SWS<br />
SoSe 2013 58
<strong>Fachübergreifendes</strong> <strong>Studium</strong><br />
Do, wöchentl, 16:00 - 19:00, 18.04.2013 - 13.07.2013, MAR 2.013 , Hark<br />
Do, Einzel, 16:00 - 19:00, 27.06.2013 - 27.06.2013<br />
Inhalt Das Colloquium bietet die Möglichkeit, Dissertationen sowie Examensarbeiten (Magister/<br />
Magistra, Diplom, Staatsexamen, BA) im transdisziplinären Feld der Frauen- und<br />
Geschlechterforschung vorzustellen und zu diskutieren. Teilnahme nur nach persönlicher<br />
Anmeldung möglich.<br />
Bemerkung BA-KulT FW 18 (Gender Studies)<br />
MA-ZIFG FP 16 (Gender Studies)<br />
SoSe 2013 59