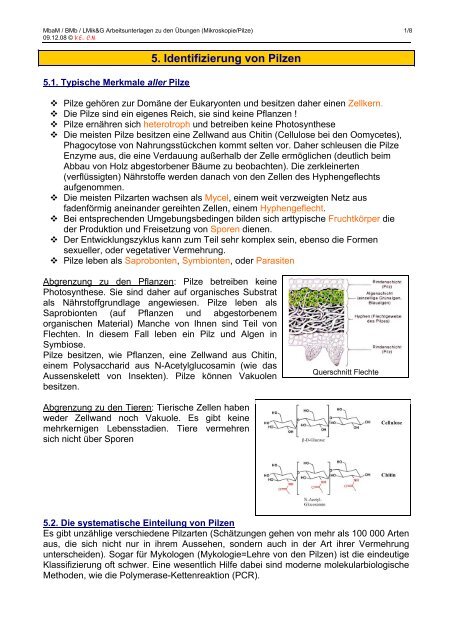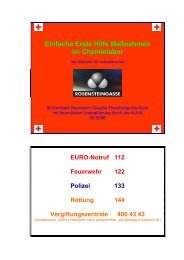5.Charakterisierung von Pilzen - member
5.Charakterisierung von Pilzen - member
5.Charakterisierung von Pilzen - member
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 1/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
5.1. Typische Merkmale aller Pilze<br />
5. Identifizierung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong><br />
Pilze gehören zur Domäne der Eukaryonten und besitzen daher einen Zellkern.<br />
Die Pilze sind ein eigenes Reich, sie sind keine Pflanzen !<br />
Pilze ernähren sich heterotroph und betreiben keine Photosynthese<br />
Die meisten Pilze besitzen eine Zellwand aus Chitin (Cellulose bei den Oomycetes),<br />
Phagocytose <strong>von</strong> Nahrungsstückchen kommt selten vor. Daher schleusen die Pilze<br />
Enzyme aus, die eine Verdauung außerhalb der Zelle ermöglichen (deutlich beim<br />
Abbau <strong>von</strong> Holz abgestorbener Bäume zu beobachten). Die zerkleinerten<br />
(verflüssigten) Nährstoffe werden danach <strong>von</strong> den Zellen des Hyphengeflechts<br />
aufgenommen.<br />
Die meisten Pilzarten wachsen als Mycel, einem weit verzweigten Netz aus<br />
fadenförmig aneinander gereihten Zellen, einem Hyphengeflecht.<br />
Bei entsprechenden Umgebungsbedingen bilden sich arttypische Fruchtkörper die<br />
der Produktion und Freisetzung <strong>von</strong> Sporen dienen.<br />
Der Entwicklungszyklus kann zum Teil sehr komplex sein, ebenso die Formen<br />
sexueller, oder vegetativer Vermehrung.<br />
Pilze leben als Saprobonten, Symbionten, oder Parasiten<br />
Abgrenzung zu den Pflanzen: Pilze betreiben keine<br />
Photosynthese. Sie sind daher auf organisches Substrat<br />
als Nährstoffgrundlage angewiesen. Pilze leben als<br />
Saprobionten (auf Pflanzen und abgestorbenem<br />
organischen Material) Manche <strong>von</strong> Ihnen sind Teil <strong>von</strong><br />
Flechten. In diesem Fall leben ein Pilz und Algen in<br />
Symbiose.<br />
Pilze besitzen, wie Pflanzen, eine Zellwand aus Chitin,<br />
einem Polysaccharid aus N-Acetylglucosamin (wie das<br />
Aussenskelett <strong>von</strong> Insekten). Pilze können Vakuolen<br />
besitzen.<br />
Abgrenzung zu den Tieren: Tierische Zellen haben<br />
weder Zellwand noch Vakuole. Es gibt keine<br />
mehrkernigen Lebensstadien. Tiere vermehren<br />
sich nicht über Sporen<br />
Querschnitt Flechte<br />
5.2. Die systematische Einteilung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong><br />
Es gibt unzählige verschiedene Pilzarten (Schätzungen gehen <strong>von</strong> mehr als 100 000 Arten<br />
aus, die sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in der Art ihrer Vermehrung<br />
unterscheiden). Sogar für Mykologen (Mykologie=Lehre <strong>von</strong> den <strong>Pilzen</strong>) ist die eindeutige<br />
Klassifizierung oft schwer. Eine wesentlich Hilfe dabei sind moderne molekularbiologische<br />
Methoden, wie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR).
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 2/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
Die meisten Pilze sind Vielzeller, es gibt aber auch einzellige Pilze, wie z.B. die Hefen,<br />
oder Pilze, die während gewisser Stadien im Entwicklungszyklus einzellig leben<br />
(Dictyostelium).<br />
Eine erste einfache Unterscheidung lässt sich aufgrund des Wachstums als Plasmodium<br />
treffen. Ein Plasmodium ist durch eine vielkernige Protoplasmamasse ohne Zellwände<br />
gekennzeichnet. Die Ernährung erfolgt durch Phagozytose. Ein Pseudoplasmodium<br />
entsteht durch die Ansammlung vieler, zuvor amöboider Zellen (Dictyostelium).<br />
Man unterscheidet daher 2 Abteilungen:<br />
Myxomycota (Schleimpilze; Plasmodium oder Pseudoplasmodium vorhanden)<br />
Eumycota (alle anderen Pilze, meist als Mycel wachsend)<br />
5.3.Myxomycota (Schleimpilze)<br />
Die Myxomycota sind zellwandlose Organismen die sich in manchen Entwicklungsstadien<br />
amöboid bewegen. Bei bestimmten Bedingungen bilden sie Sporangien, welche mit einer<br />
Cellulose- oder Chitinwand umgebene Sporen enthalten.<br />
Die Myxomycota lassen sich in vier Klassen gliedern:<br />
Acrasiomycetes ; Hydromyxomycetes; Myxomycetes; Plasmodiophoromycetes<br />
5.3.1.Acrasiomycetes<br />
Die Acrasiomyceten (zelluläre Schleimpilze)<br />
sind einkernige terrestrische Organismen, die<br />
auf feuchten Böden vor allem <strong>von</strong><br />
Bakterien, aber auch <strong>von</strong> anderen<br />
Nährstoffen leben. Die Bakterien werden<br />
durch Phagozytose aufgenommen. Von der<br />
etwa 20 Arten umfassenden Gruppe ist<br />
Dictyostelium discoideum ein wichtiges<br />
Objekt zur Erforschung der<br />
Differenzierungsprozesse vom ein- zum<br />
vielzelligen Organismus. Wie aus dem<br />
Entwicklungszyklus zu ersehen ist,<br />
aggregieren die amöboiden Zellen bei<br />
Nahrungsmangel zu einem<br />
Pseudoplasmodium. Die Aggregation wird<br />
durch Zellen ausgelöst, die zuerst<br />
Nahrungsmangel registrieren. Sie beginnen,<br />
rhythmisch cAMP abzugeben, was bei den<br />
Entwicklungszyklus bei Dictyostelium discoideum<br />
benachbarten Zellen eine Bewegung auf dieses Zentrum hin auslöst und in der Folge auch<br />
deren Stoffwechsel umstellt. An der Aneinanderlagerung der sind Lectine (Kohlenhydrate<br />
bindende Proteine) beteiligt. Bei der weiteren Entwicklung kann sich das Pseudoplasmodium<br />
(Name bedeutet, es besteht aus Einzelzellen und ist nicht vielkernig! ) wie eine Schnecke<br />
weiterbewegen. Während der Aggregationsphase kann es zu einer Verschmelzung zu<br />
diploiden Zygoten kommen, die eine Meiose durchlaufen noch bevor der Sorokarp<br />
ausgebildet ist. Dieser Fruchtkörper ist etwa 2mm hoch er besteht aus einem<br />
Cellulosestiel und einem Köpfchen, das mit Sporen gefüllt ist. Unter günstigen<br />
Bedingungen keimen diese Sporen wieder zu Amöben aus.
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 3/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
5.3.2. Myxomycetes<br />
Myxomyceten (echte Schleimpilze) sind vielkernige nackte<br />
Protoplasmakörper, es gibt also keine deutliche Trennung zwischen<br />
einzelnen Zellen. Diese Pilze leben auf verrottendem Holz und Laub<br />
und ernähren sich ebenfalls <strong>von</strong> Bakterien und anderen organischen<br />
Stoffen durch Phagocytose. Das intensiv gelbe Physarum<br />
polycephalum (nicht verwechseln mit Fusarium, einem Ascomyceten!)<br />
bildet ein verzweigtes Fusionsplasmodium Bei Nahrungsmangel bildet<br />
sich das Plasmodium zu einer schwarzen Sporangienmasse um.<br />
Viele Vertreter der 400 Arten umfassenden Gruppe bilden<br />
morphologisch differenzierter Fruchtkörper (2-3 mm Größe), in denen<br />
die Sporen in einem netzartigen Capillitium liegen. Es besteht aus<br />
einem Netzwerk <strong>von</strong> Cellulosefasern, in welche die Sporen eingelagert sind. Sie werden<br />
durch Wind verbreitet und keimen zu Myxamöben aus. Die<br />
Myxamöben durchlaufen vielfach ein begeißeltes Stadium<br />
(Myxoflagellaten). Auf faulenden Pflanzenteilen fallen bei Feuchtigkeit<br />
die großen schaumigen zitronengelb gefärbten Plasmodien der<br />
Lohblüte (Fuligo septica) auf. Auf der dem Licht abgewandten Seite<br />
umgestürzter Bäume findet man die braungefärbten bizarren<br />
Fruktifikationsgebilde <strong>von</strong> Cribaria rufa.<br />
Physarum<br />
polycephalum<br />
Arcyria cinerea<br />
5.3.3. Plasmodiophoromycetes (parasitische Schleimpilze)<br />
Der berüchtigste Vertreter dieser etwa 20 Arten umfassenden Gruppe ist Plasmodiophora<br />
brassicae, der Erreger der Kohlhernie. An Kohl und anderen Cruciferen verursacht er<br />
Wurzelanschwellungen, tumorartiges Wachstum. Die Wurzelhaare werden <strong>von</strong> zweifach<br />
begeißelten Zoosporen (=Planosporen) infiziert, in der Zelle entwickelt sich ein Plasmodium.<br />
Es zerfällt in Zoosporen, die erneute Infektionen verursachen. Zur Überwinterung wird ein<br />
interzelluläres Sporangium mit Dauersporen gebildet. Im Frühjahr keimen diese mit einer<br />
Chitinwand umgebenen Dauersporen (Aplanosporen) zu begeißelten Zoosporen aus.<br />
5.4. Eumycota<br />
Die Eumycota lassen sich in 5 Abteilungen gliedern:<br />
Mastigomycotina bilden bewegliche Planosporen<br />
Deuteromycotina (fungi imperfecti) haben keine sexuelle Vermehrung<br />
Zygomycotina Mucor Rhizopus<br />
Ascomycotina zu den Hemiascomycets gehört Hefe oder Candida.<br />
Zur Klasse der Euascomycetes gehören typische Schimmelpilze wie Aspergillus,<br />
Penicillium, Alternaria oder Fusarium<br />
Basidiomycotina besitzen typische Fruchtkörper (“Schwammerl”) wie die Hutpilze
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 4/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
Ascomycotina (Schlauchpilze)<br />
Ascomyceten sind die formenreichste Klasse der<br />
Pilze, sie leben in den verschiedensten Habitaten<br />
als Saprobionten auf Pflanzen- und Tierresten,<br />
als Krankheitserreger, im Süß- und Salzwasser.<br />
Ihr charakteristisches Merkmal sind Sporen als<br />
Folge eines Befruchtungsvorganges (perfekte<br />
Sporen), die zu acht in einem Schlauch (Ascus)<br />
entstehen.<br />
Die vegetativen Strukturen sind entweder<br />
einzellig, wie bei den Hefen, oder aus septierten<br />
Ascomyceten © Fritsche Mikrobiologie 1998<br />
(unterteilten) Hyphen aufgebaut, wobei jedes<br />
Segment mehrere Kerne enthalten kann. Falls diese Kerne genetisch nicht identisch sind<br />
spricht man <strong>von</strong> einem Heterokaryon.<br />
Zahlreiche Schimmelpilze, wie Aspergillus und Penizilliumarten; dazu gehören aber auch<br />
wichtige Hefen<br />
Zygomycotina (Jochpilze)<br />
Diese niederen Pilze pflanzen sich asexuell durch Aplanosporen<br />
fort, die in Sporangien entstehen und aktiv abgeschleudert<br />
werden können. Zahlreiche Schimmelpilze (z.B. Mucor- und<br />
Rhizopusarten) gehören zu den Zygomycotina.<br />
Mucor sp.<br />
Schimmelpilze: gehören zu verschiedenen Abteilungen (siehe<br />
oben). Ihnen gemeinsam ist, dass sie nur unter dem Mikroskop genauer untersuchbar sind<br />
(keine großen Fruchtkörper wie die Basidiomyzeten). Zu erkennen sind sie an dem in<br />
Regel weißen Pilzgeflecht (Myzel=Summe aller Hyphen; Hyphe = einzelner Pilzfaden).<br />
Wenn Schimmelpilze lange genug kultiviert werden, verfärben sich viele <strong>von</strong> ihnen (grün,<br />
braun, schwarz). Diese Färbung stammt meistens <strong>von</strong> den gebildeten Sporen<br />
(Vermerhungsformen)<br />
Hefen: gehören zu den Hemiascomycetes, leben meist<br />
einzellig, manche können „Zellverbände“ bilden (da alle Zellen<br />
die gleiche Aufgabe haben, spricht man nicht <strong>von</strong><br />
„Vielzellern“);<br />
Die technologisch bedeutsamste Art ist Saccharomyces<br />
cerevisiae: Brotherstellung (CO2 bildet Blasen und macht Brot<br />
„locker“), Wein- und Bierherstellung (Alkoholbildung unter<br />
anaeroben (O2-freien) Bedingungen<br />
nach Webster/Pilze
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 5/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
Basidiomycotina (dazu gehören z.B. die<br />
Ständerpilze - „Schwammerln“): das<br />
Pilzgeflecht befindet sich im Boden, die<br />
„Schwammerln“ sind der Fruchtkörper<br />
(Vermehrungsorgan).<br />
Das Mycel der typischen Speisepilze stellt<br />
zum Teil hohe Ansprüche an die<br />
Symbiosepartner , daher können die<br />
meisten <strong>von</strong> ihnen nicht gezüchtet werden<br />
(außer z.B. Champignon).<br />
Basidiomyceten © Fritsche Mikrobiologie, 1998<br />
5.5. Pilze mit technologischer Bedeutung<br />
Penicilliumarten: Herstellung <strong>von</strong> Penizillin und anderen ß-Lactamantibiotika („klassische<br />
Antibiotika“; bestimmte Verbindungsklasse; klassische Antibiotika wirken nur gegen<br />
Bakterien, und nicht gegen Viren und Pilze)<br />
Aspergillus niger: Herstellung <strong>von</strong> Zitronensäure (Zusatz zu Getränken, Süßwaren,<br />
Einsatz als Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen, etc.)<br />
5.6. Pilze als Krankheitserreger<br />
Pilze, die den menschlichen Körper besiedeln:<br />
Vor allem an der Oberfläche der Haut (Nagelpilz, Fußpilz,..), aber auch an inneren<br />
Oberflächen (Candida im Darmtrakt (Hefe); Aspergillus flavus in der Lunge)<br />
Hinweis für die Laborarbeit:<br />
Wenn man Pilze aus der Umwelt anzüchtet, weiß man – durch bloßes Betrachten – in der<br />
Regel nicht, um welche Pilze es sich handelt. Aus diesem Grund ist jede Pilzkultur so zu<br />
behandeln, als ob sie pathogen (krankheitserregend) wäre. Es ist daher strikt auf gute<br />
sterile Arbeitstechnik zu achten!<br />
Pilze, die Toxine (Gifte) bilden<br />
Pilze können Gifte bilden, die vor allem über Lebensmittel in den menschlichen Körper<br />
gelangen können, z.B. der Mutterkornpilz, der Getreide befällt; Fusarium-Arten, die<br />
ebenfalls Getreide befallen, aber auch Schimmelpilze, die im Haushalt Früchte etc.<br />
befallen.<br />
Hinweis: Im Gegensatz zu Bakterien (die meist bei neutralem pH-Wert am besten<br />
gedeihen, vertragen viele Pilze tiefere pH-Werte – sie wachsen deshalb z.B. an der<br />
Oberfläche <strong>von</strong> Früchten (z.B. Hefe auf der Obefläche <strong>von</strong> Trauben – diese Hefen können<br />
den Traubensaft zu Wein vergären). Nährmedien, auf denen Pilze (und keine Bakterien)<br />
wachsen sollen, haben daher oft einen sauren pH-Wert<br />
5.7. mikrobiologische Kultivierung<br />
Verwendet man bei der Anreicherung <strong>von</strong> Luftkeimen Malzextrakt oder Würze als<br />
Nähbodengrundlage, so bekommt man bei längerer Bebrütung bei Temperaturen bis max.<br />
30°C vorwiegend Bewuchs durch niedere Pilze (Hefen, Ascomyceten )<br />
Solche Pilze stellen in vielen Bereichen biotechnologischer Produktionsstätten ein<br />
Problem dar, weil ihre Verbreitung durch Sporen sehr rasch und sehr weitreichend erfolgt.<br />
In der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion muss daher besonders drauf geachtet<br />
werden, Kontaminationen durch Pilzsporen zu vermeiden !
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 6/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
Durchführung:<br />
Die Anreicherung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong> und Schimmelpilzen erfolgt auf Nährböden aus<br />
Malzextraktagar oder Würzeagar. Nach etwa 2-4 Tagen Bebrütung bei 30°C werden die<br />
Platten begutachtet und versucht die verschiedenen Pilzarten zu unterscheiden.<br />
Beimpfung fester Nährmedien<br />
Luftinfektion: Pilzsporen sind ein Bestandteil <strong>von</strong> Staub; für die Beimpfung Petrischalen mit<br />
Universalnährmedium für Pilze (z.B. Malzextraktagar, Würzeagar, Saboraudagar) 10<br />
Minuten öffnen<br />
Pilze an der Oberfläche <strong>von</strong> Gegenständen: zahlreiche Schimmelpilzsporen befinden sich<br />
auf Kehrgeräten (Besen etc.); viele Pilze können <strong>von</strong> der Oberfläche <strong>von</strong> Früchten bzw.<br />
anderen Pflanzenteilen angezüchtet werden; Universalmedium für Pilze (siehe oben),<br />
Objekt kurz auflegen<br />
5.8 Untersuchung <strong>von</strong> Pilzkolonien<br />
Hefekolonien (Kolonie= Ansammelung einer größren Organismenzahl nach Vermehrung<br />
auf einem festen Nährmedium) haben in der Regel eine glänzende Oberfläche, sind meist<br />
gelblich, manchmal auch orange oder rot gefärbt; die Kolonien sind makroskopisch nicht<br />
<strong>von</strong> Bakterienkolonien zu unterscheiden.<br />
Schimmelpilzkolonien: wattiges Aussehen (Myzel), weiß bzw. <strong>von</strong> der Mitte der Kolonie<br />
ausgehende Verfärbung (Hinweis auf Sproenbildung)<br />
5.8.1. Präparation <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong> für die Mikroskopie<br />
5.8.1.1. Untersuchung im Stereomikroskop<br />
Pilzkulturen lassen sich in der Petrischale ohne Abheben des Deckels recht gut mit dem<br />
Stereomikroskop untersuchen. Die Vergrößerung bleibt dabei allerdings auf etwa 20-fach<br />
begrenzt. Es ist jedoch möglich die Pilzkultur in ihrer Gesamtheit zu untersuchen und vor<br />
allem verschieden weite Entwicklungsformen (Alter) zu beobachten. Am äußersten Rand<br />
der Kultur befinden sich die jüngsten Hyphen, die noch keine Fruchtkörper tragen. Weiter<br />
in Richtung Zentrum kann man die verschiedenen Stadien der Fruchtkörperbildung sehen<br />
und eventuell schon eine grobe Zuordnung treffen.<br />
5.8.1.2. Lichmikroskopische Untersuchung<br />
Präparation:<br />
Die Platten sollen dabei möglichst wenig bewegt werden um die<br />
Freisetzung <strong>von</strong> Sporen zu minimieren. Die Platten sollen daher auch<br />
nur kurz zur Entnahme <strong>von</strong> Probenmaterial geöffnet werden.<br />
Von glatten, klar abgegrenzten runden Kolonien, kann, wie bei<br />
Bakterien, mit einer ausgeglühten Impföse etwas Material<br />
entnommen und in physiologischer Kochsalzlösung auf dem<br />
Objektträger suspendiert werden.<br />
Von Schimmelpilzkulturen wird mit zwei abgeflammten Präpariernadeln ein Teil des<br />
Myzels nach oben herausgezogen und auf einen Objektträger überführt. Die Probe wird in<br />
1 Tropfen physiologischer Kochsalzlösung zerrupft, wobei man darauf achten sollte,<br />
vorsichtig zu arbeiten um die empfindlichen Fruchtkörper (Sporangien) nicht vollkommen<br />
zu zerstören (der Zusatz <strong>von</strong> etwas Spülmittel hilft bei dem Verteilen).
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 7/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
Beobachtung:<br />
Hefen: rund bis oval, viel größer als Bakterien (auch bei 400-facher Vergrößerung gut<br />
sichtbar); die meisten Hefen vermehren sich durch „Sprossung“ indem sich die Zelle nicht<br />
symmetrisch teilt, sondern an einer Stelle die Tochterzelle beginnt herauszuwachsen.<br />
Sprosse sind charakteristisch für das Vorliegen einer Hefe; einige Hefen vermehren sich<br />
durch Spaltung wie Bakterien („Spaltpilze“)<br />
Schimmelpilze: Pilzfäden erkennbar (findet man nur „Kugeln“, wurden nur Sporen<br />
überimpft, die Präparation muss wiederholt werden).<br />
Folgende Merkmale sind für die Eingrenzung entscheidend: Form der Sporenträger<br />
(Ansatz) und Art der Sporen-tragenden Fortsätze. Art der Hyphen, ob septiert (unterteilt)<br />
oder nicht, Art der Verzweigungen.<br />
Septierte Hyphen weisen auf Ascomyzenten oder Basidiomyzeten hin<br />
(Septum=Querwand; die Zellen sind durch eine Zellwand <strong>von</strong>einander getrennt)<br />
Unseptierte Hyphen (Zellen nicht durch Querwand getrennt, die Zellen bilden einen langen<br />
„Schlauch“, der viele Zellkerne hat) weisen auf Zygomyzeten hin<br />
Klassifikaton mit Hilfe <strong>von</strong> Fruchtkörpern: für die Klassifikation braucht man viel Erfahrung.<br />
Einige Pilze lassen sich aber <strong>von</strong> Nicht-Experten/innen grob klassifizieren: Die Gattungen<br />
Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Mucor und Rhizopus sind gut zu erkennen.<br />
Penicillium sp.<br />
“Pinselschimmel” (Ascomycetes)<br />
Raster-EM Lichtmikroskop<br />
Aspergillus sp. (Ascomycetes)<br />
5.8.2. Färbungen<br />
Hefe:<br />
Methylenblaufärbung erlaubt Unterscheidung zwischen lebenden und toten Zellen.<br />
Lebende Zellen bauen den blauen Farbstoff ab, und sind daher farblos, tote Zellen blau<br />
gefärbt. Durchführung: Zusatz <strong>von</strong> 1 Tropfen Methylenblaufärbelösung am Deckglasrand,<br />
mit Küchenrolle durch das Präparat durchsaugen<br />
Gramfärbung (Durchführung siehe Arbeitsblatt „Bakterienidentifikation“ – Hefen sind violett<br />
gefärbt (wie Gram-positive Bakterien)<br />
5.9. Lagerung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong><br />
Lagerung als Sporensuspension oder in Schrägagar-Kulturröhrchen mit verringerter<br />
Nährstoffkonzentration
MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 8/8<br />
09.12.08 © V.E., C.N.<br />
5.10. Literatur:<br />
Campbell N.A.2006; Biologie;<br />
Pearson-Studium; München, (Grundlagenwissen Pilze) Basiswissen Mikrobiologie 1998. ,<br />
Brett, UZV, (mikroskopische Untersuchung <strong>von</strong> Schimmelpilzen)<br />
Bast, Mikrobiologische Methoden; 1999, Spektrum-Verlag (Präparationstechnik,<br />
Färbelösungen,..)<br />
Webster, „Pilze“; Springer 1983<br />
Glaubitz, Atlas der Gärorganismen,<br />
Anhang: Typische Vertreter <strong>von</strong> Schimmelpilzen