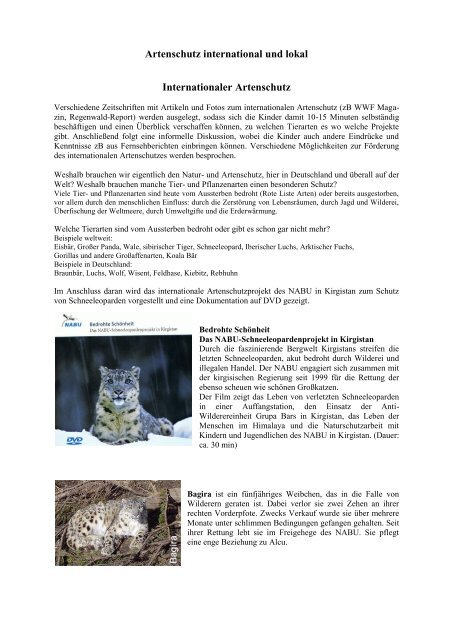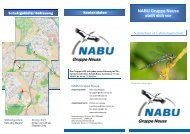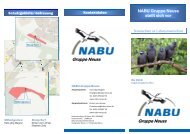Artenschutz international und lokal Internationaler ... - NABU Neuss
Artenschutz international und lokal Internationaler ... - NABU Neuss
Artenschutz international und lokal Internationaler ... - NABU Neuss
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Artenschutz</strong> <strong>international</strong> <strong>und</strong> <strong>lokal</strong><br />
<strong>Internationaler</strong> <strong>Artenschutz</strong><br />
Verschiedene Zeitschriften mit Artikeln <strong>und</strong> Fotos zum <strong>international</strong>en <strong>Artenschutz</strong> (zB WWF Magazin,<br />
Regenwald-Report) werden ausgelegt, sodass sich die Kinder damit 10-15 Minuten selbständig<br />
beschäftigen <strong>und</strong> einen Überblick verschaffen können, zu welchen Tierarten es wo welche Projekte<br />
gibt. Anschließend folgt eine informelle Diskussion, wobei die Kinder auch andere Eindrücke <strong>und</strong><br />
Kenntnisse zB aus Fernsehberichten einbringen können. Verschiedene Möglichkeiten zur Förderung<br />
des <strong>international</strong>en <strong>Artenschutz</strong>es werden besprochen.<br />
Weshalb brauchen wir eigentlich den Natur- <strong>und</strong> <strong>Artenschutz</strong>, hier in Deutschland <strong>und</strong> überall auf der<br />
Welt? Weshalb brauchen manche Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten einen besonderen Schutz?<br />
Viele Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten sind heute vom Aussterben bedroht (Rote Liste Arten) oder bereits ausgestorben,<br />
vor allem durch den menschlichen Einfluss: durch die Zerstörung von Lebensräumen, durch Jagd <strong>und</strong> Wilderei,<br />
Überfischung der Weltmeere, durch Umweltgifte <strong>und</strong> die Erderwärmung.<br />
Welche Tierarten sind vom Aussterben bedroht oder gibt es schon gar nicht mehr?<br />
Beispiele weltweit:<br />
Eisbär, Großer Panda, Wale, sibirischer Tiger, Schneeleopard, Iberischer Luchs, Arktischer Fuchs,<br />
Gorillas <strong>und</strong> andere Großaffenarten, Koala Bär<br />
Beispiele in Deutschland:<br />
Braunbär, Luchs, Wolf, Wisent, Feldhase, Kiebitz, Rebhuhn<br />
Im Anschluss daran wird das <strong>international</strong>e <strong>Artenschutz</strong>projekt des <strong>NABU</strong> in Kirgistan zum Schutz<br />
von Schneeleoparden vorgestellt <strong>und</strong> eine Dokumentation auf DVD gezeigt.<br />
Bedrohte Schönheit<br />
Das <strong>NABU</strong>-Schneeleopardenprojekt in Kirgistan<br />
Durch die faszinierende Bergwelt Kirgistans streifen die<br />
letzten Schneeleoparden, akut bedroht durch Wilderei <strong>und</strong><br />
illegalen Handel. Der <strong>NABU</strong> engagiert sich zusammen mit<br />
der kirgisischen Regierung seit 1999 für die Rettung der<br />
ebenso scheuen wie schönen Großkatzen.<br />
Der Film zeigt das Leben von verletzten Schneeleoparden<br />
in einer Auffangstation, den Einsatz der Anti-<br />
Wilderereinheit Grupa Bars in Kirgistan, das Leben der<br />
Menschen im Himalaya <strong>und</strong> die Naturschutzarbeit mit<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen des <strong>NABU</strong> in Kirgistan. (Dauer:<br />
ca. 30 min)<br />
Bagira ist ein fünfjähriges Weibchen, das in die Falle von<br />
Wilderern geraten ist. Dabei verlor sie zwei Zehen an ihrer<br />
rechten Vorderpfote. Zwecks Verkauf wurde sie über mehrere<br />
Monate unter schlimmen Bedingungen gefangen gehalten. Seit<br />
ihrer Rettung lebt sie im Freigehege des <strong>NABU</strong>. Sie pflegt<br />
eine enge Beziehung zu Alcu.
Alcu, ebenfalls ein fünfjähriges Weibchen, geriet gemeinsam<br />
mit Bagira in die Falle der Wilderer. Dabei verlor sie ihre<br />
gesamte linke Vorderpfote <strong>und</strong> ist dadurch stark behindert. Im<br />
Gehege ist sie häufig mit Bagira anzutreffen, hat jedoch auch<br />
guten Kontakt zu Kunak <strong>und</strong> ist von neugierig-fre<strong>und</strong>lichem<br />
Charakter.<br />
Ein kasachischer Wanderzirkus versuchte, das sechsjährige<br />
Männchen Kunak außer Landes zu schmuggeln. Nach der<br />
erfolgreichen Rettung durch den <strong>NABU</strong> nahm er im Gehege<br />
sofort Kontakt zu Alcu <strong>und</strong> Bagira auf. Seinen Pflegern gegenüber<br />
ist er zutraulich, bei Fremden reserviert <strong>und</strong> abwartend.<br />
Seinen männlichen Willen pflegt er gegenüber den Weibchen<br />
in der Regel durchzusetzen.<br />
Pate werden für den Schneeleoparden<br />
Helfen Sie mit, die letzten Schneeleoparden zu retten.<br />
Ihre persönliche Urk<strong>und</strong>e als Pate für den Schneeleopard.<br />
Naturfilme<br />
"Tiger der Sümpfe", "Mein Leben mit Löwen" <strong>und</strong> andere Naturfilme aus der Reihe "Natural Killers"<br />
geben einen Einblick in die spannende Arbeit von Naturfilmern <strong>und</strong> Forschern. Gleichzeitig erlebt<br />
man die Lebenswelt der Königstiger in den S<strong>und</strong>arbans (Mangrovensümpfen) von Bangla Desh <strong>und</strong><br />
der Löwen in der afrikanischen Steppe des Krüger Nationalparks in Südafrika. (Dauer: ca. 50 min)<br />
Weitere Informationen zum <strong>international</strong>en Natur- <strong>und</strong> <strong>Artenschutz</strong>:<br />
World Wide F<strong>und</strong> for Nature WWF www.wwf.de<br />
International Union for Conservation of Nature IUCN www.iucn.org<br />
United Nations Environment Programme (UNEP) www.unep.org<br />
Greenpeace www.greenpeace.de www.greenpeace.org
Nationaler <strong>Artenschutz</strong><br />
Die Rückkehr der Luchse <strong>und</strong> Wölfe nach Deutschland; Ausrottung <strong>und</strong> Wiederansiedlung; Schutzgebiete<br />
<strong>und</strong> Aufklärungsarbeit.<br />
Das Bildungsprojekt des BMU "Don Cato - Die<br />
Rückkehr des Luchses" hat das Thema <strong>Artenschutz</strong><br />
<strong>und</strong> Biodiversität für Kinder aufbereitet. Mit einer<br />
CD reisen sie mit dem jungen Luchs Don Cato<br />
durch verschiedene Naturräume in Deutschland, im<br />
Winter durch die Alpen, im Frühjahr durch eine<br />
Fluss- <strong>und</strong> Auenlandschaft, im Sommer an der Küste<br />
<strong>und</strong> im Herbst im Harzgebirge. Die Geschichten,<br />
die er dabei erlebt, können Kinder per Mausklick<br />
miterleben <strong>und</strong> lernen dabei viel über die Artenvielfalt<br />
unserer Ökosysteme.<br />
Das Begleitheft vermittelt Wissenswertes über<br />
Luchse <strong>und</strong> die verschiedenen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />
in den vier Ökosystemen, die der Luchs Don Cato auf der CD durchwandert.<br />
Texte, Bilderrätsel, Quiz <strong>und</strong> Memory vermitteln, was biologische Vielfalt eigentlich bedeutet.<br />
Auf dem Don Cato Poster "Wir erhalten Lebensräume" sind 87 einheimische Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />
dargestellt. www.bmu.de/doncato bmu@broschuerenversand.de<br />
Weitere Informationen zu Luchs, Wolf <strong>und</strong> anderen seltenen Tierarten in Europa:<br />
www.bmu.de www.wwf.de www.nabu.de<br />
http://www.nabu.de/aktionen<strong>und</strong>projekte/wolf/willkommenwolf/<br />
http://www.nabu.de/tiere<strong>und</strong>pflanzen/saeugetiere/raubtiere/luchs/
Lokaler <strong>Artenschutz</strong><br />
Streuobstwiese, Blumenwiese <strong>und</strong> Wilde Hecke (zB Bürgerwäldchen in Lank) (Ordner: Wiese)<br />
Bunte Blumenwiesen, Streuobstwiesen <strong>und</strong> Wilde Hecken sind ein wichtiger Beitrag zum <strong>lokal</strong>en<br />
<strong>Artenschutz</strong>.<br />
Eine bunte Blumenwiese ist voller Artenvielfalt (Biodiversität). Wiesenblumen <strong>und</strong> Gräser, Kaninchen,<br />
Vögel <strong>und</strong> Mäuse, Schnecken <strong>und</strong> Regenwürmer, <strong>und</strong> eine Vielzahl von Insekten wie Spinnen,<br />
Bienen, Hummeln, Libellen, Schmetterlinge, Grillen, Schwebfliege, Florfliege, Marienkäfer, Heuschrecke,<br />
Grashüpfer, Ameisen, Blatthüpfer, Zickaden <strong>und</strong> Weichkäfer kann man bei einer Wiesen-<br />
Safari entdecken. Dabei braucht es keine umfangreiche Ausrüstung. Ein paar einfache Becherlupen<br />
<strong>und</strong> Lupen (Achtung: in hoher Wiese geht das Material leicht verloren) <strong>und</strong> Bestimmungsbücher für<br />
Blumen, Gräser, Insekten <strong>und</strong> Vögel sind ausreichend.<br />
Neben der Wiesenuntersuchung sollte auch auf die besondere Bedeutung der Streuobstwiese <strong>und</strong> des<br />
gemischten Heckensystems eingegangen werden. Beides gilt als wichtiges Habitat <strong>und</strong> Nahrungsquelle<br />
für viele Vogel- <strong>und</strong> Insektenarten wie auch für Nager, Igel, Rehe <strong>und</strong> Füchse. Die Idee, ein Bürgerwäldchen<br />
in dieser Art anzulegen basiert auf dem Hintergr<strong>und</strong>, dass alte Streuobstwiesen <strong>und</strong> wilde<br />
Hecken mit vielen Beerensträuchern heute zu einer Seltenheit in unserer Region geworden sind. Auf<br />
der Wiese sind einige Ansitze (Holzpfosten mit Querbalken) angebracht, die Greifvögeln dienen beim<br />
Erspähen ihrer Beute. Alte Streuobstwiesen sind ein besonderes Habitat für Steinkauz, Waldkauz,<br />
Eulen <strong>und</strong> Fledermäuse, die in den Stammhöhlen der alten Obstbäume Quartiere finden <strong>und</strong> auf offener<br />
Wiese gut jagen können.<br />
Ein Steinhügel mit Insektennisthilfen für Wildbienen <strong>und</strong> Solitärwesepen ist eine gute Ergänzung für<br />
eine Obstwiese, da die Insekten zur Bestäubung der Blüten <strong>und</strong> zum biologischen Pflanzenschutz beitragen.<br />
Die Obstwiese des Bürgerwäldchens ist von einer dichten Wildhecke umgeben.<br />
Wildhecken<br />
Eine wilde Hecke besteht aus verschiedenen Bäumen <strong>und</strong> Sträuchern, zB Brombeerbüschen, Haselnuss,<br />
Hol<strong>und</strong>ersträuchern <strong>und</strong> wilden Obstbäumen. Weil diese Pflanzen unterschiedlich hoch wachsen,<br />
gibt es in solchen Hecken verschiedene Stockwerke. Manche Vogelarten bauen ihre Nester ganz<br />
oben in den Bäumen, manche etwas weiter unten in den Sträuchern, wieder andere ganz unten am<br />
Boden. Igel suchen nachts zwischen den Blättern nach Schnecken <strong>und</strong> Würmern. In den Ästen <strong>und</strong> auf<br />
den Blättern leben verschiedene Käfer, Spinnen, Raupen, Schmetterlinge <strong>und</strong> Fliegen. Bienen, Hummeln<br />
<strong>und</strong> Hornissen finden Pollen an den Blüten der verschiedenen Strauch- <strong>und</strong> Baumarten von Februar<br />
bis Juli. Schmetterlinge sammeln den Nektar.<br />
Blütezeit von früh bis später im Jahr: Haselblüten > Weidenkätzchen > Schlehe, Traubenkirsche > Weißdorn,<br />
Pfaffenhütchen, Hol<strong>und</strong>er > Wildrose, Brombeere<br />
Die Früchte <strong>und</strong> Nüsse im Herbst <strong>und</strong> Winter werden von vielen Tieren <strong>und</strong> Vögeln als Nahrung genutzt.<br />
Vielen Tieren bieten dichte Hecken Nistplatz, Schlafplatz (auch für Winterschlaf), Nahrungsquelle,<br />
Schutz vor Sonne <strong>und</strong> Regen, <strong>und</strong> ein Versteck vor Feinden. Hierzu zählen auch Erdkröte, Feldmaus,<br />
Haselmaus, Kaninchen, Wiesel <strong>und</strong> Iltis.<br />
Hecken sind zugleich ein Wind- <strong>und</strong> Erosionsschutz auf freien Flächen. Allerdings sind in den vergangenen<br />
Jahrzehnten viele Hecken zwischen Feldern von Bauern beseitigt worden, weil in der Landwirtschaft<br />
mit den modernen Maschinen auf größeren Flächen einfacher <strong>und</strong> rationeller gewirtschaftet<br />
werden kann (Flurbereinigung). Für die Natur sind damit jedoch wichtige Lebensräume verloren gegangen.<br />
Biologische Vielfalt (BMU-Heft): Streuobstwiese<br />
Ausmalseite: Biologische Vielfalt - Eine Wiese voller Leben<br />
Tierarten auf einer Streuobstwiese: Maus, Igel, Fledermaus, Schmetterling, Biene, Hummel, Vögel,<br />
Spinnen, Schnecken, Raupen, Blattläuse<br />
Gedicht "Fre<strong>und</strong>schaft" (Datei: Gedicht Fre<strong>und</strong>schaft)<br />
(aus: Biologische Vielfalt, Arbeitsheft für Gr<strong>und</strong>schule, BMU; auch andere Anregungen zum Thema Wiese <strong>und</strong><br />
Obstwiese) http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gs_biodiv_schuelerheft.pdf (download)
Bienen, Wespenarten, Hummeln, Hornissen, Spinnen, Schnecken, Schmetterlinge, Marienkäfer,<br />
Maulwurf, Igel, Heuschrecken <strong>und</strong> Haselmaus<br />
(Ordner: Wiese; Datei: Tiere <strong>und</strong> Insekten auf der Wiese; Informationen, Literatur <strong>und</strong> Spiele)<br />
Bienen, Wespen <strong>und</strong> Hummeln (Ordner: Wildbienen,-wespen, Ohrwürmer)<br />
R<strong>und</strong> 100.000 Arten gehören zu der weltweit verbreiteten Gruppe der Hautflügler, zu denen neben<br />
Bienen <strong>und</strong> Wespen auch die Ameisen gehören. Eine besondere Faszination üben die hochgradig organisierten<br />
Insektenstaaten vieler Hautflüglerarten aus. Daneben gibt es aber auch eine Viezahl von<br />
solitär lebenden Bienen <strong>und</strong> Wespen, die keine Völker ausbilden. Die Weibchen legen ihre Eier je<br />
nach Art in der Erde, an totem Holz oder an lebenden Pflanzen ab.<br />
Die Hummeln sind mit ihren langen Zungen neben Solitär-<br />
<strong>und</strong> Honigbienen die wichtigsten blütenbestäubenden Insekten.<br />
Zwischen März <strong>und</strong> Mai suchen die im Vorjahr begatteten<br />
Königinnen unter Grasbüscheln <strong>und</strong> in verlassenen Mäusenestern<br />
nach geeigneten Nistplätzen.<br />
Natürliche Nistmöglichkeiten für Hautflügler sind durch die<br />
moderne Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft sowie naturfern gestaltete<br />
Gärten selten geworden. Neben einer natürlichen Gartengestal-tung<br />
kann man durch die Anbringung von Nisthilfen für<br />
Unterschlupf sorgen. Besonders geeignet ist hierfür Bambus<br />
oder Schilfrohr, als kleines Bündel (ca. 20 cm lang), Lochsteine,<br />
angebohrte Hartholzklötze <strong>und</strong> Lehmwände, an einem<br />
sonnigen, warmen, wettergeschützten Ort aufgestellt. Blumenwiesen,<br />
blühende Sträucher <strong>und</strong> Obstbäume, Stauden, Trockenmauern <strong>und</strong> wilde Ecken bieten<br />
Nahrung <strong>und</strong> Lebensraum für viele Hautflüglerarten.<br />
Mit Kindern kann man auf der Streuobstwiese am<br />
Bürgerwäldchen die Nisthilfen für Hautflügler<br />
genauer untersuchen. Mit Schilf <strong>und</strong> Bambus kann<br />
jedes Kind seine eigene kleine Nisthilfe basteln,<br />
mit nach Hause nehmen <strong>und</strong> im Garten aufhängen.<br />
Die Schilfstöcke können vor Ort mit Rosenscheren<br />
auf eine Länge von 15-20 cm geschnitten werden.<br />
Am besten geeignet sind dafür Schilfmatten aus<br />
dem Baumarkt (Stengeldurchmesser 0,5-1 cm<br />
Durchmesser).<br />
Bambusstöcke müssen zersägt werden da sie sonst<br />
oft spleißen. Diese Arbeit sollte zuvor auf Tischen<br />
(zB in der <strong>NABU</strong>-Station) gemacht werden. Mit<br />
Kordel oder dünnem Draht werden die Stöckchen<br />
zu 6-10 cm dicken Bündeln fest zusammen geb<strong>und</strong>en. Zur Aufhängung wird ein weiterer Faden oder<br />
Draht an zwei Seiten befestigt. Die Nisthilfen sollten an einem sonnigen, möglichst regengeschützten<br />
Ort aufgehängt werden.<br />
Nisthilfen für Bienen <strong>und</strong> Wespen, Infoblatt Nr.17,<br />
NUA<br />
www.nua.nrw.de poststelle@nua.nrw.de<br />
Bienen, Wespen <strong>und</strong> Hornissen, <strong>NABU</strong><br />
info@<strong>NABU</strong>-Natur-Shop.de<br />
Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung; Naturgärten<br />
<strong>und</strong> Nisthilfen für Hautflügler; Blumenwiese;<br />
Biologischer Pflanzenschutz<br />
Naturschutz ums Haus, <strong>NABU</strong><br />
<strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de<br />
Gartenteich, Trockenmauer, begrünte Fassaden,<br />
Dachbegrünung, Sommerblumen <strong>und</strong> Stauden, lebendige<br />
Wege <strong>und</strong> Plätze; Nisthilfen, Sommerquartiere <strong>und</strong> Überwinterungshilfen für Vögel, Wildbienen, Fledermäuse,<br />
Hummeln, Igel
Mit Kindern auf die große "Nussjagd" gehen<br />
Haselmaus<br />
Die Haselmaus ist klein <strong>und</strong> flink, überwiegend nachts turnt sie durch die Sträucher an Waldrändern<br />
<strong>und</strong> Hecken, <strong>und</strong> kaum jemand bekommt sie je zu Gesicht. Deshalb ist auch kaum bekannt, wo es<br />
wieviele von ihr überhaupt noch gibt. Um das heraus zu finden rufen die Naturschutzjugend NAJU<br />
NRW <strong>und</strong> die Nordrhein-Westfalen-Stiftung auf zur Großen Nussjagd.<br />
www.nussjagd-nrw.de schlauemaus@nussjagd-nrw.de<br />
Zum Aufspüren der scheuen Haselmaus werden Haselmaus-Forscher gebraucht, sie nach angenagten<br />
Haselnüssen, der Lieblingsspeise der Haselmaus, suchen. Die besonderen Nagespuren verraten, ob<br />
eine Haselmaus oder eine andere Maus an der Nuss genagt hat. Die Spuren der Nagezähne verlaufen<br />
bei der Haselmaus parallel oder leicht schräg zum Öffnungsrand.<br />
Das Loch ist fast kreisr<strong>und</strong> <strong>und</strong> hat einen<br />
glatten Rand. Rötel-, Wald- <strong>und</strong> Gelbhalsmäuse nagen<br />
einen rauen Rand mit Zahnspuren senkrecht zum Öffnungsrand.<br />
Vögel <strong>und</strong> Eichhörnchen zerbechen oder<br />
halbieren die Haselnussschalen einfach. Ein kleines<br />
Loch hat der Haselnussbohrer, ein Rüsselkäfer, in die<br />
Nuss gefressen.<br />
Eigentlich ist die Haselmaus keine Maus sondern gehört<br />
zu den Schlafmäusen oder Bilchen. Sie ist eine kleine<br />
Verwandte des Siebenschläfers, wie ein Blick auf ihren<br />
Schwanz verrät: er ist dicht <strong>und</strong> buschig behaart, ein<br />
perfektes Steuer beim Spingen im Geäst. Die echten<br />
Mäuse haben dagegen einen dünnen, fast nackten<br />
Schwanz. Die Haselmaus baut ihr Nest in Baumhöhlen,<br />
Nistkästen oder zwischen Brombeerranken. Im Winter<br />
halten die Haselmäuse einen echten Winterschlaf. Dabei<br />
sinkt ihre Körpertemperatur bis auf 4°C <strong>und</strong> das Herz<br />
schlägt nur noch ganz langsam. Je nach Wetter dauert in<br />
unserer Gegend der Winterschlaf von Oktober/November<br />
bis März/April.<br />
(Datei: Haselmaus Nussjagd)
Das Artensterben hat sich beschleunigt<br />
Immer mehr Menschen (ver)brauchen Natur<br />
Alles Leben ist gekennzeichnet durch Werden <strong>und</strong> Vergehen. Phasen massiven Artensterbens, ausgelöst beispielsweise<br />
durch Naturkatastrophen, hat es in der Erdgeschichte immer wieder gegeben – die letzte vor 65 Millionen<br />
Jahren. Seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert jedoch wird der Rückgang der biologischen Vielfalt maßgeblich durch<br />
menschliches Handeln verursacht. Neueste Erhebungen gehen davon aus, dass die derzeitige Aussterberate von 3<br />
bis 130 Arten pro Tag um den Faktor 100 bis 1000 über dem natürlichen Wert liegt. Von den weltweit untersuchten<br />
Arten sind laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion IUCN (2006) beispielsweise eine von drei Amphibienarten,<br />
ein Viertel aller Säugetier- <strong>und</strong> Nadelbaumarten sowie jede achte Vogelart gefährdet.<br />
Die Hauptursachen des Artensterbens sind bekannt: Lebensraumzerstörung, Übernutzung <strong>und</strong> illegaler<br />
Handel von wildlebenden Arten <strong>und</strong> das Einbringen gebietsfremder Tiere <strong>und</strong> Pflanzen. Auch Klimaveränderung<br />
<strong>und</strong> Umweltverschmutzung zeichnen sich immer deutlicher als Mitursache für Verbreitungsschw<strong>und</strong><br />
oder das Aussterben von Arten ab.<br />
Nur der Mensch kann die Artenkrise beenden<br />
Das Aussterben von Arten ist unumkehrbar. Mit jeder ausgestorbenen Art wird unsere Welt ärmer an Genen,<br />
Farben, Formen <strong>und</strong> Geräuschen. Mit dem Andauern des Artensterbens ist, über kurz oder lang, auch mit dem<br />
Verlust wichtiger <strong>und</strong> unbezahlbarer Ökosystemfunktionen wie der Photosyntheseleistung der Pflanzen, ihrer<br />
Klimaregulationsfunktion, der Bestäubung <strong>und</strong> Verbreitung von Wild- <strong>und</strong> Nutzpflanzen durch Insekten <strong>und</strong><br />
andere Tiere sowie der Selbstreinigung von Fließgewässern zu rechnen. Auch der Verlust mancher Pflanzen-<br />
<strong>und</strong> Tierart mit bekannter oder potenzieller Heilwirkung droht.<br />
Was können wir gegen das weltweite Artensterben tun?<br />
Nur der Mensch, als Verursacher der Biodiversitätskrise, kann diese auch beenden. Ein wichtiger Weg, die Artenvielfalt<br />
zu bewahren ist, die Lebensräume von Arten zu erhalten <strong>und</strong> zu schützen. Die Ausweisung von<br />
Schutzgebieten allein jedoch stellt noch nicht die Lösung des Problems dar. Die Kontrolle der Übernutzung <strong>und</strong><br />
des Handels von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten, der Erhalt von wichtigen Arten außerhalb von Schutzgebieten, die<br />
Reduktion von Mensch-Wildtierkonflikten - all diese Problematik würde durch alleinigen Flächenschutz nicht<br />
gelöst werden.<br />
Manchmal müssen anhand von Forschungsarbeiten artspezifische Schutzprojekte erstellt werden. Deswegen<br />
arbeiten Artenschützer heutzutage gleichermaßen an Schutzinstrumenten für kritisch bedrohte Arten, an Konzepten<br />
für die nachhaltige Nutzung ausgewählter Arten <strong>und</strong> an Akzeptanz schaffenden Maßnahmen bei der Lokalbevölkerung<br />
für den <strong>Artenschutz</strong>. Denn moderne Konzepte im <strong>Artenschutz</strong> beziehen auch den Menschen mit<br />
ein. Schließlich können Schutzgebiete dem Druck von außen langfristig nur standhalten, wenn Bewohner bei der<br />
Planung mit einbezogen werden.<br />
Insbesondere Anwohner werden ein Reservat nur respektieren, wenn dessen Gründung ihren Lebensunterhalt<br />
nicht bedroht. Hier ist es erforderlich, den Schutz der Natur mit deren nachhaltiger Nutzung zu verbinden: Es<br />
darf nicht mehr aus der Natur entnommen werden als natürlicherweise nachwächst – bei der Ernte von Holz <strong>und</strong><br />
Heilpflanzen genauso wie bei der Nutzung von Wildtieren an Land <strong>und</strong> im Meer. Letztendlich gilt es, konkrete<br />
Maßnahmen politisch, wirtschaftlich oder im rechtlichen Rahmen zu verankern <strong>und</strong> umzusetzen <strong>und</strong> im Lebensraum<br />
zu überprüfen, ob die Maßnahmen auch Wirkung zeigen.<br />
Quelle: http://www.wwf.de/themen/artenschutz/bedrohte-tiere-<strong>und</strong>-pflanzen
Biologische Vielfalt bewahren<br />
Neue Konzepte gegen den Ausverkauf der Wildnis<br />
Breitmaulnashorn in Namibia. © Ulf Dörner / WWF<br />
Wie viele Arten sind bedroht <strong>und</strong> bereits ausgestorben?<br />
Etwa vier Milliarden Jahre der Evolution haben auf unserem Planeten<br />
zur Entstehung einer Vielzahl an beeindruckenden <strong>und</strong> unscheinbaren,<br />
großen <strong>und</strong> winzigen, bunten <strong>und</strong> farblosen <strong>und</strong> häufig in ihrer Erscheinung<br />
einmaligen Arten geführt. Etwa zwei Millionen Arten -<br />
Tiere, Pflanzen, Pilze <strong>und</strong> Mikroorganismen - wurden bislang beschrieben.<br />
Diese stellen jedoch nur einen Teil der gesamten Artenzahl<br />
der Erde dar, die von Biologen vor allem aufgr<strong>und</strong> noch nicht entdeckter<br />
Kleinstlebewesen auf 10 bis 100 Millionen geschätzt wird.<br />
Die Gesamtheit der Arten <strong>und</strong> ihrer Lebensräume sowie die genetische<br />
Variabilität innerhalb einer Art werden unter dem Begriff der biologischen<br />
Vielfalt oder Biodiversität zusammengefasst.<br />
Viele Arten sind schon von Natur aus selten. Sie drohen daher rascher auszusterben als andere. Etwa weil sie groß sind<br />
<strong>und</strong> nur wenige Exemplare hervorbringen. Weil sie womöglich nur in einem begrenztem Gebiet, beispielsweise nur<br />
auf einer Insel oder in einem See vorkommen. Oder weil sie sich nur langsam fortpflanzen <strong>und</strong> Verluste nicht rasch<br />
ausgleichen können. Man darf daher bei der Einschätzung des Gefährdungsstatus einer Art nicht nur zählen, man muss<br />
auch gewichten. Der letzten Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN (2006) zufolge sind weltweit bereits 16.119<br />
Arten gefährdet - darunter ein Drittel aller Amphibienarten <strong>und</strong> ein Viertel aller Säugetierspezies.<br />
Zwischen den Jahren 1600 <strong>und</strong> 1700 lag die Aussterberate für Vögel <strong>und</strong> Säugetiere bei einer Art pro Jahrzehnt, zwischen<br />
1850 <strong>und</strong> 1950 hatte sie eine Art pro Jahr erreicht. Die derzeitige Aussterberate liegt bei 3 bis 130 Arten pro<br />
Tag! Die Rote Liste der IUCN (2006) enthält über 800 dokumentierte Fälle von ausgestorbenen Arten seit dem 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert - 784 komplett (also inklusive Zoohaltung) ausgestorbene <strong>und</strong> 65 in der Wildnis ausgestorbene Arten. Die<br />
wahre Zahl liegt jedoch vermutlich noch deutlich höher.<br />
Konzepte im <strong>Artenschutz</strong><br />
Erst in den 1970er Jahren begann weltweit der großräumige Schutz von wild lebenden Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten - zunächst<br />
über das Washingtoner <strong>Artenschutz</strong>übereinkommen CITES, einem Abkommen zur Regulierung des Handels<br />
mit ausgewählten Spezies. Seit den 1980er Jahren setzt der Naturschutz zunehmend auf die Unterschutzstellung wertvoller<br />
Lebensräume. Dennoch bleibt die Betrachtung der Art als Indikator für die Überlebensfähigkeit eines Ökosystems<br />
<strong>und</strong> damit auch für die Schutzwürdigkeit eines Lebensraums enorm wichtig. Mit der Flora-Fauna-<strong>und</strong> Habitat-<br />
Richtlinie (FFH) baut sogar ein ganzes Gesetz in der EU auf dem gezielten Schutz bestimmter Arten auf.<br />
Doch dieses Prinzip hat seine Grenzen. Viele Schutzgebiete liegen mehr <strong>und</strong> mehr wie Inseln in einem Meer von Kulturlandschaften.<br />
Immer weiter dringen landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Siedlungen in die verbleibenden Naturräume<br />
außerhalb der Schutzgebiete vor. Ein genetischer Austausch zwischen Populationen dieser „Schutzinseln“<br />
wird daher immer schwieriger <strong>und</strong> führt zu verstärkter Inzucht innerhalb der Populationen <strong>und</strong> zu größerer Anfälligkeit<br />
für Erb- <strong>und</strong> anderen Krankheiten. Ein Verb<strong>und</strong> dieser Schutzgebiete <strong>und</strong> Biotope ist für einen langfristigen Naturschutz<br />
daher unumgänglich. Ziel des <strong>Artenschutz</strong>es <strong>und</strong> damit auch des WWF ist daher,<br />
die Erhaltung wildlebender Arten in ihren natürlichen Lebensräumen auf der Basis natürlicher Lebensbedingungen<br />
sowie<br />
die Förderung einer nachhaltigen Nutzung von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten, die nicht zum Ausbeuten der jeweiligen<br />
Art führt.<br />
Quelle: http://www.wwf.de/themen/artenschutz/bedrohte-tiere-<strong>und</strong>-pflanzen/biologische-vielfalt/
Literatur zu <strong>Artenschutz</strong> <strong>und</strong> Biodiversität<br />
Biologische Vielfalt, Arbeitsheft für Gr<strong>und</strong>schule, BMU bmu@broschuerenversand.de<br />
Themen: Heilpflanzen - Apotheke Natur; Artenvielfalt; Eine Wiese voller Leben; Entdeckungsreise; Protokollvorlagen<br />
für Pflanzen- <strong>und</strong> Tierbestimmung; Streuobstwiese; alte Bäume; Regenwald; Recycling-Papier<br />
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gs_biodiv_schuelerheft.pdf (download)<br />
Naturschutz ums Haus, <strong>NABU</strong> <strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de<br />
Gartenteich, Trockenmauer, begrünte Fassaden, Dachbegrünung, Sommerblumen <strong>und</strong> Stauden, lebendige Wege<br />
<strong>und</strong> Plätze; Nisthilfen, Sommerquartiere <strong>und</strong> Überwinterungshilfen für Vögel, Wildbienen, Fledermäuse,<br />
Hummeln <strong>und</strong> Igel<br />
Wohnvergnügen, Für mehr Natur am Haus, <strong>NABU</strong> (neue Kurzfassung von Naturschutz ums Haus (s.o.)<br />
Zukunft gestalten - Natur erhalten, Umweltb<strong>und</strong>esamt (UBA) www.uba.de<br />
Umweltfre<strong>und</strong>lich Gärtnern <strong>und</strong> Kompostieren, Lebendiges Grün für Balkone, Fassaden, Dächer, Hinterhöfe <strong>und</strong><br />
Vorgärten<br />
Wir erk<strong>und</strong>en die Wiese, MURL NRW (nicht mehr erhältlich)<br />
Wiesenarten, Wiesenpflege, Stockwerke in der Wiese, "Expedition durch den Wiesendschungel", Tiere <strong>und</strong><br />
Pflanzenarten, Überlebenstricks, Gräser, Spurensuche, Blumensamen sammeln <strong>und</strong> aussäen<br />
Natürlich lernen, Themenheft "Schmetterlinge", <strong>NABU</strong> + LBV<br />
Arten <strong>und</strong> Entwicklungszyklus; Artenschw<strong>und</strong>; Beobachtungstipps; Schmetterlingsschutz (Faltertränke, Brennesselbeet,<br />
Blumenwiese); Spiele,Lieder,Basteltipps<br />
Natürlich lernen, Themenheft "Schlangen", <strong>NABU</strong> + LBV<br />
Merkmale <strong>und</strong> Nahrung, Fortbewegung, Spiel- <strong>und</strong> Bastelideen, Rätsel<br />
Erlebter Frühling, "Kreuzspinne", NAJU-Heft (Spinnen allgemein)<br />
Lebensraum, Netzbau <strong>und</strong> Netzformen, Nahrung, Fortpflanzung, Übersicht Spinnenarten, Spinnenrätsel<br />
Erlebter Frühling, "Hasel", NAJU<br />
Botanik, Lebensraum, Windbestäubung, Fraßspuren, Rätsel<br />
Große Nussjagd in NRW (2009/10), Suche nach der Haselmaus <strong>und</strong> ihren Fraßspuren<br />
Wettbewerb der NAJU NRW für junge Forscher<br />
NAJU-Versum, Heimische Schmetterlinge, Wir tun was!<br />
Wissenswertes über Schmetterlinge, Aktion Falterwiese; englisch-sprachige Rätsel; Zitronenfalter<br />
BUND, Schmetterlinge schützen<br />
Schmetterlingsarten in Deutschland; Entwicklungszyklus; gefährdete Arten; Garten- <strong>und</strong> Balkonpflanzen für<br />
Schmetterlinge; Tagfalter-Monitoring; Insektenschutz; Biotopschutz<br />
Heimische Schmetterlinge in Wort <strong>und</strong> Bild, <strong>NABU</strong> Nettetal (Insektenschutz, Biotopschutz)<br />
Bienen, Wespen <strong>und</strong> Hornissen, <strong>NABU</strong> info@<strong>NABU</strong>-Natur-Shop.de<br />
Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung; Naturgärten <strong>und</strong> Nisthilfen für Hautflügler; Blumenwiese; Biologischer<br />
Pflanzenschutz<br />
Nisthilfen für Bienen <strong>und</strong> Wespen, Infoblatt Nr.17, NUA<br />
www.nua.nrw.de poststelle@nua.nrw.de<br />
Der Igel, Pflegefall oder Outdoor-Profi? <strong>NABU</strong><br />
Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung, Winterschlaf; Gefahren; Beerensträucher, Reisighaufen, Blumenwiese,<br />
Steinmauer, Igelhäuschen
Igel sind Wildtiere <strong>und</strong> keine Hausbewohner, NUA, Informationsblatt Nr. 4<br />
poststelle@nua.nrw.de<br />
Don Cato - Die Rückkehr des Luchses (CD, Poster, Heft)<br />
Don Cato CD: Ein junger Luchs begibt sich auf die Reise durch verschiedene Naturräume in Deutschland, im<br />
Winter durch die Alpen, im Frühjahr in einer Fluss- <strong>und</strong> Auenlandschaft, im Sommer an der Küste <strong>und</strong> im<br />
Herbst im Harz. Die Geschichten, die er dabei erlebt, können Kinder per Mausklick miterleben <strong>und</strong> lernen dabei<br />
viel über die Artenvielfalt unserer Ökosysteme.<br />
Don Cato Begleitheft: Wissenswertes über Luchse <strong>und</strong> zu den verschiedenen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten in den vier<br />
Ökosystemen, die der Luchs Don Cato auf der CD durchwandert. Bilderrätsel, Quiz <strong>und</strong> Memory. Und was<br />
bedeutet eigentlich biologische Vielfalt?<br />
Don Cato Poster: Wir erhalten Lebensräume, Bilder von 87 einheimischen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />
www.bmu.de/doncato bmu@broschuerenversand.de<br />
Wölfe, BMU www.bmu.de service@bmu.de<br />
Wiederansiedelung von Wölfen in Deutschland; Rudelleben von Wölfen; Wolfsmanagement; Schutz <strong>und</strong> Aufklärung<br />
Biologische Vielfalt, Arbeitsheft für Sek<strong>und</strong>arstufe, BMU bmu@broschuerenversand.de<br />
Artenvielfalt weltweit, Biosphärenreservate <strong>und</strong> Nationalparks, Hightech aus der Natur, Filmprojekt, Kompetenzcheck<br />
Eine zusätzliche Handreichung für Lehrkräfte ist in gleichnamigem Heft enthalten, mit dem Untertitel "Materialien<br />
für Bildung <strong>und</strong> Information"<br />
Biologische Vielfalt, Die Gr<strong>und</strong>lage unseres Lebens, BMU<br />
Artenreichtum - Artensterben, Global Handeln, <strong>international</strong>e Naturschutzkonferenzen, Verantwortung von<br />
Politik <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Bedeutung der Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt, <strong>NABU</strong><br />
Fakten <strong>und</strong> Vorschläge zur Schaffung von ökologischen Vorrangflächen im Rahmen der EU-Agrarpolitik,<br />
<strong>NABU</strong> (Faltblatt <strong>und</strong> Studie) www.<strong>NABU</strong>.de <strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de<br />
Landwirtschaft 2015, Die <strong>NABU</strong>-Vision für ein Miteinander von Landwirtschaft <strong>und</strong> Naturschutz,<br />
<strong>NABU</strong> (Faltblatt <strong>und</strong> Strategiepapier)<br />
www.<strong>NABU</strong>.de <strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de