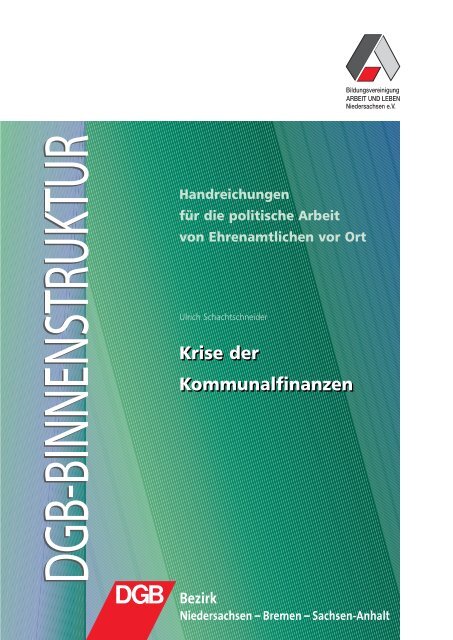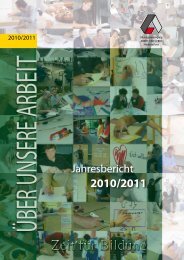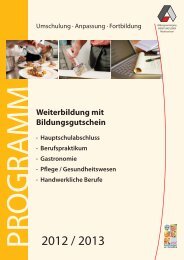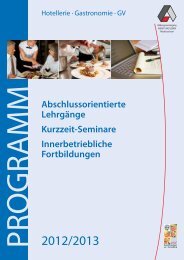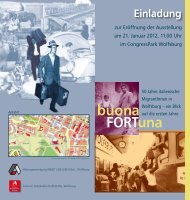Krise der Kommunalfinanzen Handreichungen ... - Arbeit und Leben
Krise der Kommunalfinanzen Handreichungen ... - Arbeit und Leben
Krise der Kommunalfinanzen Handreichungen ... - Arbeit und Leben
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Handreichungen</strong><br />
für die politische <strong>Arbeit</strong><br />
von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Ulrich Schachtschnei<strong>der</strong><br />
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Kommunalfinanzen</strong>
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nie<strong>der</strong>sachsen e. V.<br />
Landesgeschäftsstelle Hannover, Pädagogische <strong>Arbeit</strong>sstelle<br />
Verantwortlich:<br />
Carl-Bertil Schwabe<br />
Autor:<br />
Ulrich Schachtschnei<strong>der</strong><br />
Hannover, Mai 2004
<strong>Handreichungen</strong><br />
für die politische <strong>Arbeit</strong><br />
von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Ulrich Schachtschnei<strong>der</strong><br />
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Kommunalfinanzen</strong>
Inhalt<br />
Vorwort ................................................................................................... 5<br />
Einleitung ............................................................................................... 7<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben .................................................................. 9<br />
Kommunen, Land, B<strong>und</strong> ....................................................................... 9<br />
Einnahmen kommunaler Haushalte ....................................................... 10<br />
Kommunale Ausgaben – Arten ............................................................. 13<br />
Vermögens- <strong>und</strong> Verwaltungshaushalt .................................................. 15<br />
Kreis – Gemeinden – Stadt .................................................................... 15<br />
Bilanzen kommunaler Aufgabenbereiche .............................................. 17<br />
Kommunale Aufgabennereiche ............................................................. 20<br />
Entwicklung <strong>und</strong> <strong>Krise</strong> ......................................................................... 21<br />
Ausgaben für soziale Leistungen .......................................................... 21<br />
Personalausgaben ................................................................................. 23<br />
Eine Einnahmekrise ............................................................................... 24<br />
Steuern runter ...................................................................................... 25<br />
Kopfsteuer reloaded .............................................................................. 26<br />
Folge: Sinkende Investitionen ................................................................ 26<br />
Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzierung .................................................. 27<br />
Vorschlag Kommunale Spitzenverbände ............................................... 27<br />
Vorschlag des BDI ................................................................................. 28<br />
Wirkungen ........................................................................................... 29<br />
Ver.di-Eckpunkte einer Gemeindefinanzreform ..................................... 30<br />
Thesen zur Information <strong>und</strong> Diskussion ......................................... 33<br />
Literatur <strong>und</strong> Links .............................................................................. 39
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
4 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Vorwort<br />
Für die <strong>Arbeit</strong> in den Orts- <strong>und</strong> Kreisverbänden des DGB ist die Finanzausstattung <strong>der</strong><br />
Kommunen <strong>und</strong> die Gestaltung <strong>der</strong> kommunalen Haushalte von großer Bedeutung. In <strong>der</strong><br />
Einleitung zu diesem Heft werden einzelne Punkte aufgelistet, die die Relevanz <strong>der</strong> kommunalen<br />
Finanzausstattung für die Gewerkschaften benennen.<br />
Um sich qualifiziert mit den Strukturen eines kommunalen Haushaltes auseinan<strong>der</strong> setzen zu<br />
können, sind Kenntnisse über die Systematik <strong>der</strong> Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben (was sind z. B.<br />
freiwillige <strong>und</strong> was sind Pflichtaufgaben) erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Für die politische Diskussion um die zukünftige Finanzausstattung des Staates <strong>und</strong> damit<br />
auch <strong>der</strong> Kommunen sind gr<strong>und</strong>legende Informationen die Voraussetzung. Mit diesem Heft<br />
wollen wir einen Beitrag für die qualifizierte Diskussion um die Staatsfinanzen aus <strong>der</strong> Sicht<br />
von <strong>Arbeit</strong>nehmerinnen <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmern leisten.<br />
Der Deutsche Gewerkschaftsb<strong>und</strong>, Region Oldenburg/Wilhelmshaven <strong>und</strong> die Bildungsvereinigung<br />
ARBEIT UND LEBEN Nie<strong>der</strong>sachsen geben den Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen in den<br />
Orts- <strong>und</strong> Kreisverbänden mit diesem Heft gleichzeitig eine Hilfestellung, um sich mit den<br />
vielfältigen Fragen <strong>und</strong> Problemen <strong>der</strong> öffentlichen Finanzen beschäftigen zu können.<br />
Möglich wurde das vorliegende Heft durch die Finanzierung des DGB für Projekte <strong>der</strong><br />
Binnenstruktur. Finanziell hat sich daneben die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN an<br />
<strong>der</strong> Erstellung des Heftes beteiligt.<br />
Erstellt <strong>und</strong> gestaltet hat das Heft Ulrich Schachtschnei<strong>der</strong>. Er hat nicht nur die theoretischen<br />
Voraussetzungen mir <strong>der</strong> Zusammenstellung <strong>und</strong> Bewertung <strong>der</strong> Materialien geschaffen,<br />
son<strong>der</strong>n parallel in Veranstaltungen mit Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen die Materialien praktisch<br />
erprobt <strong>und</strong> Thesen zur Information <strong>und</strong> Diskussion erarbeitet, die das <strong>Arbeit</strong>en mit diesem<br />
Heft erleichtern sollen <strong>und</strong> hier ebenfalls abgedruckt sind (siehe Seite 33ff). Zudem gibt es<br />
für die Städte Delmenhorst <strong>und</strong> Wilhelmshaven Beiblätter mit ortsspezifischen Daten. Sie<br />
sind auf Anfrage erhältlich (siehe Adressen auf <strong>der</strong> Rückseite des Umschlags).<br />
Wir danken Ulrich Schachtschnei<strong>der</strong> für seine <strong>Arbeit</strong>.<br />
Manfred Klöpper<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> DGB-Region<br />
Oldenburg/Wilhelmshaven<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Bernd Bischoff<br />
Regionalleiter<br />
ARBEIT UND LEBEN Nds. e. V., Region Nord<br />
Vorwort<br />
5
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
6 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Einleitung<br />
Die Schere zwischen privatem Reichtum <strong>und</strong> öffentlicher Armut öffnet sich weiter. So wie alle<br />
öffentlichen Haushalte sind auch die <strong>Kommunalfinanzen</strong> durch die ökonomischen <strong>und</strong> politischen<br />
Entwicklungen in einer krisenhaften Situation hineinmanövriert worden. In jüngster<br />
Zeit nahmen die Einbrüche bei den Einnahmen dramatische Formen an, so dass eine<br />
Gemeindefinanzreform von allen gesellschaftlichen Gruppen für nötig gehalten wird. Ein<br />
erster Entwurf <strong>der</strong> daraufhin eingerichteten Kommission liegt bereits vor <strong>und</strong> könnte schon<br />
Anfang 2004 zur Anwendung gelangen.<br />
Gewerkschafter/Innen sind mit dem Thema Gemeindefinanzen in ihrem betrieblichen <strong>und</strong><br />
außerbetrieblichen Alltag ständig konfrontiert. Dies ist beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> Fall, wenn zum Beispiel<br />
• um Tarife im öffentlichen Dienst gestritten wird,<br />
• Sozialhilfeempfänger zu niedrigst bezahlter <strong>Arbeit</strong> gezwungen werden sollen, um die<br />
kommunalen Ausgaben für Leistungen für Sozialhilfe zu senken,<br />
• kommunale Einrichtungen Personal <strong>und</strong> Sachmittel einsparen o<strong>der</strong> geschlossen werden<br />
sollen,<br />
• Zuschüsse gekürzt werden,<br />
• kommunale Investitionen thematisiert werden.<br />
Zudem haben Än<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Einnahme- sowie <strong>der</strong> Ausgabenstruktur immer auch verteilungs-<br />
<strong>und</strong> sozialpolitische Wirkungen. Allein dies erfor<strong>der</strong>t ein hohes Interesse von<br />
GewerkschafterInnen an Finanzpolitik – auf welcher Ebene auch immer.<br />
In <strong>der</strong> Praxis wird es dann häufig schnell schwierig <strong>und</strong> unübersichtlich. Bei je<strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung<br />
kontern Experten mit Zahlen, die angeblich keine an<strong>der</strong>e Lösung zulassen. Der vermeintliche<br />
Sachzwang zum Kürzen bestimmter Leistungen wird so konstruiert.<br />
Um hier Aussagen einschätzen zu lernen, gegebenenfalls argumentativ gegenhalten zu können,<br />
muss man nicht seinerseits Experte werden. Nötig ist allerdings, einen Überblick zu<br />
gewinnen über einige wesentliche Gr<strong>und</strong>lagen kommunalen Finanzwesens:<br />
• Struktur (Arten) von Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben,<br />
• Größenordnung verschiedener Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben,<br />
• Entwicklung verschiedner Ausgaben/ Einnahmen in den letzten Jahren.<br />
Mit diesem Basiswissen können die aktuellen Reformvorschläge zur Verbesserung <strong>der</strong><br />
<strong>Kommunalfinanzen</strong> besser eingeschätzt werden – mit ihren Auswirkungen auf die Haushaltsbilanzen<br />
<strong>und</strong> ihre verteilungspolitische Wirkung.<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Einleitung<br />
7
Einleitung<br />
In diesem Heft wird vor allem die Struktur kommunaler Haushalte in Deutschland dargelegt,<br />
wie sie sich im Mittel gestaltet. Dabei wird wenig Wert auf absolute Zahlen gelegt. Es geht<br />
vor allem um Anteile, Größenverhältnisse, um Tendenzen. Örtlich werden die Verhältnisse<br />
natürlich mehr o<strong>der</strong> weniger abweichend sein. Zur Einschätzung spezifischer Verhältnisse<br />
o<strong>der</strong> Schwierigkeiten im eigenen Kreis bzw <strong>der</strong> eigenen Stadt ist ein Vergleich <strong>der</strong> durchschnittlichen<br />
Verhältnisse mit den eigenen hilfreich. Für einige Kreise bzw. kreisfreie Städte<br />
im DGB-Bezirk Wilhelmshaven/Oldenburg ist die Struktur ihrer kommunaler Ausgaben <strong>und</strong><br />
Einnahmen exemplarisch herausgearbeitet <strong>und</strong> in einem Beiblatt dokumentiert worden.<br />
Es wird sich zeigen, dass die jetzige Situation nicht durch noch so strikte Sparanstrengungen<br />
zu beheben ist. Wer wesentliche Qualitäten des unmittelbaren <strong>Leben</strong>sumfeldes für alle<br />
Bürger sowie die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten möchte, wird sich darüber<br />
Gedanken machen müssen, wie die Einnahmeseite verbessert werden kann. Hier bieten sich<br />
in diesem produktiven <strong>und</strong> reichen Land – entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt –<br />
ungenutzte Möglichkeiten.<br />
8 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben kommunaler Haushalte<br />
Kommunen, Land <strong>und</strong> B<strong>und</strong><br />
Die Kommunen sind keine eigene Staatsebene. Sie sind den Län<strong>der</strong>n zuzurechnen.<br />
B<strong>und</strong>/Län<strong>der</strong> können Kommunen wegen ihrer Gesetzgebungskompetenz<br />
zur Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichten.<br />
Sie haben zudem eigenverantwortlich zu regelnde Aufgaben: Sie sind verantwortlich<br />
für Sicherstellung eines bürgernahen <strong>und</strong> bedarfsgerechten Angebots<br />
an sozialen Einrichtungen <strong>und</strong> Dienstleistungen.<br />
Die kommunale Selbstverwaltung ist im Gr<strong>und</strong>gesetz garantiert. Deshalb erhalten<br />
die Kommunen Finanzhoheit <strong>und</strong> haben ein Recht auf angemessene Mittelausstattung.<br />
Aus <strong>der</strong> Selbstverwaltung ergibt sich aber auch eine finanzielle<br />
Eigenverantwortung. Aus ihr leitet sich etwa das Recht auf „wirtschaftsbezogene<br />
Einnahmequellen” (mit Hebesatzrecht) ab.<br />
Einnahmen <strong>der</strong> Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 2002 (Ost <strong>und</strong> West)<br />
Werte für das gesamte B<strong>und</strong>esgebiet. Eigene Zusammenstellung nach Berechnungen <strong>und</strong> Schätzungen für 2002<br />
(nach DIW Berlin sowie Prognose <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esvereinigung <strong>der</strong> kommunalen Spitzenverbände)<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
9
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Einnahmen kommunaler Haushalte<br />
Die Grafik auf <strong>der</strong> vorherigen Seite zeigt die Verteilung <strong>der</strong> einzelnen Einnahmequellen<br />
aller Gemeinden <strong>und</strong> Kreise (= Gemeindeverbände) im gesamten B<strong>und</strong>esgebiet.<br />
Die Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände erhalten ihre Einnahmen im<br />
wesentlichen aus folgenden Arten von Quellen:<br />
• Anteile aus Steuern des B<strong>und</strong>es, Zuweisungen vom Land 50%<br />
• Eigene Steuern 19%<br />
• Gebühren, Beiträge 11%<br />
• Wirtschaftliche Tätigkeiten, Verkäufe 11%<br />
Die Einnahmequellen gestalten sich im einzelnen wie folgt:<br />
� Gewerbesteuer – Prozentangaben immer bezogen auf Gesamteinnahmen: 12 %<br />
- Schlüssel:<br />
Gewerbeertrag x Steuermesszahl x Hebesatz<br />
• Gewerbeertrag: Gewinn nach Abzügen (z. B. Verluste aus früheren Jahren)<br />
• Steuermesszahl:<br />
- Kapitalgesellschaften: 5%,<br />
- Personengesellschaften: 1 – 5% je 12.500 €,<br />
- Freibetrag: 24.500 €<br />
• Hebesatz:<br />
von Gemeinde festzulegen Schnitt im Jahr 1999: 392% (West), 356% (Ost)<br />
Streuung: 97% >250% (West)<br />
83% >250% (Ost)<br />
• Zerlegung auf mehrere Kommunen möglich (nach Höhe <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>slöhne)<br />
• Bei Personenunternehmen: Pauschalanrechnung auf ESt<br />
• Gewerbesteuerumlage an B<strong>und</strong> (28%) nach nivellierten Hebesätzen<br />
Probleme:<br />
• Konjunkturabhängig bei reiner Ertragsbesteuerung<br />
• Tendenz zur Großbetriebssteuer<br />
• Anfälligkeit gegenüber kurzfristigen Unternehmensentscheidungen<br />
(Verlagerung, Umgruppierung)<br />
10 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
� Gr<strong>und</strong>steuer 6 %<br />
• Forstwirtschaftlich: Gr<strong>und</strong>steuer A<br />
übrige: Gr<strong>und</strong>steuer B (96,6%)<br />
• Schlüssel:<br />
Einheitswert x Messzahl x Hebesatz<br />
• Einheitswerte von 1964 bzw. 1935 (Ost)<br />
• Messzahl: z. B. 3,5% für ein Einfamilienhaus<br />
• Hebesatz: von Gemeinde festzulegen. Schnitt 1999: 366% (West),<br />
372% (Ost)<br />
• darf auf Mieter überwälzt werden<br />
� Sonstige Gemeindesteuern
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
• Ausgleich von Steuerkraftunterschieden <strong>und</strong> unterschiedlichen Bedarfen:<br />
- Bedarfsindikatoren:<br />
- Hauptansatz: Einwohner<br />
- Nebenansätze: Soziallasten, <strong>Arbeit</strong>slose, Flächen, Schüler u. a.<br />
• Spezielle Erstattungen <strong>und</strong> Zuweisungen<br />
- bestimmte Schulen, Jugendschutz, Bauüberwachung u. a.<br />
- Erstattung von Zahlungen für Wohngeld<br />
- Anteilige Sozialhilfe<br />
� Investitionszuweisungen 5 %<br />
• Zuweisungen über Län<strong>der</strong><br />
• einmalig zweckgeb<strong>und</strong>en, Anteilsfinanzierung (in Vermögenshaushalt)<br />
• an Unternehmen<br />
� Gebühren <strong>und</strong> Beiträge 11%<br />
• Gebühren<br />
- für direkte Gegenleistungen<br />
z.B.: Verwaltungsgebühren (Beurk<strong>und</strong>ungen, Genehmigungen)<br />
z.B.: Benutzungsgebühren (Müll, Straßenreinigung, Bä<strong>der</strong>, Musikschulen,<br />
Friedhöfe, Abwasser)<br />
- Höhe „im angemessenen Verhältnis zum Nutzen”<br />
- sozial staffelbar („Leistungsfähigkeitsprinzip”)<br />
• Beiträge:<br />
z. B.: Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen/ Versorgungsanschlüsse (in<br />
Vermögenshaushalt)<br />
� Sonstiges 11 %<br />
Darunter:<br />
• Verkäufe von Gr<strong>und</strong>stücken, Unternehmen – 5% (in Vermögenshaushalt)<br />
� Wirtschaftliche Betätigung 6 %<br />
• Laufende wirtschaftliche Tätigkeiten – Verkauf, Mieten, Pachten,<br />
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile von Gr<strong>und</strong>stücken<br />
� Kreditaufnahme 3%<br />
• Letztes Mittel, nach Gemeindehaushaltsrecht nur zur Finanzierung von<br />
Investitionen (in Vermögenshaushalt)<br />
12 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Kommunale Ausgaben – Arten<br />
Die Struktur kommunaler Ausgaben, aufgeteilt nach Ausgabenarten, stellt sich<br />
wie folgt dar:<br />
� Personal 26 %<br />
• Löhne, Gehälter aller Beschäftigten <strong>der</strong> Stadtverwaltung (incl.<br />
Straßenreinigung, Kin<strong>der</strong>garten etc.)<br />
� Sachaufwand 19 %<br />
• Laufende Sachmittel, alle Bereiche<br />
� Soziale Leistungen (Übertragungen) 19 %<br />
Darunter:<br />
• Sozialhilfe nach BSHG: Hilfe zum <strong>Leben</strong>sunterhalt ca. 7%<br />
Ausgaben <strong>der</strong> Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 2002 (Ost <strong>und</strong> West)<br />
Quelle: siehe Grafik “Einnahmen”<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
13
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
• Sonstige Leistungen nach BSHG<br />
(Krankenhilfe, Einglie<strong>der</strong>ungen für Behin<strong>der</strong>te..) ca. 7%<br />
• Leistungen nach Asylberwerberleistungsgesetz ca. 1%<br />
• Leistungen für Kriegesopfer u. ä. ca. 1%<br />
• Jugendhilfeleistungen nach KJHG (Heime, betreutes Wohnen)... ca. 3%<br />
(Prozentangaben beziehen sich auf Gesamtausgaben)<br />
� Soziale Einrichtungen 5 %<br />
• Pflegeeinrichtungen<br />
• Wohnungslose<br />
• Selbsthilfegruppen u. a.<br />
• Jugendhilfeeinrichtungen (Freizeitstätten, Krippen <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>gärten)<br />
� Sachinvestitionen 16%<br />
• Zuschüsse (z.B. Krankenhausumlage, Erschließungsbeiräge an<br />
Energieversorger, Sporteinrichtungen)<br />
• Vermögenserwerb (Gr<strong>und</strong>stücke, Ausstattungen)<br />
• Baumaßnahmen<br />
� Zinsen 4 %<br />
� Sonstiges 10 %<br />
Darunter<br />
• Darlehen, Beteiligungen, Tilgungen 2%<br />
• Unternehmen 3%<br />
• Erwerbungen 2%<br />
(Prozentangaben beziehen sich auf Gesamtausgaben)<br />
14 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Vermögens- <strong>und</strong> Verwaltungshaushalt<br />
Kommunale Haushalte sind aufgeteilt in Verwaltungs- <strong>und</strong> Vermögenshaushalt.<br />
• Im Vermögenshaushalt werden alle Ein- <strong>und</strong> Ausgaben erfasst, die für<br />
die Entwicklung des kommunalen Vermögens relevant sind, z.B. Kauf<strong>und</strong><br />
Verkauf, Kosten für Baumaßnahmen <strong>und</strong> für größere Einrichtungsgegenstände,<br />
Tilgungen.<br />
• Der Verwaltungshaushalt umfasst alle an<strong>der</strong>en Ausgaben <strong>und</strong> Einnahmen.<br />
Er regelt den laufenden Betrieb, also z. B. Personalausgaben, laufende<br />
Sachmittel, Sozial- <strong>und</strong> Jugendhilfe, Zuschüsse <strong>und</strong> Zuweisungen,<br />
Zinszahlungen<br />
• Beide Teile des Haushaltes sind getrennt zu bilanzieren<br />
• Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt müssen dem Vermögenshaushalt<br />
zugeführt werden. Bei nicht ausgeglichenem Verwaltungshaushalt<br />
ist mindestens ein Pflichtteil in Höhe <strong>der</strong> Tilgungsleistungen an den<br />
Vermögenshaushalt zu übertragen.<br />
Die Vermögenshaushalte <strong>der</strong> Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände <strong>der</strong> BRD im<br />
Jahre 1999 beliefen sich insgesamt auf etwa 41 Mrd., das sind etwa 36% des<br />
Einnahmevolumens <strong>der</strong> Verwaltungshaushalte (114 Mrd. €) * .<br />
Vermögenshaushalte<br />
Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 1999 *<br />
* Eigene Zusammenstellung <strong>und</strong> Berechnung nach Angaben des Statistischen B<strong>und</strong>esamtes 1999<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
15
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Kreis – Gemeinden – Land<br />
Die Struktur <strong>der</strong> Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben, wie sie oben für alle Gemeinden<br />
prinzipiell dargestellt worden ist, gilt gleichermaßen für kreisfreie Städte sowie<br />
für Kreise mit ihren kreisangehörenden Gemeinden. Bei den Kreisen existiert<br />
jedoch eine Aufgabenteilung zwischen Gemeinden <strong>und</strong> Kreis.<br />
• Die Kommunen sind entwe<strong>der</strong> kreisfreie Städte o<strong>der</strong> kreisangehörige<br />
Gemeinden. Der Landkreis (ein „Gemeindeverband”) <strong>und</strong> die Gemeinden<br />
übernehmen zusammen die gleichen Aufgaben, die kreisfreie Städte<br />
auch haben.<br />
• Die Gemeinden finanzieren sich im Prinzip ebenso wie die kreisfreien<br />
Städte. Sie haben jedoch an den Landkreis eine Kreisumlage (ca. 30%)<br />
abzugeben. Dafür deckt <strong>der</strong> Landkreis bestimmte Zentrale Aufgaben ab.<br />
Zu den Pflichtleistungen gehören in <strong>der</strong> Regel u.a. Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendhilfe,<br />
Abfallbeseitigung, Krankenhausversorgung, Kreisstraßen, Schulen<br />
des Sek<strong>und</strong>arbereichs I <strong>und</strong> II, Berufs- <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>schulen, Bauaufsicht,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsamt, Veterinärwesen, Umweltschutz. Freiwillige Leistungen<br />
sind Volksbildung, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Kulturpflege. (Diese gilt für<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen; die Aufgaben variieren je nach B<strong>und</strong>esland). Der Landkreis<br />
finanziert sich ansonsten wie kreisfreie Städte.<br />
• Der Landkreis als Gemeindeverband erhebt keine eigenen Steuern <strong>und</strong><br />
bekommt auch keine Anteile an den B<strong>und</strong>essteuern. Ansonsten hat er<br />
Einnahmen wie kreisfreie Städte auch.<br />
16 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Bilanzen kommunaler Aufgabenbereiche<br />
Um zu beurteilen, wie einzelne kommunale Tätigkeiten finanziert sind, welche<br />
Zuschüsse sie erfor<strong>der</strong>n <strong>und</strong> welche Dimension <strong>der</strong>en Ausgabe- <strong>und</strong> Einnahmevolumen<br />
aufweist, sind im folgenden wesentliche Aufgabenbereiche mit <strong>der</strong><br />
Zusammensetzung ihrer Einnahmen, Ausgaben sowie ihres „Zuschussbedarfes”<br />
(in <strong>der</strong> Grafik gestrichelt angedeutet) aus allgemeinen Mitteln dokumentiert.<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
• Gemeindeorgane<br />
• Finanzverwaltung<br />
• Sonst. allgemeine Verwaltung<br />
Legende:<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
• Öffentliche Ordnung<br />
• Umweltschutz<br />
• Feuerschutz/Rettungsdienste<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
17
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Schulen<br />
• Schulverwaltung<br />
• Schulen<br />
• Schülerbeför<strong>der</strong>ung<br />
Sozialhilfe nach BSHG:<br />
laufende Übertragungen<br />
• Hilfe zum <strong>Leben</strong>sunterhalt (ca. 50%)<br />
• Sonstige Leistungen nach dem BSHG<br />
(Krankenhilfe, Einglie<strong>der</strong>ungshilfen f.<br />
Behin<strong>der</strong>te)<br />
Kultur<br />
• Theater, Konzerte, Musikpflege<br />
• Volksbildung<br />
• Museen, Archive, Forschung,<br />
Kulturpflege<br />
Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />
• Krankenhäuser<br />
• Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege/ - verwaltung<br />
• Sportstätten/ Badeanstalten<br />
• Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />
18 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Jugendhilfe<br />
• Jugendhilfe nach dem KJHG<br />
• Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendhilfe<br />
Bau <strong>und</strong> Verkehr<br />
• Bauverwaltung<br />
• Städteplanung/Vermessung/Bauordnung<br />
• Wohnungswesen<br />
• Gemeinde- <strong>und</strong> Kreisstrassen<br />
• Wasserabläufe<br />
• Straßenbeleuchtung, Reinigung<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
• Abwasser, Abfallbeseitigung<br />
• Sonstige Gemeinschaftsdienste<br />
• Fremdenverkehr+Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />
(ca. 10%)<br />
Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />
19
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Kommunale Aufgabenbereiche<br />
Die Einzelbilanzen zeigen, dass fast alle kommunalen Aufgabenbereiche zu<br />
weit mehr als 50% aus allgemeinen Mitteln – also aus den Steuern <strong>und</strong> aus allgemeinen<br />
Finanzzuweisungen getragen werden müssen. Nur die öffentlichen<br />
Dienstleistungen Abwasser, Müllabfuhr etc. können weitgehend durch entsprechend<br />
angepasste Gebühren finanziert werden.<br />
Der gesamte Bereich <strong>der</strong> Übertragung von sozialen Leistungen (im Wesentlichen<br />
Leistungen <strong>der</strong> Sozialhilfe <strong>und</strong> Jugendhilfe) ist von den Kommunen kaum<br />
beeinflussbar <strong>und</strong> wird nur zum Teil erstattet. Allerdings ist zu beachten, dass<br />
die ständige Hilfe zum <strong>Leben</strong>sunterhalt (also die Zahlungen, die im allgemeinen<br />
Sprachgebrauch als Sozialhilfe bekannt sind), nur etwa 7% (bzw. nach Abzug<br />
von Erstattungen ca. 5%) des Gesamthaushalts betragen. Ein Großteil <strong>der</strong><br />
sozialen Leistungen wird für Einglie<strong>der</strong>ungshilfe (Behin<strong>der</strong>te) <strong>und</strong> für Jugendhilfe<br />
aufgewandt.<br />
20 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Entwicklung <strong>und</strong> <strong>Krise</strong><br />
Das Gemeindefinanzsystem durchlebt seit längerem eine krisenhafte Zuspitzung.<br />
Die Ursache dafür ist im Wesentlichen in sinkenden Einnahmen zu verorten.<br />
Entgegen weit verbreiteter Meinungen hat es keine Explosion <strong>der</strong> Ausgaben<br />
gegeben. Die Ausgaben stiegen zwar absolut gesehen, also in den jeweiligen<br />
Preisen, bis etwa 1995 an.<br />
Dieser Anstieg verlief jedoch im Rahmen <strong>der</strong> Steigerung <strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichen<br />
Leistung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im selben Zeitraum etwa im<br />
gleichen Verhältnis. Der Anteil <strong>der</strong> kommunalen Ausgaben am BIP wurde ab<br />
1995 hingegen wie<strong>der</strong> geringer.<br />
Auch in absoluten Zahlen ist seit Anfang <strong>der</strong> 90er Jahre ein Rückgang zu verzeichnen,<br />
wenn die Inflation berücksichtigt wird (hier umgerechnet auf Preise<br />
von 1995).<br />
Nettoausgaben, ohne beson<strong>der</strong>e Finanzierungsvorgänbge, Stat. B<strong>und</strong>esamt. Anteil am BIP = Ausgaben/BIP (eigene Berechnungen)<br />
Quelle: Deutscher Städtetag, Preisbereinigung; eigene Berechnung<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Entwicklung <strong>und</strong> <strong>Krise</strong><br />
21
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Ausgaben für soziale Leistungen<br />
Die Ausgaben für soziale Leistungen, die etwa zur Hälfte Ausgaben nach dem<br />
B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz (BSHG) sind, steigen bis Mitte <strong>der</strong> 90er Jahre aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> steigenden <strong>Arbeit</strong>slosenzahlen deutlich an, auch in konstanten Preisen. Danach<br />
findet ein leichter Rückgang statt, <strong>der</strong> durch die Einführung <strong>der</strong> Pflegeversicherung<br />
verursacht ist. Danach stagnieren die Ausgaben. Im Verhältnis zur<br />
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> kommunalen Ausgaben<br />
für soziale Sicherung etwas mo<strong>der</strong>ater: Von 1,4 % des BSP im Jahre 1980 bis<br />
auf 2,2 % im Jahre 1995 bzw. 1,8% heute.<br />
Die Ausgaben nach dem BSHG sind übrigens nur zum Teil Hilfen zum <strong>Leben</strong>sunterhalt.<br />
Einen ebenso großen Anteil machen inzwischen die Einglie<strong>der</strong>ungshilfen<br />
für Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung aus.<br />
Quelle: Stat. B<strong>und</strong>esamt, Anteil am BSP = Ausgaben/BSP (eigene Berechnung), Preisbereinigung; eigene Berechnung<br />
Quelle: Dt. Städte- <strong>und</strong> Gemeindeb<strong>und</strong>: DStGB-Bilanz 2002/3 (* geschätzt)<br />
22 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Personalausgaben<br />
Die Personalausgaben steigen bis Anfang <strong>der</strong> 90er Jahre in jeweiligen <strong>und</strong> in<br />
konstanten Preisen an. Seit dem stagnieren sie. Die Grafik zeigt hier nur die<br />
Werte für Westdeutschland.<br />
Das Niveau <strong>der</strong> Personalausgaben in Ostdeutschland (gemessen an den Personalausgaben<br />
pro Einwohner) ist nur geringfügig höher als im Westen (106 %),<br />
nachdem es in den letzten Jahren einen stetigen Rückgang gegeben hat: 1992<br />
lagen die ostdeutschen Personalausgaben noch um fast die Hälfte höher als im<br />
Westen (143%).<br />
Quelle: Berechnungen des Städtetages nach Angaben des Stat. B<strong>und</strong>esamtes, 2002; Schätzung Preisbereinigung: eigene Berechnung<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Entwicklung <strong>und</strong> <strong>Krise</strong><br />
23
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Eine Einnahmekrise<br />
Die Kommunen haben kein Ausgabenproblem, son<strong>der</strong>n ein Einnahmeproblem.<br />
Seit 1995 sinken die Gesamteinnahmen <strong>der</strong> Kommunen. Von 1995 bis 2002<br />
gingen sie im Westen um 5,5 % zurück (in Preisen von 1995). Im Osten sanken<br />
sie von 1995 bis 2002 sogar um 17 % (in Preisen von 1995). Die Ursachen liegen<br />
im Wesentlichen an Min<strong>der</strong>einnahmen bei <strong>der</strong> Gewerbesteuer <strong>und</strong> beim<br />
kommunalen Anteil an <strong>der</strong> Einkommenssteuer.<br />
Quelle: Berechnungen des Städtetages nach Angaben des Stat. B<strong>und</strong>esamtes, 2002; Schätzung Preisbereinigung: eigene Berechnung<br />
Quelle: Berechnungen des Städtetages nach Angaben des Stat. B<strong>und</strong>esamtes, 2002; Schätzung Preisbereinigung: eigene Berechnung<br />
24 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Steuern runter<br />
Ob in <strong>der</strong> Presse o<strong>der</strong> am Stammtisch. „Steuern runter” ist eine For<strong>der</strong>ung, die<br />
überall ankommt <strong>und</strong> zunächst plausibel erscheint. Würde man im Supermarkt<br />
die K<strong>und</strong>en befragen: „Wollen sie weniger bezahlen?”, das Ergebnis wäre genauso<br />
klar.<br />
Für die Gemeinden ist eine Politik <strong>der</strong> Steuersenkung seit etwa 10 Jahren Realität.<br />
Ihre wichtigsten Einnahmequellen gehen zurück:<br />
� Anteil an <strong>der</strong> Einkommenssteuer – 11% 1<br />
Ursachen:<br />
• Sinkende Steuersätze verringern Verteilungsmasse (z.B. Spitzensteuersatz)<br />
• Min<strong>der</strong>einnahmen durch Verrechnung b<strong>und</strong>espolitisch motivierter Zuschüsse<br />
(EHZ, Kin<strong>der</strong>geld, Zulagen zur privaten Altersvorsorge etc.) mit<br />
dem Einkommensteueraufkommen<br />
• Schlechtere Konjunktur<br />
� Gewerbesteuer – 21%<br />
Ursachen:<br />
• Ausgeweitete Möglichkeiten, Steuer-Schlupflöcher zu nutzen<br />
(“Gestaltbarkeit”)<br />
• schlechtere Konjunktur<br />
• Entwicklung hin zur Besteuerung weniger „Großbetriebe” mit entsprechend<br />
unstetigen Gewinnverläufen<br />
� Zuweisungen (allgemeine <strong>und</strong> Investitionszuweisungen) – 1% 2<br />
Ursachen:<br />
• Verringerte Verteilungsmasse bei Land <strong>und</strong> B<strong>und</strong> durch<br />
- Einbruch bei <strong>der</strong> Körperschaftssteuer<br />
- Wegfall <strong>der</strong> den Län<strong>der</strong>n zu Gute kommenden Vermögenssteuer<br />
- schlechtere Konjunktur<br />
Die Gemeinden <strong>und</strong> mit ihnen die meisten ihrer Bürger <strong>und</strong> Bürgerinnen leiden<br />
unter <strong>der</strong> Politik <strong>der</strong> Steuersenkungen, die vor allem Besserverdienenden zu Gute<br />
kommen. Folge ist die Einschränkung o<strong>der</strong> Verteuerung von kommunalen (<strong>und</strong><br />
an<strong>der</strong>en) Leistungen. Dies spüren in <strong>der</strong> Regel Menschen mit geringerem Einkommen.<br />
Ihre relativ geringe Steuerersparnis wird so per saldo aufgehoben o<strong>der</strong><br />
führt zu einer realen Mehrbelastung ihrer alltäglichen Ausgaben (z.B. für Kin<strong>der</strong>betreuung,<br />
Schulbücher, Klassenfahrten, Benutzung von Sportanlagen etc.)<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Entwicklung <strong>und</strong> <strong>Krise</strong><br />
Anmerkungen:<br />
1 Entwicklung von 1992 bis 2002 (in<br />
Preisen von 1995<br />
2 von 1992 bis 1999<br />
25
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Kopfsteuer reloaded<br />
In dieser Not werden vielerorts kommunale Versorgungseinrichtungen privatisiert,<br />
um kurzfristig Geld in die Kassen zu spülen. Das ist zunächst verständlich,<br />
verstärkt jedoch die verteilungspolitische Schieflage: Früher o<strong>der</strong> später werden<br />
sich die Investoren ihre Investition, z. B. in ein kommunales Abwassernetz über<br />
entsprechend höhere Gebühren zurückholen. Das bisherige Eigentum muss von<br />
den Gemeindebürgern ein zweites Mal finanziert werden. Bei vielen ehedem<br />
kommunalen Diensten trifft dies jeden Bürger gleichmäßig: Eine Kopfsteuer!<br />
Folge: Sinkende Investitionen<br />
Unter den Bedingungen sinken<strong>der</strong> Einnahmen mussten die Gemeinden die<br />
Ausgaben für Sachinvestitionen stark zurückfahren Von 1992 bis 2000 ist ein<br />
Rückgang um etwa 30% zu verzeichnen, mit negativen Auswirkungen auf die<br />
Qualität von Verkehrsinfrastruktur, Schulen, Bä<strong>der</strong>n <strong>und</strong> an<strong>der</strong>em.<br />
Das difu (Deutsches Institut für Urbanistik) hat für den Zeitraum von 2000 bis<br />
2009 für die alten B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong> einen Investitionsbedarf in Höhe von ca. 450<br />
Mrd. € errechnet (davon Verkehr 27 %, soziale Infrastruktur 20 %, Wasserversorgung<br />
u. Umweltschutz 20 %). Dies entspräche einer Aufstockung <strong>der</strong> Investitionen<br />
um 40-50 % im Vergleich zu heute. Diese Ergebnisse wi<strong>der</strong>legen die<br />
oft geäußerte Sättigungsthese, nach <strong>der</strong> eine Aufstockung kommunaler Investitionen<br />
„purer Luxus” seien.<br />
Quelle: Stat. B<strong>und</strong>esamt, Anteil am BSP = Ausgaben/BSP (eigene Berechnung), Preisbereinigung; eigene Berechnung<br />
26 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen<br />
Die Notwendigkeit einer Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen ist angesichts <strong>der</strong> dramatischen<br />
Lage vieler Kommunen inzwischen überall anerkannt. Seit 2002 besteht<br />
eine Kommission zur Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen unter Fe<strong>der</strong>führung<br />
des B<strong>und</strong>esministerium für Finanzen (BMF), in <strong>der</strong> u. a. Vertreter <strong>der</strong> Gemeinden,<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong>, des Handwerks <strong>und</strong> <strong>der</strong> Industrie sowie <strong>der</strong> Gewerkschaften<br />
mitwirken. Die Reformvorschläge gehen in unterschiedlichste Richtungen.<br />
Vorschlag <strong>der</strong> Kommunalen Spitzenverbände<br />
Der Deutsche Städte- <strong>und</strong> Gemeindeb<strong>und</strong> (DStGB) for<strong>der</strong>t sowohl eine Reduzierung<br />
<strong>der</strong> kommunalen Leistungsverpflichtungen als auch eine Anhebung <strong>der</strong><br />
kommunalen Einnahmen.<br />
DStGB: Mehr kommunale Einnahmen<br />
Reform <strong>der</strong> Gewerbesteuer<br />
• Einbeziehung von Freiberuflern <strong>und</strong><br />
Selbständigen<br />
• Ausweitung <strong>der</strong> Bemessungsgr<strong>und</strong>lage um<br />
gewinnunabhängige Komponenten<br />
- Zinsen<br />
- 25% <strong>der</strong> Mieten <strong>und</strong> Pachten für bewegliche<br />
Güter<br />
- 75% <strong>der</strong> Mieten <strong>und</strong> Pachten für unbewegliche<br />
Güter<br />
- Freibetrag von 25.000 € für Zinsen/Mieten,<br />
Pachten<br />
- Abschaffung des Staffeltarifs<br />
- Ertragsabhängiger Abbau des Freibetrags<br />
für Personenunternehmen<br />
- Senkung <strong>der</strong> Steuermesszahlen, differenziert<br />
nach Kapitalgesellschaften <strong>und</strong><br />
Personenunternehmen<br />
• Senkung <strong>der</strong> Gewerbesteuerumlage<br />
Hebesatzrecht auf den gemeindlichen<br />
Einkommenssteueranteil<br />
• Wirkung: Verringert die Abhängigkeit von<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> för<strong>der</strong>t „Identität von<br />
Nutzern, Zahlern <strong>und</strong> Entschei<strong>der</strong>n” – wirkt<br />
einer „Anspruchsinflation” entgegen<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen<br />
... <strong>und</strong> weniger Verpflichtungen<br />
• Abbau von „kostentreiben<strong>der</strong>” Standardsetzung<br />
durch Land, B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Rechtsprechung<br />
(z. B. technische Regelwerke, Unfallverhütung,<br />
Schulausstattung, Kin<strong>der</strong>gärten)<br />
• Die Reformvorhaben zur <strong>Arbeit</strong>slosen- <strong>und</strong><br />
Sozialhilfe müssen Gemeinden entlasten.<br />
Keine Zuständigkeit für das neue <strong>Arbeit</strong>slosengeld<br />
II („Erwerbsfähige” ohne Anspruch auf<br />
Leistungen aus <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>slosenversicherung)<br />
• Verankerung des „Konnexitätsprinzips” („Wer<br />
bestellt, bezahlt”) im Gr<strong>und</strong>gesetz. Dadurch<br />
sollen in Zukunft fehlende Kompensationen<br />
vom B<strong>und</strong> für Belastungen durch reformierte<br />
B<strong>und</strong>esgesetze nicht mehr möglich sein. Dazu<br />
gehört eine obligatorische Anhörung <strong>der</strong> Kommunen,<br />
eine Konsultationspflicht bei Gesetzgebungsverfahren<br />
27
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
Abschaffung<br />
• <strong>der</strong> Gewerbesteuer<br />
• des Anteils an <strong>der</strong> Einkommenssteuer<br />
Einführung eines kommunalen Zuschlags<br />
• auf Einkommens- <strong>und</strong> Körperschaftssteuer<br />
• Hebesatzrecht<br />
Vorschlag des BDI (B<strong>und</strong>esverband <strong>der</strong> deutschen Industrie)<br />
Der BDI for<strong>der</strong>t die Abschaffung <strong>der</strong> Gewerbesteuer <strong>und</strong> des Gemeindeanteils<br />
an <strong>der</strong> Einkommenssteuer. Als Ersatz sollen die Kommunen einen Zuschlag auf<br />
die Einkommens- <strong>und</strong> Körperschaftssteuer erheben dürfen.<br />
BDI-Modell:<br />
Einkommens- <strong>und</strong> Körperschaftssteuer<br />
• Senkung <strong>der</strong> Einkommenssteuer<br />
• Erhöhung <strong>der</strong> Körperschaftssteuer<br />
• die Summe <strong>der</strong> beiden Maßnahmen soll für<br />
die Gesamtheit <strong>der</strong> Steuerpflichtigen belastungsneutral<br />
sein<br />
28 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Wirkungen<br />
In <strong>der</strong> Kommission zur Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen sind die Modelle von<br />
DStGB <strong>und</strong> BDI durchgerechnet worden, um ihre Wirkungen auf Aufkommen<br />
<strong>und</strong> Belastungen für einzelnen Gruppen zu ermitteln:<br />
Nach <strong>der</strong> Modellrechnung<br />
• führt das Kommunalmodell (DStGB) neben einer Erhöhung <strong>der</strong> kommunalen<br />
Steuerbasis auch zu einer Verschiebung <strong>der</strong> Lasten einzelner Gruppen<br />
von Steuerzahlern. Selbständige werden stärker zur Finanzierung<br />
kommunaler Leistungen herangezogen, <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmer<br />
sinkt bei diesem Modell leicht.<br />
• hätte das BDI-Modell zur Folge, dass <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> bisher Gewerbesteuerpflichtigen<br />
sich um etwa ein Drittel verringert, <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmeranteil<br />
dagegen sich stark erhöhen würde.<br />
Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen<br />
Grafik: Nur Strukturverän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> kommunalen Steuerbasis (ohne Gr<strong>und</strong>steuer, Umsatzsteuer <strong>und</strong> sonstige Gemeindesteuern)<br />
Quelle: Gemeiondefinanzkommission 2003, <strong>Arbeit</strong>sgruppe Quantifizierung<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
29
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
ver.di: Eckpunkte einer Gemeindefinanzreform<br />
Die Gewerkschaft ver.di lehnt mehr Wettbewerb bei den kommunalen Finanzen,<br />
wie er nach dem BDI-Vorschlag entstehen würde, ab. Schon die bestehenden<br />
Unterschiede zwischen reichen <strong>und</strong> armen Gemeinden bei Ausstattungs<strong>und</strong><br />
Angebotsniveau kommunaler Leistungen sind aus Sicht von ver.di nicht<br />
akzeptabel. Das Ziel <strong>der</strong> Einheitlichkeit <strong>der</strong> <strong>Leben</strong>sverhältnisse hat für ver.di<br />
Priorität. Eine Gemeindefinanzreform muss zudem verteilungsgerecht sein.<br />
Zur Sicherung von Qualität <strong>und</strong> Quantität <strong>der</strong> Gemeindefinanzen for<strong>der</strong>t ver.di<br />
eine Reform mit folgenden Prinzipien:<br />
Sicherung von Qualität <strong>und</strong> Quantität <strong>der</strong> Gemeindefinanzen<br />
durch<br />
• eine verbesserte finanzielle Gr<strong>und</strong>ausstattung<br />
• strukturelle Reformen bei Gewerbe- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>steuer<br />
• eine Ausweitung des kommunalen Anteils an den Gemeinschaftssteuern<br />
(Einkommenssteuer <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Umsatzsteuer)<br />
Zur Erreichung <strong>der</strong> gr<strong>und</strong>legenden Ziele nach Quantität <strong>und</strong> Verteilungsgerechtigkeit<br />
können die bisherigen Elemente <strong>der</strong> Gemeindefinanzierung gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
beibehalten werden:<br />
Elemente <strong>der</strong> Gemeindefinanzierung<br />
• eine eigene Steuer mit Bezug zur lokalen Wirtschaft<br />
• einem einwohner- <strong>und</strong> wohnsitzbezogenem Baustein<br />
• einem bodenbezogenen Element<br />
• <strong>der</strong> Umsatzsteuer als weiterem wirtschaftsbezogenem Element<br />
Diese bestehenden Steuerelemente haben sich von ihrem Prinzip her bewährt,<br />
müssen aber neu ausgestaltet werden:<br />
Durch die Einbeziehung von Freiberuflern wird die Gewerbesteuer auf mehr<br />
Schultern verteilt. Ein Mehraufkommen kann erzielt werden, ohne das die jetzt<br />
noch Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen mehr belastet werden.<br />
30 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Gewerbesteuer<br />
• Verbreiterung <strong>der</strong> Bemessungsgr<strong>und</strong>lage d. Reduzierung v. Freibeträgen<br />
• Stopfen von Schlupflöchern<br />
• Erweiterung des Kreises von Steuerpflichtigen, v. a. durch Einbeziehung<br />
von Freiberuflern<br />
Zur Erhöhung <strong>und</strong> zur Verstetigung <strong>der</strong> kommunalen Einnahmen tragen auch<br />
ein höherer Anteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer sowie eine Erhöhung <strong>der</strong> Bemessungsgr<strong>und</strong>lage<br />
<strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>steuer bei:<br />
Erhöhung des Anteils an <strong>der</strong> Umsatzsteuer<br />
Vorteile:<br />
• Langsame Zunahme im Zuge <strong>der</strong> allgemeinen Wirtschaftsentwicklun<br />
• Verstetigung durch Konjunkturunabhängigkeit<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>steuer<br />
• Aktualisierung <strong>der</strong> Wertbasis<br />
• Verbreiterung <strong>der</strong> Bemessungsgr<strong>und</strong>lage (Abbau von Steuerbefreiungen)<br />
Um mehr Zuweisungen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> für ihre Kommunen zu ermöglichen, hält<br />
ver.di eine Stärkung <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>finanzen für nötig.<br />
Verteilungsgerechte Stärkung <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>finanzen<br />
• eine verfassungsgemäße Reform <strong>und</strong> Wie<strong>der</strong>einführung <strong>der</strong><br />
Vermögenssteuer<br />
• eine Erhöhung <strong>der</strong> Erbschaftssteuer. Dabei sollen<br />
Immobilienvermögen nicht länger gegenüber Geldvermögen bevorteilt<br />
werden<br />
Ver.di hält eine B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> ggf. auch Län<strong>der</strong>(mit)finanzierung bei gesamtgesellschaftlichen<br />
Aufgaben für richtig. Es sollte das Äquivalenzprinzip mehr beachtet<br />
werden: „Wer bestellt, bezahlt!”. Wenn Kommunen durch Verän<strong>der</strong>un-<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen<br />
31
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
gen belastet werden, die vom B<strong>und</strong> verantwortet sind, sollten sie auch Kompensationszahlungen<br />
dafür erhalten. Dies gilt etwa für folgende Bereiche:<br />
Finanzierungsbeteiligung durch den B<strong>und</strong>:<br />
• Sozialhilfe<br />
• Familienlastenausgleich<br />
• Kin<strong>der</strong>betreuung (Recht auf Kin<strong>der</strong>gartenplatz)<br />
• Altersversorgung<br />
Zur Stärkung struktur- <strong>und</strong> finanzschwacher Gemeinden mit Kernfunktion für<br />
das Umland sollte zudem über die Verteilung des Einkommenssteueranteils diskutiert<br />
werden:<br />
Stärkung <strong>der</strong> Kernstädte durch neue Verteilung des Anteils an<br />
<strong>der</strong> Einkommenssteuer (ESt.)<br />
• Abschwächung des Wohnsitzprinzips<br />
• Teilweise Verteilung nach <strong>Arbeit</strong>sstätten<br />
32 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Thesen zur Information <strong>und</strong> Diskussion<br />
These 1: Einnahmekrise<br />
Die <strong>Krise</strong> <strong>der</strong> Kommunen ist eine Einnahmekrise. Die Einnahmen <strong>der</strong> Kommunen<br />
halten nicht Schritt mit <strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.<br />
Fragen:<br />
• Wie ist die Einnahmestruktur?<br />
- In <strong>der</strong> BRD/ in unserer Kommune?<br />
• Wie entwickeln sich die Einnahmen?<br />
- In absoluten Zahlen? In inflationsbereinigten Zahlen?<br />
- In <strong>der</strong> BRD/ in unserer Kommune?<br />
• Wie entwickelt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung?<br />
- Wie entwickelt sich das Verhältnis kommunale Einnahmen –<br />
gesamtwirtschaftliche Entwicklung?<br />
• Wie entwickeln sich die Steuereinnahmen?<br />
- In absoluten Zahlen? In inflationsbereinigten Zahlen?<br />
- In <strong>der</strong> BRD/ in unserer Kommune?<br />
• Wie entwickeln sich Ausgaben?<br />
- Personalkosten?<br />
- Sozialleistungen?<br />
- Investitionen?<br />
- In <strong>der</strong> BRD/ in unserer Kommune?<br />
Material zur Situation b<strong>und</strong>esweit:<br />
• „Ver.di for<strong>der</strong>t eine stabile <strong>und</strong> solidarische Gemeindefinanzierung”<br />
Beschluss des B<strong>und</strong>esvorstandes 18.02.02<br />
• Gemeindefinanzierung (Projekt <strong>Kommunalfinanzen</strong> DGB-Region OL-<br />
WHV)<br />
Material zur Situation vor Ort:<br />
• Haushaltsbücher (Hg.: Kommunen),<br />
• Internet: homepage <strong>der</strong> Kommunen<br />
• Bürgerinformation <strong>der</strong> Kommunen<br />
• Orts-Infos (Projekt <strong>Kommunalfinanzen</strong> DGB- Region OL-WHV<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Thesen zur Information <strong>und</strong> Diskussion<br />
33
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
These 2: Privatisierung untauglich<br />
Die Privatisierung kommunaler Dienstleistungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verkauf kommunaler<br />
Infrastruktur hat die Wirkung einer Kopfsteuer. Längerfristig wird sie<br />
zudem die kommunalen Haushalte belasten.<br />
Fragen:<br />
• Warum wirken Privatisierungen wie eine Kopfsteuer?<br />
• Welche Wirkung auf kommunalen Haushalte wird die Herausnahme profitabler<br />
Sektoren haben?<br />
• Sind private Unternehmen kostengünstiger? Wenn ja, warum?<br />
• Welche Privatisierungspläne gibt es in meiner Kommune?<br />
Material zum Thema: Privatisierung <strong>der</strong> Wasserwirtschaft:<br />
• Privatisierung im Wassersektor (Hg.: WEED) ISBN: 3-9806757-8-5<br />
• Ware Wasser (Hg. ISW - institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung<br />
e. V., isw_muenchen@t-online.de)<br />
• Durst nach mehr: Wieviel Privatisierung verträgt die Wasserwirtschaft?<br />
Mitbestimmung 4/2002 (Hg. Hans Böckler Stiftung)<br />
34 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
These 3: Öffentliche Armut: Politisch gewollt<br />
Die Zurückdrängung öffentlicher Aufgaben wird von <strong>der</strong> herrschenden<br />
neoliberalen Ideologie als ohnehin richtiger Weg angesehen. Politisch<br />
durchgesetzt wird er über die Politik <strong>der</strong> Steuersenkungen.<br />
Fragen:<br />
• Welche Argumente werden gegen die öffentliche Hand angeführt?<br />
• Was ist davon bedenkenswert? Was falsch?<br />
• Wie wird die Unumgänglichkeit von Steuersenkungen begründet?<br />
• Profitieren alle Bürger mehr o<strong>der</strong> weniger von Steuersenkungen?<br />
Material:<br />
• ver.di for<strong>der</strong>t eine stabile <strong>und</strong> solidarische Gemeindefinanzierung.<br />
Beschluss des ver,di- B<strong>und</strong>esvorstands vom 18.02.2002<br />
Herausgeber: ver.di, 2003<br />
• Staatsfinanzen stärken – Zukunftsaufgaben zwischen öffentlicher Armut<br />
<strong>und</strong> privatem Reichtum<br />
Herausgeber: ver.di 2002, Bereich Wirtschaftspolitik<br />
• Finanzpolitik für <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Gerechtigkeit<br />
Einnahmen stärken statt Ausgaben kürzen<br />
Herausgeber: ver.di 2002, Bereich Wirtschaftspolitik<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Thesen zur Information <strong>und</strong> Diskussion<br />
35
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
These 4: Gefährliche Miwirkung<br />
Als GewerkschafterIn sollte man nicht an einem alternativen Sparkonzept<br />
mitarbeiten. Je<strong>der</strong> alternative Kürzungsvorschlag legitimiert die Politik <strong>der</strong><br />
Austrocknung<br />
Fragen:<br />
• Welchen Nutzen können alternative Sparkonzepte aus gewerkschaftlicher<br />
Sicht bringen?<br />
• Welchen Schaden können sie bewirken?<br />
• Wie ist die Gesamtbilanz?<br />
• Was wäre <strong>der</strong> Nutzen in meiner Kommune?<br />
36 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
These 5: Mehr Autonomie: Mehr Ungleichheit<br />
Ein kommunales Hebesatzrecht auf die Einkommenssteuer, wie vom BDI<br />
vorgeschlagen, wird die finanziellen Unterschiede zwischen den<br />
Kommunen vergrößern.<br />
Fragen:<br />
• Welche Vorschläge zur Sanierung <strong>der</strong> Gemeindefinanzen liegen auf dem<br />
Tisch? (Städte- <strong>und</strong> Gemeindeb<strong>und</strong>, BDI, ver.di)<br />
• Welche verteilungspolitische Wirkung haben sie?<br />
• Was bewirkt ein Hebesatzrecht auf die gesamten kommunalen<br />
Steuereinnahmen?<br />
• Der Städte- <strong>und</strong> Gemeindeb<strong>und</strong> for<strong>der</strong>t einen Rückgang <strong>der</strong><br />
Verpflichtungen von Kommunen, etwa: weniger Standardsetzungen.<br />
Was ist davon zu halten?<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Thesen zur Information <strong>und</strong> Diskussion<br />
37
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
These 6: Geld ist genug da<br />
Wer einen Nie<strong>der</strong>gang <strong>der</strong> Kommunen verhin<strong>der</strong>n will, muss die Politik <strong>der</strong><br />
Steuersenkungen angreifen bzw. Steuererhöhungen for<strong>der</strong>n.<br />
Fragen:<br />
• Ist eine Erhöhung <strong>der</strong> Gewerbesteuereinnahmen ausreichend?<br />
• Welche Steuern könnten erhöht werden, ohne negative Auswirkungen<br />
auf die Konjunktur befürchten zu müssen?<br />
38 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort
Literatur <strong>und</strong> Links<br />
Zum Vertiefen <strong>und</strong> Weiterlesen:<br />
Broschüren:<br />
• <strong>Kommunalfinanzen</strong> in Deutschland <strong>und</strong> Europa - Stand, Debatte <strong>und</strong><br />
Alternativen.<br />
Dokumentation eines workshops <strong>der</strong> Hans-Böckler-Stiftung <strong>und</strong> ver.di.<br />
Herausgeber: ver.di, 2003<br />
• ver.di for<strong>der</strong>t eine stabile <strong>und</strong> solidarische Gemeindefinanzierung.<br />
Beschluss des ver,di-B<strong>und</strong>esvorstands vom 18.02.2002<br />
Herausgeber: ver.di , 2003<br />
• Gemeindefinanzen im Brennpunkt<br />
Dokumentation des workshop vom Oktober 2002. Mit Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Kommission zur Reform <strong>der</strong> Gemeindefinanzen aus Wissenschaft, Politik<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft. Herausgeber: ver.di , 2003<br />
• Finanzpolitik für <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Gerechtigkeit<br />
Tagungsdokumentation. Herausgeber: ver.di 2002<br />
• Staatsfinanzen stärken<br />
Zukunftsaufgaben zwischen öffentlicher Armut <strong>und</strong> privatem Reichtum<br />
Herausgeber: ver.di 2002, Bereich Wirtschaftspolitik<br />
• Finanzpolitik für <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Gerechtigkeit<br />
Einnahmen stärken statt Ausgaben kürzen. Herausgeber: ver.di 2002,<br />
Bereich Wirtschaftspolitik<br />
Flyer:<br />
• Ver.di extrablatt: „Wer die Gemeinden knapp bei Kasse lässt, schränkt die<br />
Freiheit von Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern ein!”<br />
• „Kommunen vor dem Kollaps” (Hg.: ver.di Nie<strong>der</strong>sachsen/Bremen)<br />
• Gemeindefinanzen. (Hg.: ver.di B<strong>und</strong>esvorstand)<br />
Links:<br />
• www.verdi.de/hintergr<strong>und</strong>/wirtschaftspolitik<br />
• www.verdi.de/gemeindefinanzen<br />
• www.gemeinden.verdi.de<br />
<strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort<br />
Literatur <strong>und</strong> Links<br />
39
<strong>Krise</strong> <strong>der</strong> <strong>Kommunalfinanzen</strong><br />
40 <strong>Handreichungen</strong> für die politische <strong>Arbeit</strong> von Ehrenamtlichen vor Ort