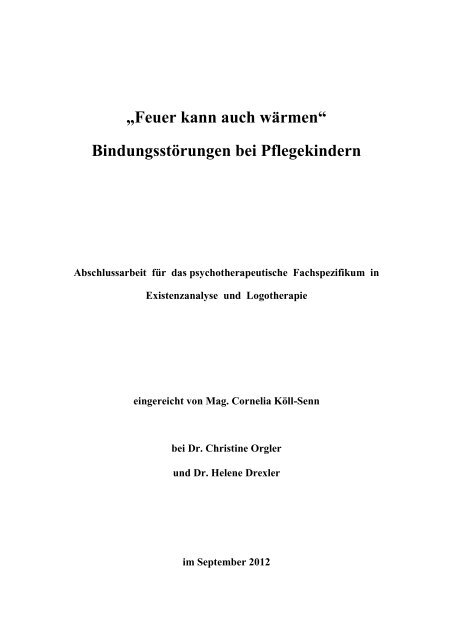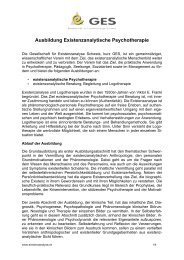PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Feuer kann auch wärmen“<br />
Bindungsstörungen bei Pflegekindern<br />
Abschlussarbeit für das psychotherapeutische Fachspezifikum in<br />
Existenzanalyse und Logotherapie<br />
eingereicht von Mag. Cornelia Köll-Senn<br />
bei Dr. Christine Orgler<br />
und Dr. Helene Drexler<br />
im September 2012
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Abstract: ............................................................................................................................... 3<br />
2 Abstract (Englisch): ............................................................................................................. 4<br />
3 Einleitung ............................................................................................................................. 5<br />
4 Pflegefamilie und Bindung .................................................................................................. 6<br />
4.1 Die Pflegefamilie – eine besondere Familie? ................................................................. 6<br />
4.2 Bindungstheorie .............................................................................................................. 8<br />
4.3 Bindung aus existenzanalytischer Sicht ....................................................................... 13<br />
5 Wenn sichere Bindung nicht gelingt ................................................................................ 17<br />
5.1 Desorganisation im Bindungsverhalten ........................................................................ 17<br />
5.2 Die besondere Situation des Pflegekindes .................................................................... 18<br />
5.3 Diagnostik von Bindungsstörungen.............................................................................. 21<br />
5.4 Formen von Bindungsstörungen ................................................................................... 23<br />
5.5 Bindungsstörungen aus existenzanalytischer Sicht ...................................................... 29<br />
6 Bindung und Psychotherapie ............................................................................................ 32<br />
6.1 Bedeutung der Bindungstheorie in der Psychotherapie ................................................ 32<br />
6.2 Bindungstheoretische Aspekte in der psychotherapeutischen Arbeit mit Eltern und<br />
Kindern ......................................................................................................................... 34<br />
6.3 Möglichkeiten und Erfahrungen in der psychotherapeutischen Arbeit mit<br />
Pflegekindern ................................................................................................................ 38<br />
6.3.1 Unterstützung beim Bindungsaufbau in der Pflegefamilie ................................... 38<br />
6.3.2 Existenzanalytische Aspekte in der psychotherapeutischen Arbeit mit<br />
Pflegekindern ......................................................................................................... 46<br />
7 Schlussbemerkung ............................................................................................................. 56<br />
Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 58<br />
2
1 Abstract:<br />
Der Wunsch nach Bindung ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen und<br />
bleibt ein Leben lang bestehen. Das Bindungsverhalten sichert zunächst das Überleben des<br />
Säuglings und beeinflusst später die Gestaltung seiner Beziehungen ebenso wie seine<br />
Entwicklung und sein Sozialverhalten. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den<br />
Grundlagen der Bindungstheorie im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Psychotherapie.<br />
Neben einer Verortung der Bindung in der Existenzanalyse und ihren Grundmotivationen<br />
wird auf diesem Hintergrund die besondere Situation eines Pflegekindes in seiner<br />
Pflegefamilie beleuchtet. Es soll dargestellt werden, wie sich frühe Traumatisierungen auf<br />
die Bindungsbeziehungen und das Bindungsverhalten auswirken und wie daraus unter<br />
bestimmten Umständen Bindungsstörungen entstehen können. Die verschiedenen Formen<br />
von Bindungsstörungen aus existenzanalytischer Sicht werden ebenso thematisiert wie ihre<br />
Auswirkungen innerhalb der Pflegefamilie und ihre Behandlung in der<br />
(existenzanalytischen) Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen. Beispiele aus der<br />
praktischen Erfahrung als Pflegemutter und Psychotherapeutin ergänzen die theoretischen<br />
Überlegungen.<br />
Schlüsselwörter: Bindung, Bindungstheorie, Psychotherapie, Existenzanalyse,<br />
Grundmotivationen, Pflegekind, Pflegfamilie, Traumatisierung,<br />
Bindungsstörung<br />
3
2 Abstract (Englisch):<br />
Attachment is one of the most primary human needs which last for a lifetime. Attachment<br />
behaviour ensures the survival of infants initially and, at a later time, influences the<br />
formation of their relationships as well as their development and social behaviour. The<br />
present paper investigates the basic principles of attachment theory with regard to its<br />
significance for psychotherapy. It situates attachment in the field of existential analysis and<br />
its basic motivations and, against this background, illuminates the special situation of a<br />
foster child within its foster family. The present paper describes the impact of early<br />
traumatization on attachment relationships as well as attachment behaviour and examines<br />
attachment disorders as a possible implication under certain circumstances. Additional<br />
subjects are different types of attachment disorders from an existential-analytical point of<br />
view and their implications within the foster family as well as their treatment in (existential-<br />
analytical) psychotherapy for children and adolescents. Examples of hands-on experience as<br />
a foster mother and psychotherapist complement the theoretical considerations.<br />
Keywords: attachment, attachment theory, psychotherapy, existential analysis, basic<br />
motivations, foster child, foster family, traumatization, attachment disorder<br />
4
3 Einleitung<br />
Das Thema Pflegekind hat mich persönlich immer schon sehr interessiert und angezogen.<br />
Die Überlegung, selber einmal ein Pflegekind aufzunehmen, war schon da, bevor mein<br />
leiblicher Sohn geboren wurde. Im Rahmen meiner Tätigkeit als mobile Frühförderin bekam<br />
ich dann die Gelegenheit, eine Pflegefamilie kennen zu lernen und ein Pflegekind über<br />
einen Zeitraum von zwei Jahren zu begleiten. Auch wenn die Pflegeeltern sich schließlich<br />
dazu entschieden, das Pflegeverhältnis zu beenden, habe ich in dieser Zeit sehr viel über<br />
traumatische Erfahrungen von Kindern, über die Schwierigkeiten und Chancen der<br />
Fremdunterbringung und über die Besonderheiten von Bindungsbeziehungen in einer<br />
Pflegefamilie gelernt.<br />
Als wir uns in unserer Familie nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, selber ein<br />
Pflegekind aufzunehmen, wusste ich demnach zumindest in der Theorie, was auf mich als<br />
Pflegemutter und auf uns als Pflegefamilie zukommen würde. Und doch konnte mich nichts<br />
- weder Vorerfahrungen, noch Literatur, noch Pflegeelternvorbereitungskurs – wirklich<br />
darauf vorbereiten, was es heißt, die neue Mutter eines in Bindungsbeziehungen im wahrsten<br />
Sinn des Wortes „gebrannten Kindes“ zu werden. Der Titel meiner Abschlussarbeit bezieht<br />
sich genau darauf: auf die schwierige Aufgabe, einem Kind, das in der unvermeidlichen<br />
Nähe zur primären Bindungsperson dieser auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war, zu<br />
zeigen, dass diese Nähe auch gut und befriedigend sein kann, dass Feuer eben auch wärmen<br />
und nicht nur zerstören kann.<br />
Aus meinen Erfahrungen mit dem von mir psychotherapeutisch begleiteten Pflegekind<br />
Sandro * und meinen Erfahrungen mit meinem eigenen Pflegesohn Rene * heraus möchte ich<br />
mich in dieser Arbeit vor allem mit den Problemen und Schwierigkeiten beschäftigen, die<br />
sich mit der Aufnahme eines Kindes in einer Familie ergeben können. Mich interessieren vor<br />
allem Besonderheiten in den Bindungsbeziehungen von Pflegekindern bis hin zu<br />
beobachtbaren Bindungsstörungen, da sie den Umgang mit dem Kind für die Pflegeeltern<br />
sehr erschweren können. Ich möchte versuchen, hinter das vordergründige Verhalten solcher<br />
Kinder zu schauen, um aus dem Verständnis für die Lebens- und Beziehungsgeschichte des<br />
Kindes heraus einen neuen Blick auf sein Empfinden und Handeln zu werfen.<br />
Meine eigenen Erfahrungen werde ich im Text durch kursive Schreibweise kennzeichnen.<br />
* Die Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert.<br />
5
4 Pflegefamilie und Bindung<br />
4.1 Die Pflegefamilie – eine besondere Familie?<br />
Wie der Begriff schon vermuten lässt, erhält mit der Aufnahme eines Pflegekindes die ganze<br />
Familie die davon abgeleitete Bezeichnung. Die Pflegefamilie scheint demnach durch das<br />
aufgenommene Kind sehr geprägt zu werden.<br />
Als ich mit meinem eigenen Pflegesohn den ersten Spaziergang durch meinen Heimatort<br />
unternahm, wurden wir von verschiedenen Nachbarn bemerkt und angesprochen, und immer<br />
wieder tauchte die Frage auf, ob mein Sohn nun ein „angenommenes“ Kind sei. Dieser eher<br />
veraltete Ausdruck für ein Adoptiv- oder wohl auch Pflegekind scheint mir aus<br />
existenzanalytischer Sicht sehr interessant, da es bei der Integration eines Kindes in eine<br />
Familie letztlich immer um ein Annehmen geht. Ein Pflegekind ist nun ein Kind, das nicht<br />
im Bauch der Pflegemutter gewachsen ist, das eine meist turbulente Vorgeschichte und ein<br />
gewisses Alter mitbringt, das bestehende Beziehungen zu seiner Herkunftsfamilie ebenso<br />
wie andere Gene in die aufnehmende Familie einfließen lässt. Und es ist nicht<br />
selbstverständlich vorauszusetzen, dass die Familie all dieses Neue und mitunter auch<br />
Fremde so ohne weiteres annehmen kann. Daraus ergibt sich, dass der vielerorts in der<br />
Fachliteratur beschriebene Integrationsprozess nicht ein einseitiges Sich-Einfügen des<br />
Pflegekindes in ein bereits bestehendes Familiensystem meint, sondern ein gegenseitiges<br />
Aufeinander-Zugehen, Aufeinander-Einlassen, Begegnen und schließlich Annehmen. Im<br />
Grunde braucht es ein gegenseitiges Ja-Sagen zum jeweiligen So-Sein des Gegenüber.<br />
In Tirol unterscheidet man zwischen Dauer- und Krisenpflegefamilien. Eine<br />
Krisenpflegefamilie nimmt ein Kind für eine bestimmte, relativ kurze Zeit vorübergehend<br />
auf, bis die Perspektive (Rückführung, Heimunterbringung, Dauerpflegeplatz) geklärt ist. In<br />
einer Dauerpflegefamilie besteht sozusagen ein Vertrag mit der Jugendwohlfahrt über die<br />
Aufnahme eines Pflegekindes bis zum vollendeten 18. bzw. 21. Lebensjahr (je nach Dauer<br />
der Ausbildung) des Kindes. So genannte heilpädagogische Pflegefamilien nehmen<br />
Pflegekinder mit Behinderungen oder erhöhtem Betreuungsbedarf auf. Im Jahr 2011<br />
befanden sich in Tirol etwa 320 Pflegekinder in 200 Pflegefamilien. Meist bleibt die<br />
Obsorge bei der Jugendwohlfahrt, während die Teilbereiche Pflege und Erziehung auf die<br />
Pflegeeltern übergehen.<br />
6
Dass es Pflegefamilien überhaupt gibt, hat mehrere Gründe. Das Aufwachsen in einer<br />
Ersatzfamilie erscheint als die noch beste Alternative, wenn die Herausnahme des Kindes<br />
aus dem leiblichen Familiensystem notwendig wird. Mit der Aufnahme eines Kindes in eine<br />
Pflegefamilie wird die Familie genutzt mit ihren „Ressourcen einer vorgegebenen<br />
Lebensform, die mit der Überschaubarkeit, Zuverlässigkeit und emotionalen Dichte ihrer<br />
Beziehungen nach geltender Auffassung die beste Strukturvoraussetzungen für primäre<br />
Sozialisation und Erziehung bietet.“ (Biermann 2001, S 598 in Schleiffer 2007, S16)<br />
Gleichzeitig trifft diese Auffassung auf den Wunsch mancher Elternpaare, ihre eigene<br />
Familie als Ressource für Kinder zur Verfügung zu stellen, die nicht bei ihren leiblichen<br />
Eltern aufwachsen können.<br />
Ob sich die Pflegefamilie als die wirklich bessere Alternative für die Fremdunterbringung<br />
erweist, ist von vielen Faktoren abhängig: von den persönlichen Fähigkeiten der<br />
Pflegeeltern, ihrer eigenen Bindungsrepräsentation, von der Art der eventuellen<br />
Traumatisierung und den Persönlichkeitsmerkmalen des Pflegekindes ebenso wie von der<br />
gebotenen Unterstützung und Begleitung, die eine Pflegefamilie von Seiten der<br />
Jugendwohlfahrt wie auch im Familien- und Freundeskreis erhält.<br />
Eine Studie von Blandow (in Schleiffer 2007, S 16) spricht nur von etwa 43% positiver<br />
Beendigungen aller Pflegeverhältnisse; Irmela Wiemann, eine anerkannte Expertin auf dem<br />
Gebiet des Pflegekinderwesens, erwähnt in ihrem Vortrag die Auswertung internationaler<br />
Trends nach Kindler (2008), die besagen, dass es etwa der Hälfte aller erwachsenen<br />
ehemaligen Pflegekinder gelingt, ökonomische Selbständigkeit, gute Familienbeziehungen<br />
und gute Fürsorge für ihre eigenen Kinder zu verwirklichen. (vgl. Wiemann 2011, S 3)<br />
Wenn man der Frage nachgehen will, was die Beziehung zwischen Pflegeeltern und<br />
Pflegekind so besonders und oftmals so besonders schwierig macht, kommt man nicht am<br />
Begriff der Bindung vorbei. Ich möchte in meiner Arbeit ausgehend von den Erkenntnissen<br />
der Bindungstheorie die Bedeutung der zwischenmenschlichen Begegnung in der Begleitung<br />
von Pflegeeltern und Pflegekindern und in der Psychotherapie für Pflegekinder näher<br />
beleuchten.<br />
7
4.2 Bindungstheorie<br />
Die Bindungstheorie geht zurück auf den Londoner Psychiater und Psychoanalytiker John<br />
Bowlby. Er hat sie in seiner Trilogie „Bindung“ (1975), „Trennung“ (1976) und „Verlust“<br />
(1983) umfassend dargelegt. Man könnte die Bindungstheorie auch als gemeinsames Werk<br />
von Bowlby und seiner Schülerin Mary Ainsworth ansehen, wobei Bowlby die Theorie und<br />
Ainsworth die empirischen Befunde und den Begriff der sicheren Basis beisteuerte (vgl.<br />
Spangler/Zimmermann 2009, S 27 ff).<br />
Ganz grundlegend spricht Bowlby davon, dass das Kind Schutz, Trost und Hilfe bei seiner<br />
Bezugsperson sucht. Er betont die Rolle dieser Schutzfunktion auch in späteren<br />
Beziehungen, und bezeichnet Schutz als die Funktion von Bindung. Bindung meint dabei<br />
nur einen Teilbereich aus dem komplexen System der Beziehung zwischen Mutter und Kind<br />
(vgl. Brisch 2010, S 35).<br />
Das Bindungsverhaltenssystem ist für Bowlby ein Steuerungssystem, das die Beziehung<br />
einer Person zu einer Bindungsfigur innerhalb gewisser Entfernungs- und<br />
Verfügbarkeitsgrenzen aufrechterhält. Dieses wird aktiviert, wenn ein Kind in Not gerät. Das<br />
Kind reagiert dann entsprechend seinen Möglichkeiten und Erfahrungen mit einem<br />
bestimmten Bindungsverhalten: es wendet sich der Bindungsperson zu, sucht ihren Blick, es<br />
ruft nach der Mutter, es weint, schreit oder klammert sich an die Bezugsperson an. Trost und<br />
Rückversicherung durch die Bezugsperson beenden das Bindungsverhalten des Kindes und<br />
machen es wieder frei für andere Aktivitäten. Die Bindung zwischen Bezugsperson und<br />
Kind stellt demnach die sichere Basis für das Erkundungsverhalten und die Exploration eines<br />
Kindes dar.<br />
Existenzanalytisch betrachtet, könnte man davon sprechen, dass ein auf die<br />
Bindungsbedürfnisse des Kindes ausgerichtetes Pflege- und Versorgungsverhalten der<br />
Bezugsperson es dem Kind ermöglicht, Urvertrauen zu entwickeln. Es kann das Vertrauen<br />
entstehen, dass die Welt, in die ich hineingeboren bin, es gut mit mir meint und mir alles zur<br />
Verfügung stellt, was ich zum seelischen und körperlichen Überleben brauche. Schutz zu<br />
bekommen, Halt zu erfahren und Raum zu haben sind die Grundbedingungen auf der Ebene<br />
der ersten Grundmotivation, die es dem Menschen möglich machen, in der Welt zu sein.<br />
Als wesentliche Faktoren für das Gelingen von Bindung werden in der Bindungstheorie die<br />
Feinfühligkeit und Responsivität der Bezugspersonen angesehen. Können die Eltern bzw.<br />
primären Bindungspersonen nicht prompt und effektiv auf die kindlichen Signale reagieren,<br />
8
hat dies für das Kind einen dauerhaften oder immer wiederkehrenden Zustand von Stress zur<br />
Folge, wodurch es auch zu traumatischen Erfahrungen kommen kann. (vgl. Bowlby in<br />
Spangler/Zimmermann 2009, S 20 ff)<br />
Am Ende des ersten Lebensjahres hat ein Kind schon genügend Erfahrungen mit seinen<br />
Bindungspersonen gesammelt, um so genannte innere Arbeitsmodelle von sich selbst, der<br />
Hauptbezugsperson und der Welt abzuspeichern. Das Kind weiß um die Interessen,<br />
Stimmungen und Absichten der Bezugsperson und kann in eine komplexe, wechselseitige<br />
Beziehung zu ihr treten.<br />
So unterschiedlich sich diese Beziehungen zwischen Bezugsperson und Kind gestalten, so<br />
unterschiedlich sind auch die Bindungsmuster, sie sich daraus entwickeln können. Die<br />
Bindungstheorie nennt vier Hauptbindungsmuster:<br />
Die sichere Bindung, die eine gesunde Entwicklung des Kindes erwarten lässt, sowie die drei<br />
Untergruppen der unsicheren Bindung (unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent und<br />
unsicher-desorganisiert), die eher zu Störungen in der Entwicklung führen können.<br />
Ein sicher gebundenes Kind besitzt die Zuversicht, dass die Eltern verfügbar, feinfühlig und<br />
hilfsbereit reagieren werden, wenn es Hilfe braucht. Es kann auf dieser Basis in Ruhe und<br />
Sicherheit die Welt erkunden.<br />
Ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind verfügt über diese Sicherheit nicht, da es<br />
wechselnde Erfahrungen je nach Befindlichkeit oder inneren und äußeren Möglichkeiten der<br />
Bezugspersonen macht. Es entwickelt eher Trennungsangst, klammerndes, ängstlich-<br />
weinerliches Verhalten.<br />
Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind kann kein Vertrauen in die Unterstützung der<br />
Bezugspersonen entwickeln und erwartet aufgrund seiner Erfahrungen die Zurückweisung<br />
seiner Bindungsbedürfnisse. Es wird sie also nicht so offen zeigen bzw. sich eher auf sich<br />
selber verlassen müssen.<br />
Kinder mit unsicher-desorganisierter Bindung fallen in der Untersuchungssituation durch<br />
teils bizarre, desorganisierte Verhaltensweisen auf. Ihnen steht in einer Notsituation kein<br />
strukturierendes Verhalten mehr zur Verfügung. Ich werde an anderer Stelle noch näher auf<br />
dieses Bindungsmuster eingehen, da es gerade bei Pflegekindern öfter zu beobachten ist.<br />
Bowlby betont die aktive, auch nonverbale Kommunikation zwischen Bezugsperson und<br />
Kind bei sicherer Bindung, während bei unsicherer Bindung diese Kommunikation<br />
eingeschränkt ist.<br />
„Die Fähigkeit zu einer solchen Kommunikation ist von zentraler Bedeutung für eine<br />
gesunde psychische Entwicklung. Auch in der Psychotherapie befassen wir uns mit<br />
9
Kommunikation, nämlich zwischen Therapeut und Patient einerseits, aber auch andererseits<br />
mit der inneren Kommunikation des Patienten. […] Intrapersonale Kommunikation wird für<br />
ein Kind selbstverständlich, das mit intrapersonaler Kommunikation vertraut ist, und<br />
umgekehrt.“ (Bowlby in Spangler/Zimmermann 2009, S 25)<br />
Die Fähigkeit, seine Emotionen den Bezugspersonen zeigen zu können, spielt eine große<br />
Rolle für die Entwicklung einer sicheren Bindung. Das stellt umgekehrt die Bezugspersonen<br />
vor die große Aufgabe, die Emotionen des Kindes von Anfang an zu spiegeln, ernst zu<br />
nehmen und verbal erfassbar zu machen. Nach Peter Fonagy kommt es dabei darauf an,<br />
inwieweit die Bindungsperson dem Kind seinen Affekt als sogenannten markierten Affekt<br />
zurückspiegeln kann. Spiegelt sich im Gesicht der Mutter die bloße Angst, wenn das Kind<br />
Angst zeigt, wird diese unendlich verstärkt. Der markierte Affekt Angst würde dem Kind<br />
hingegen zeigen, dass die Mutter die Angst des Kindes zwar wahrnimmt, sie aber gut<br />
aushalten kann und mit beruhigendem, tröstendem Gesichtsausdruck darauf reagiert, mit der<br />
Sicherheit, dass die Angst machende Situation gemeinsam gut bewältigt werden kann.<br />
(vgl. Fonagy in Müller 2012, S 5)<br />
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder erleben, dass die Kommunikation mit den Eltern in<br />
nicht belasteten Situationen zwar funktioniert, sonst aber eingeschränkt ist. Sie sprechen<br />
nicht mit den Eltern über die Ursachen ihres Kummers, sondern unterdrücken, verdrängen<br />
oder verschieben das Zeigen negativer Gefühle.<br />
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder werden durch das nicht vorhersagbare Verhalten der<br />
Bezugspersonen sehr irritiert und immer wieder enttäuscht. Es entsteht viel Frustration und<br />
damit ein erhöhtes Maß an Ärger und Kummer beim Kind, das gerade in<br />
Trennungssituationen zum Ausdruck kommt. (vgl. Malai in Spangler/Zimmermann 2009,<br />
S140 ff)<br />
Als Folge beider Varianten können bestimmte Emotionszustände im Lauf der Entwicklung<br />
immer mehr in den Mittelpunkt rücken und durch die Wiederholung kann eine Verbindung<br />
zum Selbstgefühl, zur Selbstidentität entstehen, wobei die Gefühle dabei nicht bewusst sein<br />
müssen, sondern auch durch Abwehrmechanismen ferngehalten werden können.<br />
Wiederholung und Variation sind entscheidende Faktoren, die zur Verfestigung eines<br />
bestimmten emotionalen Themas in der Strukturierung von Emotionen in der Persönlichkeit<br />
führen. „Eltern-Kind-Konflikte sind wesentliche und emotional besetzte Erfahrungen und<br />
stellen zweifellos Schlüsselerlebnisse für die Entwicklung emotionaler Organisation und für<br />
das Lernen von Glücksregulierung und Abwehrstrategien dar.“ (Malatesta/Wilson, 1998, in<br />
Magai in Spangler/Zimmermann, 2009, S 145)<br />
10
Ich halte diese Bemerkungen zu Bindung und Emotion deshalb so bedeutsam gerade im<br />
Zusammenhang zu Pflegekindern, da ich Ärger als die Hauptemotion in meinen<br />
Gegenübertragungsgefühlen zu meinem eigenen Pflegesohn erlebe. Sehr bald nach seiner<br />
Aufnahme in unsere Familie hatte ich bereits das Gefühl, dass der Ärger nun buchstäblich<br />
Einzug in unser Heim gehalten hatte. Nie zuvor habe ich selber so viel Wut und Ärger<br />
verspürt als im Zusammenleben mit Rene. Als er ca. ein Jahr bei uns lebte, hatte er offenbar<br />
so viel Vertrauen zu uns gefasst, dass der Ärger auch bei ihm sehr erlebbar wurde. Einige<br />
Monate lang sprach er praktisch nur mit ärgerlicher Stimme, mussten wir täglich mehrere<br />
massive Wutausbrüche bewältigen, wurde die ärgerlich erhobene Faust und das Vor-Ärger-<br />
Zittern zu seinem Markenzeichen. Inzwischen ist es gut möglich, dem Ärger auch spielerisch<br />
Raum zu geben. Die Verkleidungskiste ist ein unerlässliches Utensil für ihn geworden. Als<br />
Ritter, Sheriff, Tiger oder Pirat verkleidet zu sein und seine Aggressionen in kämpferischen<br />
Spielen auszudrücken, hat seinem Ärger ein Ventil verliehen. Gleichzeitig wird es immer<br />
wichtiger, diesen Ärger für ihn verstehbar zu machen, indem er klar benannt und als aus<br />
seiner Lebensgeschichte heraus berechtigt angesehen wird.<br />
Langsam wird es möglich, den Ärger zu benennen und zuzuordnen: Ärger auf mich als<br />
Pflegemutter, wenn ich eine Grenze ziehen muss, Ärger auf das Kind in der Spielgruppe,<br />
weil es etwas weggenommen hat, Ärger auf die leibliche Mutter, weil sie die Besuche nicht<br />
wahrnimmt und weil sie es nicht geschafft hat, ihn so zu versorgen, dass er bei ihr hätte<br />
bleiben können.<br />
Wenn der Ärger so um sich greift und oft an mir als der Hauptbezugsperson abgeladen wird,<br />
ist es auch für mich schwer, ihn dann nicht immer auf mich persönlich bezogen zu erleben.<br />
Als Pflegemutter bin ich sehr gefordert, als Vorbild in der Bewältigung von Wut und Ärger<br />
zu fungieren. Das bedeutet, dass ich Rene. vorleben muss, wie ich mich selber wieder<br />
beruhigen kann, wenn mich etwas aufgeregt hat. Selbstberuhigungsstrategien zu lernen, ist<br />
für Rene unendlich wichtig: der CD-Player im Zimmer, der Hängesessel im Wohnzimmer,<br />
viel Bewegung an der frischen Luft, das Puzzle, das er schon gut alleine schafft, das<br />
Bilderbuch, in dem er sich mit seinen Nöten wieder findet. Und gleichzeitig brauche auch<br />
ich manchmal klar benannte Mama-Zeit, zehn Sekunden Durchatmen oder Kurz-aus-dem-<br />
Zimmer-gehen, bevor ich mir überlege, wie ich auf eine Provokation reagieren werde. Das<br />
Zusammenleben mit einem bindungstraumatisierten Kind erfordert unendlich viel Arbeit an<br />
sich selbst.<br />
11
Aus Bowlbys Sicht können Kinder zu unterschiedlichen Bindungspersonen auch<br />
unterschiedliche Bindungsmuster entwickeln und bleiben diese Bindungsmuster relativ<br />
stabil, auch wenn das kindliche Verhaltensmuster sich in den ersten zwei bis drei<br />
Lebensjahren noch verändern kann, wenn die Eltern ihr Verhalten ändern. Dies könnte auch<br />
Hoffnung machen für das Aufwachsen von Pflegekindern, die in einem relativ jungen Alter<br />
in eine Pflegefamilie vermittelt werden, wenn nicht Trennungstraumata schon zu einer so<br />
großen Verunsicherung in den Beziehungen zu erwachsenen Bezugspersonen geführt haben,<br />
dass bereits Bindungsstörungen entstanden sind.<br />
Bowlbys Erkenntnisse wurden von der Bindungsforschung in Deutschland aufgegriffen und<br />
in unzähligen Studien (etwa in Bielefeld und Regensburg durch Grossmann und Grossmann)<br />
unter neuen Fragestellungen beleuchtet.<br />
Die deutschen Studien bestätigten den Zusammenhang zwischen der Feinfühligkeit der<br />
Bindungsfigur und der sicheren Bindung des Kindes. Es wurde die Frage aufgeworfen,<br />
inwieweit auch das Temperament des Kindes Einfluss auf die Bindungsgestaltung hat. Ein<br />
so genanntes „schwieriges“ Temperament des Kindes, das sich in geringer<br />
Orientierungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher Erregbarkeit zeigt, scheint es durchschnittlich<br />
feinfühligen Müttern zu erschweren, angemessen auf den Säugling zu reagieren. Die<br />
Orientierungsfähigkeit des Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn<br />
Kommunikationsprobleme etwa durch sensorische Auffälligkeiten (Hör- oder<br />
Sehbehinderungen, kognitive Einschränkungen,…) vorliegen oder Schwierigkeiten in der<br />
Selbstregulierung seines emotionalen Verhaltens auftreten. Auch die Frühgeburt oder<br />
Krankheit eines Kindes kann die Eltern so ängstigen, dass sie zunächst mit ihren eigenen<br />
Sorgen und Befürchtungen so beschäftigt sind, dass es ihnen schwer fällt, ihrem Kind<br />
genügend Trost und Halt zu geben. (vgl. Minde in Endres/Hauser 2002, S 361 ff)<br />
Die Kontinuität der Bindungsorganisation konnte in Studien ebenso festgestellt werden wie<br />
transgenerationale Aspekte. „Die Bindungsqualität der Kinder konnte durch die<br />
Bindungsrepräsentationen ihrer Mutter vorhergesagt werden.“ ( Grossmann in<br />
Spangler/Zimmermann 2009, S 60)<br />
Durch die Erhebung von physiologischen, biologischen Reaktionen (etwa Herztätigkeit,<br />
Cortisol-Ausschüttung) konnte nachgewiesen werden, dass eine Aktivierung des<br />
Bindungsverhaltenssystems durch die Trennung von der Bezugsperson bei allen Kindern<br />
erfolgt, auch bei den vermeidend gebundenen Kinder, die eine solche Trennung scheinbar<br />
teilnahmslos hinnehmen. (vgl. Grossmann in Spangler/Zimmermann 2009, S 61f)<br />
12
4.3 Bindung aus existenzanalytischer Sicht<br />
In der Existenzanalyse gibt es zunächst die Differenzierung zwischen Beziehung und<br />
Begegnung. „Als Beziehung im eigentlichen Sinne verstehen wir eine grundlegende,<br />
durchgängige Form von Wechselwirkungen, in die man allein durch die Präsenz oder auch<br />
bloß Vorstellung des anderen unausweichlich gestellt ist. Beziehung entsteht somit in dem<br />
Moment, in welchem man des anderen gewahr wird.“ (Längle in Existenzanalyse 1/2004,<br />
S 23)<br />
Das bedeutet, dass wir Menschen uns der Beziehung nicht entziehen können: wir treten auch<br />
dann in Beziehung zu etwas oder jemanden, wenn wir uns gar nicht dafür entschieden haben.<br />
Wie wir eine Beziehung aber gestalten, ob wir sie forcieren oder ihr aus dem Weg gehen,<br />
hängt wiederum sehr von uns selber ab.<br />
„Unter Begegnung verstehen wir das intendierte Aufsuchen und Antreffen eines Du<br />
vermittels eines Dialogs. Begegnung richtet sich also an die Person, an das Wesen eines<br />
Menschen.“ (ebd. S 24)<br />
Begegnung braucht also eine Offenheit, ein Wollen, eine Entscheidung dafür. Der Dialog<br />
zwischen zwei Menschen ist der Raum, in dem diese Begegnung geschieht. Begegnungen<br />
machen eine Beziehung erst aus, machen sie lebendig und erfüllt.<br />
Bindung sieht Längle als eine „enge Form der Beziehung, die entweder ein Angewiesensein<br />
auf den anderen oder ein aktives (entschiedenes) sich Einlassen auf den anderen beinhaltet.“<br />
(ebd. S 26)<br />
Als Beispiel für ein Angewiesensein auf den anderen nennt er die Eltern-Kind-Beziehung<br />
aus der Sicht des Kindes, wobei es aus der Sicht der Eltern ein aktives Zugehen auf das Kind<br />
benötigt. Im Gegensatz dazu gibt es auch die gewählte Bindung in einer Liebesbeziehung zu<br />
einem Partner. Hier lässt sich schon erahnen, dass die Erfahrungen, die ein Kind in der<br />
Bindung zu den Eltern macht, Auswirkungen darauf haben, welche Bindungen es später zu<br />
nahe stehenden Menschen eingehen wird.<br />
Bindung hat für mich persönlich viel zu tun mit einem Band der Sicherheit zwischen dem<br />
Kind und seinen Bindungspersonen, das je nach Situation, Lebensalter und Bedürfnis des<br />
Kindes sehr kurz, fest und straff sein oder immer mehr an Elastizität und Flexibilität<br />
gewinnen muss.<br />
13
Bei einer Wanderung durch eine Klamm hatte mein Mann unseren Pflegesohn durch ein<br />
Klettergeschirr mit daran befestigtem Seil gesichert. Je nach Beschaffenheit des Geländes<br />
und Steilheit des Weges, führte er ihn mal an der kurzen und dann wieder an der langen<br />
Leine. Zum Erkunden des Baches wurde unser Pflegesohn ganz vom Seil befreit, um ihn<br />
später am abschüssigen Hang wieder an das verbindende Seil zu nehmen. Dabei rutschte er<br />
immer wieder mal aus und konnte sofort durch Zug am Seil wieder stabilisiert und mit<br />
beiden Beinen fest auf die Erde gestellt werden. Dabei fiel mir sehr bewusst die<br />
Angewohnheit unseres Pflegekindes auf, immer etwas in der Hand halten zu müssen, am<br />
besten drei Sachen in beiden Händen. Dies hatte schon beim ersten Kennenlernen die<br />
leibliche Grossmutter von Rene erzählt. Im Moment des Wanderns erkannte ich es als seine<br />
Möglichkeit, sich Halt zu suchen, indem er etwas festhält, das aber letztlich keine Schutz<br />
bietet, sondern im Gegenteil es ihm oft erschwert, tragfähigen Halt zu ergreifen.<br />
Dies fordert von der Bindungsfigur, dass sie achtsam wahrnimmt, wie viel Band das Kind<br />
gerade braucht, wie lang das Band sein darf, um auch Entwicklung zu ermöglichen. So hat<br />
Bindung auch mit Angebunden-Sein zu tun: Angebunden-Sein an die erste Person, die ein<br />
Kind in Empfang nimmt und für es sorgt, sowohl in körperlicher als auch seelischer<br />
Hinsicht. Nur wenn diese Anbindung gut gelingt und ein wechselseitiger Prozess daraus<br />
entsteht, innerhalb dem die Bezugsperson sich von den Bedürfnissen des Kindes steuern<br />
lässt, feinfühlig darauf reagiert und gleichzeitig eine sichere, stabile Basis bildet, wird es<br />
einem Kind auch möglich, mit Interesse und Neugier auf die Welt zuzugehen.<br />
Bettina Bonus spricht in diesem Zusammenhang von einem gemeinsamen Lebensband<br />
zwischen Mutter und Kind, das schon während der Schwangerschaft geknüpft wird und auch<br />
nach der Geburt als gemeinsame Lebens- und Gefühlshülle weiter bestehen bleibt. Dabei ist<br />
das Kind natürlich sehr viel existentieller von dieser Verbindung abhängig als die Mutter.<br />
„Wenn sie aber die Wahrnehmung des zarten Bandes zulässt und sehr feinfühlig an das Kind<br />
und alles, was im Umkreis des Kindes geschieht, herangeht, kann auch die leibliche Mutter<br />
dieses zarte, unsichtbare Band spüren. Das, was wir als Muttergefühl kennen, ist eine der<br />
Auswirkungen des zarten, unsichtbaren Lebens- und Gefühlsbandes, der ganz instinktiven<br />
Sorge um das Leben und das seelische Wohlergehen des leiblichen Kindes.“<br />
(Bonus 2006, S 60)<br />
Wenn Bowlby Schutz als die Funktion von Bindung bezeichnet, so kann man Bindung<br />
zunächst auf der Ebene der ersten Grundmotivation einordnen. Schutz und Halt, Gehalten-<br />
Sein und Beschützt-Werden sind die grundlegendsten Erfahrungen, die ein Kind neben der<br />
14
körperlichen Versorgung erleben muss. Sehr bald gewinnt auch der Raum immer mehr an<br />
Bedeutung, den ein Kind bekommt, erste Entdeckungen mit sich, dem eigenen Körper, der<br />
Bezugsperson und der umgebenden Welt zu machen. Dies sind die Grundvoraussetzungen,<br />
damit ein Kind überhaupt in der Welt sein kann, dass es da sein kann.<br />
Über dieses Gehalten-Sein tritt das Kind auf der Ebene der zweiten Grundmotivation ein in<br />
eine Beziehung zur Bezugsperson, in eine Nähe zu ihr. Dafür ist es notwendig, dass die<br />
Bezugsperson sowohl emotional als auch zeitlich verfügbar ist, für das Kind da ist, sich ihm<br />
in seiner Eigenart und seinen Wünschen und Bedürfnissen zuwendet. Bindung entsteht<br />
meinem Erachten nach in der vertrauensvollen, tragfähigen Beziehung zur nahesten Person.<br />
In der Folge wird es erst möglich, dass das Da-Sein des Kindes auch gut ist. Längle ordnet<br />
Bindung der zweiten Grundmotivation zu und meint, dass Bindung den Menschen „mehr in<br />
der Festigkeit seiner Beziehung“ sieht. (Längle in Existenzanalyse 1/2004, S 28)<br />
Wenn das Kind die Erfahrung machen darf, dass seine Bedürfnisse wahrgenommen und<br />
erfüllt werden, kann es die Welt als guten Ort erleben, auch wenn oder gerade weil es sich<br />
anfangs immer wieder in den sicheren Hafen der Anbindung zur Bezugsperson flüchten<br />
wird. Über diese soziale Rückversicherung wird es dem Kind erst möglich, sich auf das<br />
einzulassen, was die Umgebung bietet. Gleichzeitig erlebt das Kind im Dialog mit der<br />
Bezugsperson Beachtung, Wertschätzung und Rechtfertigung, erhält Rückmeldungen über<br />
sich selbst. Vom Gegenüber als wertvoll erlebt zu werden, legt den Grundstein für den<br />
eigenen Selbstwert und das Kind wird fähig, Ja zu sich selber zu sagen.<br />
Auf der Ebene der dritten Grundmotivation ermöglicht Bindung die Zuwendung sowohl zu<br />
sich selber als auch zu dem, was die Welt an das Kind heranträgt. Aus der Sicherheit heraus,<br />
geschützt und gehalten zu sein und geliebt zu werden, wagt das Kind, sich einzulassen, sich<br />
hinzuwenden, auf etwas oder jemanden zuzugehen. Es hat schon die Erfahrung gemacht,<br />
dass es gut ist. So kann es einwilligen in das „Sich-Berühren-Lassen“ durch Personen und<br />
Werte.<br />
Die Bindungstheorie geht davon aus, dass eine sichere Bindung einen wesentlichen<br />
Schutzfaktor für das Gelingen und die Bewältigung aller Lebensaufgaben darstellt. Ich<br />
würde Bindung als wesentlichen Faktor dafür ansehen, inwieweit ein sinnerfülltes Leben auf<br />
der Ebene der vierten Grundmotivation für einen Menschen möglich wird.<br />
„Denn der Mensch verwirklicht sich nur dort, wo er in Beziehung tritt.“ (Längle in<br />
Rothbucher/Wurst 1989, S 81)<br />
Längle siedelt die Beziehung hauptsächlich in der zweiten Grundmotivation an. Er spricht<br />
davon, dass eine Beziehung nur dann gut und erfüllend ist, wenn Aspekte aller vier<br />
15
Grundmotivationen enthalten sind: „Dasein für den anderen [1.Grundmotivation]; Fühlen,<br />
dass es einem nicht gleichgültig ist, wie es dem anderen geht und was er tut<br />
[2.Grundmotivation]; ihn sehen und freigeben in sein Selbstsein, ihn darin schätzen und das<br />
eigene Selbstsein daneben leben können [3. Grundmotivation]; in einem gemeinsamen<br />
Kontext stehen, der beide angeht und sie verbindet [4. Grundmotivation].“ (Längle in<br />
Existenzanalyse 1/2004, S 29)<br />
Was er als beziehungsfördernde Haltung beschreibt, trifft meiner Meinung nach auch auf die<br />
Förderung von Bindung zu, gerade bei Pflegekindern in einer neuen Familie. So wäre es<br />
wünschenswert, wenn es Pflegeeltern gelingt, dem Pflegekind annehmend, zuwendend,<br />
achtend und entwicklungsfördernd zu begegnen. Was es Pflegeeltern manchmal erschweren<br />
kann, eine solche Haltung einzunehmen, werde ich im nächsten Kapitel näher beleuchten.<br />
16
5 Wenn sichere Bindung nicht gelingt<br />
5.1 Desorganisation im Bindungsverhalten<br />
Mary Ainsworth hat mit der so genannten „Fremden Situation“ ein strukturiertes<br />
Testinstrumentarium geschaffen, das die unterschiedlichen Bindungsmuster bei Eltern und<br />
Kindern beobachtbar macht. Dabei wechseln sich Phasen der Begegnung, Trennung und<br />
Wiedervereinigung in genau definierten Zeitabständen ab und werden das Verhalten und die<br />
Reaktionen des Kindes genau festgehalten.<br />
Die Verteilung der Bindungsmuster innerhalb normaler Stichproben vieler internationaler<br />
Studien zeigt die Mehrheit sicher gebundener Kinder, eine beachtliche Minderheit<br />
vermeidend gebundener Kinder und einen kleineren Teil ambivalent-gebundener Kinder.<br />
Bald zeigte sich auch, dass einige Kinder nicht in eines der oben beschriebenen Muster<br />
eingeordnet werden konnten. Die meisten dieser Kinder zeigten desorganisiertes Verhalten<br />
in Anwesenheit der Eltern, weshalb Mary Main auf der Grundlage ihrer Beobachtungen den<br />
vierten Bindungsstil der unsicher-desorganisierten Bindung postulierte. Sie beschreibt<br />
desorganisiertes Verhalten wie folgt: „das Kind erstarrt in seinen Bewegungen bei<br />
gleichzeitigem trance-ähnlichem Gesichtsausdruck, es schaukelt stereotyp auf Händen und<br />
Knien nach begonnener Annäherung, bei Angst vor Fremden entfernt es sich von der<br />
Bezugsperson und lehnt seinen Kopf an die Wand; es schaut während der Trennung zur Tür<br />
und schreit nach der Bezugsperson, wendet sich aber bei der Wiedervereinigung still ab; es<br />
richtet sich auf, um die Bezugsperson zu begrüßen, sinkt aber dann in sich zusammen auf<br />
den Boden.“ (Main in Spangler/Zimmermann 2009, S 126)<br />
Diese Beschreibung macht deutlich, dass es sich beim desorganisierten Bindungsmuster<br />
nicht um eine neue Form der Verhaltensorganisation handelt, sondern um eine<br />
Unterbrechung des organisierten Verhaltens. Mary Main umschreibt es mit dem englischen<br />
Ausdruck: „the look of fear with nowhere to go“ (ebd., S 126). Ängstigendes elterliches<br />
Verhalten in einer ängstigenden Situation bringt ein Kind in eine schier unlösbare<br />
Verzweiflung: es ist unfähig, seine Angst zu unterdrücken, gleichzeitig gibt es aber auch<br />
keine Lösung für die Angst, und das Kind sieht keinen Ort, an den es sich flüchten könnte.<br />
In wiederholten oder einzelnen Situationen zu erleben, von der Mutter alleingelassen zu<br />
werden, keinen Schutz zu erfahren, kann das Vertrauen in die Mutter erschüttern oder ganz<br />
verloren gehen lassen.<br />
17
Der Anteil von Kindern mit unsicher-desorganisiertem Bindungsverhalten lag in<br />
Normalstichproben etwa bei 15-25%, während er bei Stichproben mit misshandelten<br />
Kindern bei ca. 80% liegt. Studien belegen einen Zusammenhag zwischen unsicher-<br />
desorganisiertem Bindungsverhalten des Kindes und einer Bindungsrepräsentation der<br />
Eltern, „in denen unverarbeitete/desorganisierte Beschreibungen von möglicherweise<br />
traumatischen Ereignissen gefunden worden waren.“ (Main in Spangler/Zimmermann 2009,<br />
S 129)<br />
Demnach kann desorganisiertes Bindungsverhalten eine direkte Auswirkung von<br />
Misshandlung oder Missbrauch sein oder die Nachwirkung eines elterlichen Traumas über<br />
die Generation hinaus bzw. eine Kombination aus Beidem. Dies lässt schon erahnen, dass<br />
Desorganisation im Bindungsverhalten bei Pflegekindern eine große Rolle spielen kann, da<br />
Pflegekinder zum Teil jahrelang in belasteten Verhältnissen mit ihren leiblichen Eltern<br />
leben, bevor sie aus der Familie herausgenommen werden.<br />
„Lächeln bei Schmerzen, bei Konflikten, wenn es seine Eltern provoziert, oder bei Trennung<br />
in unbekannter Umgebung. Diese Kennzeichen sind möglicherweise im frühen Alter, in dem<br />
die ‚Fremde Situation’ durchgeführt wird, nicht beobachtbar, aber später typischerweise bei<br />
Pflege- oder Adoptivkindern zu beobachten.“ (Weinberg 2010, S 27)<br />
5.2 Die besondere Situation des Pflegekindes<br />
Das Risiko, als Folge der oft prekären Umstände in den Herkunftsfamilien eine unsichere<br />
oder hochunsichere Bindung zu entwickeln, ist für ein Pflegekind sehr groß. Pflegekinder<br />
sind sehr häufig von Verwahrlosung, Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch<br />
betroffen.<br />
Traumatische Erfahrungen im Rahmen von Bindungsbeziehungen stellen eine massive<br />
Bedrohung für die kindliche Entwicklung dar, insbesondere was die Selbstentwicklung und<br />
die Ausbildung innerer Regulationsprozesse angeht.<br />
Die leiblichen Eltern waren für Pflegekinder oft nicht die Quelle des Vertrauens, sondern der<br />
Auslöser von Angst, Hilflosigkeit, Bedrohung und Überforderung. Sie waren entweder nicht<br />
anwesend oder als Halt nicht verfügbar. „Damit wird das Kind, das durch die traumatische<br />
Erfahrung überwältigt ist und die Situation mit eigenen Ressourcen nicht kontrollieren kann,<br />
völlig allein gelassen.“ (Scheurer-Englisch in Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 2008,<br />
S 73)<br />
Ob eine Situation oder ein Ereignis tatsächlich ein Trauma darstellt, hängt von bestimmten<br />
Merkmalen ab, die Scheurer-Englisch wie folgt zusammenfasst:<br />
18
„Es handelt sich um eine einmalige oder fortdauernde Erfahrung, die zu einer psychischen<br />
Verletzung führt, die für das Kind überwältigend und mit seinen psychischen und physischen<br />
Möglichkeiten nicht kontrollierbar ist, die Todesangst und Angst vor Vernichtung des<br />
physischen oder psychischen Selbst auslöst und bei der das Kind in der Situation auf<br />
niemanden zurückgreifen kann, bei dem es Schutz oder Hilfe erfährt.“ (Scheurer-Englisch in<br />
Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 2008, S 67)<br />
Dabei ist zu bedenken, dass es Kindern unter drei Jahren kaum oder gar nicht möglich ist,<br />
aus eigener Kraft jemanden aufzusuchen, der ihnen helfen könnte. Die Kinder sind<br />
gezwungen, sich an die bedrohliche Lebenswelt anzupassen, die eigenen überwältigenden<br />
Gefühlsreaktionen zu kontrollieren und sich weiterhin auf die ängstigenden<br />
Bindungspersonen einzulassen, weil ihr Überleben von ihnen abhängt.<br />
Kinder, die in der Beziehung zu ihren Bindungspersonen traumatisiert werden, kämpfen<br />
darum, psychisch zu überleben, bringen ein großes Defizit an positiven<br />
Bindungserfahrungen mit, haben oft keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen, können sich<br />
schwer mitteilen und entwickeln eine „misstrauische Selbstbezogenheit“. (ebd. S 76)<br />
Pflegekinder sind nicht selten „Überlebende“ prekärer Lebensumstände. Aus ihrer<br />
Notsituation heraus entwickeln sie oft Verhaltensweisen, die hauptsächlich dazu dienen,<br />
massive Angst und Ohnmacht, Verlassensein und Hilflosigkeit abzuwehren. Je nach<br />
Persönlichkeit, Ressourcen, Resilienzfaktoren und äußeren Umständen wird sich ein Kind<br />
eher dazu entscheiden, die Angst zu vermeiden oder sie durch ausgeklügelte Kontroll- und<br />
Machtstrategien in Schach zu halten. (vgl. Bonus 2006, S 51ff)<br />
„Da Kinder, die fremd untergebracht werden müssen, häufig aus chaotischen<br />
Familienstrukturen kommen und meistens viel Unruhe, Unterversorgung, Gewalt, Angst und<br />
Einsamkeit erlebt haben, sind sie oft nicht sicher gebunden. So können sie nach einem<br />
Beziehungsabbruch nicht immer vertrauensvoll Bindungen neu entwickeln, sondern es kann<br />
sein, dass sie positive Bindungsbemühungen von Bezugspersonen mit starken Ambivalenzen<br />
oder mit Vermeiden-Wollen von Bindung erwidern.“ (Pflegefamilienstudie Tirol 2006, S 11)<br />
Dies lässt erahnen, dass der Aufbau neuer Beziehungen innerhalb der Pflegefamilie und im<br />
besten Fall auch von Bindung zu den Pflegeeltern für ein Pflegekind sehr schwer ist und oft<br />
von beiden Seiten ambivalent erlebt wird. „Pflegekinder bauen Bindungsbeziehungen zu den<br />
Pflegeeltern auf, allerdings wirken die unsicheren Bindungsmuster und die Desorganisation<br />
aus den bestehenden Beziehungen zunächst weiter.“ (Scheurer-Englisch in Stiftung zum<br />
Wohl des Pflegekindes 2008, S 80)<br />
19
Pflegekinder zeigen oft große Probleme, sich überhaupt auf neue Beziehungen einzulassen<br />
und tun es zunächst nur im Schutz von vermeidenden oder kontrollierenden<br />
Verhaltensstrategien (Wechsel von Nähe und Distanz, Rollenumkehr, Kontrolle und<br />
Vermeidung in Beziehungen). Pflegekinder übertragen hochunsichere Bindungserwartungen<br />
auf die Pflegeeltern und machen es ihnen schwer, sie liebevoll zu umsorgen. Sie verhalten<br />
sich oft entgegen ihren Bedürfnissen so, als würden sie keine Hilfe benötigen. In der<br />
Übertragung der mit den leiblichen Eltern gemachten Erfahrungen auf die Pflegeeltern kann<br />
das Kind diese oft entgegen der realen Situation als übermächtig und bedrohlich erleben.<br />
Hier vermischen sich alte mit neuen Gefühlen, vor allem, wenn gleichzeitig auch Sicherheit<br />
spürbar wird und mit den Pflegeeltern neue, befriedigendere Erfahrungen gemacht werden<br />
können. Um bindungskorrigierende Erfahrungen machen zu können, muss das Kind die<br />
Pflegeeltern zumindest in bestimmten Situationen als Quelle von Trost und Zuspruch<br />
erleben. (vgl. Schleiffer, S 20)<br />
„Zu einer erfolgreichen Bearbeitung traumatischer Erfahrungen gehört die Erinnerung an<br />
und das Trauern über die erlebten Verletzungen, das Ansprechen und Neuinterpretieren der<br />
Situationen und Gefühle, die das Trauma ausgelöst haben.“ (Scheurer-Englisch in Stiftung<br />
zum Wohl des Pflegekindes 2008, S 81)<br />
Es ist für Pflegeeltern unendlich wichtig, das Kind darin zu begleiten, seine Gefühlszustände<br />
und emotionalen Bedürfnisse erkennen, aushalten und deren Befriedigung durch andere<br />
zulassen zu können.<br />
Und es ist sehr schwierig, „einem einmal oder fortdauernd gebrannten Kind zu zeigen, dass<br />
Feuer auch wärmen kann.“ (ebd. S 82)<br />
Damit positive bindungsbezogene Effekte entstehen können, sind einige Faktoren besonders<br />
wichtig: dass es eine möglichst langfristige Perspektive für das Kind in einer<br />
Dauerpflegefamilie gibt, dass die Pflegeeltern bereit sind, in die Beziehung zum Pflegekind<br />
zu investieren und sich um sein Wohl zu kümmern, dass sie sich nicht durch das<br />
vordergründig vom Kind gezeigte Verhalten entmutigen und abschrecken lassen, dass sie das<br />
Pflegekind mit dem annehmen, was es mitbringt, und ihre Idealvorstellungen bezüglich des<br />
Verhaltens eines Kindes oder besonderer Familienharmonie zurückstellen können. So wie<br />
jede Ankunft eines Kindes zunächst einmal eine Ent-Täuschung in dem Sinne darstellt, dass<br />
das Bild vom erträumten, erhofften, gewünschten Kind dem Bild des realen Wesens weichen<br />
muss, das man in den Händen hält, so erfordert die Aufnahme eines Pflegekindes mit seiner<br />
oft problematischen Geschichte geradezu ein sehr bewusstes Zurücknehmen von Wünschen,<br />
Hoffnungen und Erwartungen, um ihm ganz offen begegnen zu können.<br />
20
5.3 Diagnostik von Bindungsstörungen<br />
Es scheint nicht so zu sein, dass eine bestimmte Form unsicherer Bindung eine bestimmte<br />
Psychopathologie zur Folge hat, sondern eher so, dass eine sichere Bindung als Schutz- und<br />
eine unsichere Bindung als Risikofaktor für die Entwicklung von psychopathologischen<br />
Symptomen anzusehen ist.<br />
Wenn Vernachlässigung, Misshandlung oder ähnliche Störungen in der Eltern-Kind-<br />
Beziehung nur phasenweise auftreten, ist die Entstehung eines desorganisierten<br />
Bindungsverhaltens beim Kind wahrscheinlich. Herrschen sie aber über Jahre vor, ist es<br />
möglich, dass Bindungsstörungen entstehen. Diese können auch nach einem Milieuwechsel<br />
in der neuen Umgebung bestehen bleiben und die neue Beziehung zwischen Pflegeeltern und<br />
Pflegekind extrem belasten. Die eigentlichen Bindungsbedürfnisse des Kindes sind in<br />
seinem Verhalten oft verzerrt und schwer zu erkennen „und können sich im schlimmsten<br />
Fall zu überdauernden psychopathologischen Mustern einer schweren Persönlichkeitsstörung<br />
verfestigen.“ (Brisch und Hellbrügge 2003 in Brisch 2010, S 96)<br />
Dies lässt sich verstehen, wenn man die neueren Erkenntnisse aus der Säuglingsforschung<br />
(vgl. Stern, Dornes) bedenkt, besonders eines ihrer Ergebnisse, nach dem bereits ein<br />
Säugling in der Interaktion mit der Mutter von dieser in seiner Aktivität und Emotionalität<br />
gesehen werden will. Er möchte Anerkennung in seiner Einzigartigkeit. „Beim Säugling<br />
finden wir also von Anfang an das elementare Bedürfnis nach interpersonaler Anerkennung,<br />
nach Gesehen-Werden und Begrüßung und Bestätigung seines So-Seins.“ (Lleras in<br />
Existenzanalyse 1/2004, S 20)<br />
Man kann sich nur allzu leicht vorstellen, dass dieses Bedürfnis in missglückten Eltern-<br />
Kind-Konstellationen nicht befriedigt wird, und es durch diese Nicht-Anerkennung zur<br />
Verletzung der Würde der Person kommt, die letztendlich in eine rastlose Suche des<br />
betroffenen Menschen nach Bestätigung bzw. nach Widerlegung seiner selbst empfundenen<br />
Wertlosigkeit mündet. (vgl. ebd. S 21)<br />
Oft tragen traumatisierte Kinder den inneren Glaubenssatz in sich: „Ich bin nichts, ich bin<br />
nichts wert, ich kann nichts, ich bin schuld, es kann nicht besser werden“. Deshalb ist es<br />
sehr wichtig, einem solchen Kind zu vermitteln, dass man es mag, in seiner Eigenart<br />
anerkennt und seine Fähigkeiten und Stärken schätzt.<br />
Als unser Pflegsohn im Alter von zwei Jahren und einem Monat in unsere Familie kam,<br />
waren seine wichtigsten Wörter: „Ich“, „haben“ und „selber“. Er legte eine nicht<br />
altersentsprechende Selbständigkeit an den Tag und bemühte sich beispielsweise schon sehr,<br />
21
sich ohne Hilfe anzuziehen. Es fiel ihm sehr schwer, sich von mir versorgen zu lassen. Den<br />
ganzen Tag wachte er peinlich genau darauf, dass alle seine Bedürfnisse erfüllt wurden: er<br />
bestellte sich beim Essen schon im Vorhinein, alles was er haben wollte; er verlangte beim<br />
Anziehen schon im Vorhinein nach allem, was er meinte, brauchen zu können („Mama,<br />
Kappe!“, „Mama, Handschuhe!“ etc.)<br />
Sein wichtigster Satz ist aber bis heute „Mama, schau!“ geblieben. Diese Aufforderung höre<br />
ich den ganzen Tag, bei allem, was Rene macht und tut. Er spielte auch während des<br />
Entstehens dieser Arbeit oft zu meinen Füssen, was aber beinahe unmöglich war, weil er es<br />
noch nicht aushalten kann, dass ich im selben Zimmer bin und nicht ständig beobachten und<br />
anerkennen kann, was ihn gerade beschäftigt.<br />
Nach Brisch (2010) gibt es derzeit in den ICD- und DSM-Manualen keine ausreichenden<br />
diagnostischen Zuordnungen für die Vielfalt und den Schweregrad an Bindungsstörungen.<br />
Im ICD 10 wird lediglich unterschieden zwischen der „reaktiven Bindungsstörung im<br />
Kindesalter (Typ I F 94.1)“ und der „Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung<br />
(Typ II F 94.2)“. Typ I meint sehr gehemmte Kinder in der Beziehungsbereitschaft zu<br />
Erwachsenen, die mit Furchtsamkeit und Ambivalenz auf Bindungspersonen reagieren.<br />
Typ II meint eine enthemmte, distanzlose Kontaktaufnahme gegenüber verschiedenen<br />
Bezugspersonen. (vgl. Brisch 2010, S 99)<br />
„Beide Verhaltensweisen werden als direkte Folge von extremer emotionaler und/oder<br />
körperlicher Vernachlässigung und Misshandlung oder als Folge eines ständigen Wechsels<br />
von Bezugspersonen angesehen.“ (ebd. S 100)<br />
Im ICD 9 wurden Bindungsstörungen noch als Störungen der emotionalen Regulation<br />
angesehen, während sie im ICD 10 unter die Kategorie „Störungen sozialer Funktionen mit<br />
Beginn in der Kindheit und Jugend“ fallen. Als Gründe dafür werden schwerwiegende<br />
Milieuschäden oder Deprivation genannt. Brisch bedauert, dass dabei der Zusammenhang<br />
mit der emotionalen Störung verloren gegangen ist. Er selber nennt als Diagnosekriterium<br />
Veränderungen im Verhalten mit den verschiedenen Bezugspersonen, die nicht nur situativ,<br />
sondern als stabiles Muster über einen längeren Zeitraum hinweg auftreten. Dabei wird ein<br />
Zeitraum von sechs Monaten für die Diagnosestellung vorgeschlagen. (vgl. Brisch 2010,<br />
S 100 f)<br />
22
5.4 Formen von Bindungsstörungen<br />
Karl-Heinz Brisch legt in seinem Buch „Bindungsstörungen“ (2010) eine ausführliche<br />
Beschreibung unterschiedlicher Ausformungen von Störungen im Bindungsverhalten vor.<br />
Kinder ohne Bindungsverhalten gegenüber einer Bindungsperson:<br />
Diese Kinder suchen auch in Bedrohungssituationen nicht die Nähe einer Bezugsperson. Sie<br />
protestieren nicht gegen eine Trennung, bevorzugen keine bestimmte Person, zeigen kein<br />
zugewandtes Verhalten. Brisch nimmt an, dass Kinder mit einem solchen Verhalten nie die<br />
Chance hatten, eine stabile Beziehung zu einer Bindungsperson aufzubauen. Zu beobachten<br />
sei diese Form der Bindungsstörung etwa bei Heimkindern oder Säuglingen mit vielen<br />
wechselnden Bezugspersonen und/oder Pflegestellen.<br />
Undifferenziertes Bindungsverhalten:<br />
Kinder mit dieser Form von Bindungsstörung verhalten sich gegenüber allen<br />
Bezugspersonen gleich freundlich und machen keinen Unterschied, ob sie jemanden schon<br />
länger kennen oder nicht.<br />
Brisch nennt zwei Sonderformen dieses Verhaltens:<br />
Soziale Promiskuität beschreibt er als ein undifferenziertes, „promiskuitives“<br />
Bindungsverhalten, das der Diagnose F 94.2 im ICD 10 am ähnlichsten ist. Die Kinder sind<br />
auch völlig fremden Personen gegenüber nicht zurückhaltend oder vorsichtig, sondern<br />
wenden sich in Gefahr an jede beliebige Person.<br />
Als ich mit meinem Pflegesohn Rene am zweiten Tag seiner Ankunft in unserer Familie auf<br />
der Straße vor unserem Haus spazieren ging, war es für mich sehr befremdlich zu erleben,<br />
dass er auf alle Menschen, denen wir auf der Straße begegneten, mit der gleichen<br />
Freundlichkeit sehr offensiv zuging. Ich hatte das Gefühl, dass er an diesem Tag auch mit<br />
jeder beliebigen Nachbarin mitgegangen wäre. Er schien die Erfahrung gemacht zu haben,<br />
dass es nicht so sehr darauf ankommt, wer für einen sorgt, aber doch die Hoffnung zu haben,<br />
dass es immer irgendjemanden geben wird.<br />
Zwei Monate später waren wir bei Freunden zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Wann<br />
immer Rene etwas brauchte, kämpfte er sich durch die Menge, um sich dann ganz bewusst<br />
23
an mich oder meinen Mann zu wenden. Es hatte sich schon eine gewisse Zugehörigkeit<br />
entwickelt.<br />
Nach etwa einem dreiviertel Jahr war eine befreundete Familie bei uns auf Besuch. Rene<br />
schlug sich den Kopf an einer Kante an. Er verbiss sich jedes Weinen, wandte sich um, ohne<br />
jemanden eines Blickes zu würdigen, um sich dann ganz gezielt in meine Arme zu werfen,<br />
und fing erst dann an zu weinen. Trotzdem war es in dieser Zeit auch noch so, dass er<br />
einfach ohne Ankündigung aus unserem Garten verschwand, um zur Nachbarin zu gehen,<br />
vor allem wenn es vorher eine Situation gegeben hatte, in der es notwendig gewesen war,<br />
ihm Grenzen zu setzen. „Es gibt immer noch andere Menschen, die sich auch um mich<br />
kümmern können“ scheint eine tief verwurzelte Erfahrung unseres Pflegesohnes zu sein.<br />
Was auf der einen Seite sein psychisches Überleben in den ersten zwei Lebensjahren<br />
gesichert zu haben scheint, macht es ihm auch sehr schwer, sich auf uns als für ihn<br />
verantwortliche, sorgende Familie einzulassen. Er hielt und hält sich immer noch einen<br />
Fluchtweg offen. Aus seiner bisherigen Lebenserfahrung war es ja notwendig gewesen, sich<br />
immer wieder auf neue Situationen einzustellen.<br />
Etwa nach eineinhalb Jahren war es so, dass er den Kopf senkte, sich hinter meinen Beinen<br />
versteckte und sich an meine Hosenbeine klammerte, wenn ihn jemand auf der Straße im<br />
Dorf ansprach, den er nicht kannte. Jetzt - nach fast zwei Jahren - sucht er auch von sich<br />
aus Nähe und Zuwendung bei mir und hält schon länger körperliche Nähe aus. Das<br />
Vertrauen in mich als Pflegemutter und in uns als Pflegefamilie ist aber immer noch sehr<br />
brüchig. Das war etwa spürbar, als wir im Urlaub in Griechenland spätabends mit unserem<br />
Mietauto auf dem Heimweg zu unserer Unterkunft waren und Rene plötzlich panische Angst<br />
äußerte, dass wir nicht mehr zurückfinden könnten.<br />
Als zweite Sonderform des undifferenzierten Bindungsverhaltens beschreibt Brisch den<br />
Unfall-Risiko-Typ, der sich beim Kind durch ein ausgeprägtes Risikoverhalten,<br />
Selbstgefährdung und Selbstverletzung äußert. Ein Kind nimmt normalerweise Blickkontakt<br />
mit der Mutter auf, wenn es in eine fremde, ängstigende Situation kommt. Diese „soziale<br />
Rückversicherung“ bei der Bezugsperson fehlt bei den genannten Kindern. Sie zeigen ein<br />
Getriebensein im Verhalten und lernen auch aus schmerzlichen Unfallerfahrungen nicht.<br />
Dieses Verhalten scheint bei Heim- und Pflegekindern mit häufigem Wechsel der<br />
Bezugspersonen und auch bei vernachlässigten Kindern oft aufzutreten.<br />
24
Sandro fiel Nachbarn auf, weil er auf der Straße nach Essen bettelte und auf dem<br />
Balkongeländer lebensgefährliche Balancierversuche unternahm. Er kam mit knapp fünf<br />
Jahren erst ins Krisenhaus des SOS-Kinderdorfes, dann zog er mit einem zweiten Kind zu<br />
einer Kinderdorfmutter. Als diese ein halbes Jahr später überraschend das Kinderdorf<br />
verließ, kam Sandro mit knapp sechs Jahren in eine Pflegefamilie. Die Pflegemutter<br />
berichtete mir voller Sorge, dass Sandro sehr oft auf die neben dem Haus gelegene Straße<br />
lief. Sie hatte den Eindruck, dass er sich bewusst vor fahrende Autos oder als<br />
Nichtschwimmer ins tiefe Wasser begab und damit sein Leben aufs Spiel setzte.<br />
Übersteigertes Bindungsverhalten:<br />
Kinder mit dieser Verhaltensform klammern exzessiv und sind nur in absoluter Nähe zur<br />
Bezugsperson emotional beruhigt und ausgeglichen. Das Verhalten ähnelt dem unsicher-<br />
ambivalenten Bindungsmuster, ist aber extrem übersteigert. Es ist für die Kinder sehr<br />
schwierig, ihre Umgebung zu erkunden, den Kindergarten oder die Schule zu besuchen. Die<br />
Bezugspersonen vermeiden Trennungen schon im Vorhinein. Diese Form der<br />
Bindungsstörung ist zu beobachten bei Kindern, deren Mütter unter einer Angststörung mit<br />
extremen Verlustängsten leiden. Auch bei den Kindern steht dann die Angst vor Trennung<br />
und Verlust im Vordergrund. Im Unterschied zur Diagnose F 93.0 im ICD 10<br />
(Trennungsangst) beschreibt Brisch, dass diese Angst in stärker ausgeprägter Form auch in<br />
vertrauter Umgebung, nicht nur bei phantasierter oder realer Trennung und auftritt.<br />
Gehemmtes Bindungsverhalten:<br />
Diese ist vergleichbar mit der unter F 94.1 im ICD 10 beschriebenen übermäßigen<br />
Anpassung. Das Kind ist im Ausdruck den Bindungspersonen gegenüber gehemmt, während<br />
es in Abwesenheit der Bindungspersonen freier und offener in seinem Gefühlsausdruck<br />
erscheint. Diese Form der Bindungsstörung betrifft vor allem Kinder nach körperlicher<br />
Misshandlung oder bei einem Erziehungsstil mit Drohung oder Gewaltanwendung. Das Kind<br />
ist dann vorsichtig gegenüber seinen Eltern, deren Schutz sie zwar ersehnen, die ihnen aber<br />
oft Angst machen.<br />
25
Aggressives Bindungsverhalten:<br />
Die Kinder bringen ihren Wunsch nach Nähe den Bindungspersonen gegenüber durch<br />
aggressives Verhalten (körperlich und/ oder verbal) zum Ausdruck. Das Familienklima kann<br />
dabei durch aggressive Verhaltensweisen der Familienmitglieder geprägt sein und eine hohe<br />
aggressive Spannung herrschen. Erste Kontakte werden meist durch aggressive Interaktionen<br />
hergestellt, was sich beruhigt, sobald Bindung sich entwickelt. Oft werden die<br />
Bindungswünsche der beschriebenen Kinder nicht verstanden, sie können leicht als<br />
Störenfriede abgelehnt werden. Wenn die primären Bindungswünsche des Kindes<br />
zurückgewiesen wurden, löst dies beim Kind Aggressionen aus. Die Frustration über die<br />
nicht beantworteten Bindungswünsche kann beim Kind zu einer Haltung führen, in der es<br />
um die Bindung kämpft. Dabei erwartet es die gewohnte Zurückweisung und gibt sich<br />
aggressiv kämpferisch.<br />
Ich denke, dass diese Form des Bindungsverhaltens bei Pflegekindern auch sehr häufig zu<br />
beobachten ist und vermute, dass sie in einem Milieu von Vernachlässigung, innerhalb dem<br />
nicht gesehen werden kann, was Kinder brauchen, leicht entsteht.<br />
Bindungsverhalten mit Rollenumkehrung:<br />
Dieses Verhalten könnte auch mit dem Begriff der Parentifizierung umschrieben werden.<br />
Das Kind verhält sich sehr fürsorglich gegenüber seinen Bezugspersonen und übernimmt<br />
ihnen gegenüber Verantwortung. Es gibt seine eigenen Erkundungswünsche auf, bleibt in<br />
der Nähe der Bezugsperson und legt ihr gegenüber ein kontrollierendes Verhalten an den<br />
Tag. Ein solches Verhalten kann entstehen, wenn das Kind Angst um den realen Verlust der<br />
Bindungspersonen haben muss, etwa bei Scheidung, Suizidandrohung oder Suizidversuch<br />
eines Elternteils. Es ähnelt dem Verhalten eines Kindes mit sicherer Bindung insofern, als<br />
das Kind sehr feinfühlig die Bedürfnisse seiner Bindungsfigur erspürt. Hingegen fehlt die<br />
Wechselseitigkeit und die positive Auswirkung auf die Exploration des Kindes.<br />
Auch diese Verhaltensform ist häufig bei Pflegekindern zu sehen. Es kommt oft vor, dass die<br />
Kinder während der Zeit, die sie noch in der Herkunftsfamilie verbrachten, die Defizite der<br />
Bindungspersonen auszugleichen versuchten, etwa nicht altersgerecht für Haushalt oder<br />
Essen oder für das Befinden der Bezugsperson sorgten. Solche Kinder bleiben dann im<br />
Kinderheim immer in der Nähe der Betreuerin, versuchen ihr jeden Wunsch von den Lippen<br />
26
abzulesen, bei allen Tätigkeiten mitzuhelfen oder die jüngeren Kinder in der Gruppe zu<br />
versorgen.<br />
Eine Pflegemutter berichtete, dass ihr fünfjähriger Pflegesohn anfangs nicht begreifen<br />
konnte, dass sie selber mit dem Auto fuhr. Er war jeweils sehr angespannt, wenn sie im Auto<br />
unterwegs waren und versuchte sich immer den Weg einzuprägen, um wieder<br />
zurückzufinden. Später stellte sich heraus, dass er immer die Orientierung behalten musste,<br />
wenn er mit seiner eigenen Mutter unterwegs gewesen war, weil sie aufgrund ihrer Alkohol-<br />
und Drogensucht oft nicht in der Lage gewesen war, wieder heimzufinden.<br />
Ebenso hatte auch Sandro wie oben bereits erwähnt auf der Strasse nach Essen betteln<br />
müssen, weil seine Mutter den ganzen Tag verschlief.<br />
Bindungsstörung mit Suchtverhalten:<br />
Wenn der Wunsch des Kindes nach Trost und Nähe unfeinfühlig mit Essen oder Ähnlichem<br />
beantwortet wird, wird nicht das eigentliche Bedürfnis gestillt, sondern nur vorübergehend<br />
ruhig gestellt. Aus der wiederholten Umlenkung des Bindungswunsches kann sich ein<br />
Suchtverhalten nach Essen oder Video- und Computerspielen (später auch nach Arbeit,<br />
Lernen, Alkohol, Drogen oder flüchtigen sexuellen Kontakten) entwickeln. Es kommt zu<br />
einer süchtigen, sehnsüchtigen Suche, bei der das Suchtmittel den kontrollierbaren,<br />
verfügbaren Ersatz für die echte Bindungsperson darstellt und gleichzeitig eine große Angst<br />
vor echtem Beziehungs- und Bindungsaufbau besteht.<br />
Psychosomatische Symptomatik:<br />
Bei emotionaler und/oder körperlicher Verwahrlosung, emotionaler Abweisung und einer<br />
distanzierten Haltung der Bezugspersonen kann eine Wachstumsretardierung die Folge sein.<br />
Auch dies ist häufig bei Pflegekindern zu sehen, die nicht genügend versorgt wurden.<br />
Durch psychische Überforderung der Hauptbezugsperson, psychische Erkrankungen wie<br />
eine postnatale Depression oder Psychose kann es zum teilweisen oder gänzlichen Rückzug<br />
der Bezugsperson und damit zu einer großen emotionalen Verunsicherung des Kindes<br />
kommen.<br />
Schrei-, Schlaf- oder Essstörungen können entstehen.<br />
27
Brisch empfiehlt, bei psychosomatischen Beschwerden von Kindern und Jugendlichen<br />
immer eine Bindungsdiagnostik vorzunehmen, da eine Bindungsproblematik die zugrunde<br />
liegende Hauptdiagnose bei Essstörungen, Schlafstörungen, Einnässen etc. sein kann.<br />
Dorothea Weinberg fügt dieser Aufzählung noch eine weitere Form der Bindungsstörung<br />
hinzu: das antagonistische Verhalten des Kindes bei Kontakt mit dem Täter (etwa dem<br />
schlagenden oder missbrauchenden Vater), das sich darin zeigen kann, dass dieser geradezu<br />
überschwänglich und übertrieben freundlich vom Kind begrüßt und „umcirct“ wird.<br />
Sie sieht dieses täuschende Bindungsverhalten oft gepaart mit aggressiv-dominantem<br />
Bindungsverhalten dem nicht misshandelnden oder missbrauchenden Elternteil gegenüber.<br />
(vgl. Weinberg 2010, S 25 ff)<br />
„Das verbindende Gemeinsame dieser Störungen ist, dass die Kinder kein ‚Urvertrauen’ in<br />
ihre Pflegepersonen und das Gute in der Welt spüren. Sie können die Zuwendung,<br />
Wegweisung und Zuneigung ihrer neuen Eltern nicht als das wahrnehmen, was sie sind.“<br />
(ebd. S 28)<br />
„Statt sich also anzuvertrauen, fühlen sie sich gezwungen, ihre persönliche Sicherheit nach<br />
ihren individuellen Fähigkeiten und Eigenarten und ihren Lebensumständen allein zu<br />
gewährleisten.“ (ebd. S 29)<br />
Weinberg beschreibt weiter, wie die so genannte traumatische Bindung an den Aggressor<br />
beim Kind eine Abspaltung von Gewalt- und Angsterlebnissen und damit das Auftreten<br />
dissoziativer Zustände bewirken kann - auch später noch, wenn das Kind eigentlich in<br />
Sicherheit ist. Das Empfinden von Todesnähe „bleibt erhalten und taucht in späteren Angst-,<br />
Verlassenheits-, Schmerz- und Bedrohungssituationen als physiologische und emotionale<br />
Reaktion auf.“ (ebd. S 31)<br />
Das Kind denkt schnell: „Die bringen mich um“ oder „Das überleb ich nicht“ und reagiert<br />
dann mit der Situation nicht angemessenem, etwa sehr aggressivem Verhalten. Es reagiert in<br />
diesem Moment auf die tödliche Bedrohung, die gar nicht existiert.<br />
Weinberg beschreibt zudem verschiedene Täuschungsreaktionen, mit denen das Kind<br />
versucht, die in den Beziehungen zu den primären Bezugspersonen erlebte Ohnmacht und<br />
Angst in Schach zu halten:<br />
Hartes, cooles Verhalten: eine hohe Aggressions- und Kampfbereitschaft täuscht über<br />
Ängste und Opfergefühle hinweg. Das Motto lautet hier: „nur ja nie mehr Opfer werden“.<br />
Ein Kampf findet häufig statt, wenn das Kind einen „schwächeren“, nicht<br />
28
aggressionsbereiten Gegner findet. Dieses Verhalten lässt sich oft bei Pflegekindern<br />
beobachten.<br />
Kinder können auch viel Aktivität einsetzen, um die Kontrolle über ihr eigenes Opfer-Sein<br />
zu behalten. Dies kommt etwa im Lolita- und Stockholm-Syndrom zum Ausdruck, aber auch<br />
darin, andere zu quälen oder in selbstverletzendem oder -zerstörendem Verhalten.<br />
Anpassung kann ein weiteres Täuschungsverhalten sein, wenn es darum geht, überbrav zu<br />
sein, um nur ja nicht anzuecken, keinen Zorn hervorzurufen, engelhaft unauffällig zu sein.<br />
Damit sendet das Kind die Botschaft: „Ich tue auch wirklich alles, was du willst! Bitte, bitte,<br />
tu mir nichts.“<br />
Es gibt auch Kinder, die sehr tatkräftig vermitteln: „Ich bin stark, ich komme klar, mit mir ist<br />
alles in Ordnung!“ (vgl. Weinberg 2010, S 32 f)<br />
Pflegeeltern sind hier sehr gefordert, nicht nur auf das nach außen vom Kind gezeigte<br />
Verhalten zu reagieren, sondern dahinter zu blicken, „mit den Augen eines Kindes sehen zu<br />
lernen“, so wie es Bettina Bonus ausdrückt. Wenn man es schafft, die vom Kind nicht mehr<br />
offen gezeigten Bindungsbedürfnisse zu erahnen und positiv zu erfüllen, kann man<br />
versuchen, das erschütterte Vertrauen des Kindes langsam wieder auf eine sichere Basis zu<br />
stellen, von der aus es vielleicht auch wieder wachsen kann.<br />
5.5 Bindungsstörungen aus existenzanalytischer Sicht<br />
Wenn man die verschiedenen angesprochenen Formen von Bindungsstörungen insgesamt<br />
betrachtet, haben sie, wie auch Dorothea Weinberg meint, eines gemeinsam: den Verlust des<br />
Vertrauens. Erschüttert wird zunächst das Vertrauen in die engsten Bezugspersonen und in<br />
der Folge das Vertrauen in die Welt und in andere Menschen, letztlich aber auch das<br />
Vertrauen in sich selber - in die eigenen Fähigkeiten und die eigene Wirksamkeit.<br />
„Es gibt kaum eine tiefere Verunsicherung und Verängstigung für einen Menschen, als in<br />
einer feindlichen, ablehnenden familiären Atmosphäre heranwachsen zu müssen.“ (Längle in<br />
Existenzanalyse 3/1999, S 19)<br />
Die Folgen einer gestörten Bindung zu den nächsten Bezugspersonen lassen sich zunächst<br />
auf der Ebene der ersten Grundmotivation beobachten. Fehlen Raum, Halt und Schutz für<br />
das Kind, sind Angst, Unsicherheit und Verschlossenheit die Folge. Bei Bindungsstörungen<br />
mit gehemmtem Verhalten gegenüber Bezugspersonen überwiegt wahrscheinlich die<br />
Tendenz zur Flucht, zum Rückzug. Das Misstrauen ist so groß, dass das Kind sich auf<br />
niemanden mehr einlässt. Es hält sich so aber auch von Beziehungen fern, kann Wärme und<br />
29
Nähe nicht wirklich erfahren. Unter Umständen kann die Beziehungslosigkeit auch bei<br />
einem Kind in die Depression führen, was uns zu den Folgen fehlender Beziehungen auf der<br />
Ebene der zweiten Grundmotivation führt.<br />
Bei Bindungsstörungen mit Enthemmung und undifferenziertem Bindungsverhalten scheint<br />
eine gewisse Beliebigkeit und Unverbindlichkeit an die Stelle verlässlicher Bindungen zu<br />
treten. Ist es einem gut gehaltenen, geschützten Kind möglich, seine Umgebung und die<br />
Bezugspersonen wahrzunehmen, scheinen bindungsgestörte Kinder, die allen<br />
Bezugspersonen mit gleicher unpersönlicher Freundlichkeit begegnen, nicht mehr gut<br />
hinzuschauen, wer denn eine sichere Person sein könnte. Um zu überleben, muss jede<br />
Bezugsperson genutzt werden. Gleichzeitig versucht sich das Kind vielleicht auch, vor<br />
neuerlichen Enttäuschungen zu bewahren und bindet sich an niemanden mehr ausschließlich.<br />
Bei Bindungsstörungen mit aggressivem Verhalten scheint das Kind den Weg des Kampfes<br />
gewählt zu haben. Es kämpft darum, mit der Bezugsperson in Beziehung zu treten. Es tut<br />
viel dafür, gesehen und beachtet zu werden, auch wenn das tatsächliche Verhalten oft wieder<br />
nur zu Ablehnung führt, die das Kind vielleicht nur zu gut kennt. Im Kampf, in der Wut<br />
spürt sich das Kind gut, während es sich selber aber aus der Beziehung draußen hält. Es<br />
demonstriert Stärke, wo es sich eigentlich fallen lassen möchte.<br />
Nach Viktor Frankl ist der Mensch nur da ganz Mensch, wo er hingegeben ist an eine andere<br />
Person. Sein Menschsein kann sich nur entfalten an einem Gegenüber. Wer der Mensch ist,<br />
ergibt sich durch sein Bezogensein. So meint auch Frankl mit Martin Buber: „Das Ich wird<br />
erst am Du zum Ich.“ Der Austausch wird hier als Grundvoraussetzung für das Leben<br />
angesehen. Nur wenn man mit anderen in Berührung kommt, entfaltet man seine<br />
Fähigkeiten. Man nimmt vom Anderen auf, wandelt es um, gibt es weiter. „Die<br />
Andersartigkeit schafft aus existenzanalytischer Sicht den Unterschied zwischen dem Ich<br />
und dem Selbst. Das Selbst ist durch das andere und wird so zum Freiraum, ‚in dem das Ich<br />
atmet’.“ (Längle in Rothbucher/Wurst 1989, S 84)<br />
Wenn das Andere mich allerdings bedroht, dann wird der Austausch unterbrochen, „eine<br />
schützende Distanz zur Gefahr wird notwendig“. (ebd. S 84)<br />
Ich denke, dass alle Bindungsstörungen dem Zweck dienen, eine solch schützende Distanz<br />
vor dem schädigenden Einfluss der Bezugspersonen herzustellen und mit einem Defizit im<br />
Selbsterleben einhergehen. Das Kind ist so sehr damit beschäftigt, die Grundbedingungen<br />
(Raum, Schutz, Halt) zu sichern und um sein psychisches Überleben zu kämpfen, dass seine<br />
Ich-Fähigkeiten sich nicht oder nur sehr einseitig entwickeln können. Bei Pflegekindern ist<br />
oft auch eine so genannte Anstrengungsverweigerung zu beobachten (vgl. Bonus 2006,<br />
30
S 149 ff): das Kämpfen ums Überleben hat so viel Kraft gefordert, die Bemühungen sind so<br />
oft enttäuscht worden, dass es sich schließlich für kaum mehr etwas lohnt, sich anzustrengen.<br />
Damit sind auch die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und die Erfüllung eigener<br />
Lebensträume bedroht.<br />
Oft steht hinter gestörtem Bindungsverhalten eine traumatische Erfahrung, die sich<br />
wiederum auf allen Ebenen der vier Grundmotivationen auswirken kann.<br />
„Die Erfahrung eines schweren Traumas erschüttert die Dimensionen des Sein-Könnens,<br />
blockiert die Beziehung zum Leben inklusive des vitalen Wertgefühls und des<br />
Beziehungslebens, löscht die Ich-Funktionen aus, sodass Selbstbild, Identität und Selbstwert<br />
verblassen. Schließlich raubt das Trauma den Glauben an eine Zukunft, an eine<br />
Entwicklung, in der das eigene Leben und Handeln aufgehen könnte.“ (Längle in<br />
Existenzanalyse 2/2005, S 10)<br />
Daraus lässt sich folgern, wie unendlich wichtig es ist, dass ein solches Kind in den<br />
Pflegeeltern Menschen begegnet, die ihm vermitteln können: du bist hier sicher, wir lassen<br />
dich nicht im Stich, es ist gut, dass du da bist, du wirst geliebt, geachtet und geschätzt dafür,<br />
was und wer du bist. Die Grundlage hierfür bildet die Bindung, die es einem Kind erst<br />
möglich macht, wieder ruhig und sicher in der Welt zu sein, wahrzunehmen, was ist, was<br />
und wer es umgibt, sich in einer Beziehung zu liebevollen Menschen aufgehoben zu fühlen,<br />
sich selber und seine Eigenarten zu spüren und wertzuschätzen und somit sein eigenes<br />
Dasein als gut und sinnvoll zu erleben. Bindungsarbeit ist Arbeit an einer sicheren Basis, am<br />
Aufbau des Vertrauens, an der Erfahrung des Seinsgrundes. Nur wenn ich mich gehalten und<br />
geschützt fühle und Raum für meine Entwicklung habe, kann ich auch das Faktische des<br />
Lebens annehmen und die eventuell auftauchenden Belastungen aushalten. Nur wenn ich<br />
mich vom Leben getragen fühle, kann ich mich wirklich darauf einlassen.<br />
31
6 Bindung und Psychotherapie<br />
6.1 Bedeutung der Bindungstheorie in der Psychotherapie<br />
Eine zentrale Errungenschaft der Bindungstheorie stellt sicher die Erkenntnis der<br />
Bedeutsamkeit von frühen Beziehungen und den damit verbundenen Erfahrungen, etwa auch<br />
Trennungen, Verlusten, Misshandlungen etc. für das weitere Leben und das Agieren von<br />
Personen in sozialen Kontakten dar. Dabei scheint die Art der Beziehung zu den frühesten<br />
Bezugspersonen prägend zu sein für die Entwicklung aller weiteren zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen. Begriffe aus der Bindungstheorie (Elterliche Feinfühligkeit,<br />
Bindungsverhalten, Sichere Basis, Bindungsstile, etc.) können in der Arbeit mit Eltern und<br />
Kindern sehr hilfreich sein. Die Verhaltensbeobachtung von Kindern, alleine oder mit ihren<br />
Eltern, kann wichtige Erkenntnisse für eventuelle Diagnosen und die Therapie liefern. (vgl.<br />
Minde in Spangler/Zimmermann 2009, S 364)<br />
Bowlby selbst hat einige Aufgaben der Bindungstheorie in der Psychotherapie formuliert:<br />
„(1) Therapeut als sichere Basis für die Selbstexploration<br />
(2) Reflexion der inneren Arbeitsmodelle in gegenwärtigen Beziehungen<br />
(3) Prüfung der therapeutischen Beziehung<br />
(4) Genese der inneren Arbeitsmodelle in den Bindungsrepräsentationen der Eltern<br />
(5) Realitätsprüfung der ‚alten’ inneren Arbeitsmodelle auf Angemessenheit“ (Bowlby in<br />
Hauser/Endres 2002, S 167)<br />
Der Psychotherapeut wird immer auch als Bindungsfigur konsultiert. Der Klient ist häufig in<br />
einer leidvollen, krisenhaften Situation, in der seine eigenen Lösungsversuche nicht fruchten<br />
und sein Bindungssystem aktiviert ist. Nicht selten kommt er ängstlich, hilflos oder suchend<br />
in die Therapie. Er kann unter Umständen eine bindungskorrigierende Erfahrung machen,<br />
wenn er auf einen Therapeuten mit sicherem Bindungsmodell trifft, der feinfühlig reagiert.<br />
Der Klient kommt mit bestimmten Erwartungen, die er aufgrund seiner bisherigen<br />
Erfahrungen in Beziehungen ausgebildet hat - eventuell auch mit der Erwartung von<br />
Abweisung oder Ablehnung - und gleichzeitig mit der Hoffnung, jemanden zu finden, der<br />
verständnisvoll und annehmend reagiert. Die bisherigen Erfahrungen können durch das<br />
Verhalten des Psychotherapeuten in Frage gestellt werden, was es möglich macht, sie zu<br />
reflektieren. Hier treffen alte Erfahrungen auf neue Erlebnisse. Solche Übertragungen<br />
können auch verzerrend auf die Wahrnehmung vom Therapeuten wirken. Er kann etwa trotz<br />
seiner Bemühungen auch als abweisend erlebt werden. In der Therapie wird es auch eine<br />
32
Rolle spielen, ob es sichere Bindungsfiguren in der Kindheit gab, ob es verschiedene<br />
Bindungsmuster zu verschiedenen Personen oder dasselbe zu beiden Elternteilen gab.<br />
„Die psychischen Störungen eines Patienten entstehen, manifestieren sich und wandeln sich<br />
in dem interaktionalen Austausch mit seinen Mitmenschen. […] Davon ist auch die<br />
therapeutische Beziehung als der Ort, an dem Heilung stattfinden soll, nicht ausgenommen.“<br />
(Endres/Hauser 2002, S 159)<br />
Der Therapeut kann den Klienten aktiv anregen, sich mit seinen Empfindungen in der<br />
Beziehung zwischen ihm und dem Therapeuten auseinanderzusetzen, was wiederum den<br />
Aufbau einer vertrauensvollen, sicheren Beziehung fördert. Diese positive therapeutische<br />
Beziehung bildet eine wichtige Grundlage, um sich mit intrapsychischen und<br />
interpersonellen Prozessen zu beschäftigen und um die Basis für Veränderungen zu schaffen.<br />
Es kann hilfreich sein, zu wissen, welche Erwartungen der Klient hinsichtlich der<br />
Reaktionen des Therapeuten hegt und diese dann einzuordnen, zu verbalisieren und zu<br />
bearbeiten. (vgl. Heverdari-Heller in Endres/Hauser 2002, S 97)<br />
In der Existenzanalyse öffnet sich der Therapeut ganz auf sein Gegenüber hin und versucht,<br />
sich in die Welt des anderen und seine inneren Bezüge hineinzuversetzen. Die Begegnung<br />
zwischen Therapeut und Klient „geschieht am Thema, abgegrenzt, schamvoll und<br />
respektierend, in belassender und eingehaltener Distanz“. (Längle in Existenzanalyse 1/2004,<br />
S 29)<br />
Diese annehmende, respektierende, sehr achtsame Haltung dem Klienten gegenüber kann es<br />
ermöglichen, dass dieser sich ebenfalls angenommen und respektiert fühlt und lernt, sich<br />
selber, seinen Gefühlen und Beweggründen gegenüber achtsam zu sein. In der geschützten<br />
Situation in der Therapie kann der Klient sich vom Therapeuten gehalten fühlen, was es ihm<br />
im günstigsten Fall ermöglicht, sich auch außerhalb der Therapie in der Welt Raum zu<br />
nehmen und das in der Therapie Erspürte, Erkannte und Erprobte dort umzusetzen.<br />
Der Therapeut als Bindungsperson spielt demnach eine wichtige Rolle für die psychische<br />
Veränderung, die einem Klienten in der Therapie möglich ist. Es scheint heute eine<br />
gesicherte Erkenntnis zu sein, dass die Qualität der emotionalen Bindung zwischen<br />
Therapeut und Klient den Therapieerfolg maßgeblich beeinflusst. (vgl. Brisch in<br />
Endres/Hauser 2002, S 86)<br />
33
6.2 Bindungstheoretische Aspekte in der psychotherapeutischen<br />
Arbeit mit Eltern und Kindern<br />
In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und deren Eltern kann die Beobachtung der<br />
gegenseitigen Interaktion wichtige Erkenntnisse über die Art der Beziehung zwischen Kind<br />
und Eltern liefern. Es lässt sich unter Umständen beobachten, wie gut abgestimmt die<br />
Wechselbeziehung ist, ob die Eltern angemessen auf die Signale des Kindes reagieren, ob<br />
das Kind die Erfahrung macht, dass es etwas bewirken kann. Im dialogischen Austausch<br />
zwischen Mutter und Kind geschehen fortlaufend Anpassungs- und Regulierungsprozesse<br />
und im Idealfall finden beide einen „gemeinsamen Takt“ (K. Grossmann in Endres/Hauser<br />
2002, S 58). Oft aber sind es Probleme in diesem Prozess, die eine psychotherapeutische<br />
Intervention nötig machen. In der Psychotherapie mit Eltern und Kindern ist der<br />
Psychotherapeut ebenso gefordert, die Funktion der sicheren Basis zu übernehmen. „Diese<br />
sichere Basis ist die Bedingung dafür, dass die Eltern bereit sind, ihre Vergangenheit und<br />
ihre gegenwärtige Situation mental zu explorieren und im therapeutischen Kontakt darüber<br />
zu sprechen.“ (Heverdari-Heller in Endres/Hauser 2002, S 94)<br />
Therapeutisch wird es hier wichtig, die Signale des Kindes in der Sprache, der<br />
Körperhaltung, Gestik und Mimik und im Ausdruck von Gefühlen zu beobachten. Während<br />
in der Kinderpsychotherapie der Fokus auf der Interaktion des Kindes mit dem Therapeuten<br />
liegt, ist in der Eltern-Kind-Psychotherapie die Eltern-Kind-Interaktion und die Art der<br />
Affektregulierung von Bedeutung. Wenn das Kind etwa in Anwesenheit der Eltern ganz<br />
allein im noch unbekannten Therapieraum spielt, könnte das auf eine vermeidende<br />
Beziehung hindeuten und darf nicht einfach mit Autonomie des Kindes verwechselt werden.<br />
Besonders der Beginn und das Ende der Therapiestunde können wichtige Erkenntnisse<br />
liefern, weil diese Momente Stresssituationen darstellen, die das Bindungsverhaltenssystem<br />
beim Klienten aktivieren und damit über die Art der Bindungsorganisation Aufschluss geben<br />
können. (vgl. ebd., S 96 ff)<br />
Dorothea Weinberg meint, dass der Moment der ersten Kontaktaufnahme des Kindes zum<br />
Therapeuten von instruktiver Bedeutung ist, weil sich das Kind in dieser für es nicht<br />
abschätzbaren Situation immer so verhalten wird, dass es sich möglichst sicher fühlt.<br />
„Dadurch geben Ihnen diese ersten Momente viele Hinweise auf die Bindungssituation, die<br />
inneren Sicherheitskonzepte und Bewältigungsmuster des Kindes in sozialen<br />
Stresssituationen und können schon gleich bindungstherapeutisch genutzt werden.“<br />
(Weinberg 2012, S 19)<br />
34
Es lässt sich beobachten, wie das Kind sich von seiner Bezugsperson löst, ob es sich an sie<br />
klammert oder schon ohne Aufforderung in den noch fremden Raum vorausgeht, ob es<br />
angespannt ist, verschlossen oder ständig lächelt, ob es versucht, dem Therapeuten alles<br />
recht zu machen oder im Gegenteil alles zu bestimmen.<br />
Ein vermeidend gebundenes Kind wird eher pseudo-selbständiges Verhalten zeigen, sehnt<br />
sich aber eigentlich nach einem empathischen und zugewandten Therapeuten. Ein<br />
ambivalent gebundenes Kind versucht wahrscheinlich eher herauszufinden, was es tun muss,<br />
um dem Therapeuten zu gefallen. Ein desorganisiert gebundenes Kind wird vielleicht in<br />
Anwesenheit der Bindungsperson sehr angespannt wirken, durch bizarres und<br />
antagonistisches Verhalten (etwa Lächeln beim Anklammern) auffallen, und die Frage nach<br />
dem pathologischen Einfluss bestimmter Bindungspersonen aufwerfen.<br />
Die therapeutische Beziehung ist für ein Kind meist eine Ergänzung der schon bestehenden<br />
Beziehungen. Seine Bindungswünsche sind vorwiegend an die Eltern gerichtet, der<br />
Therapeut muss erst einmal ein Vertrauensverhältnis zum Kind herstellen und somit zur<br />
Bindungsperson werden. Aber das Kind wird seine bisherigen Bindungsstrategien auch auf<br />
den Therapeuten übertragen.<br />
Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind wird eher nicht über seine Gefühle sprechen,<br />
sondern auf der Spiel- und Handlungsebene zeigen, was es emotional bewegt. Es kann sein,<br />
dass es einen emotionalen Sicherheitsabstand aufrechterhält. In der Gegenübertragung<br />
können Gefühle von Leere und Müdigkeit, von fehlender Lebendigkeit aufkommen. „Die<br />
Bearbeitung der Affektabwehr gelingt oft am besten über spielerische Momente, wo gezeigte<br />
Gefühle aufgefangen und gespiegelt werden können, und das Kind allmählich Vertrauen<br />
fasst, sich in seinen Gefühlen mitteilen zu können.“ (Endres/Hauser 2002, S 171)<br />
Hier ist der Therapeut aufgefordert, dem Kind auftauchende Affekte zu spiegeln, die vom<br />
Kind inszenierten Spiele emotional anzureichern und die Bindungswünsche des Kindes<br />
feinfühlig zu beantworten. Ideal ist es, wenn begleitende Elterngespräche es dem<br />
Erwachsenen ermöglichen, sein unsicher-distanziertes Bindungsmodell zu hinterfragen.<br />
Wenn Eltern wieder Zugang finden zu ihrem eigenen Erleben als Kind, können sie vielleicht<br />
motiviert werden, ihrem eigenen Kind diese negativen Erfahrungen zu ersparen und in der<br />
eigenen Elternrolle die Muster aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Der Therapeut<br />
kann hier auch als Modellfigur und sichere Basis sowohl für das Kind als auch für die Eltern<br />
dienen.<br />
Bei einem unsicher-ambivalenten Bindungsmuster stehen eher Trennungs- und<br />
Verlustängste im Vordergrund. Die Kinder sind in ihrem Selbstwert eingeschränkt, fühlen<br />
35
sich schnell hilflos und überfordert, trauen sich neue Aufgaben nicht zu. In der<br />
Gegenübertragung fühlt man sich als Therapeut aufgefordert, dem Kind zu helfen und ihm<br />
etwas abzunehmen. Passive Kinder oder Kinder mit geringer Frustrationstoleranz neigen<br />
dazu, den Therapeuten zu aktivieren. Endres und Hauser betonen hier, dass es wichtig ist,<br />
dem Kind Strukturhilfen im Umgang mit seinen Gefühlen zu geben, von denen es manchmal<br />
überrollt wird. Dazu kann der Therapeut Gefühle mit der momentanen Beziehungssituation<br />
verknüpfen und es dem Kind ermöglichen, das Innenleben eines Erwachsenen, seine Gefühle<br />
und Gedanken kennen zu lernen.<br />
Bei einem desorganisierten-desorientierten Bindungsmuster wird sich in der therapeutischen<br />
Beziehung vor allem die Abwehr der Hilflosigkeit und Ohnmacht zeigen. Das Kind verhält<br />
sich in der Therapie vielleicht stark kontrollierend. Es zwingt dem Therapeuten etwa eine<br />
Rolle, ein Spiel auf, dem er sich nicht entziehen kann. Dieses Spiel kann eine unerbittliche<br />
Qualität annehmen und löst in der Gegenübertragung des Therapeuten Ohnmacht und<br />
Hilflosigkeit aus, die die eigentlich abgewehrten kindlichen Gefühle darstellen, oder den<br />
Impuls zur Verweigerung, zum Gegendruck, was den Elternanteilen in der Interaktion<br />
entsprechen kann. Zeigen kann sich auch eine bewegungsintensive Hypermotorik. „Das<br />
Kind zwingt den Erwachsenen […] in einen Spielmodus, bei dem es die maximale Kontrolle<br />
des interaktiven Geschehens festlegt, um seine Angst vor Kontrollverlust und dem<br />
Zusammenbruch der eigenen Strategie abzuwehren.“ (Endres/Hauser 2002, S 174)<br />
Ich lernte das Pflegekind Sandro im Rahmen der mobilen Hausfrühförderung in seiner<br />
neuen Pflegefamilie kennen. Es ist ein Prinzip der Frühförderung, dass die Stunden in der<br />
gewohnten Umgebung mit den anwesenden Eltern und Geschwistern stattfinden. Sandro war<br />
sehr kontaktfreudig und bald waren wir in ein von ihm inszeniertes Spiel mit Figuren in<br />
einem Schachtel-Puppenhaus vertieft. Nachdem das Häuschen eingerichtet war, begann sich<br />
das Familienspiel dahingehend zu verändern, dass zunächst die Tierfiguren Hahn und<br />
Henne von Sandro im Backofen gebraten wurden. Danach ging Sandro dazu über, der Reihe<br />
nach alle Menschenfiguren im Backofen zu verbrennen, bevor er schließlich das ganze Haus<br />
mitsamt seinen Bewohnern in einem großen imaginären Feuer untergehen ließ. Dabei<br />
befand sich Sandro in einem solchen Sog der Spielereignisse, dass er sich von mir in<br />
keinster Weise steuern oder beeinflussen ließ. Der anwesende Pflegevater und die beiden<br />
Pflegegeschwister verfolgten das Spiel mit wachsendem Entsetzen und fühlten sich sehr<br />
macht- und hilflos. In den folgenden Elterngesprächen beschlossen wir daraufhin, Sandro<br />
ein psychotherapeutisches Angebot zukommen zu lassen, sodass die Stunden nun mit Sandro<br />
36
alleine stattfinden würden, da er seine Bedürfnisse nach symbolischem Spiel in der ersten<br />
Stunde klar zum Ausdruck gebracht hatte.<br />
In den folgenden Stunden drehte sich das Spiel immer darum, dass Sandro sich eine<br />
besonders mächtige Figur ausdachte und mir die Rolle des Opfers zudachte. Über viele<br />
Stunden war er die Hexe, die den kleinen Hund töten wollte. Dazu dachte er sich immer neue<br />
Möglichkeiten und Wege aus. Ich kann mich noch gut an meine wachsende Hilflosigkeit und<br />
Ohnmacht erinnern, die ich in der Rolle des Hundes verspürte – so ganz der Macht der Hexe<br />
ausgeliefert zu sein. Immer, wenn es der Hexe dann gelungen war, den Hund zu fangen und<br />
zu töten, musste er wieder auferstehen und das Spiel ging wieder von vorne los. Es müssen<br />
seine eigenen Empfindungen der Ohnmacht, der Angst und des Ausgeliefertseins gewesen<br />
sein, die er mich in diesem Spiel spüren ließ. Aus heutiger Sicht hat Sandro hier klar<br />
traumatisches Spiel gezeigt, in dem sich das erlebte Trauma immer wieder reinszenierte, und<br />
aus dem es für ihn alleine kein Entrinnen gab.<br />
Einen ersten Erfolg konnte ich erringen, als es mir zum ersten Mal gelang, in der Rolle des<br />
kleinen Hundes mit einer List den Plan der Hexe zu vereiteln. Sandro hatte in der Rolle der<br />
Hexe viele Schüsseln mit Futter aufgestellt. Manche davon waren vergiftet. Ich betonte nun<br />
also, welch guten Geruchssinn der Hund hat und begann am Futter zu schnüffeln. Der kleine<br />
Hund weigerte sich, das vergiftete Futter zu fressen, weil er das Gift riechen konnte. Da gab<br />
es einen kurzen Moment, in dem Sandro sehr verblüfft und verwundert war und zum ersten<br />
Mal merkte, dass man vielleicht auch dann, wenn man nicht unbedingt der Größte und<br />
Stärkste ist, die Oberhand behalten kann. Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, dass Sandro<br />
in den Rollen wechselte und immer wieder einmal auch die Rolle des Kleinen, Schwachen<br />
einnahm. Ein wirklicher Perspektivenwechsel und ein länger dauerndes Einfühlen in die<br />
Rolle des Opfers war aber erst nach etwa eineinhalb Jahren Therapie möglich.<br />
Sandro hatte in seiner Vorgeschichte erlebt, wie es sich anfühlt, den Erwachsenen und ihren<br />
Stimmungen ausgeliefert zu sein. Er musste versuchen, für sich selber zu sorgen. Aus dieser<br />
sicher unheimlich ängstigenden Situation heraus erschien es ihm als einzige Lösung, selber<br />
auch so mächtig und stark und einflussreich zu erscheinen. Er flüchtete sich in<br />
Omnipotenzgefühle und den Pflegeeltern gegenüber in sehr autonomes, kontrollierendes<br />
Verhalten.<br />
37
Der Wunsch nach Allmächtigkeit und gleichzeitig die Sehnsucht nach Gehaltenwerden kam<br />
auch in einer Stunde zum Ausdruck, in der er mir erklärte, er habe die Macht, den Teufel zu<br />
rufen. Er öffnete mit meiner Hilfe das Fenster und schrie aus Leibeskräften: „Komm nur,<br />
Teufel, komm!“ Dann allerdings verließ ihn der Mut, und er bekam große Angst, dass er den<br />
Teufel tatsächlich herbeirufen könnte. Ich musste das Fenster wieder schließen, er verkroch<br />
sich auf meinem Schoß und ich musste ihm wieder und wieder versichern, dass er keine<br />
solche Macht besitzt, und der Teufel jetzt nicht kommen wird. Zu diesem Zeitpunkt bestand<br />
zwischen uns wohl schon eine Art von Bindung, die es ihm ermöglichte, sich auch in seiner<br />
Angst und Schwäche anzuvertrauen und eine Art von sicherer Basis, von der aus er seine<br />
Bewältigungsstrategien ein wenig hinterfragen konnte.<br />
Der Kindertherapeut muss also für das Kind als verlässliche psychische und physische Basis<br />
dienen und dem Kind trotz der vielleicht vorliegenden Bindungsstörung die Erkundung im<br />
Therapieraum und die Auseinandersetzung in der gemeinsamen Beziehung ermöglichen. Im<br />
besten Fall kann das Kind im Symbolspiel in der Kindertherapie seine erlebten<br />
Bindungserfahrungen darstellen und mit Hilfe des Therapeuten über den Weg neuer<br />
Bindungserlebnisse eine sichere Bindungsqualität entwickeln.<br />
6.3 Möglichkeiten und Erfahrungen in der psychotherapeutischen<br />
Arbeit mit Pflegekindern<br />
6.3.1 Unterstützung beim Bindungsaufbau in der Pflegefamilie<br />
Bindungsentwicklung ist nicht auf genetische Verwandtschaft festgelegt und grundsätzlich<br />
mit jeder Person möglich, die feinfühlig ist, „sich in die Innenwelt des Kindes empathisch<br />
hineinversetzt und durch dialogischen Blickkontakt, Sprache und Berührung eine<br />
Bindungsbeziehung aufbaut.“ (Brisch/Hellbrügge 2009, S 236)<br />
Soziale und emotionale Elternschaft kann von Pflegeeltern also für ein Pflegekind<br />
übernommen werden mit der begründeten Hoffnung, dass sich neue Bindungsbeziehungen<br />
entwickeln. Ganz allgemein können wichtige Personen auf dem Lebensweg des Kindes zu<br />
sekundären Bindungsfiguren werden. Von einer Bindungsbeziehung kann man sprechen,<br />
wenn es sich um eine Beziehung auf Dauer mit einer bestimmten Person handelt, „die als<br />
emotional bedeutsam erlebt wird, wenn sie den Wunsch nach Nähe und Kontakt beinhaltet<br />
38
und dementsprechend Trennungsschmerz impliziert und wenn in ihr Sicherheit und Trost<br />
gespendet werden.“ (Schleiffer 2007, S 19)<br />
Bei jüngeren Kindern, die bereits innerhalb der ersten Lebensmonate in eine Pflegefamilie<br />
kommen, werden die neuen Bindungsbeziehungen erfahrungsgemäß recht schnell aufgebaut,<br />
und es braucht dazu vor allem ein Mindestmaß an Feinfühligkeit und psychologischer<br />
Verfügbarkeit der Pflegeeltern.<br />
Bei älteren Kindern, die in einer Pflegefamilie untergebracht werden, muss man davon<br />
ausgehen, dass das Kind schon bedeutsame bindungsrelevante Erfahrungen gemacht hat.<br />
Bindungsunsicherheiten oder eine schon bestehende Bindungsstörung erschweren den<br />
Aufbau neuer Bindungsbeziehungen. Ausschlaggebend für eine Bindungsstörung dürfte das<br />
„Fehlen eines Angebotes vorhersehbarer, persönlicher und das heißt nicht austauschbarer<br />
Beziehungen im ersten Lebensjahr sein“ (ebd. S 21 )<br />
In der Folge bildet das Kind keine auf eine bestimmte Person bezogenen Erwartungsmuster<br />
aus und kann das Bindungsangebot der Pflegeeltern nicht annehmen. Es bleibt je nach Art<br />
der Bindungsstörung unverbindlich, distanzlos oder gehemmt in seinem<br />
Beziehungsverhalten. Dadurch können die Motivation, das Durchhaltevermögen und das<br />
Verständnis der Pflegeeltern für die dahinter liegenden Gründe sehr strapaziert werden.<br />
Pflegeltern fühlen sich unter Umständen durch das Verhalten des Kindes persönlich<br />
gekränkt, hilflos oder ohnmächtig, wodurch die Beendigung des Pflegeverhältnisses in den<br />
Bereich des Möglichen rückt.<br />
„Gerade Bezugspersonen mit einem unsicheren Bindungsstil lassen sich durch ein<br />
abweisendes, indifferentes oder gar aggressives Verhalten von Seiten ihres Pflegekindes<br />
leicht zu einer komplementären Reaktion provozieren.“ (ebd. S 22)<br />
Wenn Pflegeltern also auf abweisendes kindliches Verhalten ebenfalls mit Ablehnung<br />
reagieren, auf indifferentes Verhalten hin sehr unverbindlich bleiben oder auf aggressives<br />
Verhalten des Kindes mit Wut, Ärger und verstärkter Machtdemonstration reagieren, kann<br />
sich auf Seiten des Kindes das gewohnte Muster verstärken und die Erfahrung verfestigen,<br />
dass es sich ja so verhalten muss, weil die Erwachsenen nicht auf seine Bedürfnisse<br />
eingehen.<br />
So empfehlen auch die meisten Ratgeber zur Erziehung von Pflegekindern, deren<br />
Erwartungen auf positive Art und Weise zu „enttäuschen“. Die Anforderungen an<br />
Pflegeeltern sind demnach hoch. Die Fachmeinung geht dahin, dass sicher-autonom<br />
organisierte Pflegeeltern am besten geeignet sind, den ihnen anvertrauten Kindern<br />
Bindungskorrekturen zu ermöglichen. Das heißt nun nicht, dass Pflegeeltern keine<br />
39
psychischen Verletzungen oder unsicheren Bindungsmuster aufweisen dürfen, nur sollten die<br />
Verletzungen einigermaßen vernarbt sein, und es sollte Pflegeeltern ermöglicht werden, in<br />
einer begleitenden Beratung oder Supervision den eigenen Erfahrungen und in der<br />
Begegnung mit dem Pflegekind vielleicht wiederbelebten Emotionen nachzuspüren.<br />
Auch wenn die Erziehung eines Pflegekindes bisweilen therapeutische Kompetenz verlangen<br />
würde, sollte es den Pflegeeltern möglich sein, in erster Linie Eltern zu bleiben, weswegen in<br />
der Fachliteratur auch von einer „sanften Professionalisierung“ von Pflegeeltern gesprochen<br />
wird oder davon, den Pflegeeltern ein „Stück Professionalität“ in den Alltag mitzugeben.<br />
(vgl. Schleiffer 2007, S 31)<br />
Therapeutische und beratende Unterstützungsangebote für Pflegeeltern und Pflegekinder<br />
sollten zum Ziel haben, das Entstehen neuer, sicherer Bindungen in der Pflegefamilie zu<br />
fördern. „Das Kind ist in der Lage, noch einmal neue, individuelle und persönliche Eltern-<br />
Kind-Beziehungen herzustellen.“ (Nienstedt/Westermann 2007, S 82)<br />
Nienstedt und Westermann meinen, dass es dazu den Dialog zwischen Eltern und Kind<br />
braucht, in dem sich die Eltern vom Kind führen lassen, von seinen Bedürfnissen und<br />
Wünschen. Das Kind soll die Erfahrung machen, dass es Einfluss auf die Eltern gewinnen<br />
kann. Auch wenn das Verhalten des Kindes zunächst wie eine Manipulation anmutet, muss<br />
das Kind seine Wirksamkeit erleben dürfen. Dieser Vorschlag wird verständlich, wenn man<br />
bedenkt, wie sehr ein Kind, das fremd untergebracht werden muss, dem mitunter<br />
unberechenbaren und inadäquaten Verhalten seiner Bezugspersonen ausgeliefert war.<br />
Gerade wenn das Kind die Eltern als überwältigend erlebt hat und damit Gefühle von<br />
Ohnmacht und Hilflosigkeit erleiden musste, führt dies nicht selten zu<br />
Bewältigungsversuchen in Größenphantasien und Pseudo-Unabhängigkeit. Westermann<br />
(2007) bezeichnet dies als die so genannte „Pippi-Langstrumpf-Phantasie“: das Kind<br />
entwickelt eine Pseudoautonomie, eine scheinbare Elternunabhängigkeit und vorpubertäre<br />
Ablösung von den Eltern.<br />
„Nur wenn das Kind die Erfahrung macht, dass seine Signale und Wünsche – und seien sie<br />
noch so unartikuliert und diffus – genau wahrgenommen und interpretiert werden, d.h. den<br />
anderen in seinem Erleben und Verhalten steuern und beeinflussen, wird es sich trotz vieler<br />
vorausgegangener Enttäuschungen auf neue Abhängigkeitsbeziehungen einlassen können.“<br />
(vgl. ebd. S 92)<br />
Gerade wenn das Kind aufgrund ängstigender Erfahrungen mit den leiblichen Eltern mit<br />
Wut, Aggression, Provokation, Rückzug oder Ablehnung reagiert, besteht die Gefahr, dass<br />
es zu einem Machtkampf zwischen Kind und Eltern kommt. Versuchen die Pflegeeltern<br />
40
durch immer massivere Maßnahmen, die Oberhand zu behalten, können die<br />
Ohnmachtgefühle beim Kind verstärkt oder neu belebt werden. Indem es sich nicht an die<br />
Forderungen der Pflegeeltern anpasst, sondern oppositionell reagiert, hat das Kind ebenfalls<br />
Einfluss auf die Eltern, aber nicht in befriedigender Weise. Die Verhaltensauffälligkeiten<br />
und der Machtkampf bleiben wie in einem Teufelskreis bestehen.<br />
Eine sehr strenge, konsequente, strafende und belohnende Erziehung ist bei Pflegekindern<br />
meist nicht so sinnvoll, weil es eine gewisse Frustrationstoleranz und die selber erfahrene<br />
Rücksicht auf eigene Bedürfnisse braucht, damit das Kind die mit einer Strafe oder<br />
Konsequenz verbundene Frustration überhaupt aushalten und annehmen kann. Es besteht die<br />
Gefahr, dass das Kind diese Frustration abspaltet, rationalisiert, bagatellisiert und<br />
dissoziatives Verhalten zeigt. „Erst die Erfahrung, dass ein anderer Mensch auf eigene<br />
Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nimmt, schafft die Voraussetzung dafür, die Wünsche<br />
und Bedürfnisse des anderen, die die eigenen einschränken, berücksichtigen zu können.“<br />
(Nienstedt/Westermann 2007, S 93)<br />
Irmela Wiemann beschreibt, dass Kritik und Strafe bei Pflegekindern wie ein<br />
Verbindungsabriss in der Beziehung wirken können. Das Kind fühlt sich dadurch in Gefahr,<br />
nicht sicher und geliebt. Es kommt schnell zur Dissoziation, zur Abspaltung des<br />
Unangenehmen. Die Kinder scheinen wie unberührt vom Konflikt, schalten auf „Durchzug“<br />
und wollen schnell wieder gut sein, während die Eltern noch verletzt sind. Wiemann<br />
empfiehlt hier, anders zu reagieren als in der „normalen“ Erziehung und zu sagen: „Ich sehe,<br />
du willst wieder gut sein. Komm, wir essen ein Eis.“ (Wiemann 2011)<br />
Pflegeeltern dürfen nicht die Befriedigung eigener Bedürfnisse erwarten, sondern müssen<br />
davon ausgehen, „dass, was das Kind auch immer tut, denkt oder sonst wie zum Ausdruck<br />
bringt, nicht unbegründet ist und deshalb als notwendig akzeptiert werden muss – was nicht<br />
zwangsläufig bedeutet, dass man es auch gutheißt und billigt.“ (Nienstedt/Westermann 2007,<br />
S 100)<br />
Nienstedt und Westermann sehen es als Fortschritt und Zeichen von gewachsenem<br />
Vertrauen an, wenn ein Kind den Pflegeeltern schon mehr zumutet und nicht mehr so<br />
angepasst ist, wie vielleicht zu Beginn des Pflegeverhältnisses. Diese<br />
Übertragungsbeziehung ist sehr wichtig, damit ein Kind alte Gefühle (Wut, Angst,<br />
Ohnmacht, Zorn, Enttäuschung) wiederbeleben kann und im günstigsten Fall einen anderen<br />
Ausgang erlebt: nicht überwältigt zu werden, Rücksicht zu erfahren, geschützt zu sein.<br />
Damit wird eine heilsame, korrigierende Erfahrung erst möglich.<br />
41
„Und nur schrittweise, wenn das Kind immer wieder die verlässliche Erfahrung macht, dass<br />
die Ausgänge andere sind als früher – und hierbei ist das Handeln der Eltern überzeugender<br />
als ihr Reden -, kann die Übertragungsbeziehung gelöst werden und sich ein eine neue,<br />
persönliche Beziehung verwandeln.“ (Nienstedt/Westermann 2007, S 106)<br />
In der Übertragungsbeziehung ist es sehr wichtig, die Bedürfnisse, Affekte und<br />
beängstigenden Vorstellungen des Kindes anzunehmen. Das Kind ist sich der primären<br />
Emotion (Angst, Schmerz, Wut) oft nicht mehr bewusst. Sie wird nicht mehr gespürt,<br />
sondern durch Handeln beantwortet (flüchten, kämpfen, bagatellisieren, sich groß und stark<br />
phantasieren). Indem man dem Kind Gefühle und Bedürfnisse, die es vielleicht nur verzerrt<br />
zeigt, zurückspiegelt, ermöglicht man ihm den Zugang zu diesen verschütteten Emotionen.<br />
Dies kann geschehen im Verbalisieren von wahrgenommenen Reaktionen des Kindes: „Du<br />
hast jetzt wohl Angst,…“ oder „Du machst dir vielleicht Sorgen und vertraust uns noch<br />
nicht,…“ oder „Das macht dich jetzt gerade sehr wütend,…“. Die Annahme solcher Gefühle<br />
durch die Pflegeeltern fördert die Selbstannahme des Kindes.<br />
Eine negative, aggressive Übertragung anzunehmen, ist meist schwierig, „weil das kindliche<br />
aggressive Verhalten einerseits oft im Widerspruch zu den eigenen Beziehungswünschen<br />
und Erziehungsidealen steht und andererseits eigene abgewehrte, aggressive Affekte<br />
mobilisiert.“ (ebd. S 117)<br />
Wenn das Kind mit den neuen Eltern verlässliche andere Erfahrungen machen kann, wird es<br />
allmählich möglich, dass sich das Kind realistisch erinnern kann und eine kritische Distanz<br />
zur eigenen Geschichte gewinnt. Diese Erinnerungsarbeit (Irmela Wiemann nennt sie auch<br />
Biographiearbeit) kann den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen, Affekten und<br />
Vorstellungen und den realen früheren Erfahrungen wieder herstellen. Als Pflegeeltern kann<br />
man das Kind unterstützen, indem man behutsam andeutet: „das kennst du wohl“ oder „das<br />
hast du vielleicht erlebt“. Nienstedt/Westermann empfehlen, interessiert auf entsprechende<br />
Äußerungen des Kindes einzugehen, aber seine Abwehrmechanismen zu respektieren, es zu<br />
unterstützen, wenn es selber Widersprüche entdeckt, Fragen des Kindes realistisch, aber<br />
wertschätzend zu beantworten und auch die vielleicht folgende Enttäuschung und die Wut<br />
auf die leiblichen Eltern anzunehmen.<br />
Mein Pflegesohn Rene konnte während einer gerichtlich angeordneten Besuchspause<br />
endlich verbalisieren, dass er eigentlich gar nicht bei uns wohnen wollte, sondern lieber bei<br />
seiner leiblichen Mutter. Er konnte mitteilen, dass er sich Sorgen um sie macht und den<br />
42
Loyalitätskonflikt aufdecken, in dem er sich befand: „Ich könnte schon bei euch wohnen,<br />
aber ich weiß ja nicht, wie es meiner Mama dann geht.“<br />
Eine Einladung des zuständigen Sozialarbeiters ermöglichte es Rene zu fragen, warum er<br />
bei uns untergebracht ist und nicht bei seiner leiblichen Mutter. Der Sozialarbeiter erklärte<br />
ihm in wenigen, kindgerechten Worten, was seine Aufgabe ist, und dass er unsere Familie<br />
für Rene gefunden hätte, weil er wollte, dass Rene an einem guten Platz aufwachsen kann<br />
und weil seine leibliche Mutter es leider nicht geschafft hatte, gut für ihn zu sorgen. Seit<br />
diesem Gespräch gab es nun die reale Person des Sozialarbeiters, auf die sich auch Renes<br />
Wut richten konnte. Der Sozialarbeiter hatte Rene direkt aufgefordert, dass er auf ihn böse<br />
sein kann, wenn er das möchte. Als nun Rene an diesem Abend seine Wut ausdrückte, indem<br />
er versuchte, mich mit seinen Fäusten zu bearbeiteten, konnte ich auf das Gespräch<br />
verweisen. Rene meinte: „Ja, ich weiß schon, ihr wart es nicht!“ Wir überlegten uns, was<br />
geeignet wäre, um seine Wut daran auszulassen. Er suchte sich mit meiner Hilfe einen<br />
großen Polster. Diesen bearbeitete er dann, indem er auf ihn einboxte, ihn biss und zwickte,<br />
mit den Füßen auf ihm herumtrampelte und ihn schließlich übers Treppengeländer schmiss.<br />
Danach war es ihm möglich, ruhig einzuschlafen. Renes Alpträume haben sich nach dem<br />
Gespräch mit dem Sozialarbeiter spürbar verringert.<br />
In den folgenden Monaten war es auch aufgrund der fehlenden Kontakte zur leiblichen<br />
Mutter immer wieder möglich, seine bisherige Lebensgeschichte zu thematisieren, die Wut<br />
auf die leibliche Mutter, weil sie sich während des Besuchsstopps überhaupt nicht bei ihm<br />
meldete, die Trauer darüber, dass sie sich nicht als verlässliche Bindungsfigur erwiesen<br />
hatte. Natürlich zeigte Rene seinen Schmerz und Ärger hauptsächlich in sehr<br />
widerborstigem, aggressivem, oppositionellem Verhalten. Die dahinter stehenden Gefühle<br />
zur Sprache zu bringen, gelang nur über gezieltes Nachfragen, in besonders innigen und<br />
haltgebenden Situationen (Kuscheln im Hängesitz), über Bilderbücher zum Thema, durch<br />
Anlässe im Alltag (die Oma hatte eine Karte geschrieben, die Mutter wieder nichts hören<br />
lassen). Oft holte er sich die Fotoalben aus seiner Schublade im Wohnzimmer, die seine<br />
Geschichte für ihn über Bilder nachvollziehbar machen (Fotos von den ersten Monaten bei<br />
der Mutter, Fotos aus der Zeit im Kinderheim, Fotos von den Besuchen der Mutter und<br />
Urgrossmutter, Fotos aus der Zeit kurz vor dem Umzug zu uns, Fotos aus der Zeit bei uns).<br />
Da er mittlerweile genau weiß, welche Fotos in welchem Album sind, kann er sich bewusst<br />
dafür entscheiden, welche Lebensphase er ansehen möchte. Es ist sehr interessant, dass es<br />
früher immer Bilder aus der Zeit vor dem Umzug in unsere Familie waren, die er sich<br />
43
aussuchte. Seit er sich bewusster damit auseinandergesetzt hat, warum er bei uns ist, sucht<br />
er sich oft die Fotos aus, die seinen Einzug bei uns und die Zeit bis jetzt dokumentieren.<br />
Nienstedt/Westermann beschreiben, dass es wie in einem zweiten Anlauf für ein Pflegekind<br />
noch einmal möglich werden kann, Entwicklung und Beziehung neu anzufangen. Dazu<br />
halten sie es für nötig, dass das Kind regrediert und damit frühere Interaktionsformen<br />
wiederholt, die ihm die Befriedigung der frühen Bedürfnisse ermöglichen. „Seine frühen<br />
Beziehungswünsche werden endlich verwirklicht, so dass es im Spiegel der Mutter ein neues<br />
Bild von sich selbst gewinnt – als ein Kind, das in Ordnung ist, weil es mit seinen Signalen<br />
und Bedürfnissen und Gefühlen verstanden wird.“ (ebd. S 128)<br />
Von dieser sicheren Basis aus kann das Kind später wieder anfangen, sich abzugrenzen,<br />
selbstständig und unabhängig zu werden.<br />
Mein Pflegesohn Rene erschien uns etwa eineinhalb Jahre nach seiner Aufnahme in unserer<br />
Familie plötzlich jünger zu sein als am Tag seines Einzuges. Seine Sprache wurde<br />
babyhafter, sein Gesichtsausdruck schien mehr Kindchenschema zu beinhalten als zuvor, er<br />
wollte sich überhaupt nicht mehr selbstständig anziehen, sondern lieber von mir bemuttern<br />
lassen, bei jeder Trennung von mir gab es lautstarken Protest. Es ist gar nicht so leicht,<br />
diese auf den ersten Blick wie Rückschritte erscheinenden Verhaltensänderungen als das zu<br />
sehen, was sie eigentlich sind: Zeichen eines gewachsenen Vertrauens und verstärkter<br />
Bindung.<br />
In dieser Situation ist es wichtig, als Eltern anzunehmen, dass das Kind gerade zwei<br />
Entwicklungsalter hat: ein reales und ein kindliches, das die regressiven Wünsche betrifft.<br />
Nienstedt/Westermann sehen den Integrationsprozess des Kindes in der Familie<br />
abgeschlossen, wenn das Kind sich in die eigene Geschlechtsrolle einzufinden beginnt, wenn<br />
es zu einer geschlechtsspezifischen Identifikation mit den Eltern kommt (durch die<br />
Bewältigung der ödipalen Phase) und das Kind differenzierte, sichere Beziehungen zu<br />
beiden Elternteilen unterhält.<br />
Hier steht unserer Familie noch ein Stück Weiterentwicklung bevor. Rene ist noch sehr<br />
damit beschäftigt, die Beziehung zu mir als Mutter zu prüfen, was sich gerade in<br />
Trennungssituationen zeigt, wenn er sehr darum kämpft, nicht von mir verlassen zu werden.<br />
Meinen Mann nimmt er scheinbar noch nicht als gleichwertige Bezugsperson wahr, obwohl<br />
44
er real genau so viel Versorgungsarbeit in der Familie leistet. Obwohl sein Verhalten weit<br />
davon entfernt ist, mädchenhaft zu sein, sagt Rene ganz klar, dass er lieber ein Mädchen<br />
wäre, weil er dann später eine Mutter werden könnte. Die Bewältigung der ödipalen Phase<br />
mit der Einwilligung in die eigene Geschlechtsrolle und der Identifikation mit dem<br />
gleichgeschlechtlichen Elternteil scheint hier noch bevorzustehen.<br />
Als Pflegeeltern übernimmt man die Aufgabe, zu einem Kind Bindung aufzubauen, dessen<br />
Vertrauen man sich zum Teil erst mühsam erarbeiten muss. In der Beratung und Supervision<br />
für Pflegeeltern sollten diese den Raum und die Unterstützung dafür erhalten, „ein<br />
psychodynamisches Verständnis dafür entwickeln zu können, welche Erfahrungen und<br />
Verletzungen – die es noch nicht mit Worten beschreiben kann – das Kind mit ihnen<br />
inszeniert.“ (Brisch/Hellbrügge 2009, S 238)<br />
Es sollte Pflegeeltern in der Begleitung ermöglicht werden, ihren eigenen Erwartungen<br />
bezüglich des aufgenommenen Kindes nachzuspüren, diese zu revidieren und die in der<br />
Gegenübertragung auftauchenden Gefühle verstehen und bewältigen zu können.<br />
Einig sind sich Experten auf dem Gebiet des Pflegekinderwesens (Nienstedt/Westermann,<br />
Wiemann, Weinberg, Bonus) auch darin, dass es besonders hilfreich ist, wenn Pflegeeltern<br />
sich darin üben, Selbstberuhigungstechniken zu erlernen und ihrem Pflegekind Vorbild zu<br />
sein im Umgang mit den eigenen Affekten. Pflegeeltern sollten dabei nicht die<br />
Psychotherapeuten ihres Kindes werden, sondern für die gute Basis, den guten sozialen und<br />
emotionalen Hintergrund sorgen. Das Kind kann über eine vertrauensvolle, achtsame<br />
Beziehung zur Bezugsperson lernen, wie man von einem Erregungszustand wieder in einen<br />
Entspannungszustand kommen kann. In seinen Kindernöten getröstet, gesehen und ermutigt<br />
zu werden, ist ein großes Glück. Um die eigenen Affekte gut regulieren zu können, muss ein<br />
Kind aber unzählige Male gut aufgefangen worden sein. Die Selbstberuhigung und<br />
Selbstfürsorge des Erwachsenen bildet hierfür die Grundlage.<br />
45
6.3.2 Existenzanalytische Aspekte in der psychotherapeutischen Arbeit<br />
mit Pflegekindern<br />
Pflegekinder, die große Probleme beim Aufbau neuer vertrauensvoller Beziehungen in der<br />
Pflegefamilie haben und in ihrem Verhalten Anzeichen einer Bindungsstörung zeigen,<br />
benötigen ein psychotherapeutisches Angebot, um die oftmals traumatischen Erlebnisse in<br />
der Herkunftsfamilie und die damit verbundenen Gefühle nicht abspalten zu müssen.<br />
Heilung kann nur gelingen über einen Prozess der Integration der eigenen<br />
Herkunftsgeschichte und über die Trauerarbeit hinsichtlich dessen, was nicht gelungen ist<br />
und erduldet werden musste.<br />
Der therapeutische Prozess umfasst dabei ähnlich dem Integrationsprozess in der<br />
Pflegefamilie zunächst die Herstellung von Sicherheit, auf der dadurch entstandenen Basis<br />
ein Erinnern und Trauern und schließlich die Wiederanknüpfung an Beziehungen und<br />
Entwicklung. (vgl. Nienstedt in Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 2008, S 57)<br />
Es geht darum, dass das Kind trotz aller erlebten Mängel und Verletzungen Ja zum Leben, Ja<br />
zu den vielleicht neuen Bezugspersonen in seiner Umgebung und Ja zu sich selber sagen<br />
kann.<br />
Nienstedt beschreibt dabei eine Haltung des Kinderpsychotherapeuten, die meiner Meinung<br />
nach der in der Existenzanalyse üblichen phänomenologischen Haltung gleichkommt. Sie<br />
sieht es als eine Arbeitsgrundlage sowohl für die Erziehung des Pflegekindes zuhause wie<br />
für die Psychotherapie, „sich vom Kind an die Hand nehmen zu lassen.“ Eine solche Haltung<br />
mildert die Angst des Kindes vor Abhängigkeit, lässt es Sicherheit gewinnen und die<br />
Hoffnung entwickeln, dass Beziehungen auch befriedigend sein können. Das Kind wird<br />
beginnen, sich zu binden, sich auf neue Beziehungen einzulassen und in der Folge auch auf<br />
sich selber, auf die Entwicklung seiner selbst bzw. seines Selbst.<br />
Dazu braucht es auf der Seite des Psychotherapeuten ein aufmerksames Interesse, eine<br />
Wahrnehmung dessen, was das Kind tut, ein Erraten, was in ihm vorgehen könnte und ein<br />
Bemühen, es einfühlend zu verstehen. (vgl. ebd. S 58)<br />
Im Folgenden möchte ich zunächst gerne ausführen, welche Voraussetzungen der<br />
Kinderpsychotherapeut auf jeder Ebene der vier Grundmotivationen schaffen muss, um dem<br />
Kind einen positiven Entwicklungsprozess in der Therapie zu ermöglichen. Gerade bei<br />
Pflegekindern muss man davon ausgehen, dass die Bedingungen und Voraussetzungen ihres<br />
46
isherigen Lebens schwierig und ungünstig waren. Umso wichtiger finde ich es, sich in der<br />
Therapie um möglichst gute Voraussetzungen zu bemühen.<br />
1. Grundmotivation: Den Grund des Seins empfinden: der Seinsgrund<br />
Die Voraussetzungen auf dieser Ebene umfassen Halt, Raum (Offenheit, Gelassenheit) und<br />
Schutz (Ruhe, Heim, Heimat). Hier geht es darum, dass das Kind haltgebende Strukturen im<br />
Therapiesetting vorfindet. Das Kind benötigt einen ansprechend gestalteten Therapieraum,<br />
der ihm genügend Platz zum Erkunden, Gestalten und Bewegen bietet. Es braucht<br />
Materialien mit Aufforderungscharakter, die seiner Phantasie und der Umsetzung innerer<br />
Bilder und Themen entgegenkommen und die ihm eine persönliche Wahl erlauben. Die<br />
Therapiestunde sollte einen Rahmen bieten, innerhalb dem die Begegnung mit dem<br />
Therapeuten möglich wird: sie kann mit einem Begrüßungsritual beginnen und mit einer<br />
Abrundung der Geschehnisse am Schluss enden. Gerade Rituale, die aus der Situation heraus<br />
entstanden sind und vom Kind in der Folge wieder eingefordert werden, fördern das Gefühl<br />
der Sicherheit und Beheimatung in der Therapie.<br />
Simon griff am Ende der Stunde zum Körbchen mit den Musikinstrumenten. Er begann, ein<br />
selber erfundenes Lied zu singen und zu begleiten, in dem er selber zusammenfasste, was in<br />
der Stunde geschehen war. Dieses Abschlusslied bildete von da an jeweils den Abschluss<br />
unserer Stunden und ermöglichte es ihm, sich gut aus der Beziehung mit mir zu<br />
verabschieden und in den Alltag zurückzukehren.<br />
Im Therapeuten sollte dem Kind ein Mensch begegnen, der es mit seiner Geschichte, seinen<br />
Konflikten und Schwierigkeiten, aber auch mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen annimmt,<br />
der unangenehme Gefühle ebenso mit ihm aushält wie er sich über Gelungenes mit ihm<br />
freut, der emotional mit ihm mitschwingt. Für Pflegekinder bedeutet dies, dass der Therapeut<br />
in der Stunde einen Ort schaffen muss, am dem sich das Kind sicher, gehalten und geschützt<br />
fühlt, so dass es ruhig da sein kann, und den zur Verfügung gestellten äußeren wie inneren<br />
Raum nutzen kann. Das Kind muss die Offenheit des Therapeuten, seine Gelassenheit<br />
gegenüber den vom Kind gezeigten Konflikten, Spannungsfeldern, unverarbeiteten<br />
Erlebnissen und entwickelten Bewältigungsversuchen erleben können. Das Kind muss<br />
spüren, dass es keine moralische Bewertung für die von ihm gestalteten Spielszenen gibt,<br />
dass der Therapeut sich auch von blutrünstigen und grausamen Spielinhalten nicht<br />
47
erschrecken lässt und um das Verstehen der dahinterliegenden Gefühle des Kindes bemüht<br />
ist.<br />
Zum Schutz gehört aber auch, dass es bestimmte festgelegte Regeln im Umgang miteinander<br />
und mit dem Spielmaterial gibt. Demnach sind zwar alle Wünsche, Affekte und Phantasien<br />
erlaubt, aber nicht alles ist realisierbar. Das Kind muss unbedingt davor geschützt werden,<br />
sich in eine Situation zu bringen, in der es sich oder sein Gegenüber verletzen oder in die<br />
Gefahr einer Retraumatisierung geraten könnte.<br />
Wenn das Kind also in der ersten Therapiestunde scheinbar ohne Angst und Hemmung den<br />
Erwachsenen voraus in den noch unbekannten Therapieraum geht, kann ich als<br />
Psychotherapeutin dem Kind auch sagen, dass es noch ganz fremd hier ist und ich möchte,<br />
dass es gut von mir begleitet den neuen Raum erfährt, weil ich möchte, dass es ihm gut geht<br />
und es sich sicher fühlen kann.<br />
Wenn das Kind Gefahr läuft, sich in der zwanghaften Wiederholung eines traumatischen<br />
Spielinhaltes zu verlieren, muss ich als Therapeutin versuchen, einen anderen Spielausgang<br />
herauszufordern, indem ich vorsichtig Impulse setze.<br />
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Kind auf dieser Ebene erfahren können soll: ich<br />
kann da sein mit allem, was mich ausmacht und bewegt.<br />
2. Grundmotivation: Den Wert des Lebens fühlen: der Grundwert<br />
Auf dieser Ebene wird es möglich, dass Kind und Psychotherapeut zueinander in Beziehung<br />
treten und sich immer wieder begegnen. Es geht hier besonders darum, über die Nähe und<br />
das gemeinsame emotionale Bewegtsein, über die Zeit in der Therapiestunde, die man<br />
gemeinsam verbringt und über die in der Beziehung zum Therapeuten erlebte Wärme und<br />
Geborgenheit zu erfahren, dass es gut ist, zu leben. Gerade Pflegekinder haben manchmal<br />
eben nicht erlebt, dass das Leben es gut mit ihnen meint. Sie übertragen diese Erfahrungen<br />
nicht selten auch auf die innere Meinung, dass es nicht gut ist, dass es sie überhaupt gibt.<br />
Was Bindungsstörungen angeht, ist dies sicher die wichtigste Ebene, auf der das Kind neue,<br />
positivere Erfahrungen machen sollte. Es geht hier darum zu erleben, dass Nähe nicht<br />
gefährlich ist, dass die Bezugsperson da ist und Wärme und Geborgenheit schenkt. In der<br />
Therapie wird es dem Kind möglich zu spüren, dass der Therapeut ihm nahe ist, ihm nahe<br />
steht, dass dem Therapeuten das Empfinden und Befinden des Kindes nahe geht.<br />
Für mich persönlich ist es wichtig, am Beginn einer jeden Stunde mit dem Kind eine kurze<br />
Zeit in der Kuschelecke des Therapieraumes zu verbringen, mich gemeinsam mit ihm<br />
48
hinzusetzen, an der vergangenen Stunde wieder anzuknüpfen, in Erfahrung zu bringen, wie<br />
das Kind heute kommt und was sich vielleicht in der Zwischenzeit ereignet hat. Hier geht es<br />
mir darum, immer wieder an der Beziehung anzuknüpfen, zu signalisieren: ich bin jetzt ganz<br />
für dich da und widme mich dem, womit du heute kommst. Dabei sucht sich das Kind aus,<br />
wie nahe es räumlich an mich heranrücken mag, ob es lieber in sicherer Entfernung, mir<br />
gegenüber oder neben mir sitzt, ob es mich anschauen oder mit mir in die gleiche Richtung<br />
blicken möchte.<br />
Über meine Zuwendung als Therapeutin kann es auch dem Kind schließlich möglich<br />
werden, sich dem zuzuwenden, was es selber erlebt hat.<br />
3. Grundmotivation: Das Eigene, Persönliche spüren: der Selbstwert<br />
Gerade traumatisierte Kinder, zu denen Pflegekinder häufig gehören, tragen oft die innere<br />
Überzeugung in sich, an den äußeren Umständen, dem schädigenden Verhalten der<br />
Erwachsenen Schuld zu sein. Ihr Bild von sich selber ist dann geprägt von der Identifikation<br />
mit dem Aggressor. Überforderte Eltern neigen dazu, ihren Kindern negative<br />
Zuschreibungen zu geben, die die Kinder unter Umständen verinnerlichen.<br />
In der Therapie ist es deshalb notwendig, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das<br />
Kind sein vielleicht bisheriges negatives Selbstbild korrigieren und ein realistisches und<br />
positives entwickeln kann. Dazu ist es notwendig, das Kind in all seinen Facetten und<br />
Bestrebungen zu beachten, sein Eigenes anzuerkennen und wertzuschätzen, was es tut und<br />
sagt. Damit ein Kind lernen kann, sich gut einzuschätzen, braucht es zunächst die<br />
Rückmeldung des Erwachsenen. Über das einfühlsame Urteil der Bezugsperson erschließt<br />
sich dem Kind, wie sein Handeln und seine Person erlebt werden. Das Kind braucht<br />
Antworten auf die Frage: Darf ich so sein, wie ich bin?<br />
Katrin benötigte einige Zeit, um sich in unseren gemeinsamen Stunden sicher zu fühlen.<br />
Diese Unsicherheit bewältigte sie, indem sie während der ersten Stunden fast pausenlos und<br />
in hohem Tempo sprach, jede Aktivität kommentierte und mich kaum zu Wort kommen ließ.<br />
Dabei nahm sie möglichst wenig Blickkontakt zu mir auf. Ich versuchte, ihrem Wortfluss und<br />
ihrer hektischen Aktivität mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit zu begegnen und mein<br />
Interesse an ihr zu signalisieren. Für mich war es sehr erstaunlich als sie etwa in der siebten<br />
Stunde eine komplexe Landschaft mit Tieren aufgebaut hatte, immer wieder zu mir sah und<br />
49
wie beiläufig fragte: Wie findest du das? Sie ließ mich spüren, wie wichtig es ihr war, eine<br />
Rückmeldung von mir zu bekommen.<br />
Viele Pflegekinder brauchen hier vielleicht eine lange Zeit, in der sie positive<br />
Rückmeldungen vom Therapeuten erhalten müssen, in der der Therapeut auch Stellung<br />
bezieht zu den Erlebnissen des Kindes und mitteilt, wie er das empfindet und was er davon<br />
hält, was dem Kind geschehen ist.<br />
Erst auf dieser Basis wird es dann möglich, dass das Kind selber Stellung bezieht und sich<br />
selber und sein Verhalten gut einschätzen kann. Hier ergeben sich in der Therapie viele<br />
Möglichkeiten, etwas vom Kind Gestaltetes, Gemaltes, Gespieltes, Gezeigtes anzuerkennen<br />
und respektvoll stehen zu lassen. In meinen Stunden hat sich ein Fotoapparat sehr bewährt,<br />
mit dem wir vom Kind gestaltete Szenen, Bauwerke, Sandbilder etc. festhalten und am<br />
Computer ausdrucken. Diese Bilder sind für die Kinder meist ganz wichtige Anker für den<br />
Alltag und Bestätigungen für die eigene Kreativität und Schaffenskraft. Das vom Kind<br />
Gestaltete bleibt auch im Raum stehen und muss am Ende nicht aufgeräumt werden, sodass<br />
es auch innerlich „stehen bleiben“ und mitgenommen werden darf.<br />
4. Grundmotivation: Den Sinn der Existenz erfahren: die Erfüllung<br />
Bei fremd untergebrachten Kindern erlebe ich häufig den Wunsch für die Zukunft, selber<br />
einmal eine Familie zu gründen und selber z.B. eine gute Mutter zu werden. In der Therapie<br />
bieten sich hierzu viele Möglichkeiten, diese Vorstellungen in der Als-Ob-Situation zu<br />
erproben und sich stellvertretend um das innere Kind zu kümmern. Eine aufarbeitende<br />
Psychotherapie kann den Grundstein dafür legen, dass die Weitergabe traumatischer<br />
Erfahrungen über Generationen unterbrochen wird und dem späteren Erwachsenen gerade<br />
im Umgang mit eigenen Kindern andere Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen als<br />
die, die man am eigenen Leib so schmerzlich erfahren hat.<br />
Die 14jährige Lisa kam zu mir in Therapie, nachdem sie vom langjährigen schweren<br />
sexuellen Missbrauch durch den Lebensgefährten der Mutter berichtet hatte. Sie entschied<br />
sich für eine Anzeige gegen den Täter, die letztendlich auch zu einer Verurteilung zu einer<br />
mehrjährigen Haftstrafe führte. Ich war sehr berührt und beeindruckt, als sie mir nach dem<br />
Urteil mitteilte, dass sie einen Teil des ihr zugesprochenen Schmerzensgeldes für eine<br />
50
Spende fürs Kinderschutzzentrum verwenden möchte. Sie hat auch schon überlegt, später<br />
einmal eine Stiftung für Missbrauchsopfer einzurichten.<br />
So bin ich davon überzeugt, dass es auch nach dem Erleben schwerwiegender Verletzungen<br />
möglich ist, mit den im Leben getroffenen Entscheidungen eine Antwort auf die Frage zu<br />
finden, wofür es gut ist, da zu sein.<br />
Kinder in der Psychotherapie kann man hier unterstützen, indem man ihre Pläne für den<br />
Alltag ernst nimmt, sie an Werte heranführt und sie darin bestärkt, das von ihnen als wertvoll<br />
Erkannte auch anzustreben.<br />
Das Menschenbild und die Motivationslehre der Existenzanalyse bilden einen passenden<br />
Hintergrund gerade für die kinderpsychotherapeutische Arbeit. Das Kind als eine einmalige,<br />
eigenständige, einzigartige Person eingebettet in ihre sozialen und emotionalen Bezüge zu<br />
sehen, ermöglicht es, sich phänomenologisch ganz auf die Welt des Kindes einzulassen.<br />
„Es gilt, Bedingungen zu schaffen, in denen das Kind Halt und Orientierung bekommt und<br />
in denen es Achtung für sich und seine emotionalen Bindungen erfahren kann, wo alle<br />
Themen, Gefühle und Ambivalenzen erlaubt sind. Das Kind soll die Möglichkeit bekommen,<br />
das Geschehene so zu verarbeiten, dass es dies bewusst ertragen und verstehen kann und es<br />
einen Umgang damit findet, zu dem es seine innere Zustimmung geben kann.“ (Strolz in<br />
Existenzanalyse 1/2003, S 39)<br />
Die phänomenologische Haltung in der Kinderpsychotherapie kommt einer „verstehenden<br />
Offenheit“ gleich, zunächst aber einem „wortlosen Verstehen“ (Görtz in Existenzanalyse<br />
1/2003, S 9). Dabei geht es darum, in der Begegnung mit dem Kind die eigenen<br />
Vorstellungen, Deutungen, Interpretationen, Bewertungen und Erklärungen wahrzunehmen,<br />
aber bewusst auf die Seite zu stellen und sich zunächst ganz auf die kindliche Spielwelt<br />
einzulassen. Anfangs kann es so sein, dass das Kind den Psychotherapeuten gar nicht in sein<br />
Spiel mit einbezieht. Die Rolle des Psychotherapeuten ist dann die eines Beobachters, der<br />
dem Kind möglicherweise die Vorgänge im Spiel beschreibend „spiegelt“. Wenn es schon<br />
möglich ist, dass das Kind dem Psychotherapeuten eine Rolle im Spiel zuweisen kann, ist es<br />
wichtig, sich an die Spielregeln des Kindes zu halten, das Kind als Regisseur anzuerkennen.<br />
Phänomenologie als Methode in der Existenzanalyse meint die Zuwendung zu den<br />
Phänomenen, zu allem, was sich von sich selber her zeigt. Ihr Ziel stellt das tiefere<br />
Verstehen des anderen und von sich selbst dar. Dazu braucht es zunächst eine Entscheidung<br />
51
für dieses phänomenologische Schauen, die Hinwendung zu den Phänomenen, eine große<br />
Offenheit und ein Verweilen in der Hingabe, den Mut sich auf das einzulassen, was im<br />
Schauen auf einen zukommt, das Vertrauen auf den Halt in sich selber und darin, den<br />
anderen halten zu können, Geduld - denn phänomenologisches Schauen erfordert Zeit - und<br />
Demut.<br />
Diese Offenheit bringt ein doppeltes Ernstnehmen mit sich: das Ernstnehmen von dem, was<br />
das Kind tut und sagt und ein Ernstnehmen von mir als Psychotherapeutin und dem, was es<br />
in mir auslöst. Ebenso ist eine doppelte Konkretheit damit verbunden: das Kind wird mir<br />
greifbar, spürbar, konkret und ich werde mir am Kind selbst konkret.<br />
Aus dieser Haltung heraus lassen sich Fragen in der Psychotherapie ableiten:<br />
1. Was zeigt sich?<br />
2. Wie ist es? (Was verstehe ich, was ist das Wichtige? Wie hängen die Dinge<br />
zusammen?<br />
3. Ist es so? (Ist es das wirklich wichtige? Ist das alles, was ich, du, wir beide<br />
verstanden haben?)<br />
Das bedeutet in der Psychotherapie ganz bei dem zu bleiben, was vom Kind kommt und was<br />
es tut; das wahrzunehmen, wie es bei mir ankommt, was es in mir auslöst und diese Erkannte<br />
immer wieder in Frage zu stellen (Ist es so? Habe ich es richtig verstanden?) und dabei das<br />
auszuklammern, was mich selber betrifft.<br />
(vgl. Längle in Existenzanalyse 2/2007, S 17 -29)<br />
In der Psychotherapie mit Pflegekindern, die Anzeichen einer Bindungsstörung zeigen, ist es<br />
notwendig, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen und ihm jedes Mal von neuem die<br />
Erfahrung zu ermöglichen, dass es in Sicherheit geschützt und gehalten ist. Dazu muss man<br />
bereit sein, sich vom Kind in einen Dialog verwickeln zu lassen, der vom Kind ausgeht und<br />
von ihm gesteuert wird, auch wenn das Kind zunächst vielleicht gar nichts tut. Das Kind soll<br />
angstreduzierende Erfahrungen machen dürfen und erleben, dass es nicht beherrscht, sondern<br />
respektiert wird.<br />
Wenn diese Sicherheit entstanden ist, kann das Kind in der Beziehung zum<br />
Psychotherapeuten das, was es erlebt hat, im Spiel reinszenieren. Ziel ist es dabei, dass das<br />
Kind seine damals empfundenen Reaktionen, die Gefühle aus der Vergangenheit als normal<br />
und richtig erkennt, dass es sich „als im Kern gesund und in Ordnung weil verstehbar,<br />
erleben kann.“ (Nienstedt in Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 2008, S 60)<br />
Im therapeutischen Spiel können die inneren Bilder der traumatischen Erfahrungen wieder<br />
mit Gefühlen verknüpft und als angemessen und verstehbar angenommen werden. Hier geht<br />
52
es auch darum, dass der Therapeut ein sicheres Gegenüber darstellt, das die Gefühle des<br />
Kindes aufnimmt und verbalisiert und dem Kind sagt und erklärt, wie es einem Kind geht,<br />
das so etwas erlebt hat. Wenn man die inneren Ängste eines Kindes ernst nehmen und es<br />
darin verstehen und anerkennen kann, erfährt es, dass es zu sich selber stehen darf.<br />
Als Grundlage dafür braucht es aber zuerst ein Aushalten der auftauchenden schmerzlichen<br />
und ängstigenden Gefühle.<br />
Das therapeutisch von mir begleitete Pflegekind Sandro wählte im Spiel monatelang sehr<br />
mächtige Rollen und wies mir stets die Rollen der hilflosen, wehrlosen Opfer zu. Dafür<br />
wählte er fast ausschließlich Tierfiguren. Schließlich kamen neue Spielszenen hinzu, in<br />
denen es darum ging, dass das Zuhause der Tiere zerstört wurde (durch Brand oder<br />
Naturgewalten) und sie einen neuen sicheren Ort finden mussten. Er selber wählte sich ein<br />
Bällehaus im Therapieraum als sicheren Ort, an dem er sich zurückziehen konnte. Hier hat<br />
er sicher seine Lebensgeschichte thematisiert, die es oft erforderte, ein Zuhause wieder<br />
verlassen zu müssen. Über den sicheren Ort im Therapieraum konnte er sich stabilisieren,<br />
Schutz und Sicherheit spüren und seine Grenzen spüren.<br />
Schließlich entdeckte er Puppen, die Kinder darstellten und eine Hexenpuppe. Unzählige<br />
Male spielte er die Hexe im Wald, vor der sich die Kinder verstecken mussten. Eines Tages,<br />
als ich wieder die Rolle der Kinder übernommen hatte und dabei beschreibend<br />
verbalisierte, wie sich die Kinder fühlen mussten, wechselte er spontan die Seiten. Ich hatte<br />
begonnen, die Kinderfiguren eine Wand aus großen Schaumstoffwürfeln bauen zu lassen, als<br />
er auch die Rolle eines Kindes übernehmen wollte und sich mit großem Eifer daran machte,<br />
einen Schutzwall für die Kinder zu bauen. Es gelang in diesem Spiel, dass die Kinder ähnlich<br />
wie im Märchen Hänsel und Gretel die Hexe überwältigen konnten und es diesmal sie war,<br />
die verbrennen musste. Auch die Kinder hatten im Kampf Verletzungen erlitten, um die er<br />
sich mit Hilfe eines Arztkoffers nun intensiv zu kümmern begann.<br />
In den folgenden Stunden drehte sich das Spiel fast ausschließlich darum, dass er zum<br />
Tierpfleger wurde und viele, viele verletzte Tiere behandelte, verband und pflegte. Hier<br />
gelang ihm eine Zuwendung zu sich selber und ich hatte das Gefühl, dass er sich<br />
stellvertretend um seine eigenen erlittenen seelischen Verletzungen kümmerte.<br />
Auch zu Hause begann er nun, sich liebevoll um seine Kuscheltiere zu kümmern und wurde<br />
für die Pflegeeltern emotional leichter erreichbar. Leider kam für die Pflegeeltern diese<br />
Entspannung in der häuslichen Situation zu spät. Sie hatten sich in der begleitenden<br />
Supervision bereits schweren Herzens dazu entschieden, dass sie Sandro nicht bei sich in<br />
53
der Familie behalten wollten. Es war ihnen klar geworden, dass ihre Erwartungen an ein<br />
Pflegekind ganz andere gewesen waren und sie sich letztendlich nicht in der Lage sahen,<br />
Sandro großzuziehen. Sandro hatte mit seinem provozierenden, herausfordernden, sehr<br />
kontrollierenden, pseudoautonomen und zum Teil auch sexualisierten Verhalten vor allem<br />
die Pflegemutter sehr geängstigt. Diese entwickelte große Ängste, dass Sandro jemandem<br />
aus der Familie tatsächlich einmal etwas antun könnte. Sandro hatte bereits so viele<br />
Beziehungsabbrüche erlebt, dass er vorsorglich die Beziehung zur Pflegemutter immer<br />
wieder von sich aus aufkündigte, etwa indem er ihr sagte, wie hässlich er ihr Gesicht finden<br />
würde.<br />
Als die Entscheidung der Pflegeeltern gefallen war, bekam die Spielfigur „Krampus“ in der<br />
Therapie eine große Bedeutung. Sandro identifizierte sich sehr mit ihr, zog sich mit ihr oft in<br />
das sichere Bällehaus zurück. Der Krampus stand in meinen Augen für den<br />
Persönlichkeitsanteil, der seine Pflegefamilie sehr geängstigt hatte. Er war aber auch der<br />
Teil, der alle seine erlittenen Ängste und Schmerzen beinhaltete.<br />
Mit seinem Umzug in ein Kinderheim endete leider auch meine Begleitung für ihn. Aus<br />
Rückmeldungen der Mitarbeiterinnen dort weiß ich aber, dass er sich die Fähigkeit,<br />
bedeutsame Inhalte im Rollenspiel auszudrücken, bewahrt hat. Als ich ihn Jahre später<br />
zufällig inmitten seiner Wohngruppenkolleginnen beobachten konnte, hatte ich den<br />
Eindruck, dass es für ihn wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen war, an einem Ort<br />
aufzuwachsen, der zwar Sicherheit und Stabilität bot, von ihm aber nicht so enge<br />
Beziehungen zu den BetreuerInnen erforderte wie das in einer Familie üblicherweise der<br />
Fall ist.<br />
Der von mir geschilderte Fall bietet leider kein „Happy End“, zeigt aber die schwierige<br />
Realität von Kindern, die schon während ihrer ersten Lebensjahre traumatisierenden<br />
Bedingungen ausgesetzt waren. Die negativen Übertragungen aus solchen Erfahrungen in<br />
der Beziehung zu einem Pflegekind anzunehmen, ist schon für den Psychotherapeuten<br />
während der begrenzten Zeit der Therapiestunde nicht immer leicht. Für Pflegeeltern, die<br />
sich im Grunde nur ein normal funktionierendes Familienleben wünschen oder für die das<br />
Pflegekind vielleicht einen bisher nicht erfüllten Kinderwunsch wahr werden lassen soll,<br />
können sie unter Umständen nicht zu bewältigen sein.<br />
Wenn die Pflegeeltern die stürmische Zeit des Beziehungsaufbaus aber durchhalten und dem<br />
Pflegekind in ausreichender Form neue, schützende, behütende, versorgende, liebevolle und<br />
wärmende Erfahrungen ermöglichen, sich von seinen Aufkündigungsversuchen und seinem<br />
54
vordergründigen Verhalten nicht einschüchtern und entmutigen lassen, und wenn es<br />
zusätzlich in der Psychotherapie für das Kind möglich wird, seine Erfahrungen spielerisch<br />
mit Hilfe des Psychotherapeuten für sich selber wieder erfahrbar und zugänglich, nun aber<br />
verstehbar und annehmbar zu machen, gibt es berechtigte Hoffnung darauf, dass eine<br />
eventuell vorliegende Bindungsstörung geheilt und die Basis für ein erfülltes Leben in<br />
befriedigenden Beziehungen gelegt werden kann.<br />
55
7 Schlussbemerkung<br />
Wie es die in der Motivationslehre der Existenzanalyse beschriebene zweite und dritte<br />
Grundmotivation darstellt, sind wir als Menschen immer schon auf andere Menschen<br />
bezogen, wir genügen uns nicht allein. Schon wenn wir gezeugt werden, befinden wir uns<br />
bereits im Mutterleib und sind mit einer Nabelschnur an den mütterlichen Körper<br />
„angebunden“. Als Neugeborene sind wir von der Beziehung zu unseren Pflegepersonen<br />
abhängig. Auch wenn mit der Entwicklung des Kindes seine Abhängigkeit von den<br />
Bezugspersonen stetig abnimmt und die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich wachsen, bleibt<br />
der Wunsch nach Bindung doch lebenslang bestehen.<br />
Während Bindung am Beginn unseres Lebens unser Überleben sichert und unseren Schutz<br />
und unsere Versorgung gewährleisten soll, so kann uns die Fähigkeit, uns an andere<br />
Personen zu binden, später davor bewahren, an den Herausforderungen des Lebens zu<br />
zerbrechen. Auch im weiteren Lebensverlauf stellen tragfähige, emotional stabile und<br />
wechselseitige Beziehungen sicher, dass wir uns den Unwägbarkeiten des Lebens stellen<br />
können und wenn nötig Schutz, Hilfe und Trost erfahren und damit auch schwierige<br />
Situationen meistern.<br />
Ein Kind, dessen psychisches und/oder auch physisches Überleben durch Schicksalsschläge<br />
in der Familie, massive Überforderung seiner Eltern, durch Vernachlässigung, Misshandlung<br />
oder Missbrauch gefährdet war, kann das Gefühl der Sicherheit, des Gehaltenseins, des<br />
Urvertrauens oft nicht entwickeln. Es wird sowohl psychisch als auch physisch mit eigenen<br />
Kräften um sein Überleben kämpfen müssen.<br />
Ein solches Kind wird allen Versuchen, ihm nachträglich sichere Bindungen zu ermöglichen,<br />
zunächst mit großem Misstrauen oder mit vorgetäuschter Zuversicht begegnen.<br />
Es erfordert von Seiten der Pflegeeltern viel Mut, einfühlendes Verstehen und ein großes<br />
Vertrauen in sich selber, in die bestehenden Familienbeziehungen und in die Heilungskräfte<br />
von Beziehungen im allgemeinen, um ein solches Wagnis einzugehen und einem einmal<br />
gebrannten Kind zu zeigen, dass Nähe und Beziehung auch wärmen und nicht nur<br />
verbrennen kann.<br />
In der sicheren Bindung zu einem Menschen muss ich mich ganz auf ihn einlassen, ihm<br />
vertrauen und mich anvertrauen. So wird auch verständlich, warum Pflegekinder vielleicht<br />
eher Formen von Bindung eingehen, in denen sie versuchen, sich nicht einzulassen, in<br />
vermeintlich schützender Entfernung zu bleiben, die Kontrolle zu behalten und sich so davor<br />
zu schützen versuchen, nicht wieder enttäuscht zu werden.<br />
56
Sich wieder jemandem anzuvertrauen, erfordert auf der Seite des Kindes unendlich viel Mut,<br />
ebenso wie es auf der Seite des Erwachsenen Mut erfordert, sich auf alles einzulassen, was<br />
dieses Kind an Verhalten, Ängsten, Vorerfahrungen, Schutzmechanismen, Wünschen und<br />
Bedürfnissen mitbringt.<br />
Dabei ist es mir aber auch wichtig zu betonen, dass das Bindungsverhalten eines Kindes<br />
jeweils seinen ganz eigenen Lösungsversuch darstellt, mit den Möglichkeiten und<br />
Bedingungen zurechtzukommen, die es vorfindet.<br />
So ist mir auch mein eigener Pflegesohn oft Vorbild darin, sich nicht so einfach unterkriegen<br />
zu lassen, für seine Bedürfnisse einzutreten, sich zu wehren und sich abzugrenzen. Er stellt<br />
mit seinem Verhalten mein sehr angepasstes soziales Ich in Frage und fordert in der<br />
Beziehung zu mir, dass ich mich sehr klar positioniere, eindeutig Stellung nehme und ein<br />
sicheres, standhaftes Gegenüber bin. Insofern sehe ich seine Aufnahme in unserer Familie<br />
auch als große Chance zur Weiterentwicklung für alle Familienmitglieder an.<br />
Pflegeeltern sind gefordert, ihre anfänglichen Erwartungen und Vorstellungen bezüglich<br />
eines harmonischen Familienlebens und des Verhaltens des Pflegekindes loszulassen und<br />
sich mit Mut, Geduld, Liebe und Demut auf das einzulassen, was das Kind mitbringt. Sie<br />
können aber auch darauf vertrauen, dass das Kind ihnen nicht jeden Fehler anrechnet. Wie<br />
ganz allgemein in der Erziehung geht es auch in der Erziehung eines Pflegekindes nicht<br />
darum, als Eltern perfekt zu sein, sondern um eine ausreichende Feinfühligkeit den<br />
kindlichen Bedürfnissen und Beweggründen im Verhalten gegenüber. Es soll für das Kind<br />
im Bemühen und im Ringen um einen gemeinsamen Weg ein Ernstnehmen seiner Person<br />
spürbar werden. Auch wenn am Ende eines Pflegeverhältnisses vielleicht nicht die Heilung<br />
aller Verletzungen beim Kind und die Erfüllung aller Erwartungen der Pflegeeltern stehen,<br />
so ist das Bemühen um eine stabile Bindung zum Kind in jedem Fall ein Versuch, ihm eine<br />
Bindungskorrektur zu ermöglichen.<br />
Hier kommt der Beratung und Begleitung von Pflegeeltern und der Psychotherapie für<br />
Pflegekinder eine stabilisierende und unterstützende Aufgabe zu. Wenn beide Maßnahmen<br />
mit einem motivierten familiären Umfeld und der Möglichkeit zur Selbstreflexion bei den<br />
Pflegeeltern zusammentreffen, sind „die kleinen alltäglichen Wunder“ (Hart in Brisch 2006,<br />
S 190) sicher möglich, als die man das Auftreten von Widerstandsfähigkeit bei Kindern auch<br />
bezeichnen kann.<br />
57
Literaturverzeichnis<br />
Bonus, Bettina (2006): Mit den Augen eines Kindes sehen lernen. Band 1: Zur Entstehung<br />
einer Frühtraumatisierung bei Pflege- und Adoptivkindern und den möglichen Folgen.<br />
Norderstedt, Books on Demand<br />
Bonus, Bettina (2010): Mit den Augen eines Kindes sehen lernen. Band 3: Liebe und<br />
nachtragende Konsequenz – eine spezielle Pädagogik für aggressive, regelverletzende,<br />
grenzüberschreitende Pflege- und Adoptivkinder. Norderstedt, Books on Demand<br />
Brisch, Karl Heinz & Hellbrügge, Theodor (Hrsg.) (2006): Kinder ohne Bindung.<br />
Deprivation, Adoption und Psychotherapie. Stuttgart, Klett-Cotta<br />
Brisch, Karl Heinz (2010): Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie.<br />
Stuttgart, Klett-Cotta<br />
Dornes, Martin (2000): Die emotionale Welt des Kindes. Frankfurt am Main, Fischer<br />
Taschenbuch Verlag<br />
Endres, Manfred & Hauser, Susanne (Hrsg.) (2002): Bindungstheorie in der<br />
Psychotherapie. München, Ernst Reinhardt<br />
Frankl, Viktor (1972): Der Wille zum Sinn. Bern, Hans Huber Verlag<br />
Görtz, Astrid (2003): Sandspieltherapie mit einem Scheidungskind. In: Zeitschrift<br />
Existenzanalyse 1/2003: Berichte zur existenzanalytischen Kinder- und<br />
Jugendlichentherapie. 20. Jg., S 4-11. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Halper, Michaela & Orville, Petra (2011): Vortrag: Trauma, Bindung und die Pädagogik.<br />
Traumapädagogik Kongress in Salzburg am 7.10.2011<br />
Längle, Alfried (1986): Existenzanalyse der therapeutischen Beziehung und Logotherapie in<br />
der Begegnung. Tagungsbericht der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse<br />
2/1986. 1. Jg., S 55-75. Sonderdruck<br />
58
Längle, Alfried (1989): Vertrauen – Mut oder Selbstaufgabe. Warum Begegnung schrecken<br />
kann. In: Rothbucher, H. & Wurst, F. (Hrsg.): Wir und das Fremde. Faszination und<br />
Bedrohung. S 79-95, Salzburg, Selbstverlag der <strong>International</strong>en Pädagogischen Werktagung<br />
Längle, Alfried (1999): Was bewegt den Menschen. Die existentielle Motivation der<br />
Person. In: Zeitschrift Existenzanalyse 3/1999. 16. Jg., S 18-29. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Längle, Alfried (2004): Beziehung(s)formen. Ein existenzanalytischer Kategorisierungs-<br />
versuch. In: Zeitschrift Existenzanalyse 1/2004: Die therapeutische Beziehung. 21. Jg., S 23-<br />
29. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Längle, Alfried (2005): Persönlichkeitsstörungen und Traumagenese. In: Zeitschrift<br />
Existenzanalyse 2/2005: Tagungsbericht: Die verletzte Person - Trauma und Persönlichkeit.<br />
22. Jg., S 4-18. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Längle, Alfried (2007): Das Bewegende spüren. Phänomenologie in der<br />
(existenzanalytischen) Praxis. In: Zeitschrift Existenzanalyse 2/2007: Das Wesentliche<br />
sehen. Phänomenologie in Psychotherapie und Beratung. 24. Jg., S 17-29. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Lleras, Fernando (2004): Die verletzte Würde. Zur Interpersonalität, Anderssein und<br />
Anerkennung in der Psychotherapie. In: Zeitschrift Existenzanalyse 1/2004: Die<br />
therapeutische Beziehung. 21. Jg., S 17-22. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Müller, Roland (2012): Kursunterlagen zu „Einführung in die Arbeit mit Ego-States in der<br />
psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen“.<br />
Nienstedt, Monika & Westermann, Arnim (2007): Pflegekinder. Stuttgart, Klett-Cotta<br />
Schleiffer, Roland (2007): Die Pflegefamilie: Eine sichere Basis? – Über<br />
Bindungsbeziehungen in Pflegefamilien. In: Stiftung zum Wohl des Pflegekindes (Hrsg.): 4.<br />
Jahrbuch des Pflegekinderwesens. S 15-42. Idstein, Schulz-Kirchner-Verlag<br />
59
Spangler, Gottfried & Zimmermann, Peter (Hrsg.) (2009): Die Bindungstheorie.<br />
Stuttgart, Klett-Cotta<br />
Stiftung zum Wohl des Pflegekindes (Hrsg.) (2008): 1.Jahrbuch des Pflegekinderwesens.<br />
Schwerpunktthema: Traumatisierte Kinder. Idstein, Schulz-Kirchner-Verlag<br />
Strolz, Annelies (2003): Therapeutische Arbeit mit sexuell missbrauchten Kindern und<br />
Jugendlichen. In: Zeitschrift Existenzanalyse 1/2003: Berichte zur existenzanalytischen<br />
Kinder- und Jugendlichentherapie. 20. Jg., S 38-40. <strong>GLE</strong> <strong>International</strong><br />
Vetter, Helmuth (1991): Die Bedeutung der Phänomenologie für die Psychotherapie.<br />
Vortrag am 21.6.1991<br />
Weinberg, Dorothea (2010): Psychotherapie mit komplex traumatisierten Kindern.<br />
Behandlung von Bindungs- und Gewalttraumata der frühen Kindheit. Stuttgart, Klett-Cotta<br />
Wiemann, Irmela (2009): Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause geben. Bonn, Balance<br />
Ratgeber<br />
Wiemann, Irmela (2010): Vortrag: Damit das Zusammenleben gelingt: Was brauchen<br />
Adoptiv- und Pflegekinder? www.irmelawiemann.de<br />
Wiemann, Irmela (2011): Vortrag: Pflege- und Adoptivfamilie. Ausnahmefamilie?<br />
www.irmelawiemann.de<br />
60