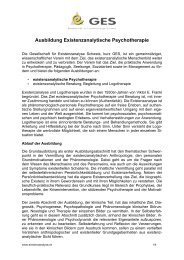PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
PDF-Vollversion - GLE-International
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
„Entstehung und Therapie<br />
von<br />
Suchterkrankungen<br />
aus existenzanalytischer<br />
Sicht“<br />
Abschlussarbeit für die fachspezifische Ausbildung in<br />
Existenzanalyse<br />
Jänner 2012<br />
Eingereicht von: Mag. Huberta Holzmann<br />
Eingereicht bei: Dr. Lilo Tutsch<br />
Dr. Sonja Laure
2<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
1. Zusammenfassung 4<br />
2. Einleitung - Persönlicher Zugang zum Thema 5<br />
3. Die Grundkonzeption der Existenzanalyse und 7<br />
Logotherapie<br />
a. Das Menschenbild in der Existenzanalyse 7<br />
b. Die Motivationslehre 8<br />
c. Die existenzielle Wende 9<br />
d. Der Begriff der Selbstdistanzierung 10<br />
4. Fallvorstellung „Anna“ 12<br />
5. Die Entwicklung von Suchterkrankungen: 16<br />
Eine Beschreibung verschiedener Faktoren<br />
und Zugänge<br />
5.1 Das Leiden am Gefühl der Sinnlosigkeit 16<br />
5.2 Das Bedürfnis nach Leidvermeidung 18<br />
5.3 Die Störung des Grundwertes 18<br />
5.4 Die Störung des Selbstwertes 19<br />
5.5 Das Unbeachtet werden der Person 20<br />
5.6 Neurowissenschaftliche Erklärungsansätze 21<br />
5.7 Der Zusammenhang zwischen Traumatisierung und 22<br />
Suchtentwicklung<br />
5.7.1 Der Zusammenhang zwischen Bindungs- 24<br />
Verhalten und Suchtentstehung<br />
5.8 Soziokulturelle Faktoren 25<br />
6. Das Verhältnis von Sucht und Person-Sein 28<br />
6.1 Der Verlust der Freiheit 28<br />
6.2 Die Entwicklung eines apersonalen Verhaltens 29<br />
6.3 Das Bedürfnis, sich zu zeigen 29
3<br />
Seite<br />
6.4 Die innere Armut und Bedürftigkeit 30<br />
6.5 Das unerträgliche Leid des traumatisierten 31<br />
Menschen<br />
7. Das Leid der Angehörigen 33<br />
7.1 Die Co-Abhängigkeit 33<br />
8. Die Therapie von Suchterkrankungen 36<br />
8.1 Grundlegende Überlegungen 36<br />
8.1.1 Der phänomenologische Zugang 36<br />
8.1.2 Der Einsatz von Spiegelneuronen in der 37<br />
Psychotherapie<br />
8.1.3 Die persönliche Haltung von PsychotherapeutInnen 38<br />
8.2 Der Beginn der Psychotherapie 38<br />
8.3 Der Therapieverlauf 41<br />
8.4 Der Therapieabschluss 48<br />
8.5 Die Diagnose 48<br />
8.5.1 Die existenzanalytische Diagnose 48<br />
8.5.2 Psychodynamik 49<br />
8.5.3 Die Diagnose nach ICD 10 49<br />
8.6 Ausblick 49<br />
9. Literaturverzeichnis 51
4<br />
Zusammenfassung<br />
In der vorliegenden Arbeit geht es um Entstehungsfaktoren und – bedingungen von<br />
Suchterkrankungen aus der Sicht der Existenzanalyse, ergänzt durch die Schilderung der<br />
Psychotherapie einer süchtigen Klientin.<br />
Eingangs werden die theoretischen Grundlagen der Existenzanalyse und Logotherapie bzw.<br />
das zugrunde liegende Menschenbild und die Motivationslehre zusammengefasst. In weiterer<br />
Folge geht es um Entstehung von Sucht, um das Verhältnis von Sucht und Person und um die<br />
Situation der Angehörigen suchtkranker Menschen. Versucht wird, einen besonderen<br />
Blickwinkel auf den Zusammenhang zwischen Suchterkrankungen und Traumatisierungen zu<br />
legen.<br />
Den abschließenden Teil bildet die ausführliche Schilderung der psychotherapeutischen<br />
Arbeit mit einer suchtkranken Klientin.<br />
Schlüsselwörter: Suchtentstehung, Sucht und Person-Sein, Angehörige, Traumatisierung,<br />
Fallschilderung, Suchttherapie<br />
Summary<br />
The present work deals with factors of development and conditions of addiction illnesses from<br />
the perspective of existential analysis, supplemented by a description of the psychotherapy of<br />
an addicted client.<br />
At the beginning the theoretical bases of the existential analysis and logotherapy and the<br />
underlying image of man and the motivation apprenticeship are summarised. In other result it<br />
is about origin of addiction, around the relation of addiction and being person and about the<br />
situation of the family members of addicted people. It is tried to lay a special point of view on<br />
the connection between addiction illnesses and trauma.<br />
The detailed portrayal of the psychotherapeutic work with an addicted client forms the final<br />
part.<br />
Key words: Development of addiction, addiction and being person, family members, trauma,<br />
case description, addiction treatment
5<br />
1. Einleitung - Persönlicher Zugang zum Thema<br />
Auf der Suche nach einem Thema für die Abschlussarbeit meiner Ausbildung zur<br />
Psychotherapeutin hat mich in den letzten zwei Jahren immer wieder das Thema „Sucht“ in<br />
seinen verschiedenen Facetten bewegt und „angefragt“.<br />
Ich habe in dieser Zeit mit zwei Klientinnen, die aufgrund ihrer Suchterkrankungen zu mir<br />
gekommen sind, therapeutisch gearbeitet. Dabei haben mich die große innere Not und<br />
Bedürftigkeit dieser beiden Frauen sehr bewegt und berührt. Beide waren in ihrem Innersten<br />
sehr einsam und bedürftig, arm an Eigenem und arm an Beziehung zu sich selbst. An dieser<br />
inneren Armut und Einsamkeit haben beide sehr gelitten. Beide waren kaum in der Lage,<br />
diese innere Einsamkeit und diesen Mangel an Eigenem, auszuhalten. Und immer, wenn der<br />
Schmerz über diesen Mangel zu groß und nicht mehr auszuhalten war, erfolgte der Griff zu<br />
Drogen.<br />
Ich habe selber keine Erfahrung mit Drogen. Ich bin Nicht-Raucherin, Nicht-Trinkerin und<br />
Nicht-Drogenkonsumentin. Ich kenne aber aus eigenem Erleben das starke Bedürfnis nach<br />
Schokolade, insbesondere an Abenden von stressigen, frustreichen Tagen. Ein wenig kenne<br />
ich daher die Gier, die Unbeherrschtheit und auch die Schwierigkeit, meinen Willen zu<br />
beherrschen.<br />
Die Schilderungen meiner Klientinnen haben mir daher spannende, bewegende,<br />
erschreckende, manchmal auch faszinierende Einblicke in diese mir fremde Welt ermöglicht<br />
und bilden für mich eine wertvolle Ergänzung meines theoretischen Wissens und<br />
therapeutischen Ausbildung.<br />
Den ersten, einleitenden Teil der Arbeit bildet ein kurzer Ein- und Überblick über<br />
Logotherapie und Existenzanalyse: Die Haltung und Philosophie dahinter sind die Grundlage<br />
meiner Überlegungen.<br />
Im zweiten Teil möchte ich zeigen, was aus existenzanalytischer Sicht Sucht bedeutet und<br />
wie Sucht entsteht<br />
Der dritte Teil schließlich soll beschreiben, wie mein therapeutischer Zugang in meiner Arbeit<br />
mit meinen Klientinnen war, welche Methoden der Existenzanalyse und Logotherapie ich<br />
eingesetzt habe, um die – von meinen Klientinnen formulierten - Therapieziele zu erreichen:<br />
die Sucht zurücklassen zu können und ein „besseres“, d. h. angstfreies und beziehungsvolles<br />
(zu sich selbst und zu anderen) Leben zu führen.<br />
Ich möchte dabei meine eigenen Überlegungen zur Diskussion stellen, verbunden mit<br />
Erkenntnissen aus der entsprechenden Literatur, und ergänzt durch eine ausführliche<br />
Schilderung meiner therapeutischen Arbeit mit Anna (so nenne ich eine meiner<br />
drogenabhängigen Klientinnen).<br />
Der Zugang zu diesem Thema über die Existenzanalyse als phänomenologische Therapie, in<br />
der die Person im Vordergrund steht und ihr Ringen um eine sinnvolle Existenz, impliziert<br />
auch eine Haltung der Wertschätzung den betroffenen Menschen gegenüber. Es geht nicht<br />
um Bewertung oder gar Verurteilung ihrer Schwächen, sondern um ein Anerkennen ihres So-<br />
Seins:<br />
„Es liegt an uns allen<br />
den Süchtigen mit Anstand und Liebe zu begegnen
selbst wenn sie schon verstrickt sind in die<br />
verlogenen Gemeinheiten ihrer Droge.<br />
Es liegt an uns allen<br />
ihnen beizustehen wenn sie schwanken.<br />
Es liegt an uns allen<br />
nicht immer die Besseren<br />
Klügeren Vernünftigen zu sein<br />
nicht alles kleiner zu machen<br />
um uns aufzuwerten<br />
sondern alles größer zu machen<br />
um uns dran zu gestalten.“<br />
(Konstantin Wecker, 1983, S 68f))<br />
6
7<br />
1. Die Grundkonzeption der Existenzanalyse und Logotherapie<br />
Die Logotherapie und Existenzanalyse wurden von Viktor Frankl begründet, der 1905 in<br />
Wien geboren wurde und als Neurologe und Psychiater tätig war.<br />
Für Frankl stand in der Logotherapie ein ganz wesentliches Thema des Menschen im<br />
Vordergrund: Das Leiden am sinnlosen Leben. Er vertrat die Ansicht, dass „… der Mensch<br />
damit nur seine Menschlichkeit manifestiert. Noch nie hat ein Tier danach gefragt, ob das<br />
Leben einen Sinn hat. Das tut eben nur der Mensch, und das ist nicht Ausdruck einer<br />
seelischen Krankheit, sondern der Ausdruck geistiger Mündigkeit, würde ich sagen.“ (Frankl<br />
1979, 1985, S 46)<br />
So war es eigentlich nur folgerichtig, darauf aufbauend die Logotherapie als sinnzentrierte<br />
Psychotherapie zu entwickeln, wonach es „drei Hauptstrassen gibt, auf denen sich Sinn finden<br />
lässt“ (vgl. Frankl 1979, 1985, S 47):<br />
- durch das Setzen von Taten bzw. Schaffen von Werken<br />
- durch das Erleben von etwas Wertvollem, insbesondere von zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen<br />
- durch die Konfrontation mit einem Schicksal, das sich einfach nicht ändern lässt – d.<br />
h. dort, wo wir als hilflose Opfer mitten in eine hoffnungslose Situation hineingestellt<br />
sind und wo wir gefordert sind, diese schwierige Situation sinnvoll zu gestalten.<br />
„Gerade dort, wo wir eine Situation nicht ändern können, gerade dort ist uns abverlangt, uns<br />
selbst zu ändern, nämlich zu reifen, zu wachsen, über uns selbst hinauszuwachsen!“ (Frankl,<br />
1979, 1985, S 48).<br />
Nach Viktor Frankl erfüllen wir Menschen den Sinn unseres Lebens „allemal dadurch, dass<br />
wir Werte verwirklichen“ (Frankl 1984, S 202)<br />
Werte erleben kann der Mensch aber nur dort, wo er in Beziehung – zu sich selbst und zu<br />
anderen - ist, wo ihn etwas berührt und wo ihm etwas nahe geht. In der Beziehungslosigkeit<br />
gibt es nichts Wertvolles. Wenn Dinge, Personen, Erlebnisse, etc. im Menschen nichts zum<br />
Schwingen bringen, werden sie für ihn nicht wertvoll. Das menschliche Leben wird erst<br />
wertvoll durch Beziehungen:<br />
- durch die Beziehung zu sich selbst<br />
- durch Beziehung zu anderen Menschen<br />
- durch Beziehung zu anderem (Dingen, Ideen, zur Natur, etc.)<br />
Was für einen Menschen wertvoll ist, ist seine höchstpersönliche Entscheidung. Immer bleibt<br />
die subjektive Frage: „Finde ICH das jetzt gut?“ Auch wenn es sich um höchst achtbare und<br />
traditionell abgesicherte Werte handelt, bleibt es doch der persönlichen Prüfung jedes<br />
einzelnen überlassen, ob dieser objektive Wert auch ein subjektiver Wert ist. Werte sind also<br />
relational.<br />
Die Logotherapie ist also eine sinnzentrierte Behandlungsform. Das dazugehörige<br />
Menschenbild, also die Anthropologie, und die Theorie zur Logotherapie wird in der<br />
Existenzanalyse dargestellt.
8<br />
„Die Logotherapie und die Existenzanalyse sind je eine Seite ein und derselben Theorie. Und<br />
zwar ist die Logotherapie eine psychotherapeutische Behandlungsmethode, während die<br />
Existenzanalyse eine anthropologische Forschungsrichtung darstellt“ (Frankl 1959, 663).<br />
Alfried Längle stellt dazu ergänzend fest, dass ja die Sinnthematik nicht die einzige<br />
Lebensbeschäftigung des Menschen ist, sodass Existenz eine breitere und größere Sicht des<br />
Menschen erfordert, in der der Aufbau der Person, die Motivation, die Emotion, die<br />
Beziehungstheorie, die Leiblichkeit, die Nosologie, usw. Platz haben müssen. (vgl. Längle<br />
1995, S 13)<br />
.<br />
Die Weiterführung der Existenzanalyse stellt daher weniger die Sinnfrage als vielmehr die<br />
Arbeit an der ganz persönlichen, nur von der jeweiligen Person individuell zu treffenden<br />
Zustimmung zum Leben in den Mittelpunkt, d. h. das „Ja“ zum Leben als Ausdruck eines<br />
beziehungsvollen und verbindlichen Existierens freizulegen. Um aber zu dieser Zustimmung<br />
zu gelangen, müssen vorher die Dinge, Ziele und Handlungen als Werte entdeckt und vor<br />
allem auf der Ebene des Erlebens erfahren werden (vgl. Längle 2003, S 39f).<br />
Ausgangspunkt für die psychotherapeutische Arbeit in der Existenzanalyse ist die jeweilige<br />
aktuelle Lebenssituation des Klienten, d.h. die Bearbeitung und Bewältigung der derzeit<br />
anstehenden Lebensaufgabe. Hier zeigt sich auch das Prinzip der dialogischen Beziehung zur<br />
Welt und zu sich selbst: Es geht darum, den Menschen in den Dialog mit sich selbst, mit<br />
seiner Innen-Welt („ich mit mir“) einerseits und in den Dialog mit anderen, mit der Außen-<br />
Welt („ich mit dir“) zu bringen:<br />
„Existenzanalytische Therapie ist daher in erster Linie auf den „dialogischen Austausch mit<br />
der Welt“ konzentriert, den sie mit dem Patienten versucht, in Gang zu bringen, zu erweitern<br />
oder zu erhalten. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei das Erkennen und Verstehen des Inhalts<br />
(Sinn) ein, um den es in diesem „Dialog mit der Welt“ gehen soll. Denn der dialogische<br />
Austausch steht und fällt mit seiner Sinnhaftigkeit.“ (Längle 1995, S14)<br />
3.1 Das Menschenbild in der Existenzanalyse<br />
Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, in dem drei voneinander verschiedene Seinsarten<br />
zusammentreffen: er ist leiblich, seelisch und geistig zugleich (vgl. Längle 1997, S 14).<br />
Als körperliches Wesen geht es dem Menschen um die Erhaltung und Gesundheit des<br />
Körpers, wobei er von den Bedürfnissen (essen, trinken, schlafen, Sexualität, etc.) gesteuert<br />
wird.<br />
Als seelisches Wesen strebt der Mensch nach Wohlbefinden in seinem Körper: Er sucht nach<br />
Spannungsfreiheit und angenehmen Gefühlen. Wenn dies gelingt, wird es als Lustgefühl<br />
erlebt, wenn er scheitert, verspürt er Frustration, Unlust und Spannung.<br />
Als geistiges Wesen geht es dem Menschen um Sinn und Werte in seinem Leben: hier sucht<br />
er die Auseinandersetzung mit Themen wie Glaube, Freiheit, Verantwortung, Liebe,<br />
Gerechtigkeit, usw.<br />
Dabei sind zwei Aspekte wesentlich:<br />
Zum einen sind die drei Dimensionen in ihrer Dynamik voneinander unabhängig. Etwas, was<br />
auf der leiblichen oder psychischen Ebene als lustvoll erlebt wird, ist nicht automatisch auf<br />
der geistigen Ebene gut und richtig. Und umgekehrt kann etwas richtig und sinnvoll sein, das<br />
auf einer anderen Ebene unangenehm ist.
9<br />
Zum anderen ist die personal-existentielle Dimension des Menschen in der Lage, sich mit den<br />
beiden anderen Dimensionen (körperliche und seelische) auseinanderzusetzen, d. h. der<br />
Mensch ist fähig zur Selbst-Distanzierung (vgl. Frankl 1990, S 234 ff).<br />
3. 2 Die Motivationslehre<br />
Der Mensch ist als Person von vier personal-existentiellen Grundmotivationen bewegt<br />
(Längle 1997, S 17), die die Grundfragen aufgreifen, vor die der Mensch in seiner Existenz<br />
gestellt ist und die als Grundbedingungen ganzheitlichen Existierens erfahrbar werden:<br />
1. Grundfrage der Existenz: Ich bin da – aber kann ich überhaupt da sein? In der ersten<br />
Grundmotivation geht es um das Ja des Menschen zum Da-Sein und zu den<br />
Bedingungen seines Lebens („Ja zur Welt“). Um überhaupt da sein zu können, braucht<br />
der Mensch ausreichend Raum, Schutz und Halt. Dann kann er sich der Welt<br />
zuwenden und im Wahrnehmen und Betrachten des Faktischen feststellen, was ist. In<br />
der ersten Grundmotivation geht es darum, das Faktische des Lebens aushalten und<br />
seine Bedingungen, auch Belastungen, annehmen zu können. Dafür braucht der<br />
Mensch ganz wesentlich die Erfahrung des Angenommenseins von anderen. Wenn der<br />
Mensch sich angenommen, gehalten und geschützt fühlt, führt dies zum Erleben des<br />
Seinsgrundes und damit zum Ur- und Grundvertrauen. Wo diese Erfahrungen fehlen<br />
(z. B. durch frühe Traumatisierungen) entstehen die Defizienzgefühle Unsicherheit,<br />
Angst und Verschlossenheit. Die pathologische Entwicklung führt zu Angststörungen,<br />
Phobien, Panik und Zwangsstörungen.<br />
2. Grundfrage des Lebens: Ich lebe – aber mag ich eigentlich leben? In der zweiten<br />
Grundmotivation geht es um das Ja des Menschen zu seinem Leben, zu seinen<br />
Emotionen und Beziehungen („Ja zum Leben“). Es geht darum, sich vom Leben<br />
berühren zu lassen und eine innere Beziehung zum Leben zu finden. Dadurch wird die<br />
Lebenskraft (Vitalität) des Menschen in Bewegung gebracht und das Leben in seiner<br />
Werthaftigkeit erst erlebbar. Voraussetzung dafür ist das Erleben und Spüren von<br />
Nähe und Zuwendung von anderen Menschen. Die Erfahrung, von anderen –<br />
insbesondere von den eigenen Eltern – gewollt zu sein, ist die wichtigste Quelle für<br />
die Ausbildung des Grundwerts. Dieser Grundwert besteht in dem tiefen Gefühl des<br />
Menschen, dass es gut ist, dass es ihn gibt. Nur auf der Basis dieses Grundwertes und<br />
unter der Voraussetzung, dass der Mensch sein Leben als gut und wertvoll erlebt, kann<br />
der Mensch sich öffnen und sich zuwenden: anderen Menschen, Tieren, Dingen,<br />
Ideen, etc., aber auch sich selbst. Diese Zuwendung zu anderen und zu sich selbst<br />
führt dazu, dass der Mensch mit anderen und sich Beziehung aufnehmen und gestalten<br />
kann.<br />
Wo diese positive Grundbeziehung zum Leben nicht gelingt, entstehen die<br />
Defizienzgefühle Sehnsucht, Gefühl der Lebenslast und innere Kälte. Die<br />
pathologische Entwicklung führt zu allen Formen der Depression.<br />
3. Grundfrage der Person: Ich bin ich – aber darf ich so sein? In der dritten<br />
Grundmotivation geht es um das Ja zur eigenen Person, d. h. zur eigenen und<br />
unverwechselbaren Art und Weise des Umgehens („Ja zur Person“). Es geht darum,<br />
sich selber zu schätzen und zu achten dafür, wie man ist und dafür, wie man sich<br />
verhält. Voraussetzung dafür ist die Erfahrung von Beachtung, Anerkennung und<br />
Ernstgenommen werden in der Individualität. Das Erleben von Wertschätzung,<br />
Respekt und Achtung für das So-Sein des Menschen ist die Grundlage für die
10<br />
Ausbildung des Selbstwertes. Der Selbstwert zeigt sich im Gefühl des Menschen, dass<br />
er gut und wertvoll ist, so wie er ist. Auf der Basis des Selbstwertes kann der Mensch<br />
auch aktiv Stellung nehmen, für sich und seine Anliegen eintreten und sich von<br />
anderen abgrenzen.<br />
Wo dies nicht gelingt entstehen die Defizienzgefühle Einsamkeit, Ruhelosigkeit,<br />
Verletztheit und Scham. Die pathologische Entwicklung führt zur Hysterie,<br />
extrovertierten Persönlichkeitsstörungen und paranoide psychogene Entwicklungen.<br />
4. Sinnfrage der Existenz: Ich bin hier – aber was soll ich in bzw. aus meinem Leben<br />
machen, dass es sinnvoll ist? In der vierten Grundmotivation geht es um das Ja zu den<br />
eigenen Handlungen, zur Zukunft, zu den Aufgaben, Anforderungen und Angeboten<br />
des Lebens („Ja zum Sinn“). Der Mensch erfährt Sinn durch Vorbilder, Erziehung und<br />
Anregungen aus Religion bzw. Philosophie. Das erleichtert es ihm, seinen<br />
persönlichen Sinn in jeder Lebenssituation zu finden und zu leben.<br />
Wo dies nicht gelingt, entstehen die Defizienzgefühle Frustration, Leere, Zweifel,<br />
Verzweiflung. Die pathologische Entwicklung führt zu Dependenzen, Süchten und<br />
Sinnkrisen.<br />
Der Mensch ist – nach Auffassung der Existenzanalyse – dann frei, wenn die vier<br />
Grundmotivationen erfüllt sind:<br />
- Wenn er die Situation annehmen kann<br />
- wenn er von etwas berührt ist, etwas mag<br />
- Wenn er zu sich und seinem Handeln stehen und es vertreten kann<br />
- Wenn er erkennt, was jetzt sinnvoll wäre.<br />
Wenn eine der ersten drei Grundmotivationen nicht erfüllt sind, kann der Mensch sein<br />
Handeln oder Erleben nicht als wirklich sinnvoll erleben: d. h. wenn er etwas tut, das er<br />
entweder nicht annehmen kann oder nicht mag oder vor seinem Gewissen nicht verantworten<br />
kann (Längle 1997, S 19)<br />
3. 3 Die existenzielle Wende<br />
Um den existentiellen Sinn zu finden, bedarf es einer speziellen Haltung sich selbst und der<br />
Welt gegenüber: zum einen ist eine gewisse Selbst-Distanzierung und zum anderen ein<br />
gewisses Maß an Weltoffenheit erforderlich (Längle 1997, S 21).<br />
Frankl formuliert dies so: „ Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat<br />
nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten –<br />
das Leben zu verantworten hat.“ (Frankl 1982, S 72)<br />
Das Leben stellt Fragen – und der Mensch antwortet, wobei seine Antworten nicht<br />
gleichgültig sind, sondern abhängig von dem, was der Mensch als wertvoll erlebt.<br />
Dialogfähigkeit im existenzanalytischen Sinn ist aber nicht auf verbale<br />
Ausdrucksmöglichkeiten reduziert, sondern meint das Frage-Antwort-Verhältnis, in dem sich<br />
der Mensch mit seiner Welt befindet:<br />
„Es ist ein ständiger Austauschprozess, in welchem die pathische Wirkung der Welt auf die<br />
Person und die gestaltende Wirkung der Person auf die Welt ineinander greifen.“ (Längle<br />
1995, S 14).
11<br />
Durch diese Zuwendung zur Welt und der offenen Begegnung mit ihren Möglichkeiten und<br />
Anforderungen entsteht sowohl der grunddialogische Charakter menschlicher Existenz als<br />
auch die Unterscheidung zwischen Wollen und Wünschen bzw. Handeln und Reagieren (vgl.<br />
Längle 1997, S 21). Beim Wollen geht es in der Existenzanalyse um ein Ja-Sagen zu Werten;<br />
Werterkenntnis wird vorausgesetzt. Der Wille ist Ausdruck von Freiheit und Entschlossenheit<br />
des Menschen und macht ihn bereit zum Handeln. Das Wollen kann aber nicht erzwungen<br />
oder von außen aufgezwungen werden: es ist eine höchstpersönliche, freie Entscheidung<br />
aufgrund einer Abwägung der Werte bzw. der Entschluss, sich auf einen Wert einzulassen.<br />
Wollen bedeutet ein Ja zum Wert.<br />
Im Gegensatz dazu ist das Wünschen die Manifestation von Erwartungshaltungen und eine<br />
grundsätzlich passive Haltung. Wenn allerdings Wünsche in einen Willensakt übergeführt<br />
werden, wird diese Haltung der Passivität aufgegeben und der Mensch wird im Handeln aktiv.<br />
3.4 Der Begriff der Selbstdistanzierung<br />
Im therapeutischen Prozess geht es immer wieder um Emotionalität bzw. um die Frage, wie<br />
eine angemessene Nähe zu den Gefühlen der KlientInnen erreicht werden kann. Angemessen<br />
bedeutet im Verständnis von Lilo Tutsch: „ So viel emotionale Berührung wie das Ich<br />
verkraften kann, ohne von bedrohlichen Gefühlen außer Gefecht gesetzt zu werden bzw.<br />
umgekehrt, so viel Emotionalität, dass das Ich überhaupt berührt wird und damit der<br />
Verarbeitungsprozess in Gang kommt.“ (Tutsch 2010, S 5)<br />
Über die Selbstdistanzierung kann die Dosierung der Emotionalität reguliert werden: Durch<br />
die Fähigkeit des Menschen, von sich Abstand zu nehmen und sich damit selbst ein<br />
Gegenüber zu schaffen, um mit sich in Beziehung und im Dialog sein zu können, kann die<br />
Person die Nähe zu auftauchenden Emotionen „managen“ (vgl. Tutsch 2010, S 6).<br />
In diesem Distanzeinnehmen und Annehmen der Situation vollzieht sich Person-Sein. Nur aus<br />
diesem Abstand heraus kann sich der Mensch frei verhalten und sich frei entscheiden, sonst<br />
bleibt sein Verhalten reaktiv.<br />
„Die Regulierung durch die Selbstdistanzierung ist vor allem dort ein Thema, wo<br />
Selbstanteile, die aus massiven Verletzungen und Traumatisierungen entstanden sind, das Ich<br />
in seinem Funktionieren einschränken bzw. wo es aufgrund früher Beeinträchtigung der<br />
Entwicklung eines Kindes überhaupt zu einer mangelhaften Ich-Entwicklung und damit zu<br />
einer strukturellen Ich-Schwäche kommt. Dadurch wird der Dialog mit sich selbst erschwert,<br />
oft auch verunmöglicht. Das Ich ist außer Funktion, die Psychodynamik gewinnt Oberhand,,<br />
der Mensch funktioniert auf der Reiz-Reaktions-Ebene.“ (Tutsch 2010, S 8)<br />
In der Selbst-Distanzierung wird das Gefühl oder das Bedürfnis des Menschen (z. B. nach<br />
Essen oder nach Drogen) nicht vernichtet, sondern einer genauen Betrachtung und<br />
Überprüfung unterzogen, sodass er einen adäquaten Umgang mit der Situation finden kann.<br />
Wenn die Selbst-Distanzierung nicht gelingt, wird der Mensch überwältigt von seinen<br />
Gefühlen bzw. Bedürfnissen und ist ihnen hilflos ausgeliefert. In dieser Dynamik liegt eine<br />
der Ursachen für das Entstehen von Sucht.<br />
Die Voraussetzung für diese Selbst-Distanzierung ist die Selbstannahme: es geht darum, zu<br />
sich selbst zu stehen, sich nicht zu übergehen, sich nicht zu verleugnen – und dennoch sich<br />
nicht bestimmen lassen, sich nicht ausliefern an Teile von sich (vgl. Längle 2005, S97).
12<br />
Die Selbstdistanzierung ist keine Haltung, die der Mensch andauernd einnimmt, sonst käme<br />
es zur Entfremdung. Sie ist vielmehr ein „situatives Erfordernis“, d. h. eine mögliche<br />
Umgangsform mit sich selbst, ein sich in die Hand nehmen mit dem Ziel, sich selbst bei sich<br />
einzufinden und wieder zu erkennen (vgl. Längle 2003, S98).<br />
Selbstdistanzierung ist ein reifer, personaler Vorgang. Im Fall meiner Klientin Anna wird sich<br />
im Verlauf des Therapieprozesses zeigen, wie die Entwicklung ihres Person-Sein mit ihrer<br />
Fähigkeit zur Selbstdistanzierung in Verbindung steht.
4. Fallvorstellung: „Anna“<br />
13<br />
Noch bevor ich mich im nächsten Abschnitt den theoretischen Ausführungen zum Thema<br />
Sucht zuwende, möchte ich an dieser Stelle meine Klientin Anna, vorstellen:<br />
Ich habe Anna im Herbst 2009 im Rahmen meines Praktikums kennen gelernt. Ich habe mein<br />
fachspezifisches Praktikum beim Psychosozialen Dienst (kurz: PSD) der Arbeitsvereinigung<br />
der Sozialhilfe Kärntens (kurz AVS) absolviert. Dort erhalten Menschen kostenlos<br />
Psychotherapie bzw. Beratung durch PsychologInnen und PsychotherapeutInnen<br />
unterschiedlicher Fachrichtungen. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz kann bis zu einigen<br />
Monaten dauern. Wenn allerdings jemand einen Therapieplatz bekommen hat, liegt es im<br />
Ermessen der jeweiligen Psychotherapeutin, wie lange die Therapie dauert. Es gibt seitens der<br />
Leiterin des PSD keine Vorgaben bzw. Einschränkungen. Die KlientInnen können sich ihre<br />
TherapeutInnen grundsätzlich nicht frei wählen, haben aber natürlich die Möglichkeit, sich<br />
wieder auf die Warteliste setzen zu lassen, wenn sie das Gefühl haben, mit der ihnen<br />
zugewiesenen Therapeutin nicht gut arbeiten zu können.<br />
Anna ist mir im September 2009 von der Leiterin des PSD zugewiesen worden. Sie war zu<br />
diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt, eine große schlanke Frau mit kurzen, dunklen Haaren.<br />
Auffallend an ihr waren ihre großen dunklen Augen. Sie war schlicht, aber sauber und<br />
ordentlich gekleidet und wirkte eine Spur „alternativ“. Weiters war bereits im ersten Eindruck<br />
eine spürbare Langsamkeit in ihren Bewegungen und Reaktionen merkbar.<br />
Im Erstkontakt berichtete Anna, sie sei von der Sozialarbeiterin am Landeskrankenhaus an<br />
den PSD verwiesen worden, mit der Empfehlung, eine Therapie zu machen. Anna hatte<br />
mehrere psychotische Episoden, von denen die letzte im Juni 2009 zu einem vierwöchigen<br />
stationären Aufenthalt im LKH geführt hatte.<br />
Die erste psychotische Episode passierte neun Jahre vor Therapiebeginn, im Jahr 2000. Anna<br />
hatte damals „alles an Drogen konsumiert, was es nur am Markt gab“ (wobei sie Heroin nach<br />
ihren Angaben nur geraucht, nicht gespritzt hatte). In der Rückschau bezeichnet sie einen<br />
LSD-Trip als Auslöser. Diese erste psychotische Episode erstreckte sich fast über 6 Monate,<br />
wobei Anna damals weder einen Arzt noch ein Krankenhaus aufsuchte.<br />
Im Jahr 2003 fand die nächste Episode statt, wieder ausgelöst durch Drogen. Diesmal<br />
erinnerte Anna sich an die Dauer von ca. drei bis vier Monaten, wieder ohne ärztliche Hilfe.<br />
Die nächste Episode (2007) wurde durch eine Stresssituation und Drogen ausgelöst. Damals<br />
suchte Anna erstmals einen Psychiater auf und erhielt Psychopharmaka verordnet, die sie ca.<br />
1,5 Jahre genommen hat. Nach dieser Zeit hatte sie die Medikamente ohne Rücksprache mit<br />
ihrem Arzt abgesetzt, was im Juni 2009 schließlich wieder in Verbindung mit einer<br />
Stresssituation und Drogen zur bislang letzten psychotischen Episode und dem<br />
Krankenhausaufenthalt geführt hat.<br />
Im Erstgespräch berichtete Anna weiters, dass sie seit ihrem 14. Lebensjahr Drogen<br />
konsumiert. Sie lebt derzeit allein mit ihrem Sohn, der zu Beginn der Therapie 5 Jahre alt war.<br />
Der Vater des Kindes hat sie, als das Kind 3 Jahre alt war, verlassen.<br />
Derzeit konsumiert Anna, nach ihren eigenen Angaben, „fast“ keine Drogen. Auf meine<br />
Frage, was sie damit genau meint, sagt sie, dass sie „hin und wieder“ einen Joint rauche.<br />
Auf meine Frage nach ihren Zielen für eine Therapie formulierte Anna in der ersten Stunde<br />
folgendes:
14<br />
- Sie möchte die Ursachen finden für die Themen, die in der Psychose auftauchen: zum<br />
einen Angst vor Männern, insbesondere Angst und Ekel vor Berührungen bzw.<br />
Sexualität durch Männer, und zum anderen sehr vage das Thema Religion<br />
- Sie möchte ihre Angst, die sie in größeren Gruppen immer wieder spürt, verstehen und<br />
überwinden lernen<br />
- Sie möchte ihre Konfliktscheu überwinden.<br />
Wir vereinbarten am Ende dieser ersten Stunde, in Zukunft einmal wöchentlich eine Stunde<br />
miteinander zu arbeiten.<br />
Meine Gefühle waren nach diesem Erstgespräch durchaus zwiespältig: Zum einen empfand<br />
ich für Anna spontan Sympathie, auch Mitgefühl für ihre schwierige Lebenssituation. Ich<br />
spürte auch eine gewisse Nähe, weil meine kleine Tochter genauso alt war wie Annas Sohn<br />
und bei mir natürlich Gedanken auftauchten, wie es wohl für Annas Sohn sein müsste. Ich<br />
spürte auch einen gewissen Respekt, wie Anna sich durch ihr Leben kämpfte und eigentlich<br />
darum kämpfte, dass ihr Leben (und das ihres Sohnes) besser werden sollte.<br />
Zum anderen tauchte bei mir eine Mischung aus Unsicherheit, Neugier und Angst auf, das<br />
Thema Drogen und Sucht betreffend. Anna war zu diesem Zeitpunkt meine erste Klientin, die<br />
das Thema Sucht so massiv einbrachte. Nach längerer Überlegung entschied ich mich dafür,<br />
trotz meiner Unerfahrenheit in Suchtfragen dieser Herausforderung zu stellen und in<br />
Begleitung einer Supervision mit Anna zu arbeiten.<br />
Gleich zu Beginn der nächsten Stunde kam das Thema Drogen zur Sprache: Anna berichtete,<br />
es sei für sie nach dem Erstgespräch „total ernüchternd und erschreckend“ gewesen, dass sie<br />
mehr als die Hälfte ihres Lebens Drogen konsumiert hatte und wie viel Negatives die Drogen<br />
ihr bereits gebracht hätten. Sie sei früher immer irgendwie „stolz“ auf ihren Drogenkonsum<br />
gewesen, er habe sie zu etwas besonderem gemacht und ihr Leben bereichert. Jetzt sehe sie<br />
auch die Nachteile.<br />
Anna sprach auch an, sie habe das Gefühl gehabt, ich hätte „eher negativ“ auf ihren<br />
langjährigen Drogenkonsum reagiert. Ob ich sie dafür verurteile oder negativ bewerte? Für<br />
mich war ganz wichtig klarzustellen, dass ich Anna als Person in keiner Weise bewerte oder<br />
beurteile. Ich würde auch ihren Drogenkonsum nicht verurteilen. Für mich gebe es dafür<br />
Gründe und Ursachen, die es in der Therapie gelte herauszufinden. Aber ich hätte eine klare<br />
Haltung zu Drogen: dass Drogen uns Menschen schaden und negative Auswirkungen haben.<br />
Anna konnte dies gut annehmen.<br />
In den nächsten Stunden erarbeiteten wir ihre Familiengeschichte:<br />
Anna ist in einer Kleinstadt in Kärnten aufgewachsen. Ihre Mutter war Hausfrau, der Vater<br />
LKW-Fahrer. Anna ist das dritte von vier Kindern: die älteste Schwester ist 5 Jahre älter, der<br />
ältere Bruder 2 Jahre. Der jüngere Bruder ist 10 Jahre jünger als Anna. Eine mit Anna<br />
gleichaltrige Cousine ist wegen der Berufstätigkeit deren Mutter mehr oder weniger im<br />
Haushalt mit aufgewachsen, Anna erlebte sie wie eine eigene Schwester. Die Familie<br />
bewohnte ein großes Zweifamilienhaus. Im Erdgeschoß lebte noch die väterliche Großmutter,<br />
die Anna als sehr streng, kühl, und auch sehr freudlos in Erinnerung hat.<br />
Der Vater habe ursprünglich einen eigenen Betrieb als Fellhändler gehabt, sei dann aber damit<br />
in Konkurs gegangen, und habe schließlich Arbeit als LKW-Fahrer gefunden. Zum Zeitpunkt<br />
des Konkurses habe er zu trinken begonnen. Anna erinnert sich, dass er „immer viel Alkohol“<br />
getrunken hat, oft auch betrunken war. Sie habe in der Rückschau den Eindruck, dass der<br />
Alkoholkonsum des Vaters in der Familie toleriert war.
15<br />
An Gespräche mit dem Vater hat Anna keine Erinnerung, auch nicht an Gespräche zwischen<br />
Vater und Mutter. Die Mutter schildert Anna als „richtige Hilfe-Mutter“, sie habe immer alles<br />
für die Kinder getan und gesorgt, habe aber auch den Eindruck gemacht, sich für die Familie<br />
„aufzuopfern“. Die Mutter sei sehr religiös und kümmere sich im Ort um mehrere<br />
hilfsbedürftige Menschen. An die frühe Kindheit, Volks- und Hauptschulzeit hat Anna<br />
„eigentlich gute Erinnerungen“. Sie berichtet von viel Freiheit, von vielen Möglichkeiten,<br />
ganze Nachmittage mit anderen Kindern in der Natur herumstreifen zu können. Sie habe auch<br />
immer gute Freundinnen gehabt und sei eine gute Schülerin gewesen.<br />
Sie habe die fehlenden Gespräche in der Familie nie hinterfragt, weil sie es ja nicht anders<br />
gekannt habe. Die Kommunikation mit der Mutter und den Geschwistern sei gut gewesen.<br />
Anna berichtete weiters, sie habe bis zu ihrem 10. Lebensjahr im Ehebett der Eltern zwischen<br />
Vater und Mutter geschlafen. Auf meine Nachfrage stellte sich heraus, dass Annas<br />
Geschwister jeweils ein eigenes Zimmer gehabt haben, es habe auch ein (kaum benütztes)<br />
Gästezimmer im Haus gegeben, es sei also keine Platzfrage gewesen. Als sie 10 war, ist ihr<br />
jüngster Bruder geboren worden. Für Anna sei daraufhin das Gästezimmer adaptiert worden,<br />
es sei aber nie wirklich „ihr“ Zimmer geworden. Sie habe sich immer eher in der Küche oder<br />
im Wohnzimmer oder vor allem im Freien aufgehalten.<br />
Mit 14 habe Anna sich für eine Ausbildung im Bereich Grafik und Design an einer HTL in<br />
Graz entschieden, wobei sie die ersten beiden Jahre im Internat gewohnt habe. Gleich zu<br />
Beginn des Schuljahres habe sie ihren ersten Freund kennen gelernt, mit dem sie 3 Jahre<br />
zusammen war. Er habe sie auch mit Marihuana vertraut gemacht, wobei nach Annas<br />
Schilderung Drogen damals an ihrer Schule sehr präsent waren und für Anna „extrem<br />
reizvoll“. Anna schildert sich in diesen Jahren zwischen 14 und 17 als sehr angepasst, mit<br />
wenig Gespür für ihren eigenen Wert und mit einer großen Faszination für andere Welten.<br />
Mit 17 lernte sie, nachdem ihr erster Freund sie verlassen hatte, ihren nächsten Freund<br />
kennen. In diesen Jahren konsumierte sie mit ihrem Freund bzw. mit dessen Clique alles an<br />
Drogen, was am Markt war. Sie berichtete, sie habe das damals toll und intensiv empfunden.<br />
Sie sei kaum in der Schule gewesen, habe aber trotzdem den Schulabschluss geschafft.<br />
Drogen seien damals „pure Faszination“ gewesen, an Schädigungen habe weder sie noch<br />
einer ihrer Freunde jemals gedacht.<br />
In Annas Erinnerung ist der Kontakt zu ihrer Familie mit dem Zeitpunkt des Schulbeginns in<br />
Graz praktisch abgebrochen. Das rege Interesse ihrer Mutter, an das Anna sich in der<br />
Pflichtschulzeit erinnert, war völlig verschwunden. Anna fühlte sich, als sei sie „in ein tiefes<br />
Loch gefallen“, sie habe „völlig den Halt verloren“. Ihr Freundeskreis habe ihr diesen Halt<br />
ersetzt.<br />
Einzig Annas ältere Schwester sei eines Tages, als Anna ca. 17 war, völlig überraschend nach<br />
Graz gekommen und habe Anna nach Hause geholt, weil die Schwester „irgendwie gespürt“<br />
habe, dass es Anna nicht gut gehe. Damals habe zumindest die Mutter von der Drogensucht<br />
ihrer Tochter erfahren. Anna kann sich nicht erinnern, mit dem Vater ein Gespräch darüber<br />
geführt zu haben. Sie kann auch nicht sagen, ob bzw. was die Mutter mit dem Vater oder den<br />
Brüdern besprochen hat. Nach diesem Gespräch und einigen Tagen Erholung sei Anna aber<br />
wieder nach Graz zurückgekehrt. Sie kann sich nicht erinnern, mit der Mutter über<br />
Therapiemöglichkeiten etc. gesprochen zu haben.<br />
Mit 20 lernte sie, nachdem ihr zweiter Freund sie verlassen hatte, ihren dritten Freund und<br />
Vater ihres Kindes kennen. Mit ihm ging sie nach Wien, arbeitete in verschiedenen Jobs und<br />
konsumierte weiterhin Drogen. In diese Zeit (im Jahr 2000) fällt ihre erste psychotische<br />
Episode, die sie als „ganz schrecklich“ in Erinnerung hat:
- ganz viele Ängste (vor Männern, vor Sexualität) und Unsicherheiten<br />
- das Gefühl, sich aufzulösen<br />
- das Gefühl, keine Grenzen mehr zu haben zwischen sich und den anderen,<br />
- Stimmen zu hören, die ihr sagen, was gut und falsch ist<br />
- das Gefühl, jeder kann ihre Gedanken lesen, etc.<br />
16<br />
Diese Episode erstreckt sich in ihrer Erinnerung über einen Zeitraum von ca. 6 Monaten. Auf<br />
den Gedanken, sich in ärztliche Betreuung zu begeben, kam weder Anna, noch ihr Freund,<br />
noch jemand aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis.<br />
In ihrer Erinnerung ist diese erste Episode ganz deutlich mit einem LSD-Trip als Auslöser<br />
verknüpft.<br />
Drei Jahre später (2003) erlebt sie die zweite psychotische Episode, wieder durch Drogen<br />
ausgelöst. Diesmal erinnert sie sich an eine Dauer von ca. 3-4 Monaten.<br />
Im Jahr 2004 wird sie schwanger. Nach ihren Aussagen ist sie in der Schwangerschaft und<br />
Stillzeit drogenfrei. Ihr Sohn wird 2004 geboren. Nach der Stillperiode beginnt sie wieder<br />
Drogen zu konsumieren.<br />
Im Jahr 2007, als sie 27 ist, verlässt sie ihr Freund wegen einer anderen Frau. Anna geht mit<br />
ihrem Sohn zurück nach Kärnten in die Nähe ihrer Familie. Eine Stresssituation und Drogen<br />
führen zur dritten psychotischen Episode im selben Jahr. Ihr Sohn ist damals drei Jahre alt.<br />
Diesmal begibt sie sich in Behandlung, und erhält Psychopharmaka, die ihr gut helfen und die<br />
sie anderthalb Jahre nimmt. Danach setzt sie die Medikamente ohne Rücksprache mit ihrem<br />
Arzt ab und erleidet 2009 die mittlerweile letzte psychotische Episode, wieder ausgelöst durch<br />
massiven Drogenkonsum. Sie geht diesmal, aufgrund der letzten positiven Erfahrung, sehr<br />
frühzeitig ins Krankenhaus, sodass sie sich relativ rasch erholt und mit Medikamenten und der<br />
Therapieempfehlung versorgt, bereits nach einigen Wochen entlassen wird.<br />
Die Medikation zu Therapiebeginn: Seroquel 400mg 1 -0 – 1<br />
Cipralex 10mg 1 – 0 – 0<br />
Bei der Erhebung der Gesundheitsanamnese konnte Anna über keine besonderen<br />
Erinnerungen bzw. Erzählungen ihrer Mutter berichten. Sie hatte allerdings die Phantasie,<br />
dass man sich mit ihr als Baby wenig beschäftigt hat. Sie habe auch immer gehört: “Du warst<br />
ja immer so brav.“<br />
Anna erinnert sich, selten krank gewesen zu sein bzw. immer noch über eine sehr stabile<br />
Gesundheit zu verfügen. Als sie 8 oder 9 war, sind ihr Polypen entfernt worden und sie habe<br />
einige Tage im Krankenhaus verbringen müssen.<br />
Sie habe vom Spielen im Freien oft Hämatome oder Zerrungen gehabt, aber nie etwas ernstes.<br />
Sie habe immer gern gegessen, sich auch immer zu dick gefühlt. Sie achte vor allem wegen<br />
ihrem Sohn auf regelmäßige und ausgewogene Ernährung. Nur für sich selber würde sie nicht<br />
so gut kochen.<br />
Schlafprobleme habe sie nie gehabt. In den letzten 2 Jahren habe sie ein erhöhtes<br />
Schlafbedürfnis, sie schlafe, wenn möglich, auch tagsüber.<br />
Konzentrations- und Merkfähigkeit sind gut. Sie fühle sich nicht depressiv, sei weder antrieb-<br />
noch freudlos.<br />
Zu Beginn der Therapie rauchte Anna nach ihren Angaben gelegentlich Marihuana und ca. 10<br />
Zigaretten täglich.<br />
Alkohol konsumiert Anna laut ihren Angaben eher selten, manchmal abends an den<br />
Wochenenden. Betrunken sei sie ganz selten.
17<br />
5. Die Entwicklung von Suchterkrankungen: Eine Beschreibung<br />
verschiedener Faktoren und Zugänge<br />
Wir verwenden im alltäglichen Sprachgebrauch den Begriff „Sucht“ sehr rasch, sehr<br />
undifferenziert und vielfältig: Drogen- und Eifersucht, Arbeits- und Spielsucht, Alkohol- und<br />
Verschwendungssucht, Internet- und Fresssucht, Habsucht und Streitsucht, etc. Im Konnex<br />
tauchen weitere Begriffe auf wie Leidenschaft und Gewohnheit. Im ICD-10, der<br />
<strong>International</strong>en Klassifikation psychischer Störungen, wird im Kapitel F1x.2 das<br />
Abhängigkeitssyndrom wie folgt klassifiziert:<br />
1. Ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren.<br />
2. Verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch, d. h. über Beginn, Beendigung<br />
oder Menge des Konsums, deutlich daran, dass oft mehr von der Substanz konsumiert<br />
wird oder über einen längeren Zeitraum als geplant oder an dem anhaltenden Wunsch<br />
oder an erfolglosen Versuchen, den Substanzkonsum zu verringern oder zu<br />
kontrollieren.<br />
3. Ein körperliches Entzugssyndrom, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird,<br />
mit denen für die Substanz typischen Entzugssymptomen oder auch nachweisbar<br />
durch den Gebrauch derselben oder einer sehr ähnlichen Substanz, um<br />
Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden.<br />
4. Toleranzentwicklung gegenüber den Wirkungen der Substanz.<br />
5. Einengung auf den Substanzgebrauch, deutlich an der Aufgabe oder Vernachlässigung<br />
anderer wichtiger Vergnügen oder Interessensbereiche wegen des Substanzgebrauchs.<br />
6. Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen, deutlich an dem<br />
fortgesetzten Gebrauch, obwohl der Betreffende sich über die Art und das Ausmaß des<br />
Schadens bewusst ist oder bewusst sein könnte (vgl.<br />
Dilling/Mombour/Schmidt/Schulte-Markwort 2004, S.77f).<br />
Macht es nun eigentlich Sinn, nach der Ursache für das Entstehen von Sucht, nach der<br />
Erklärung für die Entwicklung eines so komplexen Krankheitsbildes zu suchen? Reinhard<br />
Haller meint dazu: „Süchtig wird man, so viel steht fest, nie aus einem einzigen Grund,<br />
sondern vielmehr durch das Zusammenspiel verschiedener Ursachen, eines ganzen<br />
Ursachenbündels:“ (Haller, 2007, S 51)<br />
Ich möchte mich im folgenden Abschnitt diesem Ursachenbündel zuwenden und vor dem<br />
Hintergrund der Existenzanalyse und Logotherapie versuchen herauszuarbeiten, welche<br />
Faktoren zum Entstehen von Sucht beitragen können.<br />
5.1 Das Leiden am Gefühl der Sinnlosigkeit<br />
Ich gehe dafür zurück zum Begründer der Logotherapie, von dem die Hypothese stammt, dass<br />
der Mensch primär nach Sinn und nicht nach Lust strebt. Lust stellt sich ja erst nach der<br />
Verwirklichung von Werten und Sinnmöglichkeiten von selbst ein. Wenn der Mensch aber in<br />
seinem Leben keinen Sinn (mehr) erkennen kann, für den es sich zu leben lohnt, ist er<br />
„existenziell frustriert“ (Frankl 1975, S 67). Er leidet an einem Gefühl der Sinnlosigkeit, der<br />
Langeweile, einer großen inneren Leere – an dem, was Frankl als das „existenzielle<br />
Vakuum“ (Frankl 1975, S 67) bezeichnet.<br />
In diesem existenziellen Vakuum, wenn der Mensch keinen Sinn mehr in seinem Leben<br />
erkennt oder keine Möglichkeiten sieht, seine Werte und für ihn sinnvollen Ziele zu erreichen,<br />
erlebt er tatsächlich eine unerträgliche Situation. Auf diesem Boden kann Sucht entstehen,
18<br />
wenn der Mensch einen Weg sucht, das Unerträgliche seines Daseins, diese bodenlose Leere<br />
und die gewaltigen Unlustgefühle irgendwie erträglich zu machen.<br />
Aus der Sicht der Existenzanalyse liegt hier eine Störung auf der Ebene der 4.<br />
Grundmotivation vor. Dort, wo es um die Sinnfrage der Existenz geht und der Mensch sich<br />
die Frage stellt, was aus seinem Leben werden soll, in welche Richtung es gehen soll, dort<br />
leidet der süchtige Mensch unter der Sinnlosigkeit seines Daseins.<br />
Bei Anna war dieses Leiden an der Sinnlosigkeit ihres Lebens nach meiner Einschätzung<br />
nicht hauptursächlich an der Entstehung ihrer Sucht beteiligt. Allerdings war auch für Anna<br />
schon mit 14 die Frage aufgetaucht, wohin es denn in und mit ihrem Leben gehen solle.<br />
Durch den Versuch, durch den Konsum von Suchtmitteln das Gefühl der Leere, der<br />
Orientierungslosigkeit und die damit verbundenen Unlustgefühle auf der Ebene des Erlebens<br />
zu beseitigen werden allerdings die Ursachen nicht beseitigt, sondern nur die Symptome.<br />
Dadurch wird auch nachvollziehbar, dass ein Suchtkranker nicht gesund werden kann,<br />
solange er mit Hilfe des Suchtmittels nur die Symptome zudeckt und „betäubt“, anstatt sich<br />
den tiefer liegenden Ursachen zuzuwenden. Dazu braucht er aber Begleitung durch die<br />
Person eines Therapeuten, mit der er es wagen und aushalten kann, durch diese<br />
Unerträglichkeit durchzugehen und neue Perspektiven, neue Sinnmöglichkeiten und Werte zu<br />
entdecken.<br />
Häufig kommen suchtkranke Menschen aus „wertarmen“ Familien, in denen den<br />
Heranwachsenden kaum oder falsche, i. S. von ungesunden, schädigenden Werten vermittelt<br />
und vorgelebt worden sind.<br />
Meine Klientin Anna berichtete dazu, dass in ihrer Familie nach ihrem Erleben keine<br />
konkreten Werte vermittelt oder vorgelebt worden waren, außer der Wert der Leistung.<br />
Leistung, d. h. konkret schulische und berufliche Leistung war wichtig und wertvoll. Diese<br />
Leistung zu erbringen, war allerdings selbstverständlich und wurde erwartet. Anerkennung<br />
oder Lob gab es dafür nicht. Leistungen in anderen Bereichen (z. B. beim Sport, in der<br />
Malerei oder Literatur) waren hingegen überhaupt nicht wichtig und wurden auch nicht<br />
geschätzt und anerkannt.<br />
Anna konnte in ihrer Erinnerung nichts finden, dass – außer Leistung in Schule und Beruf -<br />
sonst noch den Eltern wertvoll gewesen wäre. Aber sie erinnerte sich an Erlebnisse, die sie<br />
heute als schädigend bezeichnet:<br />
„ Der Vater hat, so lange ich mich erinnern kann, immer Alkohol getrunken. Er ging direkt<br />
von der Arbeit ins Wirtshaus und trank dort seine täglichen Mengen Bier und wenn er<br />
heimkam, war er betrunken. Das war aber eigentlich kein Thema, es wurde auch nie darüber<br />
geredet. Die Mutter hat manchmal genörgelt und geschimpft, aber eigentlich wars egal.<br />
Niemand, auch niemand von den Verwandten, hat je darüber geredet, ob Trinken gut oder<br />
schlecht ist, warum er trinkt oder was er uns damit antut.<br />
Und eigentlich waren auch andere Dinge egal. Die Eltern haben nie darüber geredet, was<br />
jetzt gut oder richtig ist oder was falsch ist. Wir Kinder haben das Gefühl gehabt, es ist<br />
eigentlich alles egal, alles gleich.“<br />
Wenn aber alles gleich ist, wie kann ein Kind, ein junger Mensch dann unterscheiden lernen<br />
zwischen wichtig und unwichtig? Wertvoll für ihn oder bedeutungslos? Er oder sie bleibt in<br />
der Orientierungslosigkeit ganz allein.
5.2 Das Bedürfnis nach Leidvermeidung<br />
19<br />
Hinter der Sucht kann auch das Bedürfnis nach Leidvermeidung stehen.<br />
Süchtige sind in dieser Haltung gewissermaßen „Symptomträger“ (Längle 1997, S 23) unserer<br />
Gesellschaft. Leid wird als wertlos angesehen. Oft fehlen auch familiäre oder<br />
gesellschaftliche Vorbilder, an denen der suchtkranke Mensch miterleben könnte, wie das<br />
Aushalten, Annehmen und Bewältigen von Leid, Schmerz und Scheitern gelingen können und<br />
das Leben dadurch vielleicht nicht glücklicher, aber reicher, erfüllter und sinnvoller machen.<br />
Aus der Sicht der Existenzanalyse ist hier die Ebene der 1. Grundmotivation in Frage gestellt,<br />
wo es darum geht, ob der Mensch überhaupt da sein kann, ob er sein Dasein mit all dem damit<br />
verbundenem Schmerz und Leid überhaupt annehmen und aushalten kann.<br />
Dazu kommt auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die zum anderen das sichtbare Leiden<br />
(z. B. von alten, kranken, sterbenden Menschen) eher aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit<br />
hinausschiebt und ins Private oder Institutionalisierte (Heime, Krankenhäuser, Hospize, etc.)<br />
rückt. Zum anderen taucht eine gewisse Haltung der Bequemlichkeit auf, die vom modernen<br />
Menschen keinen Verzicht mehr fordert, sondern suggeriert, er könne alles haben und tun,<br />
was er möchte, ohne sich dafür anstrengen, bemühen oder auf etwas verzichten zu müssen.<br />
Insbesondere in der Pädagogik, respektive Schulpädagogik, sollte auf diese Entwicklung<br />
besonderes Augenmerk gelegt werden.<br />
5.3 Die Störung des Grundwertes<br />
Sucht ist aus der Sicht der Existenzanalyse immer auch mit einem unsicheren, teilweise<br />
sogar negativen Grundwert verbunden (Guth 1997, S 68). Der suchtkranke Mensch hat<br />
keinen (guten) Grund, zu seinem Leben „Ja“ zu sagen. Er findet nichts, was gut daran wäre,<br />
dass er lebt, weil er häufig nicht gewollt und angenommen ist.<br />
Hier liegt existenzanalytisch eine Störung auf der Ebene der 2. Grundmotivation vor. Die<br />
Grundfrage des Lebens: „Ist es gut, dass ich da bin?“ ist im Leben von süchtigen Menschen<br />
zu selten (manchmal überhaupt nicht) positiv beantwortet worden. Persönliche Zuwendung,<br />
Nähe und Liebe haben süchtige Menschen häufig in einem viel zu geringen Ausmaß, oft auch<br />
gar nicht, erlebt. Stattdessen müssen viele Menschen, manchmal von Beginn ihres Lebens an,<br />
Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch erdulden.<br />
Wenn wir mit Anna auf die Zeit der Entstehung ihrer Suchterkrankung (14. Lebensjahr)<br />
zurückgeschaut haben, waren dies für Anna sehr schmerzhafte Stunden, weil sie damals nicht<br />
„Ja“ sagen konnte zu ihrem Leben, sondern eigentlich ein deutliches „Nein“ in sehr<br />
destruktiver Weise zum Ausdruck brachte. Sie wunderte sich zwischendurch sogar ein wenig,<br />
dass sie diese Zeit überhaupt überlebt hat: „Wenn ich daran denke, was ich damals alles<br />
konsumiert habe, und in welchen Mengen! Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch lebe.“<br />
An diesen Begriff „Wunder“ konnten wir gut anknüpfen und das Bild entwickeln lassen, dass<br />
das Leben – ihr, Annas, Leben! – ja tatsächlich ein Wunder ist und wunderbar sein kann (vor<br />
allem in Bezug auf ihren Sohn).<br />
Im Zusammenhang mit einem negativen Grundwert erklärt sich auch die hohe Suizidrate bei<br />
suchtkranken Menschen: 8-75mal höher als bei der übrigen Bevölkerung (vgl. Guth 1997, S<br />
68). Zu berücksichtigen ist aber auch, dass jahre- und z. T. jahrzehntelanger<br />
Suchtmittelmissbrauch enorme schädigende Auswirkungen auf den gesamten Organismus
20<br />
haben und das Sterblichkeitsrisiko daher deutlich höher liegt als bei der gesunden<br />
Bevölkerung.<br />
In der Arbeit mit Anna wurde auch spürbar, dass in ihrem kindlichen Leben niemand „so<br />
richtig“ (Zitat Anna) Ja gesagt hatte zu ihr und ihrem Dasein. „Ich war halt auch da, das<br />
jüngste Kind (ihr jüngerer Bruder ist zehn Jahre nach Annas Geburt geboren worden, Anm.).<br />
Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sich meine Eltern darüber gefreut hätten oder dass sie<br />
froh waren, mich zu haben.“<br />
Aber genau das ist es, was ein Mensch braucht, um einen stabilen Grundwert ausbilden zu<br />
können: dass schon am Beginn seines Lebens jemand da ist, der JA zu ihm sagt und der ihm<br />
vermittelt, dass es gut ist, dass er da ist. Wenn es, so wie Anna es im obigen Zitat formuliert,<br />
eigentlich egal und bedeutungslos ist, ob ich da bin, bleibt dieser Grundwert unausgebildet<br />
bzw. nur sehr fragmentarisch und brüchig.<br />
So ist es auch erklärbar, warum suchtkranke Menschen oft gar nicht oder nur sehr spät und<br />
zögerlich Hilfe von außen (z. B. Therapie) in Anspruch nehmen: es fehlt ihnen das Wozu<br />
(vgl. Guth 1997, S 69).<br />
5.4 Die Störung des Selbstwertes<br />
Verbunden mit dem schon beschriebenen unsicheren und schwachen Grundwert leiden<br />
suchtkranke Menschen häufig auch an einem geringen Selbstwert. Sie zweifeln daran, ob sie<br />
so sein dürfen, wie sie eigentlich sind. Oft sind sie im Innersten sehr unsicher, ängstlich,<br />
traurig, einsam und wütend.<br />
Aus der Sicht der Existenzanalyse liegt hier die Beeinträchtigung auf der Ebene der 3.<br />
Grundmotivation. Die Grundfrage der Person: “Darf ich so sein, wie ich bin?“ ist im Leben<br />
von süchtigen Menschen meist viel zu selten – und manchmal gar nicht – positiv beantwortet<br />
worden. Wertschätzung und Anerkennung von anderen für ihr So-Sein als Person zu erhalten<br />
ist für suchtkranke Menschen sehr oft etwas völlig Fremdes.<br />
Für Anna war der Blick der anderen zumeist ein sehr strenger und prüfender Blick. Sie fühlte<br />
sich immer irgendwie in Frage gestellt und neigte dann dazu, sich - noch bevor ein Konflikt<br />
ausbrechen konnte – für ihre Art zu denken und zu handeln zu rechtfertigen. Sich so zu<br />
zeigen, wie sie eigentlich war, war für Anna immer mit großen Ängsten verbunden: „ Ich<br />
habe immer das Gefühl, die anderen können und wissen alles besser als ich. Ich denke immer,<br />
das, was mir wichtig ist, wird von den anderen kritisiert oder als falsch und blöd eingestuft. “<br />
So sei, wie man ist – und sich auch so zeigen dürfen vor anderen, wie man ist – dies ist für<br />
suchtkranke Menschen häufig nicht möglich. Die innere Einsamkeit herzeigen? Den Schmerz<br />
über so viel erlebte Missachtung zum Ausdruck bringen? Seine Wut und Trauer äußern? Auch<br />
für Anna war dies erst nach vielen Stunden der gemeinsamen Arbeit, in denen sie Vertrauen<br />
fasste und sich eine Beziehung zwischen uns entwickelte, ansatzweise möglich. Sie brauchte<br />
viel Unterstützung, Wertschätzung und Anerkennung für ihr So-Sein, damit es ihr möglich<br />
wurde, etwas von sich herzuzeigen.
5.5 Das Unbeachtet-Werden der Person<br />
21<br />
Wenn ein Mensch es wagt, etwas von sich, von seiner Person, herzuzeigen, ist es existenziell<br />
notwendig, dass er dafür Beachtung erfährt, dass er in seinem So-Sein gesehen und<br />
wahrgenommen wird. Diese Erfahrung, im Wesen gesehen und erkannt worden zu sein,<br />
fehlt bei vielen suchtkranken Menschen oft völlig (vgl. Rauch/Görtz 1997, S34). Gerade in<br />
den Jahren des Heranwachsens ist diese Erfahrung von besonderer Bedeutung.<br />
Auch Anna schildert diese Erfahrung. Anfangs erzählt sie darüber sehr sachlich und<br />
emotionslos, so als hätte das alles gar nichts mit ihr zu tun: „Es hat sich eigentlich niemand<br />
für mich interessiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir beim Essen über etwas<br />
gesprochen hätten, was mich beschäftigt oder was ich erlebt habe. Ich hätte z. B. gern<br />
Klavierspielen gelernt. Das wäre auch gar kein Problem gewesen, es gab eine Musikschule<br />
im Ort und finanziell wäre es auch leistbar gewesen. Aber ich bin gar nicht auf die Idee<br />
gekommen, meine Eltern zu fragen. Nicht, weil ich Angst vor einer Ablehnung hatte. Aber ich<br />
hatte das Gefühl, meine Interessen sind völlig unwichtig, bedeutungslos, belanglos. Ich war<br />
mir auch sicher, kein Mensch würde mir überhaupt zuhören oder sich Zeit für mich nehmen.“<br />
Für Anna war es erst jetzt, viele Jahre danach und in der Geborgenheit der Therapie, möglich,<br />
sich emotional dieser Erfahrung des Nichtgesehenwerdens, zu nähern. Heute kann sie den<br />
Schmerz und die Wut darüber (zumindest ansatzweise) spüren. Als Kind, als Jugendliche war<br />
es ihr nicht möglich gewesen. Sie blieb ein „braves Kind“, ein unauffälliges, „pflegeleichtes“<br />
Kind. Und sie blieb natürlich einsam. Wenn keine Person vorhanden ist, die sich als sehendes,<br />
wahrnehmendes Gegenüber verhält, bleibt der Mensch einsam. Nur in der Begegnung mit<br />
anderen kann sich die Person entwickeln.<br />
Aus der Sicht der Existenzanalyse liegt hier der Schwerpunkt auf der Ebene der 2.<br />
Grundmotivation. Hier geht es darum, Beziehung aufzunehmen zu sich selbst und zu<br />
anderen, Kontakt und Nähe zu sich selbst und anderen herzustellen, letztendlich sich selbst<br />
und die anderen zu lieben. Wo dies nicht gelingt, bleibt der Mensch sich fremd und bleibt<br />
auch dem anderen fremd.<br />
Ich möchte an dieser Stelle an das grausame und grauenhafte Experiment erinnern, das dem<br />
deutschen Kaiser Friedrich II im 13. Jahrhundert zugeschrieben wird: Auf der Suche nach der<br />
„Ursprache“ habe Friedrich mehrere Säuglinge von der Außenwelt isoliert und ihren Ammen<br />
befohlen, die Kinder zwar zu säugen und sauber zu halten, aber weder mit ihnen zu sprechen<br />
noch sie zu liebkosen, oder ihnen sonstige Zuwendung zuteil werden zu lassen. Auf diese<br />
Weise habe Friedrich herausfinden wollen, in welcher Sprache Kinder ihre ersten Worte von<br />
sich geben. Die Kinder hätten dann aber gar nicht gesprochen, sondern seien aufgrund der<br />
mangelnden menschlichen Zuwendung frühzeitig gestorben (Quelle: Wikipedia).<br />
Der Mensch ist als soziales Wesen auf Begegnung angelegt: erst in der Begegnung mit dem<br />
anderen kann sich die Person entwickeln. Wo dies nicht gelingt, bleibt die Person<br />
unterentwickelt, kümmerlich, hungrig und einsam. Auch in der Lebensgeschichte von Anna<br />
hat diese Begegnung mit einem Menschen, der ihr ein Gegenüber hätte sein können, nicht<br />
stattgefunden. Daraus entstand in Anna diese große innere Einsamkeit. Durch ihr<br />
gleichzeitiges Funktionieren in der Rolle des braven, unauffälligen Kindes wurde ihr Schmerz<br />
und Leid noch verstärkt – was sie aber nicht spüren konnte bzw. erst nach vielen<br />
Therapiestunden langsam lernte.
22<br />
Aus ihrer Erfahrung mit alkoholabhängigen Patienten schildern Rauch und Görtz ihr Erleben<br />
wie folgt: „Um diesen tiefen Schmerz zu lindern, wird irgendwann zum Alkohol gegriffen.<br />
Der Schmerz wird quasi narkotisiert.“ (Rauch/Görtz 1997, S.34).<br />
Es wird aber nicht nur der Schmerz darüber, nicht gesehen und als Person erkannt worden zu<br />
sein, verdrängt. Auch die Wut als Ausdruck dessen, was einem Menschen wichtig und<br />
wertvoll ist, fehlt meist. Wut ist aber ein heilendes Gefühl: „Darin zeigt sich die Person<br />
authentisch, in der Verletzung ihres Wertes und im Einsatz um diesen.“ (Rauch/Görtz 1997, S<br />
35). Insbesondere Kindern ist aber der Ausdruck von Wut häufig nicht möglich. Sie würden<br />
dadurch riskieren, in ihrer ohnehin unsicheren, gefährdeten Situation möglicherweise<br />
verlassen und bestraft zu werden.<br />
Johannes Rauch und Astrid Görtz konnten in ihrer Arbeit mit süchtigen PatientInnen drei<br />
Reaktionsweisen bzw. Stadien der Suchtentwicklung beobachten:<br />
1. Die Person flieht. Sie gibt auf, lässt sich den Raum nehmen und geht weg. Dahinter<br />
steht das Erleben, das das, was ihr als Person wichtig ist, keinen Platz hat. Daraus<br />
resultiert Aggression gegen sich selbst.<br />
2. Die Person lässt sich entwerten. Sie lässt zu, dass das, was ihr wichtig ist, verletzt ist.<br />
Sie schluckt den Ärger und leidet. Daraus ergibt sich Depression und Resignation.<br />
3. Die Person kämpft. Sie versucht, sich irgendwie wieder Raum zu verschaffen, zum<br />
Beispiel durch das trinken (vgl. Rauch/Görtz 1997, S 35f).<br />
Wut war ein Gefühl, das Anna sehr fremd war, wenn es um sie persönlich ging. Sie konnte<br />
sich nicht wirklich an Situationen erinnern, in denen sie wütend gewesen war. Auch in der<br />
Therapie brauchte sie viele Stunden, bis sie Wut spüren und auch ausdrücken konnte. Sie<br />
konnte aber sehr gut die Wut ihres kleinen Sohnes spüren, aushalten und mit ihm gemeinsam<br />
fassen. Wenn ihr Sohn wütend war, konnte Anna dies immer nachvollziehen und verstehen.<br />
5.6 Neurowissenschaftliche Erklärungsansätze<br />
An dieser Stelle möchte ich nur kurz einen Exkurs in den Bereich der Medizin, respektive<br />
Neurobiologie wagen, und mich der Auswirkung von Rauschmitteln auf das Gehirn<br />
zuwenden. Vor allem der Neurotransmitter Dopamin spielt eine entscheidende Rolle bei der<br />
Entstehung und Wahrnehmung angenehmer Gefühle, sodass das Dopaminsystem als<br />
entscheidender Pfad im Belohnungssystem des Gehirns gilt (vgl. Teeson/Degenhardt, Hall<br />
2008, S51f).<br />
Wenn Dopamin durch das Motivationssystem des Gehirns freigesetzt wird, löst dies sowohl<br />
im Gehirn als auch im ganzen Körper Gefühle von Wohlbehagen, Konzentration und<br />
Handlungsbereitschaft aus. Zusätzlich werden weitere körpereigene Botenstoffe, die<br />
endogenen Opioide, freigesetzt. Deren Wirkung entspricht derjenigen von Opium oder<br />
Heroin, sind allerdings in der Dosierung feiner abgestimmt, sodass sie lediglich einen sanften,<br />
wohltuenden Effekt nach sich ziehen: sie wirken positiv auf das Ich-Gefühl, auf die<br />
emotionale Gestimmtheit und die Lebensfreude. Zudem stärken sie das Immunsystem und<br />
vermindern die Schmerzempfindlichkeit – in Summe also höchst positive und wohltuende<br />
Effekte (vgl. Bauer 2008, S 30f).<br />
Aus der (neurobiologischen) Suchtforschung weiß man inzwischen, dass diejenigen<br />
Suchtstoffe süchtiges Verhalten erzeugen, die eine starke Sofortwirkung auf die Dopamin-<br />
Achse oder auf das endogene Opioidsystem des Körpers haben. Auf die Dopamin-Achse<br />
wirken Alkohol, Nikotin und Kokain. Heroin, Opium, wahrscheinlich auch Cannabinoide,
23<br />
zielen auf das System der körpereigenen Opioide und können diese ersetzen. Durch den<br />
Konsum dieser Drogen werden wohltuende, entspannende, Angst und Stress reduzierende<br />
Empfindungen ausgelöst (vgl. Bauer 2008, S 34).<br />
Durch den Konsum von Drogen wird quasi von außen, absichtsvoll in diese<br />
feindifferenzierenden Systeme eingegriffen und an den Gefühlen „herummanipuliert“ (Kuntz<br />
2011, S 210).<br />
Durch das Aufeinandertreffen spezifischer Wirkstoffe von Drogen auf die entsprechenden<br />
Rezeptoren im menschlichen Gehirn werden auf Dauer nachhaltig die die Aktivität und<br />
Funktion der körpereigenen Botenstoffe verändert. Kuntz: „Der so veränderte<br />
Informationsfluss im Gehirn als der Steuerzentrale des menschlichen Handelns prägt bei<br />
allen regelmäßigen Konsumenten psychoaktiver Rauschdrogen über kurz oder lang ein<br />
spezielles Suchtgedächtnis aus.“ (Kuntz 2011, S 106)<br />
Aus der Gehirnforschung weiß man mittlerweile, dass die Zeit der Pubertät und Adoleszenz<br />
eine besonders sensible Lebensphase ist. Die „Schaltzentrale“ im Kopf der Heranwachsenden<br />
erfährt eine komplette Umstrukturierung: unzählige Verbindungen zwischen Nervenzellen<br />
werden neu verknüpft, während andere sich auflösen, verschwinden und ihre bisherige<br />
Funktion verlieren. Gleichzeitig wird das Gehirn von körpereigenen, vermehrt oder neu<br />
produzierten chemischen Substanzen überschwemmt, die unterschiedlichste Funktionen,<br />
Chancen, aber auch Risiken eröffnen. Daher ist auch nachvollziehbar, dass die meisten<br />
Jugendlichen die Folgen ihres aktuellen Handelns nicht ausreichend abschätzen können (vgl.<br />
Kuntz 2011, S 200ff).<br />
In jedem Fall ist das Gehirn junger Menschen in der Zeit des Heranwachsens überaus<br />
empfindlich und anfällig für Fehlschaltungen oder Beschädigungen. Helmut Kuntz: „Von<br />
daher gesehen, ist es die für Jugendliche am wenigsten geeignete Zeit, mit Nikotin, Alkohol,<br />
Drogen oder einer täglichen Dosis von Gewalt in Berührung zu kommen. Das sinkende<br />
Einstiegsalter für den Suchtmittelgebrauch, immer neue Substanzen sowie sich verhärtende<br />
Gebrauchsmuster bei allen benutzen Mitteln führen zu beobachtbaren seelischen wie<br />
neurophysiologischen Problemen, wie wir sie früher nicht kannten.“ (Kuntz 2011, S 212).<br />
In dieser Hinsicht hatte die Drogengeschichte meiner Klientin Anna einen ungünstigen Start:<br />
Sie war mit 14 Jahren mitten in der Pubertät. Nicht nur ihre körperliche und seelische<br />
Entwicklung, auch ihre Gehirnentwicklung befand sich mitten im Umbrauch. Der in dieser<br />
Zeit phasenweise durchaus exzessive Gebrauch von Drogen hatte daher auch sicherlich<br />
ungünstige Auswirkungen auf ihre Gehirnentwicklung.<br />
5.7 Der Zusammenhang zwischen Traumatisierungen und Suchtentwicklung<br />
Ein weiterer, mir äußerst wesentlich erscheinender Faktor bei der Entstehung von<br />
Suchterkrankungen ist das Erleben der Patienten, dass sie als Person nicht geachtet, bedroht<br />
bzw. verletzt worden sind. Traumatische Erfahrungen, vor allem in der frühen Kindheit,<br />
sind besonders gravierende negative Entwicklungseinflüsse, können in Zusammenhang mit<br />
der Entwicklung späterer psychischer Störungen, u. a. affektive Erkrankungen,<br />
Angststörungen, Essstörungen, emotional-instabile Persönlichkeitsstörung,<br />
Suchterkrankungen, etc. gebracht werden.<br />
Duncan et al. fanden in einer Studie über eine repräsentative Stichprobe von 4000 Frauen aus<br />
der Allgemeinbevölkerung, dass körperliche Misshandlung im Kindesalter mit erhöhten Raten
24<br />
von späterem Substanzmittelmissbrauch einherging. In der Gruppe, die Misshandlungen<br />
ausgesetzt gewesen war, wiesen 18% einen erhöhten Medikamentenmissbrauch auf, in der<br />
Kontrollgruppe nur 5%. Auch Drogenkonsum und Indikatoren für den Missbrauch von<br />
Alkohol waren in der Gruppe der Betroffenen deutlich erhöht (vgl. Schäfer 2006, S.17).<br />
Belege für Zusammenhänge zwischen frühen Traumatisierungen und Suchterkrankungen<br />
erbrachten Zwillingsstudien, die in den letzten Jahren publiziert wurden. Kendler et. Al<br />
befragten über 700 weibliche erwachsene Zwillingspaare mit psychiatrischen Diagnosen zu<br />
sexuellem Missbrauch im Alter von unter 16 Jahren. Die Missbrauchserlebnisse wurden nach<br />
dem Schweregrad differenziert. Bei der Gruppe mit vollzogenem Geschlechtsverkehr war die<br />
Wahrscheinlichkeit einer späteren Alkoholabhängigkeit 6,5fach, die einer späteren<br />
Drogenabhängigkeit 6,6fach erhöht. Während zwischen Missbrauch ohne intimen<br />
Körperkontakt und anderen psychischen Störungen keine Zusammenhänge mehr feststellbar<br />
waren, zeigten sich mit Suchterkrankungen nach wie vor signifikante Zusammenhänge (vgl.<br />
Schäfer 2006, S 20).<br />
Traumatische Ereignisse betäuben und lähmen die Person in einem Ausmaß, das weit über die<br />
üblichen Erwartungen hinausgeht. Die Fähigkeit der Situationsbewältigung verschwindet und<br />
die Abwehrmechanismen versagen (vgl. Boss 2008, S54).<br />
Insbesondere sexueller Missbrauch in früher Kindheit ist eine schwere Form der<br />
Traumatisierung. Besonders gravierend ist es, wenn es sich bei den Tätern um<br />
Familienangehörige oder besonders nahe stehende Personen handelt und wenn sich der<br />
Missbrauch wiederholt: „Dann wird das Ich überflutet von als katastrophisch empfundener<br />
Angst und Panik, von Scham, Ekel, Ohnmacht, Hass, Demütigung und Verzweiflung. Die<br />
Wahrnehmung kann das, was geschieht, nicht „fassen“, die Person ist fassungslos, alles wird<br />
konfus und entsetzlich“ (Sachsse 1996, S 260).<br />
Wenn die Person „fassungslos“ ist und in diesem unendlichen, ausweglos scheinenden<br />
Schrecken quasi wie im dichten Nebel hilf- und orientierungslos „herumirrt“, findet sie<br />
vielleicht Erleichterung (zumindest für den Moment) durch den Konsum eines Suchtmittels.<br />
Psychotrope Substanzen, die die Wahrnehmung verändern und dadurch für den Augenblick<br />
erträglich machen, helfen zwar vordergründig dabei, die Person stabil zu halten, führen aber<br />
geradewegs in die Sucht.<br />
An dieser Stelle möchte ich wieder einige Hinwiese aus dem Bereich der Neurobiologie<br />
einfügen bzw. Überlegungen zur Frage, welche Folgen schwere Traumatisierungen auf<br />
neurobiologische Strukturen des Gehirns haben. Emotionale Erfahrungen aus früheren<br />
Situationen werden im limbischen System gespeichert, das mit der Großhirnrinde eng<br />
verschaltet ist. Eines der wichtigsten Speicherorgane von Emotionen in diesem limbischen<br />
System ist die Amygdala (Mandelkern): sie ist auf die Speicherung unangenehmer,<br />
gefährlicher und schmerzhafter Erfahrungen spezialisiert. Wenn die Amygdala eine äußere<br />
Situation oder ein Erlebnis als für den Menschen bedrohlich einstuft, werden ihre<br />
Nervenzellen aktiv, schütten aktivierende Botenstoffe (insbesondere Glutamat) aus und<br />
aktivieren eigene Notfallgene. Innerhalb eines Sekundenbruchteils werden die<br />
„Alarmzentren“ des Gehirns (Hypothalamus und Hirnstamm) aktiviert: der ganze Körper<br />
mitsamt Kreislauf, Herzschlag, Atmung, etc. wird in Hochspannung versetzt.<br />
Das zentrale Stressgen CRH und die gesamte hormonelle Stressachse des Körpers werden<br />
durch die Amygdala aktiviert: das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet, gleichzeitig<br />
werden erregende Botenstoffe wie Noradrenalin ausgeschüttet und eigene Notfallgene frei.<br />
Dadurch wird der Organismus in die Lage versetzt, auf die äußere, bedrohliche Situation<br />
entweder mit einer besonderen Anstrengung, d. h. Kampf, oder einer sofortigen Flucht zu<br />
reagieren.
25<br />
Im Fall eines Traumas gibt es diese Auswege nicht. Hier erlebt der Mensch das Gefühl des<br />
Ausgeliefertseins, der völligen Hilf- und Machtlosigkeit und des Kontrollverlusts. In der<br />
Amygdala wird der oben beschriebene Alarmzustand gespeichert, d. h. es kommt zu einer<br />
dauerhaften Erhöhung der Sensibilisierung von Alarm-Nervenzellen, zu einer bleibenden<br />
Super-Verstärkung von Nervenzell-Kontakten und zu einer dauerhaften Aktivierung des<br />
zentralen Stressgens CRH. Die Amygdala behält durch das Traumaerlebnis eine bleibende<br />
Erhöhung ihrer Empfindlichkeit und reagiert auf an sich harmlose Alltagssituationen von nun<br />
an viel empfindlicher als zuvor (vgl. Bauer 2011, S168ff).<br />
Die dauernde Alarmbereitschaft und der erhöhte Stresspegel führen nun dazu, dass der<br />
Organismus sich Entspannung, Beruhigung und Entlastung wünscht. Suchtmittel können<br />
dieses Bedürfnis (zumindest für den Moment) stillen:<br />
„Eine Sucht löst uns aus einer Realität, die wir unerträglich finden. Sie bietet eine<br />
Fluchtmöglichkeit vor den Konflikten und Dilemmas, die sich uns als unlösbar darstellen.<br />
Wenn wir es in der eigenen Haut, im eigenen Körper nicht mehr aushalten, wo wir das<br />
Wunder und das Leid erleben, ein Mensch zu sein, kann einen die Sucht in einen Zustand von<br />
Bewusstlosigkeit bringen. Bewusstlos spüren wir nichts, wissen wir nichts von unseren<br />
Qualen, Verwirrungen und Kämpfen.“ ((Johnston 2007, S 45).<br />
Im Fall meiner Klientin Anna gibt es nach meiner Einschätzung Hinweise auf eine<br />
frühkindliche Traumatisierung: Zum einen berichtete Anna, sie habe in ihren ersten 10<br />
Lebensjahren im Ehebett der Eltern geschlafen, zwischen Vater und Mutter. Die beiden<br />
älteren Geschwister hätten jeweils ein eigenes Zimmer gehabt, es habe auch ein leerstehendes<br />
„Gästezimmer“ gegeben (obwohl nie Übernachtungsgäste gekommen sind!), es sei also keine<br />
Frage des Raumangebotes gewesen. Anna sei dann, als die Mutter mit dem jüngsten Bruder<br />
schwanger geworden sei, in das ehemalige Gästezimmer, das nunmehr zum Kinderzimmer<br />
adaptiert worden sei, übersiedelt.<br />
Zum anderen berichtete Anna, sie habe in ihren psychotischen Episoden jeweils sehr starke<br />
Angstgefühle gehabt, die sie heute nicht näher präzisieren könne. Es habe sich aber immer<br />
definitiv um Angst vor Männern gehandelt, um Angst vor körperlichen Berührungen und es<br />
sei „immer“, so Anna, „irgendwie um Sexualität gegangen“. Sie möge und könne sich aber<br />
nicht näher damit beschäftigen. Für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, dass es sich hier um<br />
ganz wesentliche Informationen handelte, dass aber im Vordergrund die Stabilisierung der<br />
Klientin - vor allem auch in Hinblick darauf, dass sie Mutter eines Kleinkindes ist – stehen<br />
müsse. Diese Informationen sollten zu einem späteren Zeitpunkt der Therapie wieder<br />
aufgegriffen und entsprechend weiterverfolgt werden.<br />
5.7.1 Der Zusammenhang zwischen Bindungsverhalten und Suchtentstehung<br />
Im Zusammenhang mit Traumatisierungen möchte ich an dieser Stelle einige Überlegungen<br />
zum Thema Sucht und Bindungsverhalten stellen. Eine sichere, in der frühen Kindheit<br />
erworbene Bindung an eine emotional stabile, verlässliche und feinfühlige Person wirkt in<br />
Bezug auf die Entwicklung von Suchterkrankungen protektiv, unsichere Bindungen stellen<br />
hingegen einen Risikofaktor dar (vgl. Schindler 2009, S 165).<br />
Ein kleines Kind, das mit einer Mutter aufwächst, die zwar körperlich anwesend ist und ihr<br />
Kind auch versorgt und beaufsichtigt, aber emotional abwesend bzw. nicht verfügbar ist,<br />
erlebt de facto ein Bindungstrauma.
26<br />
Eine unsichere Bindung stellt einen Risikofaktor bei späteren Belastungen dar, und führt<br />
dazu, dass die betroffenen Kinder später weniger Bewältigungsmöglichkeiten für Konflikte<br />
zur Verfügung haben, eher weniger zu gemeinschaftlichen Aktivitäten neigen, weniger<br />
soziale Beziehungen haben und häufig auch schlechtere Gedächtnis – und Lernleistungen<br />
aufweisen.<br />
Wenn ein kleines Kind schon früh die Erfahrung gemacht hat, dass auf seine Wünsche nach<br />
Nähe und Zuwendung von den Eltern bzw. den Bezugspersonen mit Abweisung reagiert wird,<br />
lernt es, Bindungsreaktionen (z. B. Weinen, Protestgeschrei, Nachlaufen, Anklammern, etc.)<br />
erst gar nicht zu zeigen. Stattdessen hält es eine emotionale Distanz zur Bindungsperson, um<br />
die befürchtete Ablehnung nicht erfahren zu müssen. Auf diese Weise kann das Kind – auf<br />
Kosten seiner Bedürfnisse nach Nähe – zumindest ein gewisses Maß an Bindung<br />
aufrechterhalten (vgl. Brisch 2010, S 95 bzw. Bauer 2011, S 178f).<br />
Kinder haben aber ein grundlegendes Bedürfnis - eine „Sehn-Sucht“ - nach Bindung. Hier<br />
besteht das Risiko, dass der bindungssuchende Mensch aus Angst vor den Gefahren einer<br />
zwischenmenschlichen Bindung sich einem Surrogat, einem Suchtstoff, zuwendet.<br />
Im Fall meiner Klientin Anna kann jedenfalls von einer Bindungsstörung ausgegangen<br />
werden. In ihrer Biografie finden sich dazu entsprechende Hinweise: z. B. der Vater, der für<br />
Anna keine Bindungsperson repräsentiert, sondern im Gegenteil Vorbild für Suchtverhalten<br />
war und ist. Im Alter von 10 Jahren, als Anna aus dem Ehebett der Eltern weichen musste,<br />
weil ihr jüngerer Bruder geboren wurde und ihren Platz eingenommen hat, erlebte Anna einen<br />
ersten schweren Einbruch in ihr Bindungsmuster. Der zweite schwere Einbruch erfolgte, als<br />
sie im Alter von 14 Jahren nach Graz zog, um dort die Schule zu besuchen, und von ihrer<br />
Familie mehr oder weniger „fallengelassen“ wurde. Insbesondere der Verlust der Mutter, die<br />
bis dahin als Bindungs- und Beziehungsperson zumindest eingeschränkt zur Verfügung<br />
gestanden hatte, war für Anna dramatisch.<br />
Im Lauf der nächsten Jahre musste Anna auch in ihren wechselnden Beziehungen zu Männern<br />
immer wieder Beziehungs- und Bindungsabbrüche erleben: Das Ende der Beziehungen wurde<br />
in jedem Fall vom jeweiligen Mann herbeigeführt, nie von Anna. Sie war immer die<br />
Verlassene. Trotz der vielen problematischen Bindungs- und Beziehungserfahrungen war und<br />
ist Anna nach meiner Einschätzung sehr bemüht, ihrem Sohn eine gute Mutter i.S. von stabil,<br />
zuverlässig und emotional verfügbar zu sein. Leider war ihr dies in den ersten Lebensjahren<br />
ihres Sohnes wegen ihres Drogenkonsums nur eingeschränkt möglich. Darauf möchte ich aber<br />
im letzten Teil meiner Arbeit noch ausführlicher eingehen.<br />
5.8 Soziokulturelle Faktoren<br />
Als abschließende Ergänzungen zu diesem Teil meiner Arbeit möchte ich noch auf einige<br />
Faktoren eingehen, die eher im gesellschaftspolitischen bzw. soziokulturellen Bereich liegen:<br />
- Hier ist in erster Linie die relativ leichte Verfügbarkeit von Suchtmitteln aller Art zu<br />
nennen. Auch Jugendliche, die deutlich jünger als 16 Jahre sind, haben keine nennenswerten<br />
Schwierigkeiten, Alkohol, Nikotin oder auch andere Suchtmittel zu erwerben. Auch meine<br />
Klientin Anna berichtete, dass es in ihrer Schulzeit in Graz „überhaupt kein Problem“<br />
gewesen sei, an „Stoff“ zu kommen. Auch jetzt in Kärnten sei dies ganz einfach.
27<br />
- Gesellschaftlich ist nach meiner Einschätzung generell eher eine gewisse Lockerheit, i.S.<br />
von Unsicherheit und Nachlässigkeit, gegenüber Regeln und Normen spürbar. Es gibt, wie<br />
vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten, keine klare gesellschaftliche Haltung gegenüber<br />
Suchterkrankungen. Sichtbar wird dies z. B. an Fragen der Legalisierung sog. „weicher“<br />
Drogen.<br />
Hinzu kommt, dass auch der Beginn von Suchtverhalten heute bereits wesentlich früher<br />
anzusetzen ist: z. T. haben bereits Kinder im Volksschulalter Erfahrung mit Alkohol und<br />
Nikotin bzw. zeigen Suchtsymptome beim Spielen am Computer.<br />
- Großen Einfluss üben sicherlich auch Vorbilder in der Familie und im Freundeskreis sowie<br />
öffentlich bekannte Personen (z. B aus den Bereichen Sport, Kunst oder Musik). In Annas<br />
Familie war (soweit bekannt) zumindest der Vater alkoholabhängig. Besonders treffend wird<br />
dies im Gedicht „Mein Vater“ von Christine Nöstlinger beschrieben:<br />
„Cola schmeckt wie Wanzengift, sagt mein Vater immer nach dem ersten Bier.<br />
Cola ist ein ausländischer Dreck, sagt mein Vater immer nach dem zweiten Bier.<br />
Cola frisst den Magen auf, sagt mein Vater immer nach dem dritten Bier.<br />
Cola zersetzt das Gehirn, sagt mein Vater immer nach dem vierten Bier.<br />
Nach dem fünften sagt er nichts mehr.“ (Nöstlinger zitiert nach Haller 2007, S 51f)<br />
- Auch der Kreis der Gleichaltrigen, in dem sich Kinder und Jugendliche bewegen, hat<br />
großen Einfluss auf den Umgang mit Suchtmitteln. Der Gebrauch von Substanzen beginnt<br />
sehr oft gemeinsam mit Freunden. Auch die Einstellungen, die im Freundeskreis gegenüber<br />
Suchtmitteln gepflegt werden, können den Suchtmittelgebrauch des einzelnen Jugendlichen<br />
relativ zuverlässig vorhersagen (vgl. Teesson/Degenhardt/Hall 2008, S64).<br />
Gerade junge, empfindsame und interessierte Menschen zeichnet oft eine Aufgeschlossenheit<br />
für andere, neue und fremde Lebenswelten aus. Hier etwas auszuprobieren, was in der<br />
bekannten Lebenswelt verboten oder gefährlich ist, kann schon reizvoll sein. Anna war<br />
sicherlich bereits als junges Mädchen sehr offen und neugierig auf Neues, das sich von ihrer<br />
bekannten und vertrauten Welt abhob.<br />
- Anna hat sich mit der Wahl ihres Berufes (Grafik und Design) auch in eine Welt begeben,<br />
in der das Experimentieren oder auch der Konsum von Drogen möglicherweise anerkannter<br />
und „normaler“ ist als in anderen Berufsgruppen. Damit gemeint ist nicht die tatsächliche<br />
Anzahl der abhängigen Menschen in den jeweiligen Berufsgruppen, sondern der Umgang<br />
damit.<br />
In jeder Berufsgruppe, sozialen Schicht und auch Altersgruppe gibt es süchtiges Verhalten –<br />
allerdings sind Suchtmittel, Konsumverhalten und oft auch soziale und gesundheitliche<br />
Auswirkungen unterschiedlich.<br />
- Viele Menschen, die zu Drogen greifen, tun dies möglicherweise auch aus einem Leiden am<br />
System bzw. Traumatisierung durch das System heraus: Es gibt eine große und durchaus<br />
wachsende Zahl von Menschen, die in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr finden:<br />
Schulabbrecher, Migranten, Alleinerzieherinnen, Familien mit vielen Kindern, junge und<br />
ältere Menschen, die den Belastungen des Alltagslebens nicht perfekt gewachsen sind – viele<br />
von ihnen haben ganz real große Schwierigkeiten, in dieser hochtechnisierten,<br />
hochkomplexen, auch schnelllebigen Welt ihren Platz zu finden. Welche<br />
Zukunftsperspektiven haben junge Leute, die nicht das Glück haben, in stabile, gut situierte<br />
Familien hineingeboren zu werden? Welche Möglichkeiten einer sinnvollen, erfüllten<br />
Lebensgestaltung haben sie, wenn sie weder berufliche noch soziale Perspektiven haben?<br />
Wenn ihnen das Gefühl vermittelt wird, eigentlich nicht gebraucht zu werden, keinen<br />
wichtigen Beitrag für die Gestaltung unserer Gesellschaft leisten zu können? Das Gefühl,
28<br />
„Null Bock“ zu haben für so ein Leben, kann durchaus viele Menschen erfassen, die<br />
eigentlich in sich die Anlagen hätten zu einem selbstbestimmten, freien, im eigentlichen Sinn<br />
glücklichen Leben.
29<br />
6.Das Verhältnis von Sucht und Person-Sein<br />
In diesem Teil meiner Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, wie es dem suchtkranken<br />
Menschen damit geht, wenn er seiner Sucht so ausgeliefert ist und sich gedrängt fühlt zur<br />
Stillung seiner Bedürfnisse, wenn er nicht mehr „Herr im eigenen Haus“ ist (oder es<br />
zumindest so erlebt). Ich möchte versuchen, das Erleben der suchtkranken Person zu<br />
beschreiben und verständlich zu machen.<br />
Das Leiden an der Sucht hat nach Alfried Längle und Christian Probst vor allem zwei<br />
Hauptsymptome: zum einen den Verlust der Freiheit bei einem Überhandnehmen des<br />
Getriebenseins und zum anderen die Entwicklung eines apersonalen Verhaltens. Der süchtige<br />
Mensch geht sich selbst in seinem Wesen verloren und es gehen ihm auch die Werte verloren<br />
(vgl. Längle/Probst 1997, S 74)<br />
Auf beide Aspekte möchte ich im Folgenden näher eingehen.<br />
6.1. Der Verlust der Freiheit<br />
Für den nicht süchtigen Menschen stellen Suchttendenzen etwas eindeutig Fremdes dar, das<br />
sein Ich bedroht. Er spürt, dass er das eigentlich nicht will und sieht auch die Gefahr, die<br />
damit verbunden ist. Er beginnt daher, sich durch bewusste Entscheidungen und zielführende<br />
Prophylaxe zu schützen. Wer z. B. die Spielsucht in sich schon spürt, ihr aber nicht erliegen<br />
will, trifft dann klare Schutzmaßnahmen: er betritt z. B. keine Spielcasinos mehr oder<br />
vernichtet zu Hause seine Computerspiele (vgl. Längle/Probst 1997, S 75).<br />
Der süchtige Mensch ist zu dieser klaren, entschiedenen Haltung nicht fähig. Wenn sein<br />
Suchtverlangen steigt, weiß er nicht mehr eindeutig, was er selbst will und was das Fremde in<br />
ihm macht. Er erlebt sich als Ich und zugleich als fremd. Die Grenzziehung zwischen dem<br />
Eigenem (dem Ich) und dem Anderem (dem Fremden, dem Suchtobjekt) geht ebenso verloren<br />
wie zwischen eigenem Wollen und Getriebensein.<br />
Die Sucht wird wichtiger als die eigene innere Klarheit, dem süchtigen Menschen geht nicht<br />
nur das Wissen darüber, was gut, gesund und richtig für ihn ist, verloren bzw. wird es ihm<br />
fremd, sondern er findet auch keine Möglichkeit mehr, gemäß diesem Wissen zu handeln. Die<br />
Sucht schiebt sich als etwas Trennendes quasi in den Menschen hinein.<br />
Die oft gehörte Frage, wie sich denn jemand freiwillig so selbstzerstörerischen<br />
Verhaltensweisen aussetzen kann, lässt sich daher nicht beantworten, weil es eben nicht um<br />
„Freiwilligkeit“ geht. In der Sucht ist der freie Wille des Menschen gebunden, eingeschränkt<br />
und blockiert durch dieses Fremde, das in ihm überhand nimmt. Die Kontrolle über das<br />
Eigene, über den eigenen Willen, geht verloren auf der Basis eines unaushaltbaren Schmerzes.<br />
Meine Klientin Anna beschreibt dies mit ihren Worten so: „Es ist nicht nur so, dass ich einen<br />
Joint rauchen will. Einerseits weiß ich ja, dass es nicht gut ist und mir schadet. Aber da ist<br />
auch etwas in mir, das stärker ist als ich. Ich muss rauchen, da ist etwas stärker in mir. Da ist<br />
ein Bedürfnis, das drängt mich dazu.“<br />
Nachgefragt, was denn dieses „wollen“ und „müssen“ bedeuten könnte, sieht Anna ihr<br />
Bedürfnis nach Entspannung, nach Entlastung, mehr Lockerheit und Vergessen ihrer Sorgen<br />
und Ängste. Das ist das, was sie will. Warum sie früher so oft und jetzt noch in manchen<br />
Situationen zu einem Joint greifen muss, beginnt sie erst langsam zu verstehen und erklärt<br />
dies so: „Ich hatte nichts anderes. Das Kiffen hat geholfen. Ich bin meine Sorgen los gewesen<br />
und hab mich wohl gefühlt. Ich wusste ja nicht, was ich sonst hätte tun sollen.“
30<br />
Dieses Wechselspiel in der Sucht zwischen dem Eigenem und dem Fremden folgt nach<br />
meiner Einschätzung der Dynamik in der Persönlichkeitsentwicklung. Je mehr der Mensch<br />
sein Eigenes entwickelt und festigt, je stärker sein Ich wird, umso schwächer wird der<br />
Einfluss des Fremden. Mit diesem Aspekt möchte ich mich im letzten Teil meiner Arbeit, in<br />
der es um Wege aus der Sucht gehen wird, ausführlicher auseinandersetzen.<br />
6.2 Die Entwicklung eines apersonalen Verhaltens<br />
Ein wesentliches Merkmal des reifen, gesunden Menschen ist seine Fähigkeit, freie,<br />
selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.<br />
In der Art und Weise, wie ein Mensch sich verhält, wie er mit den Herausforderungen des<br />
Lebens umgeht, wie er sich selbst und anderen begegnet, welche Haltungen er einnimmt, wie<br />
er zur Entschiedenheit findet, wie er Stellung nimmt zu den Fragen des Lebens und wie er<br />
seine individuellen Antworten vertreten kann – in all diesen Bereichen zeigt sich die Person.<br />
Die Befreiung des Menschen vom „Müssen“ zum „Wollen“, d.h. der Weg aus dem<br />
Vorgegeben und der Passivität zum Selbst-Gewählten und zur Aktivität zeichnet die<br />
Entwicklung der Person nach.<br />
Dort, wo in der Sucht das Fremde sich mit dem Eigenem vermischt und das Ich „stört“ bzw.<br />
in seiner Freiheit einschränkt, kann der Mensch keine freien Entscheidungen mehr treffen.<br />
Damit verliert er einen ganz wesentlichen Teil dessen, was Person-Sein ausmacht. Er gibt in<br />
der Sucht „die Fäden aus der Hand“, er lässt sich von der Sucht treiben bzw. ist ihrer<br />
Dynamik ausgeliefert und ergibt sich seinem apersonalen Verhalten. Dies passiert allerdings<br />
nicht in einer Haltung der Freiwilligkeit, sondern aus der Not heraus, keine anderen,<br />
gesünderen Alternativen zur Verfügung zu haben.<br />
In der Sucht ist der Mensch einsam: er sieht kein Gegenüber, er erkennt das Persönliche nicht<br />
weder bei sich selbst noch bei anderen. Ohne diese persönliche Begegnung mit der eigenen<br />
bzw. einer anderen Person gerät der Mensch in eine tiefe, existenzielle Einsamkeit, die kaum<br />
auszuhalten ist.<br />
Um diese innere Einsamkeit erträglich zu machen und um zugleich Leben zu spüren<br />
(Lebendigkeit spüren sie nur bei bestimmten Drogen wie Koks und Extasy… Cannabis dient<br />
primär der Beruhigung!), erfolgt immer wieder der Griff zum Suchtmittel.<br />
Der süchtige Mensch leidet darunter, dass die eigene Erlebnisfähigkeit so eingeschränkt und<br />
schwach ist. „Sucht ist Hunger nach Erleben der eigenen Vitalität, ist der ursprünglich<br />
geistige Griff nach mehr Leben, der sich nun psychisch (und somatisch) verselbständigt hat.<br />
„ (Längle/Probst 1997, S 85) –<br />
6.3 Das Bedürfnis, sich zu zeigen<br />
Eine ganz wesentliche Eigenheit der Person ist es, sich zeigen zu dürfen, wie sie ist: nicht<br />
Teile oder Seiten von sich verstecken oder verstellen zu müssen, sondern sich als Gesamtheit,<br />
als Einheit vor den anderen hinstellen zu dürfen.<br />
„Persönlich“ wird eine Begegnung immer dann, wenn ein Mensch sich dem anderen<br />
gegenüber öffnet und zeigt, was ihm wichtig ist, was ihn bewegt und berührt. Eine<br />
persönliche Begegnung kann den anderen daher immer wieder überraschen oder auch<br />
erschrecken. „Personsein heißt, immer auch anders sein können“, nennt dies Viktor Frankl.
31<br />
Dieses Sich-Herzeigen des Menschen in einer persönlichen Begegnung ist eine wesentliche<br />
Voraussetzung für die Entwicklung des Selbstwerts und die Ich-Bildung: Zwischen den<br />
beiden Polen Selbstreflexion (wie erlebt der Mensch sich selbst?) und Fremdreflexion (wie<br />
wird er von anderen gesehen?) entwickeln sich im dialogischen Prozess Selbstbild und<br />
Selbsteinschätzung.<br />
Wenn der Mensch für sein So-Sein Beachtung und Aufmerksamkeit findet und wenn er mit<br />
dem, was er von sich herzeigt, Anerkennung, Wertschätzung und Respekt erhält, so kann sich<br />
sein Selbstwert entfalten und stärken.<br />
Bei vielen suchtkranken Menschen fehlt aufgrund der schweren Bindungstraumatisierungen<br />
diese Erfahrung, in ihrem Wesen erkannt und gesehen worden zu sein. Unter dem Einfluss der<br />
Drogen, im Rausch, können sie es wagen, sich herzuzeigen. Sie können Dinge tun oder<br />
aussprechen, zu denen ihnen in drogenfreien Situationen der Mut fehlt. Sie können sich<br />
öffnen und wären für eine persönliche Begegnung bereit. Dadurch wird allerdings das Gefühl<br />
von Ich-Selbst-Sein-Können an die Droge bzw. an das Erleben im Drogenrausch geknüpft –<br />
und die Mächtigkeit der Sucht genährt.<br />
Person-Sein und Suchtmittel schließen sich allerdings aus, wie oben bereits gezeigt wurde:<br />
Person-Sein braucht die Freiheit – und nicht das von außen Getrieben-Werden durch die<br />
Droge. Person-Sein braucht auch die Entschiedenheit des Menschen und seine Fähigkeit und<br />
Bereitschaft, Verantwortung für sein Tun und Lassen zu übernehmen. In der Suchtdynamik<br />
geht diese Entschiedenheit verloren und die Eigenverantwortung wird geschwächt bzw. bleibt<br />
unausgebildet. In Bildern gesprochen, könnte man die Person mit einem Kutscher<br />
vergleichen, der den Wagen, d. h. das Psychophysikum lenkt. In der Sucht gibt der Kutscher<br />
die Zügel aus der Hand, der Wagen entgleitet und das Ziel geht verloren.<br />
Meine Klientin Anna hat sehr oft über ihr Gefühl berichtet, vor anderen Menschen Angst zu<br />
haben und es nicht wagen zu dürfen, ihre eigene Meinung zu äußern; sie hat von ihrer Angst<br />
davor erzählt, dass die anderen sie sehr streng und überkritisch beurteilen könnten bzw. alles,<br />
was sie tut und denkt, für falsch halten. Der Cannabis-Konsum hat diese Angst gelöst: „Wenn<br />
ich eingeraucht war, hatte ich kein Problem mit den anderen. Da war die Angst weg.“<br />
6.4 Die innere Armut und Bedürftigkeit<br />
Sucht und Not gehören zusammen. Der süchtige Mensch ist bedürftig, er spürt seinen inneren<br />
Hunger, sein Defizit in der eigenen Erlebnisfähigkeit. In der Sucht geht es nicht um den<br />
Suchtstoff an sich (Alkohol, Nahrungsmittel, Kokain, etc.), sondern um das Erleben der<br />
Wirkung. Es geht nicht um biologische Notwendigkeiten (z. B. Hunger oder Durst zu stillen),<br />
sondern es geht darum, Bedürfnisse im psychischen bzw. emotionalen Bereich zu befriedigen,<br />
innere Schmerzen zu lindern und den Erlebnishunger zu stillen.<br />
Die Suchtmittel als solche haben auch keinen eigenen, objektiven, Wert - sie dienen nur als<br />
Mittel zum Zweck: um endlich satt, zufrieden, ausgeglichen, entspannt, glücklich zu werden.<br />
Hier kommt der, für den suchtkranken Menschen meines Erachtens besonders tragische<br />
Aspekt der Sucht zum Vorschein: er versucht, mit den Suchtmitteln seinen inneren Hunger zu<br />
stillen und seine Bedürftigkeit erträglicher zu machen – und es funktioniert immer nur für den<br />
Augenblick. Er wird nur für einen ganz kurzen Moment satt. In dem Augenblick, in dem die
32<br />
Wirkung der Droge nachlässt, erwacht auch der Hunger wieder und die innere Bedürftigkeit<br />
wird – vielleicht sogar noch stärker als zuvor – spürbar. Welch große Enttäuschung das für<br />
den süchtigen Menschen in seiner Not bedeuten muss!<br />
Dazu kommen noch Gefühle der Schuld und der Scham, weil dem süchtigen Menschen ja<br />
durchaus bewusst ist, dass er mit dem Konsum der Suchtmittel etwas „falsch“ gemacht hat,<br />
dass er der Mächtigkeit der Sucht nicht widerstehen konnte, dass er den eigenen guten<br />
Vorsätzen wieder untreu geworden ist, dass er seine Angehörigen (oder auch Therapeuten)<br />
enttäuscht hat, etc.<br />
Meine Klientin Anna lernte im Lauf ihrer Entwicklung als Drogenkonsumentin diesen<br />
Kreislauf nur allzu gut kennen und sie spürte auch schmerzhaft die dazugehörigen Gefühle<br />
der Scham, des Ekels vor sich selbst, des „schlechten Gewissens“, der Enttäuschung, etc. Ihre<br />
jahrelangen Versuche einer Bewältigungsstrategie bestanden aus Wegschieben der<br />
unangenehmen Gefühle und danach wieder zum Griff nach Suchtmitteln. Aber auch bei Anna<br />
hat diese Strategie nicht funktioniert. Ihre innere Armut ist geblieben, ihre Bedürftigkeit und<br />
ihre Einsamkeit auch. Erst langsam beginnt Anna zu verstehen, dass diese innere Not nicht<br />
mit den bisherigen Mitteln zu lindern ist, sondern dass es sie selbst dazu braucht (dazu mehr<br />
im letzten Kapitel meiner Arbeit).<br />
6.5 Das unerträgliche Leid des traumatisierten Menschen<br />
Wenn Kinder traumatischen Erfahrungen ausgesetzt sind (z. B. in Form von<br />
Vernachlässigung, Misshandlung, emotionaler bzw. sexueller Gewalt) und dies durch<br />
diejenigen Personen, von denen sie eigentlich Liebe, Zuwendung, Schutz und Geborgenheit<br />
erhalten sollten, dann nehmen sie massiven Schaden auf allen Ebenen ihrer Entwicklung: von<br />
der Entwicklung des Gehirns bis zur Gestaltung ihrer Beziehungsfähigkeit, von der<br />
Entwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Identität bis zur Qualität ihrer Bindungen – alle<br />
Bereiche der kindlichen Entwicklung werden beeinträchtigt (vgl. Huber 2005, S 87)<br />
Die Folgen sind aber nicht nur die oben beschriebenen Beeinträchtigungen von<br />
Entwicklungsbereichen, sondern auch – und vor allem – Schmerz und Leid. Insbesondere<br />
wenn dieser Schmerz durch eine nahe stehende, vertraute, in gewissem Sinn sogar geliebte<br />
Person verursacht wird, wie soll ein Kind dies aushalten? Wie wird dieser Schmerz für einen<br />
erwachsenen Menschen aushaltbar?<br />
Der Schluss liegt nahe, dass Suchtmittel zum Zweck der Linderung eingesetzt werden, um<br />
den mit der Verletzung verbundenen Schmerz erträglich zu machen bzw. gar nicht erst spüren<br />
zu müssen. Andere, gesündere Alternativen sind traumatisierten Menschen häufig schlichtweg<br />
nicht bekannt. Positive Vorbilder, die unterstützend wirken könnten, gibt es meist weder im<br />
Familienverband noch im Bekanntenkreis.<br />
Wissenschaftliche Studien belegen, dass ein hoher Anteil von suchtkranken Menschen<br />
frühkindlichen Traumatisierungen ausgesetzt waren (vgl. Schäfer 2006, S 17f). In diesem<br />
Zusammenhang möchte ich auf das Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit zur Entstehung von<br />
Sucht verweisen.<br />
Viele Menschen, die traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren, leiden auch darunter,<br />
keinen stabilen Halt und Boden zu haben. Sie fühlen sich völlig verunsichert, schutzlos und<br />
ausgeliefert. Erst wenn ihnen stabile Bindungspersonen, z. B. im Rahmen einer<br />
Psychotherapie, neue Wege und Strategien zur Linderung ihres Schmerzes aufzeigen, eine
33<br />
wertschätzende und respektvolle Beziehung anbieten, Schutz, Raum und Halt schaffen – erst<br />
dann sind süchtige Menschen mit traumatischen Erfahrungen in der Lage, möglicherweise die<br />
Sucht aufgeben zu können.<br />
Im Fall meiner Klientin Anna ist es m. E. die Vermutung von frühkindlichen<br />
Traumatisierungen aufgrund mehrerer Faktoren durchaus berechtigt: Zum einen berichtete<br />
Anna über ihre Angst vor Männern und Sexualität, die sie während ihrer psychotischen<br />
Episoden quälte; zum anderen musste sie als Kind in ihren ersten zehn Lebensjahren nachts<br />
im Ehebett zwischen den Eltern schlafen, obwohl im Haus auch Platz für ein eigenes Zimmer<br />
für sie gewesen wäre.<br />
Erschwerend kommt hinzu, dass Anna keine maßgebliche soziale Unterstützung in ihrer<br />
Familie fand, sondern im Gegenteil an ihr als Person niemand wirklich interessiert war. Sie<br />
musste außerdem etliche negative Lebensereignisse und Stressfaktoren hinnehmen:<br />
Schulwechsel von einer kleinen Landgemeinde in eine völlig fremde, wesentlich größere und<br />
für Anna unübersichtliche Stadt; unbefriedigende Partnerschaften mit Männern;<br />
Beziehungsabbrüche durch ihre Partner; unbefriedigende berufliche und finanzielle Situation;<br />
alleinige Sorge für ihren kleinen Sohn, etc.<br />
Anna hat noch kein bewusstes Wissen darüber, welchen Traumatisierungen sie in ihrem<br />
bisherigen Leben ausgesetzt war: zum einen wegen ihrer dissoziativen Fähigkeiten (die sie<br />
vor einem Wissen beschützen, dass sie noch nicht ertragen könnte), und zum anderen weil<br />
ihre Sucht ihr bisher dabei geholfen hat, ihren inneren Schmerz zu lindern.<br />
Im bisherigen Therapieverlauf waren traumatische Erlebnisse für Anna daher auch kein<br />
Thema, dem sie sich zuwenden wollte bzw. konnte. Erst wenn die Voraussetzungen dafür<br />
geschaffen sind, Anna sich sicher und geschützt gefühlt, ihre Alltagsaufgaben gut bewältigen<br />
kann und ein tragfähiges Netz an unterstützenden sozialen Beziehungen aufgebaut hat, könnte<br />
sie sich der Bearbeitung ihren tieferliegenden Themen zuwenden.<br />
Viele früh traumatisierte Menschen haben, so wie auch Anna, nicht die Erfahrung machen<br />
dürfen, in ihrem So-Sein erkannt und anerkannt worden zu sein. Für die Therapie gilt daher,<br />
was Michaela Huber schreibt:<br />
„Die therapeutische Beziehung ist also eine entscheidende Begegnung: Darf die KlientIn<br />
endlich gesehen werden? Darf sie sich dann auch selbst erkennen? Wird sie von der<br />
TherapeutIn auch für ihr Anderssein anerkannt? Und darf sie sich dann auch in einem<br />
nächsten Schritt selbst anerkennen, so wie sie wirklich ist, und nicht, wie andere sie haben<br />
wollen?“ (Huber 2006, S 39)<br />
Die therapeutische Arbeit mit Anna wird im abschließenden Kapitel ausführlich behandelt<br />
werden.
34<br />
7.Das Leid der Angehörigen<br />
Die Mächtigkeit der Sucht beschränkt sich nicht nur auf den einzelnen suchtkranken<br />
Menschen: sie erfasst auch sein Umfeld, seine Familie, Freunde und Arbeitskollegen. Die<br />
Angehörigen haben enorm unter den Auswirkungen der Sucht in allen ihren Facetten zu<br />
leiden: seien es die durch die Sucht eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten der Familie,<br />
sei es durch Veränderungen im emotionalen oder sozialen Verhalten, sei es durch<br />
zunehmendes Desinteresse am anderen, sei es durch die Scham des Kindes für den<br />
betrunkenen Vater, sei es durch gesundheitliche Probleme, eingeschränkte Leistungsfähigkeit,<br />
Gewalttätigkeit, etc.<br />
Die Angehörigen sind häufig in zweifacher Hinsicht mit Vorwürfen und Beschuldigungen<br />
konfrontiert. Zum einen durch den suchtkranken Menschen, der die Schuld für das Entstehen<br />
der Sucht seinen Angehörigen zuweist und zum anderen durch das gesellschaftliche Umfeld.<br />
Angehörige erleben sich oft hin- und her gerissen zwischen dem Bedürfnis, helfen und<br />
unterstützen zu wollen und aber auch der eigenen Wut, Hilflosigkeit und Gefühlen der<br />
Ablehnung dem suchtkranken Menschen gegenüber (vgl. Haller 2007, S 168). In dieser<br />
Verstrickung wird häufig eine Co-Abhängigkeit deutlich, die nichts zur Suchtheilung, sondern<br />
nur zur Prolongierung des Leids beiträgt.<br />
Angehörige von suchtkranken Menschen wollen meist helfen, tun dies aber oft mit falschen,<br />
ungeeigneten oder sogar kontraproduktiven Mitteln. Bagatellisieren oder sogar bewusstes<br />
Ignorieren des Suchtverhaltens, (gut gemeinte) Unterstützung durch Erfinden von Ausreden,<br />
wenn der suchtkranke Partner nicht zur Arbeit geht, Akzeptieren und Erdulden der Sucht –<br />
dies alles trägt zur Aufrechterhaltung des Suchtverhaltens bei. In den meisten Fällen<br />
funktionieren dieses Verleugnungs- und Verdrängungsmechanismen eine lange Zeit:<br />
„Solange der Süchtige jemanden hat, der ihn entschuldigt, ihn deckt und für ihn Erklärungen<br />
kreirt, für ihn arbeitet, sich mit ihm solidarisiert und ihn sogar verteidigt, wird er sein<br />
süchtiges Verhalten um keinen Deut ändern.“ (Haller 2007, S171)<br />
7.1 Die Co-Abhängigkeit<br />
Die Dynamik der Sucht umfasst häufig nicht nur den betroffenen suchtkranken Menschen,<br />
sondern sie streckt ihre „Fangarme“ auch nach den Angehörigen und Freunden aus. Co-<br />
Abhängigkeit bezeichnet Haltungen und Verhaltensweisen von Personen, Gruppen, aber auch<br />
Institutionen, die dazu beitragen, dass die Sucht aufrecht bleibt (vgl. Fengler 2002, S 100).<br />
Beispiele sind die Ehefrau, die ihren betrunkenen Mann an seiner Arbeitsstelle wegen Grippe<br />
entschuldigt; die Kollegin, die die Fehler ihres süchtigen Vorgesetzten deckt; die Großmutter,<br />
die ihrem Enkel Geld zusteckt und damit den nächsten Joint finanziert; der Ehemann, der<br />
Ausreden erfindet, wenn seine medikamentenabhängige Frau ihre Termine nicht einhält, etc.<br />
Ihnen allen ist gemein, dass sie den Süchtigen in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit<br />
stellen: ihr Leben dreht sich um ihn, besser gesagt: um seine ungesunden, aus der<br />
Suchterkrankung resultierenden manipulativen Mechanismen.<br />
Das Phänomen der Co-Abhängigkeit hat möglicherweise gar nicht so viel mit der<br />
Suchterkrankung des Partners zu tun als viel mehr mit, die sehr oft auf schwere<br />
Traumatisierungen, Bindungsstörungen oder sonstigen Beeinträchtigungen im Bereich der<br />
Persönlichkeitsentwicklung zurückzuführen sind. Es wäre daher eigentlich angebracht, die
35<br />
Co-Abhängigkeit als eigenständiges Krankheitsbild zu betrachten und in einer eigenen Arbeit<br />
umfangreich zu betrachten. Nichtsdestotrotz halte ich es für sinnvoll, im Zusammenhang mit<br />
Suchterkrankungen zumindest einen kurzen Blick aus der Sicht der Existenzanalyse auf das<br />
Phänomen der Co-Abhängigkeit zu werfen.<br />
Bei den betroffenen Angehörigen finden sich häufig folgende Eigenschaften, die in ihrer<br />
eigenen Persönlichkeitsstruktur begründet sind:<br />
- Beziehungsabhängigkeit: co-abhängige Menschen räumen der Beziehung<br />
zum süchtigen Partner (Elternteil, Kind, etc.) einen enormen Stellenwert ein.<br />
Die Beziehung zu ihm ist wichtiger und wertvoller als das eigenen<br />
Wohlergehen bzw. eigene Bedürfnisse und Ansprüche. Die Angst, diese<br />
Beziehung zu gefährden oder gar zu verlieren lässt sie dadurch vor<br />
ernsthaften Konflikten und Entscheidungen zurückscheuen. Im Extremfall<br />
tun co-abhängige Menschen alles, um die Beziehung aufrechtzuerhalten.<br />
(vgl. Wilson Schaef 2003, S 56)<br />
- Eigene Wertlosigkeit: Co-abhängige Menschen haben oft das Gefühl der<br />
eigenen Wertlosigkeit. Die Person des anderen wird als wichtiger und<br />
wertvoller erachtet, die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt oder ignoriert,<br />
sofern sie überhaupt wahrgenommen werden können. (vgl. Wilson Schaef<br />
2003, S 60). „Menschen ohne Grenzen spüren nicht, wenn sie verletzt<br />
werden oder selbst verletzen. Solche Menschen haben Schwierigkeiten, nein<br />
zu sagen oder sich zu schützen. Sie lassen es zu, dass andere sie körperlich,<br />
sexuell, emotional oder intellektuell ausnutzen und wissen nicht, dass sie das<br />
Recht haben, zu sagen: „Nein, hör auf. Ich will nicht angefasst werden!“<br />
oder: „Ich bin nicht für deine Gefühle, Gedanken oder Handlungen<br />
verantwortlich“.“ (Mellody2010, S 34).<br />
- Mit dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit eng verbunden ist das Bedürfnis<br />
vieler co-abhängiger Menschen nach Bestätigung von außen. Sie brauchen<br />
Rückmeldungen und Anerkennung durch andere, um für das eigene Handeln<br />
Bestätigung zu bekommen und sich dadurch sicherer zu fühlen (vgl. Wilson<br />
Schaef 2003, S 61)<br />
Aus der Sicht der Existenzanalyse ist auch beim Krankheitsbild der Co-Abhängigkeit,<br />
vergleichbar den Suchterkrankungen, hauptsächlich die Ebene der 3. Grundmotivation<br />
beeinträchtigt. Wo kein ausreichend stabiler Selbstwert ausgebildet werden konnte, fehlt auch<br />
das Gefühl für den Wert der eigenen Person, fehlt die Wertschätzung für das eigene Selbst<br />
und dadurch auch die Fähigkeit, das Eigene ausreichend zu achten und zu schützen. Die<br />
Abgrenzung zu den anderen gelingt nur eingeschränkt oder gar nicht. Eine gelungene<br />
Abgrenzung wirkt ja in zwei Richtungen: zum einen heißt Sich-Abgrenzen Ja sagen zum<br />
Eigenen und zum anderen Nein sagen zum Fremden, Zum Unpassenden, zu dem, was dem<br />
Menschen nicht gerecht wird. Dort, wo aber das Eigene in der Person nicht klar genug gefasst<br />
ist, dort „drängt“ sich das Fremde herein und beansprucht mehr und mehr Raum.
36<br />
Bei der Co-Abhängigkeit liegt existenzanalytisch betrachtet meines Erachtens aber auch eine<br />
Beeinträchtigung auf der Ebene der 2. Grundmotivation vor, wo es um das Thema Beziehung<br />
zu anderen, aber auch zum eigenen Selbst geht. Dort, wo der Mensch einen guten Umgang<br />
mit sich selbst (und anderen) pflegt, wo er achtsam und sorgsam ist, dort haben auch seine<br />
Beziehungen zu anderen den „passenden“, gleichbedeutenden Stellenwert: die Beziehung<br />
zum suchtkranken Partner ist nicht wichtiger oder wertvoller als die Beziehung zu sich selbst.<br />
Wo der Mensch aber die Beziehung zu sich selbst nicht pflegt und schätzt, sie vielleicht auch<br />
gar nie richtig entwickelt hat, dort können die Beziehungen zu anderen an Bedeutung und<br />
Wert gewinnen und unverhältnismäßig wichtig werden. Je schwächer und unentwickelter die<br />
Beziehung zu sich selbst ist, umso wichtiger werden die Beziehungen zu anderen. Umso<br />
größer wird auch die Angst, diese Beziehungen zu verlieren, was dazu führt, dass diese<br />
Menschen sehr viel auf sich nehmen bzw. vielen Konflikten und Entscheidungen ausweichen,<br />
um diese Beziehungen zu anderen aufrechtzuerhalten.<br />
Im Zusammenhang mit der Co-Abhängigkeit (aber natürlich nicht nur damit!) taucht auch der<br />
Begriff des Helfersyndroms auf: Gemeint ist nicht das Helfen Wollen, wo jemand um Hilfe<br />
bittet bzw. Hilfe braucht, sondern die Haltung der übertriebenen Fürsorge, das Gefühl,<br />
„unbedingt“ helfen zu wollen bzw. eigentlich zu müssen, das Gefühl, gebraucht zu werden,<br />
und das Gefühl, sich unentbehrlich machen (vgl. Wilson Schaef 2003, S 65). Für jemand<br />
anderen Dinge zu tun, die er oder sie eigentlich selber tun könnte, bedeutet auch, dem anderen<br />
die Verantwortung abzunehmen und Entscheidungen für ihn oder sie zu treffen, die eigentlich<br />
von ihm oder ihr zu treffen wären.<br />
Co-Abhängige richten ihr Leben auf den süchtigen Menschen aus – vergleichbar damit, wie<br />
der Süchtige sein Leben auf das Suchtmittel hin ausrichtet. In beiden Fällen entwickelt sich<br />
eine vergleichbare Dynamik.
8.1 Grundlegende Überlegungen<br />
37<br />
8. Die Therapie von Suchterkrankungen<br />
Aus der neurobiologischen Forschung weiß man inzwischen, dass Menschen durch frühes<br />
Leid, Vernachlässigung oder Traumatisierungen einen „biologischen Fingerabdruck“ (Bauer<br />
2008, S172) zurückbehalten, der ihr weiteres Verhalten beeinflusst. Aber, auch das belegen<br />
neue Forschungsergebnisse eindrucksvoll, Menschen sind dadurch nicht gezwungen, ihr<br />
durch die negativen Erfahrungen geprägtes Verhalten für ihre weitere Lebenszeit<br />
beizubehalten bzw. sogar an ihre Nachkommen weiterzugeben.<br />
Joachim Bauer beschreibt zwei Chancen, dem ewigen Weitergeben und Wiederholen von<br />
Mustern entgehen zu können: Als erste Chance beschreibt er die Pubertät eines Menschen, in<br />
deren Verlauf der mit dieser Lebensphase verbundene hormonelle Ansturm einen Teil des<br />
epigenetischen Fingerabdrucks, der im Gehirn bis dahin geprägt wurde, verändern bzw.<br />
löschen kann. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Jugendlichen in dieser Zeit neue,<br />
bereichernde, gesündere Erfahrungen machen können (vgl. Bauer 2008, S 173)<br />
Und: „Eine zweite Chance, der ewigen Wiederholung der erwähnten Muster zu entgehen, ist<br />
die Psychotherapie. Sie wirkt, wie vielfach gezeigt werden konnte, nicht nur auf das<br />
psychische Erleben, sondern auch auf die neurobiologischen Strukturen des Menschen.“<br />
(Bauer 2008, S 174)<br />
8.1.1 Der phänomenologische Zugang<br />
Basis der existenzanalytischen Therapie ist die Phänomenologie, die auf Brentano, Max<br />
Scheler, Edmund Husserl, Martin Heidegger und Jean Paul Sartre zurückgeht. Gemeint damit<br />
ist eine „Wesensschau“, bei der es darum geht, aufgrund von persönlichem Vertrauen und<br />
Mut auf die Dinge hinzuschauen, wie sie sich zeigen. Angestrebt werden die Unterscheidung<br />
zwischen Phantasie und Realität, d.h. es geht nicht darum, was sein könnte oder was ein<br />
Mensch über den anderen vermutet, sondern um ein freies und unvoreingenommenes<br />
Hinschauen auf das Wesen des Menschen. Ziel ist weiters ein Erkenntnisgewinn durch das<br />
Verstehen der Dinge, wobei es vorrangig nicht darum geht, Erklärungen zu suchen bzw. zu<br />
finden, sondern darum, etwas vom Wesen des anderen zu verstehen. Bei dieser<br />
Tiefenwahrnehmung geht es sowohl darum, was sich zeigt, als auch darum, was ein Mensch<br />
vom anderen erkennen kann.<br />
Helmuth Vetter vertritt dazu drei Thesen:<br />
„1. Die Phänomenologie erzieht zur Achtung vor allem Begegnenden. Das ist ihre erklärte<br />
Maxime, damit beginnt die Deskription, und dies ist die von der Phänomenologie geforderte<br />
Grundhaltung der Gelassenheit.<br />
2. Die Phänomenologie erzieht zu einem möglichst unbefangenen Sehen der Vorurteile, die<br />
in allem Denken und Tun immer schon wirksam sind. Darin liegt die Bedeutung der<br />
Thematisierung von Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff.<br />
3. Die Phänomenologie erzieht zum kritischen Blick auf andere Meinungen und nicht zuletzt<br />
auf sich selbst. Darin liegt die Aufgabe der phänomenologischen Destruktion.“ /Vetter 2007,<br />
S 9f)<br />
„Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen<br />
unsichtbar“, lässt Antoine de Saint-Exupery (1983, S72) den Fuchs zum kleinen Prinzen<br />
sagen und meint damit, dass diese Haltung der Offenheit und des Hinschauens erst
38<br />
ermöglicht, dass das Unverwechselbare jedes Wesens sich zeigen kann. Je freier, offener und<br />
ungezwungener sich ein Mensch traut hinzuschauen, umso mehr kann sich zeigen. Vorsicht<br />
ist geboten bezüglich vorschneller Interpretationen des Wahrgenommenen und Achtung ist<br />
geboten vor den Erfahrungen und dem Erleben des anderen.<br />
Phänomenologie ist weniger eine therapeutische Methode als vielmehr eine Haltung. Für die<br />
existenzanalytische Psychotherapie bedeutet dies, dass PsychotherapeutInnen zuallererst die<br />
Entscheidung treffen müssen, sich darauf einzulassen, was sich in der Begegnung mit den<br />
KlientInnen zeigen wird.<br />
Phänomenologisches Arbeiten erfordert die Hinwendung mit allen Sinnen zum Gegenüber,<br />
um sich freizugeben für die Wahrnehmung dessen, was sich vom anderen zeigt.<br />
Es braucht weiters innere Offenheit und auch den Mut, Bekanntes zurückzulassen.<br />
Vorerfahrungen brauchen und sollen nicht ignoriert werden, aber bewusst zur Seite gestellt<br />
werden, damit sie das freie „Schauen“ (die Wesensschau) nicht beeinträchtigen. Die<br />
phänomenologische Haltung verlangt vom Psychotherapeuten, dass er sich in der<br />
therapeutischen Begegnung von dem, was sich zeigt, berühren lassen kann, und sich<br />
gleichzeitig davon distanziert, um nicht in der Betroffenheit zu bleiben.<br />
Je größer das Ausmaß an innerer Sicherheit bzw. am In-sich-Ruhen ist, über das<br />
PsychotherapeutInnen verfügen und je freier in ihrem Handeln und Erleben sie sich fühlen<br />
können, umso mehr wird sich auch von den KlientInnen zeigen.<br />
Alfried Längle: „Den anderen zu verstehen heißt: zu sehen, was er meint, nicht mit anderem<br />
(besserem?) Wissen zu deuten und damit etwas hineinzulegen, das Gesagte nicht zu erweitern<br />
oder weiterzuführen, sondern herauszuheben, was in ihm enthalten ist. Vielleicht gelingt es<br />
uns manchmal, den anderen durch solch offenes Zuhören und Mitschauen besser zu<br />
verstehen, als er sich bis dahin selbst verstanden hat. Das wird als befreiend erlebt: gesehen<br />
zu werden in dem, was einem wichtig ist.“ (Längle 2007. S 20)<br />
Phänomenologische Prozesse brauchen Zeit und Geduld. Wie lange es dauert, bis sich etwas<br />
vom Wesen zeigt und bis ein Verstehen möglich ist, hängt von den jeweils interagierenden<br />
Personen ab.<br />
Eine neuere Erkenntnis aus der neurobiologischen Forschung zeigt einen ganz anderen<br />
Zugang zur Psychotherapie, auf den ich im Folgenden näher eingehen möchte:<br />
8.1.2 Der Einsatz von Spiegelneuronen in der Psychotherapie<br />
Stimmungen, Gefühle, auch Körperhaltungen wirken „ansteckend“ auf Menschen: Wer<br />
angelächelt wird, lächelt meist unbewusst zurück, wenn einer in der Runde gähnt, gähnt oft<br />
auch ein anderer, in Sitzungen nehmen Menschen die ähnliche Körperhaltung wie ihr<br />
Gegenüber ein, die Freundin fühlt mit ihrer traurigen Freundin mit, Eltern spüren, dass mit<br />
ihrem Kind etwas nicht stimmt, etc. Was aus dem Alltag den meisten von uns vertraut und<br />
bekannt ist, wurde in den letzten Jahren auch Thema in der Gehirnforschung. Joachim Bauer<br />
beschäftigt sich seit längerem intensiv mit der Frage der neurobiologischen Resonanz:<br />
„Nervenzellen, die im eigenen Körper ein bestimmtes Programm realisieren können, die aber<br />
auch dann aktiv werden, wenn man beobachtet oder auf andere Weise miterlebt, wie ein
39<br />
anderes Individuum dieses Programm in die Tat umsetzt, werden als Spiegelneurone<br />
bezeichnet.“ (Bauer 2006, S23)<br />
Spiegelneurone sorgen dafür, dass sich ein Mensch in den anderen „hineinversetzen“ kann,<br />
dass er mitfühlen kann, was der andere fühlt. Die Fähigkeit zur Empathie hängt aber<br />
wesentlich davon ab, ob und wie sehr die Spiegelsysteme funktionstüchtig sind und durch<br />
entsprechende Beziehungserfahrungen eingeübt werden konnten. Menschen, die wenig<br />
liebevolle Spiegelung erlebt haben, die sich selbst als starr, eingeengt und emotionsarm<br />
erleben, brauchen den Psychotherapeuten als Gegenüber, der das Spiegelungsgeschehen (oft<br />
zum ersten Mal in ihrem Leben) in Gang bringt: „Dazu müssen sie ermutigt werden, darüber<br />
zu sprechen, wie sie ihr Leben und ihren Kontakt zu anderen, auch zum Therapeuten,<br />
wahrnehmen. Umgekehrt sollte auch der Therapeut den Patienten in behutsamer,<br />
anfragender Weise immer wieder darauf ansprechen, wie er (der Therapeut) ihn (den<br />
Patienten) jetzt gerade erlebt und welche Vorstellungen er von den im Moment im Patienten<br />
vermutlich vorhandenen Gefühlen hat.“ (Bauer 2006, S 139)<br />
Spiegelsysteme können daher mit dazu beitragen, dass der Psychotherapeut einen ersten<br />
Eindruck, ein erstes Gefühl von seinem Gegenüber gewinnen kann. Durch die Haltung der<br />
phänomenologischen Offenheit kann der Psychotherapeut allerdings diesen ersten Eindruck<br />
bewusst „zur Seite schieben“ („Epoché“) und noch einmal auf die Situation hinschauen, was<br />
und wie es sich ihm zeigt. Für die phänomenologische Haltung in der Therapie braucht es<br />
daher eine ganz bewusste Entscheidung des Therapeuten und ein Zurückstellen der Impulse.<br />
Zu diesem Thema komme ich etwas später, wo es in Annas Therapie um das Thema<br />
Beziehungsaufnahme geht, noch ausführlicher.<br />
8.1.3 Die persönliche Haltung von PsychotherapeutInnen<br />
Zusätzlich zur phänomenologischen Haltung und zum theoretischen Wissen über<br />
Krankheitsbilder, Methoden und Techniken, sind auch persönliche Einstellungen bzw.<br />
Haltungen von PsychotherapeutInnen wesentlich. Dazu gehören vor allem Wertschätzung,<br />
Achtung und Respekt vor den KlientInnen: vor ihren Ansichten und Meinungen, ihren<br />
Lebenserfahrungen, ihren bisherigen Problembewältigungsversuchen – auch wenn sie<br />
erfolglos oder sogar kontraproduktiv waren – und ihren Lebenszielen.<br />
Die psychotherapeutische Begegnung muss auf der Ebene des Personalen eine gleichwertige,<br />
gleichrangige sein. Dort, wo der Klient sich nicht geachtet und respektiert fühlen kann, dort<br />
kann er es auch nicht wagen, seine Schwächen und Verletzlichkeit zu zeigen.<br />
8.2 Der Beginn der Psychotherapie<br />
Das Gebot von Achtung und Respekt vor der Lebenssituation von KlientInnen gilt in ganz<br />
besonderer Weise für suchtkranke Menschen: An ihnen haftet ohnehin der Makel der<br />
„Charakterschwäche“ und der „Willensschwäche“, auch das Anrüchige des Dunklen und<br />
Verbotenen. Sie leiden häufig nicht nur unter den (manchmal nur befürchteten, häufig aber<br />
realen) negativen Bewertungen ihrer Umgebung, sondern auch unter ihrer eigenen<br />
Enttäuschung, weil ihnen der Ausstieg aus der Sucht nicht gelingen will. Scham und<br />
Frustration sind häufige Begleiter von Suchtkranken.<br />
Auch Anna kam in dieser Haltung des Beschämt- und Bedrückt-Seins zu mir. Sie kam auch<br />
nicht ganz freiwillig, sondern auf dringende Empfehlung der Sozialarbeiterin am<br />
Landeskrankenhaus, wo sie sich zur vierwöchigen stationären Behandlung einer
40<br />
psychotischen Episode befunden hatte. Sie kam zusätzlich angetrieben von einer vagen,<br />
unausgesprochenen Befürchtung, die Sozialarbeiterin des Jugendamtes könnte ihr mit der<br />
Abnahme ihres Sohnes drohen, wenn Anna sich nicht zu einer konsequenten<br />
Drogenausstiegstherapie entscheiden würde.<br />
Anna war also wesentlich stärker von außen gedrängt als von innen motiviert. Das innere<br />
Bedürfnis, für sich selber etwas zum Positiven zu verändern, konnte sie noch nicht<br />
wahrnehmen. Sie selber wäre sich diesen mühsamen Weg nicht wert gewesen. Ein ganz<br />
starker Wert war und ist für Anna aber die Beziehung zu ihrem Sohn: um ihn nicht zu<br />
verlieren (bzw. um gar nicht in die Nähe einer solchen Möglichkeit zu geraten), war Anna<br />
auch zu diesem Schritt bereit.<br />
„ Es braucht Mut, Entschlossenheit und Einsatz, wenn man ein belastetes Leben ändern will,<br />
man muss auch manche Unbequemlichkeit auf sich nehmen und es braucht vor allem Geduld.<br />
Von Rückschlägen darf man sich nicht entmutigen lassen. Es geht darum, Veränderung zu<br />
wollen, nicht aufzugeben, sich dazu zu entschließen, dass man sein Schicksal ändern will,<br />
Negativzuschreibungen zu beenden und geduldig an Veränderungen zu arbeiten.“<br />
(Reddemann 2011, S 52)<br />
Anna hat, auch ohne diese Worte von Luise Reddemann zu kennen, alle diese<br />
Voraussetzungen mitgebracht.<br />
Im Erstgespräch schilderte Anna ihre bisherige Krankengeschichte, wobei klar wurde, dass<br />
Drogen sie bereits seit ihrem 14. Lebensjahr begleiteten. Im Zuge der Anamnese wurde aber<br />
auch deutlich, dass Annas Leben von Beginn an durch die Trinksucht des Vaters belastet war.<br />
Sie war also eigentlich noch nie drogenfrei gewesen.<br />
Anna machte auf mich im Erstkontakt einen ruhigen, zurückhalten, abwartenden Eindruck.<br />
Auffallend waren ihre Langsamkeit, sowohl in ihrer Motorik als auch in ihrer Sprechweise:<br />
sie wirkte müde und träge. Verständlich wird dies im Zusammenhang mit ihrem langjährigen<br />
Cannabiskonsum. Sie war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt und Mutter eines Kleinkindes,<br />
wirkte auf mich aber wie eine Schülerin, die ein wenig ängstlich das Urteil ihrer Lehrerin<br />
erwartete. Sie machte auch den Eindruck eines Menschen, der sich daran gewöhnt hat, von<br />
anderen beurteilt zu werden und erschien mir insgesamt passiv, ein wenig lethargisch und<br />
sehr nachgebend. Anna war allerdings zu diesem Zeitpunkt noch im aktiven Drogenkonsum,<br />
d. h. diese Verhaltensweisen waren Nebenerscheinungen ihrer Sucht, nicht ihres eigentlichen<br />
Wesens.<br />
Bei mir war von Beginn an viel Sympathie für Anna vorhanden, ich empfand auch Mitgefühl<br />
für ihre schwierige Lebenssituation und Respekt davor, wie sie sich durch ihr Leben kämpfte.<br />
Ich fühlte mich auch von der Tatsache angezogen, dass wir beide Kinder im gleichen Alter<br />
haben, fragte mich aber natürlich, wie dieses Leben denn für Annas Sohn sein müsste<br />
Bei mir tauchte aber auch eine Mischung aus Unsicherheit, Neugier und Angst auf, weil ich<br />
zu diesem Zeitpunkt – abgesehen von theoretischem Wissen – noch keine praktische<br />
therapeutische Erfahrungen mit suchtkranken Menschen gemacht hatte. Ich hatte aber auch<br />
das Gefühl, in Anna nicht vorrangig den Junkie, sondern die schwache und verletzte Person<br />
sehen zu können und entschied mich daher dafür, diese Herausforderung anzunehmen und in<br />
Begleitung der Supervision mit Anna zu arbeiten.<br />
Für Anna war meine Ambivalenz möglicherweise auch spürbar gewesen, weil sie mich bereits<br />
in der 2. Stunde, eine Woche später darauf ansprach. Sie habe den Eindruck gehabt, ich hätte<br />
„eher negativ“ auf ihren bisherigen Drogenkonsum reagiert. Sie wollte auch ganz konkret<br />
wissen, ob ich sie dafür abwerten oder gar verurteilen würde. Ich war beeindruckt von ihrer<br />
Offenheit und ihrem Mut, mich darauf anzusprechen. Ehrlichen Herzens konnte ich ihr<br />
antworten, dass ich sie, Anna, weder abwerten noch verurteilen würde. Ich hätte tatsächlich
41<br />
eine negative Haltung, allerdings nicht ihr – oder anderen suchtkranken Menschen –<br />
gegenüber, sondern zu Drogen und Suchtmitteln. Ich sei der festen Überzeugung, dass<br />
Drogenmissbrauch auf uns Menschen gravierende schädliche Auswirkungen hat, die das<br />
Leben beeinträchtigen und häufig sogar zerstören könnten.<br />
Mir war wichtig, Anna meine klare Haltung zu Drogenmissbrauch von Beginn an mitzuteilen,<br />
damit sie sich daran orientieren und festigen könnte. Mir war aber auch wichtig, zu<br />
differenzieren zwischen meiner Haltung zu Suchtmitteln einerseits und zu den suchtkranken<br />
Menschen andrerseits.<br />
Mein Einstieg in die Psychotherapie mit Anna fand, sichtbar gemacht am Thema meiner<br />
Haltung zu Drogen, auf der Ebene der ersten Grundmotivation statt: Anna brauchte Schutz,<br />
Raum und Halt.<br />
Sie hatte zu diesem Zeitpunkt keine erwachsene, verlässliche Bezugsperson, die ihr auf ihrem<br />
Weg zur Veränderung beistehen konnte. Der Kindesvater, der selber schwer drogensüchtig<br />
ist, hatte sich bereits vor Jahren von ihr getrennt. Die Kontakte zwischen den beiden, die<br />
wegen dem gemeinsamen Kind erforderlich waren, gestalteten sich konfliktreich. Ihre Mutter<br />
stand zwar in Krisensituationen immer zur Verfügung und half ihr bei konkreten<br />
Alltagserledigungen oder bei der Kinderbetreuung. Eine hilfreiche Gesprächspartnerin war sie<br />
für Anna aber nicht. Der Vater war aufgrund seiner Alkoholsucht nicht hilfreich, der jüngere<br />
Bruder wegen seiner Cannabisabhängigkeit selber zutiefst bedürftig. Zum älteren Bruder hatte<br />
Anna nie eine enge, vertrauensvolle Beziehung. Einzig ihre Schwester war ihr eine<br />
zuverlässige Stütze. Es gab noch einige Freundinnen, mit denen Anna zwar Kontakt hatte,<br />
aber keine wirkliche enge Beziehung pflegte.<br />
Anna brauchte einen geschützten Raum, in dem sie sich sicher fühlen konnte und wo sie<br />
beginnen konnte, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen. Sie brauchte den Halt, den sie selber<br />
in sich nicht hatte, durch eine außenstehende, stabile erwachsene Person.<br />
Wir haben unsere therapeutische Arbeit damit begonnen, mit Anna den äußeren Rahmen<br />
unserer Therapie zu strukturieren und legten ganz verbindliche Termine und Regeln fest.<br />
Dazu gehörten Pünktlichkeit, Zeitplan, strukturierte Abläufe, Informationen meinerseits<br />
betreffend Verschwiegenheitspflicht, etc.<br />
Dadurch ist für Anna ein klar umrissener Raum entstanden, in dem sie sich sicher und<br />
geschützt fühlen konnte. Die Klärung meiner Haltung zu Drogenmissbrauch gleich in der<br />
zweiten Therapiestunde gab ihr zusätzlich Halt.<br />
Sicherheit und Halt gaben ihr auch die Gewissheit, dass ich als ihre Therapeutin ihren<br />
jahrelangen Drogenmissbrauch aushalten konnte. Anna konnte spüren, dass ich in der Lage<br />
war, mir ihre Geschichte anzuhören, dass ich mit ihr mitfühlte und dass ich weder zu<br />
erschrocken noch zu ängstlich war, um mich gemeinsam mit Anna diesen Dämonen entgegen<br />
zu stellen. Sie spürte aber, dass ich durchaus ein wenig erschrocken und ängstlich auf ihre<br />
Schilderungen in der ersten Stunde reagiert hatte. Nach der gemeinsamen Klärung, worauf<br />
sich meine Ängstlichkeit und mein Erschrecken bezogen hatten, wurde es auch für Anna<br />
zunehmend möglich, sich der Realität Schritt für Schritt zu stellen.<br />
Mir war wichtig, Anna auch meine Wertschätzung und meinen Respekt ihr gegenüber zum<br />
Ausdruck zu bringen. Sie sollte in der Therapie das Gefühl des Angenommen-Seins und der<br />
Akzeptanz wahrnehmen lernen. In den ersten Therapiestunden konnte Anna dadurch, dass sie<br />
durch mich Schutz, Raum und Halt erlebte, langsam beginnen, Beziehung zu mir<br />
aufzunehmen und Vertrauen zu fassen. Sie blieb dabei immer vorsichtig und zurückhaltend,<br />
immer ein wenig auf der Hut.
42<br />
„Du musst sehr geduldig sein.“ Sagt Saint-Exuperys Fuchs zum Kleinen Prinzen (1983, S<br />
67). „Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein<br />
bisschen näher setzen können….“<br />
8.3 Der Therapieverlauf<br />
In den ersten 15 Stunden der Therapie ging es in erster Linie um den Aufbau einer<br />
vertrauensvollen Beziehung zwischen Anna und mir. In dieser Zeit lag ein Schwerpunkt<br />
unserer Arbeit auf der Ebene der 2. Grundmotivation, aber auch auf der Ebene der 3.<br />
Grundmotivation: unsere Themen waren Beziehung, zu sich selbst und zu anderen, und<br />
die Stärkung des Ichs. Anna brauchte von mir immer wieder viel Bestätigung und<br />
Ermunterung, viele positive Rückmeldungen und Bestärkungen. Sie war sehr unsicher und<br />
vorsichtig; sie war auch ängstlich darauf bedacht, alles richtig zu machen. Ganz banale<br />
Alltagssituationen, z.B. wenn die Kindergärtnerin ihres Sohnes sie auf die vergessene<br />
Bezahlung des Bastelbeitrag hinwies, konnten sie sehr aus dem Gleichgewicht bringen und zu<br />
Selbstbeschuldigungen und äußerst strengen Beurteilungen ihrer selbst führen. Solche<br />
Situationen brachten Anna auch zu ausführlichen Phantasien darüber, wie denn die<br />
Kindergärtnerin jetzt über sie als Mutter denke: auch diese Phantasien waren durchwegs<br />
negativ gefärbt.<br />
Parallel dazu lernte Anna in dieser Phase einen 20 Jahre älteren Mann kennen, in den sie sich<br />
sehr heftig und übergangslos verliebte. Dieser Mann passte, abgesehen vom<br />
Altersunterschied, in ihr bisheriges „Partnermuster“: er gehörte zur alternativen Szene, war<br />
Musiker und langjähriger Cannabis-Konsument. Anna war zu Beginn der Beziehung sehr<br />
glücklich. Fast euphorisch, alles sei „so perfekt!“<br />
Bereits nach drei Wochen war es nicht mehr ganz so perfekt: Annas Freund begann, Kritik an<br />
ihr zu üben (z. B. wegen ihres hohen Schlafkonsums tagsüber) und gleichzeitig, Ansprüche<br />
und Forderungen an sie zu stellen. Er wollte auch gern bei ihr einziehen, weil er gern eine<br />
„Familie“ haben wollte. (Er hatte bereits mehrere Ex-Frauen bzw. -Freundinnen und auch<br />
Kinder aus verschiedenen Beziehungen.) Anna „flüchtete“, indem sie für einige Tage den<br />
Kontakt zu ihm abbrach und trennte sich danach von ihm, weil sie sich nicht in der Lage sah,<br />
seinen Forderungen standzuhalten bzw. ihre eigenen Vorstellungen dem gegenüber zu stellen.<br />
Dabei wurden mehrere Aspekte deutlich, die wir in der Therapie bearbeiteten: zum einen<br />
Annas großes Bedürfnis und ihre Sehnsucht nach einem Partner und zum anderen ihre große<br />
Schwierigkeit, für sich einzutreten bzw. ihre Tendenz, Konfrontationen auszuweichen.<br />
Anna lernte in der Therapie erstmals, sich selber zu sehen. Sie lernte wahrzunehmen, wie<br />
ausweichend und ängstlich sie sich zu diesen Konflikten in ihrer Beziehung (und auch in<br />
anderen Beziehungen) stellte. Sie erkannte, wie schwer es ihr fiel, für sich selber einzutreten.<br />
Dies konnte ihr gelingen, weil sie sich bei mir mittlerweile sicher und geschützt fühlen<br />
konnte. Sie konnte aushalten und annehmen, dass und wie ich sie sah und mich ihr<br />
zuwendete. Dadurch konnte auch Anna ihren Blick auf sich richten und sich langsam sich<br />
selber zuwenden. Auch in diesem Prozess war sie langsam und vorsichtig. Ich bestärkte sie in<br />
ihrer Umsicht: sie begann dadurch, Achtsamkeit und Sorgsamkeit sich selbst gegenüber zu<br />
entwickeln.<br />
In der Supervision zeigte sich, dass Anna in ihrem Leben auch noch viel an Struktur schaffen<br />
sollte, um zu mehr Stabilität zu gelangen. Wir legten daher in den nächsten Wochen - parallel<br />
zur Vertiefung unserer Beziehung – den Schwerpunkt unserer Arbeit auf zwei Themen: die<br />
Betreuung ihres Sohnes und die Arbeitssuche.
43<br />
Anna hatte ihren Sohn bisher erst am späten Morgen in den Kindergarten gebracht, weil sie in<br />
der Früh lange schliefen. Dort blieb er bis spätnachmittags, weil Anna auch tagsüber viel<br />
schlief. Diesen Rhythmus hat Anna langsam geändert, indem sie sich um einen geregelten<br />
Tagesablauf bemühte. Dadurch konnte sie ihren Sohn schon viel früher in den Kindergarten<br />
bringen und auch wesentlich früher abholen, sodass den beiden am Nachmittag viel mehr<br />
gemeinsame Zeit zur Verfügung stand. Die positive Reaktion ihres Sohnes und auch meine<br />
unterstützende Rückmeldung haben Anna sehr darin bestärkt und ermutigt, weiter an<br />
konkreten Veränderungen zu arbeiten. Erstmalig hat Anna dadurch ein Gefühl von positiver<br />
Selbstwirksamkeit erfahren.<br />
Sie begann danach auch wesentlich motivierter mit der Arbeitssuche und fand bald ein<br />
bezahltes Praktikum bei einem Grafiker, das ihr inhaltlich sehr gefiel und das ihr auch noch<br />
genügend Zeit für die Betreuung ihres Sohnes ließ.<br />
Anna besorgte sich – erstmals in ihrem Leben! – einen Kalender und lernte weiter, ihren<br />
Alltag zu strukturieren. Sie hatte sich Termine bisher nur „gemerkt“ (oder auch nicht; in den<br />
ersten Monaten unserer Arbeit hat sie mehrere Termine bei mir vergessen), jetzt aber wurden<br />
alle Termine, die sie oder ihr Kind betrafen, in den Kalender eingetragen und erhielten damit<br />
mehr Verbindlichkeit. Für Anna waren diese kleinen Erfolgserlebnisse wie Schlüsselszenen:<br />
sie lernte, wie sie selber etwas dazu beitragen konnte, ihr Leben zum positiven zu verändern.<br />
Sie setzte sich in der Folge kleine, ganz konkrete Ziele (z. B. mehr Kontakt mit einigen<br />
Familienmitgliedern zu verbringen, mehr Sport machen, etc.), die sie durchaus mit<br />
Konsequenz verfolgte.<br />
Durch diese positiven Erlebnisse wurde Anna insgesamt mutiger und begann, sich auch an<br />
schwierige Themen ihrer Persönlichkeitsentwicklung heranzuwagen: Sie wollte daran<br />
arbeiten, mehr Vertrauen zu sich selbst zu haben, weniger Angst vor anderen zu haben, mit<br />
Kritik besser umgehen zu können und sich gegen ihren Ex-Lebenspartner und Vater ihres<br />
Kindes (der selber sehr massiv im Drogenmilieu aktiv ist) besser behaupten zu können.<br />
Bezüglich dieses Mannes hatte Anna eine sehr ängstliche, fast devote Haltung. Sie ließ sich z.<br />
B. darauf ein, dass er ihr den Unterhalt für ihren Sohn immer in bar bezahlte, anstatt es auf ihr<br />
Konto zu überweisen. Sie äußerte sich auch sehr unklar über die Herkunft des Geldes, bzw.<br />
ließ durchblicken, dass es aus unsauberen Einkünften stamme.<br />
In der Supervision war dies mehrmals Thema und wir überlegten gemeinsam, auf welche<br />
Weise wir Anna dabei unterstützen könnten, sich gegenüber ihrem Ex-Freund zu<br />
positionieren. Wichtig erschien, Anna ganz klar zu vermitteln: „Egal, was Sie früher getan<br />
haben, womit Sie Ihr Geld verdient haben und was Ihr Ex-Freund möglicherweise gegen Sie<br />
in der Hand hat - ich kann es aushalten und schicke Sie nicht weg!“. Anna war nicht in der<br />
Lage, klar auszusprechen, wo dieses Geld herkommt. Dazu hatte sie letztendlich zu viel Angst<br />
– und zu wenig Vertrauen. Sie schämte sich für etwas, worüber sie mit mir nicht sprechen<br />
konnte. Ich spürte, wie wichtig es war, diese Scham zu respektieren und Anna nicht zur<br />
Bloßstellung zu zwingen. Das wäre schamlos gewesen. Ich vertraute darauf, dass Anna zum<br />
für sie richtigen Zeitpunkt die Scham ablegen würde. Meine diesbezügliche Rückmeldung hat<br />
Anna sehr entlastet.<br />
Von diesem Thema abgesehen, machte Anna sehr gute Fortschritte. Sie machte einen<br />
zunehmend stabilen, zufriedenen, ausgeglichenen Eindruck. Nach ihren eigenen Angaben war<br />
sie die ganze Zeit über drogenfrei und wirkte dementsprechend fit, orientiert, klar und<br />
konzentriert. Die Trägheit und das Schläfrige waren aus ihrem Wesen verschwunden und<br />
hatten lebhaften, interessierten, humorvollen Zügen Platz gemacht. Sie sagte selber mehrmals,<br />
sie sei seit ihrem 14. Lebensjahr nicht mehr so glücklich gewesen und habe sich so wohl<br />
gefühlt.
44<br />
Es gelang Anna auch, eine Arbeitsstelle im grafischen Bereich zu finden, die inhaltlich und<br />
organisatorisch genau ihren Vorstellungen entsprach, auch wenn sie den Chef als etwas<br />
„zickig“ erlebte. (Womit sie leider Recht behalten sollte!)<br />
Jetzt, wo sie ihren Alltag so gut im Griff hatte (sie war regelrecht begeistert darüber, wie<br />
hilfreich ein Terminkalender sein kann!), konnte sie sich in der Therapie ihren persönlichen<br />
Themen zuwenden. Der Boden dafür war geschaffen, wir hatten eine gute Beziehung<br />
zueinander aufgebaut und konnten uns nun vorsichtig ihrer Person zuwenden.<br />
Den Ausführungen in den vorangegangen Kapiteln folgend, kann aus existenzanalytischer<br />
Sicht die Entstehung von Suchterkrankungen auf Verletzungen bzw. Beeinträchtigungen auf<br />
die Ebenen aller vier Grundmotivationen zurückgeführt werden. Am massivsten in den<br />
Folgewirkungen sind aber Störungen auf der Ebene der 3. Grundmotivation: Dort, wo die<br />
Person in ihrer frühen Entwicklung gestört oder behindert worden ist, wo sie nicht gesehen<br />
und nicht beachtet worden ist, dort kann der Grundstein für spätere Suchterkrankungen gelegt<br />
werden. In der existenzanalytischen Suchttherapie muss es nun m.E. darum gehen, das hier<br />
Versäumte aufzuholen bzw. Schädigungen zu bearbeiten.<br />
Süchtig-Sein und Person-Sein schließen einander aus: Wer ganz Person ist, wer stimmig mit<br />
sich ist und in einer guten Beziehung zu sich selbst und anderen steht, wer achtsam mit sich<br />
und anderen umgeht, wer zu dem, was und wie er ist, ohne Angst stehen kann – der braucht<br />
sich in keine Abhängigkeit begeben. Aus der Sicht der suchtkranken Menschen würde dies<br />
bedeuten, dass die Drogen als „Hilfsmittel“ dienen, um ihr Person-Sein aufrechthalten zu<br />
können, um ihren Schmerz ertragen zu können und nicht mehr so viel fühlen zu müssen.<br />
Bei Anna wurde die Entwicklung ihres Person-Seins in ihrer Familie nicht gefördert. Sie<br />
wurde zu wenig beachtet, sie wurde nicht genug gesehen und nicht ernst genug genommen.<br />
Dadurch hat sie aber auch nicht gelernt, auf sich selbst zu achten und sich selbst ernst zu<br />
nehmen. Anna ist in ihrem bisherigen Leben viel zu selten ernsthaft gefragt worden: „Was<br />
sagst denn du dazu?“ und hat auch nie gelernt, sich selber diese Frage mit der nötigen<br />
Ernsthaftigkeit zu stellen. In der Therapie war dies für Anna völliges Neuland. Sie begab sich<br />
aber mit großem Mut und Engagement auf diese Entdeckungsreise zu ihrem eigenen Ich: Das<br />
gleiche Interesse und die gleiche Offenheit, die sie in die Welt der Drogen geführt hatten (sie<br />
hatte vor allem zu Beginn der Therapie noch mit einer gewissen Begeisterung in der Stimme<br />
von den „bewusstseinserweiternden“ und „faszinierenden“ fremden Welten der Drogen<br />
berichtet), brachten sie auch jetzt in Bewegung.<br />
Wir arbeiteten mit Anna vor allem mit der Methode der Personalen Existenzanalyse (PEA),<br />
in deren vier Schritten der Mensch sein Person-Sein vollzieht:<br />
PEA 0: Hier geht es im ersten Schritt um das Beschreiben des Faktischen: Was ist genau<br />
geschehen? Die Basis jedes Gesprächs ist die Realität; das Ziel ist Sachlichkeit.<br />
PEA 1: Im zweiten Schritt erfolgt eine phänomenologische Analyse, d. h. das Auffinden<br />
ursprünglicher Eindrücke und Empfindungen: Wie war das für mich? Wie habe ich es<br />
erlebt? Das Ziel ist das Erfassen des Wesentlichen im Eindruck.<br />
PEA 2: Im dritten Schritt erfolgt die innere Stellungnahme, d. h. durch Selbstdistanzierung<br />
soll das Neue mit dem Bestehenden in Beziehung gebracht werden: Was halte ich davon?<br />
Was sage ich dazu?<br />
PEA 3: Im vierten und letzten Schritt geht es um die äußere Stellungnahme, d. h. das<br />
Handeln: Was wäre jetzt richtig, zu tun oder zu sagen? Eine adäquate Antwort soll erarbeitet<br />
werden.
45<br />
Anna mochte diese Methode. Die umfassende Betrachtungsweise eines Themas gefiel ihr und<br />
kam ihrem Wesen entgegen. Sie lernte auch rasch, die Fragestellungen mit in ihren Alltag zu<br />
nehmen und quasi als Hausübung sich bei vielen Situationen zu fragen: „Was ist da<br />
eigentlich? Wie fühlt es sich für mich an? Wie stehe ich dazu? Was wäre jetzt gut zu tun?“<br />
Anna übte an ganz banalen Situationen (z. B. ein etwas angespanntes Familienmittagessen),<br />
aber auch in schwierigeren Konflikten mit ihrem Chef.<br />
Es machte ihr spürbar Freude, sich so näher zu kommen, kennen zu lernen, ihr Ich zu stärken<br />
und ihr Person-Sein zu entwickeln. Mir machte es in dieser Zeit ebenfalls besondere Freude,<br />
mit Anna zu arbeiten.<br />
Anna litt darunter, immer noch so streng zu sich zu sein bzw. das Gefühl zu haben, es nie gut<br />
genug machen zu können. Sie habe in sich eine ganz strenge, Gott-ähnliche Gewissensinstanz,<br />
die ihr ständig sage, was richtig oder falsch ist. Diese strenge Instanz abzuschaffen, sei ganz<br />
unmöglich. Auf meine Frage, ob es vorstellbar sei, zu dieser Instanz ihre eigenen,<br />
persönlichen Ansichten und Meinungen quasi dazu zu stellen, konnte sie gut eingehen. In der<br />
nächsten Zeit übte sie, zu den auftauchenden Fragen immer das Eigene zu finden mit der<br />
Frage „Was sage ICH dazu?“. Sie machte gute Fortschritte und konnte dies auch selber so<br />
sehen.<br />
Meine therapeutische Intention war, das Eigene in Anna immer mehr zu stärken, damit sie<br />
gegen das Fremde (die Sucht) besser gewappnet sein konnte. Je mehr sie ihr Person-Sein<br />
entwickeln würde, umso weniger würde sie die Sucht brauchen, war meine Überzeugung. Wir<br />
haben daher den Schwerpunkt unserer Arbeit darauf gelegt, Anna in allen Bereichen ihrer<br />
Person zu stärken: herauszufinden, was sie mag bzw. nicht mag, mehr Beziehung zu sich<br />
selbst und zu anderen zu bekommen, herauszufinden, was sie für richtig bzw. falsch hält, etc.<br />
Diese positive Entwicklung wurde durch einen Vorfall mit ihrem Sohn unterbrochen, der von<br />
einem Besuchswochenende bei seinem Vater mit einem zusammengerollten Geldschein in der<br />
Hosentasche, mit weißem Pulver bestäubt, zurückkehrte. Anna wirkte bei der Schilderung der<br />
Situation wie betäubt. Real war ihr die Botschaft völlig klar: ihr Ex-Partner macht kein<br />
Geheimnis aus seinem Drogenkonsum in Gegenwart ihres gemeinsamen Kindes. Anna konnte<br />
weder Wut noch Empörung verspüren, fühlte sich schwach und hilflos. Sie war überwältigt<br />
von Schmerz und Schuld darüber, dass sie der Verantwortung für ihren Sohn so wenig gerecht<br />
wurde. An Konsequenzen für ihren Ex-Freund konnte sie nicht denken. Im Gegenteil hielt sie<br />
noch immer fest am Idealbild einer Familie, die sie für ihren Sohn erhalten wollte. Sie wolle<br />
ihm nicht den Vater wegnehmen.<br />
Ich war in dieser Situation sehr besorgt um Anna und ihren Sohn und verspürte in mir viel<br />
Wut auf ihren Ex-Freund, der so verantwortungs- und rücksichtslos mit dem Kind umging.<br />
Anna konnte mit meiner Wut überhaupt nichts anfangen, dieses Gefühl war in dieser Situation<br />
völlig fremd. Sie fühlte sich auch in der Beziehung zu ihrem Ex-Freund viel zu unsicher, als<br />
dass sie hätte die Wut zulassen können.<br />
Zu meiner Sorge um Anna und ihren Sohn kam auch das ganz starke Bedürfnis, das Kind<br />
schützen zu wollen. Anna war dazu nicht ausreichend in der Lage.<br />
Für mich war wichtig, diese Thematik rasch in die Supervision zu bringen, um mir<br />
Unterstützung von meiner Supervisorin und der Gruppe hinsichtlich der weiteren<br />
Vorgangsweise zu holen. Wir haben auch ganz konkrete Fragen hinsichtlich des Schutzes des<br />
Kindes besprochen bzw. Unterstützungsmöglichkeiten für Anna überlegt.<br />
In den nächsten Stunden war vor allem wichtig, Anna zu stützen und zu stabilisieren, damit<br />
sie diese Krise durchstehen konnte. Wir haben auch erarbeitet, was sie und ihr Sohn in dieser
46<br />
Situation brauchen: Anna hat von sich aus beschlossen (und wurde dabei sehr von mir<br />
unterstützt), dass sie bis auf weiteres keine Übernachtungen ihres Kindes beim Vater mehr<br />
erlaube und dass der Kindesvater ihren Sohn nur noch stundenweise in Anwesenheit von<br />
bestimmten Personen, die Annas Vertrauen genießen, sehen könne. Wir beschlossen auch,<br />
dass Anna Schule und Hort informieren sollte, dass der Kindesvater das Kind ohne Annas<br />
Zustimmung nicht abholen dürfe. Diese Vorgangsweise haben wir in der Therapie mehrfach<br />
besprochen und abgesichert, sodass Anna gut bei sich bleiben konnte und den Vorwürfen und<br />
Angriffen ihres Ex-Lebenspartners gut standhalten konnte.<br />
Sie konnte auch in Folge zu dieser Entscheidung stehen, litt aber sehr darunter, dass der<br />
Kindesvater in den folgenden drei Monaten ihren Sohn kein einziges Mal angerufen hat –<br />
nicht einmal zu Weihnachten. Auch das Angebot von Besuchen (allerdings in Anwesenheit<br />
von Annas Vertrauenspersonen) hat der Vater nicht genützt.<br />
Für Anna war dies sehr schmerzhaft, weil sie mit ihren Vorstellungen und Sehnsüchten nach<br />
einer „heilen Familie“ konfrontiert wurde. Anna lernte, trotz ihres Schmerzes auf die Realität<br />
hinzuschauen und begann auch, sich mit ihrer eigenen Beziehung zu ihrem Vater<br />
auseinanderzusetzen. Diese Zeit brachte viel Trauer in unsere Stunden. Anna musste sich<br />
auch der Tatsache stellen, dass ihr eigener Vater für sie nicht als Bindungs- und<br />
Beziehungsperson zur Verfügung gestanden hatte.<br />
Parallel dazu wurde in dieser Zeit die berufliche Situation für Anna immer schwieriger: sie<br />
bekam von ihrem Chef immer seltener klare und eindeutige Anweisungen – und nach<br />
Fertigstellung ihrer Projekte dafür viel Kritik, weil sie nicht seinen Vorstellungen<br />
entsprachen. Seine Impulsivität und Unberechenbarkeit, verbunden mit Alkoholkonsum (sein<br />
Spitzname in der Firma war bezeichnenderweise „Whiskey“) verunsicherten sie sehr. Nach<br />
einer besonders heftigen Eskalation kündigte Anna.<br />
Danach kam sie einerseits erleichtert, andrerseits aber sehr verunsichert in die Stunde. Sie<br />
fühle sich schwach und unsicher und war sehr im Zweifel wegen der Kündigung, ob sie dies<br />
richtig gemacht habe. Es gab auch in ihrer Familie einige kritische Anmerkungen zu Annas<br />
Verhalten (i. S. v. „ Das muss man eben aushalten!“).<br />
Deutlich wurde wieder ihre Angst, in Konfliktsituationen nicht standhalten zu können und wie<br />
schwer es ihr fiel (aus ihrer Lebensgeschichte heraus verständlich!), zu sich selbst stehen zu<br />
können. Hier zeigte sich, wie fragil der Boden immer noch war, auf dem Anna sich bewegte.<br />
Es gelang uns aber in den nächsten Stunden gut, Annas Blick wieder auf sie selbst zu richten<br />
und herauszuarbeiten, was denn für sie gut und richtig sei. Anna erlebte ihre Entscheidung,<br />
diese Stelle zu kündigen, nach einer kurzen Phase der Unsicherheit, als absolut richtig. Sie<br />
konnte dies auch nach außen hin, z. B. gegenüber ihrer Familie oder ihrer Betreuerin vom<br />
Arbeitsamt, gut vertreten.<br />
In der Supervision wurde besprochen, dass die weitere Stabilisierung von Anna ganz wichtig<br />
sei. Es gebe viele unbearbeitete Themen in Annas Leben, aber vorrangig sei es, Annas<br />
Struktur zu festigen. Die Supervisionsgruppe hatte aber auch, so wie ich selbst, den Eindruck,<br />
dass Anna zunehmend an Boden, Sicherheit und Struktur gewann.<br />
Die folgenden Wochen brachten für Anna eine sehr schwierige Phase. Sie hatte, offensichtlich<br />
um den Druck und die Anspannung der letzten Zeit bewältigen zu können, zu einem für sie<br />
vertrauten Entspannungsmittel gegriffen und einen Joint geraucht. Dies brachte sie in<br />
Psychose ähnliche Zustände: Sie fühlte sich total ängstlich, hatte das Gefühl, „sie löse sich<br />
auf“, konnte sich selbst nicht mehr spüren, hörte Stimmen (von außen, die ihr sagten, was sie<br />
tun sollte), etc.<br />
Ich versuchte, sie zu einem stationären Aufenthalt zu bewegen. Anna lehnte dies ab und hatte<br />
dabei auch sehr viel Unterstützung von ihrer Mutter, die einen Klinikaufenthalt auch nicht für
47<br />
notwendig hielt. Innerhalb der nächsten Tage habe ich in mehreren Gesprächen und<br />
Telefonaten versucht, Anna und ihre Mutter von den positiven Effekten eines stationären<br />
Aufenthalts zu überzeugen. Schließlich erklärte Anna sich dazu bereit, wurde aber leider an<br />
der Klinik wegen Platzmangels und der Begründung, ihr Zustand sei „eh nicht so akut“,<br />
abgewiesen. Sie wurde medikamentös versorgt und sollte wöchentlich zu Kontrollen<br />
kommen.<br />
In dieser Zeit lebte Anna mit ihrem Sohn bei ihren Eltern, die sich sehr um die beiden<br />
kümmerten und auch für den regelmäßigen Schulbesuch des Kindes sorgten.<br />
Anna ging es relativ rasch wieder deutlich besser und konnte wieder zwischen und sich und<br />
den anderen differenzieren. Sie fühlte sich nicht mehr so „aufgelöst“, brauchte aber etliche<br />
Wochen, um sich wieder ganz zu erholen. Für Anna war dieser Einbruch so massiv, dass sie<br />
diese Zeit später als „Wendepunkt“ bezeichnete und schwor, dass sie in Zukunft keine Drogen<br />
mehr anrühren werde. Sie habe sich in ihrem Leben schon öfter überlegt, dass es besser wäre,<br />
ohne Drogen zu leben, aber so entschlossen wie jetzt sei sie noch nie gewesen.<br />
Anna sagte mir, sie habe den Joint gebraucht, „um den Druck auszuhalten. Es war mir<br />
einfach alles zu viel!“.<br />
Für mich stellte sich in der Supervision die Frage, ob ich die Anspannung, unter der Anna<br />
gestanden hatte und die den Griff zum Cannabis ausgelöst hatte, nicht besser und früher hätte<br />
wahrnehmen können bzw. sollen. Die Supervisionsgruppe bestätigte meinen Eindruck, dass es<br />
gut gewesen wäre, mit Anna mehr darauf zu achten, was diese schwierigen Situationen<br />
(Konflikt mit Kindsvater, Stress im Beruf, Jobverlust, etc.) für sie bedeuten. Wir haben auch<br />
nicht genug auf Entspannungsmöglichkeiten geachtet. Die Gruppe vertrat aber auch die<br />
Ansicht, dass ich keine „Hellseherin“ sein müsse und Anna mir nicht deutlich genug gezeigt<br />
habe, wie es ihr ging. Phänomenologisch betrachtet sei es ja nur möglich, dass<br />
wahrzunehmen, was sich zeigt.<br />
Auf der anderen Seite hat sich aber die Beziehung zwischen Anna und mir in mehreren<br />
Aspekten als tragfähig erwiesen:<br />
- Sie kam nach ihrem Drogenkonsum in diesem ängstlich-aufgelösten Zustand in die<br />
Stunde, d. h. sie hatte den Mut und das Vertrauen zu mir, sich so zu zeigen, wie sie ist.<br />
Sie kam auch, weil sie mir zutraute, ihr bei der Bewältigung dieser Krise zu helfen.<br />
- Meine Frage, ob sie Drogen konsumiert habe, bejahte sie nach einem kurzen Zögern.<br />
Auch hier zeigte Anna ihr Vertrauen zu mir. Die gleiche Frage habe ihr auch ihre<br />
Schwester (zu der Anna ein gutes Verhältnis hat) gestellt: hier habe sie geleugnet.<br />
Anna ist es nicht leicht gefallen, zu mir ehrlich zu sein, weil sie meine Haltung zu<br />
Drogen kennt. Für Anna war aber offensichtlich wichtiger, die Beziehung zwischen<br />
uns durch eine Lüge nicht zu gefährden. Dies hat mich sehr berührt.<br />
- Anna konnte auch meiner Empfehlung, sich stationär behandeln zu lassen, folgen,<br />
obwohl sie selber eigentlich die Notwendigkeit nicht sah. Auch hier hat sie mir<br />
vertraut.<br />
Auf der Basis dieser vertrauensvollen Beziehung konnten wir gut weiter arbeiten.<br />
Für Anna war das wichtigste Ziel, wieder ihren Alltag in den Griff zu bekommen, d. h. Arbeit<br />
und eigene Wohnung. (Sie hatte ihre frühere Wohnung kündigen müssen, weil sie mit ihrem<br />
Sohn doch längere Zeit bei den Eltern leben musste.)<br />
An diesen konkreten Zielen haben wir sehr konzentriert gearbeitet, achteten aber auch auf<br />
realistische Ziele und darauf, dass Anna sich keiner Überforderung aussetzte. In relativ kurzer<br />
Zeit hat Anna eine Stelle als Haushaltshilfe gefunden, die sie sehr gut mit der Betreuung ihres<br />
Kindes vereinbaren kann und bei der sie sich wohlfühlt. Sie arbeitet jetzt seit mehr als sechs
48<br />
Monaten – die längste Phase von Berufstätigkeit in den letzten sieben Jahren ihres Lebens.<br />
Anna hat dort einen für sie guten Platz gefunden, weil ihr die Regelmäßigkeit und<br />
Überschaubarkeit ihrer Aufgaben viel Halt geben. Sie wünscht sich zwar immer noch,<br />
freiberuflich und völlig selbständig im grafischen Bereich zu arbeiten, weiß aber, dass so eine<br />
Arbeitsform sie völlig überfordern würde.<br />
Gleichzeitig fand Anna eine günstige und gut gelegene Wohnung, sodass sie mit ihrem Sohn<br />
wieder selbständig leben konnte.<br />
Nachdem es Anna gelungen war, Arbeit und Wohnung zu finden, konnte sie sich wieder mehr<br />
sich selbst zuwenden.<br />
Anna beschäftigten dabei vor allem zwei Themen: Zum einen wurde ihr klar, wie sehr sie sich<br />
bei der Neuorientierung und Neugestaltung ihres Lebens auf sich allein gestellt fühlte.<br />
Abgesehen von mir, ihrer Schwester und einer engen Freundin sei niemand daran interessiert,<br />
wie sehr sie sich um eine Verbesserung ihres Lebens bemühe. Ihre Eltern stünden ihrem<br />
Drogenkonsum zwar nicht positiv gegenüber und es gebe auch aktive Hilfe in Krisenzeiten,<br />
aber es gebe keine klare Haltung, keine Stellungnahme, keine Orientierungshilfe.<br />
Zum anderen wurde Anna immer mehr bewusst, welchen Schaden ihr Leben durch ihren<br />
langjährigen Drogenkonsum genommen hatte und wie sehr sie immer noch davon<br />
beeinträchtigt ist. Anna lernte, auch durch ihre Arbeit und die Eltern von Schulfreunden ihres<br />
Sohnes, immer mehr Menschen kennen, die keine Drogenerfahrungen haben und ein<br />
zielorientiertes, aktives Leben führen. Anna kam dabei zur bitteren Erkenntnis: „Ich habe 15<br />
Jahre meines Lebens mit Drogen verschissen! Was hätte ich in dieser Zeit alles tun können!<br />
Alles wäre besser gewesen ohne diesen Drogenscheiß!“ Anna neigte üblicherweise nicht zu<br />
einer derben Ausdrucksweise, sondern war immer um eine Sprache bemüht, die ihre<br />
Gefühlsregungen gut ausdrücken konnte. Aber im Zusammenhang mit Drogen sei ihr nur<br />
diese Fäkalsprache möglich. Alles andere wäre unpassend.<br />
Anna hat in dieser Zeit wieder einen Mann kennengelernt, der sie wegen seiner Feinfühligkeit<br />
und seinem Interesse an ihr sehr beeindruckte und in den sie sich verliebte. Aufgrund ihrer<br />
Schilderung tauchte bei mir die Vermutung auf, er könne ein Cannabis-Konsument sein.<br />
Darauf konkret angesprochen, stimmte Anna dieser Vermutung zu. In der Bearbeitung dieses<br />
Themas wurde deutlich, dass Anna zwar nicht mehr selber konsumieren wolle, dass sie aber<br />
nach wie vor eine sehr nachgiebige Haltung anderen gegenüber hatte. Es würde sie z. B. nicht<br />
stören, wenn ihr Partner neben ihr einen Joint rauchen würde. Wenn sie allerdings an ihren<br />
Sohn denkt, verändert sich Annas Haltung: Dann verhält sie sich viel klarer, gesünder und<br />
vernünftiger. Sie wolle keinen Mann in ihrem Leben haben, der Drogen konsumiere. Anna hat<br />
daraufhin auch umgehend diese beginnende Beziehung beendet.<br />
Während der gesamten Arbeit mit Anna hat sich durchgehend der starke Wert gezeigt, den die<br />
Beziehung zu ihrem Sohn für sie hat. Dies wurde spürbar in Alltagsdingen (Anna hat immer<br />
auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung geachtet, allerdings vor allem ihrem Sohn zuliebe),<br />
aber auch bei ihrer derzeitigen – und hoffentlich bleibenden! – Haltung zu Drogen: „Ich will<br />
eine gesunde, drogenfreie Mama für meinen Sohn sein!
8.4 Der Therapie-Abschluss<br />
49<br />
Die Therapie mit Anna ist noch nicht beendet. Anna hat im Rahmen ihrer<br />
Persönlichkeitsentwicklung, ihres Person-Werdens, noch etliche Schritte vor sich. Aber an<br />
dieser Stelle kann eine erste Bilanz darüber gezogen werden, was in der Therapie mit Anna<br />
schon gelungen ist und woran in Zukunft noch zu arbeiten sein wird.<br />
- Anna hat ihren Alltag gut strukturiert und kann ihre täglichen Aufgaben gut<br />
bewältigen. Sie hat Arbeit, eine eigene Wohnung, und kommt mit der Betreuung ihres<br />
Kindes gut zurecht.<br />
- Sie hat in der Therapie gelernt, Beziehung und Bindung aufzubauen und zu halten<br />
(speziell zu mir) und generell auf Beziehungen besser zu achten. Anna hat in der<br />
Therapie auch gelernt, Beziehung zu sich selbst aufzunehmen. Sie hat mehr Zugang zu<br />
ihren Gefühlen, kann sie besser wahrnehmen und ausdrücken. Auf der Ebene der 2.<br />
Grundmotivation hat Anna nach meiner Einschätzung viel nachgeholt.<br />
- Anna erlebt sich selbst jetzt als wertvoller, auch wenn die wertvollste Beziehung in<br />
ihrem Leben nach wie vor die zu ihrem Kind ist.<br />
- Sie kann sich selber mehr achten und schätzen und kann auch besser zu sich selbst<br />
stehen. Sie kann ihre Grenzen besser wahrnehmen als zu Therapiebeginn, spürt<br />
Grenzüberschreitungen deutlicher und kann bereits viel mehr zu sich stehen. Sie ist<br />
dabei, ihr Eigenes zu entdecken und zu finden. Bei dieser Entwicklung steht sie m. E.<br />
noch ziemlich am Anfang und braucht weiterhin viel Begleitung. Im Hinblick auf ihre<br />
Suchtgeschichte hat Anna daher immer noch ein großes Risikopotential. Solange die<br />
Person in ihr noch so zart ist und ihr Eigenes noch so ungefestigt, ist Anna auf ihrem<br />
Weg zur Gesundung noch sehr gefährdet.<br />
Trotz dieser Einschränkungen hat sich Anna auch auf der Ebene der 3.<br />
Grundmotivation sehr stark entwickelt.<br />
8.5 Die Diagnose<br />
8.5.1 Die existenzanalytische Diagnose<br />
Aus der Sicht der Existenzanalyse sind bei Anna Beeinträchtigungen auf zumindest drei<br />
Grundmotivationen vorliegend:<br />
1. Auf der Ebene der 1. Grundmotivation sind bei Anna Angst und Unsicherheit zu<br />
finden. Sie hat viele Phasen der Schutzlosigkeit und des Ausgeliefert-Seins erlebt und<br />
schon in ihrer kindlichen Entwicklung zu wenig Schutz und Halt erfahren. Sie hat<br />
auch immer wieder erlebt, keinen Raum zu haben, wo sie gut da sein kann.<br />
2. Auf der Ebene der 2. Grundmotivation steht bei Anna die mangelnde<br />
Beziehungsfähigkeit im Vordergrund. Sie hat nie bewusst erfahren, dass es gut ist,<br />
dass es sie gibt. Ihr Grundwert ist im Wesentlichen unentwickelt geblieben.<br />
3. Die schwerste Beeinträchtigung liegt bei Anna sicherlich auf der Ebene der 3.<br />
Grundmotivation in Form einer massiven Selbstwertstörung. In ihrer Entwicklung zur<br />
Person ist sie in ihrer Familie und auch später zu wenig gesehen und beachtet worden<br />
ist; sie ist viel zu selten gefragt worden, wie es ihr geht oder wie sie eine Sache sieht.<br />
Sie ist viel zu selten ernst genommen worden und hat dadurch auch nie gelernt, sich<br />
selber ernst zu nehmen. Sie war in ihrer Familie und später in ihren Partnerschaften<br />
nicht wichtig und hat dadurch auch nicht gelernt, sich selber wichtig zu nehmen. Sie<br />
war für niemanden wertvoll und konnte sich selber auch nicht als wertvoll erleben.
50<br />
8.5.2 Psychodynamik<br />
Anna zeigte als Copingreaktionen zum einen deutliche Rückzugstendenzen, d. h. sie hat<br />
gelernt, enge emotionale Beziehungen zu vermeiden und sich aus Beziehungen<br />
herauszuhalten, um nicht verletzt zu werden. Sie hatte auch ein gewisses Ausmaß an<br />
Gleichgültigkeit (sie dissoziierte, um nicht das volle Ausmaß ihres Schmerzes spüren zu<br />
müssen) sich selbst und anderen gegenüber – mit einer ganz deutlichen Ausnahme: Zu ihrem<br />
Sohn hatte Anna eine sehr enge, liebevolle Beziehung, die ihr auch als sehr wertvoll erleben<br />
konnte und über die sie gut erreichbar war.<br />
Durch das Vermeiden von Nähe konnte Anna aber natürlich in Folge auch keine positiven<br />
Beziehungserfahrungen machen. Ihre Haltung blieb daher unkorrigiert.<br />
Anna zeigte deutliche Wiederholungstendenzen in ihren Männerbeziehungen: ihre bisherigen<br />
Partner gehörten zum ihr vertrauten Drogenmilieu und waren kaum bis gar nicht an Anna als<br />
Person, an ihren Gedanken, Gefühlen, Träumen und Hoffnungen interessiert. Sie brachten ihr<br />
weder Respekt noch Wertschätzung oder Anerkennung entgegen. Sie zeigten weder<br />
Einfühlungsvermögen noch Rücksichtnahme und ließen ihr auch kaum Unterstützung<br />
zukommen. Anna war auch in ihren Beziehungen zu Männern sehr einsam.<br />
Zum anderen ging Anna in die Entwertung: sie konnte an sich nichts Positives, Liebenswertes<br />
finden, konnte Lob und anerkennende Rückmeldungen nicht annehmen.<br />
Anna befand sich in einem Zustand der Resignation. Sie hat ihr Leben über sich ergehen<br />
lassen, ohne viel dabei zu empfinden. Dadurch wurde sie aber noch apathischer und<br />
kraftloser. An Anna waren Enttäuschung, Passivität und Schicksalsergebenheit spürbar. Als<br />
sie zu mir kam, hatte sie eigentlich keine Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Situation.<br />
8.5.3 Die Diagnose nach ICD 10<br />
F 43.22 Anpassungsstörung (Angst und Depression gemischt)<br />
F 60.6 Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung<br />
F 12.20 Cannabisabhängigkeit, gegenwärtig abstinent<br />
F 12.56 St.p. mehrfacher Drogenpsychose<br />
F 94.1 Bindungsstörung<br />
8.6 Ausblick<br />
Ich bin zuversichtlich, dass Anna sich auf einem guten Weg befindet. Sie hat vor allem im<br />
Bereich ihrer Beziehungsfähigkeit und ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch einen weiten<br />
und möglicherweise immer wieder schwierigen Weg vor sich. Sie ist in ihrem Person-Sein<br />
noch sehr labil, sodass sie wahrscheinlich noch längere Zeit therapeutische Begleitung und<br />
Unterstützung brauchen wird. Auch Rückfälle in ihr Suchtverhalten sind nicht auszuschließen<br />
bzw. eher anzunehmen, vor allem unter größeren Alltagsbelastungen. Der Grundstein für ein<br />
stabileres Leben, in dem Anna mit mehr innerer Zustimmung ja zu sich und zu ihrem Leben<br />
sagen kann, ist aber gelegt worden.<br />
Ich möchte mit einigen persönlichen Bemerkungen und einer Gedichtzeile von Hilde Domin<br />
meine Arbeit abschließen:<br />
„Jeder der geht<br />
belehrt uns ein wenig<br />
über uns selber“<br />
(Hilde Domin)
51<br />
Ich bin dankbar für meine Arbeit mit Anna und für die Möglichkeit, sie in vielen<br />
Begegnungen wahrnehmen und erleben zu dürfen. Sie hat mich beeindruckt durch ihren Mut,<br />
immer wieder die Herausforderungen ihres Lebens anzunehmen und sich ihren „Dämonen“<br />
entgegenzustellen; sie hat mich berührt und bewegt in ihrem Bemühen, eine gute und<br />
liebevolle Mutter für ihren kleinen Sohn zu sein; sie hat mich geärgert und wütend gemacht,<br />
wenn sie unpünktlich war oder Termine nicht eingehalten hat; sie hat ihre Freude über<br />
Fortschritte mit mir geteilt und mich dadurch bereichert; und sie war und ist konsequent darin,<br />
ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Anna hat mich gelehrt, auf die Person zu achten –<br />
und nicht den Junkie zu sehen.
52<br />
Literaturverzeichnis<br />
Bauer, Joachim: Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene<br />
steuern. Piper, Frankfurt am Main, 17. Auflage 2011<br />
Bauer, Joachim: Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. Heyne,<br />
München, 4. Auflage 2008<br />
Bauer, Joachim: Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das<br />
Geheimnis der Spiegelneurone. Heyne, München, 16. Auflage 2006<br />
Bergmann, Wolfgang/Hüther, Gerald: Computersüchtig. Kinder im Sog der modernen<br />
Medien. Beltz Tb, Weinheim und Basel, 2. Auflage 2009<br />
Boss, Pauline: Verlust, Trauma und Resilienz. Die therapeutische Arbeit mit dem<br />
„uneindeutigen Verlust“. Klett-Cotta, Stuttgart 2008<br />
Brisch, Karl Heinz: Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie. Klett-Cotta,<br />
Stuttgart, 10. Auflage 2010<br />
Dilling,H./Mombour, W./Schmidt, M.H./Schulte-Markwort,E.(Hg.): <strong>International</strong>e<br />
Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V(F). Diagnostische Kriterien für<br />
Forschung und Praxis. Hans Huber, Bern, 3. Auflage 2004<br />
Fengler, Jörg (Hg.): Handbuch der Suchtbehandlung. Beratung – Therapie – Prävention.<br />
Ecomed, Landsberg/Lech 2002<br />
Frankl, Viktor: Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie.<br />
Piper, München Neuausgabe 1990<br />
Frankl, Viktor: Die Sinnfrage in der Psychotherapie. Piper, München, 7. Auflage 1997<br />
Frankl, Viktor: Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Piper, München, 22. Auflage 2009<br />
Guth, Elisabeth: Der suchtkranke (abhängige) Mensch aus der Sicht der Existenzanalyse und<br />
Logotherapie. In: Längle, Alfried, Probst, Christian (Hg.): Süchtig sein. Entstehung, Formen<br />
und Behandlung von Abhängigkeiten. Facultas, Wien 1997<br />
Haller, Reinhard: (Un)Glück der Sucht. Wie Sie Ihre Abhängigkeiten besiegen. Ecowin,<br />
Salzburg 2007<br />
Huber, Michaela: Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabehandlung. Teil 1.<br />
Jungfermannsche Verlagsbuchhandlung, Paderborn, 2. Auflage 2005<br />
Hüther, Gerald: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Vandenhoeck & Ruprecht,<br />
Göttingen, 10. Auflage 2011
53<br />
Johnston, Anita: Die Frau, die im Mondlicht aß. Ess-Störungen überwinden durch die<br />
Weisheit uralter Märchen und Mythen. Knaur MensSana, München, Neuausgabe 2007<br />
Kuntz, Helmut: Drogen&Sucht. Ein Handbuch über alles, was Sie wissen müssen. Beltz, 2.<br />
Auflage 2011<br />
Kuntz, Helmut: Sucht – Eine Herausforderung im therapeutischen Alltag. Leben lernen, Klett-<br />
Cotta, Stuttgart 2007<br />
Längle, Alfried: Logotherapie und Existenzanalyse – eine begriffliche Standortbestimmung.<br />
In: <strong>GLE</strong> (Hg.): Logotherapie und Existenzanalyse. Eine begriffliche Standortbestimmung.<br />
Wien 1995<br />
Längle, Alfried: Das Ja zum Leben finden. Existenzanalyse und Logotherapie in der<br />
Suchtkrankenhilfe. In: Längle, Alfried/Probst, Christian (Hg.): Süchtig sein. Entstehung,<br />
Formen und Behandlung von Abhängigkeiten. Facultas, Wien 1997<br />
Längle, Alfried: Emotion und Existenz. In. Längle, Alfried (Hg.): Emotion und Existenz,<br />
Facultas, Wien 2003<br />
Längle, Alfried: Das Bewegende spüren. Phänomenologie in der (existenzanalytischen)<br />
Praxis. In: <strong>GLE</strong> (Hg.): Das Wesentliche sehen. Phänomenologie in Psychotherapie und<br />
Beratung. Wien 2007<br />
Längle, Alfried/Probst, Christian: Was sucht der Süchtige? Beweggründe und Ursachen aus<br />
existenzanalytischer Sicht. In: Längle, Alfried/Probst, Christian (Hg.): Süchtig sein.<br />
Entstehung, Formen und Behandlung von Abhängigkeiten. Facultas, Wien 1997<br />
Mellody, Pia: Verstrickt in die Probleme anderer. Über Entstehung und Auswirkung von Co-<br />
Abhängigkeit. Kösel, München, 10. Auflage 2010<br />
Rauch, Johannes/Görtz, Astrid: Erfahrungen aus dem klinischen Alltag mit Suchtkranken. In:<br />
Längle, Alfried/Probst, Christian (Hg.): Süchtig sein. Entstehung, Formen und Behandlung<br />
von Abhängigkeiten. Facultas, Wien 1997<br />
Reddemann, Luise: Überlebenskunst. Klett-Cotta Leben!, Stuttgart 2006<br />
Reddemann, Luise: Würde – Annäherung an einen vergessenen Wert in der Psychotherapie.<br />
Klett Cotta Leben lernen, Stuttgart 2008<br />
Saint-Exupery, Antoine de: Der Kleine Prinz. Arche, Zürich 1983<br />
Schäfer, Ingo: Die Bedeutung von Traumatisierungen für die Entwicklung und den Verlauf<br />
von Suchterkrankungen. In: Schäfer, Ingo/Krausz, Michael(Hg.): Trauma und Sucht.<br />
Konzepte – Diagnostik – Behandlung. Klett-Cotta, Stuttgart 2006<br />
Schindler, Andreas: Bindung und Sucht. In: Thomasius Rainer/Schulte-Markwort,<br />
Michael/Küstner, Udo/Riedesser, Peter(Hg.): Suchtstörungen im Kindes- und Jugendalter.<br />
Das Handbuch: Grundlagen und Praxis. Schattauer, Gießen, 2008
54<br />
Teesson, Maree/Degenhardt, Louisa/Hall, Wayne: Suchtmittel und Abhängigkeit. Formen –<br />
Wirkung – Interventionen. Hans Huber, Bern 2008<br />
Tutsch, Lilo: Emotionen im psychotherapeutischen Verarbeitungsprozess: aktivieren oder<br />
managen? In: <strong>GLE</strong> (Hg.): Vom Leben berührt. Emotion in Therapie und Beratung. Wien 2010<br />
Vetter, Helmuth: Was ist Phänomenologie? In: <strong>GLE</strong> (Hg.): Das Wesentliche sehen.<br />
Phänomenologie in Psychotherapie und Beratung. Wien 2007<br />
Wecker, Konstantin: Und die Seele nach außen kehren. Ketzerbriefe eines Süchtigen. Uns ist<br />
kein Einzelnes bestimmt. Neun Elegien. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1983<br />
Wilson Schaef, Anne: Co-Abhängigkeit. Die Sucht hinter der Sucht. Heyne, München 2003