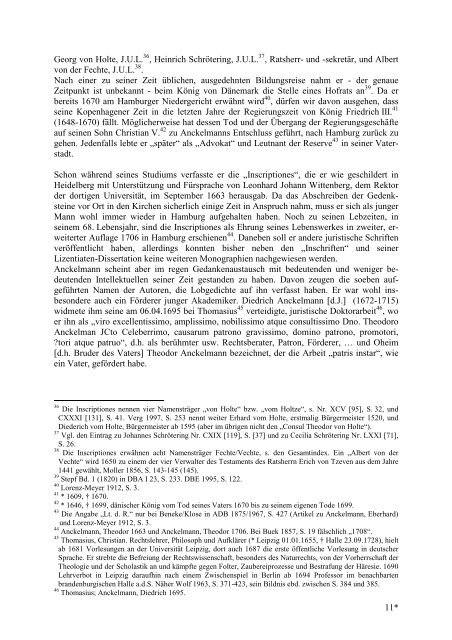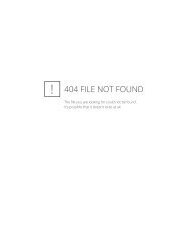Inscriptiones Hamburgensis - Familienforschung von Bernhard Pabst
Inscriptiones Hamburgensis - Familienforschung von Bernhard Pabst
Inscriptiones Hamburgensis - Familienforschung von Bernhard Pabst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Georg <strong>von</strong> Holte, J.U.L. 36 , Heinrich Schrötering, J.U.L. 37 , Ratsherr- und -sekretär, und Albert<br />
<strong>von</strong> der Fechte, J.U.L. 38 .<br />
Nach einer zu seiner Zeit üblichen, ausgedehnten Bildungsreise nahm er - der genaue<br />
Zeitpunkt ist unbekannt - beim König <strong>von</strong> Dänemark die Stelle eines Hofrats an 39 . Da er<br />
bereits 1670 am Hamburger Niedergericht erwähnt wird 40 , dürfen wir da<strong>von</strong> ausgehen, dass<br />
seine Kopenhagener Zeit in die letzten Jahre der Regierungszeit <strong>von</strong> König Friedrich III. 41<br />
(1648-1670) fällt. Möglicherweise hat dessen Tod und der Übergang der Regierungsgeschäfte<br />
auf seinen Sohn Christian V. 42 zu Anckelmanns Entschluss geführt, nach Hamburg zurück zu<br />
gehen. Jedenfalls lebte er „später“ als „Advokat“ und Leutnant der Reserve 43 in seiner Vaterstadt.<br />
Schon während seines Studiums verfasste er die „<strong>Inscriptiones</strong>“, die er wie geschildert in<br />
Heidelberg mit Unterstützung und Fürsprache <strong>von</strong> Leonhard Johann Wittenberg, dem Rektor<br />
der dortigen Universität, im September 1663 herausgab. Da das Abschreiben der Gedenksteine<br />
vor Ort in den Kirchen sicherlich einige Zeit in Anspruch nahm, muss er sich als junger<br />
Mann wohl immer wieder in Hamburg aufgehalten haben. Noch zu seinen Lebzeiten, in<br />
seinem 68. Lebensjahr, sind die <strong>Inscriptiones</strong> als Ehrung seines Lebenswerkes in zweiter, erweiterter<br />
Auflage 1706 in Hamburg erschienen 44 . Daneben soll er andere juristische Schriften<br />
veröffentlicht haben, allerdings konnten bisher neben den „Inschriften“ und seiner<br />
Lizentiaten-Dissertation keine weiteren Monographien nachgewiesen werden.<br />
Anckelmann scheint aber im regen Gedankenaustausch mit bedeutenden und weniger bedeutenden<br />
Intellektuellen seiner Zeit gestanden zu haben. Da<strong>von</strong> zeugen die soeben aufgeführten<br />
Namen der Autoren, die Lobgedichte auf ihn verfasst haben. Er war wohl insbesondere<br />
auch ein Förderer junger Akademiker. Diedrich Anckelmann [d.J.] (1672-1715)<br />
widmete ihm seine am 06.04.1695 bei Thomasius 45 verteidigte, juristische Doktorarbeit 46 , wo<br />
er ihn als „viro excellentissimo, amplissimo, nobilissimo atque consultissimo Dno. Theodoro<br />
Anckelman JCto Celeberrimo, causarum patrono gravissimo, domino patrono, promotori,<br />
?tori atque patruo“, d.h. als berühmter usw. Rechtsberater, Patron, Förderer, … und Oheim<br />
[d.h. Bruder des Vaters] Theodor Anckelmann bezeichnet, der die Arbeit „patris instar“, wie<br />
ein Vater, gefördert habe.<br />
36 Die <strong>Inscriptiones</strong> nennen vier Namensträger „<strong>von</strong> Holte“ bzw. „vom Holtze“, s. Nr. XCV [95], S. 32, und<br />
CXXXI [131], S. 41. Verg 1997, S. 253 nennt weiter Erhard vom Holte, erstmalig Bürgermeister 1520, und<br />
Diederich vom Holte, Bürgermeister ab 1595 (aber im übrigen nicht den „Consul Theodor <strong>von</strong> Holte“).<br />
37 Vgl. den Eintrag zu Johannes Schrötering Nr. CXIX [119], S. [37] und zu Cecilia Schrötering Nr. LXXI [71],<br />
S. 26.<br />
38 Die <strong>Inscriptiones</strong> erwähnen acht Namensträger Fechte/Vechte, s. den Gesamtindex. Ein „Albert <strong>von</strong> der<br />
Vechte“ wird 1650 zu einem der vier Verwalter des Testaments des Ratsherrn Erich <strong>von</strong> Tzeven aus dem Jahre<br />
1441 gewählt, Moller 1856, S. 143-145 (145).<br />
39 Stepf Bd. 1 (1820) in DBA I 23, S. 233. DBE 1995, S. 122.<br />
40 Lorenz-Meyer 1912, S. 3.<br />
41 * 1609, † 1670.<br />
42 * 1646, † 1699, dänischer König vom Tod seines Vaters 1670 bis zu seinem eigenen Tode 1699.<br />
43 Die Angabe „Lt. d. R.“ nur bei Beneke/Klose in ADB 1875/1967, S. 427 (Artikel zu Anckelmann, Eberhard)<br />
und Lorenz-Meyer 1912, S. 3.<br />
44 Anckelmann, Theodor 1663 und Anckelmann, Theodor 1706. Bei Buek 1857, S. 19 fälschlich „1708“.<br />
45 Thomasius, Christian. Rechtslehrer, Philosoph und Aufklärer (* Leipzig 01.01.1655, † Halle 23.09.1728), hielt<br />
ab 1681 Vorlesungen an der Universität Leipzig, dort auch 1687 die erste öffentliche Vorlesung in deutscher<br />
Sprache. Er strebte die Befreiung der Rechtswissenschaft, besonders des Naturrechts, <strong>von</strong> der Vorherrschaft der<br />
Theologie und der Scholastik an und kämpfte gegen Folter, Zaubereiprozesse und Bestrafung der Häresie. 1690<br />
Lehrverbot in Leipzig daraufhin nach einem Zwischenspiel in Berlin ab 1694 Professor im benachbarten<br />
brandenburgischen Halle a.d.S. Näher Wolf 1963, S. 371-423, sein Bildnis ebd. zwischen S. 384 und 385.<br />
46 Thomasius; Anckelmann, Diedrich 1695.<br />
11*