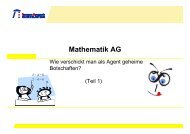VV Nalimov - Fachbereich Mathematik - Universität Kaiserslautern
VV Nalimov - Fachbereich Mathematik - Universität Kaiserslautern
VV Nalimov - Fachbereich Mathematik - Universität Kaiserslautern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gesagt, festmachte an der Frage ob Wahrscheinlichkeiten objektiv vorgegeben oder einfach<br />
Ausdruck subjektiven Empfindens sind. Während in den klassischen von der Physik dominierten<br />
Naturwissenschaften die Objektivisten fast selbstverständlich die Oberhand hatten, war in<br />
weicheren Wissenschaften wie der Ökonomie der Subjektivismus Mode. (Würfel vs.<br />
Profitchancen.) In der Diskussion der Statistiker wurde der Bayessche Ansatz lange Zeit<br />
identifiziert mit dem Konzept der subjektiven Deutung des Wahrscheinlickeitsbegriffs. Woher, so<br />
sagte man, kommt denn die a-priori-Verteilung, die für diesen Ansatz eine so zentrale Rolle spielt.<br />
Da kann eigentlich nur die persönliche Meinung des Forschers hineinspielen, also seine subjektive<br />
Sicht der Dinge. In der Sowjetunion wurde mindestens in den wahrscheinlichkeitstheoretischen<br />
Lehrbüchern die Beliebigkeit des Subjektivismus als im Gegensatz zu den objektiven Gesetzen des<br />
dialektischen Materialismus gesehen.<br />
Heute wird diese Identifizierung von Bayes-Verfahren mit Subjektivismus in Frage gestellt: auch<br />
die Objektivisten benutzen das Bayes-Verfahren gerne, weil es eine computerisierbare Vorschrift<br />
zur Veränderung von Wahrscheinlichkeiten in hochkomplexen Problemen wie etwa in der<br />
Bildverarbeitung oder der Hirnforschung erlaubt, ohne daß sie sich auf eine allzu verpflichtende<br />
Deutung der a-priori Verteilungen einlassen müssen.<br />
Nach diesem Ausflug in die statistische Methodenlehre kommt jetzt <strong>Nalimov</strong>s wesentlich erweiterte<br />
Verwendung dieser Schlußweise. Erst auf diesen erweiterten Sinn ist seine Wortschöpfung vom<br />
„Bayesschen Syllogismus“ ([5], p. 284) gemünzt. Dafür ist wesentlich, daß <strong>Nalimov</strong> ein sehr stark<br />
von der Linguistik geprägtes Bild von unserem Umgang mit der Welt hat. Sein Paradigma ist das<br />
Verstehen, oder besser Deuten eines Textes. Gegeben ist ein Text, zum Beispiel ein normales<br />
Dokument, ein Gedicht oder ein Abfolge von Nukleinsäuren in einem Chromosom. Aber er geht<br />
viel weiter. Auch die einzelne Person ist ein Text, ja die Welt als Ganzes ist ein Text. Das jeweilige<br />
Selbstverständnis eines Menschen kann man sich repräsentiert denken durch eine<br />
Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den möglichen Deutungen, also einer a priori-Verteilung p(µ).<br />
Nie gibt es nur eine denkbare Deutung. Zusätzlich sieht der Mensch Phänomene y die beeinflußt<br />
sind von der jeweiligen Deutung, aber auch von vielen anderen Faktoren. Dies ist repräsentiert<br />
durch Filter p(y | µ). Nachdem ein bestimmtes Phänomen y aufgetaucht ist, führt dies zu einer<br />
neuen Wahrscheinlichkeitsverteilung, der a posteriori-Verteilung p(µ | y): Andere Lesarten des<br />
eigenen Textes bekommen die Priorität. Es gibt also ein Kontinuum von Beispielen der Interaktion<br />
eines Bewußtseins mit einem ihm durch die jeweilige Situation vorgelegten Text. Die zeitliche<br />
Abfolge der Lesarten und ihres Stellenwerts entsteht nach <strong>Nalimov</strong> durch eine dem Bayeschen<br />
Fomalismus nachempfundene Umschichtung in Wechselwirkung mit den erlebten Phänomenen.<br />
<strong>Nalimov</strong>s Sicht der Zahl.<br />
Diese weitgehende Übertragung von einem Muster, das der quantitativen Wissenschaft entstammt,<br />
in die fundamentalen Bereiche unseres Bewußtseins, das insbesondere durch unsere tiefe<br />
sprachliche Prägung geformt ist, kann nur für jemanden akzeptabel sein, der eigentlich keinen<br />
echten Sprung zwischen diesen Welten empfindet. Der folgende Abschnitt ist eine Kurzfassung<br />
des Aufsatzes [9].<br />
Im Anfang war das Wort, logos. Diesen Anfang des Johannes-Evangeliums zitiert er immer wieder.<br />
Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.<br />
Der Name Gottes. Die Namen Gottes. Die enge Bindung religiöser Erfahrung mit Sprache steht für<br />
<strong>Nalimov</strong> außer Frage.<br />
Nun verweist er aber gerne zusätzlich darauf, daß unter den vielen Bedeutungen des griechischen