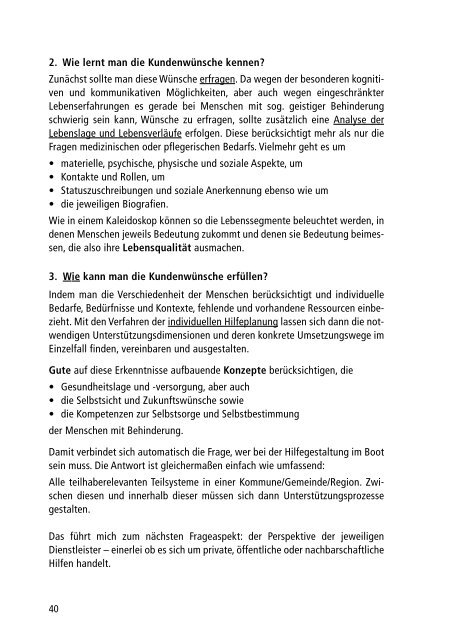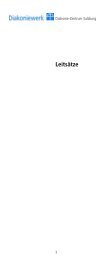MS-Bro 2005_Kern - Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
MS-Bro 2005_Kern - Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
MS-Bro 2005_Kern - Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Wie lernt man die Kundenwünsche kennen?<br />
Zunächst sollte man diese Wünsche erfragen. Da wegen der besonderen kognitiven<br />
und kommunikativen Möglichkeiten, aber auch wegen eingeschränkter<br />
Lebenserfahrungen es gerade bei Menschen mit sog. geistiger Behinderung<br />
schwierig sein kann, Wünsche zu erfragen, sollte zusätzlich eine Analyse der<br />
Lebenslage und Lebensverläufe erfolgen. Diese berücksichtigt mehr als nur die<br />
Fragen medizinischen oder pflegerischen Bedarfs. Vielmehr geht es um<br />
• materielle, psychische, physische und soziale Aspekte, um<br />
• Kontakte und Rollen, um<br />
• Statuszuschreibungen und soziale Anerkennung ebenso wie um<br />
• die jeweiligen Biografien.<br />
Wie in einem Kaleidoskop können so die Lebenssegmente beleuchtet werden, in<br />
denen Menschen jeweils Bedeutung zukommt und denen sie Bedeutung beimessen,<br />
die also ihre Lebensqualität ausmachen.<br />
3. Wie kann man die Kundenwünsche erfüllen?<br />
Indem man die Verschiedenheit der Menschen berücksichtigt und individuelle<br />
Bedarfe, Bedürfnisse und Kontexte, fehlende und vorhandene Ressourcen einbezieht.<br />
Mit den Verfahren der individuellen Hilfeplanung lassen sich dann die notwendigen<br />
Unterstützungsdimensionen und deren konkrete Umsetzungswege im<br />
Einzelfall finden, vereinbaren und ausgestalten.<br />
Gute auf diese Erkenntnisse aufbauende Konzepte berücksichtigen, die<br />
• Gesundheitslage und -versorgung, aber auch<br />
• die Selbstsicht und Zukunftswünsche sowie<br />
• die Kompetenzen zur Selbstsorge und Selbstbestimmung<br />
der Menschen mit Behinderung.<br />
Damit verbindet sich automatisch die Frage, wer bei der Hilfegestaltung im Boot<br />
sein muss. Die Antwort ist gleichermaßen einfach wie umfassend:<br />
Alle teilhaberelevanten Teilsysteme in einer Kommune/Gemeinde/Region. Zwischen<br />
diesen und innerhalb dieser müssen sich dann Unterstützungsprozesse<br />
gestalten.<br />
Das führt mich zum nächsten Frageaspekt: der Perspektive der jeweiligen<br />
Dienstleister – einerlei ob es sich um private, öffentliche oder nachbarschaftliche<br />
Hilfen handelt.<br />
40<br />
Auch hier stelle ich wieder drei Fragen:<br />
1. Welche Prozesse sind relevant?<br />
Hier sind alle Abläufe zur Finanzierung, Planung, Differenzierung und Umsetzung<br />
geeigneter Hilfen wichtig. Für Lebensqualität ist eine unentgeltliche Familienstunde<br />
nicht weniger wert als eine teure Fachleistungsstunde. Dies gilt im<br />
Binnenbetrieb der Leistungsträger und -anbieter ebenso wie in den Kooperationsfeldern<br />
des gegliederten Hilfesystems.<br />
2. Wie sollten die Prozesse laufen?<br />
Sie sollten schnell, zuverlässig und zielgenau laufen. Es gilt Abschied zu nehmen<br />
von Wagenburgmentalitäten zwischen Anbietern der Pflege-, Behinderten- oder<br />
Altenhilfe, der verschiedenen Rehabilitationsträger, der Bildungs- oder Medizinisch-therapeutischen<br />
Dienste. Dies gelingt dann am besten, wenn Schnittstellen,<br />
Zuständigkeitsfragen und Informationen nicht dazu zwingen, gegen spezifische<br />
Eigeninteressen zu handeln. Insofern ist es auch ein Strukturentwicklungsthema.<br />
3. Wie kann man das umsetzen?<br />
Es genügt nicht, vorhandene Angebote der Behindertenhilfe nur zu intensivieren<br />
oder um Aspekte der Pflege oder Geriatrie anzureichern. Vice versa gilt dies<br />
ebenso für Pflege- oder Altenhilfedienste.<br />
Aber es kann sich lohnen, Methoden des Care- und Casemanagements vermehrt<br />
zum Tragen kommen zu lassen, um so Hilfe nach Maß im Einzelfall zu gestalten.<br />
Denn wenn „Balanced Aging“ altern mit Lebensqualität bedeutet, dann kann es<br />
nicht darum gehen, Menschen mit Unterstützungsbedarf den vorhandenen Hilfesystemen<br />
anzupassen, sondern die Organisationen müssen ihre Perspektive<br />
und teilweise wohl auch ihre Angebotsformen und -intensionen so wandeln,<br />
dass sie die jeweilig passende Unterstützung bieten können.<br />
Damit sind wir bei der vierten, der Lern- und Entwicklungsperspektive angelangt,<br />
die ich mit dem fünften Aspekt, der Suche nach weiteren relevanten Fragen,<br />
verbinden will.<br />
Ich fasse zunächst zusammen:<br />
Wir haben gesehen, dass Konzepte bei den Kompetenzen, Bedarfen und Bedürfnissen<br />
ansetzen müssen, die heute alte Menschen mit Behinderung haben und<br />
artikulieren. Sie müssen sich aber zugleich auf die nächsten Generationen, also<br />
41