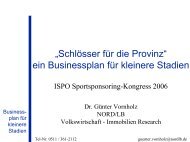Wirtschaftliche Auswirkungen öffentlich finanzierter Stadionprojekte
Wirtschaftliche Auswirkungen öffentlich finanzierter Stadionprojekte
Wirtschaftliche Auswirkungen öffentlich finanzierter Stadionprojekte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wirtschaftliche</strong> <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong><br />
<strong>finanzierter</strong> <strong>Stadionprojekte</strong><br />
von<br />
Helmut M. Dietl Markus Pauli<br />
Neue Folge Nr. 61
<strong>Wirtschaftliche</strong> <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong> <strong>finanzierter</strong><br />
<strong>Stadionprojekte</strong><br />
Helmut M. Dietl Markus Pauli<br />
Neue Folge Nr. 61<br />
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften<br />
Universität Paderborn<br />
Warburgerstr. 100<br />
D-33098 Paderborn<br />
August 1999
Dietl, Helmut M./Pauli, Markus (1999): <strong>Wirtschaftliche</strong> <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong><br />
<strong>finanzierter</strong> <strong>Stadionprojekte</strong>, in: Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissen-<br />
schaften, Universität Paderborn, Neue Reihe Nr. 61, August 1999 *<br />
Abstract:<br />
Deutsche Fußballbundesligavereine sind zur Aufrechterhaltung ihrer nationalen und<br />
internationalen Wettbewerbsfähigkeit vielfach auf größere und modernere<br />
Fußballstadien angewiesen. Der Beitrag geht der Frage nach, ob die dafür<br />
notwendigen Stadioninvestitionen in Höhe von mehreren Milliarden DM wie in der<br />
Vergangenheit üblich überwiegend von <strong>öffentlich</strong>er Seite getragen werden sollen.<br />
Auftragsstudien von Stadionbefürwortern (Vereine, Sportverbände, regionale<br />
Wirtschaftsverbände und -unternehmen, etc.) kommen zu dem Ergebnis, daß die<br />
überwiegend <strong>öffentlich</strong>e Finanzierung der Stadien unter Wohlfahrtsgesichtspunkten<br />
gerechtfertigt ist (Kapitel 2). Objektive theoretische Überlegungen und unabhängige<br />
empirische Untersuchungen legen hingegen den Schluß nahe, daß eine<br />
überwiegend <strong>öffentlich</strong>e Finanzierung der <strong>Stadionprojekte</strong> in den meisten Fällen<br />
unter allokativen und distributiven Aspekten ineffizient ist (Kapitel 3). Es wird<br />
argumentiert, daß eine Erhöhung des privaten Anteils an den Kosten<br />
wohlfahrtssteigernd wirkt, wozu aber eine Änderung der Rechteverteilung an den<br />
Stadien, Vereinen oder Ligaeinnahmen zwingend erforderlich ist (Kapitel 4).<br />
* Für wertvolle Hinweise und Anregungen bedanken wir uns ganz herzlich bei Marie-Luise Klein,<br />
Markus Kurscheidt, Andreas Pohlmann, Bernd Rahmann und Susanne Royer.<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
1. EINFÜHRUNG 5<br />
2. ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN AUS SICHT DER<br />
3<br />
STADIONBEFÜRWORTER 14<br />
2.1. Allgemeine makroökonomische Analysen 16<br />
2.2. Spezielle makroökonomische Analysen 17<br />
2.2.1. Nachfrageorientierte Analysen 18<br />
2.2.1.1. Stadioninvestitionen als Voraussetzung für attraktiven Zuschauersport 18<br />
2.2.1.2. Nachfrageinduzierte Einkommens- und Beschäftigungswirkungen 22<br />
2.2.2. Angebotsorientierte Analysen 27<br />
2.3. Fazit: Ergebnisse der Auftragsstudien 29<br />
3. ÖKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN AUS UNABHÄNGIGER SICHT 30<br />
3.1. Beurteilung allgemeiner makroökonomischer Analysen 30<br />
3.2. Beurteilung spezieller makroökonomischer Analysen 32<br />
3.2.1. Typischer Finanzierungsplan für <strong>Stadionprojekte</strong> 32<br />
3.2.2. Beurteilung nachfrageorientierter Auftragsstudien 36<br />
3.2.2.1. Unterschätzung der Kosten <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen 36<br />
3.2.2.2. Vernachlässigte Kosten und Verteilungswirkungen auf der Einnahmenseite 39<br />
3.2.2.3. Überschätzung der Nutzen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen 43<br />
3.2.3. Beurteilung angebotsseitiger Effekte 55<br />
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 57<br />
5. LITERATURVERZEICHNIS 63
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Aufteilung Gesamtumsatz erste Bundesliga (1996/97) ..........................6<br />
Abbildung 2: durchschnittliches Fassungsvermögen deutscher Erstligastadien .........7<br />
Abbildung 3: durchschnittliche Auslastung deutscher Erstligastadien.........................8<br />
Abbildung 4: Stadionsanierungen im europäischen Vergleich ....................................9<br />
Abbildung 5: Einkommens- und Beschäftigungswirkungen zusätzlicher<br />
4<br />
Zuschauerausgaben.............................................................................24<br />
Abbildung 6: Angebotsseitige Wirkungen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen ..............28<br />
Abbildung 7: Herkunft finanzieller Mittel für <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong>....................34<br />
Abbildung 8: Ökonomische Wirkungen steuerbefreiter <strong>öffentlich</strong>er Bonds................42<br />
Abbildung 9: Angebot und Nachfrage nach Profisportstadien...................................45<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Zuschauerauslastung ausgewählter Bundesligastadien (1998/99).............7<br />
Tabelle 2: Verwendungsseite finanzieller Mittel für <strong>Stadionprojekte</strong> .........................33
1. Einführung<br />
Profifußball ist in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern seit Jahr-<br />
zehnten mit großem Abstand die beliebteste Zuschauersportart. Angesichts der<br />
zunehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung ist in den letzten Jahren<br />
auch die ökonomische Bedeutung des Profifußballs deutlich gestiegen. Die jährlichen<br />
Einnahmen deutscher Bundesligavereine haben sich seit Beginn der 90er Jahre<br />
bereits mehr als verdoppelt. In der Saison 1996/97 verzeichneten die 18 Erstligisten<br />
einen Gesamtjahresumsatz in Höhe von 956,7 Millionen DM. 1 Der größte Anteil an<br />
diesen Ertragssteigerungen resultiert aus dem exponentiellen Preisanstieg für TV-<br />
Übertragungsrechte nationaler und internationaler Fußballwettbewerbe. 2<br />
Die zunehmende mediale Berichterstattung, verbunden mit fernsehgerechten Spiel-<br />
plänen, einer erhöhten Anzahl von Live-Übertragungen und höheren Einschaltquo-<br />
ten, hat auch zu einem signifikanten Preisanstieg für Trikot- und Bandenwerbung<br />
geführt. 3 Die große Popularität des Profifußballs quer durch alle Bevölkerungs-<br />
schichten bewirkte zuletzt hohe Umsatzsteigerungen im Merchandising-Bereich.<br />
Europäische Spitzenteams wie Manchester United oder Bayern München erreichen<br />
allein im Fanartikel-Geschäft jährliche Umsätze in Höhe von 71 bzw. 50 Millionen DM<br />
(Saison 1997/98). 4<br />
Ist der Anteil traditioneller Zuschauereinnahmen an den Gesamteinnahmen in den<br />
letzten Jahren einerseits gesunken, stellen diese Erlöse andererseits neben den TV-<br />
Geldern immer noch die wichtigste Einnahmequelle zur Finanzierung der<br />
1<br />
Vgl. DG-Bank (1998), S. 5.<br />
2<br />
Die Erlöse aus dem TV-Rechteverkauf an der deutschen Bundesliga sind von 650.000 DM (Spielzeit 1964/65)<br />
auf ca. 320 Millionen DM (Spielzeit 1998/99, Free- und Pay-TV) gestiegen, wobei die größten Zuwächse mit<br />
Aufkommen privater Konkurrenz für die <strong>öffentlich</strong>-rechtlichen Sendeanstalten in den 90er Jahren erzielt wurden.<br />
Im Vergleich zu Spanien (600 Mio. DM), England (630 Mio. DM) und Italien (1 Mrd. DM) sind die deutschen<br />
TV-Rechtepreise immer noch gering, so daß mit einem weiteren Anstieg der Erlöse gerechnet wird, zumal jetzt<br />
auch internationale Medienkonzerne um die Rechte an der nationalen Liga mitbieten. Eine ähnliche<br />
Preisentwicklung hat sich bei der Rechtevergabe an europäischen Mannschaftswettbewerben vollzogen. Den<br />
Zuschlag für die Übertragung der Championsleague 1999/2000 erhielt der dem australischen<br />
Medienunternehmer Murdoch gehörende Sender TM3 für ca. 200 Millionen DM, einem Preisanstieg<br />
gegenbenüber der Vorsaison um 80 Mio. DM bzw. 66 Prozent.<br />
3<br />
Beliefen sich die Erlöse aus Trikotwerbung aller Erstligaclubs Mitte der 90er Jahre auf 51 Millionen DM,<br />
betrugen die Einnahmen in der Spielzeit 1997/98 bereits 90 Mio. DM und in der gerade abgelaufenen Saison<br />
1998/99 ca. 108 Millionen DM. Angaben: Kicker Sportmagazin. Vgl. auch Rahmann et al. (1998), S. 57ff.<br />
4<br />
Vgl. Kramer (1999), S. 129. Andere Quellen dokumentieren bereits jetzt deutlich höhere Umsätze im<br />
Merchandising Bereich für deutsche Spitzenclubs oder sehen in absehbarer Zeit Umsätze für einzelne<br />
Spitzenclubs in dreistelliger Millionenhöhe. Vgl. DG-Bank (1998), S. 15; Hennes/Salz/Wulf (1996), S. 30.<br />
5
Vereinsausgaben dar (siehe Abb. 1). Höhere Zuschauerzahlen in der 1. Liga führten<br />
zusammen mit gestiegenen durchschnittlichen Eintrittspreisen auch hier zu deutli-<br />
chen Einnahmezuwächsen. Gegenüber der Spielzeit 1990/91 (105 Millionen DM)<br />
erhöhten sich die Zuschauereinnahmen aus Erstligabegegnungen um 173 Prozent<br />
auf ca. 287 Millionen DM pro Saison. Ende der 90er Jahre scheinen die Grenzen des<br />
Wachstums der Zuschauererlöse trotz des anhaltenden Fußballbooms für viele deut-<br />
sche Profifußballvereine erreicht. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die unter<br />
quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten oftmals nicht mehr konkurrenzfähigen<br />
Fußballstadien deutscher Bundesligavereine. 5<br />
6<br />
TV-Gelder<br />
33%<br />
Eintrittskarten<br />
30%<br />
Sonst<br />
8%<br />
Abbildung 1: Aufteilung Gesamtumsatz erste Bundesliga (1996/97) 6<br />
Deutsche Erstligavereine stoßen insbesondere bei Spitzenbegegnungen immer<br />
häufiger an ihre Kapazitätsgrenzen. In der Bundesligasaison 1998/99 erreichten<br />
sowohl Vereine mit großen Stadien (z.B. Borussia Dortmund) als auch Bundesligi-<br />
sten, die ihre Heimspiele in mittleren bis kleinen Sportstätten austragen mußten (z.B.<br />
1. FC Kaiserslautern und SC Freiburg), eine durchschnittliche Auslastung ihrer<br />
Stadien von weit über 90 Prozent (vgl. Tabelle 1).<br />
Trikotsponsor<br />
9%<br />
Merchandising<br />
20%<br />
5 Die Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fußballvereine in Anbetracht zu alter und unattraktiver<br />
Stadien ist ein Ergebnis einer umfassenden Untersuchung deutscher Bundesligastadien durch die Münchner<br />
Unternehmensberatung Roland Berger & Partner aus dem Jahre 1998. Zur Notwendigkeit größerer und<br />
modernerer Fußballstadien vgl. auch die Studien von Rahmann et al. (1998) und der DG-Bank (1998).<br />
6 Angaben DG-Bank (1998), S. 7.
Verein Stadion Zuschauerschnitt Auslastung (%)<br />
Borussia Dortmund Westfalenstadion 62.992 91,3<br />
1. FC Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion 40.277 95,9<br />
Bayer Leverkusen BayArena 21.369 95,0<br />
SC Freiburg Dreisamstadion 21.653 96,2<br />
Tabelle 1: Zuschauerauslastung ausgewählter Bundesligastadien (1998/99) 7<br />
Es ist davon auszugehen, daß die absolute Anzahl der Zuschauer bei vielen<br />
(Spitzen-)Begegnungen nur durch die Stadiongröße begrenzt wird. 8 Ein weiteres<br />
Indiz hierfür ist, daß das durchschnittliche Fassungsvermögen aller<br />
Bundesligastadien (1. Liga) in den 90er Jahren stagniert bzw. unter Berücksichtigung<br />
der kommenden Spielzeit sogar tendenziell abnimmt (vgl. Abb. 2), während die<br />
durchschnittliche Auslastung aller Erstligisten kontinuierlich zunimmt (vgl. Abb. 3).<br />
Zuschauerplätze<br />
46000<br />
45000<br />
44000<br />
43000<br />
42000<br />
41000<br />
40000<br />
44574<br />
44346<br />
43791<br />
45149<br />
Abbildung 2: durchschnittliches Fassungsvermögen deutscher Erstligastadien 9<br />
Ein weiterer wichtiger Engpaßfaktor liegt in der oftmals zu geringen Anzahl von<br />
Sitzplätzen. In nicht ausverkauften Begegnungen wirkt oft der qualitativ schlechte<br />
Zustand vieler deutscher Bundesligastadien restriktiv auf die Zuschaueranzahl. 10 Der<br />
7<br />
Angaben Kicker Sportmagazin, Sonderheft Finale 98/99, 1999.<br />
8<br />
Der Zuschauerrekord von Borussia Dortmund (1.070.864 Zuschauer) in der gerade abgelaufenen<br />
Bundesligasaison 1998/99, möglich geworden durch den Ausbau der Stadionkapazität des Westfalenstadions vor<br />
der vergangenen Spielzeit auf 69.000 Plätze, ist ein weiteres Indiz dafür, daß deutsche Bundesligastadien mit<br />
Hilfe quantitativer Verbesserungen mehr Zuschauererlöse einbringen können. Vgl. u.a. Kicker Sportmagazin,<br />
Sonderheft Finale 98/99, 1999.<br />
9<br />
Angaben: Kicker-Sportmagazin.<br />
10<br />
Zu den unter qualitativen Gesichtspunkten unzureichenden Standards deutscher Bundesligastadien vgl. u.a.<br />
Roland Berger (1998); DG-Bank (1998); Rahmann et al. (1998). Der positive Zusammenhang zwischen<br />
Stadionqualität und Besucheraufkommen kann als ein Ergebnis der DFB-Studie zur Situationsanalyse des<br />
7<br />
42796<br />
43473<br />
44145<br />
41912<br />
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
marode Zustand vieler Stadien läßt zukünftig kaum noch Spielraum für<br />
Eintrittspreiserhöhungen. Eine zu geringe Anzahl an überdachten Sitzplätzen, VIP-<br />
Logen und Business-Seats bietet nicht genug Möglichkeiten für eine<br />
einnahmensteigernde Preisdifferenzierung. Zahlungskräftige Zuschauer bleiben<br />
angesichts mangelnder Stadionqualität zum Teil fern. Gleichzeitig werden in dieser<br />
Atmosphäre weitere Einnahmequellen im Catering- und Werbebereich nur<br />
unzureichend ausgeschöpft. 11<br />
8<br />
Auslastung (%)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
56<br />
59<br />
63 64 67<br />
72 72<br />
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99<br />
Abbildung 3: durchschnittliche Auslastung deutscher Erstligastadien 12<br />
Zahlreiche Profivereine anderer großer Fußballnationen stehen vor dem gleichen<br />
Problem, in zu kleinen und veralteten Stadien spielen zu müssen. Deutsche Bundes-<br />
ligastadien sind aber im Vergleich zu den Stadien anderer europäischer Spitzenligen<br />
im Durchschnitt deutlich älter (siehe Abb. 4). Für nicht wenige europäische Spitzen-<br />
clubs wie Manchester United oder Ajax Amsterdam sind in den letzten Jahren große<br />
deutschen Profifußballs festgehalten werden. In einer repräsentativen Umfrage unter Fußballanhängern stand der<br />
Wunsch nach mehr überdachten Sitzplätzen an 2. Stelle (44 %). 12 % der ehemaligen Stadionbesucher gaben die<br />
mangelnde Stadionqualität als Grund für ihr Fortbleiben an. Vgl. Gesellschaft für Konsum-, Markt- und<br />
Absatzforschung (1985). Siehe auch die Studie von Hamm (1996) zum Mönchengladbacher Bökelberg bzw. von<br />
Schröder (1987) zum Weserstadion in Bremen.<br />
11 In der Saison 1997/98 betrug der Anteil der mit höheren Gewinnmargen zu vermarktenden Sitzplätze an der<br />
Gesamtzahl aller Zuschauerplätze deutscher Erstligastadien 68,8 Prozent. In vielen Stadien liegt der<br />
Sitzplatzanteil aber deutlich darunter. Das Wedaustadion, Spielstätte des MSV Duisburg, verfügt bei einer<br />
Gesamtkapazität von 30.128 Plätzen über einen Sitzplatzanteil von nur 33,2 Prozent. Da bei den lukrativen<br />
europäischen Pokalwettbewerben in der Vorsaison aus Sicherheitsgründen nur 40% des Stehplatzkontingents<br />
ausgenutzt werden durften, konnte der MSV Duisburg als deutscher Vertreter im Europapokal der Pokalsieger<br />
1998/99 nur ca. 18.000 der möglichen 30.000 Eintrittskarten pro Spiel verkaufen. Vor einem ähnlichen Dilemma<br />
steht der UEFA-Cup Teilnehmer VFL Wolfsburg in der kommenden Spielsaison, in der die UEFA keine<br />
Stehplatzkontingente mehr zuläßt. Das VFL Stadion verfügt lediglich über 2.530 Sitzplätze, einem Anteil von<br />
15,8 Prozent. Trägt der VFL die europäischen Pokalspiele in seinem eigenen Stadion aus, könnte er unter<br />
Berücksichtigung der UEFA-Auflagen lediglich 2.530 Eintrittskarten pro Spiel verkaufen, eine für UEFA-Cup<br />
Spiele unvorstellbar geringe Zahl. Vgl. zu den Sitzplatzkontingenten deutscher Bundesligastadien DG-Bank<br />
(1998), S. 13.<br />
12 Angaben: Kicker-Sportmagazin.
und sehr moderne Fußballstadien neu gebaut oder bestehende Stadien grundlegend<br />
saniert worden, so daß diese Sportstätten ein deutlich höheres Einnahmepotential im<br />
Vergleich zu den durchschnittlichen deutschen Bundesligastadien bieten. Ähnliches<br />
gilt für die Vereine, die ihre Heimspiele in den Austragungsstätten der Europamei-<br />
sterschaft 1996 in England und der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich austragen<br />
können.<br />
9<br />
15<br />
6<br />
0,33<br />
5<br />
14<br />
*: Sanierungssumme mindestens DM 20 Mio.<br />
Abbildung 4: Stadionsanierungen im europäischen Vergleich 13<br />
Im Zeitraum von 1988 bis 1998 sind in Europa zehn moderne Fußballstadien neu<br />
erbaut worden, keines davon in Deutschland. Sämtliche Stadionneubauten sind reine<br />
Sitzplatzstadien. 14 In fünf dieser Fußballstadien (St. Denis, Arnheim, Amsterdam,<br />
Wimbledon und Turin) sind zudem alle Plätze überdacht. Im Vergleich dazu sind in<br />
Deutschland nur 6 Prozent aller Erstligastadien reine Sitzplatzstadien. Lediglich 30<br />
Prozent der Stadien bieten vollständig überdachte Zuschauerplätze an. Ein über-<br />
dachtes Spielfeld ähnlich wie in Amsterdam oder Arnheim gibt es in Deutschland<br />
noch nicht, ist aber für die in puncto Komfort und Größe sehr moderne Arena „Auf<br />
Schalke“, die sich 1999 noch im Bau befindet, vorgesehen. 15 Weitere moderne, den<br />
13 Angaben: Roland Berger (1998).<br />
14 Sitzplätze können angesichts höherer Margen mehr Nettoeinnahmen bringen. Reine Sitzplatzstadien sind von<br />
den „echten“ Fußballfans unerwünscht. Vgl. dazu u.a. Schulze-Marmeling (1999). Es besteht somit die Gefahr,<br />
daß in reinen Sitzplatzstadien für Stimmung sorgende „echte“ Fans ausbleiben und die schlechtere Atmosphäre<br />
auch negativ auf andere Zuschauer wirkt. Schalke 04, ein Verein mit vielen Fans und langer Tradition, hat bei<br />
seinem Stadionprojekt „Auf Schalke“ entgegen den anderen Stadionneubauten die Wünsche aller Zuschauer<br />
berücksichtigt und Stehplatzkontingente eingeplant.<br />
15 Vgl. zu der Modernität neuer und deutscher Fußballstadien Roland Berger (1998).<br />
6<br />
11<br />
1,3 1,2 0,985<br />
Deutschland Großbritannien Frankreich Italien<br />
Durchschnittlicher Zeitraum seit letzter umfangreicher Sanierung*<br />
Anzahl umfangreich sanierter Stadien* 1988 -1998<br />
Investitionssumme umfangreich sanierter Stadien* 1988-1998 (Mrd. DM)<br />
8<br />
13
neuen wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werdende Fußballstadien, gibt es in<br />
Deutschland bislang nur wenige. 16<br />
Eine grundlegend andere Situation im Vergleich zu Deutschland findet sich in den<br />
USA. In den USA ist in den letzten Jahren ein regelrechter Bauboom zu verzeichnen.<br />
31 Teams der Major League Baseball (MLB) und National Football League (NFL)<br />
bekamen zwischen 1989 und 1997 ein neues bzw. modernisiertes Stadion, das den<br />
neuen wirtschaftlichen Anforderungen gerecht wird. 39 andere Teams suchen ein<br />
neues Stadion oder werden in absehbarer Zeit in eine modernere Austragungsstätte<br />
für ihre Heimspiele umziehen. 17<br />
Die neuen bzw. modernisierten Stadien in den USA und Europa zeichnen sich nicht<br />
nur durch mehr Luxus und Komfort aus. Zwei weitere wichtige Trends sind in diesem<br />
Zusammenhang zu nennen. Die Baukosten für die modernen Stadien sind in den<br />
letzten Jahrzehnten angesichts der neuen Anforderungen und eingesetzten Techno-<br />
logien inflationsbereinigt um ein Vielfaches gestiegen. 18 Ein mit Fußballstadien<br />
vergleichbares profigerechtes Football-Stadium kostete 1997 bereits mindestens 200<br />
Millionen US-$. Die teuersten Varianten verursachten Konstruktionskosten in Höhe<br />
von 500 Millionen US-$; Planungen für ein neues „Yankee-Stadium“ in New York<br />
16<br />
Beispiele für unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten relativ attraktive Bundesligastadien sind z.B. die<br />
„BayArena“ in Leverkusen, das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, das Gottfried-Daimler-Stadion in<br />
Stuttgart und das Westfalenstadion in Dortmund. Während die moderne BayArena den quantitativen FIFA-<br />
Richtlinien zur Austragung von WM-Spielen nicht genügt (die FIFA setzt in ihrem neuen Pflichtenheft eine<br />
Mindestkapazität von 40.000 Plätzen voraus), sind die geplanten Ausbau- und Modernisierungsvorhaben in<br />
Dortmund und Stuttgart noch nicht abgeschlossen, so daß die unter quantitativen und qualitativen Aspekten<br />
besten deutschen Bundesligastadien nur bedingt mit hochmodernen Stadien wie der Arena Amsterdam oder dem<br />
„Stade de France“ in St. Denis nahe Paris vergleichbar sind. Vgl. z.B. Chervell (1998); o.V. (1999a).<br />
Gleichzeitig sind die genannten deutschen Stadien aber bedeutend besser als der nationale Durchschnitt und<br />
bieten somit den Vereinen deutlich bessere Einnahmemöglichkeiten.<br />
17<br />
Vgl. Noll/Zimbalist (1997a), S. 5; Armacost (1997). Baade/Dye (1990), S. 1 sprechen im Hinblick auf den<br />
Boom im Stadionbau von einer “Stadium Mania“.<br />
18<br />
Okner (1974), S. 339ff. stellte bereits Anfang der 70er Jahre im Zusammenhang mit einer empirischen<br />
Untersuchung über Subventionen von Sportstadien und -arenen einen signifikanten Kostenanstieg „neuerer“<br />
Stadien aus den 70er Jahren gegenüber älteren Stadien früherer Jahrzehnte fest. Daß dieser Trend sich bis in die<br />
90er Jahre fortsetzte, zeigen neuere Untersuchungen. Vgl. z.B. Quirk/Fort (1992), S. 154 ff.; Baim (1994);<br />
Noll/Zimbalist (1997c), S.5. Baade/Dye (1990), S. 3 stellen ferner in Bezug auf die Kostenentwicklung USamerikanischer<br />
Sportstadien fest: „Increases in the construction cost index have been approximately 50 percent<br />
and 100 percent greater than increases for the consumer and wholesale price indices respectively for the 1965 to<br />
1989 period.“ Rahmann et al. (1998), S. 130f. sehen einen positiven Zusammenhang zwischen der<br />
Investitionskosten- und Betriebskostenhöhe. Dieser positive Zusammenhang wird durch eine empirische Studie<br />
zu den Konstruktions- und Betriebskosten von US-Profisportstadien bestätigt. Vgl. dazu Quirk/Fort (1992),<br />
Chapter 4.<br />
10
veranschlagen Konstruktionskosten von bis zu einer Milliarde US-$. 19 Daneben<br />
werden die Stadien in Europa und den USA immer mehr auf die Erfordernisse und<br />
Bedürfnisse einer Sportart ausgerichtet. Erlauben neue Dachkonstruktionen,<br />
Konferenzräume, Erlebnis- und Freizeitbereiche, Restaurants, Stadionhotels, etc. auf<br />
der einen Seite die Durchführung nichtsportlicher (z.B. politischer, wirtschaftlicher,<br />
kultureller oder religiöser) Veranstaltungen, werden auf der anderen Seite die neuen<br />
Stadien mehrheitlich so konzipiert, daß sie im Gegensatz zu früheren Mehrzwecksta-<br />
dien nur noch für eine Sportart ausgelegt sind. 20<br />
US-amerikanische Profisportstadien sind genau wie deutsche Bundesligastadien<br />
überwiegend im <strong>öffentlich</strong>en Besitz. Dies gilt insbesondere für die neuen, modernen<br />
Stadien. 21 Angesichts des anhaltenden Baubooms rechnet man in den USA mit<br />
<strong>öffentlich</strong>en Ausgaben für Stadionbauten bzw. -modernisierungen für den Zeitraum<br />
von 1997 bis 2006 in Höhe von ca. 7 Milliarden US-$. Auch für Deutschland<br />
wünschen sich viele Bundesligavereine einen <strong>öffentlich</strong> geförderten Bauboom.<br />
Moderne, hinreichend große Bundesligastadien sind nicht nur die Voraussetzung<br />
dafür, den Zuschlag für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu erhalten. 22<br />
Neue bzw. modernisierte Sportstätten vergrößern bestehende und erschließen neue<br />
Einnahmequellen. Höhere Zuschauereinnahmen bieten bessere Bedingungen dafür,<br />
19<br />
Vgl. zu den Konstruktionskosten Noll/Zimbalist (1997c), S. 495. Die Kosten beinhalten auch die Preise für<br />
benötigte Grundstücke sowie für die unterstützende Infrastruktur. Siehe auch die Übersicht zu den<br />
Konstruktionskosten US-amerikanischer Profistadien (1884-1990) von Quirk/Fort (1992), S. 161ff., Table 4.14.<br />
20<br />
Vgl. z.B. Baade/Sanderson (1997), S. 113; Noll/Zimbalist (1997c), 494f. Ähnliche Tendenzen sind auch in<br />
Deutschland zu erkennen. Derzeit spielen noch ca. Zweidrittel aller Bundesligavereine in Mehrzweckstadien mit<br />
Tartan- bzw. Aschenbahn, was unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für diese Vereine einen Nachteil darstellt,<br />
vgl. Roland Berger & Partner (1998). Neue bzw. modernisierte Fußballstadien wie in Leverkusen, Dortmund,<br />
Kaiserslautern oder Schalke (im Bau) werden daher zumeist als reine Fußballstadien konzipiert.<br />
21<br />
Ursprünglich waren US-amerikanische Profistadien mehrheitlich in privater Hand. Mit dem Aufschwung des<br />
Profiteamsports zum nationalen Massenphänomen trat eine entgegengesetzte Entwicklung ein. Seit 1953 ist die<br />
Mehrheit der Profisportstadien in <strong>öffentlich</strong>em Besitz. 1991 waren bereits 77 % der Stadien <strong>öffentlich</strong>, ein Trend<br />
der sich weiter fortsetzt. Stadionneubauten für den US-Profiteamsport zwischen 1960 und 1997 sind zu 86 %<br />
<strong>öffentlich</strong>es Eigentum. Auch die Stadien in der Minor League sind zu 90 % im <strong>öffentlich</strong>en Besitz. Vgl. zum<br />
Trend zu immer mehr <strong>öffentlich</strong>en Profisportstadien in den USA Noll/Zimbalist (1997a), S. 2f.; Baim (1994), S.<br />
1ff.; Okner (1974), S. 326f.; Crompton (1995), S. 14 und zur Minor League Johnson (1989). In Deutschland<br />
wird der Sportstättenbau historisch als eine <strong>öffentlich</strong>e Aufgabe interpretiert, woran sich bis heute kaum etwas<br />
geändert hat. Vgl. Rahmann et al. (1998), S. 177ff. In der Spielsaison 1997/98 waren fast alle Erstligastadien<br />
Eigentum der <strong>öffentlich</strong>en Hand. Nur der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen sind Eigentümer ihrer<br />
Stadien. Borussia Dortmund hält Anteile am Westfalenstadion. Vgl. DG-Bank (1998). Neue <strong>Stadionprojekte</strong> in<br />
Schalke und Hamburg sehen ebenfalls die Vereine als Miteigentümer vor. Vgl. u.a. Frisch (1998), S. 30 und FC<br />
Schalke 04 Stadion-Beteiligungsgesellschaft (1998).<br />
22<br />
Vgl. zu den Anforderungen an WM-Stadien die Studie zu den sozio-ökonomischen <strong>Auswirkungen</strong> der<br />
Fußball-WM 2006 in Deutschland von Rahmann et al. (1998). Da die FIFA im Anschluß an die Studie (1999)<br />
die Mindestanforderungen an die Stadionkapazität für Vorrundenspiele nochmals auf 40.000 Zuschauer<br />
angehoben hat, ergibt sich gegenüber den Studienergebnissen ein noch größerer Bedarf an neuen bzw.<br />
modernisierten Stadien in Deutschland.<br />
11
eine leistungsstarke Mannschaft in die nationalen und internationalen Wettbewerbe<br />
zu schicken. Um gegenüber den europäischen und nationalen Profivereinen, die<br />
bereits jetzt oder in naher Zukunft in modernen Stadien spielen können, wettbe-<br />
werbsfähig bleiben zu können, sind viele Clubs auf neue bzw. modernisierte Stadien<br />
dringend angewiesen.<br />
Viele Kommunen sehen sich daher in zunehmenden Maße Forderungen von<br />
Vereinen und Verbänden nach neuen bzw. modernisierten Stadien ausgesetzt.<br />
Sportstättenbau wurde in Deutschland historisch als eine <strong>öffentlich</strong>e Aufgabe<br />
interpretiert. Im Vergleich zu den 70er Jahren, wo anläßlich der Fußball-WM 1974 in<br />
Deutschland <strong>öffentlich</strong>e Investitionen in deutsche Bundesligastadien getätigt wurden,<br />
hat sich die Situation aus kommunaler Sicht jedoch in drei Punkten grundlegend<br />
geändert.<br />
Erstens sind - wie oben dargelegt - deutlich höhere Investitionsausgaben erforderlich,<br />
um wirtschaftlich attraktive Stadien zu bauen. 23 Dies ist um so problematischer, als<br />
daß sich zweitens die kommunale Haushaltssituation im Vergleich zu den 70er<br />
Jahren vehement verschlechtert hat und sehr hohe kommunale Defizite nur geringen<br />
Spielraum für Investitionsentscheidungen zulassen. 24 Drittens haben sich die<br />
Fußballvereine seit den 70er Jahren immer mehr zu mittelständischen Wirtschafts-<br />
unternehmen entwickelt. Während die Einnahmen der Profivereine kontinuierlich<br />
angestiegen sind, hat der kommunale Anteil an den Einnahmen stetig abgenommen,<br />
der <strong>öffentlich</strong>e Anteil an den Kosten gleichzeitig zugenommen. 25 Eine ähnliche<br />
23<br />
Die <strong>öffentlich</strong>en Investitionen in deutsche WM-Stadien zu Beginn der 70er Jahre waren insgesamt geringer als<br />
heutige Baukosten einzelner supermoderner Fußballarenen. Den Ergebnissen der Studie von Roland Berger<br />
(1998) zu Folge erfordert die Ausrichtung der Fußball-WM 2006 in Deutschland den Bau von mindestens<br />
300.000 zusätzlichen Stadionplätzen für ca. 1 Mrd. DM. Rahmann et al. (1998), S. 130ff. gehen je nach Wahl<br />
der Austragungsstandorte von Investitionskosten zwischen ca. 0,5 und 2,4 Milliarden DM aus, ohne dabei jedoch<br />
mögliche Infrastrukturinvestitionen außerhalb des Stadions zu berücksichtigen. Da von den Stadioninvestitionen<br />
nur ein Teil der Erstligastadien profitieren würde, es sich zudem nur um Investitionen zur Erfüllung der FIFA-<br />
Mindestanforderungen handelt und diese in der Zwischenzeit nochmals verschärft wurden, ist davon<br />
auszugehen, daß der Investitionsbedarf für alle Erstligastadien bei mehreren Millarden DM liegt. Allein die<br />
Umbauten bzw. Sanierungsmaßnahmen beider deutscher Olympiastadien (Berlin und München) veranschlagen<br />
bereits fast 1 Mrd DM. Hinzu kommen weitere Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen außerhalb des<br />
eigentlichen Stadions (z.B. Verkehrsanbindung).<br />
24<br />
Vgl. u.a. Rahmann et al. (1998), S. 177ff.; Maennig (1991), S. 36.<br />
25<br />
Vgl. Owen/Beitsch (1997) und die dort dokumentierten Ergebnisse der Real Estate Research Consultants<br />
Studie über die kommunalen Anteile an Stadioneinnahmen und -kosten in den USA. Auch in Deutschland ist ein<br />
Auseinanderfallen von Kostenträger und Einnahmenbezieher feststellbar. Während die Kommunen den Großteil<br />
der Kosten für die Bereitstellung der Sportstätten tragen, erzielen private Veranstalter, insbesondere<br />
Fußballvereine, durch die Nutzung dieser Sportstätten immer höhere Einnahmen, ohne sich entsprechend an den<br />
12
Entwicklung vollzog sich auch in den USA, wenngleich hier weniger kommunale<br />
Defizite sondern vielmehr rückläufige Bundes- und Landeszuschüsse für lokale<br />
Projekte sowie Steuersenkungen zu strengeren kommunalen Budget-Restriktionen<br />
führten. 26<br />
Die Ausgangslage im Sportstättenbereich läßt sich dahingehend zusammenfassen,<br />
daß Vereine unter Wettbewerbsgesichtspunkten auf neue bzw. modernisierte<br />
Stadien angewiesen sind. Aus kommunaler Sicht stellt sich jedoch das Problem, daß<br />
den immer knapper werdenden <strong>öffentlich</strong>en Haushaltsbudgets immer höhere<br />
Stadioninvestitionen gegenüberstehen, während gleichzeitig die Refinanzierungs-<br />
möglichkeiten durch Einnahmen aus dem Stadionbetrieb rückläufig sind. Es stellt<br />
sich aus kommunaler Sicht die Frage, ob eine überwiegend <strong>öffentlich</strong>e Finanzierung<br />
und Bereitstellung moderner Profisportstadien eine lohnenswerte Investition darstellt.<br />
Ziel dieses Beitrages ist es, vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage die allokativen<br />
und distributiven <strong>Auswirkungen</strong> der bisherigen Praxis <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitio-<br />
nen darzustellen und ein Fazit hinsichtlich des ökonomischen Wertes dieser Investi-<br />
tionen zu ziehen. Da neben dem Profisport viele andere gesellschaftliche Gruppen<br />
die <strong>öffentlich</strong>e Unterstützung ihrer Anliegen verlangen, erfordert der zunehmende<br />
Wettbewerb um <strong>öffentlich</strong>e Mittel eine genauere Prüfung der Mittelverwendung. Im<br />
Hinblick auf die zunehmende Ökonomisierung der politischen Entscheidungsfindung<br />
eignen sich hierfür vor allem formal-ökonomische Analysen. 27<br />
Zur Legitimation hoher <strong>öffentlich</strong>er Ausgaben für Stadionneubauten und<br />
-modernisierungen sind in den letzten Jahren zahlreiche Studien über die ökonomi-<br />
schen <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen von verschiedenen Interes-<br />
sengruppen in Auftrag gegeben worden. Zu diesen Interessengruppen gehören in<br />
erster Linie Profivereine, Sportverbände, regionale Wirtschaftsverbände und<br />
Kosten zu beteiligen. Angesichts dieser Misere fordert der Deutsche Städtetag eine Beteiligung der Kommunen<br />
an den erzielten TV-Geldern. Vgl. o.V. (1998b), S. 26.<br />
26<br />
Vgl. zu den rückläufigen Haushaltsbudgets US-amerikanischer Kommunen u.a. Baim (1994), S. 189f.;<br />
Baade/Dye (1988).<br />
27<br />
Vgl. Baade/Dye (1988); Kurscheidt/Rahmann (1999); Maennig (1998), S. 311. Maennig weist zudem darauf<br />
hin, daß formal-ökonomische Analysen auch wegen gesetzlicher Bestimmungen und aus Gründen der<br />
Vergleichbarkeit notwendig sind.<br />
13
Kommunalpolitiker. 28 Fast alle diese Auftragsstudien kommen zu dem Ergebnis, daß<br />
die <strong>öffentlich</strong>en Investitionen in Profisportstadien gerechtfertigt sind, da sie zu mehr<br />
Einkommen und Beschäftigung in der Bevölkerung führen. In Kapitel 2 wird die<br />
übliche Argumentationsweise der Stadionbefürworter skizziert.<br />
Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß viele <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen nicht<br />
zu den von den Befürwortern prognostizierten positiven ökonomischen <strong>Auswirkungen</strong><br />
für die Bevölkerung führten, sondern oftmals sogar negative wirtschaftliche Auswir-<br />
kungen mit sich brachten, 29 beschäftigen sich immer mehr unabhängige Wissen-<br />
schaftler mit den ökonomischen <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen. In<br />
Kapitel 3 wird diese unabhängige Sichtweise in Form von theoretischen Überlegun-<br />
gen und empirischen Untersuchungen den Ergebnissen der Auftragsstudien gegen-<br />
übergestellt. Schließlich werden in Kapitel 4 die wichtigsten Ergebnisse zusammen-<br />
gefaßt und Rückschlüsse auf eine geeignete Stadionfinanzierung in Deutschland<br />
gezogen.<br />
2. Ökonomische <strong>Auswirkungen</strong> aus Sicht der Stadionbefürworter<br />
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten ökonomischer Studien, die zur<br />
Legitimation <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen erstellt bzw. herangezogen werden. 30<br />
Hier sind als erstes allgemeine makroökonomische Analysen zur Bedeutung des<br />
(Fußball-)Sports für Bund, Länder und Gemeinden zu nennen. Diese Studien sind<br />
relativ ungenau und wenig aussagekräftig in bezug auf konkrete Investitionsvorha-<br />
ben. Spezielle economic impact studies eignen sich von daher besser. Bei der Frage<br />
ob und wenn ja, in welcher Höhe <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen getätigt werden<br />
sollen, handelt es sich um eine komplexe Entscheidungssituation mit hoher Wertig-<br />
keit. Öffentliche Stadionbaumaßnahmen zeichnen sich nicht nur durch ein hohes<br />
Investitionsvolumen aus. Die sich anschließende Diskussion zeigt, daß von den<br />
Investitionen eine hohe Wirkungsvielfalt, verbunden mit bedeutenden externen<br />
28 Während die Profivereine durch die Stadioninvestitionen ein höheres Einnahmepotential erhalten, erhoffen<br />
sich verschiedene regionale Unternehmen höhere Umsätze durch Bauaufträge, Fanausgaben, etc. Politiker<br />
können aus verschiedenen Gründen ein Interesse an den Stadioninvestitionen haben. Wegen der oft hohen<br />
Popularität der Vereine in der Bevölkerung und den Wirtschaftsinteressen regionaler und überregionaler<br />
Lobbyisten können sie mit Stadioninvestitionen sowohl wahltaktische Ziele als auch private Zwecke verfolgen.<br />
29 Vgl. dazu u.a. Baim (1994), S. 189f.; Baldo (1991), S. 34 und Baade/Dye (1990), S. 5. Baade/Dye weisen in<br />
diesem Zusammenhang darauf hin, daß die schlechten Erfahrungen vieler Kommunen in Form enormer<br />
<strong>öffentlich</strong>er Defizite durch Stadioninvestitionen z.B. in Pontiac, Michigan (Silverdome) und New Orleans<br />
(Superdome) den Widerstand der Steuerzahler in ganz USA hervorgerufen haben.<br />
30 Vgl. Késenne (1997), S. 4.<br />
14
Effekten ausgeht, die über einen längerfristigen Zeitraum nachwirken. In derartigen<br />
Situationen sind besonders Kosten-Nutzen-Analysen geeignet, um die Vorteilhaftig-<br />
keit von Investitionsmaßnahmen zu bestimmen. 31<br />
Kosten-Nutzen-Analysen lassen sich vereinfacht in klassische und erweiterte (sozio-<br />
ökonomische) Analysen unterscheiden. Klassische Kosten-Nutzen-Analysen unter-<br />
suchen gemäß dem Kaldor-Hicks-Kriterium, ob die Gewinner einer Investition die<br />
Verlierer voll kompensieren können und den Gewinnern dennoch ein Überschuß<br />
verbleibt. Ist der Gesamtnutzen größer als die Gesamtkosten, gilt die Maßnahme als<br />
wohlfahrtssteigernd (rein allokative Sichtweise). Ob die Kompensation der Verlierer<br />
tatsächlich durchgeführt wird (distributive Sichtweise), ist für die<br />
Vorteilhaftigkeitsentscheidung unbedeutend. 32<br />
Investitionsentscheidungen führen gerade im Sportbereich zu bedeutenden Vertei-<br />
lungswirkungen. Zudem sind gerade die gewählten Finanzierungsmodelle für das<br />
Ausmaß (negativer) Verteilungswirkungen entscheidend. Da hier nicht der Frage<br />
nachgegangen werden soll, ob Sportstadien für sich genommen lohnenswerte<br />
Investitionen darstellen, sondern vielmehr untersucht wird, ob die bisherige Praxis<br />
der überwiegend rein <strong>öffentlich</strong>en Finanzierung eine aus kommunaler Sicht lohnens-<br />
werte Investition darstellt, eignen sich im vorliegenden Fall erweiterte Kosten-Nutzen-<br />
Analysen in besonderem Maße. 33 Erweiterte Kosten-Nutzen-Analysen berücksich-<br />
tigen in ihrem Ergebnis auch Verteilungswirkungen. 34 Die Berücksichtigung von<br />
Verteilungswirkungen erfordert zumindest eine grobe Bewertung dahingehend, was<br />
31 Vgl. Rahmann et al. (1998), S. 88; Mühlenkamp (1994); Thöni (1984).<br />
32 Vgl. Maennig (1998), S. 323f.; Luckenbach (1986), S. 33f. Bei der hier angesprochenen Kompensation der<br />
Verlierer handelt es sich einzig um eine personelle Umverteilung, nicht aber um die funktionale Distribution.<br />
33 In diesem Zusammenhang muß auch geprüft werden, ob <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen aus ökonomischer<br />
Sicht weiterhin in den Aufgabenbereich der <strong>öffentlich</strong>en Hand fallen. Durch den möglichen Ausschluß vom<br />
Konsum (Erhebung von Benutzungsentgelten und Eintrittspreisen) und der zunehmenden Rivalität im Konsum<br />
(Kapazitätsengpässe) handelt es sich nicht mehr um ein <strong>öffentlich</strong>es Gut im eigentlichen Sinne. Meritorische<br />
Interessen wie die Förderung des Sportes, verbunden mit einem höheren Freizeit- und Unterhaltungswert,<br />
positiven Gesundheitswirkungen innerhalb der Bevölkerung, etc., konnten in früheren Jahrzehnten glaubhaft als<br />
Rechtfertigungsgrund für <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> angeführt werden. Im Gegensatz zu früher hat die<br />
zunehmende Professionalisierung und Kommerzialisierung des Profifußballs in Deutschland den Anteil privater<br />
Nutzen durch die Bereitstellung von <strong>öffentlich</strong>en Fußballstadien deutlich ansteigen, den Anteil <strong>öffentlich</strong>er<br />
Nutzen dagegen abnehmen lassen. Der absolut gesehen immer noch hohe <strong>öffentlich</strong>e Nutzen dieser Stadien läßt<br />
die Beteiligung der <strong>öffentlich</strong>en Hand an den Stadioninvestitonen weiterhin sinnvoll erscheinen. Die<br />
nachfolgende Diskussion zeigt aber, daß die rein <strong>öffentlich</strong>e Finanzierung der Investitionen ineffizient geworden<br />
ist und die privaten Nutznießer der Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten stärker an den Kosten beteiligt<br />
werden müssen.<br />
34 Vgl. Maennig (1998), S. 323f.; Késenne (1997), S. 4.<br />
15
unter distributiven Gesichtspunkten gewünscht bzw. nicht gewünscht wird. Dabei soll<br />
im folgenden nicht die Frage nach der „gerechten“ Verteilung beantwortet werden. In<br />
der Literatur gibt es aber große Übereinstimmung dahingehend, daß eine Umvertei-<br />
lung von arm nach reich unerwünscht ist. 35<br />
Neben den eher nachfrageseitigen Argumentationen für <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitio-<br />
nen werden in Zusammenhang mit den speziellen economic impact studies auch<br />
angebotsseitige Erklärungen (z.B. Agglomerationstheorien) von Stadionbefürwortern<br />
angeführt. Im folgenden werden nun die typischen Rechtfertigungen für <strong>öffentlich</strong>e<br />
Stadioninvestitionen aus der Sicht der Stadioninteressenten mit Hilfe von allgemei-<br />
nen (Abschnitt 2.1) und speziellen makroökonomischen Studien (Abschnitt 2.2) kurz<br />
skizziert, bevor im nachfolgenden Kapitel 3 eine objektive Bewertung der Ergebnisse<br />
erfolgt.<br />
2.1. Allgemeine makroökonomische Analysen<br />
Allgemeine makroökonomische Analysen versuchen, die allgemeine Bedeutung des<br />
Sports als Bestandteil der überregionalen oder regionalen Ökonomie zu ergründen. 36<br />
Sie liefern vor allem statistische Ergebnisse, z.B. über den (über-)regionalen Anteil<br />
des Sports an den Ausgaben, der Produktion, dem Einkommen, der Beschäftigung<br />
oder den Steuereinnahmen. In der jüngeren Vergangenheit sind bereits einige (z.T.<br />
groß angelegte) Studien über die wirtschaftliche Bedeutung des Sports von unab-<br />
hängigen Wissenschaftlern durchgeführt worden. 37 Die zum Teil sehr ähnlichen<br />
Ergebnisse suggerieren, daß der Sport in vielen westeuropäischen Ländern und<br />
Regionen zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden ist. Bis zu zwei Prozent<br />
des Bruttosozialproduktes sind direkt oder indirekt auf den Sportsektor zurückzufüh-<br />
ren. Ca. zwei Prozent aller Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Sport ab.<br />
Daneben zeigen einige Studien, daß die Steuereinnahmen aus dem Sportsektor die<br />
<strong>öffentlich</strong>en Fördergelder für den Sport z.T. übersteigen. 38<br />
35 Vgl. Baim (1994), S. 162f.<br />
36 Vgl. dazu u.a. Késenne (1997).<br />
37 Studien zur wirtschaftlichen Bedeutung des Sports wurden z.B erstellt von Weber et al. (1995) für<br />
Deutschland, Jones (1989) für verschiedene westeuropäische Länder und Couder/Késenne für die belgische<br />
Region Flandern.<br />
38 Vgl. Késenne (1997), S. 5ff.<br />
16
Aufgrund der höheren Glaubwürdigkeit unabhängiger Studien und den beachtlichen<br />
Kosten der Durchführung eigener Untersuchungen, greifen Stadionbefürworter<br />
oftmals auf die Ergebnisse der bereits vorhandenen Analysen zurück. Dabei<br />
interpretieren sie die Ergebnisse so, daß <strong>öffentlich</strong>e (Stadion)Investitionen aus<br />
verschiedenen Gründen als lohnenswert erscheinen. 39 Angesichts der hohen<br />
wirtschaftlichen Bedeutung des Sports würden im Falle rückläufiger Fördermittel<br />
Einkommen und Beschäftigung in der Bevölkerung sinken. Da die Steuereinnahmen<br />
aus dem Sportbereich z.T. größer als die <strong>öffentlich</strong>en Fördermittel sind, verlangen<br />
einige Sportvertreter die Erhöhung der Fördermittel. Ihrer Ansicht nach würden<br />
<strong>öffentlich</strong>e Ausgaben durch höhere (Steuer)Einnahmen überkompensiert. Da der<br />
Fußball in den meisten westeuropäischen Ländern im Sportsektor auch unter<br />
wirtschaftlichen Aspekten die bedeutendste Position einnimmt, 40 werden beide<br />
Argumentationsweisen oftmals für Stadioninvestitionen herangezogen.<br />
2.2. Spezielle makroökonomische Analysen<br />
Der gesellschaftliche Nutzen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen variiert in Abhängigkeit<br />
vom vorhandenen Nachfragepotential und Investitionsbedarf. 41 Sowohl das Nachfra-<br />
gepotential (bestimmt durch Bevölkerungsdichte, Einzugsgebiet, Kaufkraft,<br />
Nachfrage nach Fußballsport, etc.) als auch die vorhandene Infrastrukturausstattung<br />
sind von Region zu Region unterschiedlich, so daß die auf überregionalen, allgemei-<br />
nen makroökonomischen Analysen basierenden Pauschalaussagen einiger<br />
Stadionbefürworter über den gesellschaftlichen Wert von Stadioninvestition<br />
ungeeignet sind. Daher werden zumeist spezielle makroökonomische Analysen zur<br />
Legitimation <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen in Auftrag gegeben. Die Mehrzahl<br />
dieser Auftragsstudien betont die kurz- bis mittelfristigen Nachfrageimpulse<br />
<strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen auf die lokale Wirtschaftskraft. Die Aussagen dieser<br />
Art von Untersuchungen erwecken beim Leser vielfach den Anschein, als handele es<br />
sich um die Ergebnisse erweiterter Kosten-Nutzen-Analysen. 42 Ein kleiner Teil der<br />
39<br />
Vgl. zur Interpretation der Ergebnisse unabhängiger makroökonomischer Studien Késenne (1997), S. 5ff.<br />
40<br />
Vgl. dazu u.a. die Ergebnisse von Rahmann et al. (1998), die aufbauend auf den Ergebnissen von Weber et al.<br />
(1995) eine qualitative Einschätzung der wirtschaftlichen Bedeutung des Fußballsports vornehmen.<br />
41<br />
Vgl. Rahmann et al. (1998), S. 116ff.<br />
42<br />
Vgl. dazu u.a. Baim (1994); Baade/Dye (1990); Crompton (1995) und die Ergebnisse der dort jeweils<br />
angegebenen zahlreichen Auftragsstudien. Bereits an dieser Stelle sei angemerkt, daß der Großteil der speziellen<br />
nachfrageorientierten Studien keine erweiterten Kosten-Nutzen-Analysen sind. Es handelt sich vielmehr oft um<br />
Input-Output-Studien, Kapitalwertrechnungen, etc., die keine alternativen Investitionsmöglichkeiten bzw.<br />
Opportunitätskosten in den Berechnungen berücksichtigen. Handelt es sich tatsächlich um Kosten-Nutzen-<br />
17
Studien argumentiert über längerfristige angebotsseitige Wirkungen auf die<br />
regionalwirtschaftliche Entwicklung.<br />
2.2.1. Nachfrageorientierte Analysen<br />
Attraktiver Profiteamsport kann vor allem durch Zuschauerausgaben innerhalb und<br />
außerhalb des Stadions Nachfrageimpulse auslösen. Um attraktive Profiteams und<br />
damit attraktiven Zuschauersport in die Stadt zu holen bzw. in der Stadt zu halten,<br />
sind <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen notwendig.<br />
2.2.1.1. Stadioninvestitionen als Voraussetzung für attraktiven Zuschauersport<br />
Sowohl unter Stadionbefürwortern als auch in der unabhängigen Literatur herrscht<br />
ein breiter Konsens darüber, daß moderne, ausreichend große Profistadien die<br />
Voraussetzung für attraktiven Profisport bieten. Für US-amerikanische Profiteams<br />
kann dies folgendermaßen erklärt werden: 43 In den USA werden die vier größten<br />
Profiligen National Basketball Association (NBA), National Hockey League (NHL),<br />
National Football League (NFL) und Major League Baseball (MLB) genau wie die<br />
jeweiligen Teams privatwirtschaftlich geführt. Die genossenschaftsähnlich struktu-<br />
rierten Ligen halten die Anzahl der Mannschaften je Liga künstlich knapp, um somit<br />
Monopolrenten bei TV-Geldern, Merchandising-Produkten, etc. abzuschöpfen.<br />
Gleichzeitig gibt es mehr Kommunen, die Profiteams in ihren Städten spielen lassen<br />
wollen, als Profiteams existieren. Da die Teams aus sportlichen Gründen weder auf-<br />
noch absteigen können und Profisport in den USA ein knappes, national äußerst<br />
beliebtes Phänomen ist, können die Teambesitzer glaubwürdig mit dem Wegzug<br />
(Relocation) ihres Teams in eine andere Stadt drohen.<br />
Ein Wegzug würde für die abgebende Stadt nicht nur einen psychologischen Verlust<br />
bedeuten. Profiteamsport zieht viele auswärtige Zuschauer an. Das Abwandern eines<br />
Profiteams würde zum einen Kaufkraftabflüsse nach sich ziehen. Gerade die<br />
neueren, auf eine Sportart zugeschnittenen Stadien sind spezifische Investitionen<br />
ohne große Verwendungsvielfalt. Werden vor einer möglichen Relocation positive<br />
Deckungsbeiträge durch den Stadionbetrieb erzielt, würde ein Abwandern zum<br />
anderen weitere Verluste in Form nicht amortisierter irreversibler Konstruktionskosten<br />
Analysen, werden oft methodische Mängel sichtbar und unhaltbare Annahmen getroffen, die eine vermeintliche<br />
Vorteilhaftigkeit der Investitionen als Ergebnis zeigen. Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel 3.<br />
43<br />
Vgl. dazu im folgenden z.B. Noll/Zimbalist (1997b), S. 76ff. u. 83ff.; Johnson (1983). Vgl. allgemein zur<br />
Teamsportindustrie in den USA z.B. Franck (1995); Quirk/Fort (1992).<br />
18
(sunk costs) bewirken. Schließlich sind auch negative angebotsseitige Einkommens-<br />
und Beschäftigungswirkungen, wie sie in Abschnitt 2.2.2 dargestellt werden,<br />
denkbar. Städte, die durch Relocation Profiteams hinzugewinnen, realisieren<br />
entsprechende psychologische und ökonomische Vorteile. 44<br />
Spielen die Teams nun aus Sicht des Teambesitzers in nicht adäquaten Sportsta-<br />
dien, können sie angesichts des interkommunalen Wettbewerbs um Profiteams und<br />
der Relocation-Möglichkeit teure Stadioninvestitionen durchsetzen. Sollte die<br />
Kommune nicht auf die Bedürfnisse der Teambesitzer eingehen, finden sich andere<br />
Kommunen, die den Wünschen nach modernen, großen Stadien gerne nachkom-<br />
men. Oftmals versuchen andere Städte sogar von sich aus, Profiteams zu einem<br />
Wechsel in ihre Kommune zu bewegen, indem sie ihnen immer pompösere, größere<br />
Sportstätten zu günstigen Pachtkonditionen anbieten. Dies erklärt einen weiteren<br />
Trend im US-Sportstättenbereich. Die durchschnittliche Lebensdauer eines<br />
Profisportstadions ist in den USA seit dem 2. Weltkrieg bis in die 90er Jahre hinein<br />
deutlich kleiner geworden. 45<br />
Die glaubwürdige Drohung einer Abwanderung von Profifußballvereinen in Deutsch-<br />
land oder anderen europäischen Fußballnationen ist unseres Wissens noch nicht in<br />
der wissenschaftlichen Literatur analysiert worden. Nichtsdestotrotz können freiwillige<br />
Abwanderungstendenzen bis hin zu erpresserischen Drohungen auch in Deutsch-<br />
land bzw. Europa in Ansätzen beobachtet werden. Die singuläre Austragung von<br />
Heimspielen in den Sportstadien anderer Kommunen konnte in der Vergangenheit<br />
anläßlich von Spitzenspielen häufig beobachtet werden. Ist das eigene Stadion zu<br />
klein, können mit einem einmaligen Wechsel in ein größeres, benachbartes Stadion<br />
mehr Zuschauereinnahmen realisiert werden. 46 Zum Teil erfüllen die Vereine, die<br />
sich für europäische Klubwettbewerbe qualifizieren oder aus der zweiten in die erste<br />
44<br />
Damit ist jedoch nicht gesagt, daß diese Städte durch den Zuzug eines Profiteams einen insgesamt positiven<br />
ökonomischen Nettonutzen erzielen. In seltenen Fällen können Städte den Major League-Status auch durch<br />
Expansionen einzelner Ligen erhalten.<br />
45<br />
Vgl. dazu u.a. Baade/Dye (1990), S. 5.<br />
46<br />
Als aktuelles Beispiel kann hier der VFL Wolfsburg angeführt werden, der bis zur Realisation des geplanten<br />
Stadionneubaus nach Aussage des Managements die Heimspiele im UEFA-Cup 1999/2000 im deutlich größeren<br />
Niedersachsenstadion (Hannover) austragen will.<br />
19
Bundesliga aufsteigen, nicht die Stadionmindestanforderungen der UEFA bzw. des<br />
DFB, so daß ein vorübergehender Stadionwechsel notwendig wird. 47<br />
Neben diesen eher einmaligen Relocations gibt es in den europäischen Spitzenligen<br />
in den letzten Jahren immer öfter Beispiele für Drohungen eines dauerhaften<br />
Stadionwechsels. Der FC Wimbledon, Mitglied der englischen Premier League, plant<br />
einen Umzug ins irische Dublin, nachdem sich der Verein nicht mit seinem Londoner<br />
Heimatbezirk Merton über den Bauplatz für ein eigenes Stadion einigen konnte.<br />
Während sich in London die Gunst der Zuschauer auf 13 Proficlubs verteilt und der<br />
FC Wimbledon über kein eigenes Stadion verfügt, gibt es in Irland großes Interesse<br />
für Fußball, aber keinen großen Verein. Ein Wechsel der Spielstätte würde nach<br />
Ansicht des Vereins das Interesse am FC Wimbledon und somit die Einnahmen aus<br />
Zuschauererlösen, Merchandising, etc. erhöhen. 48<br />
Ein deutsches Beispiel ist der langjährige Streit der Münchner Erstligisten FC<br />
Bayern München und TSV 1860 München mit der Stadt München über die Moderni-<br />
sierung des Münchner Olympiastadions. Hatten sich Stadt und Vereine bereits in<br />
zähen Verhandlungen auf den Umbau des Münchner Olympiastadions zu einem<br />
reinen Fußballstadion geeinigt, gab es bis Mitte 1999 keine Übereinkunft über die<br />
Finanzierung. Während die Stadt bereit ist, die Kosten einer einfachen Variante in<br />
Höhe von ca. 140 Millionen DM allein zu tragen, bestehen die Vereine auf einer<br />
moderneren, mehr Einnahmen versprechenden Ausbauvariante für ca. 400 Millionen<br />
DM. Die Stadt ist nicht bereit, auch die zusätzlichen 260 Millionen DM zu finanzieren<br />
und fordert von den Vereinen, den Zusatzbetrag selbst aufzubringen. Beide<br />
Erstligisten sind hierzu nicht bereit. 49 Vielmehr drohen sie mit dem Wegzug vor die<br />
Tore Münchens. Eigene Stadionpläne, finanziert durch einen Börsengang, sowie<br />
47 Der DFB hat gemäß seiner Satzung auch die Möglichkeit, Platzsperren - z.B. aufgrund gewalttätiger Fan-<br />
Ausschreitungen - zu verhängen. Vereine müssen in diesem Fall ihre Heimspiele während der Sperrzeit in einem<br />
Stadion austragen, das mindestens 30 Kilometer entfernt liegt. Mögliche Mehreinnahmen im Vergleich zur<br />
Austragung in der originären Heimstätte sind an den DFB abzuführen, der über die Verwendung dieser Gelder<br />
entscheidet. Vgl. Durchführungsbestimmungen des DFB, § 2 (Platzsperre).<br />
48 Vgl. zu den Umzugsplänen des FC Wimbledon Reng (1998). Da gemäß den UEFA-Richtlinien Vereine ihre<br />
Pflichtspiele nur innerhalb der Grenzen ihres eigenen Landesverbandes austragen dürfen, klagt der FC<br />
Wimbledon, vertreten durch den bekannten Brüsseler Anwalt Louis Dupont, der bereits das Bosman-Urteil<br />
erwirkt hat, vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die UEFA. Dupont argumentiert in seinem Vorhaben mit<br />
den römischen Verträgen, wonach es allen Unternehmen (also auch Profivereinen) erlaubt sein soll, ihren<br />
Geschäften von jedem Mitgliedsland der EU aus nachzugehen.<br />
49 Vgl. u.a. Grill (1999), S. 39.<br />
20
private Investitionspläne eines Großinvestors für ein modernes Stadion in Riem ver-<br />
leihen der Drohung Glaubwürdigkeit.<br />
Unabhängig davon, ob Vereine wie der FC Wimbledon oder der FC Bayern München<br />
ihre Drohungen tatsächlich umsetzen, verleiht ihnen allein die Möglichkeit eines<br />
Wegzugs aus ihrer Heimatstadt eine bessere Verhandlungsposition zur Durchset-<br />
zung von Stadioninvestitionen. 50 Die große regionale Verbundenheit vieler<br />
(deutscher) Bundesligisten läßt die Relocation-Drohung im Vergleich zu US-amerika-<br />
nischen Profiteams jedoch insgesamt weniger glaubwürdig erscheinen. Wenngleich<br />
die Tendenz zumindest regionaler Wechsel steigt, kann die These, Stadioninvestitio-<br />
nen sind die Voraussetzung attraktiven Profisports, in Deutschland besser über die<br />
Wettbewerbsfähigkeit der Vereine begründet werden. 51<br />
Die Anzahl der Erstligisten ist in Deutschland (ähnlich wie in anderen europäischen<br />
Fußball-Ligen) durch den Austragungsmodus der Meisterschaft auf 18 Mannschaften<br />
beschränkt. Auch in Deutschland gibt es wesentlich mehr Kommunen, die sich Erstli-<br />
gasport für ihre Stadt wünschen. 52 Besteht die Möglichkeit eines geographischen<br />
Abwerbens von Clubs durch andere Städte in nur begrenztem Maße, ergeben sich<br />
hier Relocation-Möglichkeiten eher dadurch, daß die einzelnen nationalen und inter-<br />
nationalen Ligen anders als in den USA durchlässig sind. Durch den sportlichen Auf-<br />
bzw. Abstieg können Städte zum Bundesligastandort werden oder ihn wieder<br />
verlieren. Ähnliches gilt für die Qualifikation zu den europäischen Pokalwettbewer-<br />
ben.<br />
Stadioninvestitionen, die zu besseren Einnahmemöglichkeiten der Vereine führen,<br />
bewirken eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Vereine. Durch eine<br />
50 Ähnliche Möglichkeiten bieten sich z.B. Juventus Turin, ein Verein der trotz des modernen WM-Stadions von<br />
1990 eigene Stadionpläne verfolgt. Vgl. o.V. (1998c). Paris St. Germain, für den das hochmoderne WM-Stadion<br />
in St. Denis nahe Paris als Heimstätte vorgesehen war, unterschrieb zu Beginn diesen Jahres einen<br />
Zehnjahresvertrag mit der Stadt Paris, der weiterhin die Austragung der Heimspiele im Prinzenparkstadion in<br />
Paris vorsieht. Als Grund gab Klubpräsident Charles Bietry finanzielle und ideelle Erwägungen an. Vgl. o.V.<br />
(1998d). Der französische Erstligist konnte allein durch den möglichen Wechsel (finanzielle) Forderungen<br />
durchsetzen. Beide Vereine, Turin und Paris, sind angesichts zukünftiger Wechselmöglichkeiten in einer starken<br />
Verhandlungsposition, die ihnen auch die Durchsetzung zukünftiger Forderungen erleichtert. Wechsel von<br />
Spielstätten sind auch in anderen deutschen Sportarten zu verzeichnen. Im Baskettball strebt z.B. Röhndorf einen<br />
Wechsel nach Frankfurt an.<br />
51 Ähnliche Erklärungsansätze werden vereinzelt auch in der US-amerikanischen Literatur beschrieben. Vgl. z.B.<br />
Baldo (1991), S. 34.<br />
21
leistungsstärkere Bundesligamannschaft steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines<br />
Nichtabstieges, sondern auch die Aussicht auf die Qualifikation für lukrative Europa-<br />
pokal-Spiele. Durch die größere Anzahl und oftmals höhere Attraktivität der nationa-<br />
len und internationalen Spiele werden mehr auswärtige Zuschauer angezogen. Kauf-<br />
kraftzuflüsse werden in der Region gesichert und zum Teil verstärkt.<br />
Eine unzureichende Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft könnte zum Abstieg in die<br />
weniger attraktive zweite Liga oder zur Nichtqualifikation für europäische Pokalspiele<br />
führen. Da die direkten Stadioneinkünfte der Stadt sowohl von den wirtschaftlichen<br />
Möglichkeiten der Vereine als auch (anteilsmäßig) von den direkten<br />
Stadioneinnahmen abhängen, würde eine Nichtqualifikation für europäische<br />
Wettbewerbe oder das Absteigen in die weniger attraktive zweite Liga den<br />
Deckungsbeitrag zur Begleichung der Stadioninvestitionen schmälern.<br />
Kaufkraftabflüsse und Amortisationsdefizite bisheriger Bundesligastadien wären die<br />
Folge.<br />
2.2.1.2. Nachfrageinduzierte Einkommens- und Beschäftigungswirkungen<br />
Es konnte gezeigt werden, daß der interkommunale Wettbewerb um Profiteams in<br />
den USA und Europa dazu führt, daß Stadioninvestitionen vielfach eine Vorausset-<br />
zung für attraktiven Profisport darstellen. Attraktiver Profisport lockt auswärtige<br />
Zuschauer an, die durch Ausgaben in der Region die Wirtschaftskraft in Form von<br />
mehr Einkommen und Beschäftigung stärken. Es stellt sich nun die Frage, ob den<br />
Kosten <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen entsprechend hohe Nutzenrückflüsse entge-<br />
genstehen. Der Großteil der in Auftrag gegebenen economic impact studies kommt<br />
zu dem Schluß, daß der Nutzen bei weitem ausreicht, um die Kosten zu decken und<br />
die ortsansässige Bevölkerung in Form von mehr Einkommen und Beschäftigung<br />
profitiert. Damit wären <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen aus allokativer Sicht<br />
gerechtfertigt und unter Verteilungsgesichtspunkten unbedenklich. Die konzeptionelle<br />
Begründung dieser nachfrageorientierten Studien verläuft oftmals wie folgt. 53<br />
Einwohner einer Kommune finanzieren durch Steuergelder die Kosten von Stadion-<br />
investitionen als Voraussetzung für Profiteamsport. Die (Sport-)Veranstaltungen in<br />
52 Ein Indiz hierfür liefern nicht zuletzt die enormen (finanziellen) Anstrengungen bzw. Förderungsmaßnahmen<br />
verschiedener Kommunen, die zum Aufstieg unterklassiger Mannschaften bis hin zur ersten Liga führen sollen.<br />
53 Vgl. zur Argumentationsweise vieler nachfrageorientierter Auftragsstudien u.a. Crompton (1995), S. 15ff.<br />
22
dem Stadion ziehen anschließend (mehr) auswärtige Besucher an, die anläßlich<br />
ihres Besuches Geld innerhalb und außerhalb des Stadions ausgeben. Stadionaus-<br />
gaben umfassen z.B. den Eintrittskartenkauf, Parkgebühren sowie Ausgaben im<br />
Catering- und Merchandising-Bereich. Das vertragliche Arrangement zwischen<br />
Kommune und Verein regelt, inwieweit die Kommune an den Stadionerlösen partizi-<br />
piert. Außerhalb des Stadions tätigen Zuschauer z.B. Ausgaben im Bereich der<br />
Gastronomie, der Übernachtungsbranche, dem Handel und dem Transportwesen.<br />
Die zusätzlichen Ausgaben auswärtiger Zuschauer (initial injection of money),<br />
verursacht durch die Stadioninvestitionen, stimulieren die lokale Wirtschaft über<br />
einen primären und einen sekundären (Multiplikator-)Effekt (siehe Abb. 5).<br />
Ein Teil der zusätzlichen Zuschauerausgaben verbleibt in der Kommune selbst. Die<br />
zusätzlichen Einnahmen lokaler Unternehmen werden z.B. für den Kauf von Gütern<br />
und Dienstleistungen anderer lokaler Unternehmen, 54 zur Bezahlung von Löhnen und<br />
Gehältern ortsansässiger Mitarbeiter oder zur Entrichtung lokaler Steuern verwandt.<br />
Die Ausgabe der zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Region führt im Rahmen<br />
dieser ersten Ausgabenrunde unmittelbar zu mehr Einkommen und Beschäftigung in<br />
der Bevölkerung (primärer Effekt). Der andere Teil der Zusatzerlöse verbleibt nicht in<br />
der Region. Er wird zum Beispiel für den Kauf von Gütern- und Dienstleistungen<br />
außerhalb der Region, für die Bezahlung der Löhne und Gehälter auswärtiger<br />
Arbeitnehmer oder für die Entrichtung überregionaler Steuern benötigt.<br />
Die Einnahmen, die in der Region verbleiben, werden nun in weiteren Ausgaberun-<br />
den zu einem Teil wieder in der Kommune ausgegeben (Multiplikatoreffekt). Im<br />
Gegensatz zur ersten Ausgaberunde profitieren in den nachfolgenden Sequenzen<br />
sportunverwandte Bereiche durch die Ausgaben privater Haushalte, ortsansässiger<br />
Unternehmen und der lokalen Gebietskörperschaft in stärkerem Maße.<br />
54 Z.B. werden Produkte zur Auffüllung der Lagerbestände gekauft, die baulichen und technischen<br />
Gegebenheiten der Unternehmen instandgehalten bzw. verbessert, Versicherungsprämien entrichtet, etc.<br />
23
Abbildung 5: Einkommens- und Beschäftigungswirkungen zusätzlicher Zuschauerausgaben<br />
zusätzliche Zuschauerausgaben<br />
Initialeffekt<br />
(initial injection<br />
Handel Stadion<br />
Gastronomie Hotel/Herberge<br />
of money)<br />
e<br />
Erlöse/Einkommen<br />
auswärtiger Unternehmen/Haushalte<br />
auswärgige private<br />
Haushalte/Unterneh<br />
men<br />
Steuern/Einnahmen<br />
überregionale<br />
Gebietskörperschaft<br />
privates Haushaltseinkommen<br />
Steuern/Einnahmen<br />
lokale Gebietskörperschaft<br />
Güter/Dienstleistungen<br />
lokaler<br />
Unternehmen<br />
erste Ausgaben-<br />
runde<br />
Sparen auswärtige<br />
Ausgaben<br />
lokale Ausgaben<br />
gesamte lokale Unternehmen<br />
anschließende<br />
Ausgaben-<br />
Erlöse/Einkommen<br />
auswärtiger Unternehmen/Haushalte<br />
Steuern/Einnahmen<br />
überregionale<br />
Gebietskörperschaft<br />
privates Haushaltseinkommen<br />
Steuern/Einnahmen<br />
lokale Gebietskörperschaft<br />
Güter/Dienstleistungen<br />
lokaler<br />
Unternehmen<br />
runden<br />
auswärtige<br />
Ausgaben<br />
Sparen<br />
lokale Ausgaben<br />
24
Die erneute Wiederausgabe der Einnahmen durch lokale Unternehmen und der<br />
lokalen Gebietskörperschaft (indirekter Effekt) sowie der ortsansässigen Haushalte<br />
(induzierter Effekt) führt innerhalb der Region zu weiteren Einkommens- und<br />
Beschäftigungswirkungen der lokalen Bevölkerung (sekundärer Effekt). Über wieviele<br />
Runden sich (nennenswerte) positive Einkommens- und Beschäftigungswirkungen<br />
ergeben, hängt in erster Linie von der Höhe der zusätzlichen Zuschauerausgaben,<br />
der Konsumneigung der Bevölkerung und dem in der Region verbleibenden<br />
Einkommen ab. Die positiven <strong>Auswirkungen</strong> nehmen aber von Ausgaberunde zu<br />
Ausgaberunde kontinuierlich ab und werden bereits nach wenigen Durchgängen<br />
vernachlässigbar gering.<br />
Ein sehr geringer Teil der Auftragsstudien geht davon aus, daß die unmittelbaren<br />
<strong>öffentlich</strong>en Einnahmen durch den Stadionbetrieb ausreichen, um die<br />
Investitionskosten zu decken (d.h. es fallen keine Subventionen an). Die Mehrzahl<br />
der Analysen kommt zu dem Ergebnis, daß Subventionen unvermeidbar sind. Der<br />
primäre und sekundäre Effekt durch die zusätzlichen Zuschauerausgaben würden<br />
aber zu bedeutenden Einkommens- und Beschäftigungswirkungen innerhalb der<br />
gesamten Bevölkerung führen, so daß die Subventionen unter allokativen und<br />
distributiven Gesichtspunkten gerechtfertigt seien. 55<br />
Unabhängig von den prognostizierten Einkommens- und Beschäftigungswirkungen<br />
führen die Auftragsstudien zahlreiche positive (intangible) externe Effekte auf, welche<br />
55<br />
Schröder (1987) kommt im Rahmen seiner Untersuchung zu den regionalwirtschaftlichen <strong>Auswirkungen</strong> der<br />
Modernisierung des Bremer Weser-Stadions zu dem Ergebnis, daß durch <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen in<br />
Höhe von 35 Millionen DM jährlich 177.000 auswärtige Zuschauer mehr ins Stadion kommen. Dies würde nach<br />
Ansicht Schröders zu jährlichen Mehreinnahmen des SV Werder Bremen in Höhe von 7,1 Millionen DM führen,<br />
so daß bei einem geeigneten vertraglichen Arrangement zwischen Verein und Stadt die Investitionen allein durch<br />
die Mehreinnahmen des Vereins gedeckt werden könnten. Selbst wenn der Anteil der Stadt an den<br />
Stadioneinnahmen nicht erhöht würde, stünden den Investitionskosten Kaufkraftzuflüsse gegenüber, die neben<br />
den jährlichen Stadioneinnahmen der Stadt (ca. 590.000 DM) jährlich 3,9 Millionen DM mehr Einkommen für<br />
die Bevölkerung Bremens bedeuteten. Rolf Rüßmann, ehemaliger Manager von Borussia Mönchengladbach<br />
schätzte die jährlichen Mehreinnahmen des Vereins durch einen Stadionneubau ebenfalls auf ca. 7 Millionen<br />
DM. Hamm (1996), der die regionalwirtschaftlichen <strong>Auswirkungen</strong> eines Stadionneubaus für Mönchengladbach<br />
näher untersuchte, ermittelte auch sehr vorteilhafte Wirkungen für die Stadt Mönchengladbach. Ein<br />
Stadionneubau würde nach Ansicht von Hamm einen zusätzlichen längerfristigen Einkommensanstieg in Höhe<br />
von ca. 22,5 Mio. DM jährlich betragen, ausgelöst durch höhere Personal- und Sachausgaben des Vereins sowie<br />
Mehrausgaben der Fans. Außerdem würden längerfristig ca. 474 neue Arbeitsplätze entstehen. Hinzu kommen<br />
nach Aussage Hamms noch die einmaligen Einkommens- und Beschäftigungswirkungen während der<br />
zweijährigen Bauzeit. Die Ausgaben für den Stadionbau in Höhe von ca. 200 Millionen DM würden das<br />
regionale Einkommen um ca. 54 Millionen DM erhöhen und gleichzeitig 550 Arbeitsplätze in der Region<br />
sichern. Hamm weist aber auch darauf hin, daß seine Ergebnisse eine optimistische Obergrenze darstellen und<br />
nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. eine genügende Auslastung des neuen Stadions) zustande kommen.<br />
25
die Vorteilhaftigkeit <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen weiter unterstreichen sollen. 56<br />
So würde die ortsansässige Bevölkerung vom Profisport in Form bedeutender public<br />
consumer benefits profitieren. Die Berichterstattung über den Heimatverein in den<br />
lokalen Medien und lokaler Profisport als beliebtes Gesprächsthema führen nach<br />
Angaben vieler Stadionbefürworter in weiten Teilen der Bevölkerung zu höherem<br />
Lokalstolz und einer besseren Identifikation mit der Stadt, ohne daß die Einwohner<br />
für diesen Effekt einen entsprechenden Preis entrichten müssen. Daneben würden<br />
auch enorme private consumer benefits aus dem Profisport resultieren. Hiervon<br />
profitieren nach Ansicht vieler Stadionbefürworter vor allem Fans und Zuschauer der<br />
Begegnungen. Da in Form von Eintrittspreisen ein Teil entstehender Renten von den<br />
Vereinen abgeschöpft wird, verbleiben hier private consumer benefits in erster Linie<br />
in Form von Konsumentenrenten. Eine empirische Studie über das Nachfragever-<br />
halten nach Profibaseball in den USA beziffert den Wert dieser „uncaptured rents“<br />
für die Bevölkerung verschiedener US-amerikanischer Städte auf durchschnittlich<br />
18,4 Millionen US-$ pro Jahr. 57<br />
Viele Stadionbefürworter sehen den Wert von Stadioninvestitionen auch darin, daß<br />
Profisport ihrer Ansicht nach geeignet ist, die gesellschaftlich gewünschten Werte<br />
und Normen über die Einhaltung von Regeln, fairen Wettbewerbs, etc. Jugendlichen<br />
zu vermitteln. Ein Resultat daraus könne ein Absinken der Kriminalitätsrate in<br />
Städten mit Profiteamsport sein. 58 Weitere Vorteile werden in einem gesteigerten<br />
Unterhaltungs- und Freizeitwert für die Kommune gesehen. Diese positiven externen<br />
Effekte können auch zu mehr Einkommen und Beschäftigung führen, wie Stadion-<br />
befürworter mit Hilfe der längerfristig ausgerichteten, angebotsorientierten Analysen<br />
aufzeigen möchten.<br />
56<br />
Vgl. zu den oftmals angeführten positiven externen Effekten u.a. Baim (1994), S. 5f.; Okner (1974), S. 327f.;<br />
Noll/Zimbalist (1997b); Colclough/Daellenbach/Sherony (1994), S. 497f. und Zimmermann (1997), S. 120ff.<br />
57<br />
Vgl. Irani (1997). Irani versucht zunächst, die Nachfragekurve nach Profi-Baseball in Abhängigkeit vom Preis<br />
mit Hilfe der Marshallschen Nachfragefunktion abzubilden. Unter der Annahme einer linearen Nachfragekurve<br />
kommt er zu dem Ergebnis, daß ein Anstieg des Ticketpreises um einen US-$ zu einem durchschnittlichen<br />
Zuschauerrückgang in Höhe von 98.000 pro Saison führt. Aufgrund der eher geringen Preiselastizität der<br />
Nachfrage errechnet Irani mit Hilfe der tatsächlichen Preise z.T. sehr hohe Konsumentenrenten. Der Wert dieser<br />
uncaptured rents wird von Irani z.B. für Los Angeles (L.A. Dodgers) 1982 auf 54 Millionen US-$ beziffert.<br />
58<br />
Vgl. dazu z.B. die Ausführungen des früheren Baseball-Profis Wilmer Mizell vor dem US-Kongreß 1971,<br />
zitiert in Baim (1994), S. 175: „... through baseball, opportunities have been afforded to young men who<br />
otherwise would not have been able to fully enjoy the American dream ... . Baseball builds character into young<br />
men who are going to be the leaders of the future. This leadership development and character building comes<br />
about in many ways, some of which may not seem very important in that sense while a boy is playing a game.<br />
But these are the things that stick with a boy when he becomes a man.“ Zu den Chancen und Risiken der<br />
Stärkung gesellschaftlich gewünschter Werte durch Profisport siehe auch Rahmann et al. (1998), Kapitel 1.<br />
26
2.2.2. Angebotsorientierte Analysen<br />
Angebotsseitige Effekte ergeben sich nach Ansicht vieler Stadionbefürworter durch<br />
den Liga-Status einer Stadt, der durch Stadioninvestitionen erlangt bzw. erhalten<br />
werden kann. 59 Der Liga-Status kann in Anbetracht des Werbewertes, verbesserter<br />
weicher Standortfaktoren und einer vorteilhaften neuen Dienstleistungsinfrastruktur<br />
eine Sogwirkung auf neue Unternehmen entfalten (siehe Abb. 6). 60 In Folge der<br />
höheren Attraktivität kann z.T. auch der Tourismussektor in der Stadt längerfristig<br />
gestärkt werden. 61<br />
Spiel- und Hintergrundberichte über Profiteams haben in Folge der zunehmenden<br />
Popularität des (Fußball)Sports und der wirtschaftlichen Notwendigkeit von Fernseh-<br />
anstalten, die hohen Preise für die TV-Rechte über längere Sportsendungen mit<br />
entsprechend mehr Werbeminuten zu refinanzieren, zugenommen. 62 Von der<br />
medialen Berichterstattung profitieren nicht nur die Vereine in Form höherer<br />
Sponsoren-, Zuschauer- oder Merchandisingeinnahmen. Auch die jeweilige<br />
Bundesligastadt erfährt eine höhere Aufmerksamkeit in den Medien. Der Wert dieser<br />
kostenlosen Imagesteigerung beträgt verschiedenen Auftragsstudien zufolge<br />
mehrere Millionen DM jährlich. 63 Eine stärkere Identifizierung mit der Stadt erleichtert<br />
nach Ansicht vieler Stadionbefürworter das Bemühen der Stadt um neue<br />
Unternehmensansiedlungen.<br />
59<br />
Zur theoretischen Argumentation angebotsseitiger Effekte der Stadionbefürworter vgl. u.a. Baim (1994), S.<br />
176f.; Baade/Dye (1988), S. 42f.; Baade/Dye (1990), S. 7f.; Hamm (1996), S. 8ff.<br />
60<br />
Neben dieser eher indirekten Sogwirkung können nach Ansicht von Hamm (1996) auch direkte Sogwirkungen<br />
auf sportverwandte Unternehmen ausgehen, welche Güter und Dienstleistungen für eine ähnliche Kundengruppe<br />
wie Fußballvereine anbieten. Dieser Gedanke tritt in vielen Sportparkkonzepten zu Tage, wo Stadionneubauten<br />
nicht isoliert sondern gemeinsam mit sportverwandten Unternehmensansiedlungen (z.B. Fitneßstudios,<br />
Sportmediziner, Bowling- bzw. Kegelbahnen, Sporthotels, Gastronomie und andere Freizeit- und<br />
Unterhaltungsunternehmen) regional konzentriert umgesetzt werden.<br />
61<br />
Vgl. dazu u.a. Baim (1994), S. 176f.<br />
62<br />
Die Ausweitung der samstäglichen SAT 1 Fußballshow „ran“ (nationale Liga) auf zwei Stunden sowie der<br />
RTL-Championsleague-Übertragungen können als Indiz hierfür angeführt werden. Die fernsehgerechtere<br />
(zeitversetzte) Ansetzung der Spiele kommt den TV-Sendungen dabei zugute.<br />
63<br />
Chicago´s Department of Economic Development schätzt den Werbewert eines Major League Baseball Teams<br />
für die Kommune Ende der 80er Jahre je nach sportlichem Erfolg auf 2,0 bis 5,7 Millionen US-$. Vgl.<br />
Baade/Dye (1988), S. 46. Schröder (1987) schätzte den Werbewert des Fußballbundesligisten SV Werder<br />
Bremen für die Stadt Bremen im gleichen Zeitraum auf jährlich 15 Millionen DM. Vgl. zum Werbewert von<br />
Profiteams auch Hamm (1996), S. 29ff. und Okner (1974), S. 327f. Die Berechnung des Werbewertes erfolgt<br />
dabei oftmals mit Hilfe der Übertragungszeiten des Profivereins im TV bzw. Hörfunk, multipliziert mit den<br />
jeweils gültigen durchschnittlichen Werbepreisen pro Minute. Da eine reine bzw. gezielte Werbesendung für die<br />
Kommune einen höheren Wert als die Sportberichterstattung des ansässigen Profiteams hat, wird der errechnete<br />
Werbepreis um einen bestimmten Prozentsatz (oft in Höhe von ca. 50 Prozent) reduziert. Dieser Wert<br />
symbolisiert aus Sicht vieler Stadionbefürworter die eingesparten Werbekosten und somit den Werbewert des<br />
Vereins für die Kommune.<br />
27
28<br />
Werbung<br />
Image<br />
Stadioninvestitionen<br />
LIGA-STATUS<br />
besseres<br />
Freizeit-/<br />
Unterhaltungs-<br />
Angebot<br />
neue<br />
Dienstlei-<br />
stungs-Infrastruktur<br />
Magnetwirkung auf Unternehmen & Tourismus<br />
kommunaler Anstieg von Beschäftigung / Einkommen<br />
Abbildung 6: Angebotsseitige Wirkungen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen<br />
Investitionen in die Sportinfrastruktur führen gemeinsam mit Profisport zu einem<br />
besseren Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsangebot der Stadt. Das Angebot weicher<br />
Standortfaktoren, die bei unternehmerischen Standortentscheidungen zunehmende<br />
Bedeutung erlangen, verbessert sich. 64 Stadionbefürworter schließen daraus die<br />
vermehrte Ansiedlung von Unternehmen.<br />
Neue Unternehmensansiedlungen können auch durch eine verbesserte Infrastruktur<br />
hervorgerufen werden. Benötigt der impulsgebende Bereich (hier der Profiverein)<br />
eine regionale Dienstleistungsinfrastruktur, die auf andere gewerbliche Wirtschafts-<br />
64 Vgl. z.B. Hamm (1996), S. 25 ff.
ereiche eine anziehende Wirkung ausübt, 65 könnten verschiedene Unternehmen<br />
ihren Standort in die Bundesligastadt verlegen. Treffen die Agglomerationseffekte in<br />
Form neuer Unternehmensansiedlungen tatsächlich zu, könnten sich mittel- bis<br />
langfristig positive Einkommens- und Beschäftigungswirkungen für die Bundesli-<br />
gastadt ergeben. 66 Gleiches gilt für den Fall, daß mehr Touristen durch den Image-<br />
Gewinn der Stadt angezogen werden.<br />
2.3. Fazit: Ergebnisse der Auftragsstudien<br />
Sowohl die allgemeinen als auch die speziellen makroökonomischen Auftragsstudien<br />
kommen in der Regel zu dem Ergebnis, daß <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen unter<br />
allokativen Gesichtspunkten lohnenswert sind und negative Verteilungswirkungen im<br />
Sinne einer Umverteilung von arm nach reich nicht auftreten. Die großen Profiteure<br />
der <strong>Stadionprojekte</strong> sehen die Legitimation <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen vor allem<br />
in nachhaltigen positiven Einkommens- und Beschäftigungswirkungen in der<br />
Kommune. Lokale Medien, die in Form positiver externer Effekte (z.B.<br />
Auflagensteigerungen) von neuen Stadien bzw. Profiteams profitieren, sind allzu oft<br />
bereit, die Ergebnisse der Studien unvoreingenommen zu publizieren. 67 Die Zweifel<br />
einiger Steuerzahler an der Zweckmäßigkeit der Investitionen werden somit z.T.<br />
beseitigt.<br />
Erfahrungen vieler <strong>Stadionprojekte</strong> führten jedoch in der Vergangenheit oftmals nicht<br />
zu den gewünschten prognostizierten Wirkungen. Einige Kommunen, die erhebliche<br />
Ausgaben für den Neubau oder die Modernisierung von Sportstadien tätigten, erlitten<br />
sogar ein finanzielles Desaster, an deren Folgen die zumeist ortsansässigen<br />
Steuerzahler heute noch leiden. 68<br />
65<br />
Hier könnten z.B. von der Werbe- und Medienbranche eine attrahierende Wirkung auf andere Unternehmen<br />
ausgehen. Zum symbiotischen Wechselverhältnis von Sport, Medien und Wirtschaft sowie der zunehmenden<br />
Bedeutung der Werbewirtschaft durch Profisport vgl. u.a. Rahmann et al. (1998), S. 57ff. und die dort<br />
angeführten Literaturhinweise.<br />
66<br />
Zu weiteren möglichen angebotsseitigen Wirkungen vgl. Hamm (1996) und die dort aufgeführten<br />
Literaturhinweise.<br />
67<br />
Vgl. z.B. Noll/Zimbalist (1997b), S. 85.<br />
68<br />
Vgl. Noll/Zimbalist (1997a), S. 30. Siehe auch Fußnote 29 zu den hohen <strong>öffentlich</strong>en Defiziten durch<br />
Stadioninvestitionen in Pontiac, Michigan (Silverdome) und New Orleans (Superdome). Vgl. Maennig (1998), S.<br />
318ff., zum „Supergau“ in Montreal. Die tatsächlichen Kosten des Olympia-Stadions in Montreal übertrafen die<br />
eingeplanten Kosten um 500 %, was neben einer hohen Steuerbelastung auch zu gesellschaftlichen Spannungen<br />
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen Kanadas führte.<br />
29
3. Ökonomische <strong>Auswirkungen</strong> aus unabhängiger Sicht<br />
Angesichts des krassen Unterschiedes zwischen den Ergebnissen vieler Auftrags-<br />
studien und den in der Realität oftmals sichtbaren ökonomischen Schäden nehmen<br />
sich vermehrt unabhängige (Sport)Ökonomen der Frage nach dem tatsächlichen<br />
Wert <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen an. Theoretische Erwägungen und empirische<br />
Untersuchungen lassen Schlußfolgerungen zu, die den Ergebnissen der Auftrags-<br />
studien zum Teil erheblich entgegenstehen. Zahlreiche Untersuchungen hinsichtlich<br />
der Annahmen, Techniken und Ergebnisse verschiedener Auftragsstudien durch un-<br />
abhängige Wissenschaftler belegen, daß „Economic impact studies of stadiums are<br />
not in short supply, but many of these were written as a house organ for a team, or<br />
an institution with ties to the team or professional sports, and are far from<br />
objective.“ 69 Welche „objektiven“ Einwände unabhängige Ökonomen erheben, soll im<br />
folgenden für die allgemeinen und speziellen makroökonomischen Analysen näher<br />
untersucht werden.<br />
3.1. Beurteilung allgemeiner makroökonomischer Analysen<br />
Viele allgemeine makroökonomische Analysen zur volkswirtschaftlichen Bedeutung<br />
des Sports kommen zu dem Ergebnis, daß der Sportsektor in vielen Ländern zu<br />
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden ist, der einen nicht unerheblichen<br />
Anteil am Bruttosozialprodukt, an der Beschäftigung und an den Steuereinnahmen<br />
ausmacht. 70 Die Problematik dieser zumeist unabhängigen Analysen liegt weniger in<br />
methodischen Schwächen. 71 Eine Kontroverse ergibt sich erst dann, wenn Politiker,<br />
Sportorganisationen und andere Stadioninteressenten die Ergebnisse der<br />
allgemeinen Studien in ihrem Sinne interpretieren. Behauptungen vieler Stadion-<br />
befürworter, ohne eine entsprechende Sportförderung (wie z.B. Stadioninvestitionen)<br />
würde die wirtschaftliche Bedeutung des Profiteamsports abnehmen und damit Ein-<br />
kommen, Beschäftigung und Steuereinnahmen zurückgehen, werden von Kritikern<br />
zurückgewiesen.<br />
69<br />
Baim (1994), S. 13. Vgl. dazu auch Crompton (1995), S. 15ff.<br />
70<br />
Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.1.<br />
71<br />
Gleichwohl weist Késenne (1997), S. 5ff. darauf hin, daß Gefahren wie Doppelzählungen oder die falsche<br />
Abgrenzung zwischen Sportsektor und sportverwandten Bereichen wie der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie<br />
berücksichtigt werden müssen.<br />
30
Ohne den Sportsektor würde die Bevölkerung nach Ansicht unabhängiger Ökono-<br />
men ihr Geld in anderen Bereichen ausgeben. 72 Ein gutes Beispiel hierfür liefert der<br />
siebenwöchige Baseball-Streik 1994 in den USA. Eine empirische Untersuchung<br />
über die ökonomischen <strong>Auswirkungen</strong> des Streiks auf die 24 betroffenen Major<br />
League-Städte zeigt, daß das (vorübergehende) Wegbrechen eines populären<br />
Sportzweiges keine bedeutenden Nachteile für die Kommunen nach sich zog. 73<br />
Umsätze im Handel und Hotelwesen gingen, wenn überhaupt, nur geringfügig<br />
zurück. Gleichzeitig war der Sommer 1994 für die Filmindustrie einer der besten in<br />
ihrer Geschichte. Andere Unternehmen in der Freizeit- und Unterhaltungsbranche<br />
haben vom Streik und dem geänderten Ausgabeverhalten der Baseball-Fans<br />
profitiert (Substitutionseffekte). 74<br />
Die <strong>öffentlich</strong>e Hand profitiert gemäß den Ergebnissen allgemeiner makroökonomi-<br />
scher Studien vom Sportsektor durch z.T. hohe Steuereinnahmen. Sind die Steuer-<br />
einnahmen größer als die bisherige Sportförderung, fordern Stadionbefürworter mehr<br />
<strong>öffentlich</strong>e Mittel für den Sportbereich. Diese würden ihrer Ansicht nach durch den<br />
Steueranstieg mehr als kompensiert. Eine objektive Betrachtung läßt diese Argu-<br />
mentationsweise unglaubwürdig erscheinen, da der Sportsektor nur zu einem<br />
geringen Teil <strong>öffentlich</strong> gefördert wird. Bedeutende Sportbereiche (z.B. Sportartikel-<br />
industrie, private Sportanbieter außerhalb der Vereine, etc.) werden <strong>öffentlich</strong> kaum<br />
oder gar nicht gefördert, führen aber zu beachtlichen Steuereinnahmen. 75<br />
Statistische Untersuchungen zur kommunalen Bedeutung des Profiteamsports<br />
zeigen, daß die (geforderten) Stadioninvestitionen in vielen kommunalen Haushalten<br />
einen größeren Anteil ausmachen (würden), als der Beitrag des gesamten Sport-<br />
sektors am lokalen Bruttosozialprodukt, so daß „ ... an expenditure on a sports<br />
stadium in a relative sense is significantly greater than the direct economic<br />
contribution one could expect from the stadium.“ 76 Die Gegenüberstellung von<br />
kommunalen Stadioninvestitionen und ökonomischer Bedeutung des Sports ist eine<br />
Möglichkeit, die Pauschalaussagen der Stadionbefürworter über die Vorteilhaftigkeit<br />
<strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen zu relativieren. Um aber genauere Rückschlüsse auf<br />
72 Vgl. z.B. Késenne (1997), S. 5ff.; Baade/Dye (1988), S. 39f.<br />
73 Vgl. zum Aufbau und den Ergebnissen der Untersuchung Zipp (1996).<br />
74 Vgl. Baade/Sanderson (1997), S. 97.<br />
75 Vgl. Késenne (1997), S. 5ff; Weber et al. (1995).<br />
31
die ökonomischen <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen ziehen zu können,<br />
sind speziellere Studien notwendig. Im folgenden werden daher die Ergebnisse der<br />
speziellen makroökonomischen Studien näher betrachtet.<br />
3.2. Beurteilung spezieller makroökonomischer Analysen<br />
Eine Untersuchung der ökonomischen <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitio-<br />
nen erfordert das Treffen vieler (subjektiver) Annahmen. Kritiker der speziellen<br />
Auftragsstudien werfen den Autoren vor, die subjektiven Entscheidungsspielräume<br />
durch ungeeignete Techniken und viel zu optimistische Annahmen im Sinne der<br />
Auftraggeber zu mißbrauchen. 77 Da bereits kleine Änderungen in den Annahmen<br />
große Ergebnisunterschiede hervorrufen, kommen unabhängige Wissenschaftler zu<br />
deutlich pessimistischeren Einschätzungen hinsichtlich der ökonomischen Auswir-<br />
kungen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen. Um die Ergebnisse der Auftragsstudien<br />
besser beurteilen und die Einwände unabhängiger Wissenschaftler besser verstehen<br />
zu können, wird im folgenden zunächst ein typischer Finanzierungsplan vorgestellt.<br />
Dabei interessiert vor allem, wofür die finanziellen Mittel ausgegeben werden<br />
(Verwendungsseite) und wer für sie aufkommt (Herkunftsseite).<br />
3.2.1. Typischer Finanzierungsplan für <strong>Stadionprojekte</strong><br />
Auf der Verwendungsseite gibt es vielfältige Bereiche, die finanzielle Mittel zur<br />
Realisierung von Stadionneubauten bzw. -modernisierungen beanspruchen (siehe<br />
Tabelle 2). 78 Plant die Kommune den Neubau eines Fußballstadions fallen in der<br />
Regel Grundstückskosten durch Kauf, Abriß alter Gebäude, Erschließung, etc. an.<br />
Größter Ausgabeposten sind die Konstruktionskosten, die sich u.a. aus Planungs-,<br />
Verwaltungs- Lohn- und Materialkosten zusammensetzen. Der Bau bzw. die<br />
Modernisierung eines Fußballstadions erfordert zumeist auch Infrastrukturmaßnah-<br />
men außerhalb des Stadions, z.B. die Anbindung an das Verkehrswegenetz. Der<br />
Betrieb des neuen bzw. modernisierten Stadions verursacht variable Kosten wie die<br />
Entlohnung von Ordnungskräften und fixe Kosten wie z.B. Wartungs-, Instandhal-<br />
tungs- und Personalkosten fest angestellter Mitarbeiter. Mit dem Betrieb entstehen<br />
der <strong>öffentlich</strong>en Hand zusätzliche Kosten wie z.B. die Entlohnung von Sicherheits-<br />
kräften oder Verwaltungskosten des Ordnungsamts, die nicht im Haushaltsbudget<br />
76 Baade/Dye (1988), S. 40.<br />
77 Baade/Dye (1990), S. 6 merken in diesem Zusammenhang an: „The leverage on alternative assumptions is<br />
particularly troublesome where the sponsor of the research has an identifiable interest or point of view.“<br />
32
der <strong>öffentlich</strong>en Betreibergesellschaft veranschlagt werden. Weitere Kosten fallen in<br />
der Nachnutzungsphase des Stadions an.<br />
Kostenbereiche Kosten z.B. verursacht durch<br />
Grundstückskosten Grundstückskauf, Abriß alter Gebäude, Erschließung<br />
Konstruktionskosten Architekten, Statiker, Baufacharbeiter, Materialverbrauch<br />
Infrastrukturkosten Anbindung an <strong>öffentlich</strong>en Verkehr und Versorgungssysteme<br />
direkte Betriebskosten variabel: Ordner, Parkplatzwächter, Müllbeseitigung<br />
fix: Management, Instandhaltung, Geschäftsstelle<br />
indirekte Betriebskosten Polizei, Bundesgrenzschutz, Ordnungsamt<br />
Nachnutzungskosten Abriß, Renaturierung<br />
Tabelle 2:Verwendungsseite finanzieller Mittel für <strong>Stadionprojekte</strong><br />
Die Finanzierung der durch Bau und Betrieb resultierenden Kosten kann grundsätz-<br />
lich durch Beiträge aus dem privaten und <strong>öffentlich</strong>en Sektor erfolgen (siehe Abb. 7).<br />
Deutsche Profistadien sind - wie bereits dargelegt - mehrheitlich in <strong>öffentlich</strong>em<br />
Besitz. Private Investoren investieren unter Renditegesichtspunkten nicht in<br />
<strong>öffentlich</strong>e Stadien, ohne an den Eigentumsrechten in irgendeiner Form beteiligt zu<br />
sein. 79 Gleiches gilt für die Profivereine, die sich ohne Miteigentum lieber indirekt<br />
über die Abtretung von Stadioneinnahmen an den Investitionen beteiligen wollen. 80<br />
Unter den bisherigen Eigentumsverhältnissen spielen private Finanzierungsbeiträge<br />
in Form von Spenden oder Sponsoringmaßnahmen bei Stadioninvestitionen eine<br />
bislang nur untergeordnete Rolle. Neubauten und Modernisierungsmaßnahmen<br />
<strong>öffentlich</strong>er Stadien werden zum Großteil mit <strong>öffentlich</strong>en Mitteln finanziert.<br />
78<br />
Vgl. zu den Kosten <strong>öffentlich</strong>er Stadionbauten bzw. -modernisierungen u.a. Noll/Zimbalist (1997a), S. 7ff.<br />
79<br />
Scheiden private Beiträge mit unmittelbaren Renditeüberlegungen aus, verbleiben neben Spenden noch private<br />
Engagements im Sponsoringbereich. Als Gegenleistung für die private Beteiligung an den Konstruktionskosten<br />
können z.B. Werbetafeln auf Wänden, Anzeigetafeln, Logen, etc. angebracht werden. Ein noch junges aber sehr<br />
erfolgreiches Konzept aus den USA ist der Verkauf von Namensrechten an dem Stadion. Vgl. dazu u.a.<br />
Noll/Zimbalist (1997a), S. 8ff.; Welch (1997); Zimmermann (1998). Auch in Deutschland haben Unternehmen<br />
den Werbewert eines Stadionnamens erkannt. So wurde z.B. 1998 das Ulrich-Haberland-Stadion in Anlehnung<br />
an den Hauptsponsor von Bayer Leverkusen in „BayArena“ umbenannt. In Fürth wurde das städtische Stadion<br />
des Zweitligisten Greuther Fürth in Play-Mobil-Stadion umbenannt.<br />
80<br />
Vgl. o.V. (1999b) zu den Aussagen von Franz Beckenbauer, Präsident des FC Bayern München, wonach die<br />
beiden Münchner Erstligisten Bayern München und TSV 1860 München eine direkte Beteiligung an den<br />
Umbaukosten des Münchner Olympiastadions kategorisch ausschließen. Eine Mitfinanzierung soll allein über<br />
eine höhere Jahresmiete erfolgen. Zur direkten privaten Beteiligung an Stadioninvestitionen siehe die<br />
Anmerkungen in Kapitel 4.<br />
33
Privatsektor<br />
• Spenden<br />
• Sponsoring<br />
• Werbetafeln<br />
• Stadiondurchsagen<br />
• Namensrechte<br />
am Stadion<br />
• ...<br />
finanzielle Mittel für <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong><br />
direkte<br />
Beiträge<br />
(Zuschüsse,<br />
Überlassung<br />
von Grundstücken,<br />
...)<br />
<strong>öffentlich</strong>er Sektor<br />
Bund/Länder Kommunen<br />
indirekte Beiträge<br />
• Lotterien<br />
• Münzen<br />
• Steuerbefreiung<br />
• Bürgschaften<br />
• ...<br />
• direkte Stadioneinnahmen<br />
(Pacht, anteilige Zuschauereinnahmen,<br />
andere Events)<br />
• indirekte Stadioneinnahmen<br />
(Steuereinnahmen aus<br />
Einkommens- und Beschäftigungswirkungen)<br />
• Einsparungen <strong>öffentlich</strong>er<br />
Haushalte (Verzicht /<br />
Hinausschieben <strong>öffentlich</strong>er<br />
Investitionen)<br />
• Steuererhöhungen (höhere<br />
Steuersätze, neue Steuern)<br />
• ...<br />
Abbildung 7: Herkunft finanzieller Mittel für <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong><br />
Der Anteil direkter Zuschüsse von Bund und Ländern für lokale (Stadion-)Projekte ist<br />
in Deutschland ähnlich wie in den USA erheblich gesunken. 81 Indirekte Zuschüsse in<br />
Form von Steuerbefreiungsmaßnahmen, Bürgschaften oder genehmigten Sonder-<br />
einnahmen aus (bundesweiten) Lotterien, Münzprägungen, Sonderbriefmarken, etc.<br />
sind jedoch nach wie vor ein beliebtes Mittel zur Finanzierung lokaler Stadionpro-<br />
jekte. 82 Der gesamte überregionale Anteil an den <strong>öffentlich</strong>en Mitteln stellt somit in<br />
81<br />
Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 1. Der Widerstand des Bundes, <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> mit<br />
<strong>öffentlich</strong>en Mitteln zu fördern, wird auch bei der Modernisierung deutscher Stadien angesichts einer möglichen<br />
Austragung der Fußball-WM 2006 in Deutschland sichtbar. Der Bund hat sich bislang nur bereit erklärt, die<br />
Sanierung des (bundeseigenen) Olypmpiastadions in Berlin und den Neubau eines WM-Stadions in Leipzig mit<br />
je 100 Millionen DM zu fördern. Angesichts der veranschlagten Investitionssummen von bis zu 500 Millionen<br />
DM je Stadion ist der Bundesanteil eher gering. Alle anderen möglichen WM-Stadien sollen nach dem Willen<br />
der Bundesregierung ohne Bundeszuschüsse erstellt bzw. modernisiert werden. Vgl. dazu u.a. o.V. (1998e).<br />
82<br />
In den USA wurde den Kommunen in der Vergangenheit häufig erlaubt, sog. „tax exempt bonds“, d.h. von<br />
überregionalen Steuern befreite <strong>öffentlich</strong>e Wertpapiere, zur Finanzierung <strong>öffentlich</strong>er <strong>Stadionprojekte</strong><br />
auszugeben. Kommunen können mit Hilfe dieser Bonds Wertpapiere unter dem marktüblichen Zinssatz<br />
emittieren und somit Fremdkapitalzinsen einsparen. Vgl. z.B. Zimmermann (1997), S. 126f. Ähnliche<br />
Maßnahmen sind auch zur Finanzierung deutscher Stadien angedacht. Vgl. z.B. Rahmann et al. (1997), S. 184.<br />
34
vielen Fällen einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung <strong>öffentlich</strong>er <strong>Stadionprojekte</strong><br />
dar. Den weitaus größten Beitrag zur Finanzierung der Stadien leisten allerdings die<br />
Kommunen selbst.<br />
Der Kommune stehen im wesentlichen vier Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfü-<br />
gung. Zunächst kann sie die Investitionskosten teilweise durch direkte Einnahmen<br />
aus dem Stadionbetrieb begleichen. Die Höhe der direkten Einnahmen aus dem<br />
Stadionbetrieb werden vor allem durch die vertraglichen Bestimmungen zwischen<br />
der Kommune und dem Hauptnutzer (dem Profiverein) bestimmt. 83 Dazu gehören<br />
z.B. Pachtzahlungen des Vereins, Anteile an den Eintrittskarten-, Werbe- und<br />
Konzessionserlösen, sowie eine Beteiligung an den Logenmieten und Parkgebühren.<br />
Weitere Betriebseinnahmen kann die Kommune durch andere Stadionevents außer-<br />
halb des Ligabetriebs erzielen.<br />
Indirekte Einnahmen durch den Stadionbetrieb resultieren aus den Primär- und<br />
Sekundäreffekten, die durch zusätzliche Ausgaben (auswärtiger) Zuschauer in der<br />
Kommune ausgelöst werden. 84 Die Einkommens- und Beschäftigungswirkungen<br />
können die kommunalen Steuereinnahmen erhöhen und somit zur Finanzierung der<br />
Investitionskosten beitragen. Die Finanzierung kann auch durch Einsparungen in<br />
anderen <strong>öffentlich</strong>en Bereichen erfolgen. Durch den völligen oder teilweisen Verzicht<br />
auf andere <strong>öffentlich</strong>e Maßnahmen oder die zeitliche Rückstellung dieser<br />
Investitionen werden finanzielle Mittel freigesetzt, die für <strong>Stadionprojekte</strong> eingesetzt<br />
werden können. Schließlich besteht aus kommunaler Sicht auch die Möglichkeit,<br />
Steuererhöhungen durchzuführen, indem Steuersätze angehoben oder neue, mit<br />
dem Projekt oft unverwandte Steuern erhoben werden. 85<br />
Zur Finanzierung von Profisportstadien mit Hilfe indirekter Zuschüsse vgl. Rahmann et al. (1998); Maennig<br />
(1988), S. 312f., Noll/Zimbalist (1997), S. 14 und Murphy (1988).<br />
83<br />
Vgl. z.B. Okner (1974), S. 334f. Reichen die direkten Einnahmen aus dem Stadionbetrieb nicht aus, um alle<br />
Investitionskosten zu decken, werden die Profiteams subventioniert.<br />
84<br />
Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.2.1.<br />
85<br />
Vgl. z.B. Noll/Zimbalist (1997b); Zimmermann (1997). Unverwandte Sondersteuern werden oft in Form der<br />
sog. „sin-taxes“ auf Alkohol und Tabak erhoben. Z.T. erfolgt eine überregionale Erhebung dieser Steuern, um<br />
lokale <strong>Stadionprojekte</strong> zu unterstützen. Dann handelt es sich um direkte überregionale Beiträge aus<br />
Steuermitteln. Vgl. z.B. Kraul (1993); Irani (1997), S. 250f. Für Deutschland muß einschränkend ergänzt<br />
werden, daß die Möglichkeiten der Kommunen, eigene Steuern zu erheben, im Vergleich zu den USA begrenzt<br />
sind.<br />
35
3.2.2. Beurteilung nachfrageorientierter Auftragsstudien<br />
Spezielle economic impact studies werden von Stadioninteressenten zur Legitimation<br />
<strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen in Auftrag gegeben. Stadioninvestitionen führen vor<br />
allem durch einen Anstieg der Zuschauererlöse zu mehr Ausgaben in der Kommune.<br />
Viele Auftragsstudien versuchen zunächst, diese Zusatzausgaben zu quantifizieren,<br />
um anschließend mit Hilfe der Multiplikatoranalyse die Gesamtauswirkungen öffent-<br />
licher Stadioninvestitionen auf Einkommen, Beschäftigung und Steuereinnahmen in<br />
der Kommune zu ermitteln. Spezielle makroökonomische Studien enthalten gerade<br />
wegen der zahlreichen subjektiven Entscheidungselemente viele Fehlerquellen bei<br />
der Berechnung und Interpretation der Ergebnisse, die nicht überraschend<br />
zugunsten der Auftraggeber der Studien ausgefüllt werden. 86 Als Ergebnis der<br />
publizierten Auftragsstudien kann zumeist festgehalten werden, daß den Kosten<br />
<strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen hohe Nutzenrückflüsse für die breite Bevölkerung<br />
gegenüberstehen. Öffentliche Stadioninvestitionen tragen zu einer bedeutenden<br />
wirtschaftlichen Entwicklung der Kommune bei, so daß „... the stadium appears to be<br />
a major force in the local economy.“ 87 Entsprechen die Ergebnisse der Studien nicht<br />
den Erwartungen der Auftraggeber, werden sie vielfach nicht ver<strong>öffentlich</strong>t. 88<br />
3.2.2.1. Unterschätzung der Kosten <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen<br />
Die Kritik unabhängiger Ökonomen an den Auftragsstudien bezieht sich auf falsche<br />
Annahmen hinsichtlich der Verwendungs- und Herkunftsseite der benötigten finan-<br />
ziellen Mittel. Kosten werden vielfach unterschätzt, Nutzenrückflüsse überschätzt.<br />
Unterschätzung der Grundstückskosten<br />
Beziehen sich die Investitionskosten auf den Bau eines neuen Stadions an einem<br />
neuen Ort, berücksichtigen viele economic impact studies nicht die tatsächlichen<br />
Kosten für das Grundstück. Handelt es sich beispielsweise um ein Grundstück in<br />
kommunalem Besitz, werden die Grundstückskosten oft ganz vernachlässigt. Es<br />
werden keine finanziellen Mittel für den Kauf benötigt. Da <strong>öffentlich</strong>e Grundstücke<br />
aber auch privat vermarktet werden können und private Unternehmensansiedlungen<br />
ebenfalls positive ökonomische <strong>Auswirkungen</strong> haben, sind Opportunitätskosten in<br />
Form nicht erzielter Grundstückserlöse und entgangener Steuereinnahmen zu<br />
86 Vgl. u.a. Baade/Dye (1988).<br />
87 Baim (1994), S. 177.<br />
88 Vgl. Késenne (1997), S.4.<br />
36
erücksichtigen. 89 Existiert noch ein altes Stadion, welches durch den Neubau nicht<br />
mehr genutzt wird, können weitere Kosten anfallen. Wurden beispielsweise die<br />
Konstruktionskosten des alten Stadions durch den Stadionbetrieb bis zum Ende der<br />
Nutzung noch nicht gedeckt, müssen beim Stadionneubau die nicht amortisierten<br />
Konstruktionskosten berücksichtigt werden. 90<br />
Unterschätzung der Konstruktions- und Infrastrukturkosten<br />
Das häufig größte Problem vieler Auftragsstudien liegt in den prognostizierten<br />
Konstruktionskosten der <strong>Stadionprojekte</strong>. 91 Gerade bei längerfristigen Bauvorhaben<br />
unterliegen Preise oft lohn- und wechselkursbedingten Schwankungen. Eine erhöhte<br />
Baunachfrage kann zu Preissteigerungen für die Leistungen der Bauunternehmen<br />
und Zulieferer führen. Sehen <strong>Stadionprojekte</strong> komplexe, neuartige Konstruktionen<br />
vor, kann neben der Preis- auch die Mengenproblematik zu einer falschen<br />
Berechnung der Konstruktionskosten führen. Genaue Mengen an Baustoffen,<br />
Arbeitszeit, Maschineneinsatz, etc. lassen sich im Vorfeld nicht genau quantifizieren.<br />
Eine empirische Untersuchung zum Vergleich zwischen geplanten und tatsächlichen<br />
Konstruktionskosten von Profisportstadien in den USA zeigt, daß die tatsächlichen<br />
Konstruktionskosten durchschnittlich 73 Prozent über den geplanten Kosten liegen. 92<br />
Die Fehlkalkulationen sind bei den teuersten <strong>Stadionprojekte</strong>n (Superdomes) mit<br />
Kostensteigerungen von bis zu 367 Prozent am gravierendsten. Ein Auseinanderfal-<br />
len von geplanten und tatsächlichen Kosten ist auch für deutsche <strong>Stadionprojekte</strong><br />
nachweisbar. Allein die Dachkonstruktion des Münchner Olympiastadions, Spielstätte<br />
des FC Bayern München und TSV 1860 München, hat statt der veranschlagten 45<br />
Millionen DM tatsächlich 172 Mio. DM gekostet. 93<br />
89<br />
Vgl. Okner (1974), S. 325.<br />
90<br />
Dies gilt in erster Linie dann, wenn zuvor ein positiver Deckungsbeitrag mit dem Stadionbetrieb erzielt<br />
werden konnte. Eine Auftragsstudie über die ökonomische Bedeutung des Fußballbundesligisten Borussia<br />
Mönchengladbach und eines Stadionneubaus in Gladbach vernachlässigt sowohl die Opportunitätskosten für das<br />
neue Grundstück als auch die nicht amortisierten Konstruktionskosten des alten Stadions. Gleichwohl fließen die<br />
finanziellen Mittel durch einen möglichen Verkauf des alten Stadiongeländes als Nutzen in die Berechnungen<br />
mit ein. Vgl. Hamm (1996).<br />
91<br />
Vgl. dazu u.a. Maennig (1998), S. 318ff.<br />
92<br />
Vgl. zu der Untersuchung Baim (1994), S. 157f.<br />
93<br />
Vgl. Maennig (1998), S. 318ff. Maennig weist auch auf Fehlkalkulationen bezüglich der Konstruktionskosten<br />
Olympischer Spiele auf. Die Ex-post-Abweichung lag hinsichtlich der Konstruktionskosten der Sportstätten<br />
zwischen 1972 (München) und 1996 (Atlanta) bei durchschnittlich 116 Prozent.<br />
37
Eine US-Studie zum Vergleich der Konstruktionskosten <strong>öffentlich</strong>er und privater<br />
Profisportstadien zeigt, daß private Stadien im Durchschnitt deutlich günstiger erstellt<br />
werden. 94 Gleichzeitig sind die privaten Stadien größer und besser auf die<br />
Bedürfnisse der Zuschauer ausgerichtet. Die Ergebnisse lassen darauf schließen,<br />
daß neben der Preis- und Mengenproblematik auch <strong>öffentlich</strong>e Ressourcenver-<br />
schwendungen für den Anstieg der Konstruktionskostensteigerungen <strong>öffentlich</strong>er<br />
<strong>Stadionprojekte</strong> mitverantwortlich sind. 95<br />
Viele Auftragsstudien vernachlässigen die Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen,<br />
die für einen ordentlichen Stadionbetrieb notwendig sind, aber außerhalb des<br />
Stadions anfallen. 96 Kosten für die Anbindung des Stadions an den <strong>öffentlich</strong>en<br />
Verkehr, die Verlegung von Versorgungsleitungen zum Stadion oder Investitionen in<br />
den Umweltschutz werden nicht den Stadioninvestitionen zugerechnet. Da die<br />
meisten Auftragsstudien die ex-ante kalkulierten Konstruktionskosten in ihren<br />
Prognosewirkungen berücksichtigen und ein Teil der Infrastrukturkosten unberück-<br />
sichtigt bleibt, werden die tatsächlichen Investitionskosten der <strong>Stadionprojekte</strong> z.T.<br />
erheblich unterschätzt.<br />
Unterschätzung direkter und indirekter Stadionbetriebskosten<br />
Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung, Versicherungsprämien, etc. hängen zu<br />
einem Großteil von der Höhe der Konstruktionskosten ab. Mit steigenden Kon-<br />
struktionskosten nehmen in der Regel auch die direkten Betriebskosten proportional<br />
zu. Auf Erfahrungswerten basierende Schätzungen gehen von durchschnittlichen<br />
jährlichen Betriebskosten in Höhe von zehn Prozent der Investitionskosten aus. 97<br />
Unterschätzen Auftragsstudien die Investitionskosten, werden oftmals viel zu<br />
niedrige Werte für die direkten Betriebskosten angesetzt.<br />
94 Vgl. zur Untersuchung und den Ergebnissen Baim (1994), S. 195ff. Es ist anzumerken, daß die privaten<br />
Stadien nicht ausschließlich mit privaten Mitteln, sondern auch mittels bedeutender direkter <strong>öffentlich</strong>er<br />
Subventionen finanziert werden. Entscheidend für den Unterschied in den Konstruktionskosten ist hier, daß die<br />
Planung, Durchführung und Kontrolle der <strong>Stadionprojekte</strong> in privater Hand liegt.<br />
95 Venturi (1993) und Obermaier (1993) weisen z.B. darauf hin, daß bei der Vergabe von Infrastrukturprojekten<br />
im Vorfeld der Fußball-WM 1990 in Italien erhebliche Schmiergelder geflossen sind, die eine Absprache von<br />
erhöhten Preisen für <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> vermuten lassen.<br />
96 Vgl. z.B. Noll/Zimbalist (1997c), S. 496f.<br />
97 Vgl. Rahmann et al. (1998), S. 130f.<br />
38
Andere Kosten, die durch den Betrieb des Stadions entstehen, aber nicht im Haus-<br />
haltsbudget der <strong>öffentlich</strong>en Stadionbetreibergesellschaft Berücksichtigung finden,<br />
werden in economic impact studies oft gänzlich vernachlässigt. 98 Dazu gehören z.B.<br />
Aufwendungen für Sicherheitspersonal (Polizei, Bundesgrenzschutz), für die Beseiti-<br />
gung von Müll und möglichen Sachschäden außerhalb des Stadions sowie für<br />
Brandschutz, medizinische Versorgung und die Abstimmung innerhalb der kommu-<br />
nalen Verwaltung im Zuge von Eventdurchführungen. Insgesamt werden in Auftrags-<br />
studien zumeist nur unzureichende direkte und indirekte Betriebskosten<br />
veranschlagt.<br />
3.2.2.2. Vernachlässigte Kosten und Verteilungswirkungen auf der Einnahmenseite<br />
In Auftrag gegebene spezielle economic impact studies unterschätzen nicht nur die<br />
Investitions- und Betriebskosten <strong>öffentlich</strong>er <strong>Stadionprojekte</strong>, die sich aus der<br />
Verwendung der finanziellen Mittel ergeben. Einsparungen in <strong>öffentlich</strong>en Haus-<br />
halten, Budgeterweiterungen durch Steuererhöhungen und indirekte überregionale<br />
Zuschüsse führen auf der Herkunftsseite der Finanzmittel zu weiteren<br />
(Opportunitäts)Kosten und Verteilungswirkungen, die in den Analysen oftmals<br />
unberücksichtigt bleiben.<br />
Einsparungen <strong>öffentlich</strong>er Haushalte<br />
Werden Stadioninvestitionen zu Lasten anderer <strong>öffentlich</strong>er Aufgaben durchgeführt,<br />
müssen mögliche Verteilungswirkungen und Opportunitätskosten berücksichtigt<br />
werden. Von Einsparungen im Sozialwesen, im Bildungsbereich, im Bereich öffentli-<br />
cher Sicherheit, etc. sind zunächst mehrheitlich ärmere Bevölkerungsschichten<br />
betroffen. 99 Werden diese nicht durch entsprechende Nutzenrückflüsse durch die<br />
Stadioninvestitionen kompensiert, verursachen Sparmaßnahmen unerwünschte<br />
distributive Wirkungen. Zudem führen Einsparungen im Bildungsbereich oder in<br />
gewerbliche Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Gewerbegebiete) zu einer geringeren<br />
Standortattraktivität für Unternehmen. Angebotsseitige Nutzenrückflüsse durch<br />
verstärkte Unternehmensansiedlungen werden vermindert und müssen als Opportu-<br />
nitätskosten den Stadioninvestitionen zugerechnet werden. 100<br />
98<br />
Vgl. dazu u.a. Okner (1974), S. 333; Noll/Zimbalist (1997c), S. 496f.; Rahmann et al. (1998), S. 79f.;<br />
Crompton (1995), S. 32f.<br />
99<br />
Vgl. Okner (1974), S. 344.<br />
100<br />
Vgl. z.B. Crompton (1995), S. 30ff. und die Ausführungen in Abschnitt 3.2.3.<br />
39
Steuererhöhungen<br />
Steuererhöhungen in Form höherer Steuersätze oder neu eingeführter Steuern<br />
führen zu Kosten, die z.T. weit über den eigentlichen Mehreinnahmen liegen. Empiri-<br />
sche Untersuchungen aus den USA zeigen, daß die gesellschaftlichen Kosten der<br />
Besteuerung die Steuereinnahmen um ca. 25 Prozent übersteigen. 101 Die Ursache<br />
hierfür liegt nicht allein in den Kosten der Steuererhebung. Höhere direkte Steuern<br />
reduzieren das verfügbare Einkommen privater Haushalte. Andere Güter und<br />
Dienstleistungen werden weniger nachgefragt. Es entstehen Opportunitätskosten in<br />
anderen (lokalen) Wirtschaftsbereichen. Höhere indirekte Steuern auf Alkohol, Tabak<br />
oder andere Verkäufe führen auch in diesen Bereichen zu einer suboptimalen Allo-<br />
kation. 102 Indirekte Steuern belasten untere Einkommensgruppen aufgrund der<br />
höheren Konsumquote in stärkerem Maße. Werden Geringverdiener nicht durch<br />
entsprechende stadioninduzierte Nutzenrückflüsse kompensiert, kommt es neben<br />
allokativen Verzerrungen zu regressiven Verteilungswirkungen.<br />
Überregionale Zuschüsse<br />
Direkte überregionale Zuschüsse durch Bund und Länder werden ebenfalls durch<br />
Einsparungen oder Steuererhöhungen finanziert. Es kommt zu ähnlichen allokativen<br />
Wirkungen wie auf kommunaler Ebene. Da die Nutzenrückflüsse aus den Stadionin-<br />
vestitionen größtenteils regionalen Charakter haben, 103 sind negative Verteilungswir-<br />
kungen sehr wahrscheinlich. Ähnliches gilt für die quantitativ wichtigeren indirekten<br />
Beiträge des Bundes und der Länder wie Sondereinnahmen aus genehmigten Lotte-<br />
rien und steuerbefreiten Investitionen.<br />
Untersuchungen staatlich genehmigter Lotterien in den USA zeigen zwei wichtige<br />
Phänomene: 104 Zum einen ziehen selbst kommunal durchgeführte Lotterien viele<br />
überregionale Teilnehmer an. Zum anderen fühlen sich ärmere Bevölkerungs-<br />
schichten überproportional von Lotterien angezogen. Im Fall der überregionalen<br />
Teilnehmer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von negativen Verteilungswirkungen<br />
101 Vgl. zu den Untersuchungen z.B. Shoven/Whalley (1984); Bovenberg/Goulder (1996). Zu den allokativen<br />
und distributiven Wirkungen der Steuererhöhungen vgl. u.a. Crompton (1995), S. 30ff.; Noll/Zimbalist (1997b),<br />
S. 60ff.<br />
102 Durch geänderte relative Preisverhältnisse im individuellen Warenkorb kann es zu einer geringeren<br />
Nachfrage bei einem insgesamt höheren Marktpreis kommen, so daß Wohlfahrtsverluste in Höhe des<br />
sogenannten Steuerkeils auftreten (excess burden).<br />
103 Vgl. Osterberg (1991).<br />
104 Vgl. Zimmermann (1997), S. 126; Clotfelder/Cook (1989); Noll/Zimbalist (1997b), S. 87.<br />
40
auszugehen. Ob sich lokal regressive Wirkungen ergeben, hängt von der Verteilung<br />
der Nutzenrückflüsse aus den Stadioninvestitionen ab.<br />
Indirekte Zuschüsse anhand von Steuerbefreiungen sind in den USA wichtiger<br />
Bestandteil der Finanzierung lokaler <strong>Stadionprojekte</strong> und werden auch in Deutsch-<br />
land verstärkt diskutiert. Beliebtestes Mittel zur Finanzierung <strong>öffentlich</strong>er<br />
Stadioninvestitionen ist dabei die Ausgabe steuerbefreiter festverzinslicher Wertpa-<br />
piere. 105 Durch den Verzicht auf überregionale Besteuerung können die Wertpapiere<br />
unterhalb des sonst üblichen Marktzinses emittiert werden. Auf überregionaler Seite<br />
kommt es zu Kosten durch Steuermindereinnahmen, auf kommunaler Seite zu<br />
Nutzen in Form geringerer Fremdkapitalzinsen. Die Ausgabe der sogenannten tax-<br />
exempt bonds ist mit negativen allokativen und distributiven <strong>Auswirkungen</strong><br />
verbunden (siehe Abb. 8). 106<br />
Im Falle eines marktüblichen Zinssatzes für normale festverzinsliche Wertpapiere in<br />
Höhe von zehn Prozent sind Steuerzahler mit einem angenommenen<br />
Höchststeuersatz von 35 Prozent bei einem Zinssatz von 6,5 Prozent für<br />
steuerbefreite Bonds gerade indifferent zwischen beiden Wertpapierarten. Je höher<br />
der Zinssatz für die tax-exempt bonds, desto stärker die Nachfrage nach diesen<br />
Wertpapieren aufgrund der Steuervorteile. Die Kommune bestimmt den Zinssatz so,<br />
daß die Nachfrage nach den Bonds dem gewünschten Angebot, d.h. der<br />
gewünschten Fremdkapitalaufnahme, entspricht. Im vorliegenden Beispiel entspricht<br />
die Nachfrage für die steuerbefreiten Bonds bei einem Zinssatz von 7,5 Prozent dem<br />
gewünschten Angebot. Steuerzahler mit einem Steuersatz von mehr als 25 Prozent<br />
präferieren die steuerbefreiten Bonds. 107<br />
Auf Seiten überregionaler Haushalte entstehen Kosten in Form von Steuerminder-<br />
einnahmen. Diese Kosten entsprechen der Fläche des Trapezes abcd. Der Nutzen<br />
der Kommune liegt in geringeren Fremdkapitalkosten und stimmt mit der Fläche des<br />
105<br />
Vgl. Fußnote 82. Noll/Zimbalist (1997c), S. 500f. und Baldo (1991) weisen darauf hin, daß die US-<br />
Bundesregierung durch die Steuerreform 1986 versucht hat, diese Art indirekter Zuschüsse für lokale Projekte<br />
einzudämmen. Die Kommunen können aber zahlreiche Schlupflöcher ausnutzen, so daß die steuerbefreite<br />
Ausgabe festverzinslicher Wertpapiere nach wie vor in hohem Maße zur Stadionfinanzierung herangezogen<br />
wird.<br />
106<br />
Vgl. zu den allokativen und distributiven <strong>Auswirkungen</strong> von tax-exempt bonds Osterberg (1991) sowie<br />
ausführlich Zimmermann (1991).<br />
107<br />
Beträgt der Steuersatz exakt 25 Prozent, ist der Steuerzahler zwischen beiden Wertpapierarten indifferent.<br />
41
Rechtecks bcde überein. Aus der Zeichnung ist ersichtlich, daß direkte Zuschüsse<br />
gegenüber der indirekten Steuerbefreiung vorteilhafter sind. Aus allokativer Sicht<br />
werden im Vergleich zur direkten Bezuschussung <strong>öffentlich</strong>e Ressourcen<br />
verschwendet, die mit der Fläche des Dreiecks abe kongruieren.<br />
10% (i normal)<br />
7,5%<br />
6,5%<br />
i normal<br />
i steuerbefreit<br />
d<br />
e<br />
a<br />
emittierte<br />
Wertpapiere<br />
Abbildung 8: Ökonomische Wirkungen steuerbefreiter <strong>öffentlich</strong>er Bonds 108<br />
Abgesehen von der Ressourcenvergeudung müssen zusätzliche Opportunitäts-<br />
kosten berücksichtigt werden. Sinkt die Nachfrage nach den normalen festverzins-<br />
lichen Wertpapieren des Privatsektors, können nicht mehr alle lohnenswerten<br />
privaten Investitionen durchgeführt werden. Verdrängungseffekte treten auf und<br />
volkswirtschaftliche Verluste entstehen. 109 Da Steuermindereinnahmen auf<br />
überregionaler Ebene durch Einsparungen in anderen Haushaltsbereichen oder<br />
Steuererhöhungen kompensiert werden müssen, sind allokative und distributive<br />
<strong>Auswirkungen</strong>, wie sie bei den direkten überregionalen Beiträgen entstehen, zu<br />
berücksichtigen. Weitere negative Verteilungswirkungen resultieren aus der<br />
108<br />
Vgl. dazu Osterberg (1991).<br />
109<br />
Steigt angesichts der zu geringen Nachfrage der Zinssatz können sich beispielsweise einige<br />
Investitionsprojekte für den Investor nicht mehr lohnen.<br />
42<br />
A<br />
c<br />
b<br />
N (i steuerbefreit)
Tatsache, daß höhere Einkommensklassen mit den höchsten Steuersätzen<br />
überproportional von den Steuerbefreiungsmaßnahmen profitieren.<br />
3.2.2.3. Überschätzung der Nutzen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen<br />
Viele nachfrageorientierte Auftragsstudien unterschätzen die tatsächliche Höhe der<br />
erforderlichen Finanzmittel für den Bau bzw. die Modernisierung und den Betrieb<br />
neuer, moderner Stadien. Die genannten (Opportunitäts)Kosten auf der Einnahmen-<br />
seite werden in den economic impact studies genau wie negative Verteilungswirkun-<br />
gen zumeist ganz vernachlässigt. Wegen des eher regionalen Charakters der<br />
Nutzenrückflüsse <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen treten in Folge der überregionalen<br />
Finanzierung durch zum Teil ärmere Einkommensklassen negative Verteilungs-<br />
wirkungen mit großer Wahrscheinlichkeit auf.<br />
Da auch auf kommunaler Ebene ärmere Einkommensklassen überproportional an<br />
den Kosten beteiligt werden, würden sich die distributiven <strong>Auswirkungen</strong> verstärken,<br />
wenn ärmere ortsansässige Privathaushalte nicht durch entsprechende Nutzenrück-<br />
flüsse entschädigt werden. Objektive Einwände gegen die getroffenen Annahmen in<br />
den economic impact studies sowie die Ergebnisse unabhängiger empirischer Unter-<br />
suchungen zeigen, daß die Nutzenrückflüsse <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen in<br />
Form direkter und indirekter kommunaler Einnahmen aus dem Stadionbetrieb in den<br />
Auftragsstudien z.T. erheblich überschätzt werden. 110<br />
Überschätzung der direkten Stadioneinnahmen<br />
Von Stadioninteressenten initiierte economic impact studies kommen in ihren<br />
Berechnungen zu dem Ergebnis, daß der Wechsel eines Profisportteams in ein<br />
neues bzw. modernisiertes Stadion zu direkten jährlichen Mehreinnahmen von bis zu<br />
30 Millionen US-$ führt. 111 In ihrer Argumentation gehen viele Autoren davon aus,<br />
daß die zusätzlichen Stadioneinnahmen „gerecht“ zwischen der Stadt und dem<br />
110<br />
Direkte kommunale Einnahmen aus dem Stadionbetrieb bestimmen die Höhe des Selbstfinanzierungsgrades<br />
der Investitionen und somit auch die kommunale Steuerbelastung. Indirekte Einnahmen aus dem Primär- und<br />
Sekundäreffekt, ausgelöst durch zusätzliche Zuschauerausgaben, führen über höhere Steuereinnahmen ebenfalls<br />
zu einem höheren Selbstfinanzierungsgrad. Gleichzeitig erhält die kommunale Bevölkerung Nutzenrückflüsse in<br />
Form von mehr Einkommen und Beschäftigung.<br />
111<br />
In Abhängigkeit von den regionalen Bedingungen und der Ligasportart kann ein neues Stadion in den USA in<br />
den ersten Jahren zusätzliche Teameinnahmen in Höhe von 10 bis 30 Mio. US-$ jährlich stiften. Vgl.<br />
Noll/Zimbalist (1997c), S. 495. Schröder (1987), S. 26ff. schätzt die jährlichen Mehreinnahmen des SV Werder<br />
Bremen durch die geplante Stadionmodernisierung auf 7,1 Millionen DM. Baade/Sanderson (1997) weisen<br />
darauf hin, daß die Mehreinnahmen durch eine höhere Stadionqualität nicht von Dauer sind, da die (relative)<br />
Qualität der Stadien im Zeitverlauf durch Abnutzung, technische Entwicklung, etc. wieder sinkt.<br />
43
Verein aufgeteilt werden. Öffentliche Stadioninvestitionen würden sich somit zu<br />
einem bedeutenden Teil selbst finanzieren. Verschiedene empirische<br />
Untersuchungen unabhängiger Ökonomen zeigen hingegen, daß der überwiegende<br />
Teil der Profisportstadien in den USA durch den Betrieb gerade in der Lage ist, die<br />
variablen (Betriebs-)Kosten zu decken. 112 In bezug auf viele deutsche Fußballstadien<br />
wird davon ausgegangen, daß selbst „... im reinen Betriebsführungsgeschäft [...]<br />
noch ein Verlust realisiert wird, der dann über die kommunalen Haushalte<br />
ausgeglichen werden muß.“ 113<br />
Die Studien zeigen weiter, daß gerade die neuen, modernen Stadien einen<br />
tendenziell geringen (oft negativen) Deckungsbeitrag durch den Betrieb erzielen.<br />
(Fußball)Vereine als Hauptmieter der Stadien müssen demnach keinen kosten-<br />
deckenden Preis für die Benutzung der Stadien entrichten. Im Vergleich zu<br />
kostendeckenden Preisen erhöhen sich die Nettoeinnahmen der Teams. Ihnen<br />
fließen Subventionen ungefähr in Höhe der Konstruktionskosten zu. Da sich die<br />
Konstruktionskosten der neuen, modernen Stadien deutlich verteuert haben, steigen<br />
die Subventionen für die Vereine durch den Wechsel in ein besseres Stadion. Eine<br />
„gerechte“ Aufteilung der Mehreinnahmen ist unwahrscheinlich. Vielmehr steigen die<br />
Kosten der <strong>öffentlich</strong>en Hand, da die absolute Höhe der durch den Betrieb<br />
ungedeckten (Konstruktions)Kosten zunimmt. Diese Tendenz kann auch durch die<br />
Ergebnisse der Real Estate Research Consultants Studie über die sinkenden<br />
kommunalen Anteile an den Stadioneinnahmen bei gleichzeitig steigenden<br />
Stadionkosten belegt werden. 114 Im Ergebnis wird die Spanne zwischen direkten<br />
Stadioneinnahmen und nicht gedeckten Konstruktionskosten in Folge <strong>öffentlich</strong>er<br />
Stadioninvestitionen größer statt kleiner. Theoretisch kann dies auf zweierlei Weise<br />
erklärt werden.<br />
Fußballstadien gleichen natürlichen Monopolen (siehe Abb.9). 115 Sie sind gekenn-<br />
zeichnet durch sehr hohe Fixkosten und verhältnismäßig geringe variable Kosten.<br />
112 Vgl. zu den verschiedenen Untersuchungen z.B. Okner (1974); Baim (1994); Quirk/Fort (1992);<br />
Owen/Beitsch (1997). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Colclough/Daellenbach/Sherony (1994) für die Minor<br />
League.<br />
113 Rahmann et al. (1998), S. 185.<br />
114 Vgl. dazu die Anmerkungen in Fußnote 25 mit Verweis auf die Ergebnisse der Real Estate Research<br />
Consultants Studie, dokumentiert von Owen/Beitsch (1997).<br />
115 Vgl. z.B. Késenne/Butzen (1987), S. 101ff.; Rahmann et al. (1998), S. 131; Okner (1974), S. 330f.<br />
44
Aufgrund positiver Skalenvorteile kommt es zur Fixkostendegression. Mit<br />
zunehmender Auslastung sinken die Durchschnittskosten, wobei die Kurve der<br />
Durchschnittskosten im relevanten Angebots- und Nachfragebereich immer oberhalb<br />
der Grenzkostenkurve liegt. (Fußball-)Stadien erfordern hohe spezifische<br />
Investitionen mit nur wenigen Verwendungsmöglichkeiten. Einzig lohnende<br />
Verwendung ist oftmals die Vermietung an ein Profiteam für Ligaspiele. Eine höhere<br />
Auslastung durch Ligasport anderer Sportarten scheidet durch den Trend zu Single-<br />
Sport-Stadien immer öfter aus. 116 In der Vergangenheit wurde der Bau von Single-<br />
Sport-Stadien u.a. dadurch gerechtfertigt, weil dort zumindest auch Rockkonzerte<br />
und andere Events stattfinden können. Der interkommunale Wettbewerb zwischen<br />
<strong>öffentlich</strong>en Veranstaltungshallen, Stadien, Parks, etc. führt aber dazu, daß der<br />
Großteil der erzielbaren Renten von den Künstlern bzw. privaten Veranstaltern<br />
abgeschöpft wird und die Kommunen die Stadien oft sogar zu Preisen unter ihren<br />
variablen Kosten zur Verfügung stellen. 117<br />
45<br />
P<br />
Grenzkosten (K‘)<br />
Durchschnittskosten (∅K)<br />
Nachfrage (N)<br />
Preis (P)<br />
N<br />
∅K<br />
K‘<br />
Auslastung<br />
Abbildung 9: Angebot und Nachfrage nach Profisportstadien<br />
116 Vgl. dazu die Anmerkungen in Kapitel 1.<br />
117 Vgl. dazu u.a. Baldo (1991), S. 37 und ausführlich Rahmann et al. (1998), Kapitel 3.
Die Anzahl der Spiele wird durch den Modus der Liga bestimmt und beträgt für die<br />
Fußballbundesliga derzeit 17 Heimspiele je Saison (zuzüglich nationaler und<br />
internationaler Pokalspiele, Freundschaftsspiele, etc.). Die Nachfrage nach dem Gut<br />
Stadion ist daher in bezug auf die Liga unelastisch. 118 Gleichzeitig haben die Vereine<br />
aufgrund des Wettbewerbs zwischen den Kommunen um Profiteams und der<br />
Relocation-Möglichkeit eine starke Verhandlungsposition. Der interkommunale<br />
Wettbewerb senkt die Preise, die zwischen Kommune und Verein für die<br />
Stadionüberlassung vereinbart werden, vielfach auf die Höhe der Grenzkosten. 119 Da<br />
die Grenzkostenkurve in natürlichen Monopolen unterhalb der Durchschnitts-<br />
kostenkurve verläuft, erwirtschaftet die Kommune durch den Stadionbetrieb Verluste.<br />
Diese Verluste entsprechen Subventionen, die in etwa den Konstruktionskosten<br />
entsprechen. Nutznießer dieser Subventionen sind die Profivereine. Durch nicht<br />
kostendeckende Pachtkonditionen erhöhen sich ihre Nettoeinnahmen.<br />
Können die Vereine nicht glaubwürdig mit einer Abwanderung drohen, so daß sie<br />
sich in einer schwächeren Verhandlungsposition befinden, steht die Kommune bei<br />
der Preisfestlegung vor einem Trade-Off-Problem. Kurzfristig ist es der Kommune<br />
möglich, kostendeckende Preise für die Stadionüberlassung zu erzielen. Dadurch<br />
erleiden die betroffenen Profivereine Wettbewerbsnachteile gegenüber den<br />
Vereinen, die in einer stärkeren Verhandlungsposition sind und somit günstigere<br />
Pachtkonditionen durchsetzen können. Die schlechtere Wettbewerbsfähigkeit kann<br />
zu einem schwächeren Team und weniger sportlichem Erfolg führen. Sinkender<br />
sportlicher Erfolg führt in der Regel zu weniger Zuschauereinnahmen.<br />
Viele Kommunen sind prozentual an den Zuschauereinnahmen beteiligt und erleiden<br />
somit mittel- bis langfristig Mindereinnahmen. In Extremfällen wie dem Abstieg in die<br />
zweite Liga oder dem Konkurs des Vereins können in Anbetracht der geringen<br />
118<br />
Die Anzahl an Freundschafts- und Pokalspielen ist jedoch variabel, so daß die Nachfrage der Vereine nach<br />
dem Gut Stadion nicht vollkommen unelastisch ist.<br />
119<br />
Noll/Zimbalist (1997b), S. 78 weisen darauf hin, daß nicht immer die Kommunen, welche die höchsten<br />
Subventionen gewähren, den Wettbewerb um die Teams gewinnen. Die Profiteams berücksichtigen bei ihren<br />
Standortentscheidungen nicht nur die Subventionen sondern die Höhe der möglichen Gesamteinnahmen (und<br />
Kosten). Da die Gesamteinnahmen in großen Metropolen z.B. aufgrund des höheren Pro-Kopf-Einkommens und<br />
einer großen Bevölkerung tendenziell höher sind, fallen die notwendigen Subventionen großer Metropolen<br />
oftmals geringer aus. Dadurch können z.T. positive Deckungsbeiträge realisiert werden. Ein kostendeckender<br />
Betrieb ist aber auch hier zumeist nicht möglich.<br />
46
Verwendungsalternativen kaum noch Erlöse mit dem Stadion erzielt werden. Die<br />
Kommune muß also bei der kurzfristigen Preisfestsetzung die langfristig möglichen<br />
Konsequenzen berücksichtigen. Zudem müssen Politiker angesichts der großen<br />
Beliebtheit des Profisports in der Bevölkerung und den hohen Einnahmen für<br />
bestimmte privatwirtschaftliche Bereiche mit dem Widerstand von Wählern und<br />
Lobbyisten gegen zu hohe Mietzahlungen rechnen. Angesichts der mittel- bis<br />
langfristigen ökonomischen und politischen Konsequenzen sind die Kommunen<br />
vielfach bereit, auch Vereinen ohne echte Relocation-Möglichkeit günstige, nicht<br />
kostendeckende Pachtkonditionen anzubieten.<br />
Untersuchungen zum Profiteamsport in den USA zeigen, daß für jedes der 25<br />
Stadionneubauten zwischen 1978 und 1992 jährliche Subventionen in Höhe von<br />
durchschnittlich ca. sieben Millionen US-$ an das dort spielende Team fließen. 120<br />
Angesichts der steigenden Konstruktionskosten der Profisportstadien gehen<br />
Sportökonomen von jährlichen Subventionen von durchschnittlich mehr als zehn<br />
Millionen US-$ je Profiteam in den USA für die nächsten zehn Jahre aus. 121 Von<br />
diesen Subventionen profitieren in erster Linie die Profivereine. Stadionsubventionen<br />
werden nur in seltenen Fällen in Form sinkender Eintrittspreise an die Zuschauer<br />
weitergegeben. Dafür gibt es folgende Erklärung.<br />
Nur wenige Kommunen verfügen über mehrere Major League-Teams bzw. Bundesli-<br />
gisten einer Sportart. Die Teams bieten ihr sportartspezifisches Produkt Ligasport als<br />
regionaler Monopolist (zumindest aber als Duopolist) an. Es ist den Vereinen in<br />
bestimmten Maße möglich, die Höhe der Eintrittspreise endogen festzusetzen und<br />
Monopolrenten abzuschöpfen. 122 Die Höhe der Monopolrenten wird u.a. durch die<br />
Preiselastizität der Nachfrage bestimmt. Verschiedene empirische Untersuchungen<br />
kommen zu dem Ergebnis, daß im Falle von Profiteamsport eine relativ starre<br />
Preiselastizität der Nachfrage vorliegt. 123 Dadurch können hohe Eintrittspreise und<br />
somit hohe Monopolrenten von den Vereinen abgeschöpft werden.<br />
120<br />
Vgl. dazu Quirk/Fort (1992), S. 170f.<br />
121<br />
Vgl. z.B. Armacost (1997).<br />
122<br />
Vgl. z.B. Noll/Zimbalist (1997b), S. 83f.; Irani (1997), S. 241.<br />
123<br />
Vgl. dazu z.B. die Untersuchungen Noll (1974); Cairns/Jennett/Sloane (1986); Domazlicky/Kerr (1990); Irani<br />
(1997); Lehmann/Weigand, (1997). Siehe auch Rahmann et al. (1998), S. 116ff. und die dort zitierten Studien.<br />
47
In den USA sind die Profiteams im privaten Besitz. Der überwiegende Teil der<br />
Subventionen wird unter den gewinnmaximierenden Eigentümern und den<br />
Mannschaften (Spieler, Trainer, etc.) aufgeteilt. 124 In Deutschland, wo die meisten<br />
Bundesligisten noch die Rechtsform des eingetragenen Vereins inne haben,<br />
profitieren in Folge eines fehlenden Gewinnaneignungsrechtes der Vereine<br />
hauptsächlich die Mannschaftsmitglieder. 125 Neue moderne Stadien führen ange-<br />
sichts steigender Subventionen und direkten Mehreinnahmen unmittelbar zu höheren<br />
Spielergehältern, in den USA auch zu höheren Gewinnen der Eigentümer. 126<br />
Unmittelbare Nutznießer <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen sind demnach Mitglieder<br />
höherer Einkommensgruppen und nicht die weniger vermögenden Bevölkerungsteile,<br />
die für einen Großteil der Kosten aufkommen.<br />
Überschätzung der indirekten Stadioneinnahmen<br />
Hohe Stadionsubventionen sind für sich allein genommen noch kein Grund,<br />
<strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen abzulehnen. Die meisten Auftragsstudien<br />
verschweigen auch nicht die Existenz von Subventionszahlungen. Die Kommune und<br />
damit auch die lokalen Steuerzahler würden aber durch indirekte Stadioneinnahmen<br />
in Form von mehr Einkommen, Beschäftigung und Steuereinnahmen für ihre Kosten<br />
kompensiert. 127 Objektive Einwände und unabhängige ex-post-Studien lassen darauf<br />
schließen, daß die von Auftragsstudien prognostizierten indirekten Nutzenrückflüsse<br />
durchschnittlich viel zu optimistisch ausfallen. Mögliche Ursachen hierfür werden im<br />
folgenden kurz skizziert.<br />
48<br />
• Überschätzung des Initialeffekts<br />
Nachfrageinduzierte Einkommens- und Beschäftigungswirkungen werden vor allem<br />
durch die zusätzlichen Zuschauerausgaben in der Kommune hervorgerufen. Das<br />
Ausmaß des primären und sekundären (Multiplikator)Effekts ist zunächst von der<br />
124<br />
Die Profispieler sind in den USA aufgrund der sogenannten salary caps und anderen Marktmachtinstrumenten<br />
der Clubbesitzer in einer schlechteren Verhandlungsposition wie in Deutschland, so daß die Mehreinnahmen aus<br />
dem Stadion bzw. Subventionen z.T. von den Eigentümern abgeschöpft werden können. Vgl. z.B. Franck<br />
(1995), S. 85f.<br />
125<br />
Zu den ökonomischen Nachteilen der Rechtsform eines eingetragenen Vereins für Fußballbundesligisten vgl.<br />
z.B. Franck/Müller (1997).<br />
126<br />
Im Anschluß an das Bosman-Urteil von 1995, womit u.a. Transferentschädigungen nach Ablauf der<br />
Spielerverträge zwischen abgebendem und neuem Verein unzulässig geworden und Spielerbegrenzungen für<br />
EU-Ausländer verboten worden sind, stiegen die Gehälter für Spitzenspieler in der Fußballbundesliga noch<br />
weiter an. Vgl. zu den sportökonomischen <strong>Auswirkungen</strong> des Bosman-Urteils z.B. Büch (1998).<br />
127<br />
Vgl. die dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.2.1.2.
Höhe der zusätzlichen kommunalen Ausgaben (initial injection of money) abhängig.<br />
Auftragsstudien berücksichtigen in ihren Prognosen zumeist die gesamten<br />
zusätzlichen Zuschauerausgaben innerhalb und außerhalb des Stadions. 128 Private<br />
Haushalte unterliegen im Rahmen ihrer Freizeit- und Unterhaltungsausgaben<br />
zeitlichen und finanziellen Beschränkungen. Verwenden ortsansässige Bewohner im<br />
Anschluß an <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen vermehrt Zeit und Geld für Stadionbe-<br />
suche, werden sie tendenziell weniger Zeit und Geld für andere lokale Freizeit- und<br />
Unterhaltungsbereiche ausgeben. 129<br />
Zusätzliche Ausgaben ortsansässiger Stadionbesucher dürfen nur dann dem<br />
Initialeffekt zugerechnet werden, wenn die Zusatzausgaben ansonsten außerhalb der<br />
Stadt ausgegeben (Importsubstitution) oder gespart worden wären. 130 Da Importsub-<br />
stitution und Entsparen im Anschluß an Stadioninvestitionen verhältnismäßig gering<br />
ausfallen, sollten sie nach Ansicht vieler Ökonomen überhaupt nicht berücksichtigt<br />
werden. 131<br />
Die Zuschauerausgaben auswärtiger Besucher dürfen ebenfalls nicht vollständig<br />
dem Initialeffekt zugeordnet werden. Ausgaben auswärtiger Zuschauer, die auch<br />
ohne das Stadionevent angefallen wären, sind nicht zu berücksichtigen. Sind<br />
Zuschauer primär aus einem anderen Grund in der Stadt („casuals“), so daß sie die<br />
Sportveranstaltung quasi als Zusatzprogramm besuchen, dürfen nur die dadurch<br />
induzierten Extraausgaben (z.B. Eintritt, Fahrtkosten zum Stadion, Verlängerungs-<br />
nacht im Hotel, etc.) dem Initialeffekt zugerechnet werden. Gleiches gilt für den Fall,<br />
daß die Zuschauer den Stadtbesuch nur zeitlich verschieben („time-switchers“), um<br />
neben ihrem originären Anliegen auch ein Ligaspiel zu besuchen. 132<br />
Empirische Untersuchungen belegen, daß viele auswärtige Zuschauer von Sport-<br />
großveranstaltungen entweder den „casuals“ oder den „time-switchers“ zuzurechnen<br />
128<br />
Vgl. z.B. Baade/Dye (1988), S. 43; Noll/Zimbalist (1997a), S. 14f.; Rahmann et al. (1998), S. 129ff.<br />
129<br />
Vgl. z.B. Baade/Sanderson (1997), S. 97.<br />
130<br />
Vgl. z.B. Baade/Dye (1990), S. 5f.<br />
131<br />
Vgl. z.B. Rahmann et al. (1998), S. 129ff.; Késenne (1997), S. 10; Burnes/Mules (1986); Crompton (1995), S.<br />
26.<br />
132<br />
Zur Abgrenzung stadioninduzierter Ausgaben auswärtiger Zuschauer vgl. z.B. Noll/Zimbalist (1997b), S. 69f.<br />
Siehe auch Crompton (1995), S. 27ff., der die Begrifflichkeiten „casuals“ und „time-switchers“ zur Abgrenzung<br />
einführt.<br />
49
sind. 133 Neue Entwicklungen im Stadienbereich wie die Zunahme von Dauerkarten<br />
oder die zunehmende Vermarktung von Business-Seats und Logen an<br />
Unternehmen, welche diese im Anschluß an Zusammenkünfte, Konferenzen, etc. oft<br />
auswärtigen Kunden und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, erhöhen den Anteil der<br />
Zuschauer, die nicht primär wegen der Sportveranstaltung das Stadion besuchen. 134<br />
Viele Auftragsstudien setzen den Initialeffekt mit den gesamten zusätzlichen<br />
(Brutto)Ausgaben gleich. Sie berücksichtigen keine lokalen Verdrängungseffekte und<br />
grenzen nicht zwischen stadioninduzierten und ohnehin anfallenden auswärtigen<br />
Zuschauerausgaben ab. 135 Der tatsächliche Initialeffekt liegt damit deutlich unter dem<br />
prognostizierten Effekt. Da sich dieser Fehler im Rahmen der Multiplikatoranalyse<br />
vervielfacht, werden Einkommens- und Beschäftigungsauswirkungen viel zu hoch<br />
ausgewiesen.<br />
50<br />
• Überschätzung des Multiplikatoreffekts<br />
Die nachfrageseitigen <strong>Auswirkungen</strong> fallen nicht nur aufgrund des zu optimistischen<br />
Initialeffektes zu hoch aus. Kritiker bemängeln weitere Fehler, die im Rahmen der<br />
Multiplikatoranalyse in Auftragsstudien häufig gemacht werden und die Ergebnisse<br />
weiter verzerren.<br />
Das Ausmaß der Multiplikatorwirkung hängt neben der Höhe der zusätzlichen<br />
(Netto-)Ausgaben von der Wiederausgabe in der Kommune ab. Empirische<br />
Untersuchungen zeigen, daß der Wirtschaftsbereich vieler Kommunen zu klein ist,<br />
um den Großteil der ökonomischen Nutzenrückflüsse aus dem Multiplikatoreffekt für<br />
sich zu beanspruchen. 136 Je autarker bzw. je stärker die intersektoralen<br />
Verflechtungen einer Kommune, desto höher in der Regel die Multiplikatorwirkung.<br />
Viele Auftragsstudien verwenden vorliegende regionale Standard-Multiplikatoren. 137<br />
Regionale Multiplikatorwirkungen sind in bezug auf den gleichen Initialeffekt in der<br />
Regel größer als die von einzelnen Kommunen in der selben Region, so daß die<br />
133 Vgl. z.B. Lee/Williams (1986), die im Rahmen einer Untersuchung zum Ausgabeverhalten von Zuschauern<br />
beim australischen Formel 1 Grand Prix in Adelaide zu dem Ergebnis kommen, daß 43 Prozent der auswärtigen<br />
Zuschauer den „casuals“ und 27 Prozent den „time-switchers“ zugerechnet werden müssen.<br />
134 Vgl. Noll/Zimbalist (1997b).<br />
135 Beispiele für die fehlende Abgrenzung zwischen sportbedingten und anderen Ausgaben auswärtiger<br />
Zuschauer finden sich auch in deutschen economic impact studies. Vgl. z.B. Hamm (1996) und Schröder (1987).<br />
136 Vgl. z.B. Rosentraub/Nunn (1978); Baim (1994).<br />
137 Vgl. z.B. Késenne (1997), S. 8ff.; Crompton (1995), S. 24ff.
Einkommens- und Beschäftigungswirkungen für die Kommune falsch errechnet<br />
werden. Die Ergebnisse gelten trotz der regionalen Multiplikatoren auch nicht für die<br />
Region, da der Anteil auswärtiger Zuschauerausgaben, die den kommunalen<br />
Prognosen zugrunde liegen, auf Regionalebene kleiner sind. Ein Teil der<br />
auswärtigen Zuschauer aus Sicht der Kommune kommen aus der Region und sind<br />
somit aus regionaler Sicht nicht mehr auswärtig. Es besteht ein Trade-Off zwischen<br />
der Höhe des Initial- und Multiplikatoreffekts.<br />
Die Verwendung von Standard-Multiplikatoren anderer Wirtschaftsbereiche,<br />
Regionen, Kommunen, etc. ist auch aus anderen Gründen problematisch. 138<br />
Intersektorale Verflechtungen sind in bezug auf verschiedene Regionen und Wirt-<br />
schaftszweige oft sehr unterschiedlich. Die genaue Kalkulation der Multiplikatorhöhe<br />
erfordert eine detaillierte Untersuchung über die Ausgaben der lokalen Bevölkerung,<br />
Wirtschaftsunternehmen, Kommunalverwaltung, etc. Im Hinblick auf das begrenzte<br />
Budget vieler Auftragsstudien, verzichten die Autoren i.d.R. auf die eigenständige<br />
Ermittlung von kommunalen Multiplikatoren und verwenden statt dessen relativ hohe,<br />
standardisierte Multiplikatoren anderer Wirtschaftsbereiche und Regionen. Viele<br />
Auftragsstudien verwenden Einkommensmultiplikatoren in Höhe von 1,2 bis 3,2. 139<br />
Unabhängige ausführliche Untersuchungen zeigen, daß der Einkommensmultiplika-<br />
tor im Sportbereich (bezogen auf das Einkommen privater Haushalte) äußerst selten<br />
größer als 0,8 ist und tendenziell deutlich kleiner als Multiplikatoren anderer<br />
Wirtschaftsbereiche ausfällt. 140<br />
Erklären lassen sich die relativ kleinen Einkommensmultiplikatoren im Sportbereich<br />
mit dem Ausgabeverhalten der bezahlten Mannschaftsmitglieder. 141 Ein Großteil der<br />
stadioninduzierten Mehrausgaben kommt den bezahlten Mannschaftsmitgliedern<br />
zugute. 142 Diese verwenden nur einen verhältnismäßig geringen Teil der Einnahmen<br />
auf den Kauf lokaler Güter und Dienstleistungen. Bezahlte Mannschaftsmitglieder<br />
138<br />
Vgl. Késenne (1997), S. 8ff.<br />
139<br />
Vgl. dazu Baade/Dye (1988) und die dort zitierten Auftragsstudien. Schröder (1987) errechnet die<br />
Einkommens- und Beschäftigungswirkungen der Modernisierung des Bremer Weserstadions mit Hilfe eines<br />
Einkommensmultiplikators in Höhe von 1,5. Colclough/Daellenbach/Sherony (1994) berichten von<br />
Auftragsstudien für die Minor League, die Multiplikatoren in Höhe von bis zu 6 verwenden.<br />
140<br />
Vgl. z.B. Flemming/Toepper (1990); Crompton (1995), S. 30ff.; Hughes (1982).<br />
141<br />
Vgl. dazu Noll/Zimbalist (1997b), S. 71ff.<br />
142<br />
In den USA teilen sich Besitzer und Mannschaft die Mehreinnahmen. Die folgende Argumentation für die<br />
Mannschaftsmitglieder trifft im wesentlichen auch auf den Teambesitzer zu.<br />
51
gehören überwiegend höheren Einkommensklassen an und unterliegen hohen<br />
Steuersätzen. Das verfügbare Einkommen ist im Vergleich zum Bruttoeinkommen<br />
relativ gering. Gleichzeitig ist die Sparquote besser verdienender Privathaushalte<br />
höher. Dieser Effekt wird im Sportbereich durch die relativ kurze Karriere eines<br />
Sportlers verstärkt. Profisportler müssen während ihrer relativ kurzen Karriere<br />
vermehrt sparen, um sich für die Zukunft abzusichern. Schließlich treffen Spieler und<br />
Trainer ihre Wohnsitzentscheidung nicht immer in Anlehnung an die Entfernung zum<br />
Arbeitsplatz. Spieler und Trainer wechseln in ihrer Karriere häufig den Arbeitsplatz.<br />
Die Wahl des ersten Wohnsitzes wird oft unter steuerlichen Gesichtspunkten oder<br />
unter Berücksichtigung der regionalen Attraktivität getroffen. 143 Ein erheblicher Teil<br />
der Spielereinkommen wird gespart oder fließt in Form von überregionalen Steuern<br />
bzw. Käufen auswärtiger Güter und Dienstleistungen aus der Kommune ab.<br />
In der Literatur werden noch zahlreiche weitere Ursachen genannt und Belege<br />
angeführt, die auf die Verwendung zu hoher Einkommensmultiplikatoren in Auftrags-<br />
studien hinweisen. 144 Zusammen mit der zu hohen Berechnungsgrundlage in Form<br />
des Inititialeffekts führt die Wahl zu hoher Multiplikatoren zu deutlich überschätzten<br />
Einkommenswirkungen.<br />
Beschäftigungsmultiplikatoren messen den direkten, indirekten und induzierten Effekt<br />
von Zuschauerausgaben auf die lokale Beschäftigung. Viele Auftragsstudien<br />
errechnen die Beschäftigungseffekte dadurch, daß sie den zusätzlichen<br />
Einkommenszuwachs durch den durchschnittlichen Bruttolohn in der Bevölkerung<br />
teilen. Da die Berechnungsgrundlage in Form der Einkommenswirkungen wie<br />
beschrieben vielfach überschätzt wird, sind die ermittelten Beschäftigungs-<br />
multiplikatoren oft viel zu hoch.<br />
Viele weitere Einwände sprechen gegen bedeutende Beschäftigungswirkungen<br />
durch <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen. 145 Die Berechnung der Beschäftigungswirkun-<br />
143<br />
Die Wahl von Steuerparadiesen als ersten Wohnsitz kann nicht nur im Tennis oder der Formel 1 beobachtet<br />
werden. Auch deutsche Fußballspieler in grenznahen Bundesligastandorten wohnen oft im steuerlich günstigeren<br />
Ausland. Viele EU-Ausländer, die in der deutschen Bundesliga spielen, behalten ihren ersten Wohnsitz im für<br />
sie günstigeren Heimatland.<br />
144<br />
Vgl. zu weiteren Ursachen z.B. Crompton (1995).<br />
145<br />
Vgl. zu den Einwänden gegen bedeutende Beschäftigungswirkungen durch <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen<br />
z.B. Baade/Sanderson (1997); Crompton (1995), S. 22f.; Rahmann et al. (1998), S. 60f.; Burgan/Mules (1992).<br />
52
gen mit Hilfe durchschnittlicher Bruttolöhne ist problematisch, da ein Großteil der<br />
zusätzlichen Zuschauerausgaben an die Profispieler geht. Die Bruttoentlohnung<br />
deutscher Bundesligaspieler ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und<br />
liegt deutlich über dem Durchschnittseinkommen normal verdienender Haushalte.<br />
Beschäftigungswirkungen ergeben sich kaum. Aus den zusätzlichen Zuschaueraus-<br />
gaben, die direkt bzw. indirekt zu mehr Einkommen in der Bevölkerung führen,<br />
lassen sich auch keine bedeutenden Beschäftigungseffekte ableiten. Die geringe<br />
Anzahl von Heimspielen und sonstigen Stadionevents führt dazu, daß profitierende<br />
Privatunternehmen im Handel, der Gastronomie, etc. die steigende Nachfrage<br />
während der Veranstaltungen mit Teilzeit- oder saisonalen Arbeitsplätzen befriedi-<br />
gen. Vollzeitarbeitsplätze, wie sie in den Auftragsstudien vielfach prognostiziert<br />
werden, entstehen nur wenige.<br />
Unabhängige Untersuchungen zeigen, daß die prognostizierten Beschäftigungswir-<br />
kungen im Verhältnis zu den <strong>öffentlich</strong>en Investitionskosten relativ gering ausfal-<br />
len. 146 Ähnliche Subventionen für andere privatwirtschaftliche Bereiche führen im<br />
Vergleich zu Stadioninvestitionen zu deutlich mehr Arbeitsplätzen. 147 Statistiken<br />
verschiedener US-Beschäftigungsprogramme zeigen, daß der Staat mit gleichen<br />
Investitionskosten oftmals mehr Beschäftigungseffekte erzielt, als sehr optimistische<br />
Auftragsstudien in Folge <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen errechnen. 148<br />
Die nachfrageseitigen Impulse, die durch <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen ausgelöst<br />
werden, führen aus unabhängiger Sicht nicht zu den von Auftragsstudien prognosti-<br />
zierten Einkommens- und Beschäftigungswirkungen. 149 Viele Ex-post-Analysen<br />
zeigen, daß selbst in Bereichen, die von den zusätzlichen Zuschauerausgaben<br />
unmittelbar profitieren (z.B. Handel und Gastronomie), in den meisten Fällen keine<br />
146 Vgl. Baade/Sanderson (1997), S. 101; Noll/Zimbalist (1997c), S. 497f.<br />
147 Die direkte Subventionierung von Privatunternehmen ist zwar unter Beschäftigungsgesichtspunkten<br />
effektiver, führt aber in der Bevölkerung oft zu Widerständen. Baade/Sanderson (1997), S. 101ff. zeigen z.B.,<br />
daß 1993 die sehr umstrittenen Subventionen des US-Bundesstaates Alabama für die erste Mercedes-Benz<br />
Fabrik in den USA in Höhe von ungefähr 300 Mio. US-$ ca. 1500 Vollzeitarbeitsplätze hervorbrachten. Dies<br />
sind umgerechnet 200.000 US-$ pro Arbeitsplatz, was im Vergleich zu anderen <strong>öffentlich</strong>en<br />
Subventionszahlungen ein eher schlechtes Ergebnis darstellt. In Relation zu den Beschäftigungswirkungen von<br />
<strong>öffentlich</strong>en Stadioninvestitionen schneiden die Mercedes-Subventionen hingegen deutlich besser ab. 1990<br />
investierte z.B. der Bundesstaat Arizona 240 Mio. US-$ in ein Superdom-Stadion, wodurch 340 neue<br />
Vollzeitarbeitsplätze erreicht werden sollten. Dies entspricht <strong>öffentlich</strong>en Kosten in Höhe von 705.800 US-$ je<br />
Arbeitsplatz.<br />
148 Vgl. z.B. Deloite & Touche (1993).<br />
53
signifikanten Einkommens- und Beschäftigungswirkungen im Anschluß an <strong>öffentlich</strong>e<br />
Stadioninvestitionen zu verzeichnen sind. 150 Die durch <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitio-<br />
nen resultierenden nachfrageseitigen Nutzen werden in Auftragsstudien deutlich<br />
überschätzt. Größere Nutzenrückflüsse verzeichnen in erster Linie nur die Profiteams<br />
und damit die Spieler, Trainer und Besitzer. Gleichzeitig unterschätzen Auftragsstu-<br />
dien die tatsächlichen Kosten <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen, für die zum größten<br />
Teil der lokale Steuerzahler aufkommen muß, ohne dafür durch nachfrageseitige<br />
Nutzenrückflüsse (wie mehr Einkommen und Beschäftigung) kompensiert zu werden.<br />
Alternative <strong>öffentlich</strong>e Investitionen versprechen höhere nachfrageseitige<br />
Einkommens- und Beschäftigungswirkungen.<br />
54<br />
• Überschätzung positiver externer Effekte.<br />
Bislang wurden in erster Linie die quantifizierbaren (tangiblen) Kosten und Nutzen<br />
betrachtet. Viele Stadioninteressenten sehen als Folge <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitio-<br />
nen in Verbindung mit attraktiven Profiteamsport hohe (intangible) positive externe<br />
Effekte. Neben den private und public consumer benefits werden oft der steigende<br />
Freizeit- und Unterhaltungswert, höherer Lokalstolz sowie die Stärkung gesellschaft-<br />
lich gewünschter Werte und Normen angeführt. 151 Ist der Nettonutzen dieser<br />
postiven Effekte größer als die oben dargelegten tendenziellen Nettoverluste im<br />
tangiblen Bereich, können <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen in der bisherigen Form<br />
durchaus legitim sein.<br />
Dem ist entgegenzuhalten, daß Stadioninteressenten das Ausmaß der positiven<br />
externen Effekte oft überschätzen und die Existenz negativer Externalitäten<br />
verschweigen. Neue moderne Profisportstadien bieten aufgrund von Logen,<br />
Business-Seats, überdachten Sitzplätzen, etc. den Vereinen bessere Möglichkeiten<br />
der Preisdiskriminierung. Die prognostizierten Konsumentenrenten werden dadurch<br />
geschmälert. Die Stärkung von Jugendlichen in ihrer charakterlichen Entwicklung,<br />
ausgedrückt durch weniger Kriminalität, läßt sich empirisch nicht nachweisen.<br />
Unabhängige Studien kommen zu dem Ergebnis, daß in kleineren Kommunen die<br />
149 Da die Höhe der erzielbaren Steuereinnahmen stark vom Ausmaß der Einkommens- und<br />
Beschäftigungswirkungen abhängen, sind auch hier keine bedeutenden Effekte zu erwarten.<br />
150 Vgl. z.B. die Studien von Baade (1987) und Baade/Dye (1990).<br />
151 Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.2.
Existenz von Profiteamsport zu einer signifikanten Erhöhung der Kriminalitätsrate<br />
führt. 152<br />
Neue <strong>Stadionprojekte</strong> führen in Verbindung mit Profiteamsport zu zahlreichen<br />
anderen Nachteilen für einzelne Bewohner der Kommunen. Vielerorts haben sich<br />
Bürgerinitiativen gegen <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> gebildet. 153 Erhöhter Lärm,<br />
Vandalismus, gewalttätige Ausschreitungen rivalisierender Fan-Gruppen, Verkehrs-<br />
staus, etc. müssen in der Entscheidung über die Verwendung der <strong>öffentlich</strong>en Mittel<br />
mit einbezogen werden.<br />
Da sich die intangiblen Effekte nicht oder nur sehr ungenau quantifizieren lassen,<br />
kann keine eindeutige Aussage über die Höhe eines positiven oder negativen Netto-<br />
nutzens der externen Effekte getroffen werden. Ein Urteil über die gesamten<br />
gesellschaftlichen <strong>Auswirkungen</strong> <strong>öffentlich</strong>er <strong>Stadionprojekte</strong> bleibt zu einem<br />
bestimmten Grad eine subjektive (politische) Einschätzung. Quantifizierbare<br />
ökonomische Kosten und Nutzen werden aber für politische Entscheidungen immer<br />
wichtiger. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit, des eher verhaltenen<br />
Wirtschaftswachstums und der knapper werdenden <strong>öffentlich</strong>en Mittel, werden die<br />
Einkommens- und Beschäftigungswirkungen <strong>öffentlich</strong>er Investitionen für die<br />
Entscheidungsfindung in Deutschland immer bedeutender. Unter nachfrageseitigen<br />
Aspekten ist die bisherige Praxis überwiegend <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen<br />
abzulehnen. Eine endgültige Entscheidung über die Vorteilhaftigkeit <strong>öffentlich</strong>er<br />
<strong>Stadionprojekte</strong> kann aber erst nach der Analyse von angebotsseitigen<br />
Wirtschaftsimpulsen getroffen werden.<br />
3.2.3. Beurteilung angebotsseitiger Effekte<br />
Stadioninteressenten stellen vielfach die Behauptung auf, <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvesti-<br />
tionen führen in Verbindung mit Profiteamsport zu positiven angebotsseitigen<br />
Einkommens- und Beschäftigungswirkungen. Über die Werbewirkung des Vereins für<br />
die Stadt, einem höheren Freizeit- und Unterhaltungswert sowie einer verbesserten<br />
152 Baim (1994) zeigt im Rahmen einer empirischen Untersuchung, daß die Kriminalitätsrate in kleineren Städten<br />
mit Profiteamsport gegenüber vergleichbaren Städten ohne Liga-Sport oft signifikant höher ist.<br />
153 Vgl. z.B. Wessel (1998); Winkler-Schlang (1998).<br />
55
Dienstleistungsinfrastruktur würden sich vermehrt Unternehmen, die nicht direkt mit<br />
dem Sportbereich in Verbindung stehen, in der Kommune ansiedeln. 154<br />
Ein Teil der prognostizierten Unternehmensansiedlungen geht auf die Verbesserung<br />
weicher Standortfaktoren zurück. Die Bedeutung weicher Standortfaktoren für unter-<br />
nehmerische Standortentscheidungen nimmt im Zuge des Tertiärisierungsprozesses<br />
insbesondere für Unternehmen mit höherqualifizierten Mitarbeitern zu. 155<br />
Traditionelle Standortfaktoren wie die Ausstattung mit klassischen Produktions-<br />
faktoren bleiben aber weiterhin für die Standortentscheidungen von Unternehmen<br />
dominierend. Weiche Standortfaktoren sind erst dann für die Ortswahl entscheidend,<br />
wenn mehrere Ortsalternativen mit ähnlicher Ausstattung an harten Standortfaktoren<br />
aus Sicht der Unternehmung bestehen. 156 Für Unternehmen mit überwiegend<br />
höherqualifizierten Mitarbeitern können weiche Standortfaktoren bereits dann die<br />
Entscheidung beeinflussen, wenn die harten Faktoren als zufriedenstellend erachtet<br />
werden. Insgesamt sind weiche Standortfaktoren nur in Ausnahmefällen das<br />
ausschlaggebende Motiv für Unternehmensansiedlungen.<br />
Der Verbesserung des Unterhaltungs- und Freizeitwertes sowie des Stadtimages<br />
stehen Verschlechterungen anderer Standortfaktoren gegenüber. Einsparungen in<br />
anderen <strong>öffentlich</strong>en Bereichen können zu Defiziten im Bildungsbereich, in der<br />
<strong>öffentlich</strong>en Sicherheit, etc. führen. 157 Hinzu kommen Steuererhöhungen zur<br />
Finanzierung <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen, die sowohl neue Unternehmen als<br />
auch deren Mitarbeiter betreffen könnten. Neue Unternehmensansiedlungen<br />
aufgrund angebotsseitiger Impulse werden somit zumindest fraglich.<br />
Unabhängige Ex-post-Untersuchungen über die Einkommens- und<br />
Beschäftigungswirkungen im Anschluß an <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen kommen<br />
zu Ergebnissen, die den Argumenten der Stadionbefürworter entgegenstehen. 158<br />
154<br />
Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.2.2.<br />
155<br />
Vgl. Hamm (1996), S. 25ff.; Grabow (1994).<br />
156<br />
Vgl. zur Wirksamkeit weicher Standortfaktoren Grabow (1994), S. 156.<br />
157<br />
Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.2.2.<br />
158<br />
Vgl. z.B. Lipsitz (1984); Baade (1987); Baade/Dye (1988); Baade/Dye (1990). Bei diesen ex-post-<br />
Betrachtungen handelt es sich zumeist um Regressionsanalysen, die hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit nicht<br />
immer unumstritten sind. Zur methodischen Kritik an den durchgeführten Untersuchungen vgl. u.a. Baim (1994),<br />
der zudem in eigenen Untersuchungen zu weniger kritischen Einkommens- und Beschäftigungswirkungen<br />
kommt. Insgesamt legen die Untersuchungen aber den Schluß nahe, daß die von den Befürwortern<br />
56
Signifikante Anstiege von Einkommen und Beschäftigung sind in sportunverwandten<br />
Bereichen äußerst selten zu beobachten. In mehreren Fällen weisen Kommunen mit<br />
Profiteamsport, die <strong>öffentlich</strong>e Stadioninvestitionen getätigt haben, eine signifikant<br />
schlechtere Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung gegenüber vergleichbaren<br />
Kommunen ohne <strong>Stadionprojekte</strong> und Liga-Sport auf. Als mögliche Erklärung führen<br />
die Autoren unabhängiger Ex-post-Analysen an, daß durch eine Konzentration<br />
<strong>öffentlich</strong>er Investitionen auf dem Sportsektor neue, durchschnittlich schlechter<br />
bezahlte Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor zu lasten höherqualifizierter, gut<br />
bezahlter Arbeitsplätze in der Industrie und anderen sportunverwandten Bereichen<br />
entstehen können. Angebotsseitige Impulse, wie sie von Stadioninteressenten<br />
angeführt werden, können ex post nicht nachgewiesen werden. In einigen Fällen sind<br />
sogar negative strukturelle Entwicklungen für die Kommunen wahrscheinlich. 159<br />
4. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Die wirtschaftliche Bedeutung des Profifußballs ist in den letzten Jahrzehnten<br />
deutlich gestiegen. Der Gesamtjahresumsatz aller deutschen Erstligisten erreicht<br />
Ende der 90er Jahre ca. eine Milliarde DM. Der Anteil traditioneller Zuschauererlöse<br />
am Gesamtjahresumsatz in Höhe von ca. 30 Prozent zeigt, daß die Zuschauer-<br />
einnahmen nach wie vor bedeutend für die Finanzierung der Vereinsausgaben sind.<br />
Viele deutsche Bundesligastadien weisen im Vergleich zu anderen europäischen<br />
Stadien qualitative und quantitative Mängel auf, die das weitere Wachstum der<br />
Eintrittskartenerlöse behindern. Das Potential weiterer Zuschauereinnahmen<br />
(Cateringerlöse, Logen- und Business- Seats-Vermarktung, etc.) wird wegen zu<br />
kleinen und unmodernen Stadien ebenfalls nur unvollständig ausgenutzt. Um<br />
national und international wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Fußballvereine auf<br />
große, moderne Sportstätten angewiesen. Die Kosten für erforderliche Neubauten<br />
und Sanierungsmaßnahmen belaufen sich für alle deutschen Erstligastadien auf<br />
mehrere Milliarden DM.<br />
prognostizierten Einkommens- und Beschäftigungswirkungen tatsächlich deutlich kleiner ausfallen, was auch<br />
durch die Untersuchungen von Baim nicht widerlegt werden kann. Negative <strong>Auswirkungen</strong> auf Einkommen und<br />
Beschäftigung im Vergleich zu anderen Kommunen ohne <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> sind zudem nicht<br />
unwahrscheinlich.<br />
159<br />
Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die ermittelten Werbewerte der Profisportteams für die Kommune nur<br />
den Kosteneinsparungen für TV- bzw. Hörfunkspots entsprechen. Der tatsächliche Wert ergibt sich aber streng<br />
genommen aus der Werbewirkung, also gerade den Einkommens- und Beschäftigungswirkungen in der<br />
Kommune.<br />
57
Sportstadionbau wird in Deutschland historisch als eine <strong>öffentlich</strong>e Aufgabe gesehen.<br />
Im Gegensatz zu früher hat sich die Situation im Stadionbereich grundlegend<br />
geändert. Konstruktions- und Betriebskosten sind in den letzten Jahrzehnten um ein<br />
Vielfaches gestiegen. Die kommunale Haushaltssituation vieler Kommunen ist sehr<br />
angespannt. Öffentliche Mittel sind knapper geworden. Fußballbundesligisten<br />
gleichen in den 90er Jahren mittelständischen Wirtschaftsunternehmen, deren<br />
Einnahmesituation sich kontinuierlich verbessert hat. Der Anteil der Kommunen an<br />
den Einnahmen hat in den letzten Jahren abgenommen, während sich die<br />
kommunalen Belastungen durch Stadionbau, -modernisierung und -betrieb deutlich<br />
erhöht haben. Die bisherige Praxis der überwiegend <strong>öffentlich</strong>en Finanzierung von<br />
<strong>Stadionprojekte</strong>n wird zunehmend in Frage gestellt.<br />
Zur weiteren Durchsetzung <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen führen<br />
Stadioninteressenten Argumente aus Auftragsstudien an, die auf einen hohen<br />
Nettonutzen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen schließen lassen. Den <strong>öffentlich</strong>en<br />
Kosten stehen nach Ansicht der Stadionbefürworter direkte und indirekte<br />
Nutzenrückflüsse gegenüber, die den Wohlstand der Gesamtbevölkerung erhöhen.<br />
Theoretische Überlegungen und unabhängige empirischen Untersuchungen zeigen,<br />
daß die bisherige Praxis der überwiegend <strong>öffentlich</strong>en Stadionfinanzierung in den<br />
meisten Fällen ineffizient ist.<br />
Direkte Zuschüsse von Bund und Ländern führen zu unerwünschten<br />
Verteilungswirkungen. Ökonomische Wirkungen <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen<br />
haben zum größten Teil regionalen Charakter. Für überregionale Beiträge kommen<br />
vorwiegend nationale Steuerzahler auf, die keine entsprechenden Nutzenrückflüsse<br />
erhalten. Indirekte Beiträge in Form von Steuerbefreiungsmaßnahmen bevorteilen<br />
höhere Einkommensbezieher und führen gegenüber direkten Beiträgen zu<br />
<strong>öffentlich</strong>en Ressourcenverschwendungen. Sondereinnahmen aus Lotterien und<br />
Einsparungen in anderen <strong>öffentlich</strong>en Haushalten benachteiligen niedrige<br />
Einkommensbezieher. Überregionale Zuschüsse weisen insgesamt allokative und<br />
distributive Nachteile auf.<br />
Der Großteil <strong>öffentlich</strong>er Stadionkosten wird durch die Kommunen aufgebracht.<br />
Auftragsstudien unterschätzen die Kosten <strong>öffentlich</strong>er <strong>Stadionprojekte</strong>. Unabhängige<br />
58
Ex-post-Analysen zeigen, daß die tatsächlichen Investitionskosten oft ein Vielfaches<br />
der veranschlagten Kosten betragen. Hinzu kommen Opportunitätskosten, die durch<br />
den Verzicht oder die zeitliche Verschiebung anderer <strong>öffentlich</strong>er Projekte entstehen.<br />
Der überwiegende Teil der kommunalen Kosten wird von den lokalen Steuerzahlern<br />
bezahlt. Einsparungen in anderen <strong>öffentlich</strong>en Bereichen und höhere indirekte<br />
Steuern benachteiligen auch niedrige Einkommensbezieher überproportional. Die<br />
direkten kommunalen Einnahmen aus dem Stadionbetrieb reichen im Durchschnitt<br />
gerade aus, die operativen Kosten zu decken. Die starke Verhandlungsmacht der<br />
Vereine sowie ökonomische und politische Überlegungen der Kommunalpolitiker<br />
führen dazu, daß Profivereine keine kostendeckenden Preise für die Benutzung der<br />
Stadien zahlen. Den Vereinen fließen Subventionen ungefähr in Höhe der<br />
Konstruktionskosten zu, die von den Steuerzahlern getragen werden.<br />
Auftragsstudien gehen davon aus, daß die lokalen Steuerzahler durch nachfrage-<br />
und angebotsseitige Einkommens- und Beschäftigungswirkungen kompensiert<br />
werden. Die aus <strong>öffentlich</strong>en Stadioninvestitionen resultierenden Nutzenrückflüsse<br />
werden von Auftragsstudien deutlich überschätzt. Ein zu großer Initialeffekt und die<br />
Verwendung zu hoher Multiplikatoren führen zu falsch prognostizieren Einkommens-<br />
und Beschäftigungswirkungen. Unabhängige Ex-post-Untersuchungen zeigen, daß<br />
Stadioninvestitionen in Verbindung mit Profiteamsport in der Mehrzahl der Fälle<br />
keinen signifikanten Anstieg von Einkommen und Beschäftigung verursachen.<br />
Unabhängige Studien zeigen, daß <strong>öffentlich</strong>e Investitionen in Alternativprojekte bei<br />
gleicher Investitionssumme deutlich vorteilhaftere Einkommens- und Beschäftigungs-<br />
effekte erzielen. Einige Untersuchungsergebnisse dokumentieren, daß Kommunen,<br />
die große <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> umgesetzt haben, eine schlechtere kommunale<br />
Wirtschaftsentwicklung gegenüber vergleichbaren Kommunen ohne <strong>Stadionprojekte</strong><br />
aufweisen. Negative strukturelle <strong>Auswirkungen</strong> auf die wirtschaftliche Entwicklung<br />
von Kommunen sind infolge einer zu großen Konzentration auf den Sportbereich<br />
nicht unwahrscheinlich.<br />
Hauptgewinner der <strong>öffentlich</strong>en <strong>Stadionprojekte</strong> sind die Vereine, insbesondere<br />
Spieler und Trainer. Sie profitieren von den kommunalen Subventionen und<br />
Mehreinnahmen aus dem Stadionbetrieb durch höhere Gehälter. Da Spieler und<br />
59
Trainer den höheren Einkommensklassen zuzuordnen sind, gleichzeitig aber viele<br />
ortsansässige Geringverdiener für die Kosten <strong>öffentlich</strong>er Stadioninvestitionen<br />
aufkommen, kommt es auch auf kommunaler Ebene zu negativen<br />
Verteilungswirkungen. Unter Berücksichtigung der unzureichenden Nutzenrückflüsse<br />
im Vergleich zu Alternativprojekten, sind <strong>öffentlich</strong>e <strong>Stadionprojekte</strong> auch unter<br />
allokativen Gesichtspunkten für die meisten Kommunen ineffizient.<br />
Dies bedeutet nicht, daß Stadioninvestitonen generell keine lohnenswerten<br />
Investitionen darstellen. Spieler, Trainer, Medien und einzelne Wirtschaftsunter-<br />
nehmen (z.B. Bau- und Ausstatterfirmen der Stadien) profitieren in hohem Maße von<br />
den Investitionen und erzielten Stadionmehreinnahmen. Ein Großteil der<br />
Nutzenrückflüsse fließen aber aus der Kommune ab und die meisten kommunalen<br />
Steuerzahler werden nur unzureichend für ihre Kosten entschädigt. Außerdem<br />
zeigen Untersuchungen, daß vergleichbare private <strong>Stadionprojekte</strong> kostengünstiger<br />
durchgeführt werden können.<br />
Da Stadioninvestitionen zur Bewahrung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher<br />
Bundesligavereine notwendig sind, müssen andere Wege der Stadionfinanzierung<br />
gefunden werden. Dabei soll auf eine zukünftige Beteiligung der <strong>öffentlich</strong>en Hand an<br />
den <strong>Stadionprojekte</strong>n nicht verzichtet werden, da ein positiver Nutzenrückfluß für die<br />
Kommune und die Region unbestreitbar ist. Aufgrund der ungleichgewichtigen<br />
Kosten- und Nutzenverteilung auf <strong>öffentlich</strong>er und privater Seite ist es aber<br />
notwendig, den privaten Anteil an den Stadioninvestitionen zu erhöhen. Eine<br />
Möglichkeit liegt darin, die Sponsoringmaßnahmen im Stadionbereich zu optimieren.<br />
Ein vielversprechender Weg stellt die Namensvergabe am Stadion oder an<br />
Stadionlogen dar.<br />
Andere aktuelle Beispiele im Profifußball zeigen, daß private Investoren unter<br />
geänderten Eigentumsverhältnissen bereit sind, hohe Beträge in <strong>Stadionprojekte</strong> zu<br />
investieren. Private Investitionen in Fußballstadien haben spezifischen Charakter.<br />
Der Werbewert für die Investoren ergibt sich vor allem durch stattfindenden<br />
Ligabetrieb. Da der Ligabetrieb die oft einzige lohnenswerte Stadionverwendung<br />
darstellt, sind private Investoren von dem Erfolg und dem Verbleiben der<br />
Ligamannschaft im Stadion abhängig. Größere private Investitionen unterliegen<br />
60
Gefahren in Form von sportlichen Mißerfolgen (Abstieg, Konkurs) und möglichen<br />
Abwanderungen der Vereine in andere Stadien. Um sich davor zu schützen,<br />
benötigen private Investoren Garantien für den Verbleib der Vereine im Stadion.<br />
Garantien können sich durch geänderte Eigentumsrechte an Stadien und<br />
Mannschaften ergeben.<br />
Eine Möglichkeit einer solchen Garantie wird dadurch erzielt, daß die Vereine selbst<br />
als private Investoren in das Stadion investieren. Die Eigenkapitalaufbringung kann<br />
dabei durch Abtretung von Vermarktungsrechten an internationale Sportrechte-<br />
agenturen oder durch einen Börsengang erfolgen. Zur Absicherung ihrer<br />
Investitionen könnten Vereine an den Eigentumsrechten des Stadions beteiligt<br />
werden. Aktuelle Beispiele für die Beteiligung der Vereine an den Investitionen und<br />
Eigentumsrechten liefern die bereits durchgeführten bzw. geplanten <strong>Stadionprojekte</strong><br />
in Dortmund, Hamburg, Kaiserslautern sowie „auf“ Schalke. 160<br />
Eine zweite vielversprechende Möglichkeit liegt darin, daß private Unternehmen<br />
mehr Einfluß auf Bundesligavereine erhalten. Ein bereits existierendes Beispiel liefert<br />
der Chemieriese Bayer, der durch die Übernahme der GmbH-Anteile am Erstligisten<br />
Bayer Leverkusen Einfluß auf das Management und die Standortwahl des Vereins<br />
nehmen kann. Die bereits realisierte Modernisierung des privaten Stadions stellt eine<br />
vergleichsweise sichere Investition mit hohem Werbewert für Bayer dar. Einen<br />
ähnlichen Weg verfolgt der VFL Wolfsburg. Dem DFB liegt der Antrag auf eine<br />
Ausnahmegenehmigung vor. Diese beinhaltet die Auslagerung und die Umwandlung<br />
der Fußballabteilung des VFL in eine GmbH. Mehrheitseignerin soll die Volkswagen<br />
AG werden. VW ist im Gegenzug bereit, ein neues Stadion für den VFL zu bauen. 161<br />
Als dritte Möglichkeit kann die Beteiligung der Kommunen an den stadionunab-<br />
hängigen Einnahmen der Vereine darstellen. Der deutsche Städtetag fordert in<br />
diesem Zusammenhang Anteile an den TV-Erlösen der Liga. Würde der DFB als<br />
Vertreter deutscher Profifußballvereine den Kommunen einen festen und vor allem<br />
von Vereinsseite nicht mit der Kommune kontraktierbaren Anteil für konkrete<br />
Stadioninvestitionen abtreten, würden private Unternehmen (TV-Anstalten,<br />
160 Vgl. z.B. o.V. (1998f).<br />
161 Vgl. Wulzinger (1999).<br />
61
Werbekunden) einen Beitrag zur Finanzierung der Projekte leisten. Je größer dieser<br />
private Anteil an der Stadionfinanzierung ausfällt, desto geringer ist das kommunale<br />
Trade-Off-Problem zwischen den kurzfrisitigen direkten und längerfristigen indirekten<br />
Nutzenrückflüssen aus dem Stadion. Welche ökonomischen und sportlichen<br />
<strong>Auswirkungen</strong> durch die möglichen Änderungen in den Eigentumsverhältnisse an<br />
Sportstadien, Profivereinen und Ligaeinnahmen resultieren, bedarf einer<br />
weitergehenden Forschung.<br />
62
5. Literaturverzeichnis<br />
Armacost, M.H. (1997): Foreword, in: Noll, Roger G./Zimbalist, Andrew (Hrsg.):<br />
63<br />
Sports, Jobs, and Taxes: the Economic Impact of Sports Teams and<br />
Stadiums, Washington, D.C. (Brookings Institution Press), 1997, S. vii-ix.<br />
Baade, R. (1987): Is there an Economic Rationale for subsidizing Sports Stadiums?<br />
Chicago, Heartland Institute Policy Study 13, 1987.<br />
Baade, R.A./Dye, R. (1988): An Analysis of the Economic Rationale for Public<br />
Subsidization of Sports Stadiums, in: The Annals of Regional Science,<br />
22(July), 1988, S. 37-47.<br />
Baade, R.A./Dye, R. (1990): The Impact of Stadiums and Professional Sports on<br />
Metropolitan Area, in: Development Growth-and-Change, 21(2), Spring 1990,<br />
S. 1-14.<br />
Baade, R.A./Sanderson, A.R. (1997): Minor League Teams and Communities, in:<br />
Noll, R.G./Zimbalist, A. (Hrsg.): Sports, Jobs, and Taxes: the Economic Impact<br />
of Sports Teams and Stadiums, Washington, D.C. (Brookings Institution<br />
Press), 1997, S. 452-493.<br />
Baldo, A. (1991): Edifice Complex, in: Financial World, 160(24), S. 34-37.<br />
Baim, D.V. (1994): The Sports Stadium as a Municipal Investment, in: Contributions<br />
Economics and Economic History, Number 151. Westport, Conn. and London<br />
(Greenwood Press), 1994.<br />
Bovenberg, A.L./Goulder, L.H. (1996): Optimal Environmental Taxation in the<br />
Presence of Other Taxes: General Equilibrium Analysis, in: American<br />
Economic Review, 86(September), 1996, S. 985-1000.<br />
Burgan, B./Mules, T. (1992): Economic Impact of Sporting Events, in: Annals of<br />
Tourism Research, New York, 19, 1992.<br />
Büch, M.P. (1998): Das „Bosman-Urteil“ – Transferentschädigungen,<br />
Ablösesummen, Eigentumsrechte, Freizügigkeit, in: Sportwissenschaft, 28(3-<br />
4), 1998, S. 283-296.<br />
Cairns, J., Jennett, N., Sloane, P.J. (1986): The Economics of Professional Team<br />
Sports: a Survey of Theory and Evidence, in: Journal of Economic Studies, 13,<br />
S. 3-80.
Chervel, T. (1998): Teurer Glanz im Norden von Paris, in: Süddeutsche Zeitung,<br />
64<br />
29.01.1998, S. 1.<br />
Clotfelder, C.T./Cook, P.J. (1989): Selling Hope: State Lotteries in America,<br />
Cambridge and London (Harvard University Press), 1989.<br />
Colclough, W.G./ Daellenbach, L.A./ Sherony, K.R. (1994): Estimating the Economic<br />
Impact of a Minor League Baseball Stadium, in: Managerial and Decision<br />
Economics, 15(5), S. 497-502.<br />
Crompton, J.L. (1995): Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events:<br />
Eleven Sources of Misapplication, in: Journal of Sport Management,<br />
9(January), 1995, S. 14-35.<br />
Deloite & Touche (1993): Economic Impact Study of a Major League Baseball<br />
Stadium and Franchise, o.O., 1993.<br />
DG-Bank (1998): Die Bundesliga geht an die Börse – Eine Studie zum deutschen<br />
Fußballmarkt und zum Going Public von Fußballvereinen, Frankfurt/Main,<br />
1998.<br />
Domazlicky, B.R./Kerr, P.M. (1990): Baseball Attendance and the Designated Hitter,<br />
in: American Economist, 34(1), S. 62-68.<br />
Flemming, W.R./Toepper, L. (1990): Economic Impact Studies: Relating the positive<br />
and negative Impacts to Tourism Development, in: Journal of Travel<br />
Research, 29(1), S. 35-41.<br />
Frisch, J. (1998): Perspektive Zweitklassigkeit, in: Süddeutsche Zeitung, 12.02.1998,<br />
S. 38.<br />
Franck, E./Müller, J.C. (1997): Verfügungsökonomische Überlegungen zur<br />
Umwandlung der Fußball-Bundesligavereine in Kapitalgesellschaften,<br />
Freiberger Working Papers, 21/1997.<br />
Franck, E. (1995): Die ökonomischen Strukturen der Teamsportindustrie: Eine<br />
Organisationsbetrachtung, Wiesbaden (Gabler), 1995.<br />
FC Schalke 04 Stadion-Beteiligungsgesellschaft (1998): Prospekt über die Arena<br />
„Auf Schalke“, Gelsenkirchen, 1998.<br />
Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V.(1985): Situationsanalyse<br />
des Profi-Fußballs, Nürnberg, 1985.<br />
Grill, M. (1999): Umbau des Olympiastadions ist gescheitert, in: Süddeutsche<br />
Zeitung, 31.03.1999, S. 39.
Grabow, B. (1994): „Weiche“ Standortfaktoren, in: Dieckmann, J./König, E.A. (Hrsg.):<br />
65<br />
Kommunale Wirtschaftsförderung – Handbuch der Standortsicherung und<br />
-entwicklung in Stadt, Gemeinde und Kreis, Stuttgart, 1994, S. 148 ff.<br />
Hamm, R. (1996): Die wirtschaftliche Bedeutung des Vereins „VFL Borussia<br />
Mönchengladbach“ für die Stadt Mönchengladbach, in: IHK-Schriftenreihe,<br />
27/1996.<br />
Hennes, M./Salz, D./Wulf, M. (1996): Englische Verhältnisse: Keine Sportart ist so<br />
populär wie Fußball, keine läßt sich besser verkaufen. Viele<br />
Bundesligamanager sind aber überfordert, in: Wirtschaftswoche, 21(34), S.<br />
28-33.<br />
Hughes, C.G. (1982): The Employment and Economic Effects of Tourism<br />
reappraised, in: Tourism Management, 31(September), 1982, S. 167-176.<br />
Irani, D. (1997): Public Subsidies to Stadiums: do the Costs Outweigh the Benefits?<br />
In: Public Finance Review, 25(March), 1997, S. 238-253.<br />
Johnson, A.T. (1983): Municipal Administration and the Sports Franchise Relocation<br />
Issue, in: Public Administration Review, 6(November/December), 1983, S.<br />
519-529.<br />
Johnson, A.T. (1989): Local Government and Minor League Baseball: Survey of<br />
Issues and Trends, Sports Consortium Special Report 1, Washington,<br />
International City Management Association, 1989.<br />
Jones, H. (1989): The Economic Impact and Importance of Sport in Europe, Council<br />
of Europe, Strasbourg, 1989.<br />
Késenne, S. (1997): Miscalculations and Misinterpretations in Economic Impact<br />
Analysis, Paper presented at the CIES Workshop „The Economic Impact of<br />
Sport“, Neuchâtel, May 23/24, 1997.<br />
Késenne, S./Butzen, P. (1987): Subsidizing Sports Facilities: the Shadow Price-<br />
Elasticities of Sports, in: Applied Economics, 29(1), S. 101-110.<br />
Kramer, J. (1999): Ein Gefühl des Schwebens, in: Der Spiegel, Nr. 21, 1999, S. 128-<br />
130.<br />
Kicker Sportmagazin (1999): Sonderheft Finale 98/99, 1999.<br />
Kraul, C. (1993): Fields of Dreams, in: Los Angeles Times, 11 July, 1993.<br />
Kurscheidt, M./Rahmann, B. (1999): Local Investment and National Impact: The<br />
Case of the Football World Cup 2006 in Germany, in: Jeanrenaud, C. (Hrsg.):<br />
The Economic Impact of Sport Events, Neuchâtel (Editions CIES), S.79-108.
Lee, P./Williams, J. (1986): The Grand Prix and Tourism, in: Burns, J.P.A./Hatch,<br />
66<br />
J.H./Mules, T.J. (Hrsg.): The Adelaide Grand Prix: The impact of a special<br />
Event, Adelaide, Centre for South Australian Economic Studies, 1986, S. 39-<br />
57.<br />
Lehmann, E./Weigand, J. (1997): Fußball als ökonomisches Phänomen: Money<br />
makes the Ball go round, Thünen-Reihe Angewandter Volkswirtschaftstheorie,<br />
Working Paper No. 8, Universität Rostock, 1997.<br />
Lipsitz, G. (1984): Sports Stadia and urban Development: A Tale of three Cities, in:<br />
Journal of Sport and Social Issues, 8 (2), 1984.<br />
Luckenbach, H. (1986): Theoretische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, München<br />
(Vahlen), 1986, 33-40.<br />
Maennig, W. (1991): Kosten-Nutzen-Analysen Olympischer Spiele in Deutschland,<br />
in: List Forum für Wirtschaft- und Finanzpolitik, 17(4), S. 336-362.<br />
Maennig, W. (1998): Möglichkeiten und Grenzen von Kosten-Nutzen-Analysen im<br />
Sport, in: Sportwissenschaft, 28(3-4), 1998, S. 311-327.<br />
Mühlenkamp, H. (1994): Kosten-Nutzen-Analyse, München/Wien, 1994.<br />
Murphy, D. (1998): Stadium Financing: Public Funds Improve Design, in: ENR,<br />
240(7), 1998, S. 81.<br />
Noll, R. G. (1974): Attendance and Price Setting, in: Noll, R. G. (Hrsg.): Government<br />
and the Sports Business, Washington, D.C. (Brookings Institution Press),<br />
1974.<br />
Noll, R.G./Zimbalist, A. (1997a): Build the Stadium – Create the Jobs, in: Noll,<br />
R.G./Zimbalist, A. (Hrsg.): Sports, Jobs, and Taxes: the Economic Impact of<br />
Sports Teams and Stadiums, Washington, D.C. (Brookings Institution Press),<br />
1997, S. 1-54.<br />
Noll, R.G./Zimbalist, A. (1997b): The Economic Impact of Sports Teams and<br />
Facilities, in: Noll, R.G./Zimbalist, A. (Hrsg.): Sports, Jobs, and Taxes: the<br />
Economic Impact of Sports Teams and Stadiums, Washington, D.C.<br />
(Brookings Institution Press), 1997, S. 55-91.<br />
Noll, R.G./Zimbalist, A. (1997c): Sports, Jobs and Taxes. The real Connection, in:<br />
Noll, R.G./Zimbalist, A. (Hrsg.): Sports, Jobs, and Taxes: the Economic Impact<br />
of Sports Teams and Stadiums, Washington, D.C. (Brookings Institution<br />
Press), 1997, S. 494-508.
Obermaier, C. (1993): Italia 1990 – Eine verpaßte Chance der Stadtpolitik? In:<br />
67<br />
Häußermann, H./Siebel, W. (Hrsg.): Festivalisierung der Stadtpolitik:<br />
Stadtentwicklung durch große Projekte, Leviathan Sonderheft 13, Opladen, S.<br />
208-229.<br />
Okner, B.A. (1974): Subsidies of Stadiums and Arenas, in: Noll, R.G. (Hrsg.):<br />
Government and the Sports Business (Brookings Institution Press), 1974, S.<br />
325-347.<br />
Osterberg, W.P. (1991): Public Subsidies for Private Purposes, in: Economic<br />
Commentary: Federal Reserve Bank of Cleveland, 1991, S. 1-4.<br />
o.V. (1998a): Kurze Meldungen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.06.1998, S.<br />
46.<br />
o.V. (1998b): Petra Roth fordert TV-Gelder für Kommunen, in: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung, 05.01.1998, S. 26.<br />
o.V. (1998c): Fußball-Notizen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.10.1998, S. 38.<br />
o.V. (1998d): Fußball-Notizen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.04.1998, S. 31.<br />
o.V. (1998e): Millionen für zwei Stadien, in: Süddeutsche Zeitung, 02.09.1998, S. 37.<br />
o.V. (1998f): Kehrtwendung um 90 Grad beim HSV: Auch die Elf soll mit der Arena<br />
wachsen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.08.1998, S. 31.<br />
o.V. (1999a): WM-reif oder nicht? Die „BayArena“ ist zu klein, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung, 10.02.1999, S. 40.<br />
o.V. (1999b): Beckenbauer droht wieder mit einem Stadionneubau, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung, 17.03.1999, S. 48.<br />
Owen, W.H./Beitsch, O.M. (1997): Some Perspectives on Sports Facilities as Tools<br />
for Economic Actitvity, in: Real Estate Issues, 22(1), 1997, S. 16-23.<br />
Quirk, J./Fort, R.D. (1992): Pay dirt: The Business of Professional Team Sports,<br />
Princeton, NJ. (Princeton University Press), 1992.<br />
Rahmann, B./Weber, W./Groening, Y./Kurscheidt, M./Napp, H.-G./Pauli, M. (1998):<br />
Sozio-ökonomische Analyse der Fußball-WM 2006 in Deutschland, Köln<br />
(Sport und Buch Strauß), 1998.<br />
Reng, R. (1998): Auszug der Verrückten aus dem Park, in: Süddeutsche Zeitung,<br />
24.02.1998, S. 20.<br />
Roland Berger (1998): Fußballstadien in Deutschland - Situation, Trends und<br />
Herausforderungen, unver<strong>öffentlich</strong>te Studie, München, 1998.
Rosentraub, M.S./Nunn, S. (1978): Suburban City Investment in Professional Sports:<br />
68<br />
Estimating the Fiscal Returns of the Dallas Cowboys and Texas Rangers to<br />
Investor Communities, in: American Behavioral Scientist, 21(3), 1978, S. 393-<br />
413.<br />
Schröder, R. (1987): Regionalwirtschaftliche <strong>Auswirkungen</strong> einer Modernisierung des<br />
Weser-Stadions, in: Bremer Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 10, S. 11.<br />
Schulze-Marmeling, D. (1999): Anmerkung zur sozialen Bedeutung des Fußballs und<br />
seiner Stadien, Referat im Rahmen der Tagung „Arena 2000 – vom Stadion<br />
zum multifunktionalen Erlebnispark“, Essen, 21.01.1999.<br />
Shoven, J.B./Whalley, J. (1984): Applied General-Equilibrium Models of Taxation and<br />
International Trade: An Introduction and Survey, in: Journal of Economic<br />
Literature, 22(September), 1984, S. 1007-1051.<br />
Thöni, E. (1984): Sport und Ökonomie: Kosten-Nutzen-Analyse als<br />
Entscheidungshilfe für Sport(Groß-)Veranstaltungen, in: Schimmelpfeng-<br />
Review, (33), 1984, S. 89-92.<br />
Venturi, M. (1993): Der aufhaltsame Aufstieg der städtischen Großereignisse, in:<br />
Häußermann, H./Siebel, W. (Hrsg.): Festivalisierung der Stadtpolitik:<br />
Stadtentwicklung durch große Projekte, Leviathan Sonderheft 13, Opladen, S.<br />
56-70.<br />
Weber, W./Schnieder, C./Kortlüke, N./Horak, B. (1995): Die wirtschaftliche<br />
Bedeutung des Sports, Schorndorf (Hofmann), 1995.<br />
Welch, R. (1997): The Name of the Game, in: The Magazine for Senior Financial<br />
Executives, 13(6), 1997, S. 46-52.<br />
Wessel, C. (1998): Protest gegen das Bayern-Stadion, in: Süddeutsche Zeitung,<br />
01.01.1998, S. 36.<br />
Winkler-Schlang, R. (1998): FC Bayern-Super-Arena bringt Lärm und Randale, in:<br />
Süddeutsche Zeitung, 13.02.1998, S. 48.<br />
Wulzinger, M. (1999): Kicker und Käfer, in: Der Spiegel, Nr. 20, 1999, S. 256-257.<br />
Zimmermann, D. (1991): The Private Use of Tax-Exempt Bonds: Controlling Public<br />
Subsidy of Private Activity, Washington, D.C. (Urban Institute Press), 1991.<br />
Zimmermann, D. (1997): Subsidizing Stadiums. Who Benefits, Who Pays? In: Noll,<br />
R.G./Zimbalist, A. (Hrsg.): Sports, Jobs and Taxes: the Economic Impact of<br />
Sports Teams and Stadiums, Washington, D.C. (Brookings Institution Press),<br />
1997, S. 119-145.
Zipp, J.F. (1996): The Economic Impact of the Baseball Strike of 1994, in: Urban<br />
69<br />
Affairs Review, 32(November), 1996, S. 157-185.