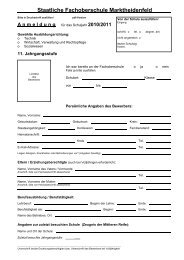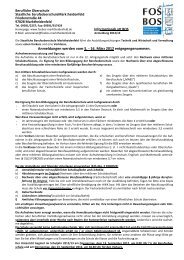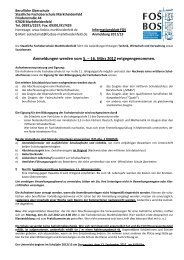Download ... - ISB - Bayern
Download ... - ISB - Bayern
Download ... - ISB - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS<br />
Lehrpläne für die Berufsoberschule<br />
Ausbildungsrichtung Wirtschaft<br />
Unterrichtsfach: Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Jahrgangsstufen 12 und 13<br />
Die Lehrpläne wurden mit KMBek vom 5. August 2003 Nr. VII.7-5 S 9410W1-6-7.66823 in Kraft gesetzt.<br />
Die Lehrpläne der Vorstufe treten zum Beginn des Schuljahres 2003/04 in Kraft, die Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 12 zum Beginn des<br />
Schuljahres 2004/05, die Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 13 zum Beginn des Schuljahres 2005/06. Sie ersetzen die bisher gültigen<br />
Lehrpläne.
INHALTSVERZEICHNIS<br />
EINFÜHRUNG<br />
1 Vorbemerkung zum Aufbau und zur Verbindlichkeit der Lehrpläne 1<br />
2 Schulartprofil Berufsoberschule 2<br />
3 Stundentafel 3<br />
4 Übersicht über die Fächer und Lerngebiete 3<br />
LEHRPLÄNE<br />
Betriebswirtschaftslehre 4<br />
ANLAGE<br />
Mitglieder der Lehrplankommission 19<br />
Seite
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschatslehre mit Rechnungswesen<br />
EINFÜHRUNG<br />
1 Vorbemerkung zum Aufbau und zur Verbindlichkeit der Lehrpläne<br />
Die folgenden Lehrpläne beschreiben die Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Berufsoberschule auf drei Ebenen.<br />
Die erste Ebene umfasst das Schulartprofil und erläutert den Bildungsauftrag der Schulart allgemein. Die zweite Ebene ist die der Fachprofile. Das<br />
Fachprofil charakterisiert den Unterricht eines bestimmten Fachs im Ganzen, indem es übergeordnete Ziele beschreibt, didaktische Entscheidungen<br />
begründet und fachlich-organisatorische Hinweise (z. B. auf fachübergreifenden Unterricht) gibt. Die Fachlehrpläne bilden die dritte Ebene. Sie<br />
enthalten jeweils eine Übersicht über die Lerngebiete sowie eine nach Jahrgangsstufen geordnete Darstellung der Lernziele, Lerninhalte und Hinweise<br />
zum Unterricht.<br />
Die Lernziele geben Auskunft über die Art der personalen Entwicklung, die bei den Schülerinnen und Schülern gefördert wird. Die Lernziele sind frei<br />
formuliert. Die jeweils gewählte Formulierung will deutlich machen, mit welchen der vier didaktischen Schwerpunkte – Wissen, Können und<br />
Anwenden, produktives Denken und Gestalten sowie Wertorientierung – die beschriebenen Entwicklungsprozesse in Verbindung stehen. Den<br />
Lernzielen sind Lerninhalte zugeordnet. Diese stellen die fachspezifischen Lerngegenstände des Unterrichts dar.<br />
Die in den drei Lehrplanebenen aufgeführten Ziele und Inhalte bilden zusammen mit fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben 1 , den<br />
einschlägigen Artikeln des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des Freistaates <strong>Bayern</strong> und des Bayerischen Gesetzes<br />
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Erziehungsarbeit.<br />
Die Fachlehrpläne stellen Lernziele und Lerninhalte systematisch dar. Ihre konkrete Abfolge im Unterricht ergibt sich aus dem jeweiligen<br />
Unterrichtsgegenstand, für den u. U. verschiedene Lernziele des Lehrplans kombiniert werden, aus der gewählten Unterrichtsmethode und der<br />
Absprache der Lehrkräfte.<br />
Die Hinweise zum Unterricht sowie die Zeitrichtwerte dienen der Orientierung oder Abgrenzung und sind nicht verbindlich. Die Freiheit der<br />
Methodenwahl im Rahmen der durch die Lernziele ausgedrückten didaktischen Absichten ist dadurch nicht eingeschränkt. Die Lehrpläne sind<br />
grundsätzlich so angelegt, dass ein ausreichender pädagogischer Freiraum bleibt, damit spezifische Interessen der Schülerinnen und Schüler, aktuelle<br />
Themen sowie öffentliche bzw. regionale Gegebenheiten aufgegriffen werden können.<br />
1 Z. B. dargestellt in: Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, Abt. Berufliche Schulen (Hrsg.), Bildungs- und Erziehungsaufgaben an Berufsschulen und Berufs-<br />
fachschulen, München 1996<br />
Seite 1
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschatslehre mit Rechnungswesen<br />
2 Schulartprofil<br />
Die Berufsoberschule führt Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss und Berufsausbildung oder einschlägiger Berufserfahrung in zwei<br />
Jahren zur fachgebundenen Hochschulreife, mit dem Nachweis ausreichender Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache (auf dem Niveau der 10.<br />
Klasse des Gymnasiums) zur allgemeinen Hochschulreife. Durch die erfolgreiche Teilnahme an der fakultativen Fachhochschulreifeprüfung können sie<br />
nach einem Jahr die Fachhochschulreife erwerben. Entsprechend ihrer beruflichen Qualifikation werden die Schülerinnen und Schüler vier<br />
Ausbildungsrichtungen zugeordnet: Technik, Wirtschaft, Sozialwesen, Agrarwirtschaft.<br />
Zum Erwerb der Studierfähigkeit werden die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, anspruchsvolle theoretische Erkenntnisse<br />
nachzuvollziehen, komplizierte Zusammenhänge zu durchschauen und verständlich darzustellen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben hohe<br />
kommunikative Kompetenz in der deutschen Sprache, entwickeln ein hohes Sprach- und Literaturverständnis und beherrschen eine Fremdsprache auf<br />
anspruchsvollem Niveau. Sie besitzen geschichtliches Bewusstsein und soziale Reife und gehen sicher mit komplexen mathematischen und<br />
naturwissenschaftlichen Problemen um. Komplexe moderne Informations- und Kommunikationsmittel nutzen sie kompetent und verantwortungsvoll.<br />
Die Schüler und Schülerinnen sind in der Lage, sich mit tiefer gehenden Problemstellungen der jeweiligen Fächer auseinander zu setzen.<br />
Der Unterricht greift die im Berufsleben erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der jungen Erwachsenen auf und erweitert sie –<br />
bestehende Unterschiede ausgleichend – gemäß den Bildungszielen der Schulart. Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, im<br />
fächerübergreifenden und projektorientierten Arbeiten die bereits erworbenen Arbeitstugenden zu entfalten. Die Schülerinnen und Schüler werden zum<br />
selbstständigen Wissenserwerb und zum eigenständigen Urteilen angeleitet. Dies verlangt eigenverantwortliches Lösen komplexer Aufgaben und<br />
fördert dadurch Flexibilität und Kreativität. Die Schülerinnen und Schüler bauen ihre fachlichen Kompetenzen aus, entwickeln ein umfassendes<br />
Problembewusstsein sowie Einstellungen und Haltungen, die auf verantwortliches Handeln in der Gemeinschaft ausgerichtet sind.<br />
Die Verwirklichung der Bildungsziele setzt bei den Schülerinnen und Schülern grundlegende Kenntnisse in den Fächern der jeweiligen<br />
Ausbildungsrichtung voraus. Für einen erfolgreichen Schulabschluss sind eine hohe Bereitschaft, sich auf geistige und ethische Herausforderungen<br />
einzulassen, eine hohe Lernmotivation, große Ausdauer, geistige Beweglichkeit und die Fähigkeit, selbstständig und mit anderen zu arbeiten,<br />
notwendig.<br />
Seite 2
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschatslehre mit Rechnungswesen<br />
3 Stundentafel<br />
Den Lehrplänen liegt die Stundentafel der Schulordnung für die Berufsoberschulen in <strong>Bayern</strong> (BOSO) in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.<br />
4 Übersicht über die Lerngebiete<br />
Die Zahlen in Klammern geben Zeitrichtwerte an, d. h. die für das betreffende Lerngebiet empfohlene Zahl von Unterrichtsstunden.<br />
Jahrgangsstufe 12 Jahrgangsstufe 13<br />
12.1 Vollkostenrechnung (29)<br />
12.2 Teilkostenrechnung (34)<br />
12.3 Materialwirtschaft (13)<br />
12.4 Geschäftsbuchführung, Jahresabschluss<br />
und Bewertung (80)<br />
12.5 Finanzwirtschaft I (15)<br />
12.6 Marketing (27)<br />
198<br />
13.1 Controlling (45)<br />
13.2 Finanzwirtschaft II (65)<br />
13.3 Produktions- und Kostentheorie (35)<br />
13.4 Management (20)<br />
165<br />
Seite 3
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Berufsoberschule<br />
Ausbildungsrichtung Wirtschaft<br />
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MIT RECHNUNGSWESEN<br />
Fachprofil: Im Fach Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen soll problemlösendes Denken gefördert und das Interesse geweckt<br />
werden, unterschiedliche betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen von verschiedenen Seiten anzugehen und zu lösen. Im<br />
Unterricht muss berücksichtigt werden, dass die Schülerinnen und Schüler beim Eintritt in die Berufsoberschule über heterogene<br />
berufliche und allgemein bildende Vorkenntnisse verfügen.<br />
In der Jahrgangsstufe 12 wird den Schülerinnen und Schülern anhand der Vollkostenrechnung verständlich, dass die Erfassung<br />
und Verrechnung der Kosten und Leistungen zur Ermittlung des Verkaufspreises und des betrieblichen Erfolgs wesentlich sind.<br />
Sie kommen auf der Grundlage der Vollkostenrechnung zur Einsicht, dass das kostenrechnerische Entscheidungssystem hin zur<br />
Teilkostenrechnung modifiziert werden muss, um produktions- und absatzpolitische Entscheidungen gewinnorientiert und<br />
marktgerecht fällen zu können.<br />
Bevor betriebswirtschaftliche Sachverhalte in der Geschäftsbuchführung systematisch erfasst und buchungstechnisch umgesetzt<br />
werden, sollen wesentliche Inhalte der Materialwirtschaft erörtert werden.<br />
Durch die Geschäftsbuchführung wird ein Fundament für die Bewertung und den Jahresabschluss geschaffen. Den Schülerinnen<br />
und Schülern wird der Zusammenhang zwischen Bewertung und Unternehmenserfolg sowie der Entscheidungsspielraum bei der<br />
Gewinnverwendung bewusst.<br />
Im Lerngebiet Finanzwirtschaft I lernen sie anhand verschiedener Kriterien die Finanzierungsarten zu unterscheiden und im<br />
Lerngebiet Marketing erkennen sie die zentrale Bedeutung des Marktes für unternehmerische Entscheidungen in allen<br />
Funktionsbereichen.<br />
In der Jahrgangsstufe 13 stehen eher strategische betriebswirtschaftliche Entscheidungsfelder im Vordergrund. An ausgewählten<br />
Bereichen werden spezielle Probleme der Betriebswirtschaftslehre exemplarisch betrachtet und bearbeitet. Die gestellten<br />
Aufgaben und Probleme dienen dazu, Methoden und Wissen an einfachen und komplexen Beispielen zu festigen und zu<br />
vertiefen. Zusätzlich sollen die Probleme bei der Übertragung der Theorie in die Praxis aufgezeigt werden. Dabei sind Aspekte<br />
des Umweltschutzes einzubeziehen.<br />
Die Schülerinnen und Schüler sollen einsehen, dass im Hinblick auf Erfolgssicherung und Gewinnmaximierung des<br />
Unternehmens die Informationsgewinnung und -auswertung als funktionsübergreifende Aufgaben eine zentrale Rolle spielen.<br />
Die Einsicht, dass die Gestaltung der unternehmerischen Zukunft auf Grundlage fundierter Planung und Steuerung in<br />
Abhängigkeit von gesetzten Zielen eine existenzielle Bedeutung für den Bestand des Unternehmens im Wettbewerb hat, wird im<br />
Lerngebiet Controlling an exemplarischen Beispielen gefördert.<br />
Seite 4
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Jahrgangsstufe 12<br />
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus Jahrgangsstufe 12 werden Bilanz und GuV-Rechnungen analysiert und daraus Folgen für<br />
die Finanzierung und die Liquidität eines Unternehmens abgeleitet.<br />
Auf diese Weise werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, die Chancen und Risiken langfristig wirksamer Entscheidungen<br />
durch geeignete Rechenverfahren zu beurteilen.<br />
Die Auseinandersetzung mit theoretischen Modellen ist in den Wirtschaftswissenschaften ein unverzichtbarer Ansatz zur<br />
Problemlösung und führt propädeutisch in die wissenschaftliche Arbeitsweise ein. Mit Hilfe der Kostentheorie wird ein<br />
gedankliches Modell erarbeitet, auf Realitätsnähe überprüft und beurteilt.<br />
Im Lerngebiet Management wird exemplarisch die Bedeutung der menschlichen Arbeit und die Notwendigkeit der Beachtung<br />
von menschlichen Verhaltensweisen für den Erfolg der Unternehmung aufgezeigt und analysiert. Damit wird das Bewusstsein<br />
gefördert, dass das Unternehmen als soziales Gebilde existent ist und als solches sowohl nach innen als auch nach außen sicht bar<br />
wird. Ferner wird die Einsicht gefördert, dass Ansehen und damit auch der Erfolg eines Unternehmens wesentlich von sozialen<br />
Prozessen beeinflusst werden.<br />
Lerngebiete: 12.1 Vollkostenrechnung 29 Std.<br />
12.2 Teilkostenrechnung 34 Std.<br />
12.3 Materialwirtschaft 13 Std.<br />
12.4 Geschäftsbuchführung, Jahresabschluss und Bewertung 80 Std.<br />
12.5 Finanzwirtschaft I 15 Std.<br />
12.6 Marketing 27 Std.<br />
198 Std.<br />
LERNZIELE<br />
LERNINHALTE<br />
HINWEISE ZUM UNTERRICHT<br />
12.1 Vollkostenrechnung 29 Std.<br />
Die Schülerinnen und Schüler führen mit<br />
Hilfe der Vollkostenrechnung eine<br />
Abgrenzung der Begriffe<br />
– Ausgaben, Aufwendungen und Kosten<br />
Eine Abgrenzungsrechnung ist nicht durchzuführen.<br />
Seite 5
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
kurzfristige Erfolgsrechnung durch und<br />
beurteilen die ermittelten<br />
Kostenabweichungen. Mit Hilfe der<br />
differenzierten Zuschlagskalkulation<br />
verrechnen sie alle bei der Leistungserstellung<br />
und -verwertung anfallenden<br />
Kosten auf den Kostenträger und ermitteln<br />
den Angebotspreis.<br />
12.2 Teilkostenrechnung<br />
– Einnahmen, Erträge und Leistungen<br />
Einteilung der Kosten nach<br />
– der Zurechenbarkeit auf die Kostenträger<br />
– der Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad<br />
Erstellung eines Betriebsabrechnungsbogens<br />
(BAB):<br />
– einfacher BAB mit vier Hauptkostenstellen<br />
– mehrstufiger BAB mit einfacher<br />
Kostenumlage ohne gegenseitige Verrechnung<br />
– Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagssätze<br />
Kostenträgerzeitrechnung:<br />
– Kostenträgerzeitrechnung auf Ist- und<br />
Normalgemeinkostenbasis mit Abstimmung<br />
von Betriebs- und Umsatzergebnis<br />
– Maschinenkosten, Maschinenlaufzeit,<br />
Maschinenstundensatz<br />
– Interpretation der Kostenabweichungen<br />
Kostenträgerstückrechnung einschließlich<br />
Maschinenkosten als Zuschlagskalkulation<br />
Kalkulation des Angebotspreises einschließlich<br />
Vertreterprovision, Skonto und Rabatt<br />
Die Ermittlung der Bestandsveränderungen unfertiger<br />
und fertiger Erzeugnisse erfolgt mit Normalgemeinkostenzuschlagssätzen.<br />
Kostenträgerzeitblatt mit<br />
maximal zwei Kostenträgern erstellen<br />
Die maschinenbezogenen Fertigungsgemeinkosten sind<br />
als Wert vorzugeben.<br />
Die Schülerinnen und Schüler erkennen Unterschied zwischen Voll- und Teil- Fallbeispiel zum Übergang von der Voll- zur Teilkos-<br />
34 Std.<br />
Seite 6
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
die Grenzen der Vollkostenrechnung und<br />
den Nutzen der Teilkostenrechnung für<br />
betriebswirtschaftliche Entscheidungen.<br />
Sie setzen die Deckungsbeitragsrechnung<br />
als Instrument betriebswirtschaftlicher<br />
Entscheidungsfindung ein.<br />
12.3 Materialwirtschaft<br />
kostenrechnung<br />
Entscheidung über die Annahme oder<br />
Ablehnung von Aufträgen anhand des<br />
Stückdeckungsbeitrags<br />
Bestimmung der kurz- und langfristigen<br />
Preisuntergrenze<br />
Break-even-Analyse durch Ermittlung der<br />
Gewinnschwellenmenge und des -umsatzes<br />
(Gesamt- und Stückbetrachtung rechnerisch<br />
und grafisch behandeln)<br />
Auswirkung von Kosten- und Preisänderungen<br />
auf die Gewinnschwelle<br />
Berechnung der Deckungsbeiträge I und II<br />
sowie des Betriebsergebnisses<br />
Optimierung des Produktionsprogramms bei<br />
Vorliegen eines Engpasses<br />
– bei der Beschaffung<br />
– in der Produktion<br />
Entscheidung über Eigenfertigung oder<br />
Fremdbezug unter Berücksichtigung<br />
qualitativer und quantitativer Aspekte<br />
Kostenvergleich zweier Fertigungsverfahren<br />
tenrechnung durchführen<br />
Mit LG 12.3 verknüpfen<br />
13 Std.<br />
Seite 7
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich<br />
mit Beschaffungsvorgängen auseinander.<br />
Sie erkennen die Bedeutung der Bedarfsplanung<br />
und der optimalen Lagerhaltung<br />
für den Erfolg einer Unternehmung.<br />
12.4 Geschäftsbuchführung,<br />
Jahresabschluss und Bewertung<br />
Die Schülerinnen und Schüler werden mit<br />
den Grundlagen und Besonderheiten der<br />
Geschäftsbuchführung vertraut und<br />
können ausgewählte Geschäftsvorfälle<br />
Ziele der Materialwirtschaft<br />
Ermittlung des Materialbedarfs<br />
In diesem Zusammenhang auch auf Vor- und Nachteile<br />
der Just-in-time-Beschaffung eingehen<br />
ABC-Analyse Einsatz eines Tabellenkalkulationsprogramms sinnvoll<br />
Angebotsvergleich auf Grundlage qualitativer<br />
und quantitativer Kriterien<br />
Rechnerische und grafische Lösung des<br />
Bestellmengen- und -häufigkeitsproblems:<br />
– Mindest- und Meldebestand<br />
– optimale Bestellmenge<br />
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der<br />
Lagerhaltung mit Hilfe folgender Kennzahlen:<br />
– Umschlagshäufigkeit<br />
– durchschnittliche Lagerdauer<br />
– durchschnittlicher Lagerbestand<br />
– Lagerzinssatz<br />
Grundlagen der Geschäftsbuchführung<br />
Aufbau und Funktion des<br />
Industriekontenrahmens<br />
Verschiedene Angebote auswerten<br />
Angebotsvergleich über Internet durchführen<br />
Hier bietet es sich an, eine Bezugskalkulation (vgl.<br />
Angebotskalkulation, LG 12.1) durchzuführen.<br />
80 Std.<br />
Seite 8
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
buchen. Sie kennen die Bestandteile des<br />
Jahresabschlusses einer großen<br />
Kapitalgesellschaft sowie die Gliederung<br />
der Bilanz. Sie sind in der Lage,<br />
ausgewählte Positionen der Bilanz nach<br />
Steuerrecht zu bewerten und die dabei anfallenden<br />
Berechnungen und Buchungen<br />
vorzunehmen.<br />
Buchen der Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br />
und Betriebsstoffe sowie Fremdbauteile<br />
Buchen der Bezugskosten<br />
Berechnen und Buchen von Rücksendungen<br />
und Nachlässen<br />
Ermitteln des Jahresgesamtverbrauchs an Roh-,<br />
Hilfs- und Betriebsstoffen sowie<br />
Fremdbauteilen mit und ohne T-Konten-<br />
Darstellung<br />
Ermitteln und Buchen von<br />
– Verkaufserlösen<br />
– Rücksendungen<br />
– Entgeltkorrekturen<br />
– Bestandsveränderungen an fertigen und<br />
unfertigen Erzeugnissen<br />
Bewegungen im Sachanlagevermögen:<br />
– Ermitteln der Anschaffungskosten<br />
– Buchen der Beschaffung von Sachanlagevermögen<br />
– Buchen der aktivierungspflichtigen<br />
Eigenleistungen<br />
– Buchen des Verkaufs einschließlich<br />
Inzahlunggabe<br />
Bilanz<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Anhang<br />
Lagebericht<br />
Keine Anzahlungen<br />
Keine Anlagen im Bau, keine Anzahlungen<br />
Am Beispiel aktueller Geschäftsberichte können deren<br />
Bestandteile und Gliederung veranschaulicht und<br />
herausgearbeitet werden.<br />
Auf eine Erstellung der GuV in Staffelform soll<br />
verzichtet werden.<br />
Seite 9
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Ergebnisverwendung Keine Berechnung der gesetzlichen Rücklagen<br />
durchführen<br />
Eigenkapital vor, nach teilweiser und nach<br />
vollständiger Ergebnisverwendung<br />
Einkommensteuerrechtliche<br />
Bewertungsmaßstäbe:<br />
– Anschaffungskosten<br />
– Herstellungskosten<br />
– Teilwert<br />
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen:<br />
– lineare und geometrisch-degressive<br />
Abschreibung<br />
– Wechsel von der geometrisch-degressiven<br />
Abschreibung zur linearen Abschreibung<br />
– geringwertige Wirtschaftsgüter<br />
– Buchen der Abschreibung<br />
Bewertung einschließlich notwendiger<br />
Buchungen von<br />
– nicht abnutzbarem Sachanlagevermögen<br />
inkl. Wertaufholung<br />
– abnutzbarem Sachanlagevermögen<br />
– Vorräten inkl. Bewertungsvereinfachung,<br />
dargestellt am Beispiel der<br />
Durchschnittsbewertung<br />
– Forderungen aus Lieferungen und<br />
Leistungen:<br />
. direkte Abschreibung von (teilweise)<br />
uneinbringlichen Forderungen<br />
Auf Vorschriften der internationalen Rechnungslegung<br />
(z. B. IAS und US-GAAP) hinweisen<br />
Ohne Berechnung<br />
Bewertung anhand von Fallbeispielen durchführen<br />
Bei Teilwertabschreibungen ist der Teilwert vorzugeben.<br />
Keine weitere Abschreibung nach Teilwertabschreibung<br />
vornehmen<br />
Fremdwährungen sind nicht zu berücksichtigen.<br />
Seite 10
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
12.5 Finanzwirtschaft I<br />
Die Schülerinnen und Schüler stellen den<br />
Zusammenhang zwischen Investition und<br />
Finanzierung her. Sie unterscheiden und<br />
beurteilen verschiedene<br />
Finanzierungsarten.<br />
12.6 Marketing<br />
. Eingang abgeschriebener Forderungen<br />
. Einzel- und Pauschalwertberichtigung<br />
am Bilanzstichtag einschließlich<br />
Abschluss der Konten<br />
– Bildung und Auflösung von Rückstellungen<br />
am Beispiel von Pensions- und Prozess-<br />
kostenrückstellungen<br />
Investitionsarten<br />
Kreislauf finanzieller Mittel:<br />
– Einnahme, Ausgabe<br />
– Kapitalbeschaffung, -verwendung, -rückfluss,<br />
-neubildung, -abfluss<br />
Finanzierungsarten nach der Rechtsstellung der<br />
Kapitalgeber und der Kapitalherkunft:<br />
– Beteiligungsfinanzierung am Beispiel der<br />
ordentlichen Kapitalerhöhung einer AG<br />
– Kreditfinanzierung:<br />
. Annuitätendarlehen<br />
. Kontokorrentkredit<br />
– offene und stille Selbstfinanzierung<br />
– Finanzierung aus Rückstellungen<br />
– Finanzierung aus sonstiger<br />
Vermögensumschichtung<br />
Keine Kreditsicherheiten besprechen<br />
Angebote verschiedener Banken vergleichen<br />
Keine detaillierte Behandlung der Finanzierung aus<br />
Abschreibungen<br />
15 Std.<br />
27 Std.<br />
Seite 11
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Die Schülerinnen und Schüler entwerfen<br />
ein Marketingkonzept und berücksichtigen<br />
dabei die verschiedenen Phasen im<br />
Produktlebenszyklus. Sie kennen<br />
Methoden und Strategien, den Erfolg des<br />
Marketingmixes zu steuern.<br />
Marketingstrategien:<br />
– Produktmix:<br />
. Produktinnovation, -variation, -differenzierung,<br />
-diversifikation und -elemination<br />
. Produktgestaltung und Verpackung<br />
– Distributionsmix:<br />
. direkter und indirekter Absatz<br />
. Vergleich Reisender und Handelsvertreter<br />
– Kontrahierungsmix:<br />
. Preispolitik<br />
. Konditionenpolitik<br />
– Kommunikationsmix:<br />
. Werbung<br />
. Sales Promotion<br />
. Public Relations<br />
Marketingmix als Kombination der<br />
Marketingstrategien unter Berücksichtigung<br />
des Produktlebenszyklus<br />
Marktwachstums-Marktanteil-Portfolio als<br />
Steuerungsmethode<br />
Vgl. LG 12.2 und 12.3<br />
Seite 12
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
Berufsoberschule<br />
Ausbildungsrichtung Wirtschaft<br />
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MIT RECHNUNGSWESEN, Jahrgangsstufe 13<br />
Lerngebiete: 13.1 Controlling 45 Std.<br />
13.2 Finanzwirtschaft II 65 Std.<br />
13.3 Produktions- und Kostentheorie 35 Std.<br />
13.4 Management 20 Std.<br />
165 Std.<br />
LERNZIELE<br />
LERNINHALTE<br />
HINWEISE ZUM UNTERRICHT<br />
13.1 Controlling 45 Std.<br />
Die Schülerinnen und Schüler erwerben<br />
einen Überblick über die Aufgaben des<br />
strategischen und operativen Controllings.<br />
Mit Hilfe des Budgetierungsprozesses<br />
lernen sie, dass die Erreichung des<br />
Unternehmensziels ergebnisorientiert<br />
geplant, gesteuert und kontrolliert werden<br />
muss.<br />
Funktionaler Aspekt des Controllings:<br />
– Information<br />
– Planung:<br />
. Planungsobjekte<br />
. Planungszeitraum<br />
– Steuerung<br />
– Kontrolle<br />
Budgetierungsprozess<br />
Flexible Plankostenrechnung auf<br />
Vollkostenbasis (rechnerische und grafische<br />
Seite 13
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
13.2 Finanzwirtschaft II<br />
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen<br />
die Struktur der Bilanz und führen<br />
Liquiditäts- und Erfolgsanalysen durch.<br />
Im Hinblick auf finanzwirtschaftliche<br />
Ziele überprüfen sie die Aussagefähigkeit<br />
von Kennzahlen und bewerten<br />
Ermittlung und Analyse der Beschäftigungs-,<br />
Verbrauchs- und Gesamtabweichung)<br />
Investitionsbudget und Grundsätze der<br />
Investitionsplanung<br />
Verfahren der Investitionsrechnung:<br />
– statische Verfahren:<br />
. Kostenvergleichsrechnung<br />
. Gewinnvergleichsrechnung<br />
. Rentabilitätsrechnung<br />
. Amortisationsrechnung<br />
– dynamische Verfahren am Beispiel der<br />
Kapitalwertmethode<br />
Vor- und Nachteile der statischen und<br />
dynamischen Investitionsrechnung<br />
Einfluss nicht quantifizierbarer Aspekte auf die<br />
Investitionsentscheidung<br />
Finanzwirtschaftliche Ziele:<br />
– Unabhängigkeit<br />
– Liquidität<br />
– Rentabilität<br />
– Sicherheit<br />
– Kreditwürdigkeit<br />
Aus Absatz- und Produktionsplanung herleiten,<br />
Zusammenhang mit Finanzplanung herstellen, keinen<br />
detaillierten Investitionsplan aufstellen<br />
Bei Ersatzbeschaffung Kapitalkosten der alten<br />
und Restwert der neuen Anlage nicht<br />
berücksichtigen<br />
Z. B. Umweltfreundlichkeit einer Maschine, Serviceleistungen<br />
des Lieferanten<br />
65 Std.<br />
Seite 14
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
ausgewählte Finanzierungsalternativen.<br />
Sie lernen weitere Finanzierungsarten<br />
kennen.<br />
Erstellen einer Strukturbilanz<br />
Bilanzanalyse:<br />
– vertikale Bilanzstruktur:<br />
. Anlagequote und Umlaufquote<br />
. Eigenkapital- und Fremdkapitalquote<br />
. statischer Verschuldungsgrad<br />
– horizontale Bilanzstruktur:<br />
. Anlagedeckungsgrad I<br />
. Anlagedeckungsgrad II<br />
. Working Capital<br />
Anhand von Geschäftsberichten<br />
veranschaulichen<br />
Beim Fremdkapital ist nur zwischen langfristigem und<br />
kurzfristigem Fremdkapital zu unterscheiden.<br />
Liquiditätsanalyse: Liquiditätsgrade 1 bis 3 Die Unzulänglichkeit der Stichtagsanalyse kann<br />
am Beispiel des Finanzplans dargestellt werden.<br />
Analyse der Finanz- und Ertragskraft:<br />
– Eigenkapitalrentabilität<br />
– Gesamtkapitalrentabilität<br />
– Leverage-Effekt<br />
– Umsatzrentabilität<br />
– Kapitalumschlag<br />
– Return-on-investment (Formel)<br />
– Cashflow<br />
– dynamischer Verschuldungsgrad<br />
Bei der Berechnung wird vom Anfangsbestand<br />
ausgegangen.<br />
Der Cashflow und die Nettoverbindlichkeiten sollten<br />
wie folgt berechnet werden:<br />
Jahresüberschuss<br />
+ Abschreibungen (- Zuschreibungen)<br />
+ Erhöhung (- Verminderung) von<br />
langfristigen Rückstellungen<br />
= Cashflow<br />
Fremdkapital<br />
Seite 15
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
13.3 Produktions- und Kostentheorie<br />
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen<br />
die Prämissen des ertragsgesetzlichen<br />
Modells mit der betrieblichen<br />
Wirklichkeit. Sie gewinnen den Einblick,<br />
dass die Produktionsfunktion auf der Basis<br />
Vergleich der Kennzahlen und Beurteilung<br />
ihrer Aussagefähigkeit<br />
Maßnahmen zur Erreichung<br />
finanzwirtschaftlicher Ziele<br />
Finanzierung aus Abschreibungen:<br />
– Lohmann-Ruchti-Effekt (mit<br />
Auswirkungen auf die Perioden- und<br />
Gesamtkapazität)<br />
– stille Selbstfinanzierung<br />
Finanzierungssurrogate:<br />
– Leasing<br />
. Operating Leasing<br />
. Financial Leasing<br />
– Factoring<br />
Auswirkung von Leasing und Factoring auf die<br />
Bilanzstruktur und den Erfolg<br />
Prämissen des Ertragsgesetzes<br />
- Kundenanzahlungen<br />
- flüssige Mittel<br />
= Nettoverbindlichkeiten<br />
Bilanzierung nur beim Leasinggeber<br />
Keine Berechnung der Leasingraten<br />
Betriebliche Produktionsprozesse, die im<br />
Widerspruch zu den Prämissen des<br />
Ertragsgesetzes stehen, diskutieren<br />
An Volkswirtschaftslehre, LG 13.2, anknüpfen<br />
35 Std.<br />
Seite 16
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
von Verbrauchsfunktionen erstellt wird,<br />
und leiten die Kostenfunktion ab. Sie<br />
wählen die geeignete Anpassungsform bei<br />
veränderter Beschäftigung unter<br />
Berücksichtigung der betrieblichen<br />
Kostenstruktur aus.<br />
Limitationaler Einsatz der Produktionsfaktoren<br />
Verbrauchsfunktionen:<br />
– leistungsabhängig<br />
– leistungsunabhängig<br />
Produktionsfunktion vom Typ B<br />
Lineare Kostenfunktion (Gesamt- und<br />
Stückbetrachtung)<br />
Auswirkungen von Kostenänderungen auf die<br />
kritischen Punkte<br />
Kosteneinflussgrößen:<br />
– Faktorqualitäten<br />
– Beschäftigung<br />
– Faktorpreise<br />
– Betriebsgröße<br />
– Fertigungsprogramm<br />
Anpassungsformen (rechnerische und grafische<br />
Lösung):<br />
– bei konstanter Betriebsgröße:<br />
. zeitlich<br />
. intensitätsmäßig<br />
. zeitlich-intensitätsmäßig<br />
. quantitativ<br />
. selektiv<br />
– bei Betriebsgrößenvariation:<br />
. quantitativ (multipel)<br />
. qualitativ (mutativ)<br />
Begriff Limitationalität klären<br />
Absprache mit der Lehrkraft des Fachs<br />
Volkswirtschaftslehre erforderlich<br />
Problemorientiertes Unterrichtsgespräch: Vergleich<br />
theoretischer und empirischer Kostenverläufe,<br />
Übertragbarkeit theoretischer Kostenmodelle in die<br />
Betriebspraxis<br />
Aufbauend auf LG 12.2<br />
Seite 17
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
13.4 Management<br />
Die Schülerinnen und Schüler erfahren die<br />
Bedeutung von grundlegenden<br />
Managementleitlinien für das<br />
Unternehmen. Sie setzen sich mit<br />
unterschiedlichen Menschenbildern und<br />
Motivationstheorien auseinander und<br />
erkennen ihre Relevanz für die<br />
Mitarbeiterführung.<br />
Nutz- und Leerkosten<br />
Kostenremanenz<br />
Unternehmensleitbild:<br />
– Produkt-Markt-Konzeption<br />
– oberste Unternehmensziele<br />
– Verhaltensgrundsätze gegenüber<br />
Anspruchsgruppen<br />
– Leitungskonzept<br />
Corporate Identity: Inhalt und Bedeutung<br />
Mitarbeiterbilder in Managementmodellen am<br />
Beispiel des<br />
– technologischen Ansatzes<br />
– Human-Relations-Ansatzes<br />
– Human-Ressources-Ansatzes<br />
Führung durch Motivation am Beispiel der<br />
Motivationstheorien von Maslow und Herzberg<br />
Mit einem Beispiel arbeiten<br />
Evtl. Betriebserkundung durchführen<br />
20 Std.<br />
Es sollten die Grundzüge einer Corporate Identity für ein<br />
konkretes Unternehmen formuliert werden.<br />
Seite 18
Berufsoberschule, Ausbildungsrichtung Wirtschaft Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen<br />
ANLAGE<br />
Mitglieder der Lehrplankommission:<br />
Wilhelm Birnkammerer Altötting<br />
Horst Hausmann Erlangen<br />
Johannes Schäfer Augsburg<br />
Bärbel Stöcklein Nürnberg<br />
Dr. Karin Schwarzkopf <strong>ISB</strong> München<br />
Seite 19