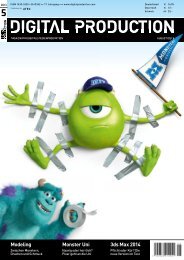Lesen Sie den ganzen Artikel als PDF - Mediadesign Hochschule ...
Lesen Sie den ganzen Artikel als PDF - Mediadesign Hochschule ...
Lesen Sie den ganzen Artikel als PDF - Mediadesign Hochschule ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ReTTeT DIe ÖKO-BOHeMe DIe WelT?<br />
Die Megatrends des Modischen am Beispiel der Bekleidung<br />
ZU BegInn<br />
Im folgen<strong>den</strong> Aufsatz soll die entwicklung großer gesellschaftlicher Trends am Beispiel der<br />
Bekleidung der letzten zwanzig Jahre aufgezeigt wer<strong>den</strong>, um dadurch dem Begriff der nach-<br />
haltigkeit und der Frage nach der Bedeutung dieses Begriffes für heutige gestaltung etwas<br />
näher zu kommen.<br />
Bestimmte entwicklungen in der gestaltung und Rezeption von Bekleidung wer<strong>den</strong> im allgemeinen<br />
Sprachgebrauch oft mit dem Begriff der Mode gleichgesetzt. eine Praxis, der ich – der<br />
Verständlichkeit zuliebe – hier folgen werde.<br />
BegRIFFSKläRUng<br />
Die Beschäftigung mit der Frage der „Megatrends“ führt <strong>als</strong> erstes zu zwei Begriffen, die in diesem<br />
Zusammenhang immer wieder fallen und mitunter eine eher unzulässige Allianz eingehen<br />
– Mo<strong>den</strong> und Trends (mitunter eben auch <strong>als</strong> Modetrends umgangssprachlich im gebrauch).<br />
Wen<strong>den</strong> wir uns vorerst <strong>den</strong> Mo<strong>den</strong> zu: ein Begriff, der nicht ohne grund langsam an Bedeutung<br />
verliert. In unschuldigeren – sprich überschaubareren - Zeiten definierte Walter Benjamin<br />
die Mo<strong>den</strong> einmal so: „Die Mode ist die ewige Wiederkehr des neuen.“ (Walter Benjamin, gesammelte<br />
Schriften, Hrsg. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt<br />
am Main, 1.Aufl.1972-1999, Bd.I/2, „Zentralpark“), wobei die Funktionsweise der Mode,<br />
auf einen einfachen nenner gebracht, <strong>als</strong> die Verneinung des Jüngstvergangenen bezeichnet<br />
wer<strong>den</strong> kann. Mode ist in dieser lesart das Flüchtige, ein Akt schöpferischer Zerstörung, der<br />
im Moment seiner Wirkung wirkungslos wird.<br />
Oder wie norbert Bolz in seinem Aufsatz „Mode oder Trend?“ (norbert Bolz, Mode oder Trend?<br />
Kunstforum 141, Jg.1998, S.196ff) feststellt: „Mode ist der Konformismus der Abweichung.“<br />
Das heißt, die Mode macht gerade in der Anpassung des einzelnen an einen scheinbar allgemeinen<br />
Konsens <strong>den</strong> Unterschied zum gerade Vergangenen oder wie georg Simmel in seinem<br />
Aufsatz „Die Philosophie der Mode“ schon vor hundert Jahren sagte: Die Mode ermöglicht<br />
„einen sozialen gehorsam, der zugleich individuelle Differenzierung ist.“ (georg Simmel, gesamtausgabe<br />
10. Philosophie der Mode 1905, Suhrkamp Verlag, 2006) – Differenzierung zur<br />
eigenen Vergangenheit.<br />
So ist das, was der Mode ihre Stärke im Alltag verleiht, die Stärke des formalen Reizes der<br />
grenze. Die Mode wird <strong>als</strong>o nicht reizvoll durch Substanz, sondern durch die Differenz, dem<br />
erlebnis von grenze und Wechsel. Und eben aus diesem grund steht ihr die gesellschaftlich-<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
1 | 12
intellektuelle Rezeption so skeptisch gegenüber. Anstelle des ungeliebten und diffamierten<br />
Mo<strong>den</strong>-Begriffs ist in <strong>den</strong> letzten fünfzehn Jahren der Begriff des Trends getreten.<br />
Trends kann man – im gegensatz zu Mo<strong>den</strong> - nicht erfin<strong>den</strong>. Man kann sie nur abtasten, verstärken<br />
und ihnen namen geben. Und im gegensatz zu Mo<strong>den</strong> funktionieren sie tatsächlich,<br />
sonst wären es keine Trends. So sind Trendforscher namensgeber – Trendforschung ist eine<br />
echtzeitanalyse. Dynamiken in unseren Kulturen wer<strong>den</strong> gelesen und benannt. Und in dieser<br />
Benennung liegt auch die gefahr der Trendforschung. Im Augenblick der Ankunft des neuen<br />
und dessen Verbreitung beginnt auch dessen Diffusion. Die Innovation der Szene verkommt<br />
zum lifestyle. Der Mega-Trend <strong>als</strong> weit reichende gesellschaftliche Ten<strong>den</strong>z, <strong>als</strong> eine Art Führungsidee<br />
muss immer auch eine lösung anbieten, einen „endgültigkeits-Ton“ anschlagen, um<br />
so einen reellen oder auch nur ersehnten Stabilisierungseffekt zu haben.<br />
Diesen Stabilisierungseffekt braucht er, um einigermaßen universell zu wirken. Richtet die<br />
Trendforschung ihren Blick nun allzu weit in die Zukunft verkommt das Instrumentarium der<br />
Trendforscher zum Kaffeesatz-lesen.<br />
Im Folgen<strong>den</strong> möchte ich nun einen kurzen Überblick über die entwicklung von Bekleidungs-<br />
Trends (und eben nICHT von Mo<strong>den</strong>) in <strong>den</strong> letzten zwanzig Jahren geben. Aktuelle Trends<br />
erkennen sich um vieles leichter mit dem Wissen um die gerade erst vergangenen.<br />
FRAgMenTIeRUng<br />
Ausgehend von einem weitgehend homogenen lebensgefühl der Sechziger und auch noch<br />
der frühen <strong>Sie</strong>bziger kommt es durch die Jugendrevolten und durch die damit verbun<strong>den</strong>en<br />
gesellschaftlichen Umwertungen (Die Jugend wirkt von nun an kulturbestimmend.) zu einer<br />
verstärkten Differenzierung und Abgrenzung von lebensmodellen, Szenen und gesellschaftlichen<br />
gruppen.<br />
Kulturelle Differenz – das Anderssein – bestimmt die Jugendkultur. So entwickeln sich bereits<br />
in <strong>den</strong> Achtzigern nebeneinander existierende, mehr oder weniger einflussreiche Subkulturen.<br />
eine entwicklung - die durch die allgemeine liberalisierung der westlichen gesellschaften noch<br />
verstärkt wird.<br />
In <strong>den</strong> späten Achtzigern und frühen neunzigern fällt dieses gesellschaftliche Setting mit<br />
einer zunehmen<strong>den</strong> Medialisierung unseres alltäglichen lebens zusammen. Das Privatfernsehen<br />
entsteht und das Angebot an Bildern, das es von nun an tagtäglich zu konsumieren gilt,<br />
schnellt nahezu explosionsartig in die Höhe.<br />
Das Musikfernsehen entwickelt sich und mit ihm verändern sich die Sehgewohnheiten rasant.<br />
Seit <strong>den</strong> frühen neunzigern wirkt die fortschreitende Digitalisierung in allen gesellschaftlichen<br />
Bereichen.<br />
neue Kunst- und Musikformen erobern ihren Platz auf der kulturellen Bildfläche. Bilder wer<strong>den</strong><br />
zur beliebig manipulierbaren Massenware. Die Bilder sind der Spiegel unserer ängste, Träume,<br />
Visionen und Wünsche – unserer Vorstellung von uns selbst.<br />
Und so verwundert es auch nicht, wenn nach einem lebensgefühl der 90er befragt, niemand<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
2 | 12
sich so recht festlegen mag oder eben dieser kleinste gemeinsame nenner eben jene vielbe-<br />
schworene Vielseitigkeit und liberalisierung der gesellschaft genannt wird. Das Individuum<br />
feiert sich selbst, betont seine Individualität um je<strong>den</strong> Preis. In dieser angestrengten Betonung<br />
der eigenen Individualität liegt dann auch das Verbin<strong>den</strong>de dieses Jahrzehnts – die Aufsplitterung<br />
der gesellschaft in ihre kleinstmöglichen einheiten, der Mythos von der Selbstverwirklichung.<br />
Für die Mode bedeutet das eine Ausprägung von Subkulturen und Szenen, die vielfältig und<br />
zeitgleich nebeneinander existieren. (Dazwischen die großen Modehäuser, die vorerst versuchten,<br />
so weiterzuwirtschaften wie bisher...). Stark geprägt wer<strong>den</strong> diese modischen Subkulturen<br />
u.a. von dem nebeneinander der unterschiedlichsten musikalischen entwicklungen. Auch<br />
die sexuelle liberalisierung und die entwicklung verschie<strong>den</strong>artigster, neuer lebensmodelle,<br />
wie Patchwork-Familien, der große Anteil von Single-Haushalten an der gesamtbevölkerung,<br />
Verschiebung der geschlechterrollen oder die emanzipation der Homosexuellen wirkte sich<br />
auf die gestaltung und Rezeption von Bekleidung aus.<br />
es entwickelten sich die unterschiedlichsten Bekleidungsstile bis hin zur sozialen Differenz<br />
durch die komplizierten, nur für eingeweihte lesbaren Zeichensysteme der Minimal-Fashion zur<br />
Jahrtausendwende. (Hier entwickelt sich auch der enorme Bedarf an Trendscouts, mit deren<br />
Hilfe die Untiefen dieser immer schwerer fassbaren Märkte umschifft wer<strong>den</strong> sollen.)<br />
BeSCHleUnIgUng<br />
Die bei<strong>den</strong> wichtigsten technischen entwicklungen der neunziger waren mit Sicherheit der<br />
flächendeckende einsatz des Computers in fast allen lebensbereichen und der <strong>Sie</strong>geszug<br />
des Mobiltelefons.<br />
Die Digitalisierung aller gestaltungs- und Produktionsprozesse und weiter Teile des alltäglichen<br />
lebens nahezu aller Menschen der westlichen Industrienationen führten zu einer rasanten<br />
Beschleunigung in diesen Bereichen. Die geschwindigkeit in Produktion und Vertrieb<br />
von Bekleidung (oder auch Mode) wurde atemberaubend. Weltweite logistik und Vernetzung<br />
senkten die Kosten für die Produktion und <strong>den</strong> Transport von Konsumgütern und eben auch<br />
von Bekleidung. Arbeitsintensive Zweige oder gesundheits- und umweltbelastende Produktionsbereiche<br />
wur<strong>den</strong> in Billiglohnländer und Staaten mit weniger restriktiven Umweltbestimmungen<br />
verlegt. Die produzierten Stückzahlen konnten auf diese Art und Weise immer weiter<br />
erhöht wer<strong>den</strong>, was wiederum die Kosten für das einzelne Kleidungsstück senkte. Selbst mit<br />
<strong>den</strong> Vertriebswegen um die halbe erde ist es heute möglich, die Herstellungspreise weit unter<br />
<strong>den</strong>en inländischer oder europäischer Waren zu halten. Diese Art der globalisierten Produktion<br />
und Distribution ist beileibe nicht nur bei Discountern und weltweit agieren<strong>den</strong> Handelsketten<br />
gängige Praxis. <strong>Sie</strong> findet heute in nahezu allen Marktsegmenten der Bekleidungsbranche<br />
statt – vom Billigdiscounter bis zum hochpreisigen Designerlabel.<br />
nun hat die globalisierung nicht allein die Herstellung der Waren strukturell verändert, auch die<br />
Rezeption der Mode ist durch die weltweite mediale Vernetzung um ein Vielfaches beschleu-<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
3 | 12
nigt. Kaum ist der letzte Ton der Musik auf einer der Schauen in Paris verklungen, liegen die<br />
Bilder schon auf <strong>den</strong> Redaktionstischen der Fashion-Mags, der Online-Dienstleister und der<br />
nachrichtenagenturen, wer<strong>den</strong> verwertet und flattern nur Stun<strong>den</strong> später auf <strong>den</strong> heimischen<br />
Rechner. eine Information, an der der Konsument von Mode noch Mitte der neunziger Jahre<br />
nur mit der erheblichen Verzögerung von Wochen teilhaben konnte. Der neuigkeitswert erfährt<br />
heute immer kürzere Halbwertzeiten. Im gegenzug können natürlich auch die Anbieter von<br />
Bekleidung immer schneller auf entstehende Szenen, Mo<strong>den</strong> oder neue Zielgruppen, zeitlich<br />
immer flexibler auf immer neue Kun<strong>den</strong>wünsche reagieren.<br />
Weltweite Konfektionäre wie H & M bringen seit 1998 mindestens 12 Kollektionen im Jahr auf<br />
<strong>den</strong> Markt, heute gibt es bei diesem Unternehmen keine saisonalen Kollektionen mehr, sondern<br />
sich überlappende Mo<strong>den</strong>-Segmente und einen täglichen eingang von neuer Ware.<br />
Für <strong>den</strong> Kun<strong>den</strong> bedeutet das, dass ein bestimmter zeitlicher Wertmaßstab – die Attraktion<br />
des neuartigen - verloren geht. ein Kleidungsstück ist bereits „Schnee von gestern“, wenn es<br />
aufgebügelt im geschäft hängt, <strong>den</strong>n sein nachfolger liegt schon hinten im lager.<br />
Die Zeitspirale der sich abwechseln<strong>den</strong> Mo<strong>den</strong> überdreht sich, die einzelnen Segmente wer<strong>den</strong><br />
immer kürzer, der glanz des neuen verblasst im Moment seines Aufscheinens, bis die Spirale<br />
aus ihrem gewinde springt und sich selbst überholt. es entsteht ein Zustand der Parallelität<br />
von Mo<strong>den</strong> – von neu neben alt neben retro neben retro-retro. „In & OUT“s, „MUST HAVe“s<br />
und eben ausgerufene Fashion Hypes wechseln sich in so schneller Folge ab und wer<strong>den</strong> so<br />
inflationär proklamiert, dass der Rezipient, der Kunde schon längst nicht mehr folgen kann.<br />
Der soziale effekt der Angleichung durch Mode aber auch der Differenz verliert sich.<br />
MeDIAlISIeRUng<br />
Der <strong>Sie</strong>geszug des Computers und dessen weltweite Vernetzung ist auch ein <strong>Sie</strong>geszug der<br />
Bilder in einem vorher nie da gewesenen Ausmaß. Auch das mediale Angebot des Fernsehens<br />
hat sich seit 1984 mit der entstehung der privaten Sender explosionsartig vervielfacht. Aus<br />
<strong>den</strong> ehem<strong>als</strong> zwei öffentlich-rechtlichen Sendern mit ihren regionalen, dritten Programmen<br />
sind in Deutschland inzwischen fünfzig Fernsehsender gewor<strong>den</strong>. Da diese Medien <strong>als</strong> visuelle<br />
Medien vor allem auf der Übermittlung von Informationen durch Bilder aufgebaut sind, ist es<br />
sicher nicht f<strong>als</strong>ch, angesichts dieser Zunahme an ausgesandten Bildern von einer Bilderflut<br />
zu sprechen.<br />
eine nachricht ohne Bild ist heute keine nachricht mehr. Doch sind es nicht die einzelnen Bilder<br />
und deren versunkene Betrachtung, die unser Sehverhalten vollständig verändert haben,<br />
vielmehr sind es die immer schnelleren Bildfolgen, die schnellen Schnitte, Überlagerungen<br />
und der hohe grad der visuellen Verdichtung der Informationen. Die digitale Verarbeitung der<br />
Bilder macht es möglich. Der digitale Boom macht auch vor der Produktion der privaten Bilder<br />
nicht halt. Seit die Digitalfotografie erschwinglich und das Heimvideo - respektive die selbst<br />
geschnittene DVD - technisch auch für <strong>den</strong> laien beherrschbar ist, produzieren wir selbst ein<br />
Vielfaches an Bildern. Zeitgleich boomt auch der Zeitschriften-Markt – hinzu kommen unzäh-<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
4 | 12
lige Blogs und Websites im netz, die die Bilder von der Mode streuen.<br />
Für die Mode bedeutet das auf der einen Seite natürlich eine quantitative erhöhung der An-<br />
zahl der Bilder, die von ihr gemacht und rezipiert wer<strong>den</strong>. Zum Anderen wer<strong>den</strong> aber durch<br />
die Realität der Überlappungen der Mo<strong>den</strong> und die zeitliche Parallelität ihrer Wertigkeiten die<br />
Bilder der Mode immer wichtiger. <strong>Sie</strong> wer<strong>den</strong> das Mittel der Differenz. <strong>Sie</strong> zeigen die formalen<br />
Zeichen der Abgrenzung. Je mehr die realen gegenstände (die Kleidung) diese Zeichen der<br />
Differenz verlieren, <strong>als</strong>o für die soziale Assimilation des Individuums alle „irgendwie richtig“<br />
sind, desto wichtiger wer<strong>den</strong> die Bilder von ihnen.<br />
<strong>Sie</strong> sind emotional aufgela<strong>den</strong>. <strong>Sie</strong> zeigen das Kleidungsstück nur am Rand. Das Material<br />
verschwindet. In <strong>den</strong> Fotostrecken der Fashionmagazine dient das gezeigte Kleidungsstück,<br />
wenn es <strong>den</strong>n überhaupt erkennbar ist, nur <strong>als</strong> Vorwand. An seine Stelle tritt das Bild. Die<br />
Bilder transportieren von nun an – fast unabhängig vom gezeigten Sujet - die verschie<strong>den</strong>en<br />
Stile. Das digitale Foto lässt surreale Welten entstehen, Models wer<strong>den</strong> – wie z.B. bei David<br />
laChapelle - zu Kunstfiguren einer absur<strong>den</strong> Szene. Im gegensatz dazu entsteht in <strong>den</strong> 90er<br />
Jahren in der Modefotografie der superrealistische Stil eines Jürgen Teller oder wer<strong>den</strong> gleich<br />
Künstler wie Wolfgang Tillmanns oder Terry Richardson <strong>als</strong> Modefotografen verpflichtet. Die<br />
dokumentarisch erscheinen<strong>den</strong> Bilder sollen Authentizität vermitteln und <strong>den</strong> Dingen (oder der<br />
Mode), die sie zeigen, ihre glaubwürdigkeit zurückgeben.<br />
Authentizität <strong>als</strong> Wert soll Schutz und Halt bieten in der Unübersichtlichkeit modischer entwicklungen.<br />
Aber es ist eben nicht die Realität – bei allem dokumentarischen gehabe bleiben die<br />
Bilder doch die Bilder. Das Bild hat die Fähigkeit, unsere Wünsche und Vorstellungen zu zeigen,<br />
uns zu berühren, weil es eben seine profane dingliche existenz verlassen kann und assoziativ<br />
wirkt. es verweist auf etwas anderes <strong>als</strong> sich selbst. Das kann das reale Kleidungsstück nicht!.<br />
Die emotion, die es auslöst, macht <strong>den</strong> Unterschied zur Beliebigkeit der Dinge.<br />
1 2 3 4<br />
5 6 7<br />
8<br />
Diese Beispiele zeigen deutlich die emotionalisierung des Konsums. Durch die inflationäre<br />
entstehung und Verbreitung dieser emotional aufgela<strong>den</strong>en Bildinhalte unterliegen diese am<br />
ende <strong>den</strong> gleichen Dynamiken wie die Mo<strong>den</strong> selbst.<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
5 | 12
gleICHZeITIgKeIT<br />
Diese drei wichtigsten entwicklungstrends der Mode - Fragmentierung, Beschleunigung und<br />
Medialisierung – wirken gleichzeitig und bedingen sich gegenseitig. geht man <strong>als</strong>o nun ei-<br />
nerseits von einem in kleinste Marktsegmente, Zielgruppen und Subkulturen fragmentierten<br />
Markt aus, von einer sich selbst überholen<strong>den</strong> Zeitspirale und damit einer tatsächlichen Parallelität<br />
der Mo<strong>den</strong> gepaart mit einer hoch emotionalisierten Bilderflut, dann führt das zu einer<br />
objektiven Beliebigkeit der realen Dinge in Bezug auf ihre herkömmlichen, Mode-immanenten<br />
Werthaftigkeiten. ein zeitlich definierter Wert existiert nicht mehr, weil seine Werkzeuge wie<br />
„In & OUT“, „MUST HAVe“ oder „next fashion-hype“ an Kraft verlieren.<br />
Zur gleichen Zeit verschwindet durch rationalisierte Fertigungsprozesse, die globalisierung<br />
der Produktion - und die damit verbun<strong>den</strong>e Ausbeutung von natur und Mensch in wirtschaftlichen<br />
entwicklungsländern - auch der Wert des Produkts, der sich für <strong>den</strong> Kun<strong>den</strong> in seinem<br />
Preis festmacht. Dieser Preis bestimmt sich durch die Qualität der Ausgangsmaterialien und<br />
deren werthafte Verarbeitung. Wer<strong>den</strong> nun die Dinge beliebig austauschbar, temporär äußerst<br />
begrenzt, so erhöht sich der Preisdruck, <strong>den</strong> der Kunde am Markt ausübt. Hier versuchten die<br />
großen Marken entgegenzusteuern, indem die Marke selbst die Dinge mit Wert auflud.<br />
<strong>Sie</strong> war das Allheilmittel der Marketing-Spezialisten und Werbeleute, der allgemeinen Marktentwicklung<br />
etwas entgegenzusetzen. Immer mehr Marken und Untermarken wur<strong>den</strong> kreiert<br />
und auf <strong>den</strong> Markt geworfen, um nach kürzester Zeit wieder in der Bedeutungslosigkeit zu verschwin<strong>den</strong>.<br />
Am ende gerät die Marke in <strong>den</strong> gleichen Strudel der entwicklung und versagt in<br />
weiten Teilen in ihrem Auftrag, wertstiftend zu sein. Die Dinge sind im klassischen Verständnis<br />
von Mode entwertet.<br />
Da nun die ehem<strong>als</strong> zeitlich bestimmten „Mode-Werte“ nicht mehr greifen, das nebeneinander<br />
der Stile und Mo<strong>den</strong> <strong>den</strong> Konsumenten zusätzlich verwirrt oder gleichgültig macht, auch die<br />
Marke diese lücke nicht mehr zu schließen vermag und zudem der Preis <strong>als</strong> Mittel der Orientierung<br />
entfällt, ist die Sehnsucht nach einer neuen Art der Aufwertung der Dinge, nach einem<br />
verlässlichen Koordinatensystem groß.<br />
nACHHAlTIgKeIT<br />
neue Werte müssen her! Am besten Werte, die der Sehnsucht des Konsumenten nach Vereinfachung<br />
in einer komplexen Welt, nach Vorauswahl und Orientierung und nach „entschleunigung“<br />
(Horx) oder Verlangsamung in einer gesellschaft, in der Zeit in bestimmten Schichten zum luxus<br />
wird, entgegenkommen. Werte – die trotzdem dem gesamtgesellschaftlich proklamierten<br />
Streben nach Individualisierung in allen lebensbereichen Rechnung tragen.<br />
An diese Stelle tritt nun ein Trend mit dem besonderen Heilsversprechen einer hohen menschlichen<br />
Moral, einer die dem einzelnen die Möglichkeit gibt, sich <strong>als</strong> guter Mensch zu fühlen, ohne<br />
einer Organisation beitreten oder seinen alltäglichen Komfort aufgeben zu müssen.<br />
Der lOHAS ist geboren und wird sogleich von der Trendforschung ausgemacht. Der „lifestyle<br />
Of Health And Sustainability“ trägt einer <strong>ganzen</strong> Reihe von Bedürfnissen Rechnung und hat eine<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
6 | 12
solche Kraft, dass sich heute schon ca. 30 % der Verbraucher der Industriestaaten (Quelle:<br />
Zukunftsinstitut – Matthias Horx) dieser „Bewegung“ zugehörig fühlen. ein Prozentsatz, <strong>den</strong><br />
Matthias Horx tagtäglich wachsen sieht. Dieser Trend bietet die Möglichkeit für je<strong>den</strong> einzelnen,<br />
sein Verhalten tatsächlich im Sinne eines guten gewissens zu verändern, ohne auf luxus<br />
und Konsum verzichten zu müssen. nachdem die Politik und auch die klassischen Umweltorganisationen<br />
in die Kritik gekommen sind, ist dieser Rückzug in die Konsumkritik sehr persönlich<br />
und individuell ohne große Festlegung auf Interessengruppen, lobbies oder ähnliches. Die<br />
Ausprägungen des individuellen lebensstils sind sehr verschie<strong>den</strong> und durch kein äußeres<br />
Reglement geregelt. Der Trend der nachhaltigkeit bietet die Chance, Teil einer Bewegung zu<br />
sein, ohne ideologisch vereinnahmt zu wer<strong>den</strong>. Jeder wählt selbst, wie weit sein moralisches<br />
gewissen reicht, wie konsequent er seinen persönlichen Konsum nach <strong>den</strong> Aspekten sozialer<br />
und ökologischer nachhaltigkeit ausrichtet.<br />
Für die Produzenten von Konsumgütern (so auch Bekleidung) ergibt sich hier die Möglichkeit,<br />
die Dinge neben <strong>den</strong> althergebrachten Werten, wie Qualität und Funktion, noch mit einem zusätzlichen<br />
Mehrwert auszustatten und nebenbei tatsächlich gutes zu tun.<br />
Inzwischen beschäftigen sich nicht nur die Trendforschung, sondern auch die Medien ausgiebig<br />
mit dem Phänomen der lOHAS, es existieren eigene Websites (wie www.lohas.de oder<br />
www.lohasguide.de u.v.a.), die grundsätze nachhaltigen lebens proklamieren und große Teile<br />
der Konsumgüterindustrie haben <strong>den</strong> Fuß – mehr oder weniger überzeugt – auf dem Trittbett<br />
des Zuges, der da gerade anrollt. Ökologisches Bewusstsein ist trés chic – man <strong>den</strong>ke nur an<br />
die weltweiten „live earth“-Konzerte Anfang August 2007.<br />
Auch die Modeindustrie hat diese neue Mega-Zielgruppe mehr oder weniger überzeugt für<br />
sich entdeckt. Die „Premium“-Modemesse in Berlin widmete sich auf ihrem parallel zur Messe<br />
stattfin<strong>den</strong><strong>den</strong> Symposium ganze drei Saisons genau diesem Thema und in der gesondert<br />
herausgestellten „green Area“ waren ausschließlich Firmen mit ihren Stän<strong>den</strong> vertreten, die<br />
sich eco-Fashion und green-glamour auf ihre Fahnen geschrieben haben.<br />
Wobei mit dem zweiten Begriff, <strong>den</strong> des „green glamour“, auch schon ein ganz wesentlicher<br />
Unterschied zur Öko-Mode der Vergangenheit greifbar wird. Die eco-Fashion von heute ist<br />
weit vom Strickpulli und Sackleinen-Hose vergangener Tage entfernt, hat nichts mehr zu tun<br />
mit Bekleidungsgestaltung in einer bewusst (kunst-)handwerklichen Anmutung oder der „Backto-the-roots-ästhetik“<br />
der ersten fundamentalen Ökos. Öko-Fashion hieß in <strong>den</strong> Achtzigern<br />
vor allem eins: Verzicht – Verzicht auf Tragekomfort und Verzicht auf die technologischen<br />
errungenschaften der Textilindustrie. Die gestaltung von Öko-Fashion war bewusst eindimensional<br />
und verzichtete auf die Inszenierung des Körpers zugunsten eines politisch-korrekten<br />
Öko-Stils. Damit hat eco-Fashion der heutigen Tage tatsächlich nichts mehr zu tun. Der Kunde,<br />
der Produkte z.B. des glamour-labels „noir“ oder des eco-Jeans-Herstellers „Kuyichi“ erwirbt,<br />
kauft die Kleidungsstücke in erster linie wegen des Designs. Das gute gewissen der<br />
konsequent nachhaltigen Produktion wird <strong>als</strong> willkommener Mehrwert praktisch „nebenbei“<br />
mit erworben.<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
7 | 12
Der Däne Peter Ingwersen kombiniert bei <strong>den</strong> Kleidungsstücken seines labels „noir“ scharfe<br />
Silhouetten, viel Haut und glamour mit ökologischem Bewusstsein, ethisch korrekter Produk-<br />
tion und sozialem engagement und findet so seine lücke auf dem heiß umkämpften Mode-<br />
Markt. Der Managing Director des niederländischen Denim-labels „Kuyichi“ Tony Tonnaer war<br />
einer der Mitbegründer von „Made-By“ einer Organisation, die andere Mode-Unternehmen<br />
dabei unterstützt, ethisch korrekt zu produzieren und <strong>den</strong> Herstellungsprozess für <strong>den</strong> Kun<strong>den</strong><br />
transparent zu machen.<br />
Hierfür erhalten alle Kleidungsstücke der labels, die zur „Made-by“ - Organisation gehören<br />
einen Code. Dieser Code ist auf dem Innenetikett (mit Materialangabe und Waschanleitung)<br />
zu fin<strong>den</strong>. Auf der Website von „Made-by“ (www.made-by.org) kann unter dem Menü „Track<br />
& Trace“ mit Hilfe einer genauen Anleitung dieser Code eingegeben wer<strong>den</strong>. nun wird mit<br />
Hilfe der Software der Amerikanischen Schwesterorganisation „Organic exchange“ der Weg<br />
nachvollzogen, <strong>den</strong> das Kleidungsstück im Prozess seiner entstehung gegangen ist. Dieser<br />
Produktionsweg gibt Auskunft über die Ausgangsmaterialien, die Fabriken in <strong>den</strong>en das Kleidungsstück<br />
genäht wird und die Handelswege, die es genommen hat. Der Produktionsprozess<br />
wird für <strong>den</strong> Kun<strong>den</strong> transparent und er kann sich bewusst für oder gegen einen <strong>Artikel</strong><br />
entschei<strong>den</strong>. Als sichtbares label hat „Made-by“ <strong>den</strong> „Blue Button“ entwickelt. ein sichtbar<br />
am Kleidungsstück angebrachter blauer Knopf gibt so dem eingeweihten Auskunft, dass dieses<br />
Teil nach <strong>den</strong> hohen sozialen Standards und mit einer guten Umwelt- und energiebilanz<br />
hergestellt wurde. Die „Made-by“ - Organisation verlinkt auch zu Produktionsstätten, die nach<br />
nachhaltigen gesichtspunkten produzieren und hat <strong>als</strong> eine der wichtigsten Aufgaben, die<br />
Information des Verbrauchers auf ihre Fahnen geschrieben.<br />
Hinter all diesen Bemühungen steht das Bestreben, zu international anerkannten und verbindlichen<br />
Standards für eine ethisch-ökologische Produktion zu kommen. noch gibt es dieses verbindliche<br />
Reglement nicht, nahezu jede Organisation, die sich der Veränderung der globalen<br />
Produktion zu mehr nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung verschrieben hat, entwickelt<br />
ihre eigenen Standards und Vorgaben. Diese gehen alle in ähnliche Richtungen, sind aber im<br />
Detail dann doch zum Teil sehr verschie<strong>den</strong>.<br />
Beschäftigt man sich nun etwas eingehender mit dem Thema nachhaltigkeit und Mode so<br />
stellt sich bald das gefühl ein, allerorten entstün<strong>den</strong> – vor allem kleinere – Mode-label, die<br />
sich in der Herstellung von Bekleidung ökologischer und sozialer Verantwortung stellen und<br />
dies auch nach außen kommunizieren.<br />
So macht das Amerikanische label „American Apparel“ seit ein paar Jahren mit ihren günstigen<br />
Baumwoll-Shirts und –Basics Furore, die zu einem Teil aus Bio-Baumwolle hergestellt<br />
sind und sämtlich in Kalifornien genäht wer<strong>den</strong>. Damit wurde das label mit seinen lässigenunprätentiösen<br />
Styles lieblingslabel einer jungen, urbanen Käuferschicht, bei der es zum<br />
sportlichen look gern „noch etwas mehr sein“ durfte. Auch dem Schweizer Designer Shauket<br />
Imam gelang mit seinem konsequent ökologischen Jeans-label KOhZO-DenIM international<br />
der Durchbruch.<br />
Diese liste ließe sich an dieser Stelle noch um einiges erweitern. Vor diesem Hintergrund<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
8 | 12
sollte man jedoch nicht vergessen, dass heute noch nicht einmal ganz 2<br />
Prozent der weltweit hergestellten Baumwolle organische Baumwolle ist.<br />
Der Rest von mehr <strong>als</strong> 98 Prozent wird immer noch auf konventionelle Art<br />
erzeugt und verarbeitet. etwa die Hälfte aller Textilien, die weltweit hergestellt<br />
wer<strong>den</strong>, sind aus Baumwolle. Allein für die erzeugung und Pflege<br />
der global benötigten Baumwolle wer<strong>den</strong> im Jahr mehr <strong>als</strong> 40 Millionen<br />
Kilogramm Pestizide und Insektizide eingesetzt.<br />
Um eine wirkliche Trendwende zu erreichen, müssten vor allem die großen,<br />
internationalen Konfektionäre ihre Produktion komplett umstellen und<br />
transparent machen. längst sind große Konfektionsfirmen wie nike, levis,<br />
Mustang, H & M oder auch Victorias Secret auf <strong>den</strong> Öko-Zug aufgesprungen.<br />
In fast jeder Kollektion der weltweiten Marken findet sich ein Ökoeckchen,<br />
mit dem es sich vor allem gut PR machen lässt. Folgt man nun<br />
9<br />
<strong>den</strong> sensationsheischen<strong>den</strong> Pressemeldungen im Detail, dann lässt sich<br />
der vielgepriesene Bio-BH bei Victorias Secret erst nach einigem Hin und<br />
Her fin<strong>den</strong>, bei Mustang sind die mit großem Presserummel angekündigten<br />
Modelle „nebraska“ und „Oregon“ aus 100 % Organic Cotton auf der Website<br />
erst gar nicht zu entdecken.<br />
H & M brachte im März des Jahres 2007 die erste Bio-Kollektion in die<br />
weltweiten geschäfte, die bereits nach wenigen Wochen ausverkauft war.<br />
Inzwischen folgten einige weitere Kollektionen eco-Fashion zu unschlagbar<br />
günstigen Preisen mit mehr oder weniger großem erfolg.<br />
H & M war eine der ersten weltweit agieren<strong>den</strong> Bekleidungsfirmen, die <strong>den</strong><br />
„Code of Conduct“ – einen Verhaltenskodex zur einhaltung grundlegender<br />
sozialer Regeln – für seine Zulieferer zur Bedingung machte. Bereits seit<br />
1996 beschäftigt H & M eigens zur Kontrolle der einhaltung dieses Verhaltenskodex<br />
weltweit insgesamt 50 Auditoren in zwanzig länderbüros und<br />
9+<br />
150 Qualitätskontrolleure vor Ort, die die über 700 Zulieferer von H & M<br />
unangekündigt prüfen.<br />
(Quelle: http://www.hm.com/de/unternehmerischeverantwortung__responsability.nhtml;<br />
H&M-Firmenwebsite). Diese gezielten Bemühungen, unternehmerische Verantwortung auszuüben,<br />
entstan<strong>den</strong> natürlich auch durch <strong>den</strong> gewachsenen gesellschaftlichen Druck und die<br />
sozialen Standards des „Codes of Conduct“ sind natürlich mit sozialen Standards reicher<br />
Industrienationen nicht zu vergleichen.<br />
Kaum, dass die großen Konfektionäre nun zaghaft die eco-Fashion für sich entdecken, regt<br />
sich in der lOHAS-ecke bereits Kritik. Von „green Washing“ wird da gesprochen und das meint<br />
das Bemühen vieler konventioneller Unternehmen, am Bio-Boom teilzuhaben und ihr Image<br />
grün aufzupolieren. Und das ist dann auch der größte Kritikpunkt des aufmerksamen und<br />
kritischen Konsumenten am allseits beschworenen Öko- und nachhaltigkeits-Trend.<br />
es besteht die Angst, dass seitens der Industrie halbherzige Angebote gemacht wer<strong>den</strong>, eco-<br />
Fashion zum eco-Hype verkommt und genauso schnell wieder fallengelassen wird, wie er<br />
entstand.<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
9 | 12
In der medialen Wahrnehmung hat dann die Präsenz des Themas innerhalb des letzten Jah-<br />
res auch schon deutlich abgenommen. Doch Strategen und Trendforscher sind sich nahezu<br />
einig, dass dieser neue Mega-Trend auf einem grundsätzlichen Bewusstseinswandel basiert.<br />
Konsumkritik – früher eher durch Verzicht zum Ausdruck gebracht – wird in Zukunft in immer<br />
stärkerem Maße durch gezielten Konsum stattfin<strong>den</strong>. Auch für das Design bedeutet das ein<br />
Um<strong>den</strong>ken im Sinne der nachhaltigkeit. es bedeutet nicht nur, ökologische Überlegungen bei<br />
der Auswahl der Materialien oder der Verfahren der Herstellung mit einzubeziehen, der Schlüssel<br />
zu diesen veränderten Bedürfnissen liegt in meinen Augen eindeutig und in der Bedeutung<br />
nicht zu unterschätzen im Design selbst.<br />
10 11<br />
FRAgen<br />
Handelt es sich bei dem Streben nach nachhaltigkeit um einen Fashion-Trend, um einen neuen<br />
Super-Hype oder schlichtweg um existentielle notwendigkeit?<br />
Selbst wenn es sich hier um einen Hype handelt – führt nicht auch der große nachhaltigkeits-<br />
PR-Boom letztendlich doch zu etwas gutem? Bleibt am ende nicht doch die Veränderung des<br />
Bewusstseins bei Konsument und Anbieter? Wie muss sich das Design verändern, um bei<br />
einem kritischen, ökologisch und/oder sozial interessierten aber <strong>den</strong>noch konsumfreudigen<br />
Konsumenten langfristig erfolgreich zu sein?<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
10 | 12
12<br />
13<br />
14 15<br />
ein Beitrag von Prof. Antje Osterburg<br />
Fachbereich Modedesign<br />
MeDIADeSIgn HOCHSCHUle<br />
für Design und Informatik<br />
lin<strong>den</strong>strasse 20-25<br />
10969 Berlin<br />
Tel. 030/399 266-0<br />
info-ber@mediadesign-fh.de<br />
www.mediadesign.de<br />
16<br />
17<br />
IM FOKUS<br />
Modedesign<br />
11 | 12
BIlDnACHWeIS ZU „MeDIAlISIeRUng“:<br />
1. Fotograf: Richard Avedon – Dovima mit elephanten – Abendkleid von Dior<br />
Das Bild ist bereits aus dem Jahr 1955 – steht aber bis heute beispielhaft<br />
für die Fotografien von Richard Avedon – vgl. auch Versace-<br />
Collezioni Donna (1995 – 97)<br />
2. Fotograf: Oliviero Toscani aus: Fotografien für Benetton 1984 – 2000<br />
3. Fotograf: David laChapelle für Xelibri<br />
IM FOKUS<br />
Quellenverweis<br />
4. Fotograf: David laChapelle - „From Heaven to Hell“ - Pieta mit Courtney love<br />
5. Fotografin: elaine Constantine für „Vogue“ 2000<br />
6. Fotograf: Jürgen Teller - „Kristen McMenamy 3“ 1996<br />
7. Fotograf: Francois Halard für „Vogue“ US 1987<br />
8. Fotograf: Sean ellis für „The Face“ März 1998<br />
BIlDnACHWeIS FÜR „nACHHAlTIgKeIT“:<br />
Alle Bildbeispiele zeigen Produkte, die nach Angaben der Hersteller<br />
nach <strong>den</strong> grundsätzen einer nachhaltigen Produktion hergestellt wor<strong>den</strong> sind.<br />
9. (Beide Bilder !) Firma: American Apperel (Kollektion 07)<br />
10. eviromental Justice Foundation „Save the future“ - limited edition von<br />
Katherine Hamnet Model: lily Cole – Foto: Matthew eades<br />
11. Firma: loomstate – Women Spring-Collection 07<br />
12. Firma: Alchemist Fashion Amsterdam – Mitglied von „Made-By“ Organisation<br />
13. Firma: Armed Angels - 1st Social Fashion label – Current Collection 2007<br />
14. Firma: eDUn - founded 2005 from Ali Hewson & Bono – One Charity-Shirt<br />
15. Firma: noir – Illuminati – Spring/Summer 07<br />
16. Firma: noir – Illuminati – Spring/Summer 07<br />
17. Firma: Cotton Couture – Spring/Summer 2007<br />
12 | 12