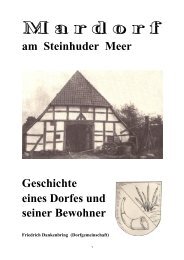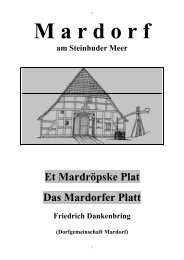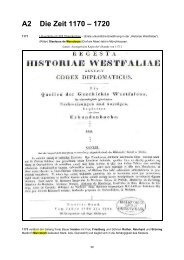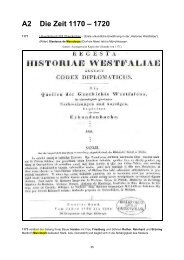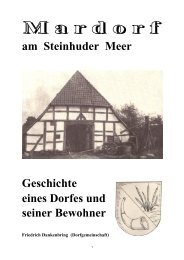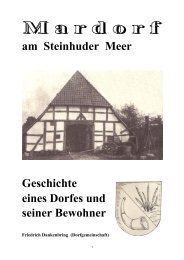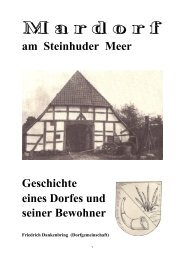Sie beginnen den Rundgang am Groß-Parkplatz Alte ... - Mardorf
Sie beginnen den Rundgang am Groß-Parkplatz Alte ... - Mardorf
Sie beginnen den Rundgang am Groß-Parkplatz Alte ... - Mardorf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Sie</strong> <strong>beginnen</strong> <strong>den</strong> <strong>Rundgang</strong> <strong>am</strong> <strong>Groß</strong>-<strong>Parkplatz</strong> <strong>Alte</strong> Moorhütte 11 und verlassen ihn nach<br />
rechts, vorbei an der Verkehrsinsel, überqueren die Meerstraße (R347) und erreichen ein<br />
kleines Waldgebiet. Die Anhöhe links ist eine ehemalige Binnenwanderdüne (10-15 m hoch)<br />
im Bereich der „Schwarzen Berge“. So genannt wegen des dunklen Untergrunds (Laub,<br />
Nadeln, Moos) im Gegensatz zum „Weißen<br />
Berg“ (offener heller Flugsand). Rechts <strong>am</strong><br />
Waldrand lässt sich ein kleiner aber sehr tiefer<br />
Graben erahnen – der Bannseegraben. Links<br />
oben auf der Düne steht ein altes Wochenend-<br />
Haus. Überall säumen jetzt Blaubeerbüsche<br />
unseren Weg (nicht verwechseln mit <strong>den</strong><br />
weniger gut schmecken<strong>den</strong> „Rauschbeeren“).<br />
Der Moorpfad verläuft bis zu einer kleinen Lichtung ein Stück gemeins<strong>am</strong> mit dem Dünen-<br />
und Strandpfad (M3). Wir gehen dort aber nach rechts auf dem schmalen Weg weiter und<br />
biegen <strong>am</strong> nächsten Schild links in <strong>den</strong> Wald ab. (Foto 1) Der enge und verschlungene Pfad<br />
<strong>am</strong> nördlichen Dünenrand liegt in einem Waldabschnitt, der sich selbst überlassen bleibt. Ein<br />
wenig schaurig wird man erinnert an die „Legende vom Hukup“ (Huckupp, Springauf):<br />
Es soll ein hundeähnliches typisches <strong>Mardorf</strong>er Fabelwesen gewesen sein, dass Tier und<br />
Mensch von hinten im Nacken aufsaß und arg zusetzte. Besonders beim Torfstechen im<br />
unheimlichen Moor spielte manchem die Vorstellung dann oft einen bösen Streich.<br />
Hochmoor „<strong>Mardorf</strong>er Feld“ (Foto 2).<br />
Es wird wieder lichter und der Weg geht nun<br />
rechts ins Moor. Der Blick links und rechts<br />
fällt auf ehemalige Handtorfstiche und voraus<br />
auf das Hochmoor. Neben dem „Jägerstuhl“<br />
(jagdlicher Hochsitz – bitte nicht besteigen)<br />
haben wir einen weiten Ausblick auf das noch<br />
bis vor wenigen Jahren intensiv abgetorfte
Im Hintergrund <strong>am</strong> Rand der Sinke ist urwüchsiger Bruchwald. Die Wanderung folgt nun<br />
nach rechts über 1 km dem überwiegend dichtbewachsenen Moorrandweg (z. T. schwierig<br />
zu gehen – Foto 3):<br />
Vor 11.000 Jahren entstan<strong>den</strong> unabhängig vom Steinhuder Meer erste kleine Niedermoore<br />
(schwerer „Schwarztorf“) im Nordwesten von <strong>Mardorf</strong> aus verlandeten Seen. <strong>Sie</strong> haben<br />
Anschluss zum Grundwasser und sind eher nährstoffreich und weisen einen üppigen<br />
Pflanzenwuchs auf. Moore „wuchsen“ dort, wo längere Zeit ein Wasserüberschuss vorhan<strong>den</strong><br />
war. Die Hochmoore bildeten sich erst später vor 3.700 Jahren. <strong>Sie</strong> haben keine Verbindung<br />
zum Grundwasser und wer<strong>den</strong> durch Niederschlagswasser gespeist. Eine typische Eigenschaft<br />
ist ihr hoher Säuregehalt mit einem ph-Wert von 3-4, das ist so sauer wie Zitronensaft. Das<br />
Wasser ist außerdem nähr- und sauerstoffarm –<br />
fast ohne Bakterien. Abgestorbene Pflanzenteile<br />
wer<strong>den</strong> deshalb nicht durch Fäulnis abgebaut,<br />
sondern konserviert. D<strong>am</strong>it konnten abgestorbene<br />
Pflanzenteile im nassen Milieu nicht vollständig<br />
zersetzt wer<strong>den</strong> und es bildete sich Torf (leichter<br />
und hell). Die Ges<strong>am</strong>tausdehnung des Toten<br />
Moores mit 33 km² ist fast genauso groß wie die<br />
des Meeres. Es hat im <strong>Mardorf</strong>er Bereich eine<br />
Mächtigkeit von bis zu 8 m.<br />
Rechts des Weges ist Bruchwald mit kleinen<br />
ehemaligen „Handtorfstichen“. Auf der anderen Seite sollte man Abstand halten zum tiefen<br />
Entwässerungsgraben. Soweit der Blick reicht ist großflächiges maschinelles Frästorf-<br />
Abbaugebiet (Foto oben rechts). Die bei<strong>den</strong> Unternehmen haben noch bis 2019 (längstens<br />
2027) alte Rechte. Unterwegs gibt es jeweils rechts 2 kleine Wege, auf <strong>den</strong>en man zur<br />
Meerstraße hin abkürzen könnte. Am Zweiten entdeckt man die Reste des ehemaligen<br />
ersten <strong>Mardorf</strong>er „Schl<strong>am</strong>mpolders“ (Meerschl<strong>am</strong>mablagerung), das sich inzwischen zu<br />
einem besonders wertvollen Biotop entwickelt hat. Weiter geradeaus ebenfalls auf der<br />
rechten Seite befin<strong>den</strong> sich die ehemaligen „Steinhuder Torfteile“:<br />
Steinhude hatte sich in früheren Zeiten rund um das Steinhuder Meer solche Parzellen<br />
gesichert, um <strong>den</strong> heimischen Bedarf decken zu können. Der Torf wurde dann an der<br />
Moorhütte auf Kähne verla<strong>den</strong> und über das Meer nach Steinhude geschafft.
Die Moornutzung hat ohnehin eine lange Geschichte:<br />
Schon etwa 900 n. Chr. entnahmen Menschen aus <strong>den</strong> Mooren im Handtorfstichverfahren<br />
<strong>den</strong> Brenntorf. Im 17. und 18. Jahrhundert wur<strong>den</strong> Moore kultiviert, um landwirtschaftliche<br />
Nutzflächen daraus zu gewinnen. Voraussetzung war die Entwässerung. Dazu wur<strong>den</strong> tiefe<br />
Gräben und Drainagen angelegt. Der maschinelle (heute industrielle) Torfabbau begann ab<br />
1908 (Verträge z. T. noch bis 2027). Im Naturpark Steinhuder Meer wer<strong>den</strong> seit Jahren sehr<br />
erfolgreich Maßnahmen zur Hochmoor-Regeneration durchgeführt (möglich nur durch<br />
Wiedervernässung).<br />
Am Ende des langen Weges mit vielen schönen Ausblicken (Foto 3) hört man ggf. <strong>am</strong> östl.<br />
Weg das Motorengeräusch des etwas versteckt gelegenen Wasserhebewerkes. Das Wasser<br />
kommt aus einem weitverzweigten<br />
Grabennetz über <strong>den</strong> Hochmoorgraben (u.<br />
a. auch vom versiegen<strong>den</strong> Bannsee) hier<br />
an und wird hoch gepumpt. So bringt es<br />
zumindest dem Steinhuder Meer ein wenig<br />
Wasser zusätzlich.<br />
Wir biegen nach rechts ab, überqueren die<br />
vielbefahrene R347 Meerstraße /<br />
Moorstraße 12 und gehen geradeaus auf dem tiefer gelegenen Weg, entlang der<br />
Hubertusstraße <strong>am</strong> Beginn des „Vogeld<strong>am</strong>ms“ vorbei:
Dieser künstliche D<strong>am</strong>m ist Teil des Steinhuder Meer Rundwegs und verdankt seinen N<strong>am</strong>en<br />
<strong>den</strong> im 18.Jhd. zahlreichen „Vogelfängern“, die ihre „Ware“ auf diesem Weg zum königlichen<br />
Hof in Hannover brachten. Später war er wichtig für <strong>den</strong> Torf-Transport nach Steinhude.<br />
Über ihn erreicht man nach 800 m auch <strong>den</strong> „Moorerlebnispfad“ (7) mit interessanten<br />
Informationsmöglichkeiten (Erlebnissteg, Aussichtspunkt, Seerosenteich, Renaturierung). Ein<br />
Abstecher lohnt sich bestimmt!<br />
Vor uns liegt das Steinhuder Meer mit einem<br />
Aussichtsturm (Foto 4), von der man einen<br />
wundervollen Blick auf das Ostenmeer (NSG) mit<br />
vielen kleinen und großen Schilfinseln hat. In der Ferne<br />
ist die „Postboje“ (seit 25 Jahren einziger<br />
schwimmender Briefkasten in Deutschland) zu erkennen. Auf der Hubertusstraße vorbei an<br />
der Gastronomie mit öffentlichem WC:<br />
In einer kleinen Schutzhütte von 1930 wurde 1948 ein<br />
„Ausschank“ eingerichtet. Wegen der schon<br />
bestehen<strong>den</strong> benachbarten Moorhütte bek<strong>am</strong> er<br />
schnell <strong>den</strong> Zusatz: „Neue Moorhütte“! 1954 wurde<br />
daraus eine Gaststätte, die später um eine Pension<br />
erweitert wurde.<br />
Der Fußweg gegenüber des <strong>Parkplatz</strong>es führt direkt zum Ufer (Foto links) und dann rechts ab.<br />
Der neue hölzerne Verbindungssteg (Foto 5) zwischen <strong>den</strong> bei<strong>den</strong> Moorhütten geht auf<br />
Holzbohlen über <strong>den</strong> ufernahen Schilf-<br />
und Sumpfbereich. Mit etwas Glück<br />
können brütende Vögel und andere<br />
Tiere beobachtet wer<strong>den</strong>. Am westl.<br />
Ende des Steges kann man seine<br />
strapazierten Füße in einem<br />
„Moorschl<strong>am</strong>mbad“ entspannen. Ein<br />
weiterer interessanter Aussichtspunkt<br />
wird über eine Holzbrücke erreicht. An<br />
der kleinen Bucht (Foto 6) gibt eine aufwendige Infotafel Wissenswertes über Brutvögel und<br />
an der Brücke eine kleine Tafel Informationen zu <strong>den</strong> Moorhütten:
Die Gaststätte mit dem „Eichenbaum“ im Lokal entstand 1923 aus der ehemaligen<br />
„Torfstecher-Schutzhütte“ <strong>am</strong> „Fisklock“ (Fischloch) als „Ausschank“. Erst 1934 konnte eine<br />
Landverbindung zum Dorf hergestellt wer<strong>den</strong>. Bis dahin gab es nur einen Bootsverkehr<br />
zwischen dem „Landungssteg“ und Steinhude. 1950 k<strong>am</strong> dann endlich der Stromanschluss<br />
und nach 1970 wird beim Ausbau der Gastronomie die<br />
100jährige Eiche in das Gebäude integriert. Bis heute<br />
wächst sie gesund weiter.<br />
Am öffentlichen WC (Schlüssel in der Gastronomie)<br />
vorbei erreichen wir wieder <strong>den</strong> Ausgangspunkt <strong>am</strong><br />
<strong>Parkplatz</strong> <strong>Alte</strong> Moorhütte 11.