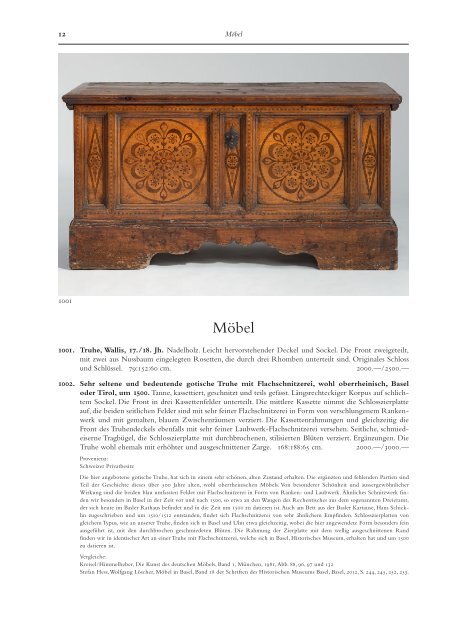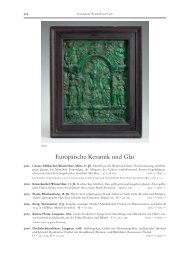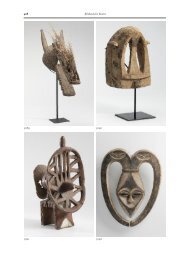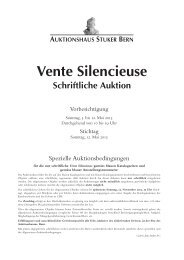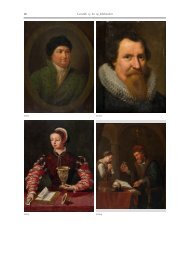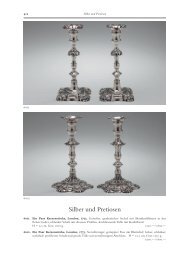Möbel und Einrichtungsgegenstände
Möbel und Einrichtungsgegenstände
Möbel und Einrichtungsgegenstände
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1001<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1001. Truhe, Wallis, 17./18. Jh. Nadelholz. Leicht hervorstehender Deckel <strong>und</strong> Sockel. Die Front zweigeteilt,<br />
mit zwei aus Nussbaum eingelegten Rosetten, die durch drei Rhomben unterteilt sind. Originales Schloss<br />
<strong>und</strong> Schlüssel. 79:152:60 cm. 2000.—/2500.—<br />
1002. Sehr seltene <strong>und</strong> bedeutende gotische Truhe mit Flachschnitzerei, wohl oberrheinisch, Basel<br />
oder Tirol, um 1500. Tanne, kassettiert, geschnitzt <strong>und</strong> teils gefasst. Längsrechteckiger Korpus auf schlichtem<br />
Sockel. Die Front in drei Kassettenfelder unterteilt. Die mittlere Kassette nimmt die Schlosszierplatte<br />
auf, die beiden seitlichen Felder sind mit sehr feiner Flachschnitzerei in Form von verschlungenem Rankenwerk<br />
<strong>und</strong> mit gemalten, blauen Zwischenräumen verziert. Die Kassettenrahmungen <strong>und</strong> gleichzeitig die<br />
Front des Truhendeckels ebenfalls mit sehr feiner Laubwerk-Flachschnitzerei versehen. Seitliche, schmiedeiserne<br />
Tragbügel, die Schlosszierplatte mit durchbrochenen, stilisierten Blüten verziert. Ergänzungen. Die<br />
Truhe wohl ehemals mit erhöhter <strong>und</strong> ausgeschnittener Zarge. 168:188:65 cm. 2000.—/3000.—<br />
Provenienz:<br />
Schweizer Privatbesitz<br />
Die hier angebotene gotische Truhe, hat sich in einem sehr schönen, alten Zustand erhalten. Die ergänzten <strong>und</strong> fehlenden Partien sind<br />
Teil der Geschichte dieses über 500 Jahre alten, wohl oberrheinischen <strong>Möbel</strong>s. Von besonderer Schönheit <strong>und</strong> aussergewöhnlicher<br />
Wirkung sind die beiden blau umfassten Felder mit Flachschnitzerei in Form von Ranken- <strong>und</strong> Laubwerk. Ähnliches Schnitzwerk finden<br />
wir besonders in Basel in der Zeit vor <strong>und</strong> nach 1500, so etwa an den Wangen des Rechentisches aus dem sogenannten Dreieramt,<br />
der sich heute im Basler Rathaus befindet <strong>und</strong> in die Zeit um 1500 zu datieren ist. Auch am Bett aus der Basler Kartause, Hans Schicklin<br />
zugeschrieben <strong>und</strong> um 1510/1512 entstanden, findet sich Flachschnitzerei von sehr ähnlichem Empfinden. Schlosszierplatten von<br />
gleichem Typus, wie an unserer Truhe, finden sich in Basel <strong>und</strong> Ulm etwa gleichzeitig, wobei die hier angewendete Form besonders fein<br />
ausgeführt ist, mit den durchbrochen geschmiedeten Blüten. Die Rahmung der Zierplatte mit dem wellig ausgeschnittenen Rand<br />
finden wir in identischer Art an einer Truhe mit Flachschnitzerei, welche sich in Basel, Historisches Museum, erhalten hat <strong>und</strong> um 1500<br />
zu datieren ist.<br />
Vergleiche:<br />
Kreisel/Himmelheber, Die Kunst des deutschen <strong>Möbel</strong>s, Band 1, München, 1981, Abb. 88, 96, 97 <strong>und</strong> 132<br />
Stefan Hess,Wolfgang Löscher, <strong>Möbel</strong> in Basel, Band 18 der Schriften des Historischen Museums Basel, Basel, 2012, S. 244, 245, 252, 253.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 13<br />
1002<br />
Register Seite 111–112
14<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1003<br />
1004<br />
1003. Sehr bedeutende <strong>und</strong> seltene Luzerner Truhe, 17. Jh., mit Allianz des Johann Ludwig Pfyffer<br />
(stirbt 1707) <strong>und</strong> der Maria Elisabeth Mutschlin (erwähnt 1698). Nussbaum, massiv, geschnitzt, gedrechselt<br />
<strong>und</strong> furniert. Rechteckiger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen. Zweischübiger Sockel. Die Front<br />
durch drei Dreiviertelsäulen unterteilt, kassettiert <strong>und</strong> mit sehr schöner Heraldik geschnitzt. Links das Männerwappen<br />
der adligen Pfyffer (Ringli-Pfyffer). Ebenfalls kassettierter Deckel, innen mit originalen, sehr<br />
reichen Beschlägen <strong>und</strong> Schloss. Seitliche Tragebügel. 86:125:65 cm. 12 000.—/15 000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus dem Besitze der Pfyffer von Altishofen,<br />
durch Erbfolge in ununterbrochenem Familienbesitz seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Die hier angebotene Truhe ist ein sehr schönes <strong>und</strong> reiches Beispiel einer prunkvollen Luzerner Truhe der Zeit der zweiten Hälfte des<br />
17. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> weist eine bedeutende <strong>und</strong> kostbar ausgeführte, heraldische Schnitzerei auf. Johann/Jost Ludwig Pfyffer, gest. 1703,<br />
wurde im Jahre 1691 Kleinrat, 1693 Vogt im Entlebuch <strong>und</strong> 1699 Vogt zu Willisau.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 15<br />
1005 1006<br />
1004. Sehr seltener <strong>und</strong> bedeutender Miniaturschrank, schweizerisch, datiert 1661. Nussbaum massiv,<br />
gedrechselt, geschnitzt <strong>und</strong> furniert. Längsformatiges Miniaturmöbel mit profiliertem Sockelgeschoss <strong>und</strong><br />
ebensolchem Kranz. Die Front sehr fein gegliedert, durch drei ionische Dreiviertel-Säulen. Zwischen den<br />
Säulen die reich verzierten <strong>und</strong> datierten Türen mit Muschelwerk <strong>und</strong> Schuppendekor, seitlich mit geometrischen<br />
Mustern. Das Innere mit zwei Tablaren. Originale Beschläge mit überaus feiner Gravur <strong>und</strong> alle<br />
verzinnt. 36,5:53:21 cm. 8000.—/12 000.—<br />
Miniaturmöbel von dieser Qualität <strong>und</strong> dazu noch datiert, wie der hier angebotene Miniaturschrank, sind von grösster Seltenheit. Unser<br />
Schrank hat sich in einem w<strong>und</strong>erbaren Originalzustand erhalten <strong>und</strong> erstrahlt in seiner alten Patina. Der Schöpfer dieses <strong>Möbel</strong>s dürfte<br />
wohl in einer Nordostschweizer Meisterwerkstatt gearbeitet haben. Solche Kleinmöbel wurden nicht nur, wie oft erwähnt, als Modellstücke<br />
vom Schreiner benutzt, sondern waren Auftragsarbeiten. In solchen Klein- <strong>und</strong> Ziermöbeln wurden Kostbarkeiten aufbewahrt<br />
<strong>und</strong> sie waren damals, wie auch heute noch, eigentliche Konversations-Stücke, über die man auch heute noch staunen mag.<br />
1005. Buffet, datiert 1789. Nussbaum. Horizontal dreigeteilter rechteckiger Korpus. Unterer Teil mit drei geschweiften<br />
Schubladen, mit seitlich je einer Türe. Darüber zweigeteiltes, offenes Fach mit drei kleinen<br />
Schubladen.Aufsatz mit vier Türen. Die Füllungen der Türen mit Kartuschen <strong>und</strong> Voluten beschnitzt.<br />
205:209:60 cm. 3000.—/4000.—<br />
1006. Schöne Mondsichelmadonna, bayrisch, Barock. Muttergottes, auf der Linken das Kind tragend, mit<br />
der Rechten das Szepter haltend. Holz, geschnitzt, ungefasst. Rückseitig gehöhlt. Minime Ergänzung <strong>und</strong><br />
Fehlstellen. H = 96 cm. 5000.—/6000.—<br />
1007. Schreibkommode, Norditalien, 2. Hälfte 18. Jh. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz mit Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaummaser<br />
furniert. Felder mit Rosenholz <strong>und</strong> Ahornfilets umrandet. Rechteckiger, vierschübiger, frontseitig<br />
leicht gebauchter <strong>und</strong> geschweifter Korpus, die oberste Schublade schmal. Sichtbare Traversen,<br />
geschweifte Zarge in Konsolenbeine übergehend.Aufsatz von drei Seiten geschweift. Darin symmetrisch angeordnet,<br />
vier Schubladen, mit zwei Geheimfächern. Schreibblatt <strong>und</strong> Front der Kommode mit ganzflächigem<br />
Medaillon eingelegt. 123:123:56. 3000.—/4000.—<br />
1008. Tischblatt von einem Spieltisch, Louis XVI, Bern. Atelier Christoph Hopfengärtner zuzuschreiben.<br />
Diverse heimische Hölzer. Rechteckiges Blatt. In der Mitte mit einem eingelegten Schachfeld, am<br />
Rand mit einem überaus feinen Hell-dunkel-Filet eingelegt.Verso mit grünem Filz. 87.5:58 cm.<br />
800.—/1200.—<br />
Register Seite 111–112
16<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1009<br />
1010<br />
1009. Kabinettmöbel, Renaissance, flämisch. Eiche mit schöner Patina. Rechteckiger, architektonisch aufgebauter<br />
Korpus mit hervorstehendem, profiliertem Kranz, darunter reich mit Akanthus-Flachschnitzereien<br />
verziert. Zwei Türen mit darüber weiteren zwei kleineren Türen, die durch einen durchgehenden, leicht<br />
hervorstehenden Sims unterteilt werden. Im Sockelbereich, der ebenfalls von einem Sims zum oberen Teil<br />
abgesetzt ist, zwei Schubladen, die von drei geschnitzten Löwenköpfen flankiert werden, mit darüber kannelierten<br />
Säulen. Die Kapitelle der oberen Säulen mit geschnitzten Engelsköpfen. Die Füllungen der Türen<br />
mit kartuschenartigen Flachschnitzereien verziert. 194:148:55 cm. 2000.—/3000.—<br />
1010. Venezianischer Spiegel, Stil Barock, 19. Jh. Rechteckiger Holzrahmen mit geschliffenem <strong>und</strong> verspiegeltem<br />
Glas belegt, mit Glasbändern <strong>und</strong> Rosetten verziert. 84:68 cm. 500.—/800.—<br />
1111. Ein Paar sehr schöne Leuchterengel, wohl Siena, 2. Hälfte 16. Jh. Holz, geschnitzt, polychrom gefasst<br />
<strong>und</strong> teilvergoldet. H = je 60 cm. 4000.—/6000.—<br />
1012. Vitrinenschrank, Barock, Bern um 1770. Mahagoni. Zweitüriger, rechteckiger Korpus, abger<strong>und</strong>ete<br />
Kanten, auf gedrückten Kugelfüssen (ergänzt), geschweifter Kranz mit zentralem Muschelmedaillon. Profilierte<br />
Türen mit jeweils sechsfach unterteilten, geschweiften Gläsern. 235:142:50 cm. 3000.—/4000.—<br />
Aus Berner Patrizierbesitz, ehemals Schloss Gerzensee.<br />
1013. Grosser Schrank, Barock. Holz, hellgrau gefasst. Grosser symmetrisch angeordneter Schrank, mit hervorstehendem<br />
Mittelteil <strong>und</strong> zwei zentralen Türen, seitlich mit je einer Türe nach hinten versetzt. Die vertikalen<br />
Ecken abger<strong>und</strong>et, geschweifter Aufsatz. 235:240:40 cm. 1500.—/2000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 17<br />
1011<br />
Register Seite 111–112
18<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1014<br />
1015<br />
1014. Bedeutende Eisen-Soldtruhe oder Dokumentenkassette, Zentralschweiz, 17. Jh. Äusserst seltene<br />
r<strong>und</strong>e, fassförmige <strong>und</strong> schwarz/rot gefasste Eisentruhe mit 5 horizontalen <strong>und</strong> 8 vertikalen übereinander<br />
geschlagenen Eisenbändern. Die breiten geschmiedeten Eisenriemenbänder sind mit Nieten auf den Truhenkörper<br />
zur Verstärkung aufgenietet. Die r<strong>und</strong>e Standfläche sowie der r<strong>und</strong>e Truhendeckel werden durch<br />
zwei im Kreuz übereinandergeschlagene Eisenbänder verstärkt. Im r<strong>und</strong>en Truhendeckel ist ein sehr seltenes<br />
<strong>und</strong> interessantes Scharnierschloss mit 6 schliessenden Riegeln <strong>und</strong> drei fixen Blockriegeln eingebaut.<br />
Durch das Öffnen des Vexierverschlusses auf der Deckeloberseite, wird das verborgene Schlüsselloch freigegeben.<br />
Mit dem passenden Holdornschlüssel können die 6 beweglichen Schlossriegel zurückgezogen<br />
werden <strong>und</strong> so der Truhendeckel abgehoben, die Dokumentetruhe geöffnet werden. Die r<strong>und</strong>e Schlossabdeckplatte<br />
ist türkisblau bemalt <strong>und</strong> fein graviert <strong>und</strong> mit getriebenen Rocaillen verziert.<br />
H = 69,5 cm, D = 33 cm. 10 000.—/15 000.—<br />
Aus altem Luzerner Besitz.<br />
R<strong>und</strong>e Eisen-Soldtruhen oder auch r<strong>und</strong>e Dokumententruhen genannt sind von grösster Seltenheit <strong>und</strong> wurden nur im 16./17. Jh. angefertigt.<br />
Im Vergleich zu den recht häufig vorkommenden rechteckigen Eisen-Soldtruhen zeichnen sich die r<strong>und</strong>en Truhen durch<br />
einen sehr komplexen äusserst präzisen Schliessmechanismus aus. Es sind nur sehr wenige fassförmige Truhen bekannt.Vgl. dazu:Truhen<br />
<strong>und</strong> Kassetten aus Privatbesitz, Museum Burg Zug 1992, Abbildung 31, Seite 53. Weitere fassförmige Eisen-Soldtruhen befinden sich<br />
unter anderem in: Süddeutsches Schatztruhen Museum in Geisslingen <strong>und</strong> in der Hanns Schell Collection in Graz.<br />
1015. Sehr feiner <strong>und</strong> kleiner Barockschrank, Niederrhein, 17. Jh. Eiche massiv, geschnitzt <strong>und</strong> mit Mooreiche<br />
<strong>und</strong> Ebenholz appliziert. Zweitüriger, hochformatiger Korpus auf erhöhten, gedrückten Kugelfüssen.<br />
Der profilierte <strong>und</strong> ausstehende Kranz mit zentralem Früchtekorb, aus welchem sich Fruchtzweige über den<br />
ganzen Fries des <strong>Möbel</strong>s ziehen. Zwei Türen mit Bogenkassetten <strong>und</strong> Früchteschnitzerei. Die Türen gegliedert<br />
durch angedeutete Balustersäulen mit eingelegten Kannelüren. Der Sockel durchbrochen geschnitzt<br />
<strong>und</strong> sehr fein gegliedert. 166:130:49 cm. 2000.—/3000.—<br />
Der hier angebotene Schrank ist mit seinen kleinen Ausmassen ein besonders schönes Beispiel der frühen Schrankmöbel, wie wir sie in<br />
Holland <strong>und</strong> Norddeutschland im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert vorfinden. Schränke dieses Typus, mit den bogenförmig abschliessenden Türkassetten<br />
<strong>und</strong> den Auflagen <strong>und</strong> Einlagen in Ebenholz, bzw. Mooreiche, finden sich um die Mitte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts u.a. auch in Gemälden von<br />
Interieurszenen eines Pieter de Hooch.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 19<br />
1016<br />
1016. Eisen-Soldtruhe oder Dokumentenkassette, Zentralschweiz, 17. Jh. Äusserst seltene r<strong>und</strong>e, fassförmige<br />
<strong>und</strong> schwarz gefasste Eisentruhe mit 5 horizontalen <strong>und</strong> 6 vertikalen übereinandergeschlagenen<br />
Eisenbändern. Die breiten geschmiedeten Eisenriemenbänder sind mit Nieten auf den Truhenkörper zur<br />
Verstärkung aufgenietet. Die r<strong>und</strong>e Standfläche sowie der r<strong>und</strong>e Truhendeckel werden durch zwei im Kreuz<br />
übereinandergeschlagene Eisenbänder in je vier Felder unterteilt. Auf dem Truhendeckel sind zusätzlich in<br />
jedem Feld eine bewegliche, r<strong>und</strong>e <strong>und</strong> durchbrochen gearbeitete Zierrosette mit einer Kugelkopfniete aufgenietet.<br />
Durch Drehen der einzelnen Zierrosetten kann die Öffnung des Vexierverschluss freigelegt werden.<br />
Durch das Öffnen des Vexierverschlusses auf der Deckeloberseite, wird das verborgene Schlüsselloch<br />
unter der drehbaren Schlüsselloch-Abdeckplatte freigegeben. Im r<strong>und</strong>en Truhendeckel ist ein interessantes<br />
Scharnierschloss mit 3 schliessenden Riegeln <strong>und</strong> einem fixen Blockriegel eingebaut. Mit dem originalen<br />
Holdornschlüssel können die 3 beweglichen Schlossriegel zurückgezogen werden, <strong>und</strong> so der Truhendeckel<br />
abgehoben, die Dokumentetruhe geöffnet werden. Die r<strong>und</strong>e Schlossabdeckplatte schützt das Schlosssystem<br />
vor demVersperren oder Blockieren durch in der Truhe liegende Gegenstände.<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Schweizer Besitz<br />
Vgl. Fussnotiz, Los-Nr. 1014.<br />
H = 71 cm, D = 32 cm.<br />
10 000.—/15 000.—<br />
Register Seite 111–112
20<br />
<strong>Möbel</strong><br />
DER BAROCKE PRUNKTISCH DES WALLISER BILDHAUERS JOHANN RITZ (1668–1720)<br />
1017<br />
1018<br />
1018<br />
1017. Hochbedeutender <strong>und</strong> einzigartiger Prunktisch,<br />
Wallis, 1. Viertel 18. Jh., signiert von<br />
Bildhauer Johann Ritz von Selkingen (1668–<br />
1720) <strong>und</strong> datiert 1717. Nussbaum, massiv, geschnitzt<br />
<strong>und</strong> gedrechselt. Rechteckiges, ausziehbares<br />
<strong>und</strong> vorstehendes Blatt über überaus reich<br />
mit Ranken- <strong>und</strong> Laubwerk geschnitzter <strong>und</strong><br />
vom Meister Johann Ritz signierter Zarge. Vier<br />
massive, fein gedrechselte Balusterbeine mit umlaufendem,<br />
originalem Steg. Originale Beschläge<br />
<strong>und</strong> Scharniere. Beigegeben sechs passende Stühle<br />
mit braunem Lederbezug. 80:177:105 cm, die<br />
beiden seitlichen Auszüge je 77 cm.<br />
2000.—/3000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Schweizer Privatbesitz<br />
Der hier angebotene prunkvolle Esstisch, gehört zu den bedeutendsten<br />
Werken der Walliser <strong>Möbel</strong>kunst <strong>und</strong> ist von allergrösster<br />
Seltenheit. Johann Ritz, der Bildhauer, der diesen<br />
gewaltigen Tisch geschaffen <strong>und</strong> ihn mit feinster Laubwerkschnitzerei<br />
verziert hat, war ein Spross einer weitverzweigten<br />
Familie von Bildschnitzer <strong>und</strong> Künstler im Wallis. Von seinen<br />
Söhnen trat der ältere, Johann Jodok Ritz (geb. 1697) in die<br />
Fussstapfen seines Vaters <strong>und</strong> wurde Bildhauer <strong>und</strong> Maler. Sein<br />
jüngerer, 1706 geborene Sohn Garinus wurde Doktor der<br />
Theologie, Dekan von Münster <strong>und</strong> Verfasser mehrerer Volksschauspiele.<br />
Wie sein Bruder <strong>und</strong>Vater widmete sich aber auch<br />
er der Bildhauerei <strong>und</strong> erreichte in dieser Kunst grosses Ansehen.<br />
Dass sich der Vater dieser grossen Dynastie von Kunsthandwerker<br />
an einem so bedeutenden <strong>Möbel</strong> mit seiner<br />
Signatur <strong>und</strong> Berufsbezeichnung verewigt, das ist ein unermesslicher<br />
Glücksfall. Die Qualität der Schnitzarbeit zeugt<br />
vom grossen künstlerischen Talent des Johann Ritz.<br />
1018. Sehr schöner heraldischer Armlehnstuhl,<br />
Schweiz, Unterwalden, von barocker Form,<br />
mit den geschnitzten Wappen der Patrizier Familien<br />
Christen <strong>und</strong> von Wittenbach. Nussbaum<br />
<strong>und</strong> Buche, massiv <strong>und</strong> reich geschnitzt. Rechteckiger<br />
Sitz über wellig ausgeschnittener <strong>und</strong> mit<br />
Voluten verzierter Zarge <strong>und</strong> vier Pfostenbeinen<br />
mit Schuppendekor <strong>und</strong> umlaufendem Steg. Die<br />
Armstützen geschweift <strong>und</strong> gerollt abschliessend,<br />
Die Rückenlehne gepolstert <strong>und</strong> mit überaus<br />
reichem Abschluss, darin, inmitten von Blüten<br />
<strong>und</strong> Rollwerk, das Allianzwappen der Christen<br />
<strong>und</strong> von Wittenbach. 2000.—/2500.—<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Schwyzer Familienbesitz<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 21<br />
1017<br />
Register Seite 111–112
22<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1019 1020<br />
1019. Sehr feiner <strong>und</strong> schöner, dreigeschossiger Kassettenschrank, Holland, 1. Hälfte 17. Jh. Eiche <strong>und</strong><br />
Ebenholz, massiv <strong>und</strong> furniert. Hochformatiger Korpus auf gedrückten <strong>und</strong> gedrechselten Kugelfüssen. Die<br />
Front sehr fein <strong>und</strong> architektonisch gegliedert. Der Unterbau mit zwei grösseren Türen, der Aufsatz mit<br />
kleineren Türen <strong>und</strong> erhöhtem, von Engelsköpfen gestütztem Kranzgeschoss. Profilierter Sockel <strong>und</strong> vorstehender,<br />
ebenfalls profilierter Kranz. Zwischen den Geschossen mit sehr feiner Schnitzerei in Form von<br />
stilisiertem Blattwerk <strong>und</strong> grotesken Masken. Sehr fein mit Kassettenfüllungen verzierte Schauseiten. Innerhalb<br />
der Kassetten mit Ebenholzfeldern. 210:170:66 cm. 3000.—/4000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Privatbesitz<br />
Der hier angebotene, dreigeschossige Schrank hat sich in seinem sehr schönen, alten Zustand, mit unverdorbener Patina <strong>und</strong> dunklem<br />
Eichenglanz, erhalten. Es ist ein besonders schönes Beispiel der schlichten aber hocheleganten <strong>Möbel</strong>, die in Holland in der ersten Hälfte<br />
des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts entstanden sind. In der gleichen Zeit wie unser Schrank, entstand ein Kinderbett, Holland, circa 1620–1650, welches<br />
sich in den Sammlungen des Rijksmuseum in Amsterdam erhalten hat (Inv. K.O.G. 1810). Das erwähnte Kinderbett weist die gleiche Art<br />
der Kassettierung auf, wie wir sie an unserem Schrankmöbel finden, mit Ebenholzfeldern im Zentrum <strong>und</strong> fein profilierten Rahmungen<br />
in Eichenholz.<br />
1020. Grosser <strong>und</strong> bedeutender Deckenleuchter, Stil Barock, Holland, circa 1850. Bronze <strong>und</strong> Messing.<br />
R<strong>und</strong>er balusterförmiger Schaft mit 20 Armen auf drei Ebenen verteilt. Unten acht <strong>und</strong> auf den oberen<br />
zwei, je sechs Arme, reich geschmückt mit reflektierenden Rosetten <strong>und</strong> abschliessenem Doppeladler.<br />
140:105 cm. 5000.—/7000.—<br />
1021. Oak dresser, englisch, 17. Jh. Eiche. Rechteckiger, langgezogener Korpus mit einer Schublade, reich beschnitzte<br />
Front, auf gedrechselten Balusterfüssen. 79:124:50 cm. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 23<br />
1021<br />
1023 1022<br />
1022. Räderuhr, süddeutsch, um 1520. Eisen.Vier schmale Pfeiler tragen den Glockenstuhl mit zwei Glocken.<br />
An der Vorderseite bemaltes Eisenblech mit Anzeige der Mondphase, darunter Ziffernring mit einem<br />
Zeiger. Werk Eisen mit Spindelhemmung <strong>und</strong> Radunrast. Schlossscheibenschlagwerk. 4 ⁄4-St<strong>und</strong>enschlag auf<br />
die obere Glocke, St<strong>und</strong>enschlag auf die untere Glocke. Restauriert <strong>und</strong> revidiert. H = 52 cm.<br />
6000.—/8000.—<br />
1023. Ungewöhnliches Zierkabinett, England, circa 1600 <strong>und</strong> später. Eiche, Nussbaum,Ahorn <strong>und</strong> Fruchthölzer,<br />
massiv <strong>und</strong> furniert. Längsformatiger Korpus mit gedrechselten Säulen. Überaus reich geschnitzter,<br />
zweitüriger Unterbau mit niedrigem Sockel <strong>und</strong> umlaufendem Rankenwerk mit Trauben. Die Türfüllungen<br />
mit figürlichen <strong>und</strong> floralen Darstellungen. Leicht zurückversetzter Aufsatz mit vier kassettierten Türchen,<br />
darin sehr fein eingelegte Blumensträusse. Von zwei Balustern gestützter Kranz, darin Schnitzwerk von<br />
Zopfband <strong>und</strong> Rosetten. Die Schmalseiten wiederum kassettiert <strong>und</strong> geschnitzt. Sehr schöne Patina, alte Ergänzungen.<br />
141:193:55,5 cm. 1000.—/1500.—<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Schweizer Privatbesitz<br />
Das hier angebotene überaus fein <strong>und</strong> reich eingelegte <strong>und</strong> geschnitzte <strong>Möbel</strong> entspricht einem Typus, wie man ihn in England in der<br />
Regierungszeit Jacob I. (regiert 1603–1626) <strong>und</strong> auch später im 17. Jh. noch antrifft. Das <strong>Möbel</strong> zeigt eine sehr schöne, tiefe Kerbschnitzerei,<br />
wie sie besonders auch an den reichen Baldachin-Betten dieser Zeit üblich waren. Von grossem Reiz sind die sehr feinen Einlegearbeiten<br />
an den Türen des Aufbaus. Wenn auch von rustikaler Art, die dem ganzen <strong>Möbel</strong> gegeben ist, so sind diese doch von grossem<br />
Charme <strong>und</strong> zeugen vom grossen Können des Schreiners. Die geometrischen Einlagen unterhalb des Abschlusses <strong>und</strong> zwischen den<br />
Türchen finden sich in dieser Zeit <strong>und</strong> um 1580/90 an bedeutenden Schau-<strong>Möbel</strong>n, den sogen. Court Cupboards.Wenn auch das hier<br />
angebotene <strong>Möbel</strong> einige schreinerische Ergänzungen erfahren hat, so ist es doch ein ungewöhnlich reizvolles Kabinettmöbel.<br />
Vergleiche:<br />
Ralph Edwards, English Furniture, England 1972, S. 295, Abb. 5, S. 296 <strong>und</strong> S. 297, Abb. 8, 9 <strong>und</strong> 11.<br />
Register Seite 111–112
24<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1024. Grosser Schrank, Barock, Ostschweiz. Zweitüriger<br />
Korpus durch drei Halbsäulen unterteilt.<br />
Nadelholz mit verschiedenen einheimischen Hölzern,<br />
Nussbaum, Eiche, Ahorn <strong>und</strong> Zwetschge<br />
furniert, eingelegt <strong>und</strong> zum Teil massiv verarbeitet.<br />
Ziselierte Beschläge, das Innere durch vier<br />
durchgehende Tablare unterteilt.<br />
215:196:70 cm. 2000.—/3000.—<br />
1025. Schrank, Renaissance, wohl Schaffhausen,<br />
1666. Nussbaum, zum Teil auf Nadelholz. Zweitüriger<br />
rechteckiger Korpus auf gedrückten<br />
Kugelfüssen <strong>und</strong> leicht ausladendem, profiliertem<br />
Kranz mit der Jahreszahl 1666. Der Sockel wird<br />
durch einen Sims zum obern Teil abgesetzt <strong>und</strong><br />
die Türen wiederum, werden von drei Säulen unterteilt.<br />
Über den Füllungen der Türen sind jeweils<br />
geschnitzte Grotesken angebracht.<br />
240:184:59 cm. 2800.—/3500.—<br />
1024<br />
1026. Nischenbuffet, Barock, Zentralschweiz,<br />
17. Jh. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, profiliert <strong>und</strong><br />
beschnitzt. Rechteckiger zweigeteilter Korpus<br />
mit durchgehendem, profiliertem, ausladendem<br />
Kranz auf gedrückten Kugelfüssen. Der linke Teil<br />
mit einem offenen Fach, darin Zinnfass <strong>und</strong><br />
Kupferschale, darunter <strong>und</strong> darüber je ein Fach<br />
mit Türe. Der rechte Teil mit einem zweitürigen<br />
Halbschrank, unten <strong>und</strong> oben ebenfalls mit je<br />
einem offenen Fach zwei weitere Türchen.<br />
204:193:40 cm. 3000.—/4000.—<br />
1025<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 25<br />
1026<br />
Register Seite 111–112
26<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1027 1028<br />
1027. Zwei sehr feine Armlehnstühle, Spanien,<br />
17. Jh. Nussbaum mit grünem Bezug. Rechteckiges<br />
Gestell mit leicht geschweiften Armlehnen.<br />
1000.—/1500.—<br />
1028. Refektoriumstisch, Barock, Wallis. Nussbaum.<br />
Rechteckiger Auszugstisch (zwei Auszüge<br />
zu 80 cm) mit breiter Zarge, seitlich je eine<br />
Schublade, gedrechselte Beine, die durch einen<br />
Steg verb<strong>und</strong>en werden. Auszüge mit geschmiedeten<br />
Arretierungen.<br />
76:190 (ausgezogen 350):59 cm.<br />
2000.—/2500.—<br />
1029<br />
1029. Schiefertisch, 19. Jh. Nussbaum. Rechteckiges<br />
Blatt mit Schiefereinlage, umrandet mit breitem<br />
Wurzelmaserrand <strong>und</strong> Filets. Darunter eine breite<br />
Zarge mit einer Schublade. Gedrechselte, schräg<br />
gestellte Beine die durch einen X-Steg verb<strong>und</strong>en<br />
sind. 75:124:99 cm. 1500.—/2000.—<br />
1030. Christuskind, Barock, Österreich. Holz, geschnitzt<br />
<strong>und</strong> polychrom gefasst. H = 54 cm.<br />
1000.—/1500.—<br />
1032<br />
1031. Kleiner Tisch <strong>und</strong> zwei Stühle, England,<br />
17/18. Jh. Eiche. Rechteckiges, von drei Seiten<br />
profiliertes Blatt, Zarge mit einer Schublade, gedrechselte<br />
Beine mit umlaufendem Steg. Dazu:<br />
Zwei Stühle, Louis XIII, Nussbaum.<br />
72:77:46,5 cm. 600.—/800.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 27<br />
1031<br />
1032. Wandbehang, Nordschweiz, 16. Jh. Wollwirkerei.<br />
Mehrfigurige Szenerie vor Architektur, Reben<br />
<strong>und</strong> Sträuchern. Oben Schriftbänder <strong>und</strong> Wappen.<br />
Leicht schadhaft. 76:105 cm.<br />
3500.—/4500.—<br />
1033. Wandbehang, schweizerisch, 16. Jh. Mehrfiguriger<br />
Zyklus mit höfischen Szenen. 51:236 cm.<br />
2800.—/3400.—<br />
1034. Armlehnstuhl, Louis XIV, Schweiz. Nussbaum. Gedrechselte Beine mit Kreuzsteg, geschweifte Armlehnen.<br />
Grün-gelber Bezug. 500.—/700.—<br />
1035. Schrank, Barock, Waadtland. Nussbaum, zum Teil mit Wurzelmaser furniert. Zweitüriger rechteckiger<br />
Schrank, mit hervorstehendem, profiliertem Sims <strong>und</strong> Sockel, auf gedrückten Kugelfüssen. Die Türen reich<br />
profiliert <strong>und</strong> im Mittelfeld mit Windrosen eingelegt. Im Innern, Ablagen <strong>und</strong> Schubladenkorpus mit vier<br />
Schubladen. Schloss ersetzt. 212:150:50 cm. 1500.—/2000.—<br />
1036. Schrank, Louis XV, schweizerisch. Kirschbaum <strong>und</strong> Nadelholz, zum Teil mit Nussbaummaser gespiegelt<br />
furniert. Rechteckiger zweitüriger Kasten, unten mit zwei Schubladen. Geschweifte Zarge in Konsolenfüsse<br />
übergehend. 201:160:54 cm. 3000.—/4000.—<br />
1034<br />
1033<br />
Register Seite 111–112
28<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Kabinett in der Stiftung Ricardo do Espirito Santo Silva, Lissabon 1037<br />
1037. Sehr feines <strong>und</strong> seltenes Barock-Zierkabinett, Portugal, 2. Hälfte 17. Jh. Palisander <strong>und</strong> ebenisierte<br />
Hölzer massiv, gedrechselt <strong>und</strong> furniert. Längsformatiges Kabinett mit vier Schubladenrängen. Die oberen<br />
beiden Ränge mit jeweils vier nebeneinanderliegenden Schüben. Die unteren beiden Ränge angedeutet<br />
<strong>und</strong> mit zwei seitlichen, übereinanderliegenden Doppelschubladen, welche ein Hauptfach flankieren, dessen<br />
Schauseite aus vier Schubladenfronten gefügt ist. Profilierter <strong>und</strong> vorstehender Kranz <strong>und</strong> ebensolcher<br />
Sockel. Die Schmalseiten kassettiert. Die ganze Front <strong>und</strong> Teile der Schmalseiten mit sehr reichem <strong>und</strong><br />
feinem Flammen- <strong>und</strong> Wellenband verziert. Filigran durchbrochene <strong>und</strong> vergoldete Messing-Zierbeschläge<br />
in Form von Rosetten, stilisiertem Blattwerk <strong>und</strong> Herzmotiven. Seitliche Tragegriffe in gew<strong>und</strong>enem Messingguss,<br />
auf Zierplatte montiert. Diese mit zentralem Sonnenmotiv <strong>und</strong> Rankenwerk in durchbrochener<br />
Arbeit. Der überaus fein gedrechselte Unterbau in massivem Rio-Palisander (Dalbergia nigra).Vier sich nach<br />
unten verjüngend gedrechselte Balusterbeine werden von einem ebenfalls fein gedrechselten, umlaufenden<br />
Steg verb<strong>und</strong>en. Messing-Zierappliken <strong>und</strong> Schrauben, vergoldet. Die Zargenschürze mit gedrechselten<br />
Türmchen <strong>und</strong> geschnitztem Rankenwerk. 146:114:55 cm. 15 000.—/25 000.—<br />
Provenienz:<br />
Alter Schweizer Privatbesitz<br />
Das hier angebotene, überaus feine <strong>und</strong> unverdorbene Zierkabinett ist eines der schönsten Beispiele einer kleinen Gruppe von ähnlichen<br />
portugiesischen Kabinettmöbeln, welche sich aus der Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts erhalten haben. Es ist in diesem<br />
Kabinett <strong>und</strong> sicher in einem vergleichbaren Kabinett aus der Stiftung Ricardo do Espirito Santo Silva, Lissabon, in dem man den<br />
eigentlichen «portugiesischen Nationalstil» erkennt. Diese elegante <strong>und</strong> ausgewogene Architektur verleiht dem <strong>Möbel</strong> eine Würde <strong>und</strong><br />
wirkt grossartig, ohne dass das <strong>Möbel</strong> selbst von grossen Ausmassen sein müsste. Die flächige Verzierung mit den reichen Flammenleisten<br />
<strong>und</strong> die sehr schöne Drechselarbeit sind sehr typisch für die Zeit um 1670/1680. Die beinahe verschwenderische Verwendung des wertvollen<br />
Palisanderholzes für die Drechslerarbeit des Kabinett-Unterbaus, erinnert an den Reichtum des portugiesischen Kolonialreiches.<br />
Die Dalbergia nigra, als Rio-Palisander bekannt, in England auch Rosewood genannt, wurde von den Portugiesen aus Brasilien importiert<br />
<strong>und</strong> fand im Luxusmöbelbau der reichen Nation <strong>und</strong> in anderen Ländern des Kontinents beliebte Verwendung. Brasilien als Exporteur<br />
der schönsten Edelhölzer, wurde im Jahre 1500 durch den portugiesischen Seefahrer Pedro Alvares Cabral für die Krone Portugals,<br />
gemäss dem 1494 geschlossenenVertrag von Tordesillas mit Kastilien, in Besitz genommen. Brasilien, das man zunächst für eine Insel hielt<br />
<strong>und</strong> Ilha da Vera Cruz, später Terra da Vera Cruze nannte, wuchs zur reichsten <strong>und</strong> grössten Kolonie Portugals heran <strong>und</strong> blieb dem<br />
Lande bis 1822 erhalten.<br />
Vergleiche:<br />
Sammlungskatalog der F<strong>und</strong>açao Ricardo do Espirito Santo Silva, Lissabon, 1995,<br />
S. 57 für das erwähnte Zierkabinett, welches, dem hier angebotenen sehr verwandt ist.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 29<br />
1037<br />
Register Seite 111–112
30<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1040<br />
1038 1039<br />
1038. Vitrine, Barock, Veneto, 1. Hälfte 18. Jh. Holz, gefasst <strong>und</strong> vergoldet.Trapezförmiger Gr<strong>und</strong>riss mit ausladenden<br />
Füssen, die mit geschnitzten Muschelornamenten verziert sind. Abgeschrägte verglaste Eckstollen,<br />
die Seiten sowie die Front ebenfalls verglast. «En chapeau» geschweifter Sims mit vergoldeten Schnitzereien.<br />
94:65:40 cm. 2000.—/2500.—<br />
1039. Ein Paar Lautenengel in Halbrelief-Schnitzerei, (wohl 17. Jh.). Holz, geschnitzt <strong>und</strong> mit Resten von<br />
originaler Fassung <strong>und</strong>Vergoldung. In Rahmen montiert. H=37 cm. 1000.—/1500.—<br />
1040. Ein Paar Altarsäulen, Renaissance, wohl Spanien. 1000.—/1500.—<br />
1041. Schreibkommode mit Vitrinenaufsatz, Biedermeier, schweizerisch. Kirschbaum. Dreischübiger,<br />
rechteckiger Korpus auf Pyramidenbeinen, schräges, herunterklappbares Schreibfach mit zehn symmetrisch<br />
angeordneten Schubladen.Aufsatz mit zwei verglasten Türen. 204:101:48 cm. 1400.—/1800.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 31<br />
1042 1043<br />
1042. Drop-leaf-table, 18. Jh. Eiche. Rechteckiges<br />
Blatt mit zwei aufklappbaren halbr<strong>und</strong>en Verlängerungen.<br />
Gedrechselte Beine, die durch einen<br />
umlaufenden Steg verb<strong>und</strong>en sind, sowie zwei<br />
ausklappbare Beine <strong>und</strong> eine Schublade.<br />
71:92:38 cm. 1000.—/1500.—<br />
1043. Oak dresser, England, 18. Jh. Eiche. Rechteckiger<br />
Korpus mit hervorstehendem, profiliertem<br />
Blatt <strong>und</strong> Zarge, mit drei nebeneinander liegenden<br />
Schubladen, auf gedrechselten Beinen.<br />
Die Felder der Schubladen zweigeteilt.<br />
80:215:54 cm. 3000.—/4000.—<br />
1042<br />
1044. Kommode, Barock, wohl Südfrankreich.<br />
Nussbaum. Rechteckiger, zweischübiger Korpus,<br />
die Front doppelt geschweift, in der Mitte zurückversetzt<br />
<strong>und</strong> beschnitzt. Die Schubladen zum<br />
Teil mit Ahorn <strong>und</strong> Nussbaum eingelegt.Vergoldete<br />
Bronzebeschläge. 82:135:64 cm.<br />
2000.—/2500.—<br />
1045. Vitrine, Transition, Louis XV/XVI, Frankreich.<br />
Palisander <strong>und</strong> Rosenholz gefriest, auf<br />
Eiche gespiegelt furniert. Rechteckiger Korpus<br />
auf geschweiften Beinen <strong>und</strong> Zarge. Dreiseitig<br />
verglast mit drei Tablaren. Bronzebeschläge. Rotbraune<br />
Marmorabdeckung. Furnierschäden.<br />
150:62:31 cm. 1200.—/1500.—<br />
1044<br />
1046. Halbschrank/Semainier, Biedermeier, Bern.<br />
Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger,<br />
zweitüriger Korpus auf Pyramidenfüssen. Innen<br />
mit sieben Schubladen. 140:113:53 cm.<br />
1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
32<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Münzschrank, Leipzig, 1724.<br />
Kirche St. Martin, Baar.<br />
1047. Sehr seltener <strong>und</strong> aussergewöhnlicher Sakristeischrank aus Baar, wohl einer Zuger Werkstatt der<br />
Zeit um 1740–50 zuzuschreiben. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Längsformatiger, zweigeschossiger<br />
Vitrinenschrank mit abgesetzter Front, erhöhtem Sockelgeschoss <strong>und</strong> gewulsteten, kantigen Füssen. Schauseitig<br />
verglast <strong>und</strong> mit Vitrinentüren versehen. Im Sockel mit breiten Schüben <strong>und</strong> Geheimschubladen im<br />
untersten Sockelbereich. Mehrfach profilierter, umlaufender Rand als Begrenzung der beiden Geschosshälften.<br />
Der Aufsatz mit bogenförmigem Abschluss <strong>und</strong> gekehltem <strong>und</strong> profiliertem Kranz. Gebrauchsanpassungen<br />
<strong>und</strong> spätere Beschläge. 220:280:65 cm. 10 000.—/15 000.—<br />
Das hier angebotene, seltene <strong>und</strong> ungewöhnliche Sakristeimöbel stammt aus dem Besitze des katholischen Pfarramtes – wohl der Kirchgemeinde<br />
St. Martin – in Baar <strong>und</strong> dürfte in die Zeit um 1760 zu datieren sein. In seinem Aufbau <strong>und</strong> feiner Ausführung ist es ein<br />
Unikat <strong>und</strong> erinnert an die zeitgleichen <strong>Möbel</strong> des wenig entfernten, protestantischen Zürichs. In ihrem Buch zum Zürcher <strong>Möbel</strong> des<br />
18. Jahrh<strong>und</strong>erts, bilden Thomas Boller <strong>und</strong> Werner Dubno eine Schreibkommode mit Vitrinenaufsatz, Zürich um 1750 ab, welche in<br />
ihrem Aufsatz den oberen, vorstehenden Mittelteil unseres Sakristeimöbels aufnimmt. Die mittleren Vitrinentüren des Aufsatzes am<br />
Sakristeischrank <strong>und</strong> der Aufbau des Kranzabschlusses sind identisch mit dem Vitrinenaufsatz des Zürcher <strong>Möbel</strong>s aus altem Privatbesitz.<br />
Eine Zuweisung des hier angebotenen <strong>Möbel</strong>s nach Zürich ist allerdings unwahrscheinlich, entspricht es doch einem dort völlig unbekannten<br />
Typus.Viel eher dürfte hier auch der Zürcher <strong>Möbel</strong>bau ganz allgemein Einfluss auf einen uns unbekannten Zuger Meister<br />
gehabt haben. Möglicherweise aber nicht nur ein Zürcherischer Einfluss, denn nicht auszuschliessen ist es, dass der Meister dieses bedeutenden<br />
Kabinettmöbels einen ähnlichen Schauschrank auf seiner Wanderschaft besichtigt oder aus einer Werkstatt gekannt hat.Wir bilden<br />
hier, zum interessanten Vergleich, einen Münzschrank aus der Stadtbibliothek in Leipzig ab, welcher 1724 datiert werden kann. Der<br />
Münschrank in Leipzig ist, ebenso wie unser <strong>Möbel</strong>, ein Unikat <strong>und</strong> ist in seiner Architektur unserem <strong>Möbel</strong> so sehr verwandt, dass man<br />
davon ausgehen könnte, dass das Leipziger <strong>Möbel</strong> unserem Schreiner womöglich als Inspiration beim Entwerfen des hier angebotenen<br />
Zuger-<strong>Möbel</strong>s diente. Mit seinem Kabinett- oder Sakristeischrank ist dem Zuger Schreiner ein sehr harmonisches <strong>und</strong> aussergewöhnliches<br />
Meisterwerk gelungen, das vielleicht als hiesige Interpretation des säschsischen Prunkmöbels zu verstehen ist.<br />
1048. Ein Paar kleine Spiegel mit Engelsköpfen, Stil Barock. Holz beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Ovaler Spiegel,<br />
reich beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. In der Kartusche ein farbig gefasster Engelskopf. 40:29 cm. 600.—/800.—<br />
1049. Ein Paar sitzende Putti, süddeutsch, frühes 18. Jh. Holz, geschnitzt <strong>und</strong> polychrom gefasst.<br />
H = 38 bzw. 40 cm. 2000.—/3000.—<br />
Die noch erhaltenen ursprünglichen Metallverankerungsösen lassen darauf schliessen, dass die beiden Putti einstmals zum Zierwerk eines<br />
Orgelsprospektes gehörten.<br />
1048 1049<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 33<br />
1047<br />
Register Seite 111–112
34<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1050 1051<br />
1050. Sehr schöner Wellenschrank, wohl schweizerisch oder Frankfurt, 1. Hälfte 18. Jh. Nussbaum massiv<br />
<strong>und</strong> furniert. Rechteckiger zweitüriger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen, horizontal geschweiftem<br />
Sockel mit zwei Schubladen <strong>und</strong> ausladendem, profiliertem, geradem Kranz. 230:198:73 cm.<br />
4000.—/6000.—<br />
1051. Flachbarockschrank, Aargau, um 1730. Nussbaum <strong>und</strong> Maser auf Nadelholz, furniert. Rechteckiger,<br />
zweitüriger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen <strong>und</strong> geradem, profiliertem Kranz. Die Felder der Türen mit<br />
Nussbaummaser kreuzweise gefügt, mit Filets überaus fein eingelegt <strong>und</strong> mit Nussbaum umrandet. Im Innenteil<br />
drei Ablagen <strong>und</strong> drei nebeneinanderliegende Schubladen. 235:160:50 cm. 1000.—/1500.—<br />
1052. Schrank, Aargau, um 1760. Kirschbaum, Filets aus Eibe <strong>und</strong> Ahorn. Zweitüriger rechteckiger Kasten mit<br />
geschweiftem, profiliertem Kranz <strong>und</strong> breitem Sockel, die vorderen Eckstollen abger<strong>und</strong>et. Die Füllungen<br />
mit Bandwerk <strong>und</strong> Blumen eingelegt, zum Teil geschwärzt, <strong>und</strong> in den Ecken beschnitzt. Das Innere zweigeteilt,<br />
links drei Ablagen, rechts ein offenes Fach für Mäntel; darüber zehn Schubladen <strong>und</strong> wiederum ein<br />
offenes Fach. 230:170:55 cm. 2000.—/3000.—<br />
1053. Schrank, Westschweiz, um 1800. Nussbaum, mit verschiedenen einheimischen Hölzern eingelegt.<br />
Rechteckiger zweitüriger Korpus, die vorderen Ecken abger<strong>und</strong>et <strong>und</strong> beschnitzt. Hervorstehender profilierter<br />
Sims <strong>und</strong> Sockel auf gedrückten Kugelfüssen. 236:175:68 cm. 2000.—/3000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 35<br />
1052 1053<br />
1054. Kleine Kommode, Stil Louis XV, 19. Jh.<br />
Nussbaum, Rosenholz <strong>und</strong> Bois de Violet auf<br />
Eiche furniert. Rechteckiger zweischübiger Korpus,<br />
mit ausziehbarem Tablar, sichtbaren Traversen<br />
auf geschweiften Beinen, die in die geschweifte<br />
Zarge übergehen. Seitlich gebaucht <strong>und</strong> von der<br />
Front gebaucht <strong>und</strong> geschweift. Die Felder mit<br />
Bois de Violet gerautet, umrahmt von einem Filet<br />
aus Rosenholz <strong>und</strong> Ahorn. Bronzebeschläge,<br />
Blatt aus rosa-grauem Marmor. 79:59:47 cm.<br />
1800.—/2500.—<br />
1054<br />
1055. Kommode, Régence, Frankreich, François<br />
Garnier zugeschrieben. Eiche mit Rosenholz<br />
furniert. Dreischübiger Korpus, die oberste Schublade<br />
zweigeteilt, von drei Seiten gebaucht, die Front<br />
zusätzlich geschweift «en arbalète». Geschweifte<br />
Zarge, übergehend in kurze, leicht ausgestellte<br />
Füsse. Traversen, Zarge, <strong>und</strong> Seitenwände mit<br />
Messingkannelüren. Die Kanten, Schlüsselschilder,<br />
Griffe <strong>und</strong> Zargenverzierung aus vergoldeter<br />
Bronze. Rot-braun-weiss geädertes Marmorblatt.<br />
Unter der Platte eingeschlagenes Monogramm<br />
F G. 84:141:66 cm. 20 000.—/25 000.—<br />
Das Monogramm F G wurde verschiedenen Ebenisten zugeordnet.<br />
J. Nicolay glaubt darin den Ebenisten François Gaudreaux<br />
(tätig von 1726–1751) zu erkennen. A. Pradère schreibt das<br />
Monogramm François Garnier (tätig von 1730–1774) zum<br />
Vater des berühmten Ebenisten Pierre Garnier (1720–1800).<br />
Lit. J.Nicolay, L’art et la manière des Maîtres ébénistes français<br />
au XVIII e siècle, Paris 1976; S. 623. – A. Pradère, Die Kunst des<br />
französischen <strong>Möbel</strong>s, München 1990, S. 247. Mit Hinweis<br />
zum Monogramm FG.<br />
Register Seite 111–112
36<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1056<br />
1056. Sehr feines <strong>und</strong> bedeutendes Paar Barocke Putti, schwäbisch, circa 1630–1640, wohl David <strong>und</strong><br />
Martin Zürn zuzuschreiben. Lindenholz, vollplastisch geschnitzt, polychrom gefasst <strong>und</strong> teilvergoldet.<br />
Jeder Putto mit kindlichem Lächeln, roten Pausbacken <strong>und</strong> geröteter Nase. Die r<strong>und</strong>lichen Köpfchen mit<br />
hoher Stirn <strong>und</strong> sehr fein gelocktem Haar. Beide Figuren mit ausgestreckten Armen <strong>und</strong> sehr fein gearbeiteten<br />
Händen. Die Beine in schreitender Bewegung <strong>und</strong> wiederum sehr fein beobachteten <strong>und</strong> künstlerisch<br />
umgesetzten Füssen <strong>und</strong> teils gespreizten Zehen. Die Fassung wohl in Teilen original erhalten. H = je 43 cm.<br />
10 000.—/15 000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Schweizer Privatbesitz<br />
Die hier angebotenen Engelsfiguren sind von beeindruckender Schönheit <strong>und</strong> grosser Ausstrahlung. Beide Figuren erinnern mit ihren<br />
korkenzieherartig gezwirbelten Locken, ihrer Mimik <strong>und</strong> Gestik, an die Engelsfiguren, welche in der Südkapelle des Überlinger Münsters<br />
(St. Nikolaus) den berühmten Rosenkranzaltar zieren. Dieses Meisterwerk des Barocks wurde von den Brüdern David <strong>und</strong> Martin Zürn<br />
geschaffen <strong>und</strong> ist mit MZ (Martin Zürn) 1631 datiert. In das Jahr 1631 fiel die Erteilung des Auftrages an die Zürn Werkstatt, für einen<br />
entsprechenden Altar nach Überlingen. Bedingt durch die andauernden Kriegswirren konnten die Arbeiten am Altar nur in Teilen aufgenommen<br />
werden. In das Jahr 1632 fällt die Stiftung des Rosenkranzaltares durch das Ehepaar Schulthais/Han. Zwischen 1635 <strong>und</strong> 1640<br />
wird durch Martin <strong>und</strong> David Zürn am Rosenkranzaltar weiter gearbeitet. Beide müssen noch einmal nach Überlingen gekommen sein,<br />
obwohl sie wegen der Kriegswirren aus Oberschwaben nach Wasserburg am Inn ausgewichen waren <strong>und</strong> dort ihre Werkstätten betrieben.<br />
Stilistische Vergleiche deuten auf die Hand der beiden Brüder hin. Jörg Zürn kommt als Bildschnitzer für den Altar nicht in Frage,<br />
da dieser schon 1636 verstorben war. Für die Jahre 1640/1641 werden zwei Weihedaten des Altares durch den Bischof Johann Truchsess<br />
von Konstanz überliefert. Wenig vor der Fertigung des Altares in Überlingen, fällt die Arbeit am Hochaltar der Friedhofskapelle Mariä<br />
Himmelfahrt in Meersburg, welche um 1630 datiert werden kann. Dieser Altar ist eine Arbeit David Zürns. Hier wird die Marienfigur<br />
von vier Putti umrahmt, die mit den hier angebotenen Figuren so sehr verwandt sind, dass sie wohl von gleicher Hand geschnitzt<br />
worden sind. An den Altarfiguren von St. Niklaus in Überlingen, den Putti in Meersburg, wie auch an den hier angebotenen Engeln,<br />
wird die Bedeutung <strong>und</strong> das Genie dieser Kunstschnitzer-Familie deutlich. Mit ihren geschnitzten Bildwerken führen sie den noch klar<br />
erkennbaren Renaissance-Stil in die glanzvolle Barockzeit am Bodensee über.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 37<br />
1056<br />
Register Seite 111–112
38<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1057 1058 1059<br />
1057. Hochzeitsschrank, Louis XV, Gruyère. Kirschbaum. Zweitüriger, rechteckiger Korpus, die vorderen<br />
Eckstollen abger<strong>und</strong>et mit geschnitzten profilierten Füllungen. Geschweifter, profilierter Sockel <strong>und</strong> Aufsatz<br />
mit zentralem floralem Ornament beschnitzt, auf gedrückten Kugelfüssen, unter den Türen jeweils eine<br />
Schublade. Das Mittelteil der Türen mit zwei gegengleichen Blattherzen <strong>und</strong> floralen Ornamenten beschnitzt.<br />
Die Füllungen oben jeweils mit einem Vogel auf einem Zweig, unten mit einem Blumenstrauss in<br />
einerVase eingelegt. Die Seiten mit einem Hell-dunkel-Filet eingelegt, unter dem Sims zwei Windrosen. Die<br />
unteren Schubladen erneuert, neuere Beschläge, mit Ergänzungen. 199:158:62 cm. 6000.—/8000.—<br />
1058. Hochzeitsschrank, Gruyère, dat. 1824. Kirschbaum massiv, geschnitzt. Intarsien aus verschidenen, teilweise<br />
eingefärbten einheimischen Hölzern. Zweitüriger Korpus mit abger<strong>und</strong>eten, geschnitzten vorderen<br />
Ecken, auf gedrückten Kugelfüssen, mit Fuss- <strong>und</strong> geschweiftem Kranzprofil. Der zentrale Mittelsteg in<br />
Kranzprofil, mit geschnitzten Blumen, übergehend. Die Türen mit gegengleich, geschweiften, profilgerahmten<br />
Füllungen, die Zwischenstege mit geschnitzten Zweigen. Die oberen Füllungen mit einem Zweig <strong>und</strong><br />
die unteren mit einer Windrose eingelegt. Im Sockel datiert. Innenausbau mit dem zweischübigen <strong>und</strong> eintürigem<br />
Beibehältnis. 211:148:45 cm. 8000.—/12 000.—<br />
1059. Hochzeitsschrank, Gruyère, um 1820. Kirschbaum, Intarsien aus Ahorn <strong>und</strong> geschwärztem Birnenholz.<br />
Rechteckiger zweitüriger Korpus, auf der Vorderseite mit abger<strong>und</strong>eten Ecken, geschweiftem, profiliertem<br />
Kranz, auf gedrückten Kugelfüssen. Zentraler Mittelsteg mit geschnitztem Blumenmotiv, das in den Kranz<br />
übergeht. Die Füllungen der Türen mit hell-dunkel Filets, einem ovalen Trennelement mit eingelegter<br />
Windrose. Darüber in den Ecken gegengleiche Zweigschnitzereien. Im Innern eintüriges Fach <strong>und</strong> daneben<br />
zwei kleine Schubladen. 190:147:42 cm. 4000.—/6000.—<br />
1060. Schöner Hochzeitsschrank, Gruyère, datiert 1825. Kirschbaum massiv, geschnitzt. Intarsien aus verschiedenfarbigen,<br />
zum Teil eingefärbten einheimischen Harthölzern. Die Füllungen der Türen sowie der<br />
Kranz mit Eibenholz gefriest. Hochrechteckiger, zweitüriger Korpus, auf derVorderseite abger<strong>und</strong>ete Ecken<br />
mit geschnitzten Füllungen, auf gedrückten Kugelfüssen, mit Fuss <strong>und</strong> geschweiftem Kranz-Profil. Der zentrale,<br />
flache Mittelsteg mit Würfelintarsien eingelegt, darüber ein geschnitztes Muschelornament, das in den<br />
Kranz übergeht. Die Türen mit gegengleich, geschweiften, profilierten Füllungen, die Zwischenstege mit je<br />
einer geschnitzten Blume <strong>und</strong> zwei gegengleiche Blattherzen. Die Türfüllungen mit Intarsienornamentik,<br />
Vögelchen auf gekreuztem Zweig <strong>und</strong> Blumen in Vase, umrandet mit helldunkel Filets. Die Türen selber<br />
umrandet mit Filets oben in einer Lilie endend. Unter dem Kranz datiert mit zwei eingelegten Windrosen.<br />
Unter den Türen, links eine vorgetäuschte <strong>und</strong> rechts eine Schubladenfront. Innenausbau mit Tablaren <strong>und</strong><br />
zwei kleinen Schubladen <strong>und</strong> einem abschliessbaren Fach. Originale Schlüsselschilder <strong>und</strong> Griffe aus gepresstem<br />
Messingblech. 208:156:50 cm. 10 000.—/15 000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 39<br />
1060<br />
Register Seite 111–112
40<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Casa Peterelli, circa 1910.<br />
1061 Prunktstube der Casa von Peterelli um 1910, mit Los-Nr. 1061.<br />
1061. Sehr seltenes <strong>und</strong> historisches Bündner Prunkmöbel aus der Casa von Peterelli in Savognin,<br />
Graubünden, 1751–1758. Nussbaum <strong>und</strong> Fruchthölzer, massiv <strong>und</strong> furniert, teils gefasst <strong>und</strong> eingelegt.<br />
Hochformatiger Korpus mit profiliertem Sockel <strong>und</strong> gequetschten Kugelfüssen. Der Unterbau mit eintürigem<br />
Schrankfach, darüber eine Schublade.Vorstehendes Deckblatt, darüber der überaus reich gestaltete <strong>und</strong><br />
geschweifte Aufsatz mit eingelassenem Spiegel <strong>und</strong> feinen Einlegearbeiten von Bandwerk, stilisiertem Muschelwerk<br />
<strong>und</strong> Voluten. In den seitlichen Zierwülsten mit je zwei übereinanderliegenden Schubladen. Der geschweifte<br />
<strong>und</strong> profilierte Kranz mit reich durchbrochenem <strong>und</strong> geschnitztem Zieraufsatz. Rocaillen,Voluten,<br />
Blumen <strong>und</strong> Rankenwerk in durchbrochener <strong>und</strong> gefasster Arbeit. In der Nische mit vorgesetztem <strong>und</strong><br />
reich graviertem Zinn-Handwaschbecken, darüber ein geflügeltes, kugelförmiges Zinn-Wasserbehältnis mit<br />
abschliessender Hermes-Figur. Das Waschbecken mit sehr feiner heraldischer Gravur mit Habsburger-Doppeladler,<br />
darin das Wappen derer von Peterelli, die durch Kaiserin Maria-Theresia in den Adelsstand erhoben<br />
wurden. 265:111:53 cm. 8000.—/12 000.—<br />
Provenienz:<br />
Luzi Plazi von Peterelli, seit 1758 in der Casa von Peterelli in Savognin erhalten.<br />
Unter den bedeutenden <strong>Möbel</strong>n des Kantons Graubünden, nimmt das hier vorgestellte Zier-Buffet eine herausragende Stellung ein.<br />
Über 250 Jahre verblieb es an seinem ursprünglichen Standort, der prunkvoll ausgestatteten Wohnstube im Erdgeschoss des Hauses Peterelli<br />
in Savognin. Das palastartige Gebäude mit seinem Turmbau ist behäbig, von schönen Proportionen <strong>und</strong> zeugt von der Bedeutung<br />
seiner einstigen Besitzer. Im Jahre 1751 kaufte Landvogt Luzi Plazi von Peterelli, der als Hauptmann in österreichischen Diensten zu<br />
grossem Vermögen gekommen war, den Vorgängerbau um 1000 Florin Churer Währung von seinem Schwiegervater Graf Rudolf von<br />
Travers-Ortenstein. Zwischen 1751 <strong>und</strong> 1758 liess von Peterelli, der den habsburgischen Dienst quittiert hatte – sein Vorfahre Oberst<br />
Anton de Peterelli war von Kaiserin Maria-Theresia geadelt worden – das bestehende Gebäude prachtvoll um- <strong>und</strong> ausbauen. Der<br />
reiche <strong>und</strong> sehr harmonische Innenausbau der Casa Peterelli dürfte unter Einfluss der ausländischen Stilrichtungen entstanden sein. Für<br />
den Umbau des Hauses soll von Peterelli einen Baumeister aus Wien zugezogen haben, dessen Pläne sich erhalten haben. Für die Arbeiten<br />
im <strong>und</strong> am Haus werden heimische Handwerker zugezogen worden sein. Sie müssen es vorzüglich verstanden haben, den österreichisch<br />
beeinflussten Geschmack des Hausherrn umzusetzen. Wohl an keinem anderen Bündner <strong>Möbel</strong> ist dieser Einfluss so stark erkennbar<br />
wie am von Peterelli Buffet, mit seinen Bandwerk-Einlagen, dem reichen Aufbau mit den seitlichen Wülsten <strong>und</strong> dem reich<br />
beschnitzten Abschluss. Die überaus feine Gravur des Waschbeckens vermittelt die Bedeutung des durch Kaiserin Maria-Theresia verliehenen<br />
Adelstitel für die Familie. Auf der Brust des habsburgischen Doppeladlers findet sich das Peterelli (früher Patharella) Wappen. Das<br />
von Peterelli <strong>Möbel</strong> zeugt von den engen Beziehungen, welche die bedeutenden Bündner Familien zum Ausland pflegten. Es ist mit seinem<br />
reichem Schmuck sicher eines der bedeutendsten Bündner <strong>Möbel</strong> der Zeit um die Mitte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> hat sich in seinem<br />
unverdorbenen Zustand erhalten.<br />
Vergleiche:<br />
Das Bürgerhaus in der Schweiz, XII. Band, Das Bèrgerhaus im Kanton Graubünden, 1.Teil. – südliche Talschaften, mit Abb.Tafel 82 <strong>und</strong> 83.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 41<br />
1061<br />
Register Seite 111–112
42<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1062<br />
1063<br />
1062. Kanapee <strong>und</strong> zwei Fauteuils, Stil Louis XV, Bern. Nussbaum. Die Sessel mit blauem, das Kanapee mit<br />
orangem Bezug. 2000.—/3000.—<br />
1063. Sehr schönes <strong>und</strong> seltenes Kanapee, Louis XV, Fribourg. Nussbaum, überaus floral beschnitzt, mit<br />
gelbem Bezug. Geschweifte Armlehnen, Zarge <strong>und</strong> acht Füsse. 2000.—/3000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 43<br />
1064<br />
1064<br />
1064. Sehr schöne <strong>und</strong> feine Rokoko-Kommode, Neuchâtel, circa 1760. Nussholz <strong>und</strong> Birkenmaser, massiv<br />
<strong>und</strong> furniert. Längsformatiger Korpus auf wellig ausgeschnittener Zarge <strong>und</strong> Stollenfüssen. Das Blatt vorstehend<br />
<strong>und</strong> wenig profiliert. Ger<strong>und</strong>ete Stollen <strong>und</strong> Traversen. Die Front mit drei Schubladen <strong>und</strong> s-förmiger<br />
Schweifung. Vergoldete Bronzebeschläge in Form von Schlüssellochzierden <strong>und</strong> Handhaben. Die<br />
Flächen sehr schön mit flammigem Nussholz furniert <strong>und</strong> in Birkenmaser umrandet. 86:123:68,5 cm.<br />
3000.—/5000.—<br />
Die hier angebotene Kommode ist vielleicht eines der schönsten Beispiele eines Rokoko-<strong>Möbel</strong>s aus der Neuenburger Gegend oder aus<br />
Neuenburg selbst. Die Gestaltung ihrer Schubladenfronten, aber gleichermassen auch der Schmalseiten <strong>und</strong> des Deckblattes, zeugen von<br />
grossem Können des hier unbekannten Meisters. Wenn dieses harmonische <strong>Möbel</strong> auch stark die Kommodenformen der deutschen<br />
Schweiz aufnimmt <strong>und</strong> etwa an den zeitgleichen Basler <strong>Möbel</strong>bau erinnert, so weist doch die charakteristische Furnierarbeit der schauseitigen<br />
Oberfläche auch auf die Westschweizer <strong>Möbel</strong>produktion hin. Im Inventar von Schloss Gümligen fand sich vor 1998 eine<br />
Schreibkommode (Auktion Sotheby’s, Zürich, 1. Dezember 1998, Los Nr. 24) mit identischen Beschlägen der Handhaben aus der Zeit<br />
um 1750, welche ebenfalls in Neuenburg entstanden ist.Wie an unserem <strong>Möbel</strong>, so spielte auch der Dekor am Gümliger <strong>Möbel</strong> mit dem<br />
Kontrast zwischen Birken- <strong>und</strong> Nussholz <strong>und</strong> war unserem <strong>Möbel</strong>, wenn auch etwas früher zu datieren, sehr verwandt.<br />
Register Seite 111–112
44<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1065<br />
1065. Bedeutende Kommode mit Schrankaufsatz, Bern, um 1750. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert, auf<br />
Nadelholz. Rechteckiger dreiseitig geschweifter, dreischübiger Korpus, leicht hervorstehendes, profiliertes<br />
Blatt, frontseitig abger<strong>und</strong>ete Eckstollen <strong>und</strong> geschweifte Zarge, die in Konsolenbeine übergehen. Zurückversetzter,<br />
zweitüriger Aufsatz mit geschweiftem, profiliertem Kranz mit einer Schublade. Die Felder der<br />
Schubladen <strong>und</strong> Seiten aus Nussbaum-Maser gespiegelt furniert, mit einem einfachen <strong>und</strong> einem Federfries<br />
jeweils umrandet. Die zwei obersten Schubladen <strong>und</strong> die Zarge haben jeweils zusätzliches Fries als falsche<br />
Traversen. Die Türen des Aufsatzes sind jeweils in vier Felder unterteilt, mit einem einfachen <strong>und</strong> einem<br />
Federfries umrandet <strong>und</strong> horizontal noch einmal durch ein einfaches Fries verb<strong>und</strong>en. Im Inneren des Aufsatzes<br />
sind drei Ablagen.Vergoldete Schlüsselschilder <strong>und</strong> Schubladengriffe in Delphinform.<br />
222:122:64 cm. 15 000.—/20 000.—<br />
1066. Sehr seltene Serie von vier Rokoko-Rahmen, Louis XV, Bern, von Johann Friedrich Funk I<br />
(1706–1775). Holz, profiliert, geschnitzt, vergoldet <strong>und</strong> teilweise mit grüner Farbe gefasst. Rechteckige<br />
Rahmen mit leichtem Hohlkehlprofil, in den Ecken geschnitzt mit Muschel <strong>und</strong> Blattornament. Jeder Rahmen<br />
mit einer kolorierten Umrissradierung von Johann Ludwig Aberli. Lichtmass je 25,5:37,5 cm.<br />
8000.—/12 000.—<br />
1067. Zwei seltene Rokoko-Rahmen, Louis XV, Bern, von Johann Friedrich Funk I (1706–1775). Holz,<br />
profiliert, geschnitzt, vergoldet <strong>und</strong> teilweise mit grüner Farbe gefasst. Rechteckige Rahmen mit leichtem<br />
Hohlkehl-profil, in den Ecken geschnitzt mit Muschel <strong>und</strong> Blattornament.<br />
Lichtmass: 46,5:32 <strong>und</strong> 46,5:30 cm. 4000.—/6000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 45<br />
1066<br />
1066<br />
1066<br />
1066<br />
1067<br />
1067<br />
Register Seite 111–112
46<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1068<br />
1069<br />
1068. Grosser Fauteuil «à la reine», Louis XV,<br />
Bern. Buche mit braunem Lederbezug. Rechteckiger<br />
Sitz mit geschweifter Zarge, die in geschweifte<br />
Beine übergeht. Gerader Rücken, oben<br />
geschweift, sowie geschweifte Armlehnen.<br />
101:108:75 cm. 1500.—/2000.—<br />
1069. Kommode, Louis XV, Bern. Nussbaum auf<br />
Nadelholz gespiegelt furniert, das Feld des leicht<br />
hervorstehenden Blattes kreuzweise gefügt. Dreischübiger,<br />
rechteckiger, frontseitig geschweifter<br />
Korpus mit abger<strong>und</strong>eten Frontstollen, sichtbaren<br />
Traversen, gerader Zarge mit geschweifter Mittelverzierung<br />
<strong>und</strong> geschweiften Konsolenbeinen.<br />
78:110:68 cm. 2000.—/3000.—<br />
1070<br />
1070. Spieltisch, Louis XV, Bern. Nussbaum. Rechteckiges<br />
Blatt, mit hervorstehenden, abger<strong>und</strong>eten<br />
Ecken. Geschweifte Zarge, mit drei Schubladen<br />
die in geschweifte Füsse übergehen.<br />
68:81:70 cm. 1000.—/1500.—<br />
1071. Miniaturschränklein, Barock, schweizerisch.<br />
Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Zweitüriger<br />
rechteckiger Korpus mit unten einer Schublade<br />
<strong>und</strong> oben einem geschweiften Sims, darin ein<br />
Geheimfach. Innen reich mit vielen Schubladen,<br />
symmetrisch angeordnet. 52:45:24,5 cm.<br />
600.—/800.—<br />
1071<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 47<br />
1074 1073<br />
1072. Kommode, Barock, schweizerisch. Nussbaum,<br />
massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger dreischübiger<br />
Korpus, leicht geschweifte Front,<br />
sichtbaren Traversen <strong>und</strong> die Zarge die in Konsolenfüssen<br />
übergeht. Profilertes weit hervorkragendes<br />
Blatt. Die Felder der Schubladen mit breitem<br />
Bandwerk aus Wurzelmaser eingelegt.<br />
78:123:64 cm. 2000.—/3000.—<br />
1073. Armlehnstuhl «à la reine», Louis XV, Fribourg.<br />
Buche, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt, Rücken<br />
<strong>und</strong> Sitz mit rosafarbenemVelours bezogen.<br />
400.—/600.—<br />
1072<br />
1074. Schreibkommode, Louis XV, Bern, von<br />
Mathäus Funk <strong>und</strong> seiner Werkstatt, um<br />
1765. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Nussbaum<br />
furniert. Zweischübiger, rechteckiger, frontseitig<br />
geschweifter <strong>und</strong> von drei Seiten gebauchter<br />
Korpus. Schräger Schreibaufsatz mit geschweiftem<br />
Blatt. Die beiden Schubladen mit Blendtraversen<br />
<strong>und</strong> Messingschienen. Die Schubladen,<br />
Seiten <strong>und</strong> Klappen gefriest, Felder der Seiten<br />
<strong>und</strong> Klappe kreuzweise gefügt, Felder der Schubladen<br />
gespiegelt furniert. Im Schreibaufsatz getreppte<br />
Schubladen <strong>und</strong> offene Fächer, mit zwei<br />
Geheimfächern. Originales Kleisterpapier, vergoldete<br />
Schlüsselschilder <strong>und</strong> Beschläge.<br />
111:109:57 cm. 25 000.—/30 000.—<br />
Vgl. Hermann von Fischer, Fonck à Berne, S. 88, Abb. 124.<br />
Register Seite 111–112
48<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Schrank um 1755, Museumsverein Lüneburg.<br />
1075. Hochbedeutender <strong>und</strong> sehr seltener Rokoko Schrank, Norddeutschland, wohl Bremen, circa<br />
1750/1760. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert, Holz, geschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Hochformatiger, zweitüriger<br />
Korpus mit hoher, wellig ausgeschnittener Zarge auf gelockten <strong>und</strong> ausstehenden Beinen. Der Kranz in<br />
Bogenform, durchbrochen <strong>und</strong> mit zentralem Podest. Sehr fein profiliert, die geschrägten Ecken des Kranzaufbaues<br />
als weitere Podeste.Vertiefte <strong>und</strong> geschweifte Türen mit feiner Kassettierung. Zweischübiges, erhöhtes<br />
Sockelgeschoss. Die Ecklisenen mit geschnitzten Kapitellen, ebenso mit geschnitztem <strong>und</strong> vergoldetem<br />
Kapitell an der Schlagleiste der Türe. Sehr fein <strong>und</strong> zurückhaltend, mit geschnitztem <strong>und</strong> vergoldetem Rankenwerk<br />
geschmückt. Gravierte Messingbeschläge <strong>und</strong> Zuggriffe. 285:200:73 cm. 22 000.—/27 000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Schweizer Privatbesitz<br />
Der hier angebotene, ganz in Nussbaum furnierte <strong>und</strong> mit vergoldeten Applikationen verzierte Hallenschrank, gehört sicher mit zu den<br />
schönsten Schreinerarbeiten des deutschen Nordens. In seiner vornehmen Behäbigkeit widerspiegelt er den <strong>Möbel</strong>-Geschmack der vermögenden<br />
hanseatischen Kaufleute, wie wir ihn in Hamburg ebenso wie in Lübeck oder Bremen vorfinden. Unser prunkvoller Schrank<br />
findet ein fast identisches Parallelmöbel welches sich in den Sammlungen des Museumsverein Lüneburg erhalten hat. Dieses prächtige,<br />
um 1755 zu datierende <strong>Möbel</strong> ist in Aufbau <strong>und</strong> Schmuck mit dem hier angebotenen identisch <strong>und</strong> weicht von diesem nur in unwesentlichen<br />
Details ab. Es ist, wie das hier angebotene Schrankmöbel in den norddeutschen Raum zu weisen <strong>und</strong> dürfte möglicherweise in<br />
einer Bremer Meister-Werkstatt entstanden sein. Ein um 1750 zu datierender Schrank, der dem unsrigen in den Gr<strong>und</strong>formen ebenfalls<br />
sehr verwandt ist, jedoch etwas massiger wirkt <strong>und</strong> mit Vasenaufsätzen geschmückt ist, hat sich in den Sammlungen des Schleswig-<br />
Holsteinischen Landesmuseum erhalten <strong>und</strong> stammt aus dem alten Tondern.<br />
Vergleiche:<br />
Kreisel/Himmelheber, Die Kunst des deutschen <strong>Möbel</strong>s, Bd. 2, Spätbarock <strong>und</strong> Rokoko, Abb. 848 <strong>und</strong> 854 für die beiden erwähnten<br />
<strong>Möbel</strong> aus Bremen bzw. aus Tondern.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 49<br />
1075<br />
Register Seite 111–112
50<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1076<br />
1076. Sehr feine Kommode, Barock, wohl Braunschweig, um 1745. Nussbaum Rüster. massiv <strong>und</strong> furniert<br />
auf Nadelholz. Rechteckiger, dreischübiger Korpus, frontseitig doppelt geschweift, mit sichtbaren Traversen,<br />
stark hervorstehende Zarge auf Konsolenfüssen. Die Felder der Seiten gespiegelt furniert. Die Schubladen<br />
<strong>und</strong> das Blatt reich eingelegt mit Filets <strong>und</strong> floralen Motiven. Das zentrale Feld des Blattes mit Früchteschale<br />
<strong>und</strong>Vogel intarsiert. Originale vergoldete Bronzebeschläge <strong>und</strong> Schlösser. 79:109:56,5 cm.<br />
2000.—/3000.—<br />
1077. Sehr seltene kleine Kommode, Louis XV, Bern, um 1740. Mathäus Funk <strong>und</strong> seinem Atelier zuzuschreiben.<br />
Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaumwurzelmaser. Rechteckiger, von drei Seiten geschweifter, dreischübiger<br />
Korpus. Die vorderen Ecken abger<strong>und</strong>et, mit hervorstehendem, profiliertem Blatt <strong>und</strong> geschweifter Zarge,<br />
die in Konsolenfüsse übergeht. Das Blatt <strong>und</strong> die Seitenwände kreuzweise gefügt. Die Schubladen gespiegelt<br />
furniert, wobei die zwei oberen Schubladen mit zwei angedeuteten Traversen furniert sind. Vergoldete<br />
Schlüsselschilder <strong>und</strong> Griffe aus geprägtem <strong>und</strong> ziseliertem Messing. Unter dem blauen Kleisterpapier, im<br />
Inneren der Schubladen, rot-weisses Herrnhuter-Kleisterpapier. 78:73:53 cm. 8000.—/12 000.—<br />
1078. Pendule mit Sockel, Stil Régence, Paris. Sign. Joly à Paris. Braunes Schildpatt in Boulle- <strong>und</strong> Contre-<br />
Boulle-Manier eingelegt; vergoldete Bronzebeschläge. Mit Blattwerk reliefiertes Bronzezifferblatt, eingelegt<br />
mit Emailkartuschen mit blauen römischen St<strong>und</strong>enzahlen. Ausgeschnittene Eisenzeiger. Ebenfalls sign.<br />
Messingwerk mit Ankergang <strong>und</strong> 1 ⁄2-St<strong>und</strong>enschlag auf Glocke. Gehäuse zu restaurieren; Putto-Aufsatz bestossen;<br />
Werk zu revidieren. H mit Sockel = 92 cm. 1800.—/2400.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 51<br />
1077<br />
1078<br />
1079. Sekretär, Louis XV, französisch. Eiche mit Amarant <strong>und</strong> Palisander, von allen Seiten furniert. Felder mit<br />
Rautengitter. Front mit zwei Schubladen, geschweifte Beine. Schlüsselschilder, die vier Eckverzierungen<br />
<strong>und</strong> Sabots aus Bronze. Schreibfach mit symmetrischer Schubladeneinteilung, treppenförmig seitlich je drei<br />
Schubladen mit offenem Fach. In der Mitte Geheimfach mit drei offenen Fächern. Klappe mit zwei Eisenschienen.<br />
Zu restaurieren. 101:84:48 cm. 2500.—/3500.—<br />
1080. Kommode, Louis XIV, Frankreich, 1. Hälfte 18. Jh. Palisander gespiegelt furniert, Schubladen parkettiert,<br />
die Seitenwände kreuzgefügt. Rechteckige, dreischübige Kommode, wobei die oberste Schublade<br />
zweigeteilt ist. Abger<strong>und</strong>ete Ecken, sichtbare Traversen, gerade Zarge mit Konsolenfüssen. Blatt mit Messingschiene<br />
umrahmt. 82:130:62 cm. 2000.—/3000.—<br />
1081. Kommode, Louis XV. Kirschbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Kirschbaum furniert. Rechteckiger, zweischübiger<br />
Korpus, von drei Seiten gebaucht, sichtbare Traverse, geschweifte Zarge in geschweifte Füsse übergehend.<br />
Schlüsselschilder, Sabots, Griffe <strong>und</strong> Spanioletten aus vergoldeter Bronze. 88:120:58 cm. 2000.—/2500.—<br />
Register Seite 111–112
52<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1082<br />
1082. Sehr feine <strong>und</strong> bedeutende Tischuhr des Claudius du Chesne, England, London, George I., erstes<br />
Viertel 18. Jh., signiert Claudius Du Chesne Londini. Nuss-Wurzelmaser, furniert, vergoldete Bronzen<br />
<strong>und</strong> gravierte Messingarbeit. Hochformatiges, überaus fein <strong>und</strong> architektonisch gegliedertes Gehäuse mit<br />
profiliertem Sockelgeschoss auf gequetschten Kugelfüssen. Die Fronttüre verglast, bogenförmig ausgeschnitten<br />
<strong>und</strong> mit Messingschienen gerahmt, seitlich des Türchens mit sehr feinen Pilastersäulen. R<strong>und</strong>es Zifferblatt,<br />
versilbert. Römische St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> arabische Minutenzahlen. Mondphase <strong>und</strong> Tiersternzeichen, sowie<br />
Datumsanzeige. Das Zifferblatt getragen von einer sitzenden Chronosfigur auf Längspodest. Das Podest<br />
selbst bezeichnet Claudius Du Chesne Londini. Die Schmalseiten mit Tragebügel in vergoldeter Bronze. Die<br />
Türchen mit wiederum bogenförmig abschliessendem Durchbruch <strong>und</strong> Zug für die Repetition. Im von<br />
grüner Seide hinterlegten Durchbruch der Füllung mit filigranem Gürtlerwerk in graviertem Messing:<br />
Figuren mit Blumenkörben, Blattvoluten <strong>und</strong> Rankenwerk in feinster Arbeit. Der domförmige Aufsatz mit<br />
Vasenbekrönung <strong>und</strong> seitlichen Pinienzapfen. Unter dem Dachabschluss mit seher feiner Messingarbeit in<br />
durchbrochener Manier. Unter dem Vasenaufsatz mit gravierter Messing-Zierplatte, darin bezeichnet:<br />
Claudius Du Chesne Dean Street St. Ann’s Soho Londini Fecit. Das<br />
Werk mit Schlag auf Carillon mit sechs Glocken sowie einer grösseren<br />
Glocke für den Hauptschlag. Die Werkzierplatte wiederum überaus<br />
fein graviert <strong>und</strong> verziert. 10 000.—/15 000.—<br />
Die hier angebotene Tischuhr zählt sicher zu den schönsten Arbeiten des berühmten Londoner<br />
Uhrmachermeisters. Die Tatsache, dass der Uhrmacher seine Arbeit auf dem domförmigen<br />
Abschluss zusätzlich mit einer eigens gefertigten Zierplatte signiert <strong>und</strong> dieser<br />
Signatur auch seine ganze Adresse in London beifügt, unterstreicht die Bedeutung der<br />
hier aus altem Privatbesitz überlieferten Uhr. Sie ist in einem sehr schönen, alten Zustand<br />
erhalten <strong>und</strong> ist von sehr feiner Ausführung.<br />
Der sehr schön durchbrochene Zwischenteil unter dem domförmigen Aufbau ist von<br />
identischer Art wie an einer bedeutenden Uhr des Meisters, welche sich aus dem Besitze<br />
des National Trust in Wallington, Northumberland, erhalten hat (National Trust Inventory<br />
Number 583034). Claude Duchesne gehörte zu einer bedeutenden Zahl von Hugenotten,<br />
welche Frankreich nach der Aufhebung des Edikt von Nantes durch das Edit de Fontainebleau<br />
durch Louis XIV, 1685, auch Richtung London verliessen. Die Mehrzahl der französischen<br />
Protestanten flohen in der Folge in die calvinistischen Gebiete der Niederlande,<br />
in die Schweiz <strong>und</strong> nach Preussen. Für alle diese Länder waren die Vertriebenen sehr willkommen,<br />
waren doch unter ihnen besonders viele erfolgreiche Kaufleute <strong>und</strong> Künstler.<br />
1693, acht Jahre nach seiner Flucht, wird der bereits sehr erfolgreiche Franzose Duchesne<br />
erstmals in London erwähnt, als Free Brother working in the Clockmaker’s Company. Du<br />
Chesne lebte in Long Acre, in der Dean Street, welches zur St. Anna-Kirchgemeinde in<br />
Soho gehörte, wo er bis 1730 verblieb.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 53<br />
1082<br />
Register Seite 111–112
54<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1083<br />
1084<br />
1083. Ein Paar Fauteuils, «en cabriolet», Louis XV. Buche, mouluriert<br />
<strong>und</strong> beschnitzt. Floraler Gobelinbezug. 1500.—/2000.—<br />
1084. Kleines Kanapee, Régence. Nussbaum, mit floralem Stoffbezug.<br />
Sechs geschweifte Beine, die in Voluten enden, verb<strong>und</strong>en<br />
durch zwei Kreuzstege, gerade Zarge, trapezförmiger, schmaler<br />
Sitz. Die gerade Rückenlehne «à la reine» mit zwei Bögen. Gepolsterte,<br />
schnabelförmige Armlehnen. 105:127:45 cm.<br />
500.—/700.—<br />
1085. Schöne Pendule mit Sockel, La Chaux-de-Fonds, um<br />
1790. Zifferblatt signiert JA Kecker (Jean Abram Kecker, Meister<br />
1778–1800) a La Chaux Fonds. Mit Repetition <strong>und</strong> Kalender.<br />
Weinrot gefasstes Gehäuse <strong>und</strong> bunte Blumenmalerei. Zu<br />
revidieren. H = 85 cm. 2000.—/3000.—<br />
1086. Schreibkommode, Louis XV, schweizerisch. Kirschbaum,<br />
massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger, frontseitig geschweifter dreischübiger<br />
Korpus mit sichtbaren Traversen. Geschweifte Zarge<br />
in Konsolenfüsse übergehend. Horizontal geschweifter, schräger<br />
Aufsatz, darin offenes zentrales Fach mit darüber zwei Schubladen,<br />
seitlich je drei Schubladen. Bronzebeschläge.<br />
107:124:68 cm. 1500.—/2000.—<br />
1085<br />
1087. Schreibkommode, 19. Jh. Nussbaum <strong>und</strong> Maser, massiv <strong>und</strong><br />
furniert. Dreischübiger rechteckiger Korpus, auf Konsolenfüssen,<br />
die in die geschweifte Zarge übergehen. Die Frontseite<br />
leicht doppelt geschweift. Die Felder der Schubladen <strong>und</strong> des<br />
Schreibfaches dreigeteilt <strong>und</strong> mit Nussbaummaser furniert.<br />
Schräger Schreibaufsatz. Innen mit einem zentralen, offenen<br />
Fach <strong>und</strong> darum Schubladen, treppenförmig angeordnet.<br />
115:111:65 cm. 2000.—/2500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 55<br />
1088 1089<br />
1088. Schreibkommode, Louis XV, Bern, Umkreis des<br />
Mathäus Funk. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Nussbaum<br />
furniert. Dreischübiger Korpus, Front geschweift,<br />
die beiden oberen Schubladen mit angedeuteten Traversen.<br />
Schräger Schreibaufsatz mit geschweifter Ablage.<br />
Darin seitlich je vier treppenförmig angeordnete<br />
Schubladen, das Mittelteil mit offenem Fach, darüber<br />
zwei weitere Schubladen.<br />
114:111:60 cm. 4000.—/6000.—<br />
Vergleiche:<br />
Hermann von Fischer, Fonck à Berne, S. 84, Abb. 111.<br />
1089. Fauteuil, «en cabriolet», Louis XV, Bern, Nussbaum,<br />
mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt. Geschweifte Beine<br />
<strong>und</strong> Zarge mit Spinnenfüssen. U-förmiger Sitz, gebogene<br />
Rückenlehne, die in geschweifte Armlehnen übergeht.<br />
Mit Blumen bestickter Gobelinbezug.<br />
500.—/700.—<br />
1090. Feine Pendule mit Sockel, Sumiswald, um 1830.<br />
Geschweiftes, schwarz gefasstes Holzgehäuse mit weisser<br />
Blumenmalerei. Emailzifferblatt mit römischen St<strong>und</strong>en-<br />
<strong>und</strong> arabischen Minutenangaben. Viertelst<strong>und</strong>en<strong>und</strong><br />
St<strong>und</strong>enschlag auf zwei Federn. Mit Repetition.<br />
Wecker auf Glocke. H = 90 cm. 3000.—/4000.—<br />
1090<br />
Register Seite 111–112
56<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1091<br />
1091. Sehr schöner <strong>und</strong> feiner Konsol- oder Kaminspiegel, Toskana, Florenz, circa 1765, Umkreis des<br />
Giovanni Battista Dolci. Holz, geschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Hochformatiger Spiegel mit zweiteiligem, altem<br />
Spiegelglas. Der Rahmen profiliert <strong>und</strong> mit gew<strong>und</strong>enen Blatt- <strong>und</strong> Blütenranken. Überaus fein mit einem<br />
Blumenzweig geschmücktes <strong>und</strong> durchbrochenes Fronton in Form einer offenen Rocaillen-Kartusche, seitlich<br />
davon mit rosengeschmückten C-Voluten. 6000.—/8000.—<br />
Der hier angebotene Spiegel ist ein besonders schönes Beispiel der Florentiner Rahmenmacher- <strong>und</strong> Bildhauerkunst des dritten Viertels<br />
des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts. Sehr verwandt mit den grandiosen Spiegeln der Genueser Handwerker, sind sie meist etwas leichter <strong>und</strong> feingliedriger<br />
in der Ausführung. Unser Spiegel zeigt sich in einem schönen, alten Zustand <strong>und</strong> ist einzuordnen in eine kleine Gruppe bedeutender<br />
Spiegel, welche sich in Florenz, Palazzo Pitti, erhalten haben. Unter dieser Gruppe wiederum befindet sich ein Spiegel, der aus<br />
derselben Hand stammen dürfte wie der hier angebotene. Diese Gruppe von Spiegeln, welche ab 1757 bis 1769 für den Grossherzoglichen<br />
Hof entstanden ist, kann wiederum mit grösster Sicherheit dem Kunstschnitzer Giovanni Battista Dolci zugewiesen werden, da<br />
dieser, zusammen mit dem Vergolder Francesco Ristori <strong>und</strong> Vittorio Frangini, in diesen Jahren für «delle spere e die tremau intagliati all<br />
francese e cioè con vari festoni di fiori, palme e nicchie» durch die Grossherzogliche «Guardaroba» bezahlt wurden.<br />
Vergleiche:<br />
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, I Mobili de Palazzo Pitti, il primo periodo lorenese, 1737-1799, Firenze, 1992, S. 150/151, für<br />
die erwähnten Spiegel<br />
1092. Kommode «en tombeau» Louis XV, signiert J.C. ELLAUME. Eiche, mit Palisander furniert sowie gefriest.<br />
Von drei Seiten geschweifter Korpus mit vorstehenden Eckstollen. Kurze geschweifte Konsolenbeine<br />
in geschweifte Zarge übergehend. Front mit drei Schubladen, die oberste dreigeteilt. Vergoldete Bronzebeschläge.<br />
Profiliertes «Brèche d’Alep»-Marmorblatt. 88:130:66 cm. 15 000.—/20 000.—<br />
Jean-Charles Ellaume, Meister 1754.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 57<br />
1092<br />
Register Seite 111–112
58<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1093<br />
1093<br />
1093. Schöne <strong>und</strong> feine sächsische Barockkommode,<br />
Dresden, circa 1725–1730. Nussbaum,<br />
massiv <strong>und</strong> furniert. Längsformatiger,<br />
dreischübiger Korpus mit wellig ausgeschnittener<br />
<strong>und</strong> durchbrochener Zarge. Das Blatt<br />
passig geschweift, wenig vorstehend <strong>und</strong> profiliert.<br />
Betonte Eckstollen, die Schubladen geschweift,<br />
mit Traversen <strong>und</strong> fein abgesetzten<br />
Rändern. Sehr fein furniert in flammigem<br />
Nussmaser. Die Felder mit Bandwerk gerahmt.<br />
Originale Beschlagsgarnitur in Messing.<br />
Die Handhaben mit beweglichem Griff,<br />
die Zierplatte mit Berain-Maske. Schlüssellochzierden<br />
in gleicher Manier.<br />
85:131:65 cm. 5000.—/8000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Schweizer Privatbesitz<br />
Die hier angebotene, in einem schönen Zustand erhaltene<br />
Barockkommode, ist ein sehr schönes <strong>und</strong> ausgewogenes<br />
Beispiel der Dresdener Barockmöbel der Zeit um<br />
1720–1730. Sie erinnert in ihrer schlichten Eleganz an eine<br />
Kommode aus Schloss Moritzburg, die um 1720/25 datiert<br />
wird <strong>und</strong> eine identische Beschlagsgarnitur aufweist. Ist<br />
auch die Moritzburger Kommode in der Schweifung der<br />
Front etwas bescheidener, so strahlen doch beide <strong>Möbel</strong><br />
eine ähnliche Eleganz aus, wie sie fast allen bedeutenderen<br />
Dresdener Kommoden dieser Zeit gegeben ist.<br />
Vergleiche:<br />
Rudolf von Arps-Aubert, Sächsische Barockmöbel, 1700–<br />
1770, Berlin, 1939, Abb. S. 68 a.<br />
Kommode um 1725, ehemals Schloss Moritzburg.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 59<br />
1094<br />
1095<br />
1094. Spiegelapplique, mit Doppelrahmen, um 1765, Louis XV, Bern, von Johann Friedrich Funk (1706–<br />
1755). Holz beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger Rahmen, mit abger<strong>und</strong>eten Ecken. Der innere <strong>und</strong><br />
äussere Rahmen profiliert <strong>und</strong> durch Sprossen mit Blattwerk verb<strong>und</strong>en. Abschluss unten mit Kartusche,<br />
oben mit Rocaillen. Halterung für Kerze fehlend. 86:33 cm. 1000.—/1500.—<br />
Lit. Hermann von Fischer, FONCK A BERNE. S.208.<br />
1095. Spiegelapplique mit Doppelrahmen um 1765, Louis XV, Bern, von Johann Friedrich Funk I<br />
(1706–1755). Holz beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger Rahmen, profiliert <strong>und</strong> durch Sprossen mit<br />
Blattwerk verb<strong>und</strong>en. Durchbrochener, verspiegelter Aufsatz. 86:35 cm. 2000.—/3000.—<br />
1096. Kommode, Frankreich, um 1800. Mahagoni <strong>und</strong> Nussbaum. Dreischübiger Korpus, seitlich mit r<strong>und</strong>en<br />
kannelierten Säulen, in gegen unten sich verjüngende Füsse übergehend, verziert mit Perlstab aus Messing,<br />
Blatt aus grauem Marmor. 78:118:49 cm. 2000.—/3000.—<br />
1097. Kommode, Directoire. Nadelholz, mit Kirschbaum <strong>und</strong> Nussbaum furniert. Rechteckiger, zweischübiger<br />
Korpus, seitlich abgeschrägt, auf Pyramidenbeinen. 80:115:57 cm. 3000.—/4000.—<br />
1098. Kommode, Directoire, Bern,Werkstatt Hopfengärtner. Nadelholz, mit Nussbaum gespiegelt furniert.<br />
Rechteckiger, dreischübiger Korpus, seitlich abgeschrägt, sichtbare Traversen, gerade Zarge, auf Pyramidenbeinen.<br />
84:77,5:47 cm. 2000.—/3000.—<br />
Register Seite 111–112
60<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1099<br />
1100<br />
1101<br />
1099. Kommode, Mitte 18. Jh., schweizerisch. Kirschbaum. Rechteckiger, dreischübiger Korpus mit leicht<br />
geschweifter Front auf Konsolenfüssen. Bronzene Griffe <strong>und</strong> Schlüsselschilder. 76:123:67 cm.<br />
800.—/1200.—<br />
1100. Ameublement, Louis XV, Bern. Bestehend aus Kanapee, drei Fauteuils <strong>und</strong> drei Stühlen sowie einem<br />
Kaminschirm. Nussbaum, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt, mit Spinnenbeinen. Gobelinbezug mit Blumenmotiven.<br />
Kanapee L = 170 cm. 5000.—/6000.—<br />
1101. Auszugstisch, Stil Louis XV, 19. Jh. Nussbaum. Rechteckig, mit zwei Auszügen. Geschweifte Zarge, geschweifte,<br />
eingerollte Beine mit geschnitzten Kartuschen, auf Bocksfüssen. Das Blatt mit einem geschweiften<br />
Band <strong>und</strong> einer Windrose eingelegt. 76:154:79 cm. Mit Auszügen 282 cm. 1400.—/1800.—<br />
1102. Kommode, Stil Biedermeier. Nussbaum auf Nadelholz, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger Korpus, auf<br />
geschnitzten Konsolenfüssen, mit abger<strong>und</strong>eten vorderen Eckstollen, leicht hervorstehendem profiliertem<br />
Blatt. Die Front dreigeteilt, das Mittelfeld mit fünf Schubladen, seitlich je mit zwei Schubladen <strong>und</strong> darunter<br />
je ein zweigeteiltes Fach mit Türe. 96:130:55 cm. 1500.—/2000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 61<br />
1103<br />
1104<br />
1105<br />
1103. Schöne Schreibkommode, Louis XV, Bern, um 1745/1750. Nussbaum auf Nadelholz. Rechteckiger,<br />
frontseitig geschweifter, dreischübiger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen mit schrägem, horizontal geschweiftem<br />
Schreibaufsatz. Die zwei obersten Schubladen mit falschen Traversen. Hervorstehendes profiliertes<br />
Blatt <strong>und</strong> Zarge, die Felder gespiegelt furniert, die des Schreibfaches kreuzweise gefügt. Das Schreibfach<br />
mit symmetrischer Schubladeneinteilung. Seitlich mit vier geschweiften, treppenförmig angeordneten<br />
Schubladen. In der Mitte eine geschweifte Schublade mit darunter einem grossen offenen Fach, darüber<br />
zwei herausnehmbare, zweigeteilte offene Fächer mit dahinter je einem Geheimfach. Die Schubladen mit<br />
Resten von altem Herrnhuter Kleisterpapier, unter dem blauen Papier. Originale vergoldete Schlüsselschilder<br />
<strong>und</strong> Griffe. 118:107:69 cm. 5000.—/7000.—<br />
1104. Sehr feine Kommode, schweizerisch, um 1750. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Nussbaum furniert.<br />
Rechteckiger dreischübiger Korpus mit zweifach geschweifter Front, sichtbaren Traversen <strong>und</strong> gedrückten<br />
Kugelfüssen. Blatt kreuzweise furniert, die Seiten gespiegelt furniert, mit fein eingelegten Ahornfilets.Vergoldete<br />
Schlüsselschilder, Schlösser ersetzt. 79:91:59 cm. 1500.—/2000.—<br />
1105. Ameublement, Louis XV, Bern, um 1760. Bestehend aus einem Kanapee <strong>und</strong> vier Stühlen. Nussbaum<br />
mit grünemVeloursbezug. Geschweifte Beine <strong>und</strong> Zarge mit Spinnenfüssen. Kanapee = 150 cm.<br />
2500.—/3500.—<br />
Register Seite 111–112
62<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1106<br />
1106. Aussergewöhnliche <strong>und</strong> sehr seltene, gefasste Rokoko-Kommode, wohl Ostschweiz oder Schaffhausen,<br />
letztes Viertel 18. Jh. Weichholz, gefasst. Dreischübiger, frontseitig geschweifter Korpus auf ausgeschnittener<br />
<strong>und</strong> geschnitzter Zarge. Die Schubladen mit Traversen, das Blatt vorstehend <strong>und</strong> wenig profiliert.<br />
Schauseitig überaus reich bemalt mit Rocaillen,Voluten <strong>und</strong> Rankenwerk auf blaugrünem Gr<strong>und</strong>. Das<br />
Blatt mit einer reich umrahmten Landschaftsvignette, darin eine Seelandschaft mit einer Insel, zu der ein<br />
schlichter Steg führt. Auf der Insel <strong>und</strong> seitlich auf dem Festland mit Häusergruppen eine hügelige Landschaft<br />
im Hintergr<strong>und</strong>. Die Schmalseiten mit grosszügigenVoluten bemalt. 78:110:58,5 cm.<br />
6000.—/8000.—<br />
Die hier angebotene Kommode scheint in ihrer Art ein eigentlicher Solitär zu sein. Sie erinnert an ähnliche Fassmalerei, wie wir sie<br />
auch auf Schrankmöbeln der Ostschweiz (Appenzell AR) finden, aber auch an künstlerisch bemalte Schränke aus der Region Schaffhausen,<br />
die ähnliche Farbkombinationen aufnehmen <strong>und</strong> dem hier angebotenen <strong>Möbel</strong> verwandt sind. ( Vgl. Auktion Sotheby’s Zürich,<br />
1. Dezember 1988, Los 256, für einen Schrank mit Landschaftsmalerei, Schaffhausen – dort als Ostschweiz oder Zürichseegegend – von<br />
ähnlichem Sujet, datiert 1751).<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 63<br />
1106<br />
Register Seite 111–112
64<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1107 1107<br />
1107. Sehr feines <strong>und</strong> seltenes Aufsatzschreibkabinett mit Dragoner-Trommler-Beschlägen, wohl<br />
Dresden, Berlin oder Rheinhessen, um 1740. Nussbaum, Thuya, Eibe <strong>und</strong> Lignum Vitae furniert.<br />
Hochformatiger, zweiteiliger <strong>und</strong> dreigeschossiger Korpus auf ausgeschnittener Zarge. Der Kommodenteil<br />
doppelt geschweift <strong>und</strong> mit betonten <strong>und</strong> ger<strong>und</strong>eten Traversen. Der Schreibaufsatz wenig zurückversetzt,<br />
mit s-förmig geschweifter Schreiblade. Das Innere überaus fein gegliedert mit je drei seitlich getreppt angeordneten<br />
Schubladen, dazwischen ein offenes Längsfach, ein Bodenfach, sowie drei Brieffächer mit bogenartig<br />
gegliederter Front. Feine Zuggriffe in Form von vergoldeten Bronze-Quasten. Der Aufsatz mit zwei<br />
kassettierten Türen <strong>und</strong> gekehltem, profiliertem <strong>und</strong> bogenförmig gestaltetem Doppelgiebel als Abschluss.<br />
Im Innern des Aufsatzes ein zentrales bogenförmiges Fach mit drei zurückversetzten Schubladen, seitlich des<br />
Faches mit zwölf Schubladen, über dem Fach mit einem Tablar als Aktenfach. Überaus fein gestaltete Oberfläche<br />
des <strong>Möbel</strong>s mit alternierend in Hell <strong>und</strong> Dunkel furnierten Edelhölzern, gespiegelt <strong>und</strong> gefriest<br />
furniert. Die Beschläge in Form der erwähnten, vergoldeten Bronze-Quasten als Zuggriffe, Schlüssellochzierden<br />
<strong>und</strong> Kommodengriffe in Form von doppelten Voluten, darüber ein Dragoner-Trommler, verziert<br />
mit seitlichenVoluten <strong>und</strong> einer Rocaille. 194:86:60 cm. 4000.—/6000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Privatbesitz<br />
Das hier angebotene, bedeutende <strong>und</strong> aussergwöhnliche Schreibkabinett, mit seinen w<strong>und</strong>erbaren Dragoner-Trommler-Beschlägen, darf<br />
wohl zu Recht als ein eigentliches Unikat bezeichnet werden <strong>und</strong> ist in der gekonnten Anwendung der edlen Furnierhölzer, wie etwa<br />
dem sogen. Pockenholz, dem lignum vitae, welches wir u.a. auch an englischen <strong>und</strong> holländischen <strong>Möbel</strong>n der Barockzeit finden, ein<br />
herausragendes Beispiel der deutschen <strong>Möbel</strong>kunst. Den Typus des zweibogig abschliessenden Schreibkabinetts, in der Form wie an unserem<br />
Schreibmöbel, finden wir in England, von wo diese <strong>Möbel</strong>form Einzug in den hiesigen <strong>Möbel</strong>bau fand, bereits im letzten Viertel<br />
des 17. Jh., in furnierter Arbeit oder mit Lackfassung. In den Jahren um 1730-1740 taucht die englische Form der Schreibschränke in<br />
Dresden auf. Allerdings scheint sich dort die Aufsatzform mit gebrochenem, bogenförmigem <strong>und</strong> geschweiftem Aufsatz einer grösseren<br />
Beliebtheit erfreut zu haben. Den Abschluss mit Doppelbogen finden wir dort sehr viel seltener, dafür an sehr bedeutenden <strong>Möbel</strong>n, wie<br />
etwa einem mit Chinoiserien verzierten Lackschrank des Martin Schnell von 1726-1730, welcher sich ehemals in Schloss Moritzburg<br />
befand. Die verwendeten Quasten-Beschläge am Innern unseres <strong>Möbel</strong>s erinnern ebenfalls an sächsische Manufaktur. In Schloss Kronberg<br />
im Taunus (Hessische Hausstiftung) hat sich ein Schreibkabinett erhalten, das in seinem Dekor <strong>und</strong> Anwendung der hellen <strong>und</strong><br />
dunklen Furniere unserem <strong>Möbel</strong> besonders verwandt ist <strong>und</strong> um 1740 datiert wird. Sein Kommoden- <strong>und</strong> Schreibteil sprechen eine<br />
gleiche Sprache, der Aufsatz hingegen ist von schlichter Bogenform. Eine frühere Zuschreibung nach Berlin wäre aber durchaus denkbar<br />
<strong>und</strong> ist auch nicht auszuschliessen.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 65<br />
1107<br />
Register Seite 111–112
66<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1108<br />
1109 1110<br />
1108. Kanapee, Louis XV, Bern. Nussbaum mit floralem Bezug. L. = 200 cm. 1500.—/2000.—<br />
1109. Stuhl, Louis XV, Bern. Nussbaum mit gelbem Bezug. 400.—/500.—<br />
1110. Spieltisch, Louis XV, schweizerisch. Nussbaum <strong>und</strong> Wurzelmaser furniert. Geschweifte Zarge <strong>und</strong><br />
Beine auf Bocksfüssen. Aufklappbares Blatt, gespiegelt furniert, mit Filetornament eingelegt. Innenseite mit<br />
rotem Filz ausgeschlagen. 68:75:3775 cm. 1000.—/2000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 67<br />
1111<br />
1111. Schöne Kommode, Régence, Vallée du Rhône, Frankreich. Nussbaum. Dreischübiger rechteckiger<br />
Korpus, wobei die oberste Schublade zweigeteilt ist, leicht geschweifte Front, abger<strong>und</strong>ete, profilierte Eckstollen,<br />
das Blatt hervorstehend. Die leicht geschweifte Zarge mit zentralem Blumenmedaillon geht in eingerollte<br />
Beine über. 94:125:69 cm. 2000.—/3000.—<br />
1112. Schreibtisch, Louis XV, Bern, um 1750. Nussbaum. Geschweifte Beine auf Bocksfüssen, Zarge ebenfalls<br />
von vier Seiten geschweift. Mit einer durchgehenden <strong>und</strong> darunter seitlich je einer Schublade. Unter dem<br />
Tischblatt ausziehbare Ablage. Blatt mit Gold geprägtem, dunkelgrünem Leder eingelegt. Beschläge ergänzt.<br />
77:120:82 cm. 4000.—/5000.—<br />
1113. Spieltisch, Louis XVI, Bern, um 1780, Atelier Johannes Aebersold (1737–1812) zuzuschreiben.<br />
Kirschbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiges aufklappbares Blatt mit gegen aussen hervorstehenden abger<strong>und</strong>eten<br />
Ecken. Breite Zarge mit r<strong>und</strong>en kannelierten, sich gegen unten verjüngenden Beinen. Das Blatt<br />
diamantartig gefriest mit sich kontrastierendem Kirschbaumfurnier. Das Feld gerahmt von in den Ecken<br />
verschlungenen grün gefärbten <strong>und</strong> doppelt gefassten Ahornfilets. Die verschlungenen Ecken mit vierblättrigen<br />
Rosetten verziert. Aufklappbares Blatt mit grünem Filz ausgeschlagen. Dazu altes originales Spielfeld<br />
aus besticktem Gobelin. 74:85,5:42,5 (85,5) cm. 2000.—/2500.—<br />
Ehemals Schloss Greng.<br />
Register Seite 111–112
68<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1114<br />
1115<br />
1114. Kleines Kanapee, Louis XVI, französisch. Kirschbaum, mit grünem Seidenbezug. Gestell mouluriert,<br />
kanneliert <strong>und</strong> mit Schleifenornamenten beschnitzt. L = 124 cm. 2000.—/3000.—<br />
1115. Sehr bedeutende <strong>und</strong> seltene frühklassizistische Marketterie-Kommode, Norditalien, Mailand,<br />
um 1800, wohl aus der Werkstatt des Giuseppe Maggiolini (1738–1814) stammend. Rosenholz,<br />
Palisander, Nussholz <strong>und</strong> teils gefärbte Hölzer, furniert <strong>und</strong> reich markettiert. Längsformatiger Korpus auf<br />
sich nach unten verjüngenden Pyramidenbeinen. Die Front mit drei Schubladen, ohne Traversen. Zentrales<br />
Kassettenfeld mit sehr feiner Einlegearbeit in teils graviertem <strong>und</strong> gefärbtem Ahorn. Darstellend eine Amsel<br />
in einer klassizistischen Früchteschale an einem Zweige pickend. Eine Schlaufe hält das schwebende Still-<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 69<br />
1116 1117<br />
leben zusammen. Der Kassettenrahmen sehr fein mit antikisierenden Motiven <strong>und</strong> Akanthusstab umrahmt<br />
<strong>und</strong> vertieft. Die Eckstollen zu beiden Schauseiten hin mit Blumenranken in einer Amphorenvase geschmückt.<br />
Die Schmalseiten mit Kirschen- <strong>und</strong> Beerenzweigen. Die Marmorplatte später. 92:125,5:59 cm.<br />
15 000.—/20 000.—<br />
Die hier angebotene Kommode ist eine besonders schöne Mailänder Arbeit des ausgehenden 18. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> dürfte wenig vor oder<br />
wenig nach 1800 entstanden sein. Ihre qualitätvolle Marketterie, die Profilierung mit Akanthusband, die Vertiefung der Kassetten <strong>und</strong> das<br />
Sujet der frontseitigen Marketterie, lassen diese Kommode in den allernächsten Umkreis der berühmten Werkstatt des Giuseppe<br />
Maggiolini (1738-1814) oder möglicherweise auch dem Meister selbst zuschreiben. Die Marketterien der Schmalseiten erinnern in ihrer<br />
Feinheit an eine Marketterie Maggiolinis, welche sich auf einer um 1807 erhaltenen Tischplatte, Mailand, Privatbesitz, erhalten hat,<br />
ebenso die Farbigkeit der Marketterie <strong>und</strong> deren Gravur, welche an unserer Kommode sehr schön erhalten ist, <strong>und</strong> gleichermassen an<br />
einem Ziertisch, des Meisters zu finden ist, welcher ebenfalls um circa 1800 zu datieren ist. In ihrer schlichten <strong>und</strong> sehr gekonnten Gliederung<br />
der Front, ist unsere Kommode mit einem Kommodenpaar zu vergleichen, welches sich in Tremezzo, in der Villa Carlotta erhalten<br />
hat. Bei jener fehlt allerdings die für den Meister so typische Vertiefung der Kassetten, wie wir sie besonders bei Maggiolini finden<br />
<strong>und</strong> wie sie an unserer Kommode besonders schön ausgearbeitet ist. Giuseppe Maggiolini wurde 1738 in Parabiago, in der Nähe von<br />
Mailand geboren <strong>und</strong> absolvierte in frühester Jugend eine Lehre als Schreiner. Sein Talent wurde früh entdeckt, <strong>und</strong> er arbeitete in der<br />
Folge als Hofebenist der Habsburger, welche die Lombardei beherrschten, <strong>und</strong> später für die Bonapartes <strong>und</strong> ganz besonders für den<br />
Prinzen Eugène de Beauharnais.<br />
Literatur:<br />
Giuseppe Beretti, Giuseppe Maggiolini, l’Officina del Neoclassicsimo, Mailand, 1994<br />
1116. Spiegel, Louis XVI. Holz, profiliert, geschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger profilierter Rahmen mit<br />
einem Schlaufenband, die unteren Ecken mit Rosetten auf den Verbindungswürfeln. Der Aufsatz mit<br />
Schlaufen <strong>und</strong> Lorbeergirlanden. 150:70 cm. 2000.—/2500.—<br />
1117. Ungewöhnliche Kaminuhr, Wien, um 1800. Emailzifferblatt signiert Döller in Wien. Arabische St<strong>und</strong>en<strong>und</strong><br />
Datumsziffern. Mit Repetition.Viertelst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enschlag auf zwei Federn, Monatskalender.<br />
R<strong>und</strong>es Mahagonigehäuse auf Konsole mit Tatzenfüssen. Rechteckiges Sockelgeschoss. Verziert mit Draperie,<br />
zwei Putten mit Instrumenten, bekrönender Adlerfigur aus Holz oder getriebenem Messing.<br />
Minime Schadstellen am Gehäuse. H = 57,5 cm. 1800.—/2000.—<br />
Register Seite 111–112
70<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1118<br />
1118. Grosses <strong>und</strong> schönes Bureau-plat, Stil Louis XVI. Rechteckiges Blatt mit leicht abgeschrägten Ecken,<br />
auf r<strong>und</strong>en kannelierten Köcherbeinen. Leicht geschweifte Zarge, auf der einen Seite drei nebeneinanderliegende<br />
Schubladen <strong>und</strong> auf der anderen drei «Faut tiroirs» zum frei stellen. Blatt mit feinem goldgeprägtem,<br />
rotem Leder. Bronzerne Beschläge <strong>und</strong> aufgesetzte Messingprofile. 78:180:89 cm. 2500.—/3500.—<br />
1119. Ein Paar sehr feine <strong>und</strong> grosse Kaminböcke mit Hirsch- <strong>und</strong> Eberjagd. Frankreich, Paris, in Louis-<br />
XV-Ausformung der Art des Jacques Caffieri <strong>und</strong> Jean-Joseph de Saint-Germain. Bronze, vergoldet <strong>und</strong><br />
patiniert. Überaus fein ziselierte <strong>und</strong> überarbeitete Chenets mit Jagdsujets, darstellend ein Hirsch <strong>und</strong> ein<br />
Eber von Jagdh<strong>und</strong>en erfasst. Der Sockel in Form von Palmettenwerk als gerollte Voluten auf profiliertem<br />
seitlichen Sockel. 36:49 cm. 10 000.—/14 000.—<br />
Das hier angebotene, überaus prachtvolle Paar Kaminböcke, stammt aus der Werkstatt eines der grossen Pariser Bronziers. Der Schwung<br />
der vergoldetenVoluten aus Palmetten <strong>und</strong> Rollwerk, erinnert an die Arbeiten des Jacques Caffieri der mit seinem Sohn Philippe zusammen<br />
arbeitete. Die Idee der aus demVolutensockel herausragenden Tierfiguren, scheint einem Paar Chenets entnommen zu sein, welches<br />
um 1752 zu datieren ist <strong>und</strong> sich im Cleveland Museum of Art befindet. Dort findet sich ein Eberkopf von gleicher dynamischer Ausformung,<br />
wie wir sie an den Tierdarstellungen unserer Kaminböcke finden. Diese Feu à sujet de chasse sind sehr selten zu finden, wurden<br />
aber im späteren 18. Jh. auch von so berühmten Bronziers wie Quentin-Claude Pitoin hergestellt, wie etwa jenes Paar mit Hirsch <strong>und</strong><br />
Eber, welches 1772 für den Salon der Madame Du Barry nach Fontainebleau geliefert wurde <strong>und</strong> sich heute im Louvre befindet. Eine<br />
Datierung unserer Kaminböcke ist schwierig <strong>und</strong> wohl nicht eindeutig zu vollziehen.Auch wenn eine etwas verspätete Arbeit nicht ganz<br />
auszuschliessen ist, so lässt wiederum die Qualität der Bronzen eigentlich nur eine Zuweisung ins 18. Jh. zu, besonders, wenn man im<br />
Detail die Bearbeitung der Tierdarstellungen <strong>und</strong> ihrer Patinierung, aber auch die Montage der Gruppen betrachtet. Dem Meister Bronzier<br />
der hier angebotenen Kaminböcke ist mit dieser Gruppe ein Werk allerersten Ranges gelungen, in Ausformung, wie auch in Ausarbeitung.<br />
1120. Spielkonsolentisch, Louis XV. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Geschweifte Beine <strong>und</strong> Zarge, eine<br />
Schublade. Blatt mit eingelegtem Schach aus Ahorn <strong>und</strong> Nussbaum.Ausgeklappt mit schwarzem Leder ausgeschlagen.<br />
69:84:42 (84) cm. 2000.—/2500.—<br />
1121. Spieltisch, Louis XV, Bern, um 1760. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz mit Nussbaum furniert. Geschweifte<br />
Beine <strong>und</strong> Zarge, aufklappbares Blatt, gerautet. Innen mit rotemVeloursbezug ausgeschlagen.<br />
74:90,5:44,5 cm. 1500.—/2000.—<br />
1122. Spieltisch, Louis XV, Bern. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiges geschweiftes Blatt mit hervorstehenden<br />
r<strong>und</strong>en Ecken <strong>und</strong> einem erhöhten Rand. Das Feld des Blattes kreuzgefügt mit r<strong>und</strong>en Ablagen<br />
in den Ecken. Geschweifte Zarge <strong>und</strong> Beine, in Huffüssen endend. 68:88:78 cm. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 71<br />
1119<br />
Register Seite 111–112
72<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1123<br />
1124<br />
1123. Kanapee, Louis XVI, Frankreich. Nussbaum, kanneliert <strong>und</strong> mouluriert, sowie beschnitzt mit grossen<br />
Rosenblättern. Neuwertiger, hellblauer Bezug. L = 200 cm. 1500.—/1800.—<br />
1124. Kommode, Louis XVI, französisch. Mahagoni <strong>und</strong> Eiche furniert. Rechteckiger, zweischübiger Korpus<br />
mit abgeschrägten Ecken.Weiss-schwarzes Marmorblatt, Köcherbeine. 85:122:59 cm. 1000.—/1500.—<br />
1125. Kleiner Tisch, Louis XV, Bern. Nussbaum. Rechteckiges Blatt, abger<strong>und</strong>ete Ecken, erhöhter Rand, Feld<br />
mit Filets umrandet, gefriest. Geschweifte Zarge, eine Schublade, geschweifte Beine mit Bocksfüssen.<br />
70:57:73 cm. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 73<br />
1126 1127<br />
1126. Schöne Brunnenuhr, Paris, um 1780, signiert Breant. Malachit <strong>und</strong> vergoldete Bronze. Emailziffernring<br />
signiert Breant (Jean Nicolas Michel Bréant, Meister 1778–1789). H = 40 cm. 4000.—/6000.—<br />
1127. Feine Portaluhr, Paris, Empire. Vergoldete Bronze. Zifferblatt signiert Le Roy du Roi à Paris. Zu revidieren.<br />
H = 40 cm. 1500.—/2000.—<br />
1128. Kleiner Tisch, Louis XV, Bern. Kirschbaum. Rechteckiges Tischblatt mit erhöhtem Rand, geschweiften<br />
Beinen <strong>und</strong> Zarge sowie einer Schublade. Spinnenfüsse. 68:83:59 cm. 1000.—/1500.—<br />
1129. Tisch, Louis XV, schweizerisch. Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaummaser gespiegelt furniert. Geschweifte Zarge<br />
<strong>und</strong> Beine auf Bocksfüssen, eine Schublade. Blatt gespiegelt furniert mit abger<strong>und</strong>etem, erhöhtem Rand.<br />
69:83:58,5 cm. 800.—/1200.—<br />
1130. Tischchen, Louis XV, Bern. Nussbaum. Rechteckiges, profiliertes Blatt mit abgeschrägten Ecken, geschweifter<br />
Zarge mit einer Schublade, sowie geschweiften Beinen, die in Bocksfüssen enden. 70:71:53 cm.<br />
600.—/800.—<br />
1131. Tisch, Louis XV. Nussbaum. Rechteckiges Blatt mit abger<strong>und</strong>eten Ecken. Geschweifte Beine auf Huffüssen,<br />
in gewellte Zarge übergehend, eine Schublade. 78:147:79 cm. 500.—/800.—<br />
1132. Spieltisch, spätes Louis XVI, Bern. Nussbaum. Rechteckiges, aufklappbares, an den Ecken abger<strong>und</strong>etes<br />
Blatt mit breiter Zarge auf Pyramidenfüssen. Die Füsse mit schwarz eingefärbter Zierleiste bei der Zarge.<br />
Das Blatt im Inneren mit grünem Filz. 74:83,5:41,5 cm. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
74<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1133<br />
1133. Sehr schöne <strong>und</strong> grosse Kommode, «en arbalète», Régence, französisch. Eiche furniert mit Palisander<br />
<strong>und</strong> Rosenholz.Auf kurzen, leicht hervorstehenden Füssen, dreiseitig gebauchter Korpus, dieVorderseite<br />
zudem geschweift. Im oberen Teil zwei kleine Schubladen, darunter zwei breite Schubladen. Beschläge aus<br />
feuervergoldeter Bronze. Graue Marmorplatte. 88:132:62 cm. 10 000.—/15 000.—<br />
1134. Demi-Lune Konsole, Louis XVI. Kirschbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Halbr<strong>und</strong>es hervorstehendes Blatt<br />
mit einem Sternfurnier. Die Felder der breiten Zarge mit einem profilierten Stab umrandet. R<strong>und</strong>e kannelierte,<br />
sich nach unten verjüngende Füsse. Messingsabots <strong>und</strong> Messingverzierungen. 83:76:38 cm.<br />
800.—/1200.—<br />
1135. Klappspieltisch, Directoire. Kirschbaum. Rechteckiges aufklappbares Blatt, innen mit einem grünen Filz<br />
bezogen. Zarge mit Pyramidenfüssen <strong>und</strong> Messingsabots. 75:81:40 (81) cm. 800.—/1000.—<br />
1136. Tisch <strong>und</strong> sechs Stühle, Stil Empire, um 1900. Sign. Alfred Junod, Bienne. Nussbaum, massiv <strong>und</strong><br />
furniert. Rechteckiger Auszugstisch mit abgeschrägten Ecken <strong>und</strong> profiliertem Blatt, Zarge <strong>und</strong> Beine<br />
kunstvoll gearbeitet <strong>und</strong> mit Palmetten <strong>und</strong> Rosetten verziert. Die Stühle mit braunem Lederbezug.<br />
1000.—/1500.—<br />
1137. Auszugstisch, Restauration. Mahagoni. R<strong>und</strong>es Blatt mit breiter Zarge auf sich nach unten verjüngendenVierkantbeinen.<br />
Bronzesabots mit Rädern. Drei Einlageblätter. 75:128,5 cm. Die Auszüge je 43 cm.<br />
1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 75<br />
1138<br />
1139<br />
1138. Sehr schöner Bureaufauteuil, Louis XV, französisch.<br />
Buche, moulouriert <strong>und</strong> beschnitzt. Sitz <strong>und</strong> Manschetten<br />
mit Gobelinbezug. 1000.—/1500.—<br />
1139. Pendule mit Sockel, um 1770/1780. Viertelst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong><br />
St<strong>und</strong>enschlag auf zwei Glocken. Geschweiftes, Schildpatt<br />
imitierendes, bemaltes Gehäuse mit Laiton-repoussé- <strong>und</strong><br />
Bronzebeschlägen. Zu revidieren. H = 97 cm.<br />
2000.—/3000.—<br />
1140. Pendule mit Sockel, Louis XVI. Grün bemaltes, marmoriertes<br />
Gehäuse mit Messingapplikationen. Viertelst<strong>und</strong>en<strong>und</strong><br />
St<strong>und</strong>enschlag auf zwei Glocken, mit Repetition. Zu<br />
revidieren. H = 92 cm. 1500.—/2000.—<br />
1140<br />
Register Seite 111–112
76<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1141<br />
1141. Überaus feine <strong>und</strong> sehr bedeutende Commode à fleurs, frühe Transition Louis XV/Louis XVI,<br />
Frankreich, Paris, circa 1765–1770, aus der Werkstatt des Nicolas Petit 1732–1791 oder des Roger<br />
Vandercruse genannt La Croix 1727–1799 stammend. Rosenholz, Bois de Violette, Königsholz, Zitronenholz,<br />
Ahorn, Buchs <strong>und</strong> Palisander auf Eiche furniert. Dreiseitig geschweifter Korpus auf wellig ausgeschnittener<br />
Zarge <strong>und</strong> s-förmigen Beinen in feuervergoldeten Bronzesabots. Die Front mit zwei Schubladen<br />
sans traverse. Originales <strong>und</strong> seltenes, passig geschweiftes, grau-schwarz-weiss durchzogenes <strong>und</strong> profiliertes<br />
Sainte-Anne Marmordeckblatt. Schauseitig mit feinster Blumenmarketerie in bois de bout <strong>und</strong> in Rosenholzgr<strong>und</strong><br />
eingelegt. Die Blütenzweige zu kleinen Sträussen geeint, der zentrale Strauss mit einer Atlasschlaufe<br />
geb<strong>und</strong>en. Kartuschenförmiges Mittelfeld <strong>und</strong> umrahmendes äusseres Feld. Alles mit allerfeinstem filetgerahmten,<br />
verschlungenen <strong>und</strong> geometrisch angeordneten Bandwerk eingelegt. Die Ecken mit Wurzelmaser<br />
betont. Beide Schmalseiten in gleicher Manier eingelegt <strong>und</strong> umfasst. Eckstollen, Zarge <strong>und</strong> Beine mit<br />
schattierenden Furnieren gefasst. Überaus fein ziselierte Goldbronzen in Form von Chutes, Sabots,<br />
Zugringen, Schlüsselloch- <strong>und</strong> Zargenzierde. 115:89,5:57,5 cm. 60 000.—/80 000.—<br />
Nicolas Petit, 1732–1791, Meister ab 1761<br />
Roger Vandercruse dit La Croix, 1727–1799, Meister ab 1755<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Genfer Privatbesitz<br />
Unter den Pariser Ebenisten der Regierungszeiten von Louis XV <strong>und</strong> Louis XVI, zählt Nicolas Petit (1732–1791) zu den bedeutendsten.<br />
Sein ausserordentlicher Erfolg als Marchand ist sicher gleich hoch zu bewerten, wie seine kunsthandwerkliche Begabung als einer der<br />
bedeutendsten Maître Ébéniste im Dienste der Krone <strong>und</strong> des französischen Hochadels. Sein Atelier in der rue du Faubourg-Saint-<br />
Antoine, im Haus zum «Nom de Jésus», produzierte während fast 30 Jahren Werke von ausserordentlicher Qualität. Die Begabung, sich<br />
dem wandelnden Geschmack einer anspruchsvollen K<strong>und</strong>schaft nicht nur stets erfolgreichst anzupassen, sondern viel mehr die Stilveränderungen<br />
auch selber zu prägen <strong>und</strong> mitzubestimmen, waren das F<strong>und</strong>ament auf dem der Erfolg des Meisters baute.<br />
Der berühmte <strong>und</strong> frühe Erforscher der Pariser Ebenisten des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts, François Comte de Salverte, lobt den Meister bereits in<br />
seiner ersten Publikation <strong>und</strong> erwähnt besonders «son extrême variété» <strong>und</strong> rühmt «la souplesse de son talent et la sûreté de son goût»<br />
<strong>und</strong> der <strong>Möbel</strong>forscher Jean Nicolay schreibt 1956 über Petit: «la délicatesse de ses conceptions se manifeste avec toute sa grâce».<br />
Die hier angebotene Kommode ist in ihrer aussergewöhnlich feinen <strong>und</strong> ausgeglichenen Linienführung sicher eine der schönsten Arbeiten<br />
der frühen Transition. Auf sie treffen die Beschreibungen des Comte de Salverte in Bezug auf den Meister vorzüglich zu. Die Blumenmarketerie<br />
mit vollen Blüten ist in schönstem <strong>und</strong> ausgesuchtestem Veilchenholz, im seltenen Stirnschnitt, dem sogenannten bois de<br />
bout, ausgeführt. In solch ausgewogener Form <strong>und</strong> gleichermassen reich <strong>und</strong> aufwändig mit geometrischen <strong>und</strong> verschlungenen Bändern<br />
gefasste Marketerie, wie sie die hier angebotene Kommode aufweist, findet sich nur an sehr wenigen vergleichbaren Werken des<br />
Meisters <strong>und</strong> wohl nirgends in dieser vollendeten Form. Der sonst reichere Bronzeschmuck tritt an dieser Kommode nobel in den Hintergr<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> lässt die ausgezeichnete Marketerie in bestem Lichte wirken. Nur an wenigen <strong>Möbel</strong>n ist der Übergang vom Rokoko hin<br />
zum Frühklassizismus in so ausgewogener Form aufzufinden. Stilelemente beider Epochen setzen sich kunstvoll durch <strong>und</strong> bilden eine<br />
Einheit die nur Gewinnendes findet.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 77<br />
1141<br />
Register Seite 111–112
78<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1141 Kommode für die Comtesse de Provence, von Roger Vandercruse gen. La Croix,<br />
1771, gefertigt.<br />
Die sehr feine Art der Marketerie in Form von Blütenzweigen in bois de bout von Veilchenholz, wie sie unsere Kommode aus Genfer<br />
Besitz aufweist, ist ein eigentliches Markenzeichen der Werkstatt. Seine Anwendung als Dekorelement auf <strong>Möbel</strong>n des Nicolas Petit kann<br />
in die Jahre zwischen 1765 <strong>und</strong> 1775 begrenzt werden, was eine genauere Datierung der hier angebotenen Kommode, wohl in die Zeit<br />
um 1770 <strong>und</strong> wenig früher, ermöglicht. Zum Vergleich erwähnen wir hier die verwandte, sehr feine Kommode des Nicolas Petit, welche<br />
sich im Juni 1997, als Los Nr. 42, bei Sotheby’s in Monaco auf Auktion fand.<br />
Wenn wir auch die Kommode in ihrer alten Zuweisung an Nicolas Petit bestätigen, so möchten wir hier auch eine mögliche Zuweisung<br />
an den wohl bedeutendsten Wegbereiter des Frühklassizismus oder Style à la Grecque überhaupt, den Pariser Ebenisten Roger Vandercruse,<br />
genannt La Croix (1727–1799) auch nicht unerwähnt lassen.Wenn auch relativ selten angewendet, so finden sich doch mindestens<br />
auf zwei seiner bedeutendsten Werke<br />
– einem Paar Kommoden von 1771, von Gilles Joubert am 1. Juli 1771 für das Grand Cabinet der Comtesse de Provence auf Schloss<br />
Compiègne geliefert,<br />
<strong>und</strong><br />
– einer Kommode von 1772, wiederum von Gilles Joubert geliefert, diese für den Salon de Compagnie der Madame du Barry nach<br />
Schloss Versailles<br />
Blumenmarketerie, welche mit den floralen Einlagen auf unserer Kommode identisch sind <strong>und</strong> aus gleicher Hand stammen dürften.<br />
Wie an unserer Kommode weisen die Blütenzweige der drei erwähnten Kommoden ebenfalls einen abschliessenden Schrägschnitt auf,<br />
wie man ihn beim Schnitt etwa von Rosen ansetzt. Ein Detail, das wir bei Nicolas Petit seltener finden. Ebenfalls sind die zentralen Blumengebinde<br />
der drei Kommoden des Roger Vandercruse in einer Symmetrie angeordnet <strong>und</strong> geb<strong>und</strong>en, wie wir es an anderen Werken<br />
des Nicolas Petit in identischer Form nicht finden. Besonders aber gilt hier die ganze Aufmerksamkeit den beiden seitlichen Blütenzweigen<br />
<strong>und</strong> den Blütenzweigen der Schmalseiten unserer Kommode. Diese Blumen weisen volle Blüten mit angedeutetem Blütenstempel auf,<br />
mit feinen Zweigen <strong>und</strong> feinem Blattwerk. Genau solches Blumenwerk mit Blütenstempel findet sich wiederum an den drei erwähnten<br />
Kommoden von Vandercruse für Compiègne <strong>und</strong> Versailles. Diese Marketerien an allen vier Kommoden stammen möglicherweise von<br />
derselben Hand.<br />
Als Schöpfer der hier angebotenen Kommode kommen nur diese beiden Pariser Kunstschreiner Nicolas Petit <strong>und</strong> Roger Vandercruse<br />
gen. Lacroix, in Frage.<br />
Vgl. Anne Droguet, Nicolas Petit 1732-1791, Paris 2001<br />
Seite 30 zum Vergleich einer Kommode der Zeit von 1765-1770, welche verwandte Blütenmarketerie <strong>und</strong> ähnliche, wenn auch weniger<br />
ausgewogene Bandwerkrahmung aufweist, wie sie an unserer Kommode zu finden ist. Gleichermassen, Seite 36, für einen Sekretär der<br />
Zeit um 1770 mit Marketerie von gleichem Charakter.<br />
Vgl. Auktionskatalog Sotheby’s Monaco 14. Juni 1997, Los Nr. 42, für die verwandte Kommode des Nicolas Petit, jedoch mit schlichterer<br />
Bandwerk- <strong>und</strong> Filetfassung der Marketeriefelder.<br />
Vgl. Clarisse Roinet, Roger Vandercruse dit La Croix 1727–1799, Paris, 2000<br />
Seite 70 zum Vergleich der Blumenmarketerie auf der Kommode der Comtesse de Provence in Schloss Compiègne <strong>und</strong> Seite 87 für das<br />
Kommodenpaar der Comtesse du Barry, ehemals Schloss Versailles, heute Walker Art Gallery Liverpool.<br />
Vgl. Pierre Verlet, Le Mobilier Royal Français, Bd. IV, S. 67 <strong>und</strong> S. 73 mit Inventarzuweisung der drei erwähnten, königlichen Kommoden<br />
des Roger Vandercruse.<br />
A FINE AND RARE BOIS DE BOUT FLORAL MARQUETRY LOUIS XV/LOUIS XVI TRANSITIONAL COMMODE,<br />
PARIS, CIRCA 1765–1770, ATTRIBUTED TO NICOLAS PETIT AND ROGER VANDERCRUSE DIT LACROIX.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 79<br />
1141<br />
Register Seite 111–112
80<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1142<br />
1143<br />
1142. Feine Kommode, Louis XVI, Frankreich, Paris, 1780–1790. Mahagoni. Dreischübiger, rechteckiger<br />
Korpus, mit sichtbaren Traversen <strong>und</strong> r<strong>und</strong>en, hervorstehenden, kannelierten Eckstollen, die in Pyramidenfüsse<br />
übergehen. Bronzebeschläge <strong>und</strong> Verzierungen. Ein Teil der Perlstäbe fehlen. Blatt aus grau-weiss geädertem<br />
belgischem Marmor, «Gris des Ardennes». 88:128:60 cm. 5000.—/6000.—<br />
1143. Sehr schöne Konsole, Louis XVI, Frankreich, Paris, 1785. Holz, reich geschnitzt, gr<strong>und</strong>iert <strong>und</strong> vergoldet.<br />
Kannelierte Beine mit Spargelverzierung, Steg mit Mäander <strong>und</strong> Urne,Verbindungen mit Rosetten.<br />
Weisse Marmorplatte. 90:100:48 cm. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 81<br />
1144<br />
1144. Sehr bedeutende <strong>und</strong> überaus feine Kaminuhr mit Greifen <strong>und</strong> Viktoria, Frankreich, Paris,<br />
Directoire/Empire, circa 1795–1805, in der Art von Pierre-Philippe Thomire <strong>und</strong> Claude Galle.<br />
Bronze, vergoldet in Glanz- <strong>und</strong> Matt-Tönen.Tempelartiges, sehr feines Gehäuse auf schlichtem Sockel <strong>und</strong><br />
gedrückten Kugelfüssen.Vier Säulen mit korinthischen Kapitellen ruhen auf vier sehr fein ausgearbeiteten<br />
Greifen <strong>und</strong> stützen den Protico mit griechischem Giebelaufsatz. Zwischen den Säulen eine geflügelte<br />
Stützfigur als Darstellung von Tag <strong>und</strong> Nacht. Das Gehäuse mit Girlanden <strong>und</strong> Lorbeerkranz verziert,<br />
Rosetten <strong>und</strong> Rankenwerk.Weisses Emailzifferblatt mir römischen St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> arabischen Minutenzahlen,<br />
sowie arabischer Anzeige für die Monatstage. Das Werk mit Glockenschlag. H = 45 cm. 7000.—/9000.—<br />
Die hier angebotene Kaminpendule ist ein sehr feines Beispiel der erstklassigen Bronzearbeiten der Übergangszeit des Directoire zum<br />
Empire. Die Feinheit der einzelnen Figuren <strong>und</strong> Applikationen, insbesondere der liegenden <strong>und</strong> stützenden Greifen, lassen vermuten,<br />
dass unsere Pendule einer der ganz grossen Werkstätten, möglicherweise jener des Pierre-Philippe Thomire oder des Claude Galle, zugeschrieben<br />
werden darf <strong>und</strong> wohl nach einem Entwurf von Charles Percier entstanden sein könnte.<br />
Register Seite 111–112
82<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1145<br />
1146<br />
1145. Schöne Marketerie-Kommode, Stil Louis XV, 19. Jh. Eiche mit Rosenholz furniert <strong>und</strong> mit verschiedenen,<br />
zum Teil eingefärbten Hölzern reich mit Blumenmotiven eingelegt.Von drei Seiten gebauchter <strong>und</strong><br />
geschweifter Korpus. Zwei Schübe ohne sichtbare Traverse. Geschweifte Beine, die in die untere geschweifte<br />
Schublade übergehen.Vergoldete Bronzebeschläge. Profilierte rot-graue Marmorplatte. 85:114:56 cm.<br />
6000.—/8000.—<br />
1146. Kleines Kanapee, Louis XV, französisch. Buche, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt. Rosafarbener, floraler<br />
Bezug. L = 123 cm. 2000.—/3000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 83<br />
1147<br />
1147. Standuhr, Louis XV, Paris, von Thomas Lefebvre, Meister ab 1761. Rosenholz-Furnier <strong>und</strong> vergoldete<br />
Bronze. Hoher Sockel auf Tatzenfüssen, gebauchter Pendelkasten <strong>und</strong> «Tête de poupée»-Abschluss.<br />
Zifferblatt mit einge-legten Emailfeldern: St<strong>und</strong>en in römischen-, Minuten in arabischen Zahlen.Werk <strong>und</strong><br />
Zifferblatt signiert T. Lefebvre A Paris. St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> 1 ⁄2-St<strong>und</strong>enschlag auf Glocke. St<strong>und</strong>en-, Minuten- <strong>und</strong><br />
Sek<strong>und</strong>enzeiger. H = 226 cm. 8000.—/12 000.—<br />
Register Seite 111–112
84<br />
<strong>Möbel</strong><br />
DER PFYFFERSCHE GEDENKTEPPICH<br />
HOCHBEDEUTENDE SCHWEIZER WOLLSTICKEREI DES<br />
17. JAHRHUNDERTS<br />
VON 1616 BIS 2012 IN UNUNTERBROCHENEM FAMILIENBESITZ DER PFYFFERVON ALTISHOFEN<br />
1148. Hochbedeutende Wollstickerei, schweizerisch, wohl Luzern oder Basel, 1616. Hochformatiger<br />
Teppich mit umlaufender Bordüre. Blaues Feld mit rosettenartigen Buchara-Oktogonen mit Wellenkanten<br />
in Farbtönen von Rotbraun, Weiss <strong>und</strong> Blau von feinster Abstufung. Zwischen den Oktogonen mit gedrücktem<br />
Buchara-Stern sowie verkleinerten Rosetten <strong>und</strong> feinsten geometrischen Mustern als reduzierte<br />
florale Motive. Im Zentrum, noch ganz in gotischer Manier, ein gew<strong>und</strong>ener Rosenkranz, der zu allen diesen<br />
umgebenden oktogonalen Rosetten Bezug nimmt <strong>und</strong> aus diesen emporwächst, bzw. diese mit dem Kranz<br />
vereint. Inmitten des Kranzes das prachtvolle Allianzwappen zweier der bedeutendsten Familien der alten<br />
Eidgenossenschaft, mit Pfyffer von Altishofen <strong>und</strong> Püntener von Brunberg, datiert 1616 <strong>und</strong> mit den Initialen:<br />
H H P R Herr Heinrich Pfyffer Ritter<br />
<strong>und</strong><br />
F M P B Frau Maria Püntener Brunberg.<br />
Das Wappen des Ritters Heinrich Pfyffer von Altishofen ist geviert von Pfyffer von Altishofen, in Gelb, darin<br />
das schwarze Mühleisen, begleitet von drei blauen Lilien <strong>und</strong> dem Wappen des savoyischen Mauritiusordens<br />
in Form eines weissen Kleeblattkreuzes. Das Wappen der Maria Elisabeth Püntener von Brunberg, geviert,<br />
mit in Gelb ein schwarzer Stierkopf mit rotem Nasenring <strong>und</strong> in Schwarz mit gelbem Feuerstahl, überhöht<br />
von weissem Kreuz. 260:193 cm. 100 000.—/150 000.—<br />
Provenienz:<br />
Maria Elisabeth Pfyffer von Altishofen, seit 1616<br />
Durch Erbschaft in ununterbrochener Familienfolge der Pfyffer von Altishofen verblieben<br />
Zum Allianzteppich Pfyffer von Altishofen-Püntener von Brunberg aus dem Jahre 1616<br />
Die Wappen <strong>und</strong> Initialen des die Jahrzahl 1616 tragenden gestickten Textils lassen sich dem Ehepaar Heinrich Pfyffer von Altishofen <strong>und</strong><br />
Maria Elisabeth Püntener von Brunberg zuordnen:<br />
Herr Heinrich Pfyffer Ritter (H.H.P.R.) <strong>und</strong> Frau Maria Elisabeth Püntener (von) Brunberg (F.M.P.B.).<br />
Heinrich Pfyffer von Altishofen (gest. 1616) war der Sohn des berühmten Schultheiss Ludwig Pfyffer (1524–1594), der als «Schweizerkönig»<br />
in die Geschichte eingegangen ist, <strong>und</strong> dessen zweiter Gattin Jakobea Segesser von Brunegg.<br />
In guter Familientradition widmete sich Heinrich den fremden Diensten <strong>und</strong> diente als Hauptmann in savoyischen Diensten. Das<br />
Geschlecht der Pfyffer war seit einem 1576 vom Staat Luzern abgeschlossenen Vertrag tonangebend in den Beziehungen zum Hause<br />
Savoyen. Das Ritterkreuz des Maurizius- <strong>und</strong> Lazarusordens, 1434 von Herzog Amadeo VIII. von Savoyen gestiftet, 1572 von Emanuele<br />
Filiberto erneuert <strong>und</strong> von Papst Gregor XIII. gesegnet, ist im gevierten Wappen Heinrichs festgehalten <strong>und</strong> in den Initialen sein Ritterstand<br />
vermerkt.<br />
Wann er die Ehe mit Maria Elisabeth Püntener schloss ist nicht bekannt. Ihre Lebensdaten bleiben bisher im Dunkeln. Sie war die Tochter<br />
des Urner Landammanns <strong>und</strong> Ritters Ambros (gest. 1598) <strong>und</strong> dessen erster Gemahlin Ursula Magoria von Locarno. Ambros Püntener<br />
erhielt an der 1598 in Luzern stattfindenden Tagsatzung den Auftrag, die Sold- <strong>und</strong> Pensionsausstände von der französischen Krone<br />
einzufordern. Wohl als Dank <strong>und</strong> Anerkennung für diese Dienste erhielten er <strong>und</strong> seine beiden Söhne das Luzerner Ehrenbürgerrecht<br />
zugesprochen. Ob zu diesem Zeitpunkt die Tochter bereits Heinrich Pfyffer geehelicht hatte, bleibt abzuklären. Sicher ist, dass die Vermählung<br />
nach 1588 stattfand, denn Maria Elisabeths erster Gatte Jakob a Pro verstarb in diesem Jahr. Dieser war der Sohn des Urner Landammanns<br />
Peter (gest. 1585), welcher 1585 zusammen mit Ludwig Pfyffer dem französischen König keine Truppen bewilligen wollte, da der<br />
Monarch bei den beiden Soldunternehmern Schulden hatte.A Pro, welcher Jahre als Oberst in savoyischen Diensten verbracht hatte, zeigte<br />
sich skeptisch gegenüber der Ansicht Ludwig Pfyffers, dass das Haus Savoyen die wahre Stütze der Katholischen in der Schweiz sei.<br />
Die Jahrzahl «1616», die gleichzeitig das Todesjahr Heinrich Pfyffers markiert, scheint auf den ersten Blick wenig plausibel. Ein solcher<br />
«Allianzteppich» wäre eher als Anschaffung im Zuge einer Vermählung erklärbar. In diesem Fall handelt es sich wohl aber tatsächlich um<br />
einen Memorialgegenstand, den die Witwe in Auftrag gab. Beim Tod ihres ersten Mannes liess Maria Elisabeth Püntener nämlich ein<br />
Bronzerelief-Tondo mit den Wappen a Pro <strong>und</strong> Püntener <strong>und</strong> der Inschrift «bie ligt der edell vest <strong>und</strong> wiss Herr h. iacob von pro landt’s<br />
fendrich starb den 22.Tag april anno 1588 got gnad der seel – dis wapen hat machen lassen die edell tugendreiche trauw f. maria elisabetha<br />
bünterin sein gewesne egmahl» giessen 1 . Anders als bei der für den Begräbnisplatz des letzten männlichen a Pro bestimmten Bronzeplatte<br />
sollte der Allianzteppich als textiles Memorialstück an die Kinder <strong>und</strong> Kindeskinder weitergereicht werden. Die direkte männliche<br />
Deszendenz von Heinrich Pfyffer von Altishofen <strong>und</strong> Maria Elisabeth Püntener von Brunberg erlosch zwar mit ihren Enkeln<br />
Heinrich <strong>und</strong> Ludwig, dennoch verbleib der Teppich bis 2012, also fast 400 Jahre im Besitz der Familie Pfyffer.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 85<br />
1148<br />
Register Seite 111–112
86<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Wollstickerei, Schweiz, um 1609, Sammlung Schweizerisches Landesmuseum,<br />
Zürich<br />
Buchara-Muster<br />
Von grösster Bedeutung im Zusammenhang mit der hier angebotenen Wollstickerei, ist die Tatsache, dass die Stickerei selbst auf einen<br />
Buchara Teppich aus der Zeit um 1600 zurückgeht. Ein solcher Teppich muss den Herstellern unserer Stickerei also bekannt gewesen<br />
sein, möglicherweise befand sich ein solcher Teppich auch im Besitze der vermögenden Auftraggeberin, deren Familie durch ihre weiten<br />
Verbindungen nach Italien <strong>und</strong> die dadurch ermöglichten Handelsverbindungen auch direkten oder indirekten Zugang zu einer Ankaufsmöglichkeit<br />
eines solch kostbaren Knüpfteppiches besass. Die Buchara Teppiche sind von vornehmer <strong>und</strong> feiner Art. Sie sind meist<br />
sehr dünn, benötigen also eine Unterlage <strong>und</strong> waren auch deswegen wohl als Tischteppiche beliebt. Buchara Teppiche werden nicht in<br />
der Stadt Buchara selbst hergestellt, sondern waren stets Erzeugnisse der Nomadenstämme dieses grossen Turkmenengebietes. Unsere<br />
Stickerei kopiert eine solche Wollknüpferei, in ähnlicher Art, wie zwei kleinere, jedoch weniger prachtvolle Arbeiten in den Sammlungen<br />
des Schweizerischen Nationalmuseums 2 , die 1609 bzw. 1553 datiert sind, jedoch keine Wappen aufweisen <strong>und</strong> nicht in solch klarer<br />
Form direkt auf einen Orientteppich Bezug nehmen. In seiner w<strong>und</strong>erbaren Qualität der Ausführung erinnert er an die prächtige Wollstickerei,<br />
Basel, Mitte 17. Jh., welche sich in den Sammlungen der Basler SeidenfabrikatenVischer (Blaues Haus), auf Schloss Wildenstein<br />
bei Bubendorf befand <strong>und</strong> dort bereits im Inventar von 1792 aus Basler Erbschaft Werthemann-Burckhardt stammend verzeichnet wird.<br />
Wenn auch schlichter in seinem zentralen Feld, so ist der etwa 30 Jahre später zu datierende Basler Teppich doch mit unserem Teppich<br />
sehr verwandt.<br />
Der Pfyffer von Altishofen- Gedenkteppich erinnert in einzigartiger Weise an die ausserordentliche Bedeutung, den Reichtum <strong>und</strong> die<br />
frühen internationalen Beziehungen der grossen Innerschweizer Familien. Er ist von höchster nationaler Bedeutung <strong>und</strong> ein Solitär<br />
allerersten Ranges in Bezug auf seine historische <strong>und</strong> kunsthandwerkliche Stellung.<br />
Unser Dank gilt Herrn Dr. Walter R.C. Abegglen, Weggis, für die wertvolle Mithilfe bei der Katalogisierung der hier angebotenen<br />
Wollstickerei, ebenso gilt unser Dank Frau Dr. Sabine Sille, Restauratorin Historisches Museum Basel.<br />
A FINE AND HIGHLY IMPORTANT HISTORICAL WOOL EMBROIDERY WITH THE COAT OF ARMS OF PFYFFER<br />
VON ALTISHOFEN AND PÜNTENER VON BRUNBERG, SWISS, PROBABLY LUCERNE OR BASLE, DATED 1616.<br />
1<br />
August Püntener, Die Püntener, Chronik eines Urner Geschlechts, Altdorf 1991, S. 44 (Abb.)<br />
2<br />
Jenny Scheider, Textilien-Katalog der Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums Zürich, Zürich 1975, S. 37, 44–45, S. 146<br />
(Abb. 69), S. 151 (Abb. 74)<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 87<br />
1148<br />
Register Seite 111–112
88<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1149<br />
1150<br />
1149. Kaminuhr, Lyon, um 1890. Zifferblatt signiert<br />
Bailly Succr de Weibel à Lyon. Werk gemarkt<br />
Médaille d’argent Vincent & Cie. Mit Kompensationspendel.<br />
Fassoniertes, schwarz bemaltes Gehäuse<br />
mit Messsing- <strong>und</strong> Emailintarsien.<br />
H = 48,5 cm. 600.—/800.—<br />
1150. Pendule mit Sockel, Neuenburg, Ende 18. Jh.<br />
Geschweiftes, blau bemaltes Gehäuse mit Goldblumen.<br />
St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Dreiviertelst<strong>und</strong>en-<br />
Schlag. Mit Repetition <strong>und</strong> Wecker. Gehäuse <strong>und</strong><br />
Werk zu revidieren. H = 88 cm.<br />
1200.—/1500.—<br />
1151. Zwei Fauteuils, Stil Louis XV, Bern. Nussbaum<br />
mit olivgrünem Bezug. 800.—/1200.—<br />
1151<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 89<br />
1152 1153<br />
1152. Sechs Stühle, Louis XV, Bern, um 1750.<br />
Nussbaum, vier mit blauen Veloursbezügen,<br />
zwei mit crème-farbenen Bezügen. Geschweifte<br />
Beine mit Bocksfüssen, seitliche<br />
Zargen asymetrisch ausgeschnitten, trapezförmiger<br />
Sitz, rechteckiger leicht geschweifter<br />
gerader Rücken. 3000.—/4000.—<br />
1153. Schöne Kommode, Barock, deutsch,<br />
Braunschweig (?). Nussbaum, Nussbaummaser<br />
<strong>und</strong> Eibe, massiv <strong>und</strong> furniert auf<br />
Nadelholz. Rechteckiger dreischübiger Korpus,<br />
abger<strong>und</strong>ete, leicht hervorstehende vordere<br />
Eckstollen aus Eibenholz, geschweifte<br />
Front (seitlich konvex, in der Mitte konkav),<br />
mit sichtbaren Traversen. Gerade Zarge, in der<br />
Mitte eine geschweifte Stütze auf Konsolenbeinen.<br />
Das stark hervorstehende Blatt von<br />
drei Seiten geschweift <strong>und</strong> wulstartig profiliert<br />
aus Eibenholz. Die Aufsicht des Blattes<br />
mit Bandwerkeinlagen <strong>und</strong> einer Windrose<br />
eingelegt. Die seitlichen Felder ebenfalls mit<br />
Bandwerkeinlagen. Die dunklen Felder der<br />
Schubladen überaus fein mit Ahornfilets umrandet.<br />
Feine Bronzebeschläge.<br />
73:104:52 cm. 3000.—/4000.—<br />
1154<br />
1154. Fünf Stühle, Louis XV, Bern oder Westschweiz.<br />
Nussbaum, Sitze mit blau-weissen<br />
Bezügen. Geschweifte Beine <strong>und</strong> Zarge, geschwungener<br />
Rücken mit zwei Sprossen.<br />
3500.—/4500.—<br />
Register Seite 111–112
90<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1155<br />
1156<br />
1155. Sehr feines Lit-de-repos, Régence, französisch. Nussbaum, beschnitzt <strong>und</strong> mouluriert, mit grünem<br />
Samtbezug. Kurze, geschweifte Beine <strong>und</strong> Zarge, gerader Rücken «à la reine», mit kurzer Armlehne.<br />
108:190:83 cm. 4000.—/5000.—<br />
1156. Kommode, Stil Régence, 19. Jh. Nussbaum, furniert. Dreischübiger rechteckiger Korpus, wobei die<br />
oberste Schublade zweigeteilt ist. Von drei Seiten gebaucht <strong>und</strong> von der Frontseite zusätzlich geschweift.<br />
Sichtbare Traversen, Konsolenfüsse die in die geschweifte Zarge übergehen. Blatt aus rötlichem grau-weiss<br />
geädertem Marmor. 85:120:55 cm. 1500.—/2000.—<br />
1157. Kaminspiegel mit Oberbild, Louis XV, Bern, dem Atelier des Johann Friedrich Funk I zugeschrieben.<br />
Lindenholz, profiliert, beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger Rahmen, die unteren Ecken mit Voluten,<br />
die Hohlkehlen mit geschnitzten Rocaillen, oben leicht geschwungen. Der Fronton mit Rocaillen <strong>und</strong><br />
in der durchbrochenen Kartusche mit geschnitzten Rosen. Rechteckiges Oberbild mit Hirten <strong>und</strong> Herde in<br />
südlicher Landschaft. 129:55 cm. 4000.—/5000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 91<br />
1158<br />
1157<br />
1158. Schöne Serie von sechs Louis-XV-Stühlen<br />
mit Joncgeflecht, Frankreich, Lyon, der<br />
Werkstatt des Pierre Nogaret (1718–1771)<br />
zuzuschreiben. Buche, massiv <strong>und</strong> geschnitzt,<br />
Joncgeflecht. Hufförmiger Sitz über welliger<br />
Zarge mit zentraler Blumenschnitzerei. Die<br />
Beine geschweift <strong>und</strong> direkt in die Zargenmoulurierung<br />
übergehend. Am Knie verziert mit<br />
Ranken <strong>und</strong> Blüten, die Füsse mit Plamettendekor.<br />
Die Rückenlehne gebogen <strong>und</strong> die Stuhlform<br />
übernehmend. Jochförmiger Abschluss,<br />
erneut mit Blumenschnitzerei <strong>und</strong> Ranken. Ehemals<br />
in Grünblau gefasst <strong>und</strong> mit Resten der<br />
ehemaligen Fassung. 88:44:52:44 cm.<br />
3000.—/4000.—<br />
Pierre Nogaret, Meister in Lyon, ab 1745.<br />
Provenienz:<br />
Alter Schweizer Privatbesitz<br />
Die hier angebotene Serie von sehr delikat geschnitzten <strong>und</strong><br />
wohlgeformten Stühlen kann mit grosser Bestimmtheit dem<br />
berühmten Atelier des Pierre Nogaret (1718–1771) zugeschrieben<br />
werden. Die Form der Rückenlehne, die fliessenden Linien<br />
des ganzen Stuhles, aber auch die Art der Blumenschnitzerei<br />
<strong>und</strong> der weichen Moulurierung, wie wir sie an unseren<br />
Stühlen finden, sind ganz typisch für den Meister <strong>und</strong> seine<br />
Werkstatt. Ein Louis-XV-Fauteuil von gleichem Dekor <strong>und</strong><br />
Machart, fand sich 1965 auf einer Auktion in Versailles <strong>und</strong> ist<br />
abgebildet in Pierre Kjellberg, Le mobilier français du XVIII è<br />
siècle, Paris, 1998, S. 604, Abb.A. Die meisten Sitzmöbel Nogarets<br />
sind in Nussholz gearbeitet, für die gefassten <strong>Möbel</strong>, so<br />
wie die hier angebotenen sechs Stühle, verwendete er auch<br />
Buchenholz. Unsere Stühle waren ehemals in Grünblau gefasst.<br />
Reste dieser Fassung finden sich noch an versteckten<br />
Stellen. Unsere Stühle sind von besonderem Liebreiz <strong>und</strong><br />
schöner Schnitzarbeit.<br />
1159. Spiegel, Stil Louis XV, Bern. Holz, profiliert,<br />
mit geschnitztem Aufsatz, die unteren Ecken<br />
graviert <strong>und</strong> vergoldet. 102:53 cm.<br />
1500.—/2000.—<br />
1159<br />
Register Seite 111–112
92<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1160 1161<br />
1162<br />
1160. Sehr feiner <strong>und</strong> seltener Salontisch des<br />
Johannes Äbersold (1737–1812), Bern, circa<br />
1775. Kirsche, Zwetschge, Nussholz <strong>und</strong> Ahorn<br />
furniert <strong>und</strong> gefriest. Längsformatiges <strong>Möbel</strong> mit<br />
vorstehendem, randgefasstem Blatt über einschübiger,<br />
welliger Zarge <strong>und</strong> geschweiften Beinen<br />
mit spinnenartiger Fusskerbung in der Art der<br />
Funkwerkstatt. Das Blatt mit zentralem, parkettiertem<br />
Medaillon, das äussere Feld in Kirschholz.<br />
Eingefasst mit verschlungener Band- <strong>und</strong> Filetrahmung.<br />
In den Ecken mit gravierten Äbersold-<br />
Blumen. 68:87:58,5 cm. 2000.—/2500.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Berner Privatbesitz<br />
Das hier angebotene, in einem schönen, alten Zustand erhaltene<br />
Salonmöbel, ist eine sehr schöne Arbeit des Berner Ebenisten<br />
Johannes Äbersold (1737–1812) <strong>und</strong> fällt in die frühe<br />
Schaffenszeit des Meisters, um 1775. Ist der Unterbau des<br />
Tischchens noch ganz dem Rokoko verpflichtet, so erinnert<br />
der Dekor des Blattes mit seinem zentralen Medaillon <strong>und</strong> den<br />
strengen Rahmenfilets bereits an die Zeit des Frühklassizismus.<br />
Die doppelt geschweifte Zargenführung, so wie wir sie<br />
an unserem Tischchen finden, ist typisch für den Meister <strong>und</strong><br />
findet sich an einem weiteren Tischchen Äbersolds aus der<br />
Zeit um 1780, welches sich in Privatbesitz erhalten hat (Vgl.<br />
Hermann von Fischer, Johannes Äbersold, 1737–1812, Ein<br />
Berner Ebenist zwischen Mathäus Funk <strong>und</strong> Christoph<br />
Hopfengärtner, Ausstellungskatalog Schloss Jegenstorf, 2000,<br />
Seite 24, Abb. 13). Die sehr aussergewöhnliche Parketterie des<br />
zentralen Medaillons, findet sich als ganzflächiges Dekor an<br />
einer Kommode des Meisters, welche in unserem Hause, in<br />
der Mai-Auktion 2012, Los Nr. 2045 angeboten werden<br />
konnte. Diese Art der Dekorationsform, dürfte möglicherweise<br />
durch Strassburger Schreinergesellen nach Bern gekommen<br />
sein. Diese Marqueterie à la Reine, wie sie Johannes Äbersold<br />
aber auch selbst, während seines Paris-Aufenthaltes um 1767<br />
vorgef<strong>und</strong>en haben wird, war besonders in Strassburg sehr beliebt<br />
<strong>und</strong> wurde auch Marqueterie d’un réseau de losanges sur<br />
la pointe genannt (François Lévy-Coblentz, L’Art du Meuble<br />
en Alsace, Strassburg 1985, S. 465–467).<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 93<br />
1160<br />
1161<br />
1161. Sehr seltener <strong>und</strong> schöner frühklassizistischer Tisch, Bern oder Lenzburg, circa 1800–1815,<br />
möglicherweise dem Meister Samuel Hämmerli (1750–1820) zuzuschreiben. Kirsche, Nussholz,<br />
Birkenmaser, Pappelmaser <strong>und</strong> Zwetschgenholz massiv <strong>und</strong> furniert. Längsrechteckiger Tisch mit profiliertem<br />
<strong>und</strong> wenig vorstehendem Blatt über einschübiger Zarge <strong>und</strong> sich nach unten verjüngenden <strong>und</strong> kannelierten<br />
Stabbeinen. Das Blatt überaus fein eingelegt mit Birken- <strong>und</strong> Pappelmaser. Ein zentrales Medaillon,<br />
in einem sehr fein mit Filets gerahmtem Feld. 67:91:61 cm. 1000.—/1500.—<br />
Obwohl der hier angebotene Salontisch an die Arbeiten des Christoph Hopfengärtner erinnert, könnte hier ein anderer, nicht weniger<br />
begabter Meister, für seine Fertigung verantwortlich sein. Das sehr auffällige Spiel der Furnierhölzer, wie wir es hier auf dem Tischblatt<br />
finden, finden wir an einigen Arbeiten des berühmten Lenzburger Ebenisten Samuel Hämmerli. Helle Pappelmaser, darin ein Medaillon<br />
aus dunklem Ahorn oder Birkenmaser, die äussere Umrandung in Zwetschgenholz.<br />
Vgl. Fritz Bohnenblust,Von den Lenzburger Tischmachern <strong>und</strong> Ebenisten Hämmerli, in Lenzburger Neujahrs Blätter, 1962, S. 30–45.<br />
1162. Bedeutender <strong>und</strong> feiner Spiegel, Louis XVI, Bern, von Johann Friedrich Funk II (1745–1781).<br />
Geohrter Spiegelrahmen mit Fronton. Holz, profiliert, beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger, an den<br />
Ecken zum Teil hervorstehender Rahmen. Fronton mitVase <strong>und</strong> Eichenlaub-Girlande. 122:68,5 cm.<br />
5000.—/6000.—<br />
Lit. Hermann von Fischer, FONK A BERNE. S. 269, Nr 509. Ein fast identischer Spiegel abgebildet, aus Schloss La Sarraz, Musée Romand.<br />
Register Seite 111–112
94<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1163<br />
1163. Sehr feine Parketterie-Kommode, Louis XV, Frankreich, Paris, 2. Hälfte 18. Jh., signiert F. Rubestuck.<br />
Rosenholz <strong>und</strong> Bois de violette furniert «en papillon» <strong>und</strong> gefriest. Dreiseitig mehrfach geschweifter<br />
Korpus auf wellig ausgeschnittener Zarge <strong>und</strong> elegant geschweiften Beinen in frontseitigen Sabots. Profiliertes<br />
<strong>und</strong> passig geschweiftes, originales Rouge de France Marmordeckblatt. Die Front mit zwei Schubladenrängen,<br />
wobei der obere Rang mit zwei kleineren Schubladen <strong>und</strong> der untere Rang mit einer Längsschublade.<br />
Sehr feine Rokoko-Beschläge in vergoldeter Bronze, in Form von Zargenzierde, durchbrochenen<br />
Sabots, ebensolchen Chutes <strong>und</strong> aus Rocaillen <strong>und</strong> Ranken geformte Handhaben, welche für die oberen<br />
Schubladen gleichzeitig als Schlüssellochzierden dienen. Die mittleren Schlüssellochzierden noch ganz in<br />
Régence Manier gestaltet. In sehr schönem originalem Zustand. 92:114:54 cm. 12 000.—/15 000.—<br />
Provenienz:<br />
Privatbesitz<br />
Die hier angebotene Louis-XV-Kommode, mit ihren sehr feinen Linien, hat sich in unberührtem Zustand erhalten. François Rübestück,<br />
der Meister, welcher unsere Kommode schuf <strong>und</strong> signierte, wurde um 1722 in Westphalen geboren <strong>und</strong> zog, wie so viele der erfolgreichen<br />
deutschen Ebenisten, schon früh nach Paris, wo er vorerst als freier Ebenist in der Rue de la Roquette arbeitete, bevor er sein<br />
Atelier vergrösserte <strong>und</strong> wohl zu der Zeit, als er seine Meisterwürde erlangte, in die Rue de Charenton umzog. Rübestück arbeitete<br />
hauptsächlich im Stile des Louis XV, doch sind von ihm auch sehr feine Arbeiten der Louis XVI <strong>und</strong> der Transitions-Zeit erhalten.<br />
Berühmt wurde Rübestück durch seine mit Vernis Martin dekorierten Kommoden <strong>und</strong> Sekretäre. Alle seine Werke zeichnen sich durch<br />
eine besonders schöne Qualität der Schreinerarbeit aus <strong>und</strong> sind von sehr guten Proportionen, wofür die hier angebotene Kommode ein<br />
besonders schönes Beispiel ist.<br />
1164. Bedeutende Prunk-Pendule, Louis XV. Sign. Lrd. DENYS à SENLIS. Messing mit farbigem Nelkendekor<br />
aus Schildpatt über Eichengehäuse, sign. A. GOSSELIN, sowie mit Innungsstempel.Vergoldete Bronzemontur.<br />
«Treize-pièces»-Emailzifferblatt (Aufzugslöcher mit Reparaturstellen). Gebläute, ausgeschnittene Zeiger.<br />
Messingwerk sign. AUDIBERT à PARIS mit Spindelgang <strong>und</strong> 1 ⁄2-St<strong>und</strong>enschlag auf Glocke. Mit Schlüssel.<br />
H = 120 cm. 12 000.—/15 000.—<br />
Jean-Pierre Audibert, Meister ab 1756<br />
Antoine Gosselin, Meister ab 1731<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 95<br />
1164<br />
Register Seite 111–112
96<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1165<br />
1165. HOCHBEDEUTENDE UND ÜBERAUS SELTENE PENDULE MIT GROSSEM FLÖTENWERK, Holland,<br />
Amsterdam, circa 1770, von Jan Hendrik Kuhn (1751–1810), die Musikwalze bezeichnet<br />
G.C. Overman, Amsterdam. Hart- <strong>und</strong> Weichholzgehäuse mit originaler Fassung in Lindengrün. Dreiteilig,<br />
aus Konsolensockel,Werkgehäuse <strong>und</strong> Aufsatz. Dreiseitig geschweift <strong>und</strong> überaus fein bemalt in weissem,<br />
floralem Dekor. Rosenblüten, Blumenzweige, Blumenkörbe <strong>und</strong> feine Ranken, auf lindengrünem Gr<strong>und</strong>.<br />
Sehr fein ziselierter, reicher Bronzebeschlag mit seiner originalen Vergoldung. Profilleisten <strong>und</strong> Blütenvoluten,<br />
eine weibliche Maske in Strahlenkranz, umranden Sockel <strong>und</strong> Werkgehäuse. Der Aufsatz mit durchbrochener,<br />
wiederum sehr fein ziselierter Ziervase mit Blütenstrauss. Weisses Emailzifferblatt für römische<br />
St<strong>und</strong>enzahlen. Arabische Minutenzahlen <strong>und</strong> arabische Ziffern für den Kalender. Gehwerk mit Glockenschlag<br />
<strong>und</strong> Auslösung für das Flötenspielwerk.Verschiedene Melodien, abrufbar, über Walzenwerk mit Spiel<br />
auf 15 Orgelpfeifen. 10 000.—/15 000.—<br />
Die hier angebotene, aus altem Schweizer Privatbesitz stammende, prunkvolle Pendule, weist in ihrem Innern ein Flötenwerk mit<br />
15 Pfeifen auf <strong>und</strong> hat sich in einem w<strong>und</strong>erbaren Zustand erhalten. Ganz <strong>und</strong> gar unter dem Einfluss der auch in die Niederlande <strong>und</strong><br />
nach England ausstrahlenden Jaquet-Droz, dürfte die hier angebotene Pendule entstanden sein. Sie ist wohl ein Meisterwerk des Amsterdamer<br />
Uhrmachermeisters Jan Hendrik Kuhn, von dem sich unter anderem ein sehr bedeutendes Kartell aus der Zeit um 1780/90 in<br />
den Sammlungen des Rijksmuseum in Amsterdam erhalten hat, dessen Lindenholzgehäuse vom Bildhauer Jan Swart gefertigt wurde. Die<br />
überaus reichen Bronzen, ganz in einem der frühen Transition zuzuweisenden frühklassizistischen Stil, dürften wohl in einer Pariser<br />
Werkstatt gefertigt worden sein. Die florale Fassung in feinstem Vernis-Martin, delikat mit lindengrünen Gr<strong>und</strong>. Anstelle eines Glaseinsatzes,<br />
verdeckt eine reizvolle Malerei mit einem musizierenden<br />
Paar in weiter Landschaft den Blick auf das Spielwerk. Die Spielwalze<br />
aus der Werkstatt des G. C. Overmann in Amsterdem. Rückseitig<br />
der Zinnpfeifen der Klebezettel der berühmten Firma Imhof<br />
& Mukle in London, die das Werk im 19. Jh. reparierte.<br />
Vergleiche:<br />
Tardy, La pendule Française, La pendule dans le monde,<br />
3e partie, Paris, 1987, p. 265<br />
F. Faessler, S. Guye, Ed. Droz, Pierre Jaquet-Droz et son<br />
temps, La Chaux-de-Fonds, 1971<br />
Rijksmuseum Amsterdam, Inv. Nr. BK-NM-8869 für das<br />
erwähnte Kartell (Cartelklok).<br />
G.C. Overman, 1813-1863, Oranje potpourri op volksliederen<br />
voor de piano forte.<br />
1165<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 97<br />
1165<br />
Register Seite 111–112
98<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1166 1167<br />
1166. Spiegel, Louis XV, Bern. Holz, profiliert, beschnitzt,<br />
graviert <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger<br />
Rahmen, untere Ecken mit Akanthusblatt. Durchbrochener<br />
Rocaillenaufsatz. 75:50 cm.<br />
1500.—/2000.—<br />
1167. Spiegel, Louis XV/XVI. Holz, profiliert, geschnitzt,<br />
graviert <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger<br />
Rahmen, die unteren Ecken mit gravierten Akanthusblättern,<br />
die oberen abger<strong>und</strong>et. Der Aufsatz<br />
mit Urne <strong>und</strong> Lorbeergirlande. 69:42 cm.<br />
1000.—/1200.—<br />
1168<br />
1168. Schreibkommode, Louis XV, Bern, um 1745,<br />
von Mathäus Funk (1697–1783) <strong>und</strong> seinem<br />
Atelier. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger,<br />
frontseitig geschweifter Korpus mit drei<br />
Schüben, auf gedrückten Kugelfüssen <strong>und</strong> wulstförmiger<br />
Zarge <strong>und</strong> Kanten. Glatte Kommodenfront,<br />
angedeutete Traversen an den beiden oberen<br />
Schubladen. Gespiegelt furnierteSchubladenfelder,<br />
die von Federfries umrahmt sind. Die Seiten kreuzweise gefügt <strong>und</strong> ebenfalls von Federfries umrahmt. Die<br />
Klappe des Schreibaufsatzes kreuzweise gefügt mit breitem Federfries umgeben. Innen seitlich je vier abgetreppte,<br />
geschweifte Schubladen. In der Mitte oben zwei offene Doppel-Schubfächer mit dahinter je einem<br />
Schubfach. Darunter eine geschweifte Schublade <strong>und</strong> ein grosses offenes Fach. Originale, vergoldete Bronze<br />
<strong>und</strong> Messingbeschläge. 110:112:66 cm. 10 000.—/15 000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 99<br />
1169<br />
1169. Schreibkommode, Barock, Norditalien, 2. Hälfte 18. Jh.<br />
Nussbaum gespiegelt furniert, Filets aus Rosenholz <strong>und</strong> Ahorn.<br />
Dreischübiger, von drei Seiten geschweifter Korpus, geschweifte<br />
Zarge in geschweifte Beine übergehend <strong>und</strong> sichtbare<br />
Traversen. Gegen oben verjüngender Schreibaufsatz, seitlich<br />
gebaucht <strong>und</strong> geschweift mit herunterklappbarem, horizontal<br />
geschweiftem Schreibblatt. Im Fach jeweils zwei übereinander<br />
<strong>und</strong> drei nebeneinander liegende Schubladen, im ganzen sechs<br />
Schubladen. Unter der mittleren Schublade ein Geheimfach,<br />
seitlich je zwei dreieckige Fächer.Vergoldete Bronzebeschläge.<br />
118:155:63 cm. 6000.—/8000.—<br />
1170<br />
1170. Fauteuil «en cabriolet», Louis XV, Frankreich. Holz,<br />
mouluriert, beschnitzt, blaugefasst <strong>und</strong> zum Teil vergoldet.<br />
Geschweifte Zarge die in die geschweiften Füsse übergeht. U-<br />
förmiger Sitz mit Jonc-Geflecht. Ger<strong>und</strong>eter Rücken, der in<br />
die geschweiften Armlehnen übergeht. 600.—/900.—<br />
1171. Ein Paar Fauteuils, «en cabriolet», Louis XV, Bern.<br />
Kirschbaum mit floralem Seidenbezug auf gelbem Gr<strong>und</strong>.<br />
1400.—/1800.—<br />
1171<br />
Register Seite 111–112
100<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1172<br />
1172. Sehr feine <strong>und</strong> bedeutende Transition-Kommode des Johannes Äbersold <strong>und</strong> seiner Werkstatt,<br />
Bern, circa 1775. Kirsche <strong>und</strong> Zwetschge, Rüster <strong>und</strong> Ahorn, gefriest <strong>und</strong> teils gefärbt. Längsformatiger<br />
Korpus auf wellig ausgeschnittener, erhöhter Zarge <strong>und</strong> geschweiften Beinen mit frontseitigen Sabots. Die<br />
Front mit zwei Schubladen <strong>und</strong> angedeuteter Traverse. Elegant gebaucht. Die Schubladenfront mit schön<br />
gefriesten Kirschholzfeldern, gerahmt von Bandwerk mit doppelten Filets, die Ecken mit verschlungenem<br />
Motiv. Die Schmalseiten <strong>und</strong> das wenig vorstehende, profilierte Blatt in gleicher Manier furniert <strong>und</strong> mit<br />
Zwetschgenholzrahmung. Ovale Messingbeschläge mit Zuggriffen, Schlüssellochzierden <strong>und</strong> Zargenapplikation.<br />
84:118:65 cm. 25 000.—/30 000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Berner Privatbesitz<br />
Unter den Kommodenmöbeln des Johannes Äbersold (1737–1812) nimmt das hier angebotene, aus Berner Privatbesitz stammende<br />
<strong>Möbel</strong> eine wichtige Position ein. Es ist ein besonders schönes Beispiel einer Kommode der Übergangszeit vom Rokoko hin zum Frühklassizismus<br />
<strong>und</strong> kann in die Zeit um 1775 datiert werden. Hermann von Fischer, der engagierte <strong>Möbel</strong>forscher <strong>und</strong> Wiederentdecker<br />
des Berner Schreinermeisters Johannes Äbersold, bildet unsere Kommode in seinem Ausstellungskatalog ( Johannes Äbersold 1737–1812,<br />
Ein Berner Ebenist zwischen Mathäus Funk <strong>und</strong> Christoph Hopfengärtner, Schloss Jegenstorf, 2000), auf Seite 11 ab, stellt sie in Vergleich<br />
mit einer Kommode des Mathäus Funk aus der Zeit um 1765 <strong>und</strong> weist auf die unterschiedliche Anwendung des Furnierschnittes<br />
hin. Zwei Schreiner deren Kommodenformen sich hier sehr nahe kommen <strong>und</strong> sich doch im Detail gänzlich unterscheiden. Äbersold ist<br />
mit unserer Kommode ein sehr grosser Wurf hinsichtlich der Gestaltung der Oberfläche des <strong>Möbel</strong>s gelungen <strong>und</strong> wendet hier, möglicherweise<br />
erstmalig, seine typische Zargen-Zierbronze mit der zentralen Urne an, wie wir sie sonst nur an französischen <strong>Möbel</strong>n der<br />
Zeit ab 1770- <strong>und</strong> seinen <strong>Möbel</strong>n der Louis XVI-Zeit finden.Wenig vor der Entstehung der hier angebotenen Kommode, nämlich 1767<br />
hält sich Johannes Äbersold auf seiner Wanderschaft noch in Paris auf, von wo er an das Bernische Handwerksdirektorium schreibt, mit<br />
der Bitte um Bewilligung, sich als Schreinermeister in Bern niederlassen zu dürfen. Es ist anzunehmen, dass er aus Paris auch den später<br />
immer wieder verwendeten Zargenbeschlag mitnahm <strong>und</strong> ihn in Bern nachgiessen liess, ähnlich wie dies schon sein Konkurrent<br />
Mathäus Funk, dessen grosse Beschlagsgarnitur der gebauchten Kommoden in Frankreich ab circa 1740 verwendet wurden <strong>und</strong> die er<br />
wohl ebenfalls aus seinem dortigen Aufenthalt mit nach Bern zurückbrachte. Es macht Sinn, dass man gerade aus Paris, wo sich damals<br />
die besten Bronzegiesser befinden, Beschläge zum Nachgiessen mit nach Hause nimmt, wo solcher Bronzeguss zum Schmücken von<br />
Kommoden bis dahin unbekannt war.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 101<br />
1172<br />
Register Seite 111–112
102<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1173<br />
1175 1174<br />
1173. Sehr feine Kaminuhr, Empire, Paris. Restauration, Frankreich, Paris, 1.Viertel 19. Jh., Bronze vergoldet<br />
<strong>und</strong> schwarzer Marmor. Auf abgesetzten Füssen ruhender, sehr fein applizierter Marmorsockel, darüber das<br />
Werkgehäuse in Form einer jungen Dame in einem von einem Schwan gezogenen, prunkvollen Wagen.<br />
Ein kleiner H<strong>und</strong> ihr zugewandt. Emailzifferblatt. Zu revidieren. H = 32 cm. 3000.—/4000.—<br />
1174. Armlehnstuhl, Stil Empire. Mahagoni mit Bronzebeschlägen. 500.—/800.—<br />
1175. Kaminuhr, wohl Paris, um 1800. Halbst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enschlag.Vergoldete Bronze. Quaderförmiger<br />
Sockel auf Füssen, rechteckiges Uhrgehäuse mit bogenförmigem Abschluss <strong>und</strong> bekrönender Urne. Daneben<br />
knieende junge Frau. Defekter Glassturz. H = 30 cm. 1500.—/2000.—<br />
1176. Sehr bedeutende <strong>und</strong> seltene Kamingarnitur in Kugeldiorit mit Orbiculartextur. Frankreich, Empire,<br />
1.Viertel 19. Jh. Signiert Hémon à Paris. Bestehend aus einer Kaminuhr <strong>und</strong> zwei dreiarmigen Girandolen.<br />
Rechteckiger Uhrensockel auf vergoldeten Winkelfüssen. Die Sockelmanchette ebenfalls in feinster Goldbronze.<br />
Darüber das bogenartig abschliessende Werkgehäuse in feinstem Kugeldiorit gearbeitet. R<strong>und</strong>es Zifferblatt<br />
mit römischen St<strong>und</strong>enzahlen. Das Zehntagewerk signiert Hémon à Paris (1812). Halbst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong><br />
St<strong>und</strong>enschlag auf Glocke. Die reich gearbeiteten, dreiarmigen Girandolen en suite gearbeitet.<br />
H = 53,5 bzw. 58 cm. 20 000.—/25 000.—<br />
Mit Expertise von Bernard Le Gall, Quimper.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 103<br />
1176<br />
1177<br />
1177. Bureau-plat, Stil Empire. 19. Jh. Mahagoni, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiges, hervorstehendes Blatt mit<br />
abger<strong>und</strong>eten Ecken <strong>und</strong> goldgeprägtem, roten Leder. Zarge mit drei Schubladen, auf der einen-, drei<br />
«Faux-Tiroirs» auf der anderen Seite. Seitlich je eine ausziehbare Ablage. R<strong>und</strong>e Füsse durch einen Kreuzsteg<br />
verb<strong>und</strong>en. Sehr feine, vergoldete Messingbeschläge. 76:165:79 cm. 2000.—/2500.—<br />
1178. Demi-lune-Klapptisch, Restauration. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Halbr<strong>und</strong>er aufklappbarer Tisch,<br />
Blatt mit einem Sternfurnier, breite Zarge mit einer Schublade, auf sich gegen unten verjüngenden Vierkantbeinen.<br />
75:99:48,5 (99) cm. 600.—/1000.—<br />
1179. Schiefertisch, Biedermeier. Nussbaum mit Schiefereinlage. Rechteckiger Auszugstisch, zwei Auszüge<br />
(je 43 cm), breite Zarge mit zwei Schubladen, auf sich nach unten verjüngendenVierkantbeinen.<br />
77:115:85 cm. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
104<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1180<br />
1180. Sehr feiner <strong>und</strong> bedeutender Barockspiegel, Österreich, wohl Wien, 1. Viertel 18. Jh. Spiegelglas<br />
graviert <strong>und</strong> vergoldet. Hochformatiges Hauptglas, umgeben von Rahmen aus Spiegelbändern <strong>und</strong> Eckzierden.<br />
Alle mit Blumen <strong>und</strong> Rankenwerk, reich geschliffen <strong>und</strong> verziert. Die Kanten mit Goldauflagen. Sehr<br />
feines <strong>und</strong> reiches Fronton aus sieben Einzelstücken, darin wiederum Voluten, Blumenranken <strong>und</strong> stilisierte<br />
Rocaillen, sowie Blattranken. 146:72:9 cm. 8000.—/12 000.—<br />
Provenienz:<br />
Schweizer Privatbesitz<br />
Der hier angebotene, überaus reich <strong>und</strong> fein geschliffene <strong>und</strong> gänzlich aus Glasstücken gefügte Prunkspiegel, dürfte wohl von Böhmer<br />
Glasschleifern in Wien entstanden sein. Gänzlich in Spiegelglas gearbeitete <strong>und</strong> gerahmte Spiegel finden sich selten, solche mit zusätzlicher<br />
Goldhöhung, wie an unserem Spiegel, sind besonders selten. Die Idee solcher Spiegel dürfte wohl von England den Weg nach<br />
Europa <strong>und</strong> hier nach Wien <strong>und</strong> die Gebiete Böhmens <strong>und</strong> Mährens gef<strong>und</strong>en haben. Bereits im letzten Viertel des 17. Jh. finden sich in<br />
der Regierungszeit William III. ähnliche Spiegelformen in England. Die Mode der gänzlich in Glas gerahmten Spiegelgläser, wie wir sie<br />
an unserem Spiegel finden, erfährt in England aber besonders in der Regierungszeit Queen Anne, ab circa 1705 besondere Beliebtheit.<br />
Ein in seiner Form <strong>und</strong> Aufbau sehr ähnlicher Spiegel, jedoch schlichter in den Gravuren <strong>und</strong> etwas später zu datieren, hat sich in Dresden,<br />
Staatliche Kunstsammlungen, unter der Inventarnummer 51315 erhalten.<br />
1181. Ein Paar Appliquen, Stil Louis XV. Bronze, vergoldet. Dreiarmiger asymmetrischer Leuchter mit Akanthusblättern.<br />
32:30 cm. 600.—/900.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 105<br />
1180<br />
Register Seite 111–112
106<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1182 1182<br />
1183<br />
1182. Sehr feines <strong>und</strong> seltenes Lackbureau, deutsch, oder<br />
österreichisch, Berlin, Dresden oder Wien (?), circa<br />
1750–60. Weich- <strong>und</strong> Hartholz, schwarzgr<strong>und</strong>ige Lackierung<br />
mit sehr feiner, allseitiger Lackmalerei in teils reliefierter<br />
Auflage in «japanischer» Manier. Hochformatiger<br />
Korpus mit abklappbarer Schreiblade über zweischübigem,<br />
frontseitig geschweiftem Korpus mit wellig ausgeschnittener<br />
Zarge <strong>und</strong> s-förmig geschweiften Beinen. Das Innere<br />
sehr fein gegliedert, mit lederbezogenem Schreibblatt<br />
<strong>und</strong> reichem Eingerichte. Zentrales Türchen mit<br />
«Porte-montre», flankiert von je drei übereinander liegenden<br />
kleinen Schubladen <strong>und</strong> je zwei äusseren, wellig<br />
geformten Schüben. Das Äussere wie auch das Innere<br />
des <strong>Möbel</strong>s überaus fein mit «japanischem» Lack von<br />
sehr hübschen Szenen bemalt, darunter Fluss- <strong>und</strong> Parkszenen,<br />
meditierende Figuren, höfische Figuren, Figuren<br />
unter Pagoden,Vögel <strong>und</strong> Parklandschaften. Die Schubladen,<br />
Beine <strong>und</strong> Aussenlinien in Goldfarbe gerahmt.<br />
Messing-Schlüssellochzierden <strong>und</strong> seitliche Tiretten mit<br />
Lederbezug. 89:64:43 cm. 20 000.—/30 000.—<br />
Provenienz:<br />
Schweizer Privatbesitz<br />
Bei dem hier angebotenen Lackmöbel dürfte es sich um eine relativ frühe Arbeit des deutschen oder österreichischen Rokokos handeln.<br />
Eine regionale Zuweisung fällt nicht leicht, doch weist das <strong>Möbel</strong>, trotz seiner relativ bescheidenen, sehr charmanten Formgebung, eine<br />
überaus feine Lackarbeit auf, wie wir sie etwa im sächsischen Raum, gleichermassen aber auch in Berlin <strong>und</strong> in Wien vorfinden. Der<br />
Einbau eines Taschenuhrhalters, einer sogen. Porte-Montre, wie wir sie an unserem <strong>Möbel</strong> vorfinden, lässt wiederum an eine deutsche<br />
oder österreichische Provenienz denken <strong>und</strong> wäre andernorts wohl kaum zu finden. Die Tatsache, dass das <strong>Möbel</strong> zum Freistellen <strong>und</strong><br />
R<strong>und</strong>umbetrachten, als Schau- <strong>und</strong> Luxusmöbel konzipiert ist, lässt vermuten, dass es für einen nicht wenig bedeutenden Auftraggeber<br />
geschaffen wurde. Das <strong>Möbel</strong> ist ein sehr schönes Beispiel der beliebten Lackkunst mit japanischen <strong>und</strong> chinoisen Motiven, wie sie an<br />
allen deutschen Fürstenhöfen zu finden war.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 107<br />
1184<br />
1183. Rahmen mit Spiegel, Louis XV, Bern. Rechteckiger Holzrahmen,<br />
profiliert, in den Ecken mit Voluten beschnitzt <strong>und</strong><br />
vergoldet. 97:83 cm. 1000.—/1500.—<br />
1184. Schöne Kommode, Stil Louis XV, Paris, 19. Jh. Holz mit<br />
Koromandellack. Trapezförmiger zweischübiger Korpus, ohne<br />
Traversen. Von drei Seiten gebaucht <strong>und</strong> geschweift. Elegante<br />
geschweifte Beine die in die untere geschweifte Schublade<br />
übergehen. Matt- <strong>und</strong> glanzvergoldete Bronzebeschläge. Korpus<br />
mit Darstellungen von höfischen, chinesischen Szenen <strong>und</strong><br />
floralem Dekor in Flachrelief, farbig gefasst <strong>und</strong> zum Teil vergoldet.<br />
Schwarzes mit Ocker durchzogenes profiliertes Marmorblatt.<br />
5000.—/8000.—<br />
1185. Kleine Pendule mit Sockel, Paris, um 1730, signiert<br />
Langlois. Geschweiftes, mit Schildpatt <strong>und</strong> Messing belegtes<br />
Gehäuse; mit Bronzeverzierungen.Werk <strong>und</strong> Zifferblatt signiert<br />
Langlois Paris. Halbst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enschlag. Emaillierte,<br />
römische St<strong>und</strong>en <strong>und</strong> gravierte, arabische Minuten. Mit Fehlstellen.<br />
Zu revidieren. H = 38 cm. 2000.—/3000.—<br />
1185<br />
Register Seite 111–112
108<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1186<br />
1186. Sehr schöne <strong>und</strong> überaus feine Parketterie-Kommode, frühes Louis XV, Frankreich Paris, circa<br />
1740–1745, Umkreis des Charles Cressent (1685–1768). Amaranth <strong>und</strong> Satinholz, furniert <strong>und</strong> parkettiert.<br />
Seitlich geschweifter, frontseitig en arbalète geformter Korpus auf hoch- <strong>und</strong> wellig ausgeschnittener<br />
Zarge <strong>und</strong> ausstehenden Stollenfüssen. Drei Schubladenränge, der oberste Rang mit einer angedeuteten<br />
Längsschublade, die durch zwei kleinere Schübe unterteilt wird. Passig geschweiftes, grau-braun-weiss<br />
durchzogenes <strong>und</strong> fein profiliertes, originales Sainte-Anne Marmordeckblatt. Reiche, vergoldete Beschläge<br />
in Form von Handhaben, Schlüssellochzierden, Chutes, Sabots <strong>und</strong> Zargenzierde, aus Rankenwerk, Rocaillen<br />
<strong>und</strong> Voluten. Überaus feine Parkettierung in Form von diamantgefriesten Feldern, doppelt gefriestem<br />
Bandwerk <strong>und</strong> gefriestem Rahmenwerk mit Bänderrahmung. Fein abgestimmt in der Farbwirkung der verschiedenen<br />
Hölzer. 84:114:61 cm. 18 000.—/25 000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Schweizer Privatbesitz<br />
Die hier angebotene, sehr kompakte <strong>und</strong> formschöne Kommode, ist ein besonders feines <strong>und</strong> schönes Beispiel der Übergangszeit von<br />
der französischen Régence hin zur Stilrichtung des frühen Louis XV. Unsere Kommode ist von ausserordentlich schöner Furnierwahl<br />
<strong>und</strong> sauberer Ausführung. Die Schubladen innen zur Frontseite mit mehrfach verleimtem Weichholz, die Schmalseiten <strong>und</strong> das Rückbrett<br />
in feinster Eiche <strong>und</strong> die Böden in ausgesuchtem Nussholz. Diese Konstruktion zeugt von grossem kunstschreinerischem Können<br />
<strong>und</strong> ist Teil der soliden Bauart dieses <strong>Möbel</strong>s. Unter vielen ähnlichen kuranteren Kommoden der Zeit um 1740-1745 hebt sich die hier<br />
angebotene durch ihre Konstruktionsmerkmale <strong>und</strong> die sehr ausgesuchte Furnierung der Schauseiten weit ab. Die diamantförmig gestalteten<br />
Seitenfelder, umrahmt von mehrfachem Bandwerk, die sehr klar gegliederte Front mit der Armbrustform, besonders aber die ausdrucksstarke<br />
Zargenführung <strong>und</strong> die Bandwerkbegleitung der Zarge, lassen dieses sehr feine, schlichte <strong>und</strong> doch sehr elegante Kommodenmöbel<br />
in die allernächste Nähe zu den Werken des berühmten Charles Cressent hinweisen.Verschiedene Kommoden mit dieser sehr<br />
eigenwilligen Zargen- <strong>und</strong> Beingestaltung haben sich von dem berühmten Meister erhalten, darunter ganz besonders eine Kommode<br />
aus französischem Besitz, welche in Paris, Galerie Charpentier, 29.5.1933 als Los Nr. 87 verkauft wurde <strong>und</strong> eine weitere Kommode, die<br />
am 29. November 1968 als Los 259 über Auktion Palais Galliera in Paris angeboten wurde.<br />
Vgl. Alexandre Pradère, Charles Cressent, Dijon, 2003, Abb. S. 156–157 <strong>und</strong> Abb. 158.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 109<br />
1186<br />
Register Seite 111–112
110<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1187 1187<br />
1187. Zwei bedeutende Hinterglasgemälde, Innerschweiz, um 1770, wohl der Werkstatt Menteler in Zug<br />
zuzuschreiben. Zwei Schäferszenen in Parklandschaft mit antikisierenden Statuen <strong>und</strong> Ruinen.<br />
Je 39:29 cm. 6000.—/8000.—<br />
Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürften die beiden galanten Schäferszenen in der Innerschweiz entstanden sein, wo im 18. Jh. ein eigentliches<br />
europäisches Zentrum der Hinterglasmalerei war. Der «malerische» Stil könnte auf die Werkstatt der Menteler in Zug hinweisen.<br />
Sowohl Franz Thaddäus I. Menteler (1712–1789), wie auch Franz Thaddäus II. Menteler (1751–1794) waren auch als Tafelmaler tätig.<br />
Als Vorlagen haben – wie damals üblich – Kupferstiche nach den grossen Rokoko-Künstlern wie Jean-Antoine Watteau (1684–1721)<br />
oder François Boucher (1703–1770) gedient. Bei den beiden vorliegenden Werken scheinen einzelne Motive zu einem neuen gelungenen<br />
Ganzen kombiniert worden zu sein. So lässt der Blumenkranz-bindende Jüngling an den «Frühling» aus den «Vier Jahreszeiten» von<br />
François Boucher denken, das Motiv des alten Handlesers erinnert an Jean Baptiste Leprince (1734–1781), der dieses Thema mehrfach<br />
darstellte.<br />
Eine Christian Wilhelm Ernst Dietrich, genannt Dietricy (1712–1774) zugeschriebene Schäferszene, welche 2006 im deutschen Kunsthandel<br />
erschienen war, stellte exakt die Gruppe mit den vier sitzenden Damen <strong>und</strong> dem knienden Herrn dar, wie wir sie von einem unserer<br />
beiden Hinterglasgemälden her kennen. Die erklärte Wertschätzung Dietricys für die Kunst von Jean-Antoine Watteau ist bekannt.<br />
Da Dietricy auch Radierer <strong>und</strong> Kupferstecher war, könnten auch druckgraphische Blätter von ihm Vorlage für die hier angebotenen<br />
Hinterglasbilder gewesen sein.<br />
1188. Demi-Lune-Konsolentisch, Biedermeier. Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaummaser, massiv <strong>und</strong> furniert. Aufklappbarer,<br />
halbr<strong>und</strong>er Tisch, breite Zarge auf mit Rosetten beschnitzten, sich nach unten verjüngenden<br />
Vierkantfüssen, mit Messingsabots auf Rädern. Die Felder der hervorstehenden halbr<strong>und</strong>en Blätter mit<br />
einem Hell-dunkel-Filet umrandet. 76:111:55 (111) cm. 1000.—/1500.—<br />
1189. Armlehnstuhl, Louis XIV, Schweiz. Nussbaum, hellbeiger Leinenbezug. Gedrechselte Beine mit Kreuzsteg.<br />
Schnabelförmige, geschweifte Armlehnen. 500.—/700.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 111<br />
1190<br />
1190. Schöner klassizistischer Schrank, Bern, letztes Viertel 18. Jh. <strong>und</strong> später. Kirschbaum auf Nadelholz<br />
furniert, mit Ahorn- <strong>und</strong> Zwetschgeneinlagen. Rechteckiger zweitüriger Korpus, mit abgeschrägten vorderen<br />
Eckstolen auf Pyramidenfüssen. Die Felder kreuzweise gefügt, umrandet von einem Filet mit Mäanderecken<br />
die von einer eingelegten, brandgeschwärzten Blume geziert werden. Messingbeschläge, grau-schwarzes<br />
Marmorblatt ergänzt. 165:137:60 cm. 8000.—/10 000.—<br />
Register Seite 111–112
112<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1191<br />
1192<br />
1191. Sehr feine <strong>und</strong> überaus seltene monumentale Mahagoni-Kommode, Holland, wohl Amsterdam<br />
oder Den Haag, circa 1790/1800. Mahagoni, massiv <strong>und</strong> furniert, grau-weiss durchzogenes St. Anne-<br />
Marmordeckblatt. Längsformatiger Korpus auf frontseitigen, kannelierten Pyramidenbeinen, die Eckstollen<br />
geschrägt <strong>und</strong> wenig geschweift. Dreischübige Front mit abgesetztem Mittelteil. Die Schubladen mir feiner<br />
Wulstumrahmung. Fries-Intarsien <strong>und</strong> passiges, wenig vorstehendes, originales Marmordeckblatt.<br />
84:140:60 cm. 6000.—/8000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus altem Privatbesitz<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 113<br />
1193 1194<br />
Die hier angebotene, sehr ungewöhnliche <strong>und</strong> qualitätsvolle Kommode ist ein interessantes Beispiel des holländischen <strong>Möbel</strong>baus der<br />
Zeit um 1790/1800. Ganz in einem holländischen Stil gehalten, weist doch die sehr feine Marmorplatte <strong>und</strong> die elegante Architektur des<br />
<strong>Möbel</strong>s auf die Vorliebe der Holländer für französisches Mobiliar der Louis XVI-Zeit hin. Besonders in den grossen Zentren wie Den<br />
Haag, wo u.a. der berühmte Ebenist Matthijs Horrix als Hoflieferant Wilhelm V. von Oranien-Nassau, wirkte, war die elegante französische<br />
<strong>Möbel</strong>kunst sehr beliebt. Die hier angebotene Kommode dürfte wohl in Den Haag entstanden sein.<br />
1192. Kommode, Stil Louis XVI. Aus verschiedenen einheimischen <strong>und</strong> exotischen Hölzern, zum Teil eingefärbt.<br />
Rechteckiger Korpus, auf sich nach unten verjüngendenVierkantfüssen. Zweitürig mit auf jeder Seite<br />
vier Schubladen. Die Flächen eingelegt mit Darstellungen von Gauklern <strong>und</strong> Fröschen. 85:115:37 cm.<br />
1000.—/1500.—<br />
1193. Ein Paar kleine Fauteuils, Louis XVI, Paris. Nussbaum grau gefasst, kanneliert <strong>und</strong> mouluriert sowie<br />
beschnitzt mit Rosetten. Originale, eingerissene Aubusson-Bezüge mit Darstellungen aus den Fabeln von La<br />
Fontaine. 2000.—/2500.—<br />
1194. Kleine Konsole, Louis XVI, Bern. Nussbaum mit grauem Marmor. Rechteckiges profiliertes Marmorblatt,<br />
die Zarge mit Rosettenflechtband überaus fein geschnitzt, die Vebindungswürfel ebenfalls mit geschnitzten<br />
Rosetten. Unter der Zarge eine Lorbeergirlande. R<strong>und</strong>e kannelierte Füsse mit Stäbchenverzierungen.<br />
78:61:38,5 cm. 2000.—/3000.—<br />
1195. Zwei Stühle, Louis XIV. Nussbaum <strong>und</strong> Eiche. Balusterbeine mit Kreuzsteg, trapezförmiger Sitz, gerader<br />
Rücken mit drei geschweiften Quersprossen. 400.—/600.—<br />
1196. Ein Paar Zungenstühle, Stil Barock, Bern. Kirschbaum mit grünemVeloursbezug. 800.—/1000.—<br />
1197. Ein Paar Fauteuils, «en cabriolet», Louis XV, französisch. Nussbaum, mouluriert <strong>und</strong> überaus fein<br />
beschnitzt, die Lehne mit geschnitzter Rose, geblumter Zarge, die Füsse mit Rosen <strong>und</strong> Akanthus. Blaue<br />
Bezüge. 4000.—/5000.—<br />
1198. Zwei Fauteuils, «en cabriolet», Louis XV, französisch. Nussbaum, mouluriert <strong>und</strong> geschnitzt mit<br />
Gobelinbezug. Halbr<strong>und</strong>er geschweifter Sitz, Violinrücken, gepolsterte, zurückversetzte Armlehnen, geschweifte<br />
Zarge <strong>und</strong> Beine. Rückenlehne, vordere Zarge sowie die vorderen Füsse mit geschnitzten Blumenmotiven.<br />
2000.—/3000.—<br />
1199. Fauteuil, «à la reine», Louis XV, Frankreich. Nussbaum, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt. Neuerer gestickter<br />
Gobelinbezug. 1000.—/1500.—<br />
Register Seite 111–112
114<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Portrait des Johann Meinrad Guggenbichler, Mondsee.<br />
Sankt Wolfgang, Salzkammergut<br />
1200. Sehr schönes <strong>und</strong> bedeutendes Paar Putti aus der Werkstatt des Johann Meinrad Guggenbichler<br />
(1649–1723), Österreich, 1. Viertel 18. Jh. Lindenholz, geschnitzt, polychrom gefasst <strong>und</strong> teilvergoldet.<br />
Beide Putti als geflügelte Kinderfiguren mit offenen Armen <strong>und</strong> lockigem Haar. Die Beine angewinkelt, die<br />
Zehen leicht abgespreizt. Sehr virtuos gestaltete Hände mit sehr feinen Fingern. Die Flügel weit geöffnet.<br />
Wehendes Lendentuch. H = je ca. 58 cm. 20 000.—/25 000.—<br />
Provenienz:<br />
Aus Schweizer Privatbesitz<br />
Das hier angebotene Paar Putti stellt die Zeit des Barock in seiner schönsten Form dar. Beschwingt <strong>und</strong> sorgenfrei wirken die beiden gefassten<br />
Figuren, die wohl ursprünglich eine grössere uns unbekannte Altargruppe zierten. Ganz aus dem Leben gegriffen scheinen beide<br />
Figuren. Pummelige, zufriedene Kinder, wie der Bildhauer sie zu seiner Zeit auch in den Dörfern Oberösterreichs angetroffen haben<br />
wird. Sie sind natürlich <strong>und</strong> von einer w<strong>und</strong>erbaren Mimik, die den Betrachter nicht unberührt lässt. Man spürt die Hand <strong>und</strong> das Genie<br />
eines grossen Bildhauers. Der Ausdruck der Gesichter verrät den Blick auf ein grossartiges Gesamtkunstwerk, wohl eine Altargruppe, zu<br />
dem unsere Putti gehörten. Das verhaltene <strong>und</strong> charmante Kinderlächeln, gleichzeitig der überraschte Blick, die grazile Positionierung<br />
der Beine <strong>und</strong> Arme, die ausgezeichnet beobachteten <strong>und</strong> fein umgesetzten Hände, ganz besonders aber die langgestreckten, virtuosen<br />
<strong>und</strong> ganz natürlich fallenden Locken, lassen unsere beiden Putti wohl dem berühmten Bildschnitzer Johann Meinrad Guggenbichler<br />
zuweisen <strong>und</strong> sind in die beste Schaffenszeit des Künstlers, um 1706, zu datieren, als er u.a. die Figuren für den Rosenkranzaltar der<br />
Wallfahrtskirche in Sankt Wolfgang im Salzkammergut schuf. Der prächtige Altar mit seinen lebensgrossen Figuren wird geradezu umschwärmt<br />
von einem prächtigen Reigen von Putti. Sie sind sicher von gleicher Hand geschnitzt wie unsere hier angebotenen Figuren<br />
<strong>und</strong> gehören zur gleichen Familie. Meinrad Guggenbichler, eigentlich Guggenbühl, wie der Name in der Schweiz geschrieben wird,<br />
wurde am 17. April 1649 in Einsiedeln geboren. Guggenbühls Vater war Bildhauer <strong>und</strong> Baumeister, seine Lehrzeit absolvierte er, zusammen<br />
mit seinem älteren Bruder Johann Michael, in Dillingen. Im Kloster Sankt Florian bei Linz finden sich 1670 seine ersten bedeutenden<br />
Arbeiten. Als Stiftsbildhauer wirkte Guggenbichler bis zu seinem Tode für das Kloster Mondsee. Zu den herausragendsten Arbeiten<br />
seiner Werkstatt zählen u.a. die Altäre in Strasswalchen, in Mondsee, in Irrsdorf, Lochen, St. Wolfgang, Oberwang, Michaelbeuren,<br />
Rattenberg im Tirol, Oberhofen am Irrsee, sowie Arbeiten für M<strong>und</strong>erfing, Schleedorf <strong>und</strong> Maria Kirchental. Guggenbichler stirbt am<br />
10. Mai 1723 in Mondsee in Oberösterreich. Mit seinem Schmerzensmann, auch Imago Pietatis <strong>und</strong> Erbärmdebild genannt, 1706 für<br />
St.Wolfgang geschnitzt, hat der barocke Bildschnitzer seine wohl bedeutendste <strong>und</strong> eindrücklichste Holzskulptur geschaffen <strong>und</strong> bleibt<br />
mit diesem Meisterwerk unvergessen. Die hier angebotenen Putti, die wir ihm <strong>und</strong> seiner Werkstatt zuweisen möchten, erinnern an sein<br />
herausragendes Können <strong>und</strong> seine Begabung, menschliche Empfindungen zu übertragen <strong>und</strong> in Holz zu schnitzen.<br />
Vgl. M. Soffner-Loibl, E.Wageneder, Mondsee - Ehem. Benediktinerabtei <strong>und</strong> Pfarrkirche St. Michael, Passau 2009<br />
Heinrich Decker, Meinrad Guggenbichler,Wien, 1949<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 115<br />
1200<br />
Register Seite 111–112
116<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1201<br />
1201. Sekretär «à abattant», Louis XV, Paris, signiert B. Lieutaud. Rosenholz <strong>und</strong> Palisander auf Eiche furniert.<br />
Die Flächen der Türen «en papillon» kreuzweise gefügt, mit Fries umrandet. Rechteckiger Korpus mit<br />
abgeschrägten Frontstollen auf welig ausgeschnittener Zarge mit kurzen, geschweiften Beinen. Abklappbare<br />
mit rotem, goldgepresstem Leder bezogene Schreibplatte, über Fach mit Doppeltüre. Im Fach herausnehmbarer<br />
Korpus, darüber drei offene Fächer. Im Schreibabteil zentrales Fach, flankiert von je drei kleinen<br />
Schubladen, unter einem grossen Fach. Über dem Schreibfach eine Schublade.Vergoldete Bronzebeschläge<br />
<strong>und</strong> Sabots. Profilierte «Rance de Belgique» Marmorplatte. Unter der Platte mit eingeschlagener Stempelsignatur.<br />
134:92:40 cm. 10 000.—/12 000.—<br />
Balthazar Lieutaud (1749–1780) entspringt einer berühmten Ebenistenfamilie <strong>und</strong> war an der Rue Pelleterie <strong>und</strong> der Rue d’enfer tätig.<br />
Er gehörte zu den bedeutendsten Ebenisten seiner Zeit. Berühmt war Lientaud vor allem für seine Uhrengehäuse.<br />
B. Lientaud, Meister ab 1749<br />
Provenienz:<br />
Schweizer Privatbesitz<br />
1202. Cartel, Stil Louis XVI, französisch. Vergoldetes, kartuschenförmiges Bronzegehäuse mit bekrönender<br />
Vase. Lorbeergirlanden <strong>und</strong> Schlaufen. Emailzifferblatt mit römischen <strong>und</strong> arabischen Zahlen. 1 ⁄2-St<strong>und</strong>en<strong>und</strong><br />
St<strong>und</strong>enschlag. H = 69 cm. 2000.—/2500.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 117<br />
1202 1203<br />
1203. Cartel, Stil Louis XVI, Paris, 19. Jh. Vergoldetes, kartuschenförmiges Bronzegehäuse mit bekrönender<br />
Vase, Löwenkopf <strong>und</strong> -fell, Widderköpfe <strong>und</strong> Früchten. Zifferblatt signiert Ate. Cadot, 3 rue de l’Echelles.<br />
Werk signiert Bernoux Paris breveté. St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> 1 ⁄2-St<strong>und</strong>enschlag. H = 73 cm. 2800.—/3200.—<br />
1204. Ein Paar Stühle, Louis XV, Bern. Kirschbaum gebeizt, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt. Beiger, mit Blumen<br />
bestickter Gobelinbezug. Geschweifte Beine <strong>und</strong> Zarge mit Spinnenfüssen,Violinerücken. 800.—/1200.—<br />
1205. Zwei Zungenstühle, Louis XV, Bern. Nussbaum, geschweifte Beine auf Bocksfüssen, übergehend in geschweifte<br />
Zarge. Gelber Bezug. 500.—/600.—<br />
Modell nach Matthäus Funk. Siehe Hermann von Fischer, FONK «A» BERN. S. 124. Abb. 227.<br />
Register Seite 111–112
118<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1206<br />
1207<br />
1206. Schreibkommode, Régence, Bern, von Mathäus<br />
Funk um 1745. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz,<br />
furniert mit Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaummaser.<br />
Dreischübiger, rechteckiger Korpus auf gedrückten<br />
Kugelfüssen, die Front geschweift, falsche,<br />
schmale Traversen an beiden oberen Schubladen<br />
als Fries ausgebildet, die Schubladenfelder gespiegelt<br />
furniert <strong>und</strong> mit Federfries eingefasst, die<br />
seitlichen Felder kreuzweise gefügt, die Eckstollen,<br />
die Kanten des Blattes sowie die Zarge in<br />
Wulstform. Das Feld der Klappe ebenfalls kreuzgefügt<br />
mit breitem Federfries umrandet. Im Innern<br />
des Schreibfaches, seitlich je vier abgetreppte<br />
Schubladen, im Mittelteil, eine geschweifte<br />
Schublade mit darunter einem grossen, offenen<br />
Fach <strong>und</strong> darüber zwei kleinere, nebeneinander<br />
liegende Schubladen. 112:117:67 cm.<br />
10 000.—/15 000.—<br />
1207. Schreibkommode, Louis XV, Bern, um 1760.<br />
Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz mit Nussbaum <strong>und</strong><br />
Zwetschgenholz furniert (Rautenmuster). Dreischübiger<br />
Korpus, frontseitig geschweift mit falscher,<br />
gefriester Traverse auf leicht geschweiften<br />
Füssen <strong>und</strong> Zarge. Schräges Schreibabteil mit<br />
seitlich je drei geschweiften Schubladen. Vergoldete<br />
Bronzebeschläge. 115:104:65 cm.<br />
1500.—/2000.—<br />
1208<br />
1208. Seltener <strong>und</strong> feiner Spiegel, Louis XV. Holz<br />
profiliert, beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Rechteckiger<br />
Rahmen, seitlich mit schmalem Doucine-Profil,<br />
unten mit geschnitzten Ranken, Mittelkartusche,<br />
seitlich mit je einem Muschelornament. Fronton<br />
mit geschnitzten Kartuschen, flankiert von Gitterwerk-Feldern.<br />
190:100 cm. 5000.—/7000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 119<br />
1209 1210<br />
1209. Sehr seltene historische Pendule mit bekröntem<br />
Wappen der Bühler von Schwyz,<br />
Innerschweiz, Luzern oder Schwyz, 18. Jh.<br />
Ebenisiertes <strong>und</strong> geschweiftes Uhrengehäuse mit<br />
reich appliziertem Sockel <strong>und</strong> abschliessendem<br />
doppelt abgesetztem Hut. Das Zifferblatt sehr fein<br />
gearbeitet, mit grossen, römischen St<strong>und</strong>enzahlen.<br />
Das Werk mit St<strong>und</strong>enschlag. Reich appliziertes<br />
Gehäuse mit Laiton repoussé in Form von Blatt<strong>und</strong><br />
Rankenwerk <strong>und</strong> filigranem Dekor. Der<br />
Sockel mit zentralem Wappen der Schwyzer Patrizier<br />
Familie Bühler. H = 81,5 cm.<br />
2500.—/3000.—<br />
Die hier angebotene, aus altem Privatbesitz stammende Pendule ist von grösster Seltenheit. In der ganzen Pracht ihres Dekors manifestiert<br />
sich die Bedeutung <strong>und</strong> der Reichtum ihrer einstigen Besitzer-Familie, der einflussreichen <strong>und</strong> bedeutend verzweigten Bühler aus<br />
Schwyz.<br />
1210. Religieuse mit Sockel, Louis XIV, Paris, signiert Claude Raillard. Rechteckiges, in Boulle-Manier<br />
dekoriertes Gehäuse mit über Eck gestellten Säulen, oben Messinggalerie, Bronzeansätze <strong>und</strong> Hut. Werk<br />
signiert. Halbst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enschlag. Mit ergänzten Teilen. H = 92 cm. 2000.—/3000.—<br />
Register Seite 111–112
120<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1211<br />
1212<br />
1211. Bedeutende Serie von vier Fauteuils <strong>und</strong> vier Stühlen «à la reine», Stil Louis XV, Frankreich,<br />
Paris, um 1850. Holz mouluriert, beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Seltene Gobelinbezüge mit Fabelszenen nach<br />
Erzählungen von Jean de La Fontaine. 8000.—/10 000.—<br />
1212. Paravent, Frankreich, 2. Hälfte, 18. Jh. Leinwand <strong>und</strong> Ölfarbe.Vier Panele mit dekorativer Ornamentmalerei.<br />
Jede Panele. 176:60 cm. 8000.—/10 000.—<br />
1213. Prunk-Kamingarnitur, von Lenois, Paris, circa 1850. Vergoldete Bronze <strong>und</strong> Marmor. Zentrale Drei-<br />
Lebensalter-Gruppe mit urnenförmigem Uhrengehäuse. Emailzifferblatt signiert Lenois à Paris. Arabische<br />
Minuten, römische St<strong>und</strong>en, Monats- <strong>und</strong> Wochentage.Vier Zeiger. Zu revidieren. Zwei grosse Girandolen<br />
mit sieben Leuchtarmen, gestützt von drei Grazien. L = 84 bzw. H = 95,5 cm. 8000.—/12 000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 121<br />
1213<br />
Register Seite 111–112
122<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Detail von Aquarell des Heinrich Zimmer, Privatbesitz 1214<br />
1214. Sehr bedeutender Sekretär des Johannes Äbersold, Louis XVI, Bern, um 1780. Pappelmaser,<br />
Zwetschgenholz,Ahorn, teils gefärbt, sowie Birnholz. Hochformatiger Korpus mit einer profilierten Rouge<br />
Suisse Marmordeckblatt. Der Unterbau mit ausgeschnittener Zarge <strong>und</strong> Stollenfüssen. Drei Längsschubladen,<br />
darüber die abklappbare Schreiblade. Abschliessend mit wenig zurückversetzter <strong>und</strong> gekehlter Friesschublade.<br />
Das Innere sehr fein ausgestaltet mit acht kleineren <strong>und</strong> einer grösseren Schublade. Ablagefach<br />
<strong>und</strong> offenes Brieffach. Herausziehbare, dreiteilige, offene Lade, dahinter Geheimfach. Die Schreibfläche in<br />
Kirschholz furniert. Schauseitig überaus fein furniert mit gespiegelten Feldern von flammigem Pappelmaser,<br />
umrahmt von eingedunkelten Birnbaumfilets mit Ahornrand.Verschlungene Eckzierden mit Äbersoldblumen.<br />
Messingzugringe <strong>und</strong> Schlüssellochzierden. 142,5:118:51 cm. 15 000.—/20 000.—<br />
Der hier angebotene Sekretär ist wohl ein Werk der Berner Äbersold Werkstatt <strong>und</strong> darf in die Zeit um 1780 datiert werden. Unser<br />
Sekretär kann verglichen werden mit einem weiteren Sekretär Äbersolds aus Privatbesitz, der von identischem Aufbau ist <strong>und</strong> einen nur<br />
wenig vereinfachten, in den wesentlichsten Teilen aber identischen Dekor aufweist. Werden an unserem Sekretär die Flächen mit dem<br />
wirkungsvollen Pappelmaster furniert, so sind die gleichen Flächen am Sekretär aus Privatbesitz in Nussholz gehalten. Beide weisen eine<br />
identische Form der Friesschublade auf, doch ist an unserem Sekretär an Stelle eines Holzblattes ein Marmorblatt verwendet worden.<br />
Beide <strong>Möbel</strong> weisen eine Form auf, wie wir sie an einem Sekretär des Johannes Äbersold auf einem Aquarell von Heinrich Zimmer<br />
(1774–1851) vorfinden, welches sich in Privatbesitz erhalten hat. Das Aquarell zeigt ein Zimmer an der Junkerngasse Nr. 18, um 1830. Mit<br />
seiner sehr schönen Rouge Suisse Marmorplatte, wie sie auch Mathäus Funk für seine <strong>Möbel</strong> verwendete, zeigt der hier angebotene<br />
Sekretär viel Verwandtschaft mit dem französischen <strong>Möbel</strong>bau, dem sich Äbersold zeitlebens hingezogen fühlte <strong>und</strong> den er in seinen<br />
Werken aufleben lässt. In den Jahren um 1767 hielt sich Äbersold auf seiner Wanderschaft in Paris auf. Es waren die Jahre des Überganges<br />
vom Louis XV- hin zum strengeren Louis XVI-Stil, den wir heute Transition nennen. 1767 ersuchte Äbersold von Paris aus das Bernische<br />
Handwerksdirektorium um die Bewilligung, sich als Schreinermeister in Bern niederlassen zu dürfen <strong>und</strong> mit zwei Gesellen zu<br />
arbeiten, gleich wie dies sein verstorbener Vater schon getan hatte.<br />
Vgl. Hermann von Fischer, Johannes Äbersold 1737–1812 Ein Berner Ebenist zwischen Mathäus Funk <strong>und</strong> Christoph Hopfengärtner,<br />
Ausstellung, Schloss Jegenstorf, 2000. Abb. 6, S. 16, Abb 17, S. 27.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 123<br />
1214<br />
Register Seite 111–112
124<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1215<br />
1216<br />
1215. Kommode, Transition, Frankreich, wohl<br />
Elsass. Nadelholz mit Rosenholz <strong>und</strong> Bois de<br />
Violet furniert. Die Felder mit verschiedenen<br />
Hölzern, zum Teil grün lasiert, mit Quadern umrandet.<br />
Zweischübiger rechteckiger Korpus, sichtbare<br />
Traverse, abgeschrägte Eckstollen, leicht geschweifte<br />
Beine <strong>und</strong> Zarge. Die Schubladen<br />
jeweils in drei Felder eingeteilt. Bronze-Sabots,<br />
Zargenverzierung <strong>und</strong> Schlüsselschilder. Marmor<br />
aus «Brèche d’Alep». 88:110:53 cm.<br />
7000.—/8000.—<br />
1216. Poudreuse, Louis XVI, Westschweiz. Verschiedene<br />
Fruchthölzer <strong>und</strong> Stockmaser, zum Teil<br />
auf Nadelholz furniert. Rechteckiger Korpus,<br />
drei aufklappbare Fächer, das mittlere mit Spiegel,<br />
darunter drei Schubladen, auf rechteckigen Pyramidenfüssen.<br />
76:89:41 cm. 1000.—/1500.—<br />
1217. Schöner Spiegel, Empire, Bern. Holz, profiliert,<br />
beschnitzt, mit Masse verziert <strong>und</strong> vergoldet.<br />
Rechteckiger Rahmen mit verzierten Verbindungswürfeln<br />
<strong>und</strong> einem sehr fein geschnitzten<br />
Aufsatz. 136:84 cm. 1500.—/2000.—<br />
1217<br />
1218. Kanapee <strong>und</strong> vier Fauteuils, wohl Toscana,<br />
um 1800. Buche, Sitze mit grünen Bezügen.<br />
Rechteckige Sitzflächen, durchbrochene, geschnitzte<br />
Rücken, gerade Zargen mit r<strong>und</strong>en<br />
Füssen. Zu restaurieren.<br />
L. Kanapee = 104 cm. 1500.—/1800.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 125<br />
1218<br />
Register Seite 111–112
126<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1219<br />
1219. Ein Paar sehr feine, frühklassizistische Appliquen, Paris, in der Art von Jean-Louis Prieur. Bronze,<br />
matt <strong>und</strong> glanz vergoldet. Wandstück aus sich kreuzendem Blattwerk mit Beeren; daraus wachsende, doppelte<br />
Arme. Darüber Akanthusblätter <strong>und</strong> Knabenherme mit Füchtekorb. H. = 49 cm. 6000.—/8000.—<br />
Lit. Hans Ottomeyer/Peter Pröschel.Vergoldete Bronzen. S. 288, 173.<br />
1220. Vier Fauteuils «en cabriolet», Louis XVI. Holz,Weiss <strong>und</strong> mit Gris Versaille gefasst.Weisse Bezüge mit<br />
Blumenmuster. R<strong>und</strong>e kannelierte Beine mit Stäbchenverzierung. Halbr<strong>und</strong>er Sitz mit gerader moulurierter<br />
Zarge, Verbindungswürfel mit Rosette. Zurückversetzte Armlehnen mit Polstermanschetten in ovalen<br />
Rücken übergehend. Dazu zwei Stühle, Stil Louis XVI. 4000.—/6000.—<br />
1221. Vier Fauteuils «en cabriolet», Louis XVI, französisch. Buche, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt, elfenbeinfarben<br />
gefasst. Crèmefarbener, geblumter Bezug. 3000.—/4000.—<br />
1222. Kanapee mit Hocker, Louis XVI. Nussbaum mit blau gestreiftem Bezug. 800.—/1200.—<br />
1223. Vier Stühle, Louis XVI, Bern, Werkstatt Christoph Hopfengärtner. Nussbaum. Grün-weiss bestickter<br />
Bezug. Zu restaurieren. 600.—/800.—<br />
Ehemals schloss Greng.<br />
1224. Fauteuil, Louis XVI, Bern oder Westschweiz. Kirschbaum, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt, blauer Steh-<br />
Veloursbezug. 400.—/600.—<br />
1225. Sechs Stühle, Louis XVI. Nussbaum. Rechteckige Rückenlehne, trapezförmige Sitzfläche, kannelierte<br />
Pyramidenfüsse. Eckverbindungen mit Rosetten verziert. Drei Stühle aus der Epoche, drei später hergestellt.<br />
1500.—/2000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 127<br />
1220<br />
Register Seite 111–112
128<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1226<br />
1226. Aufsatzkommode, Louis XV, Bern, Werkstatt Mathäus Funk, um 1740/45. Nussbaum, massiv <strong>und</strong><br />
furniert. Dreischübiger, rechteckiger Korpus, geschweifte Front, geschweifte Zarge in Konsolenbeine übergehend.<br />
Zweitüriger Aufsatz, mit geschweifter Front <strong>und</strong> gekehltem, geschwungenem Kranz. Innen mit drei<br />
nebeneinanderliegenden Schubladen, darüber ein offenes Fach mit zwei Ablagen. Die Felder der Kommode<br />
<strong>und</strong> des Aufsatzes von drei Seiten gerautet, die zwei obersten Schubladen der Kommode mit angedeuteten<br />
Traversen.Vergoldete Schlüsselschilder <strong>und</strong> Beschläge, innen mit originalem Papier ausgeschlagen.<br />
215:108:61 cm. 16 000.—/22 000.—<br />
Vgl. Hermann von Fischer, Fonck à Berne. S. 87, Abb. 121.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 129<br />
1227 1228<br />
1227. Vier Fauteuils «à la reine», Louis XV, Frankreich. Nussbaum. Mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt mit Kartuschen<br />
<strong>und</strong> Roquillarden. 3000.—/4000.—<br />
1228. Stockuhr mit Carillon, England, 19 Jh. Holz geschwärzt <strong>und</strong> poliert mit vergoldeten Bronzeapplikationen.<br />
Teilversilbertes Messingzifferblatt, im Bogenfeld Schlagwerksabstellung <strong>und</strong> Einstellung des Carillons:<br />
Wahl zwischen Westminster-Melodie <strong>und</strong> 8-Glockengeläut. Die Seitenwände mit elegant durchbrochenem<br />
Messingdekor. St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Viertelst<strong>und</strong>enschlag mit Repetition. Schlag auf acht Glocken <strong>und</strong><br />
Feder. H = 71,5 cm. 4000.—/5000.—<br />
1229. Sechs Stühle, Restauration. Nussbaum. Trapezförmiger, lachsfarben bezogener Sitz, Rückenmedaillon<br />
der Stühle mit Medusa Kopf. Ein Stuhl unrestauriert. 600.—/900.—<br />
1230. Kanapee, Biedermeier. Nussbaum mit floralem Stoffbezug. Strenges <strong>Möbel</strong> mit geschweiften Lehnen.<br />
L = 190 cm. 800.—/1200.—<br />
1231. Drei Stühle, Biedermeier. Nussbaum. Sitz mitVeloursbezug, Rücken mit ovalem Medaillon <strong>und</strong> Palmette.<br />
600.—/900.—<br />
1232. Kanapee, Biedermeier. Nussbaum. Rechteckiges Gestell, die Seiten mit geschwungenen Schwanenhals-<br />
Lehnen <strong>und</strong> vertikalen Sprossen. Profilierte Zarge auf Konsolenfüssen. Sitzkissen <strong>und</strong> drei Rückenkissen mit<br />
senfgelbem Bezug. 500.—/700.—<br />
1233. Vier Stühle, Biedermeier. Nussbaum mit grünem Veloursbezug. Trapezförmiger Sitz, gerade Zarge mit<br />
sich nach unten verjüngenden Vierkantbeinen, durchbrochen geschnitzte gotische Kathedralenfenster-<br />
Füllungen an den Rückenlehnen. 400.—/600.—<br />
1234. Brasero, Louis XVI, Bern. Kirschbaum <strong>und</strong> Wurzelmaser. Kubusartiger Korpus mit abgeschrägten Ecken,<br />
abnehmbarem, profiliertem Blatt, auf Pyramidenfüssen. Im Inneren mit Weissmetall-Einlage. 57:34:35 cm.<br />
600.—/1000.—<br />
1235. Vitrine, Norditalien/Veneto, Klassizismus, 18/19. Jh. Holz grau gefasst, mit Blumen bemalt <strong>und</strong> zum<br />
Teil vergoldet. Rechteckiger von drei Seiten verglaster Korpus, oben geschweift. Geschnitzter <strong>und</strong> vergoldeter<br />
Aufsatz mit Kranzornament. Zwei Glastablare. 131:68:39 cm. 1500.—/1800.—<br />
Register Seite 111–112
130<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1236<br />
1237<br />
1236. Guéridon, Louis XVI, Frankreich, Paris, um 1780. Mahagoni.<br />
Ovaler, zylinderförmiger Korpus mit drei Schubladen auf<br />
vier r<strong>und</strong>en kannelierten Beinen mit einer nierenförmigen Ablage.<br />
Blatt aus weissem Marmor mit einer Messingumrandung.<br />
74:47,5:35 cm. 600.—/800.—<br />
1237. Zylinderbureau, Directoire, Frankreich. Mahagoni. Rechteckiger<br />
Korpus auf r<strong>und</strong>en sich nach unten verjüngenden<br />
Beinen. Drei nebeneinander liegende Schubladen, darüber das<br />
Schreibfach mit halbr<strong>und</strong>er, aufklappbarer Lade. Darin zwei<br />
offene Fächer <strong>und</strong> drei Schubladen, die mit Birkenmaser furniert<br />
sind. Ausziehbare Schreibplatte mit grünem Leder. Über<br />
dem Schreibfach drei weitere nebeneinanderliegende Schubladen.<br />
Blatt des Aufsatzes aus grau-weiss geädertem Marmor, das<br />
mit einer Messinggalerie umrandet ist. Das ganze <strong>Möbel</strong> mit<br />
Messing- <strong>und</strong> Ebenholz-Filets fein eingelegt. Dazu aufgesetze<br />
profilierte Messingleisten. 120:109:59 cm. 2000.—/3000.—<br />
1238. Stuhl, Louis XV. Holz grau gefasst, Rücken <strong>und</strong> Sitz mit Jonc.<br />
500.—/600.—<br />
1238<br />
1239. Bedeutende Serie von vier Fauteuils «en cabriolet»,<br />
Louis XVI, Paris, signiert Louis-Magdeleine Pluvinet.<br />
Buche, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt, ovale Rücken, mit beige/grün<br />
gestreiften, floralen Bezügen. Alle Fauteuils in der Zarge gestempelt<br />
mit «L*M*PLUVINET». 10 000.—/14 000.—<br />
Louis Magdeleine Pluvinet, Meister ab 1775.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 131<br />
1239<br />
Register Seite 111–112
132<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Emanuel Handmann, 1746: Bildnis des Johann Friedrich<br />
Funk I (1706–1775).<br />
1240. HOCHBEDEUTENDER UND ÜBERAUS SELTENER ROKOKO-KAMINSPIEGEL A PALMES, MIT<br />
OBERBILD, Bern, circa 1765–1770, von Johann Friedrich Funk I. (1706–1775). Holz, geschnitzt, in<br />
zwei Tönen vergoldet, gemattet <strong>und</strong> poliert. Hochformatiger, sehr fein <strong>und</strong> reich geschnitzter Rahmen, auf<br />
zwei seitlichen, palmetten-geschmückten Füsschen. Der seitliche äussere Rahmen innen sehr fein gekehlt<br />
<strong>und</strong> graviert, aussen aufgedoppelt mit feinsten ausstehenden <strong>und</strong> geb<strong>und</strong>enen Palmetten. Zum Fronton hin<br />
mit s-förmiger Schweifung, die Fronton-Schnitzerei flankierend. Das Fronton selbst mit jochartig abschliessendem<br />
Rahmen, geschmückt mit Blumengirlanden <strong>und</strong> Rosetten, dazwischen ein abschliessendes Podest<br />
<strong>und</strong> über diesem die überaus feine Schnitzerei, mit Köcher, Pfeil <strong>und</strong> Bogen, einer brennenden Fackel <strong>und</strong><br />
Blumenkranz. Der Spiegel zum Oberbild hin begrenzt, mit wiederum jochartigem Abschluss, geschmückt<br />
mit einer Girlande,Voluten <strong>und</strong> Blüten. Im prächtigen Oberbild, in Öl auf Leinwand gemalt, finden sich vier<br />
schlafende Nymphen, von zwei Satiren beobachtet, die sich hinter Geäst versteckt halten. Die Nymphen selbst<br />
vom Weingenuss ermattet, in Träumen versunken <strong>und</strong> wenig bedeckt, aneinandergeschmiegt liegend.Weintrauben,<br />
ein Tamburin <strong>und</strong> eine leere Schenkkanne umgeben die im Schlafe Beobachteten. Über der Szene<br />
ein Cupido, den Blick auf die beiden Schelme gerichtet, in seinen Händen zwei kleine Fackeln, an die Vergänglichkeit<br />
auch dieses Momentes erinnernd. Restauriert in Bern 1892. 213:97 cm. 20 000.—/25 000.—<br />
Provenienz:<br />
Berner Patrizierbesitz<br />
Als Leihgabe im ehemaligen Landgut der von Steiger in Tschugg bei Erlach<br />
Von allen bekannten Spiegeln der berühmten Berner Werkstatt des Johann Friedrich Funk I., ist der Kaminspiegel aus Tschugg wohl<br />
eine der schöneren Arbeiten <strong>und</strong> mit seinem Oberbild eines sehr fähigen Malers der Nachfolge des François Boucher (1703–1770), ein Solitär.<br />
In seiner prachtvollen Gestaltung ist der hier angebotene Spiegel vergleichbar mit den wenig früher entstandenen Kaminspiegeln mit<br />
Oberbild aus dem Wildtschen Haus in Basel, mit dessen Innenausstattung der vermögende Basler Kaufmann Jeremias Wildt-Socin<br />
(1705–1790), Johann Friedrich Funk I. betraute. Dieser schuf in den Jahren zwischen 1764 <strong>und</strong> 1767 die prachtvollsten Innenausstattungen<br />
mit Konsolen, Spiegeln <strong>und</strong> Marmorkaminen für das würdige Haus am Petersplatz, wo diese noch heute zu bestaunen sind.<br />
Johann Friedrich Funk I. wurde seiner Begabung entsprechend zum Bildhauer ausgebildet. Möglich wäre, dass er seine Ausbildung in<br />
Bern bei Johan Jakob Langhans (1666–1748) <strong>und</strong> Michael Langhans (1686–1755) absolvierte. Ab 1731 etablierte sich Funk hier mit einer eigenen<br />
Werkstatt. Dem hochbegabten Bildhauer wurden schon sehr bald bedeutende Aufträge übertagen, so besonders im Jahre 1735 die<br />
Schaffung eines neuen Schultheissen-Throns, ein Prunksitzmöbel für das Haupt der Republik im Berner Rathaus. Dem unternehmerisch<br />
sehr geschickten Kunsthandwerker gelang es in kaufmännischer Weitsicht, sich das Monopol für den Import <strong>und</strong> den Verkauf von<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 133<br />
1240<br />
Register Seite 111–112
134<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Glas <strong>und</strong> Spiegelglas der Herzoglich Württembergischen Spiegelmanufaktur in Stuttgart zu sichern. Dieses Monopol, welches sich auf<br />
die ganzen Gebiete der alten Eidgenossenschaft ausdehnte, sicherte Funk <strong>und</strong> seinem Unternehmen ab 1742 eine besonders vorteilhafte<br />
Situation.<br />
Es spricht aus den berühmten Funk-Spiegelrahmen <strong>und</strong> Konsolen immer auch starker französischer Einfluss <strong>und</strong> sicher gehören diese<br />
kunstvollen Schöpfungen zu den bedeutendsten Schnitzarbeiten des Rokoko ausserhalb Frankreichs. Die Arbeiten Funks sind von so feiner<br />
Virtuosität, dass man sich an die feinsten süddeutschen Stuckarbeiten erinnert fühlt. Es ist ein süddeutsches Rokoko, welches sich in<br />
diesen Rahmen <strong>und</strong> Konsolenwerken mit französischem Stilempfinden mischt.Aber nicht nur! Auch etwas Friederizianisch-Preussisches<br />
spricht aus diesen Werken <strong>und</strong> scheint ihnen gleichsam Quell der Inspiration gewesen zu sein, was ganz besonders am hier angebotenen<br />
Prunkspiegel aus altem Berner Patrizierbesitz erkennbar ist. Im Jahre 1746 flüchtete der in den Diensten Friedrichs des Grossen zu<br />
Ruhm gekommene Bildhauer <strong>und</strong> Stukkateur Johann August Nahl (1710–1781) über Bayreuth <strong>und</strong> Strassburg in die Nähe Berns, wo er<br />
das Tannengut bei Zollikofen erwarb. Berührungspunkte zwischen Nahl <strong>und</strong> Funk muss es in der Berner Zeit des Künstlers, zwischen<br />
1746 <strong>und</strong> 1755 viele gegeben haben. Nachweislich haben die beiden Bildhauer die Arbeiten am Mittelteil des Orgelprospektes im Berner<br />
Münster 1749 ausgeführt, wo wir bereits die frühe Form der Schnitzerei mit Palmetten finden, wie sie der Spiegel aus Tschugg in so<br />
reifer Form aufweist.Wer die Werke Funks, die Konsolen, Spiegel- <strong>und</strong> Bilderrahmen, die Appliken, aber auch die Arbeiten in Stein, mit<br />
den für Friedrich II. geschaffenen Werken der Kunsthandwerker um Nahl vergleicht, der wird unweigerlich Parallelen finden.<br />
Neben unserem Kaminspiegel mit Oberbild, der lange im Hause hing, hat das ehemalige Landgut der von Steiger, neben einer berühmten<br />
Bibliothek, auch andere illustre «Gäste» beherbergt. Der berühmte Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), erhielt im Jahre 1793,<br />
vermittelt durch Johannes Brodhag (Wirt des von Schiller bevorzugten Gasthauses zum Ochsen in Stuttgart) Anstellung beim Dragonerhauptmann<br />
Karl Friedrich von Steiger (1754–1841) in Bern, zur Unterrichtung von dessen Kindern. Unterrichtet wurde im Winter in<br />
Bern, im Hause der von Steiger an der Junkerngasse 51 <strong>und</strong> im Sommer in der Campagne der Familie, dem Steigerhaus, in Tschugg bei<br />
Erlach, wo Hegel auf die erwähnte, sehr bedeutende, von Christoph von Steiger d. Ae. (1651–1731) aufgebaute Bibliothek stiess.Von dieser<br />
Bibliothek machte Hegel regen Gebrauch, enthielt sie doch insbesondere eine umfangreiche Sammlung an englischer <strong>und</strong> französischer<br />
Literatur. Es war in Bern, während seiner Zeit im Hause der von Steiger, wo Hegel eine wichtige Basis für sein späteres Schaffen<br />
legen konnte.<br />
Vgl. Hermann von Fischer FONCK A BERNE, <strong>Möbel</strong> <strong>und</strong> Ausstattungen der Kunsthandwerkerfamilie Funk im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert in Bern, Bern,<br />
2001, Abb. 375, für einen stilistisch sehr verwandten Spiegel aus der Zeit um 1760–1770.<br />
A CARVED GILTWOOD ROCOCO MIRROR A PALMES BY JOHANN FRIEDRICH FUNK I. (1706–1775), Swiss, Berne, circa<br />
1765–1770, removed from the former «von Steigersche Campagne» in Tschugg<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 135<br />
Register Seite 111–112
136<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1241<br />
1242<br />
1241. Reisependulette, Empire, Wien. Rechteckiges, schwarz gefasstes<br />
Holzgehäuse mit vergoldeten Bronzeapplikationen.<br />
Viertelst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enschlag. Zifferblatt <strong>und</strong> rückseitiger<br />
Deckel signiert Johann Caspar Hartmann in Wien. H = 22 cm.<br />
1000.—/1200.—<br />
1242. Zylindersekretär, Louis XVI, schweizerisch. Eiche <strong>und</strong><br />
Kirschbaum, massiv <strong>und</strong> furniert, zum Teil auf Nadelholz. Dreischübiger<br />
rechteckiger Kommodenteil mit sichtbaren Traversen<br />
auf eingelegten Pyramidenfüssen. Schräger Schreibaufsatz mit<br />
darüber einer Schublade. Die Füllungen der Schubladen, des<br />
Schreibblattes <strong>und</strong> der Seiten mit Kirschbaum kreuzweise gefügt,<br />
von feinen Filets gefasst <strong>und</strong> mit Eiche gefriest. Die vertikalen<br />
Kanten mit einem hell-dunkel Band eingelegt. Im Inneren<br />
des Schreibfaches, seitlich jeweils getreppte Schubladen,<br />
dazwischen zwei offene Fächer mit einem Geheimfach. Darüber,<br />
durchgehend über die ganze Fläche, ein offenes schmales<br />
Fach. R<strong>und</strong>e Messingbeschläge. 126:120:61 cm.<br />
2500.—/2800.—<br />
1243<br />
1243. Brassero, Louis XVI. Rosenholz <strong>und</strong> Zebrano. Rechteckiger<br />
Korpus mit abgeschrägten Seiten, oben offen mit einem Kupfereinsatz<br />
<strong>und</strong> unten eine Schublade, auf Pyramidenfüssen mit<br />
einem Kugelabschluss aus Messing. 47:28:27 cm.<br />
600.—/800.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 137<br />
1244<br />
1244. Sehr seltene <strong>und</strong> feine frühklassizistische Kommode, Bern,<br />
um 1795–1800. Kirschholz, Birkenmaser, Ahorn <strong>und</strong> Zwetschgenholz,<br />
massiv, furniert <strong>und</strong> graviert. Zweischübiger Korpus<br />
auf hohen Pyramidenbeinen. Die Front mit abgeschrägten Eckstollen,<br />
die Schmalseiten wenig vertieft kassettiert. Zweischübig,<br />
mit Traversen. Passig ausgeschnittenes <strong>und</strong> profiliertes<br />
Rouge Suisse Marmordeckblatt. Die Flächen mit sehr feinem<br />
<strong>und</strong> flammigem Birkenmaser furniert, umrahmt von Filets <strong>und</strong><br />
sehr fein gearbeiteten Bändern. Eckstollen mit filetgerahmten<br />
Feldern <strong>und</strong> Rosette mit graviertem Edelweiss. Zugringe mit<br />
Rosetten, gefächerte Schlüssellochzierden.<br />
Provenienz:<br />
Alter Schweizer Privatbesitz<br />
88:94:53,5 cm.<br />
4000.—/5000.—<br />
Wenn auch eine Zuweisung der hier angebotenen Kommode nicht eindeutig<br />
möglich ist, so ist es durchaus denkbar, dass sie in der Hopfengärtner-Werkstatt<br />
oder aber von einem Meister, der in der berühmten Werkstatt gearbeitet hat,<br />
verfertigt worden ist. Die Kommode ist ein Unikat <strong>und</strong> ihre harmonischen Proportionen,<br />
wie auch der gekonnte Schmuck ihrer schauseitigen Oberfläche mit<br />
den flammigen Furnierbildern <strong>und</strong> den gekonnten Einlegearbeiten, verweisen<br />
auf einen grossen Meister. Die seitlichen Gravuren der Eckstollen-Rosetten mit<br />
einem Edelweiss finden sich auf keinen weiteren <strong>Möbel</strong>n <strong>und</strong> nehmen möglicherweise<br />
Bezug auf den Auftraggeber dieses w<strong>und</strong>erbaren Bernermöbels des<br />
ausgehenden 18. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
1244<br />
Register Seite 111–112
138<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1245. Hochbedeutender, grosser <strong>und</strong> historischer Basler Fre<strong>und</strong>schaftsteppich mit Wappen Burckhardt,<br />
Iselin <strong>und</strong> Merian, Basel, datiert 1838. Wolle <strong>und</strong> Seide gestickt. Quadratischer Teppich mit umlaufenden<br />
Fransen <strong>und</strong> geometrisch gestalteter Bordüre. Im Zentrum die Wappen dreier der bedeutendsten Basler<br />
Familien: Iselin, mittig, Burckhardt links <strong>und</strong> Merian zur Rechten. Die Wappen nehmen Bezug auf<br />
Catharina Burckhardt, verwitwete Merian, geborene Iselin. Die vier Eckquadrate bezeichnet: Der geliebten<br />
Frau Cath. Burckhardt.Vwt: Merian gb: Iselin Von Ihren Samtlichen Fre<strong>und</strong>innen Und Schwestern. Ihre Hand vereint<br />
das Ganze, wie Ihr Herz die Liebe Aller Ein Gegenstand der Fre<strong>und</strong>schaftlichen Erinnerung. Geweiht 1838. Der<br />
ganze Teppich in 49 gleich grosse Quadrate unterteilt, alle Quadrate umrahmt <strong>und</strong> von rotem Gr<strong>und</strong>. In<br />
diesen Gr<strong>und</strong> mit überaus feiner Stickerei in Form von Rosenblüten, Blumensträussen, Ziervögeln, Kinderszenen,<br />
fre<strong>und</strong>schaftliche Erinnerungen <strong>und</strong> Figurengruppen. 270:270 cm. 15000.—/18000.—<br />
Provenienz:<br />
Catharina Burckhardt-Iselin, 1838<br />
Basler Privatbesitz<br />
Der hier angebotene Teppich ist wohl der schönste Zeuge einer solch spätbiedermeierlichen Basler Stickerei <strong>und</strong> ist möglicherweise das<br />
besterhaltene Exemplar eines solchen Zierteppichs, der doch immerhin für den täglichen Gebrauch bestimmt war. Mit seiner w<strong>und</strong>erbaren<br />
<strong>und</strong> farbenfrohen Komposition ist dieser Basler-Teppich ein besonders wichtiges Zeitdokument <strong>und</strong> ein Unikat in Qualität <strong>und</strong><br />
Gestaltung.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 139<br />
1245<br />
Register Seite 111–112
140<br />
<strong>Möbel</strong><br />
Ein schönes Ensemble bestehend aus einer Kommode <strong>und</strong> einem Sekretär en suite<br />
von Christoph Hopfengärtner (1758–1843) <strong>und</strong> seiner Werkstatt<br />
Bereits in der Frühjahrsauktion war es uns gelungen, ein Ensemble von einem Sekretär <strong>und</strong> einer Kommode<br />
aus der Hopfengärtner-Werkstatt anbieten zu können. Dass uns ein solcher Glücksfall erneut ereilt, das freut<br />
uns ganz besonders. Auch die hier angebotene Kommode <strong>und</strong> der dazugehörige Sekretär sind, trotz vielen<br />
Erbgängen, über 200 Jahre vereint geblieben. Das zeugt von grosser Wertschätzung die die vorangegangenen<br />
Besitzer diesen seltenen <strong>und</strong> wertvollen <strong>Möbel</strong>n entgegenbrachten. Spätestens zu Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
wird man kaum mehr gewusst haben, dass die beiden <strong>Möbel</strong> einst aus einer der nobelsten Berner Werkstätten<br />
stammten. Die beiden hier angebotenen <strong>Möbel</strong> aus altem Privatbesitz, sind zwei besonders feine <strong>und</strong> in<br />
ihrem Dekor ausgewogene Beispiele der Arbeiten der Hopfengärtner-Werkstatt. Ihr Dekor mit Maserfurnier<br />
für die Front, <strong>und</strong> schlichtes gespiegeltes Furnier für die Schmalseiten, finden wir auch an einer Kommode<br />
mit Vitrinenaufsatz aus Berner Privatbesitz, welche um 1795/1800 zu datieren ist <strong>und</strong> 1986 als Nr. 15<br />
anlässlich der Hopfengärtner-Ausstellung in Schloss Jegenstorf gezeigt wurde. Der in Stuttgart, am 21. Juli<br />
1758, als Sohn eines Schreiners geborene Christoph Hopfengärtner findet sich, nach Lehr- <strong>und</strong> Wanderjahren,<br />
ab 1788 in Bern, wo er als Meistergeselle beim Ebenisten Abraham Frank Isenschmid Anstellung fand.<br />
Am 24. Mai 1792 erhält Hopfengärtner die Empfehlung zum Meisterstück, welches er im Herbst gleichen<br />
Jahres vollendet <strong>und</strong> das sich heute in Schloss Jegenstorf<br />
befindet. Im Sommer 1793 wird er zum Ebenistenmeister<br />
gewählt. Hopfengärtners eigene Werkstatt<br />
erfreute sich sehr schnell einer besonderen Beliebtheit<br />
bei einer bedeutenden K<strong>und</strong>schaft, so etwa auch der<br />
Grossfürstin Anna Feodorowna von Russland. Hopfengärtner<br />
stirbt am 24. November 1843 an der Kramgasse<br />
40 in Bern.<br />
Vgl. Hermann von Fischer, Christoph Hofpengärtner <strong>und</strong> Zeitgenossen,<br />
Ausstellungskatalog Schloss Jegenstorf, 1986, Seite 6ff.<br />
Sigm<strong>und</strong> v.Wagner: Ebenist Hopfengärtner in Bern<br />
Aquarell um 1820 (Bernisches Historisches Museum)<br />
1246<br />
1246. Sehr feine Kommode des Christoph Hopfengärtner,<br />
Bern, um 1800. Kirschbaum, Nussbaum-<br />
Maser, Ahorn, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger dreischübiger<br />
Korpus mit frontseitig abgeschrägten Stollen,<br />
auf Pyramiden-Füssen.Wenig vorstehendes, fein profiliertes<br />
Blatt mit zentralem Maserfeld, gerahmt von Filets<br />
<strong>und</strong> Kirschbaum. Stirnseitig mit umlaufendem Friesband<br />
in Hell <strong>und</strong> Dunkel. Die Schubladen mit Traversen<br />
<strong>und</strong> jeweils in drei Felder unterteilt. Diese wiederum<br />
mit sehr schönem gekröpftem Nussbaum-Maser<br />
furniert <strong>und</strong> mit sehr feinen Filets gerahmt, der äussere<br />
Rahmen mit Kirschbaum-Furnier. Messingbeschläge<br />
<strong>und</strong> Zugringe. 78:88:49 cm. 10 000.—/15 000.—<br />
1247. Sehr feiner Sekretär «à abattant», des Christoph<br />
Hopfengärtner, Bern, um 1800. Kirschbaum,<br />
Nussbaum, Nussbaum-Maser <strong>und</strong> Ahorn, massiv <strong>und</strong><br />
furniert. Hochformatiger Korpus mit frontseitig abgeschrägten<br />
Eckstollen, wenig vorstehendem Blatt, auf<br />
Pyramidenfüssen. Die Front mit zweischübigem Kommodenteil,<br />
darüber die abklappbare Schreiblade unter<br />
abschliessender Friesschublade. Das Innere des Schreibfaches<br />
mit seitlich je vier kleineren <strong>und</strong> im Mittelteil<br />
einer grösseren Schublade. Darunter einem dreigeteilten<br />
Schubfach mit Geheimfach, sowie einem grösseren<br />
<strong>und</strong> kleinerem offenen Fach. Das Äussere der Schubladen,<br />
dreigeteilt mit flammigen Nussbaumfeldern<br />
furniert, gerahmt mit Ahornfilets <strong>und</strong> Kirschbaum.<br />
Das Blatt mit umlaufendem Band in Hell <strong>und</strong> Dunkel.<br />
Messingbeschläge <strong>und</strong> Zugringe. 140:101:51 cm.<br />
10 000.—/15 000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 141<br />
1247<br />
Register Seite 111–112
142<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1248<br />
1249 1250<br />
1248. Kaminuhr, Restauration, französisch. Rechteckiges, patiniertes<br />
Messinggehäuse mit bekrönender Doppelhenkelschale. Mit Applikationen<br />
aus vergoldeter Bronze. Halbst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enschlag auf<br />
Glocke. H = 40 cm. 2000.—/2500.—<br />
1249. Kaminuhr, Rorschach, Restauration. Reliefiertes Zifferblatt aus<br />
vergoldeter Bronze mit römischen Ziffern, signiert J. Bischoff Uhrmacher<br />
in Rorschach. Halbst<strong>und</strong>enschlag. Hochrechteckiges Alabastergehäuse,<br />
frontal mit Blumen- <strong>und</strong> Blattapplikationen. Mit Holzsockel<br />
<strong>und</strong> Glassturz. Kleine Reparaturstellen. H = 48 cm.<br />
600.—/800.—<br />
1250. Œil-de-bœuf, Directoire. Patiniertes Gehäuse mit Bronzelunette<br />
<strong>und</strong> Messingknauf. Mit Repetition <strong>und</strong> Wecker. H = 33 cm.<br />
1500.—/2000.—<br />
1251. Grosser Korbleuchter, Stil Louis XV. Bronze, vergoldet, mit<br />
Kristallglasbehang. 120:70 cm. 2000.—/4000.—<br />
1251<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 143<br />
1252<br />
1252. Ein Paar schöne Leuchtappliquen, Empire, Paris, um 1808, in der Art von Claude Galle zugeschreiben.<br />
Bronze, matt <strong>und</strong> glanz vergoldet.Vierarmige Leuchter. Der Mittelschaft als Kore mit Flügeln<br />
die auf einer Kugel steht. An den Tüllen der zwei vorderen geschwungenen Leuchterarme befinden sich je<br />
ein grotesker Kopf <strong>und</strong> an den Tüllen der seitlichen Arme geflügelte Löwen (Chimären) <strong>und</strong> Palmetten.Auf<br />
der Rückseite einer Applique sind die PunzenVR 62 eingeschlagen. 58:30:20 cm. 4000.—/6000.—<br />
Lit. Marie-France/Dupuy-Baylet. L’HEURE LE FEU LA LUMIÈRE. Edition Faton. S. 60. Dort ist ein identischer Leuchter abgebildet.<br />
Register Seite 111–112
144<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1253<br />
Kommode von J. Äbersold, um 1775, Privatbesitz<br />
1253. Zwei Fauteuils <strong>und</strong> drei Stühle, «en cabriolet», Louis XVI, Schweiz. Nussbaum <strong>und</strong> Kirsche mit<br />
braunem Lederbezug. Medaillonrücken mit U-förmigem Sitz, sich gegen unten verjüngende, gerade kannelierte<br />
Beine. 3000.—/4000.—<br />
1254. Sehr feine <strong>und</strong> bedeutende Parketterie-Kommode, Louis XVI, Bern, um 1780, eine Arbeit des<br />
Johannes Äbersold (1737–1812). Nussbaum, Fruchtholz <strong>und</strong> Ahorn massiv, furniert <strong>und</strong> teils graviert.<br />
Längsformatiger, eleganter Korpus mit ausgeschnittener Zarge <strong>und</strong> sich nach unten verjüngenden, kantigen<br />
Beinen in vergoldeten Bronze-Sabots. Die Front zweischübig, sans traverse, mit seitlich geschrägten Eckstollen.<br />
In drei Felder unterteiltes Furnierbild der Schubladenfronten. Flammiger Nussbaum-Wurzelmaser<br />
gespiegelt furniert, gerahmt mit von feinen Filets gerahmtem, in den Ecken verschlungenem Bandwerk.<br />
Gravierte Blüten als Eckzierden. Gleichermassen gestaltete Stollen <strong>und</strong> Schmalseiten. Das Deckblatt wenig<br />
vorstehend, passig ausgeschnitten <strong>und</strong> profiliert. Ebenfalls mit sehr feinem gespiegeltem Furnierfeld, fein<br />
gerahmt <strong>und</strong> mit Blüten verziert. Vergoldete Bronzebeschläge in Form von Stollenrosetten, Zugringen,<br />
Zargen- <strong>und</strong> Schlüssellochzierden. 87:121:55 cm. 15 000.—/20 000.—<br />
Die hier angebotene Kommode ist von aussergewöhnlicher Qualität <strong>und</strong> ein hervorragendes Beispiel der hochwertigen Produktion des<br />
berühmten Berner Ateliers. Das <strong>Möbel</strong>, ganz klar <strong>und</strong> rein in den Formen des Frühklassizismus gehalten, kann in die Zeit um 1780 datiert<br />
werden. Sie ist mit ihrem sehr schönen Deckblatt in ausgesuchtem Nussbaumholz eine eigentliche Weiterentwicklung eines Kommodenmodelles<br />
aus der sogen.Transitionszeit um 1770–1775, zwischen den Stilen des Louis XV <strong>und</strong> Louis XVI. Eine solche Kommode<br />
fand sich, aus Berner Patrizierbesitz, 1988, bei Sotheby’s Zürich, Los Nr. 381, angeboten. Zeigen sich dort noch zurückhaltend die<br />
Schwünge der Beine <strong>und</strong> Zargenschürze in der Art des späten Rokoko, so weist unsere Kommode eine sehr viel ausgeglichenere Stilfestigkeit<br />
auf. Gleich sind beiden Kommoden die Gestaltung der Flächen, mit Rahmenwerk <strong>und</strong> Rosetten. Unsere Kommode findet ein<br />
sehr verwandtes <strong>Möbel</strong> in einer grossen Toiletten-Kommode des Johannes Äbersold, aus dem Jahre 1777, welche sich in Privatbesitz erhalten<br />
hat.Wenn auch dort mit Marmordeckblatt, so ist sie in der Aufteilung der Flächen, der Gestaltung der Eckstollen <strong>und</strong> Beine identisch.<br />
Eine weitere Kommode der Zeit um 1780, ebenfalls mit Holzblatt, welches die Form <strong>und</strong> Profilierung der sonst verwendeten Marmordeckplatten<br />
aufnimmt, so wie auch an unserem <strong>Möbel</strong>, hat sich im Besitze des Bernisches Historisches Museum, Inv. Nr. 38’148,<br />
erhalten <strong>und</strong> findet sich in Schloss Oberhofen. Diese Kommode ist jedoch von kleineren Ausmassen <strong>und</strong> ihr fehlt die Dreiteilung der<br />
Front in reiche Maserfelder. Die hier angebotene Kommode ist von bernischer Manufaktur, aber man erkennt an ihr auch den Einfluss<br />
der französischen Formensprache, wie sie Johannes Äbersold auf seiner Wanderschaft <strong>und</strong> seinem Aufenthalt in Paris, 1767, kennengelernt<br />
hat. Wohl unmittelbar nach seinem Paris-Aufenthalt dürfte die Kommode der 1988er Auktion entstanden sein, die einer direkten<br />
Umsetzung einer Pariser Transition-Kommode entspricht <strong>und</strong> aus der unser Kommoden-Modell als Weiterentwicklung hervorging.<br />
Literatur:<br />
Hermann von Fischer, Johannes Äbersold 1737–1812, Ein Berner Ebenist zwischen Mathäus Funk <strong>und</strong> Christoph Hopfengärtner, Ausstellungskatalog,<br />
Stiftung Schloss Jegenstorf, 2000.<br />
Auktionskatalog Sotheby’s Zürich, 1. Dezember 1988, Abb. Los Nr. 381.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 145<br />
1254<br />
Register Seite 111–112
146<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1255<br />
1256 1257<br />
1255. Säule, Frankreich. Holz, matt- <strong>und</strong> glanzvergoldet. Balusterform.<br />
96:38 cm. 800.—/1200.—<br />
1256. Marmorsäule, um 1900. Sockel <strong>und</strong> Kapitel aus weissem Marmor.<br />
Säulenschaft aus rosafarbenem Marmor. Quadratischer Sockel <strong>und</strong><br />
Kapitell mit zylinderförmiger Säule. Das drehbare Kapitell, auf drei<br />
Rollen, ist verziert mit stilisierten Disteln. 110:32:32 cm.<br />
1200.—/1500.—<br />
1257. Zeitungsständer, englisch, 2. Hälfte 19. Jh. Nussbaum. Mit verstellbarem<br />
Fächer, auf Rädern. 120:76:70 cm. 800.—/1200.—<br />
1258. Armlehnstuhl, Restauration. Nussbaum mit grünem Sitzbezug.<br />
Leicht gebogener Rücken mit eingerollten Armlehnen <strong>und</strong> Froschschenkel-Füssen.<br />
500.—/600.—<br />
1258<br />
1259. Arbeits- <strong>und</strong> Nähtisch, Biedermeier, Bern. Nussbaum auf<br />
Nadelholz furniert. Seitlich ein Paar Lyrafüsse auf einem rechteckigem<br />
Sockel mit einer grossen Schublade auf gedrückten Kugelfüssen.<br />
Rechteckiges aufklappbares Blatt mit einem Fach, darunter eine<br />
Schublade, die geschweift gegen innen versetzt ist. Das Blatt kreuzweise<br />
gefügt. 85:94:51,5 cm. 500.—/700.—<br />
1260. Klapptisch, England, Mitte 19. Jh. Mahagoni. Rechteckiges Blatt<br />
mit zwei aufklappbaren Verlängerungen, Zarge mit einer Schublade.<br />
R<strong>und</strong>e, leicht geschweifte Beine. 75:52:59 cm. 700.—/1000.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 147<br />
1261<br />
1261<br />
1262<br />
1261. Sehr feines Ameublement, Stil Chippendale, England, 19. Jh. Mahagoni reich geschnitzt. Bestehend<br />
aus einer Sitzbank <strong>und</strong> zwei Stühlen. L Bank = 173 cm. 2000.—/2500.—<br />
1262. Partner’s desk, England, 1. Hälfte 19. Jh. Mahagoni. Rechteckiges Blatt mit geprägtem, braunem Leder<br />
bezogen.Auf gedrechselten Beinen <strong>und</strong> gerade Zarge mit beidseitig je drei Schüben. 78:151:92 cm.<br />
2000.—/2500.—<br />
Register Seite 111–112
148<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1263<br />
1264<br />
1263. Bedeutende <strong>und</strong> überaus seltene Miniaturkommode des Christoph Hofpengärtner (1758–1843),<br />
Bern, letztes Viertel 18. Jh. Nussbuam, Kirsche,Ahorn, Zwetschge <strong>und</strong> Pappelkropf furniert. Längsformatiger<br />
Korpus mit fein eingelegten Pyramidenbeinen. Die Front mit abgeschrägten Eckstollen. Drei Schubladen<br />
mit Traversen, das Blatt vorstehend <strong>und</strong> passig geschnitten. Überaus reich eingelegt, die Schubladen<br />
mit Pappelkropffeldern, umrahmt von doppelt verzahntem Schnitzelband, die Schmalseiten mit gleichermassen<br />
furnierten Feldern, umrahmt von feinem Zierband. Zarge mit T-Mäander, die Eckstollen mit dunkleren<br />
Pappelkropffeldern, gefasst von doppelten Filets. Mit zentralem Fächermedaillon eingelegtes <strong>und</strong> mit<br />
Zierband eingerahmtes Zentralfeld. Die Kanten geschwärzt <strong>und</strong> mit Hell/Dunkel-Band in Zwetschge <strong>und</strong><br />
Ahorn furniert. Originale Beschläge <strong>und</strong> sehr feines Buntpapier. 35:42,5:26,5 cm. 6000.—/9000.—<br />
Provenienz:<br />
Alter Schweizer Besitz<br />
Die hier angebotene Miniaturkommode ist ohne Zweifel der berühmten Werkstatt des Christoph Hopfengärtner (1758–1843) zuzuschreiben.<br />
Sie übernimmt in allen Teilen die Merkmale der grösseren Kommodenmöbel des Meisters <strong>und</strong> seiner Berner Werkstatt, insbesondere<br />
auch in der Umfassung der Zarge <strong>und</strong> der Gestaltung der Stollen <strong>und</strong> der Furnierwahl. Das Auftauchen eines so seltenen Klein<strong>und</strong><br />
Ziermöbels ist von grösster Seltenheit. Es dürfte sich bei unserem Miniaturmöbel um eine Auftragsarbeit gehandelt haben. Solche<br />
<strong>Möbel</strong>, als eigentliche Zierstücke, wurden zum Aufbewahren von Korrespondenzen ebenso wie zum Verstauen von Schmuck <strong>und</strong> Kleingegenständen<br />
verwendet. Ganz allgemein aber waren sie wohl als Konversationsstücke gedacht <strong>und</strong> erregten, damals wie auch heute<br />
noch, grösstes Erstaunen. Das hier angebotene <strong>Möbel</strong> dürfte in der Zeit um 1795/1800 entstanden sein <strong>und</strong> hat sich in einem w<strong>und</strong>erbaren,<br />
originalen Zustand erhalten.<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 149<br />
1265<br />
1266<br />
1264. Kommode, Österreich. Nussbaum, Esche <strong>und</strong> Buche.<br />
Zweischübiger rechteckiger Korpus, leicht hervorstehendes<br />
profiliertes Blatt, sichtbare Traverse, getreppte Zarge mit geschnitzten<br />
Eckrosetten, auf sich gegen unten verjüngende<br />
Vierkantfüssen. Die Felder der Schubladen mit Rosetten<br />
<strong>und</strong> Filets umrandet. Das Blatt ebenfalls mit Filets <strong>und</strong><br />
Rosetten unterteilt. Im zentralen Bereich mit einem Mönch<br />
mit Sichel <strong>und</strong> Ähren eingelegt. Seitlich je mit einem Jäger<br />
<strong>und</strong> auf der Rückseite mit einem Bauern eingelegt. Beschläge<br />
mit Ringgriffen. 85:122:60 cm. 2000.—/3000.—<br />
1265. Armlehnstuhl, Restauration. Nussbaum mit blau geblumtemVeloursbezug.<br />
500.—/600.—<br />
1267<br />
1266. Kommode, Directoire, Bern. Kirschbaum. Rechteckiger<br />
dreischübiger Korpus mit abgeschrägten Frontstollen die in<br />
Vierkantfüsse übergehen. Felder der Schubladen mit Nussbaum<br />
umrandet. Innen mit originalem Papier ausgeschlagen.<br />
Die oberste Schublade ist innen dreigeteilt <strong>und</strong> die unterste<br />
zweigeteilt. Originale Messingbeschläge, Blatt aus «marbre<br />
de Roche» (nördlichYvorne). 81:101:51,5 cm.<br />
2000.—/3000.—<br />
1267. Travailleuse, Louis XVI. Kirschbaum, massiv <strong>und</strong> furniert.<br />
Das Blatt kreuzweise gefügt <strong>und</strong> mit einem feinen<br />
Filet umrandet. Rechteckiger dreischübiger Korpus, mit<br />
leicht hervorstehendem Blatt, kannelierten Eckstollen auf<br />
sich nach unten verjüngenden kannelierten Vierkantbeinen.<br />
Die oberste Schublade mit aufklappbarem Fach <strong>und</strong> Nadelkissen.<br />
Zu restaurieren. 76:49:41 cm. 600.—/800.—<br />
Register Seite 111–112
150<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1268<br />
1269<br />
1268. Kommode, Louis XIV, Westschweiz. Nussbaum.<br />
Rechteckiger dreischübiger Korpus,<br />
wobei die oberste Schublade zweigeteilt ist, die<br />
vorderen Eckstollen abger<strong>und</strong>et, hervorstehendes<br />
Blatt, das vorne leicht abger<strong>und</strong>et ist. Messingbeschläge.<br />
80:124:60 cm. 600.—/800.—<br />
1269. Auszugstisch, Louis XVI, schweizerisch.<br />
Nussbaum. Rechteckig, mit zwei Auszügen. Blatt<br />
<strong>und</strong> Auszüge mit Schieferstein eingelegt. Kannelierte<br />
Vierkantbeine, breite kannelierte Zarge mit<br />
Mittelrosette.<br />
78:118:80 cm. Mit Auszügen: 210 cm.<br />
2000.—/3000.—<br />
1270. Kleine Kommode, Louis XVI. Nussbaum.<br />
Rechteckiger vierschübiger Korpus, leicht hervorstehendes,<br />
profiliertes Blatt, kannelierte Eckstollen<br />
auf r<strong>und</strong>en, sich nach unten verjüngenden<br />
Beinen. Bronzegriffe <strong>und</strong> Messingsabots.<br />
78:49:39, 5 cm. 1000.—/1500.—<br />
1270<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 151<br />
1271<br />
1274 1273<br />
1271. Brasero, Stil Louis XVI, Bern. Kirschbaum <strong>und</strong><br />
Nussbaum. Rechteckiger Kubus mit abgeschrägten<br />
Seiten, auf sich nach unten verjüngenden kannelierten,<br />
r<strong>und</strong>en Füssen. Abnehmbares profiliertes Blatt,<br />
im Inneren mit Metallbehälter. 58:35:35 cm.<br />
500.—/700.—<br />
1272. Spieltisch, Louis XVI, Schweiz. Aus verschiedenen<br />
einheimischen <strong>und</strong> exotischen Hölzern. Rechteckiger<br />
Tisch auf Pyramidenfüssen mit Bronzesabots.<br />
Drehbares Blatt, auf der einen Seite mit eingelegtem<br />
Schach, auf der anderen mit Filz ausgeschlagen.<br />
Unter der Zarge vertieft mit eingelegtem<br />
Backgammon-Spielbrett. 75:99:61,5 cm.<br />
800.—/1000.—<br />
1272<br />
1273. Table-bouillotte, Biedermeier. Kirschbaum.<br />
Ovales Blatt mit durchbrochenem Messingrand, auf<br />
einer breiten einschübigen Zarge <strong>und</strong> langen feinen<br />
Pyramidenfüssen. 1000.—/1500.—<br />
1274. Kaminuhr, französisch, um 1820. Rechteckiger<br />
Mahagonikasten. Vergoldete Bronzelunette, weisses<br />
Emailzifferblatt. St<strong>und</strong>enschlag auf Feder. Zu revidieren.<br />
H = 39 cm. 800.—/1000.—<br />
Register Seite 111–112
152<br />
<strong>Möbel</strong><br />
1275<br />
1276 1277<br />
1275. Serviteur muet, Venedig, 19. Jh. Kniender Jüngling mit Tablett.<br />
Holz geschnitzt, schwarz gefasst, zum Teil vergoldet <strong>und</strong> lüstriert,<br />
überarbeitet. 57:28 cm. 1000.—/1500.—<br />
1276. Kredenz, Napoléon III. Holz schwarz lackiert, mit Messing, Bein<br />
<strong>und</strong> Perlmutt in Boulle-Technik eingelegt <strong>und</strong> mit Bronzebeschlägen<br />
reich verziert. Rechteckiger eintüriger Korpus, mit hervorstehenden<br />
gedrechselten <strong>und</strong> kannelierten Säulen auf Köcherfüssen. Das Blatt<br />
aus weiss-grau geädertem Marmor. 108:84:41 cm.<br />
1500.—/2000.—<br />
1277. Grotten-Guéridon, Venedig, Mitte 19. Jh. Holz geschnitzt <strong>und</strong><br />
polychrom gefasst, zum Teil vergoldet. Kleiner Moor auf einem Dreibein,<br />
geschweifte, sechseckige Ablage mit geschweifter Zarge. Kleinere<br />
Fehlstellen. 1500.—/1800.—<br />
Aus adeligem Besitz.<br />
1278<br />
1278. Kredenz, Napoléon III. Ebenisiertes Holz mit überaus feinen<br />
Ahornfilets <strong>und</strong> Beinornamenten eingelegt. Rechteckiger eintüriger<br />
Korpus mit seitlich je einer gedrechselten kannelierten Säule auf<br />
Köcherfüssen. 107:72:41 cm. 800.—/1200.—<br />
Register Seite 111–112
<strong>Möbel</strong> 153<br />
1279 1280<br />
1279. Kredenztruhe, italienisch, Mitte 19. Jh. Holz ebenisiert <strong>und</strong> mit<br />
Bein-Intarsien eingelegt. Rechteckiger Korpus mit hervorstehender,<br />
profilierter Zarge <strong>und</strong> Blatt, auf geschnitzten Löwenköpfen. Front<br />
<strong>und</strong> Seiten reich mit Intarsien im Renaissancestil eingelegt.<br />
72:150:52 cm. 1000.—/1500.—<br />
1280. Travailleuse, Japan, Ende 19. Jh. Rechteckiger Korpus mit Klappdeckel.<br />
Innen Hauptfach <strong>und</strong> zwei Schubladen. Auf Untergestell.<br />
Schwarz bemalt, reicher Goldlackdekor in verschiedenen Tönen.<br />
79,5:46,5:31 cm. 1000.—/1200.—<br />
1281. Nähtisch, Napoléon III. Papiermaché <strong>und</strong> Holz, zum Teil mit<br />
Perlmutter eingelegt, schwarz lackiert <strong>und</strong> bemalt. Rechteckiger<br />
Kasten mit aufklappbarem Deckel, zwei gedrechselte Beine, die<br />
durch einem Steg verb<strong>und</strong>en werden, mit vier Füssen. 69:48:35 cm.<br />
600.—/800.—<br />
1281<br />
Register Seite 111–112