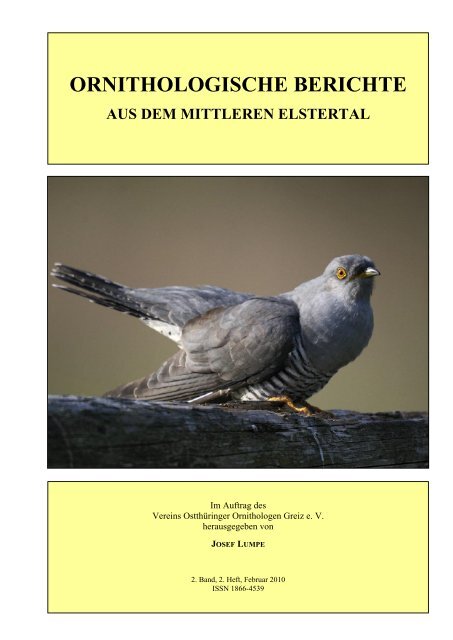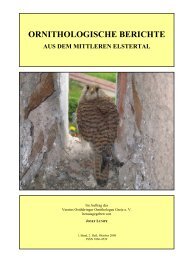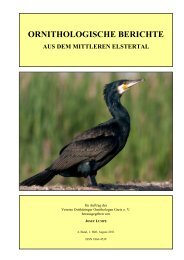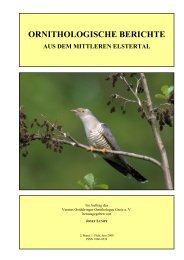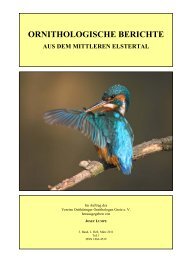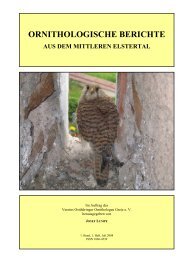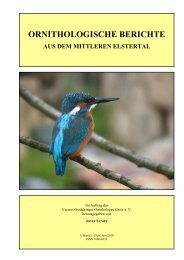ornithologische berichte aus dem mittleren elstertal - Verein ...
ornithologische berichte aus dem mittleren elstertal - Verein ...
ornithologische berichte aus dem mittleren elstertal - Verein ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ORNITHOLOGISCHE BERICHTE<br />
AUS DEM MITTLEREN ELSTERTAL<br />
Im Auftrag des<br />
<strong>Verein</strong>s Ostthüringer Ornithologen Greiz e. V.<br />
her<strong>aus</strong>gegeben von<br />
JOSEF LUMPE<br />
2. Band, 2. Heft, Februar 2010<br />
ISSN 1866-4539
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal<br />
Verlagsrechte beim <strong>Verein</strong> Ostthüringer Ornithologen Greiz e. V. (VOOG)<br />
Erscheinungsort: Greiz<br />
Heft 2, Band 2, Februar 2010<br />
Her<strong>aus</strong>geber und Schriftleiter im Auftrag des VOOG:<br />
Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 Greiz<br />
(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />
Redaktionelle Bearbeitung:<br />
Dipl.-Ing. Kl<strong>aus</strong> Lieder, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg<br />
(Tel.: 0 36 60 2 / 3 58 61; e-mail: lieder-ornis@gitta-regner.de)<br />
<strong>Verein</strong> Ostthüringer Ornithologen Greiz e. V.<br />
1952 – Gründung als Fachgruppe Ornithologie<br />
1993 – <strong>Verein</strong>sgründung<br />
Geschäftsstelle ist der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden<br />
Bankverbindung: Sparkasse Gera-Greiz, Konto-Nr. 620 130, BLZ: 830 500 00<br />
Mitgliedsbeitrag: 15,00 €/Jahr<br />
Homepage: www.ornithologen-greiz.de<br />
Vorstand<br />
1. Vorsitzender:<br />
Dipl.-Fachlehrer Wolfgang Frühauf, An der Eichleite 28, 07973 Greiz<br />
(Tel.: 0 36 61 / 67 46 40; e-mail: afruehauf@yahoo.de)<br />
2. Vorsitzender und Schatzmeister:<br />
Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 Greiz<br />
(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />
Herstellung und Gestaltung<br />
Druck:<br />
VOOG – Computerdruck<br />
Bindung:<br />
VOOG – Thermo – Bindung<br />
Titelfoto: Frank Leo, Kuckuck – Vogel des Jahres 2008<br />
ISSN 1866-4539
K. LIEDER & J. LUMPE<br />
Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera<br />
am Beispiel der Brutvögel der Roten Liste Thüringens<br />
Eine Bilanz nach 200 Jahren <strong>ornithologische</strong>r Forschung
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2, 81 – 214 Februar 2010<br />
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera<br />
am Beispiel der Brutvögel der Roten Liste Thüringens<br />
Eine Bilanz nach 200 Jahren <strong>ornithologische</strong>r Forschung<br />
KLAUS LIEDER* & JOSEF LUMPE**<br />
Mit 74 Abbildungen, 2 Übersichtskarten, 23 Verbreitungskarten<br />
Einleitung 81<br />
Definitionen 83<br />
Übersichtskarten 84<br />
Brutvogelarten der Roten Liste Thüringens 86<br />
Diskussion 199<br />
Bildnachweis 206<br />
Literatur 207<br />
Einleitung<br />
Zum Umfang der Arbeit<br />
In dieser Arbeit werden alle Brutvogelarten der Roten Liste Thüringens (WIESNER 2001) behandelt, die auf<br />
<strong>dem</strong> Gebiet des Landkreis Greiz und der Stadt Gera gebrütet haben bzw. noch brüten oder für die begründeter<br />
Brutverdacht bestand. Neben der Auswertung der Fachliteratur wurde auf die umfangreiche Datenbank<br />
des <strong>Verein</strong>s Ostthüringer Ornithologen Greiz e. V. zurückgegriffen. Beobachtungen sind, soweit sie schon<br />
bekannt waren, bis einschließlich 2009 eingearbeitet worden.<br />
Zur Bedeutung Roter Listen<br />
Im nationalen und regionalen Maßstab spielen Rote Listen für bestimmte Organismengruppen seit fast 30<br />
Jahren eine immer größere Rolle in der Naturschutzarbeit. Ziele und Bedeutung Roter Listen lassen sich<br />
folgendermaßen charakterisieren:<br />
- „Information der Öffentlichkeit, der zuständigen Landes- und Bundesbehörden und von internationalen<br />
Gremien über Gefährdung von Pflanzen- und Tierarten,<br />
- wirksamer Schutz von Gebieten, in denen gefährdete Arten vorkommen, da nur durch Biotopschutz die<br />
Erhaltung der Restvorkommen vieler Arten gewährleistet werden kann,<br />
- Entscheidungshilfe für Naturschutzbehörden bei Anträgen auf Ausweisung von Schutzgebieten für gefährdete<br />
Arten und zur Abwehr von Eingriffen in Schutzgebiete,<br />
- Entscheidungshilfe für alle Institutionen, die Eingriffe in die Landschaft planen, auf ihre Verträglichkeit prüfen<br />
und bewerten,<br />
- Richtschnur für Maßnahmen in Land- und Forstwirtschaft sowie für die Anwendung des Vertragsnaturschutzes<br />
und anderer Fördermaßnahmen,<br />
- Entscheidungshilfe für alle Institutionen des Naturschutzes, der Jagd, der Fischerei und der Wasserwirtschaft,<br />
die Managementmaßnahmen (Hege, Pflege, Steuerung) von Pflanzen- und Tierbeständen planen<br />
und durchführen,<br />
- Vorbereitung und Formulierung von Untersuchungsprogrammen für die am stärksten gefährdeten Arten<br />
hinsichtlich Größe und Entwicklung ihrer Populationen (Artenmonitoring),<br />
- Schaffung ökologischen Grundlagenwissens als Vor<strong>aus</strong>setzung für die Einleitung und Durchführung wirksamer<br />
Schutzmaßnahmen (z. B. im Rahmen von Artenhilfsprogrammen),<br />
- Anregung für alle Fachleute, sich in stärkerem Maße an der Lösung von Fragen der Überlebenssicherung<br />
von Pflanzen- und Tierarten zu beteiligen,<br />
- Aufforderung an alle Schulen und Hochschulen, erhöhtes Augenmerk auf die Vermittlung von Wissen über<br />
die Bedrohung von Flora und Fauna und über die Gefährdungsursachen zu richten,<br />
- Beitrag für die Zusammenstellung von Listen gefährdeter Arten in größeren Bezugsräumen,<br />
- Anregung zum intensiven Überdenken der Wirksamkeit der aktuell verfügbaren Naturschutzinstrumente.“<br />
(FRITZLAR & WESTHUS 2001, zitiert nach NOWAK, BLAB & BLESS 1994).<br />
K. * Lieder Dipl.-Ing. & J. K. Lumpe: Lieder, Bewahrung Gessentalweg der Artendiversität 3, 07580 Ronneburg, im Landkreis ** Dipl.-Ing. Greiz J. und Lumpe, der Stadt Dr.-Otto-Nuschke-Straße Gera am Beispiel der 18, Brutvögel... 07973 Greiz<br />
81
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Danksagung<br />
Wir möchten allen Mitgliedern des <strong>Verein</strong>s und weiteren Naturfreunden, die uns ihr Datenmaterial zur Verfügung<br />
gestellt haben, herzlich danken. Unser Dank gilt besonders FRANK LEO und TORSTEN PRÖHL (Bildagentur<br />
fokus-natur.de), SÖNKE MORSCH und FRANK DERER (Bildagentur Fotonatur.de) sowie JENS HALBAUER,<br />
DR. JOCHEN WIESNER, DR. SIEGFRIED KLAUS, ANDREAS WINKLER, ANNETTE und WOLFGANG FRÜHAUF für die<br />
Bereitstellung der Abbildungen. Der Thüringer Anstalt für Umwelt und Geologie Jena danken wir für das<br />
Kartenmaterial.<br />
Vorbemerkungen<br />
Bei jeder behandelten Art werden die Status der Roten Liste Thüringens und Deutschlands aufgeführt. Die<br />
Gefährdungskategorien sind vergleichbar. Besteht für eine Art ein weiterer Schutzstatus (Anhang I-Arten der<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie und streng geschützte Arten nach BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11), ist dies ebenfalls<br />
vermerkt.<br />
Die „Lokalen Gefährdungsfaktoren“ und „Lokalen Schutzmaßnahmen“ orientieren sich im Grundgerüst an<br />
den umfassenden Angaben bei BAUER, BEZZEL & FIEDLER (2005). Für jede Art wurde geprüft, ob die entsprechenden<br />
Faktoren bzw. Schutzmaßnahmen für das Untersuchungsgebiet zutreffen bzw. anwendbar sind.<br />
Gebietsspezifische Besonderheiten wurden ergänzt.<br />
In die nach Quadranten eingeteilten Verbreitungskarten, abgeleitet <strong>aus</strong> den Topographischen Karten<br />
1:25.000 des Landkreises Greiz und der Stadt Gera (vgl. Seite 85), werden für einige Arten die geschätzten<br />
Häufigkeiten gemäß ADEBAR-Projekt der Jahre 2005 – 2008 eingetragen. Im Text der jeweiligen Artkapitel<br />
werden genauere Informationen zur Häufigkeit, die zwischenzeitlich bekannt geworden sind, berücksichtigt.<br />
Mit „Untersuchungsgebiet“ wird bis 1990 der Altkreis Greiz, der Altkreis Zeulenroda und der Altkreis Gera-<br />
Land und Gera Stadt bzw. nach 1990 der Landkreis Greiz und die Stadt Gera bezeichnet. Beide Gebiete<br />
sind flächenmäßig nahezu identisch.<br />
Beobachtungen, die nur mit <strong>dem</strong> Namen des Beobachters und ohne Verweis auf eine Literaturstelle angegeben<br />
sind, stammen <strong>aus</strong> der Datenbank des <strong>Verein</strong>s Ostthüringer Ornithologen Greiz e. V.<br />
Aufgezählte Beobachternamen sind untereinander durch Kommas und von Literaturstellen durch Semikolons<br />
getrennt. Aufgezählte Literaturstellen sind untereinander ebenfalls durch Semikolons abgeteilt.<br />
Als im Untersuchungsgebiet <strong>aus</strong>gestorben gelten Vogelarten, von denen 15 Jahre und länger hier keine<br />
Ind. mehr gebrütet haben.<br />
Die zeitliche Gliederung des Textes in den Artkapiteln (Jahrhunderte oder kürzere Jahresspannen) erfolgt<br />
angepasst an den Umfang der gefundenen Daten.<br />
Abkürzungen<br />
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz RNG Renaturierungsgebiet<br />
BNG Bundesnaturschutzgesetz RLD Rote Liste Deutschland<br />
BP Brutpaar, Brutpaare RLT Rote Liste Thüringen<br />
BV Brutvogel sM singendes / singende Männchen<br />
FG Fachgruppe SOK Saale-Orla-Kreis<br />
Ind. Individuum, Individuen sic tatsächlich so<br />
Jh. Jahrhundert TK Topographische Karte<br />
KULAP Kulturlandschaftsprogramm UNB Untere Naturschutzbehörde<br />
Ms. Manuskript vgl. Vergleiche<br />
mündl. mündlich VOOG <strong>Verein</strong> Ostthüringer Ornithologen Greiz e. V.<br />
NSG Naturschutzgebiet VSR Vogelschutzrichtlinie<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 82
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Definitionen<br />
Für die einzelnen Vogelarten wurden die offiziellen Gefährdungskategorien angegeben, die folgendermaßen<br />
definiert sind:<br />
- Ausgestorben, <strong>aus</strong>gerottet oder verschollen:<br />
Arten, deren dauerhaftes Vorkommen in Thüringen belegt ist, die in der Zwischenzeit aber mit Sicherheit<br />
oder großer Wahrscheinlichkeit erloschen sind.<br />
Diesen Arten muss bei Wiederauftreten in der Regel besonderer Schutz gewährt werden.<br />
- Vom Aussterben bedroht:<br />
In Thüringen von der Ausrottung oder <strong>dem</strong> Aussterben bedrohte Arten.<br />
Für diese Arten sind Schutzmaßnahmen in der Regel dringend notwendig. Das Überleben in Thüringen ist<br />
unwahrscheinlich, wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende<br />
Schutz- und Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen.<br />
- Stark gefährdet:<br />
Im nahezu gesamten Verbreitungsgebiet in Thüringen gefährdete Arten.<br />
Wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und<br />
Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen, ist damit zu rechnen, dass die<br />
Arten innerhalb der nächsten zehn Jahre vom Aussterben bedroht sein werden.<br />
- Gefährdet:<br />
In großen Teilen des Verbreitungsgebietes in Thüringen gefährdete Arten.<br />
Wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und<br />
Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen, ist damit zu rechnen, dass die<br />
Arten innerhalb der nächsten zehn Jahre stark gefährdet sein werden.<br />
- Extrem selten:<br />
Seit jeher extrem seltene oder sehr lokal vorkommende Arten, für die kein merklicher Rückgang und keine<br />
aktuelle Gefährdung erkennbar sind.<br />
Die wenigen und kleinen Vorkommen in Thüringen können aber durch derzeit nicht absehbare menschliche<br />
Einwirkungen oder durch zufällige Ereignisse schlagartig <strong>aus</strong>gerottet oder erheblich dezimiert werden<br />
(FRITZLAR & WESTHUS 2001).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 83
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Übersichtskarten<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera<br />
Großaga<br />
Pölzig<br />
Bad Köstritz<br />
Söllmnitz<br />
Großenstein<br />
Kraftsdorf<br />
Gera<br />
Ronneburg<br />
Münchenbernsdorf<br />
Rückersdorf<br />
Weida<br />
Seelingstädt<br />
Niederpöllnitz<br />
Auma<br />
Triebes<br />
Zeulenroda<br />
Teichwolframsdorf<br />
Hohenölsen<br />
Langenwetzendorf<br />
Greiz<br />
Pöllw itz<br />
Bernsgrün<br />
Maßstab: 1 cm = 1,5 km<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 84
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schema der Topographischen Karten mit den Quadranten 1 – 4 (Beispiel siehe TK 5037)<br />
5037<br />
Eisenberg<br />
1 2<br />
3 4<br />
5038<br />
Gera Nord<br />
5039<br />
Kayna<br />
5137<br />
Münchenbernsdorf<br />
5138<br />
Gera<br />
5139<br />
Ronneburg<br />
5237<br />
Triptis<br />
5238<br />
Weida<br />
5239<br />
Teichwolframsdorf<br />
5337<br />
Zeulenroda<br />
5338<br />
Triebes<br />
5339<br />
Greiz<br />
5438<br />
Plauen Nord<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 85
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Brutvogelarten der Roten Liste Thüringens<br />
Graugans – Anser anser (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Extrem selten<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Erstbesiedlung 2008<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. und 20. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Graugans<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
21. Jahrhundert<br />
Im Zuge der Bestandszunahme in Thüringen wurde auch der Landkreis Greiz besiedelt. Je ein erfolgreiches<br />
BP wurde 2008 und 2009 auf <strong>dem</strong> Hirschteich in Greiz-Aubachtal festgestellt. 2008 führte das Paar 4 Jungvögel<br />
(HALBAUER, LANGE, LUMPE, SIMON; LUMPE 2008 a). Zusätzlich zum BP 2009 war neben den 6 Jungvögeln<br />
noch ein weiterer Altvogel auf <strong>dem</strong> Gewässer anwesend.<br />
Mit weiteren Ansiedlungen kann in den nächsten Jahren gerechnet werden.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störungen durch Freizeitnutzung an Gewässern<br />
- Hohe Prädatorendichte (Fuchs)<br />
- Fehlender ungestörter Lebensraum mit dichtem Uferbewuchs<br />
- Fehlende Feuchtgebiete mit weitem Blickfeld<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Zurzeit sind keine speziellen Schutzmaßnahmen für die Graugans erforderlich<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 86
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Brandgans – Tadorna tadorna (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Extrem selten<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Erstbesiedlung 1998<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Brandgans<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
Die erste erfolgreiche Brut eines Paares der Brandgans für das Untersuchungsgebiet wurde 1998 im Wismut-Sanierungsbereich<br />
RNG Culmitzsch festgestellt (JAKOB, LANGE; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1999). In den<br />
Jahren 1999 und 2000 bestand für je 1 BP begründeter Brutverdacht (LANGE & LIEDER 2001).<br />
21. Jahrhundert<br />
Weitere sichere Brutnachweise <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Wismut-Sanierungsbereich RNG Culmitzsch liegen für die Jahre<br />
2001 – 2005 vor (ROST 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). 2008 hat die Brandgans im benachbarten Auetal bei<br />
Gauern gebrütet, sicher infolge der anhaltenden Sanierungsarbeiten. (KOCH; LUMPE & LIEDER 2009). Im Zeitraum<br />
von 2006 – 2009 waren 7 – 9 Altvögel zur Brutzeit im RNG Culmitzsch gleichzeitig anwesend. Im Jahre<br />
2006 wurde die Revierverteidigung eines Männchens und im Jahre 2009 die Kopulation eines Paares im<br />
RNG Culmitzsch beobachtet (LANGE, KANIS). Nach den Wertungskriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE &<br />
SCHRÖDER (2005) kann für diese vier Jahre begründeter Brutverdacht für 1 – 3 BP angenommen werden.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störungen durch laufende Sanierungsmaßnahmen im ehemaligen Bergbaugebiet<br />
- Verlust der offenen Wasserflächen im RNG Culmitzsch bis ca. 2011 im Zug der Wismut-Sanierung<br />
- Fehlendes Ausgleichsgewässer führt zum Verschwinden als Brutvogel<br />
- Hohe Prädatorendichte (Fuchs, Waschbär)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung eines ca. 10 ha großen und störungsfreien Stillgewässers als Ausgleichsmaßnahme für den<br />
Verlust der Wasserfläche im Wismut-Sanierungsgebiet<br />
- Ohne gleichwertige Ersatzmaßnahme stirbt die Brandgans im Landkreis Greiz <strong>aus</strong><br />
- Prädatorenbekämpfung (Fuchs, Waschbär)<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 87
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schnatterente – Anas strepera L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Gefährdet<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Erstbesiedlung 1997<br />
Chronik der Bestandentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Schnatterente<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. und 21. Jahrhundert<br />
Erstmals wurde von der Schnatterente in Jahre 1997 ein Brutnachweis erbracht. Das Paar führte auf <strong>dem</strong><br />
Dorfteich in Wolfersdorf 7 Jungvögel (LANGE; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1998).<br />
In mehreren Jahren bestand nach den Wertungskriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005)<br />
begründeter Brutverdacht:<br />
RNG Großkundorf: 1987 (LANGE, MÜLLER, OEHLER, TOLKMITT)<br />
Weiderteich bei Niederpöllnitz: 1998, 1999, 2000, 2002, 1 – 2 BP 2006 (LIEDER, LUMPE, MÜLLER, SIEBERT,<br />
ZSCHIEGNER)<br />
Frießnitzer See: 2005 (MÜLLER)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Ein Brutgewässer wurde im Zuge von Bergbau-Sanierungsmaßnahmen zerstört (RNG Großkundorf)<br />
- Der Brutplatz Weiderteich bei Niederpöllnitz ist durch Freizeitnutzung (Surfen) und Vergrämungsmaßnahmen<br />
für Kormoran und Graureiher gefährdet<br />
- Hohe Prädatorendichte (Fuchs, Waschbär)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherung des Brutplatzes Weiderteich bei Niederpöllnitz durch Verhinderung der Freizeitnutzung<br />
- Prädatorenbekämpfung im Umfeld von Brutplätzen (Fuchs, Waschbär)<br />
- Keine Störung durch Vergrämungsmaßnahmen für Kormorane und Graureiher<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 88
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Krickente – Anas crecca L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Gefährdet<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Erstmals fand BREHM (1820 – 22) die Krickente 1810 am Frießnitzer See als Brutvogel vor. Auch LIEBE<br />
(1873) bezeichnet sie als Brutvogel, ohne Nennung konkreter Nachweise. HELLER (1926) bezieht sich auf<br />
seine Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 und schreibt: „Soll früher auf <strong>dem</strong> Binsenteich [Parkteich Greiz]<br />
gebrütet haben.“<br />
1900 bis 1950<br />
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war nach HIRSCHFELD (1932) die Krickente in der Umgebung von<br />
Hohenleuben Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Gesicherte Brutnachweise konnten nur in den Jahren 1993 und 2002 für den Frießnitzer See erbracht werden<br />
(BAUM, LIEDER; ROST 1999).<br />
Brutverdacht bestand an folgenden Gewässern:<br />
Wöhlsdorfer Grund 1971 (BARNIKOW, SCHÜTZ; GÜNTHER 1975 a)<br />
Talsperre Zeulenroda 1973 (FG Zeulenroda; GÜNTHER 1975 a)<br />
Großer Teich bei Kauern 1974 (LIEDER, AUERSWALD; ROST 1999)<br />
RNG Großkundorf 1980 (COBURGER, JAKOB, LANGE)<br />
Weiderteich bei Niederpöllnitz 1991 (LIEDER; ROST 1999)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Ein Brutgewässer wurde im Zug von Bergbau-Sanierungsmaßnahmen zerstört (RNG Großkundorf)<br />
- Der Brutplatz Weiderteich bei Niederpöllnitz ist durch Freizeitnutzung (Surfen) gefährdet<br />
- Hohe Prädatorendichte (Fuchs, Waschbär)<br />
- Gefährdung der Jungvögel durch Besatz mit großen Raubfischen (Wels, Hecht)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherung des Brutplatzes Weiderteich bei Niederpöllnitz durch Verhinderung der Freizeitnutzung<br />
- Prädatorenbekämpfung im Umfeld der Brutplätze (Fuchs, Waschbär)<br />
- Abfischen großer Raubfische an den potentiellen Brutgewässern<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 89
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Knäkente – Anas querquedula L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Knäkente<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
1900 bis 1950<br />
VÖLKEL fand um 1930 die Art als Brutvogel am Weiderteich bei Niederpöllnitz (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
An mehreren Stillgewässern wurden Brutnachweise erbracht: Raitzhainer Teich 1963 (GÜNTHER 1969),<br />
Weiderteich bei Niederpöllnitz 1966 (HEYER 1967), Röpsener Teiche 1967 (BAUM; GÜNTHER 1975 b), Großer<br />
Teich bei Kauern 1968 (AUERSWALD, LIEDER; LANGE & LIEDER 2001), Frießnitzer See zwei BP 1996 (BAUM,<br />
LIEDER; LANGE & LIEDER 2001), Dorfteich Nauendorf im nordöstlichen Landkreis Greiz 1996 (LIEDER; ROST<br />
1999), Moorteich im Pöllwitzer Wald 2007 (HEMPEL; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008).<br />
An folgenden Stillgewässern bestand begründeter Brutverdacht:<br />
RNG Großkundorf 1989 (MÜLLER; KRÜGER 1995 b), 1991 (LIEDER), 1997 (LANGE), Teiche Leschke bei Auma,<br />
alljährlich in den 1960er-Jahren bis zum letzten Maidrittel anwesend (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971),<br />
Großer Teich bei Kauern 1964, 1967, 1973 (GÜNTHER, SCHEFFEL; GÜNTHER 1969, 1975 b), 2006 (LIEDER),<br />
Burkersdorfer Feldteich 1995 (BAUM; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1996), Frießnitzer See 1995, zwei BP 2002<br />
(LIEDER), Culmitzsch-Aue bei Zwirtzschen 1996 (LANGE), RNG Culmitzsch 2003, 2004 (JAKOB, LANGE), 2005<br />
(LANGE).<br />
Weitere Nachweise zur Brutzeit können nach den Kriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005)<br />
nicht als Brutverdacht gewertet werden, schließen aber regelmäßiges Vorkommen nicht <strong>aus</strong>.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Trockenlegung von Brutgewässern durch Wismut-Sanierung (RNG Großkundorf und Culmitzsch-Aue bei<br />
Zwirtzschen bereits trockengelegt, RNG Culmitzsch folgt in spätestens zwei Jahren)<br />
- Der Brutplatz Weiderteich bei Niederpöllnitz ist durch Freizeitnutzung (Surfen) gefährdet<br />
- Hohe Prädatorendichte (Fuchs, Waschbär)<br />
- Gefährdung der Jungvögel durch Besatz mit großen Raubfischen (Wels, Hecht)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherung des Brutplatzes Weiderteich bei Niederpöllnitz durch Verhinderung der Freizeitnutzung<br />
- Schaffung eines ca. 10 ha großen und störungsfreien Stillgewässers als Ausgleichsmaßnahme für den<br />
Verlust der Wasserflächen durch Wismut-Sanierung<br />
- Prädatorenbekämpfung im Umfeld der Brutplätze (Fuchs, Waschbär)<br />
- Abfischen großer Raubfische an den potentiellen Brutgewässern<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 90
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Löffelente – Anas clypeata L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Stark gefährdet<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Erstbesiedlung 2003<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. und 20. Jahrhundert<br />
In der uns zugänglichen <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Löffelente<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
21. Jahrhundert<br />
Der erste reguläre Brutnachweis der Löffelente wurde 2003 am Weiderteich bei Niederpöllnitz erbracht. Ein<br />
Weibchen führte 10 Jungvögel, von denen 20 Tage später noch 6 vorhanden waren (LANGE, SCHUSTER).<br />
Nach den Wertungskriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) bestand außer<strong>dem</strong> begründeter<br />
Brutverdacht für folgende Gewässer: Weiderteich bei Niederpöllnitz 2002 (LIEDER, LUMPE, SCHUSTER) und<br />
2006 (BECHER, LANGE, LIEDER, LUMPE, MÜLLER), Frießnitzer See 2002 (LANGE, LEO, MÜLLER).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Der Brutplatz Weiderteich bei Niederpöllnitz ist durch Freizeitnutzung (Surfen) gefährdet<br />
- Durch Ackernutzung bis an den Gewässerrand am Weiderteich bei Niederpöllnitz und teilweise Ackernutzung<br />
am Frießnitzer See fehlen extensive und feuchte Grünlandflächen<br />
- Hohe Prädatorendichte (Fuchs, Waschbär)<br />
- Gefährdung der Jungvögel durch Besatz mit großen Raubfischen (Wels, Hecht)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherung des Brutplatzes Weiderteich bei Niederpöllnitz durch Verhinderung der Freizeitnutzung<br />
- Erweiterung extensiver Grünlandflächen um die Brutplätze Weiderteich bei Niederpöllnitz und am<br />
Frießnitzer See<br />
- Prädatorenbekämpfung im Umfeld der Brutplätze (Fuchs, Waschbär)<br />
- Abfischen großer Raubfische an den potentiellen Brutgewässern<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 91
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wachtel – Coturnix coturnix (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Wachtel wird als häufiger Brutvogel bezeichnet, wobei sie für die Jahre um 1870 und 1893 als besonders<br />
zahlreich erwähnt wird (LIEBE 1873, 1893). Trotz starker jährlicher Schwankungen wird der Bestand als<br />
gleichbleibend eingeschätzt (LIEBE 1878). HELLER (1926) bezeichnet die Wachtel nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 als selten und unregelmäßig in der Umgebung von Greiz. Regelmäßig brütend wurde sie von<br />
ihm bei Moschwitz, Dobia und Gablau gefunden. Als spärlichen Brutvogel nennt DOMBROWSKI (1893) die<br />
Wachtel für die Umgebung von Greiz.<br />
1900 bis 1950<br />
Am 03. Juli 1902 wurde bei Gera ein Vollgelege der Wachtel mit 15 Eiern gefunden (SCHEIN 1903). Nach<br />
HILDEBRANDT (1919) ging der Bestand stark zurück und nur bei Ronneburg und bei Jena habe er sie noch<br />
öfters gehört. In der Umgebung von Hohenleuben fand HIRSCHFELD (1932) die Art als spärlichen Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) verzeichnet für die Zeit um 1969 einen rapiden Bestandsrückgang der Wachtel in der Umgebung<br />
von Gera, besonders in den 10 Jahre davor. Nach LANGE & LEO (1978) ist das Brutvorkommen im<br />
Altkreis Greiz nach vorherigem Bestandsrückgang um 1970 erloschen. Im Zeitraum zwischen 1975 und<br />
1980 werden wieder mehrere Vorkommen im gesamten Kreisgebiet aufgeführt (GOTTSCHALK 1982 a). Im<br />
Jahre 1997 wurden 26 rufende Vögel an 17 Orten erfasst (LANGE & LIEDER 2001). Gegenwärtig dürfte die Art<br />
noch häufiger sein, wobei immer offen bleiben muss, ob eine tatsächliche Zunahme erfolgte oder nur intensiver<br />
danach gesucht wurde. Zu beachten ist bei der Wachtel, dass die Anzahl rufender Männchen, nur diese<br />
werden erfasst, nicht mit <strong>dem</strong> Brutbestand gleichzusetzen ist (ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER 2005).<br />
Die Verbreitung im Landkreis Greiz und der Stadt Gera ist flächendeckend, außer in Waldgebieten und Städten.<br />
Angaben für ADEBAR-Projekt: 8 Quadranten mit 0, 4 Quadranten mit 1, 9 Quadranten mit 2 – 3, 14<br />
Quadranten mit 4 – 7 rufenden Männchen. Damit kann der Gesamtbestand auf gegenwärtig mind. 50 BP<br />
beziffert werden, was für eine Zunahme in den letzten Jahren spricht.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft (Zerstörung kleinstrukturierter Kulturlandschaft, Verlust von Brachland<br />
und Grasflächen, frühere und häufigere Mahdtermine, Stickstoffüberdüngung, zu dichte Saatreihen, Einsatz<br />
von Agrochemikalien)<br />
- Verluste durch Verbauung der Landschaft (neue Straßentrassen, Wohnbaugebiete, Gewerbegebiete)<br />
- Verluste durch Zunahme des Straßenverkehrs<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 92
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rebhuhn – Perdix perdix (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Stark gefährdet<br />
Regelmäßiger Brutvogel, starke Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
17. Jahrhundert<br />
Zwischen 1611 und 1632 wurden 348 (!) Rebhühner bei Triebes gefangen oder geschossen (HENNICKE<br />
1896). Als Quelle nennt HENNICKE zwei handschriftliche Aufzeichnungen <strong>aus</strong> der Bibliothek des<br />
Alterturmsforschenden <strong>Verein</strong>s Hohenleuben: „Derer Von Metsch zu Triebis Jagtbüchlein Von 1611 bis 1618<br />
incl.“ und „Derer Von Metschen zu Triebis Jagd Büchelein von Ao 1619 biß 1632 incl.“<br />
19.Jahrhundert<br />
Das Rebhuhn wird von LIEBE (1873) als Brutvogel mit starken Bestandsschwankungen infolge strenger Winter,<br />
aber mit insgesamt gleichbleiben<strong>dem</strong> Bestand erwähnt. HELLER (1926) bezeichnet das Rebhuhn nach<br />
seinen Aufzeichnungen von 1881 als „regelmäßigen, aber im Bestand sehr schwankenden Brutvogel unsrer<br />
Felder.“ In der Greizer Gegend war die Art nach DOMBROWSKI (1893) nicht häufig.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist das Rebhuhn ein häufiger und allgemein verbreiteter Brutvogel in Ostthüringen.<br />
HIRSCHFELD (1932) stellt für die Umgebung von Hohenleuben fest, dass der Bestand der Art im strengen<br />
Winter 1928 / 29 sehr gelitten hat, sich aber inzwischen wieder erholen konnte.<br />
Ab 1950<br />
Nach LANGE & LEO (1978) sind im Altkreis Greiz Mitte der 1950er-Jahre noch mehr als 200 Rebhühner zu<br />
finden. Danach nahm der Bestand bis 1977 auf kaum noch 30 Paare ab. Um 1970 bis 1980 soll es etwa 100<br />
bis 150 BP im Untersuchungsgebiet gegeben haben (GOTTSCHALK 1982 b, LANGE & LIEDER 2001). Noch 1988<br />
brüten nach THEOPHIL & WEIDNER (1990) mindestens 60 Paare in diesem Gebiet. Durch weiter anhaltenden<br />
Bestandsrückgang waren um 2000 nur noch wenig mehr als 10 BP vorhanden, mit Schwerpunkt im Gebiet<br />
um Gera (LANGE & LIEDER 2001). Gegenwärtig kann der Brutbestand mit 18 – 26 Paaren angegeben werden<br />
(ADEBAR-Projekt 2005 – 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft (Zerstörung kleinstrukturierter Kulturlandschaft, Verlust von Brachland,<br />
Feldhecken, Feldrainen und Grasflächen, frühere und häufigere Mahdtermine, Stickstoffüberdüngung, zu<br />
dichte Saatreihen, Einsatz von Agrochemikalien)<br />
- Verluste durch Verbauung der Landschaft (neue Straßentrassen, Wohnbaugebiete, Gewerbegebiete)<br />
- Aufforstung von sanierten Bergbauflächen<br />
- Verluste durch Zunahme des Straßenverkehrs<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft und Reduzierung der Verwendung von Agrochemikalien<br />
- Anlage von Strukturen zur Deckung und Nahrungssuche in der <strong>aus</strong>geräumten Feldflur<br />
- Schaffung neuer Lebensräume auf sanierten Bergbauflächen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 93
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 1: Rebhuhn<br />
2 – 3<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
2 – 3 4 – 7 2 – 3<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 94
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Haselhuhn – Tetrastes bonasia (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach den Jagdtabellen der Greizer Forstreviere wurden zwischen 1786 und 1843 noch 6 Vögel geschossen<br />
(LANGE & LEO 1978). Danach gibt es keine verbürgten Nachweise von Wildvögeln mehr. HELLER (1926)<br />
schreibt nach seinen Aufzeichnungen von 1881: „Solange unsere Wälder noch Unterholz besaßen, soll dieser<br />
Vogel nach Aussage älterer Jäger und Förster, wenn auch selten, im Gebiet gebrütet haben. Ein Brutplatz<br />
ist mir nicht bekannt.“<br />
20. Jahrhundert<br />
Bei einem Vogel am 10.08.1983 im Pöllwitzer Wald (ZIERTH; LANGE & LIEDER 2001) könnte es sich um eine<br />
Aussetzung gehandelt haben.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust geeigneter Waldlebensräume oder deren Fragmentierung<br />
- Beseitigung von Weichhölzern<br />
- Zunahme geschlossener Nadelwälder<br />
- Entwässerungen<br />
- Früher durch Jagd dezimiert<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Eine Neubesiedlung wäre nur durch Aussetzung möglich<br />
- Geeignete Lebensräume könnten langfristig nur durch die großflächige Aufforstung der sanierten<br />
Wismutbergbauflächen mit Laubgehölzen entstehen<br />
- Auch die fortschreitende Sukzession auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen im Zeitzer Forst, der<br />
„Muna“ bei Rüdersdorf und im Pöllwitzer Wald könnten in ferner Zukunft großflächig laubholzreiche Wälder<br />
entstehen lassen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 95
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Birkhuhn – Tetrao tetrix L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach LIEBE (1873, 1878) ist die Art noch verbreiteter Brutvogel mit starkem Bestandsrückgang. Er nennt als<br />
Brutplätze Bad Klosterl<strong>aus</strong>nitz (Waldgebiet reicht bis in den Landkreis Greiz), Linda, Ronneburg bis Crimmitschau<br />
und Auma bis Ziegenrück. HELLER (1926) kennt das Birkhuhn laut seinen Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
Jahre 1881 von Kühdorf, Elsterberg, Pfaffengrün, Herlasgrün und Heinsdorf. KOEPERT (1896) führt das Birkhuhn<br />
ebenfalls für das Waldgebiet um Bad Klosterl<strong>aus</strong>nitz an. DOMBROWSKI (1893) nannte für das Revier<br />
Hermannsgrün bei Greiz einen Bestand von ca. 20 Ind. und bezeichnet das Birkhuhn u.a. als sehr häufig im<br />
Revier Großkundorf.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist es in den Sümpfen bei Bad Klosterl<strong>aus</strong>nitz und mit einem kleinen Bestand bei<br />
Gauern südlich von Ronneburg beheimatet. DETMERS (1912) erwähnt ein Vorkommen bei Großebersdorf.<br />
Ein kleiner Bestand siedelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Hohenölsen (VÖLCKEL; FLÖßNER 1984 a).<br />
SCHMIDT (1926) beobachtete im Haardtwald zwischen Greiz und Weida 1925 1 Hahn und 4 Hühner. Der<br />
Hahn wurde kurz darauf geschossen. Laut HIRSCHFELD (1932) ist das Birkhuhn in der Gegend um<br />
Hohenleuben selten und nur noch stellenweise anzutreffen, z.B. in der Hainsberger Flur. In der Umgebung<br />
von Greiz zählte das Birkhuhn bis etwa 1915 noch zu den verbreiteten und ziemlich häufigen Brutvögeln. Im<br />
Revier Waldh<strong>aus</strong> waren 5 bis 10 Balzplätze bekannt. Weitere Vorkommen bestanden im Revier Heinrichsgrün,<br />
bei Gablau, Leiningen, Hohndorf und Moschwitz. Bis 1930 war der Bestand erloschen (LANGE & LEO<br />
1978). Bei Culmitzsch wurden 1945 letztmalig 2 Hähne und 3 Hennen gesehen (LANGE & LEO 1978).<br />
Ab 1950<br />
Die letzten Nachweise gelangen 1954 mit 2 Ind. im Markersdorfer Grund, mit 2 Ind. bei Großdraxdorf, mit<br />
5 Ind. in Greiz-Rothental (LEO, MÖCKEL, RICHTER; LANGE & LEO 1978), 1956 mit balzenden Männchen bei<br />
Berga sowie zwischen Pansdorf und Hohndorf (FG Greiz, PIETZOLD; FLÖßNER 1984 a) und mit 2 Männchen<br />
am 02.06.1997 auf <strong>dem</strong> ehemaligen Truppenübungsplatz im Pöllwitzer Wald (HERRGEN; ROST, FRIEDRICH &<br />
LANGE 1998).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust geeigneter Offenlandschaften mit extensiver Weidewirtschaft und feuchtem Grünland<br />
- Früher durch Jagd dezimiert<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wiederbesiedlung ist nur möglich, wenn sich die landwirtschaftliche Nutzung, besonders des Grünlandes,<br />
großflächig ändern würde, was gegenwärtig nicht zu erwarten ist<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 96
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Auerhuhn – Tetrao urogallus L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
LIEBE (1878) stellt ein unaufhaltsames Schwinden des Bestandes fest. Er nennt als Brutplätze noch Bad<br />
Klosterl<strong>aus</strong>nitz (Das Waldgebiet reicht bis in den Landkreis Greiz). HELLER (1926) kennt die Art nach seinen<br />
Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 als Brutvogel im Pöllwitzer Wald. Nach DOMBROWSKI (1893) war das<br />
Auerhuhn Standvogel im Revier Friesau und im Pöllwitzer Wald bei Greiz.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach FEUSTEL (1912) wurde ein Rackelhahn erlegt: „Am 21. Oktober 1911 schoß Herr Fabrikant Weißker in<br />
Greiz auf seinem Jagdreviere einen Rackelhahn in voller Pracht und zwar die seltenere Art, Vater : Auerhahn,<br />
Mutter: Birkhenne.“ HILDEBRANDT (1919) verweist auf das Vorkommen des Auerhuhns in den waldreichen<br />
Teilen des Buntsandsteins westlich der Elster. Im Pöllwitzer Wald gab es 1920 noch 4 Hähne und 20<br />
Hennen (HILFERT; HIRSCHFELD 1932). Die letzten vergeblichen Brutversuche im Revier Waldh<strong>aus</strong> bei Greiz<br />
erfolgten in den Jahren 1928 / 29 (MÜLLER; LANGE & LEO 1978). Bei Tautenhain verschwand das Auerhuhn<br />
um 1930 (GÜNTHER 1969).<br />
Ab 1950<br />
Am längsten hielt sich der Bestand im Revier Bad Klosterl<strong>aus</strong>nitz. Von 1963 bis 1973 wurden <strong>aus</strong> diesem<br />
Gebiet noch 10 Ind. gemeldet. Danach erfolgte ein stetiger Rückgang und letztmalig wurde 1981 noch 1 Ind.<br />
nachgewiesen (Bezirksjagdbehörde Gera, KEUTSCH; FLÖßNER 1984 b).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Forstwirtschaft<br />
- Freizeitnutzung in Waldgebieten<br />
- Früher durch Jagd dezimiert<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Eine Wiederbesiedlung ist derzeit nicht zu erwarten<br />
- Die Maßnahmen zum Schutz wären so komplex, dass sie im Landkreis Greiz nicht zu erfüllen sind<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 97
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Zwergtaucher – Tachybaptus ruficollis (Pallas)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Gefährdet<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Starke Abnahme um 1985 – 1993,<br />
danach Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
In der näheren Umgebung seines Wohnortes fand BREHM (1820 – 1822) die Art als häufigen Brutvogel: „Der<br />
kleine Steißfuß, Podiceps minor ist der gemeinste in unserer Gegend. Ein jeder schilfreiche Teich von einigem<br />
Umfange beherbergt ein Pärchen und große, wie der frießnitzer See, sind oft von mehrern Paaren bewohnt.<br />
Dies war, so lange ich hier bin, der Fall, den Sommer 1821 <strong>aus</strong>genommen. In ihm fehlten die kleinen<br />
Steißfüße auf allen unseren Teichen, den frießnitzer See nicht <strong>aus</strong>genommen ...“ Die Ornithologische Sektion<br />
Gera (1859) bezeichnet die Art als häufigen Brutvogel in der Umgebung von Gera. Auch LIEBE (1873)<br />
führt den Zwergtaucher als „ziemlich häufigen“ Brutvogel auf, und nennt „... die größeren Teiche zwischen<br />
Oberpöllnitz, Frießnitz und Wittchenstein ...“ LIEBE (1878) schreibt: „… so bezieht er ... winzig kleine Teiche<br />
und sogar die Ausschachtungen neben den Bahnen, die er z. B. im Elsterthal regelmäßig zur Heimat macht.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach Hildebrandt (1919) ist er ein verbreiteter Brutvogel in Ostthüringen und brütet selbst auf ganz kleinen<br />
Teichen.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) erwähnt eine starke Abnahme um Gera nach <strong>dem</strong> strengen Winter 1962 / 63. Der Bestand<br />
von ca. 100 BP im Altkreis Gera-Land wurde auf ein Drittel reduziert und hat sich bis 1968 nicht wieder erholt.<br />
Auf <strong>dem</strong> St<strong>aus</strong>ee Greiz-Aubachtal brütete die Art nur bis 1969 regelmäßig mit 1 BP (LEO & LANGE<br />
1981). BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) führen den Zwergtaucher als regelmäßigen Brutvogel in der<br />
Leschke, im „Himmelreich“ und am oberen Aumühlenteich auf. Eine erste Bestandserfassung 1972 / 73<br />
brachte folgende Ergebnisse: Altkreis Gera (LIEDER, SCHEFFEL): 1 BP Raitzhainer Teich, 1 – 3 BP Großer<br />
Teich Kauern, 1 BP „Erholung“ Münchenbernsdorf, 2 BP Röpsener Teiche, 1 BP Agaer Teich, 4 BP<br />
Frießnitzer See; Altkreis Greiz (TOLKMITT): 1 BP Parkteich Greiz, 1 BP Schlötenteich, 2 BP Teich bei Gottesgrün;<br />
Altkreis Zeulenroda (LORENZ): ca. 15 BP um Auma (Wolge, Leschke, „Himmelreich“, oberer<br />
Aumühlenteich) und ca. 10 BP im restlichen Kreisgebiet, u.a. 1 BP Pöllwitzer Teiche, 1 BP Tschorrteich.<br />
LANGE & LEO (1978) vermerken für den Altkreis Greiz, dass der Zwergtaucher seit den 1960er-Jahren, in<br />
denen noch ca. 20 BP bekannt waren, stark abgenommen hat und nicht mehr alljährlich hier brütet. Zu dieser<br />
Zeit waren bereits etliche Brutvorkommen erloschen. Speziell genannt werden Teiche bei<br />
Münchenbernsdorf, die Eisteiche bei Bad Köstritz, der Aubachst<strong>aus</strong>ee, der Schwarze Teich und der Obere<br />
Krümmeteich. 1982 bis 1984 wurden folgende Bestandszahlen ermittelt (LIEDER 1987): Altkreis Gera max.<br />
13 BP (nicht alljährlich alle Brutplätze besetzt); Altkreis Greiz max. 3 BP (nicht alljährlich alle Brutplätze besetzt);<br />
Altkreis Zeulenroda 3 – 5 BP. Im Jahr 1987 wurden nach einer Bestanderhebung nur noch 6 – 8 BP<br />
im Gesamtgebiet festgestellt (LIEDER 1989). Dieser Rückgang hielt bis 1993 an. Danach erfolgte wieder eine<br />
Bestandszunahme auf ca. 30 BP im Jahr 2001 (LANGE & LIEDER 2001). Gegenwärtig brüten ca. 35 – 52 BP<br />
(ADEBAR-Projekt 2005 – 2008).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 98
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Eutrophierung der Gewässer, Beseitigung der Röhrichtzonen<br />
- Verluste der Jungvögel durch Raubfische (Wels, Hecht)<br />
- Freizeitnutzung an Gewässern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrags<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Beseitigung der Raubfischbesetzung an den Brutgewässern<br />
- Verhinderung der Freizeitnutzung an den Brutgewässern und an größeren Gewässern in der Umgebung<br />
der Brutplätze<br />
Verbreitungskarte 2: Zwergtaucher<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3 2 – 3<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 99
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rothalstaucher – Podiceps grisegena (Boddaert)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Extrem selten<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Streng geschützt<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Erstbesiedlung 1996<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Angabe von LIEBE (1873) „Podiceps subcristatus soll früher im Frießnitzer See gebrütet haben“ wird von<br />
keiner Seite bestätigt. LIEBE (1878) führt nochmals dazu <strong>aus</strong>: „Der rothhälige Haubentaucher soll früher auf<br />
<strong>dem</strong> Frießnitzer See gewohnt haben; Ch. L. Brehm weiss aber nichts davon; ...“ Da LIEBE die Quelle selbst<br />
nicht kennt, ist die Angabe kein Beleg für ein Vorkommen im 19. Jahrhundert auf <strong>dem</strong> Frießnitzer See.<br />
20. Jahrhundert<br />
Das bisher einzige gesicherte Brutvorkommen des Rothalstauchers bestand im Jahre 1996 am Dorfteich in<br />
Wolfersdorf. Das Paar führte 4 Jungvögel. (LANGE, LIEDER; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1997). Weitere Brutvorkommen<br />
sind weder davor noch danach belegt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Es sind keine lokalen Gefährdungsursachen am bisher einzigen Brutplatz bekannt<br />
- Einer möglichen Ansiedlung an vielen Stillgewässern stehen die gleichen Gefährdungsfaktoren wie beim<br />
Zwergtaucher entgegen:<br />
· Eutrophierung der Gewässer<br />
· Beseitigung der Röhrichtzonen<br />
· Verlust der Jungvögel durch Raubfische (Wels, Hecht)<br />
· Freizeitnutzung an Gewässern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- An weiteren potentiellen Brutplätzen (z. B. Frießnitzer See, Weiderteich, Burkersdorfer Feldteich) sind die<br />
gleichen Schutzmaßnahmen wie beim Zwergtaucher zu ergreifen:<br />
· Verminderung des Nährstoffeintrags<br />
· Schutz der Röhrichtzonen<br />
· Vermeidung der Besetzung mit Raubfischen an den Brutgewässern<br />
· Verhinderung der Freizeitnutzung an den Brutgewässern bzw. bei größeren Gewässern in der Umgebung<br />
der Brutplätze<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 100
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schwarzhalstaucher – Podiceps nigricollis (Brehm)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Der Schwarzhalstaucher wird von BREHM (1824) als „Der Ohrensteißfuß. (Geöhrte Steißfuß. Ohrentaucher.)<br />
Podiceps auritus, Lath. (Colymbus auritus, Linn.)“ beschrieben, was zur irrtümlichen Aufnahme des Ohrentauchers<br />
durch ROST & GRIMM (2004) in die Liste der Thüringer Brutvögel führte. Zur Klärung des Sachverhaltes<br />
wurden die Originaldokumente zu allen Lappentaucherarten im Brehm-Museum in Renthendorf eingesehen.<br />
Die Ergebnisse sind 2009 in einem Manuskript (LIEDER) zusammengefasst worden und werden<br />
hier <strong>aus</strong>zugsweise wiedergegeben:<br />
Die Artbeschreibung durch BREHM ist unter der Bezeichnung Podiceps auritus eindeutig <strong>dem</strong> Schwarzhalstaucher<br />
und nicht <strong>dem</strong> Ohrentaucher zuzuordnen: „... der ganze Oberkörper, Hals und Oberkopf dunkelschwarz<br />
...“ Zum Vorkommen führt BREHM <strong>aus</strong>: „Er bewohnt ... Seen und große Teiche des <strong>mittleren</strong> Europa,<br />
... ist in manchen Gegenden Deutschlands, z.B. in der L<strong>aus</strong>itz ziemlich gemein ...“ BREHM (1822) gibt ein<br />
Brutvorkommen des Schwarzhalstauchers in Ostthüringen mit folgen<strong>dem</strong> Wortlaut an: „Der Ohrensteißfuß,<br />
Podiceps auritus nistete nur im Jahre 1818 auf <strong>dem</strong> frießnitzer See; früher oder später bemerkte ich ihn dort<br />
nicht.“<br />
Im Gegensatz dazu bezeichnet BREHM (1824) den Ohrentaucher als „Den gehörnten Steißfuß (Gehörnter<br />
Taucher.) Podiceps cornutus, Lath.“ Seine Beschreibung der Artkennzeichen weist auch eindeutig auf den<br />
Ohrentaucher hin: „Vorderhals vom Ende des schwarzen Kragens an schön rostroth“. Zum Vorkommen führt<br />
BREHM <strong>aus</strong>: „Er bewohnt das nordwestliche Europa und nördliche Amerika, ... kommt auf <strong>dem</strong> Zuge ... äußerst<br />
selten nach Deutschland, ... im Herbst häufiger als im Frühjahr“.<br />
Auf die Verwechslung beider Vogelarten auf Grund des Synonyms „Ohrensteißfuß“ für den Schwarzhalstaucher<br />
weist auch WÜST (1990) hin.<br />
1900 bis 1950<br />
HIRSCHFELD konnte im Jahre 1932 einen Brutnachweis des Schwarzhalstauchers für den Weiderteich bei<br />
Niederpöllnitz erbringen. Auch am Frießnitzer See war der Schwarzhalstaucher nach VÖLCKEL zu dieser Zeit<br />
Brutvogel (HILDEBRANDT & SEMMLER 1978; HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Brutnachweise des Schwarzhalstauchers ergaben sich mit 1 BP 1981 im RNG Großkundorf (ROST 1998),<br />
mit 2 BP 1998 (erfolglos) am Weiderteich bei Niederpöllnitz (LIEDER, LUMPE; ROST, FRIEDRICH & LANGE<br />
1999), mit je 1 BP 2001 am Weiderteich bei Niederpöllnitz und am Frießnitzer See (LIEDER, LUMPE) sowie mit<br />
2 BP 2003 im RNG Culmitzsch (JAKOB). Nach den Wertungskriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER<br />
(2005) besteht begründeter Brutverdacht für folgende Gewässer: Weiderteich bei Niederpöllnitz 1997, 1999,<br />
2002, 2005 und 2006 (LANGE, LIEDER, LUMPE, MÜLLER), RNG Culmitzsch 2002, 2004, 2005 und 2006<br />
(JAKOB, LANGE, LUX, MÜLLER, SCHUSTER), RNG Großkundorf 1983, 1984, 1986 und 1988 (HILPMANN, JAKOB,<br />
LANGE, MÜLLER, ROTT).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 101
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Eutrophierung der Gewässer<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen<br />
- Verlust von Brutgewässern (RNG Großkundorf bereits trockengelegt, RNG Culmitzsch soll in den nächsten<br />
zwei bis drei Jahren folgen)<br />
- Verluste der Jungvögel durch Raubfische (Wels, Hecht)<br />
- Freizeitnutzung an Gewässern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Schaffung eines ca. 10 ha großen Gewässers als Ersatzmaßnahme für das RNG Culmitzsch<br />
- Vermeidung der Besetzung mit Raubfischen an den Brutgewässern<br />
- Verhinderung der Freizeitnutzung an den Brutgewässern bzw. bei größeren Gewässern in der Umgebung<br />
der Brutplätze<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 102
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rohrdommel – Botaurus stellaris (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
18. Jahrhundert<br />
Die Ornithologischen Sektion Gera (1859) <strong>berichte</strong>t: „Im vorigen Jahrhundert einmal bei St. Gangloff vorgekommen,<br />
zu deren Erlegung, weil ihres Geschrei willen kein Jäger sich daran wagte, ein Commando Soldaten<br />
von Gera <strong>aus</strong>rückte!?“<br />
19.Jahrhundert<br />
SEYDEL (1860) führt <strong>aus</strong>, dass vor 15 Jahren eine Rohrdommel bei Niederndorf geschossen wurde, die<br />
durch ihre Rufe die ganze Gegend in Angst und Schrecken versetzte. Nach SEYDEL (1883) war die Rohrdommel<br />
früher Brutvogel am Weiderteich bei Niederpöllnitz und am Frießnitzer See. Als Gewährsmann wird<br />
der Rittergutsbesitzer VÖLKEL <strong>aus</strong> Wetzdorf genannt. LIEBE (1873) vermerkt, dass er sie vor vielen Jahren<br />
einmal zur Brutzeit am Frießnitzer See gehört habe. In einer späteren Arbeit (LIEBE 1892) erwähnt er, dass<br />
er die Rohrdommel vor einem halben Jahrhundert öfter im Schilf dieses Teiches beobachtet hat. HELLER<br />
(1897) teilt zum Brutvorkommen folgendes mit: „Auch mein väterlicher Freund Liebe, unter dessen Leitung<br />
ich hier meine ersten <strong>ornithologische</strong>n Studien machen konnte, kannte den Woyderteich und Frießnitzer See<br />
noch als Brutplatz mancher nun <strong>aus</strong> der Gegend verschwundener Vögel, wie … Ardea minuta, Botaurus<br />
stellaris ...“ Für den Tinzer Teich wird die Rohrdommel als sehr seltener Brutvogel bezeichnet (Ornithologischen<br />
Sektion Gera 1859).<br />
21. Jahrhundert<br />
Die vorläufig letzte Sichtbeobachtung einer Rohrdommeln zur Brutzeit war 1 Ind. am 11. Juli 2008 auf <strong>dem</strong><br />
Finkenberg bei Auma. Der Vogel wanderte zunächst vom Rand eines Wiesenteiches zur 25 Meter entfernten<br />
Straße Auma – Braunsdorf und flog bei Annäherung eines PKW in die benachbarten Aumawiesen ab. Wenige<br />
Stunden später wurde die Rohrdommel noch einmal an einem kleinen Teich in der Nähe der Eisenschmidtmühle<br />
gesehen (BARNIKOW, BÖTTCHER; ROST 2009).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Eutrophierung der Gewässer<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen<br />
- Verlust von Brutgewässern (Tinzer Teich, Teiche im Erlbachtal)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages in Gewässer<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Entwicklung eines größeren Schilfgebietes am Weiderteich bei Niederpöllnitz könnte die Weideransiedlung<br />
begünstigen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 103
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Zwergdommel – Ixobrychus minutus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Am Frießnitzer See war die Zwergdommel Brutvogel. LIEBE (1873) erhielt 1852 einen noch nicht flüggen<br />
Jungvogel <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> „Schilfdickicht“ des Frießnitzer Sees, traf die Zwergdommel in späteren Jahren aber<br />
nicht mehr dort an. SEYDEL (1883), der sich auf den Rittergutbesitzer VÖLKEL <strong>aus</strong> Wetzdorf bezieht, meint,<br />
dass sie noch immer dort Brutvogel sei. Auch für den Tinzer Teich bei Gera wird die Zwergdommel als sehr<br />
seltener Brutvogel erwähnt (Ornithologischen Sektion Gera 1859).<br />
1900 bis 1950<br />
Das Vorkommen am Frießnitzer See bestand vermutlich auch in den 1930er-Jahren. ROßBACH (1937) führt<br />
<strong>aus</strong>: „Herr Rittergutsbesitzer Edgar Völckel, Hohenölsen, teilte mir mit, dass am sog. ,Frießnitzer See‘, einem<br />
Teich bei Frießnitz, Landkr. Gera, die Zwergrohrdommel, – Ixobrychus minutus minutus L. – wahrscheinlich<br />
sogar als Brutvogel, vorkomme.“<br />
Ab 1950<br />
„Am Parkteich Greiz wurde sie [die Zwergdommel] 1954 verhört, eine Brut jedoch konnte nicht festgestellt<br />
werden, ...“ (CZERLINSKY 1966). Am Großen Teich bei Kauern bestand in den Jahren 1972 / 73 ein Brutverdacht<br />
(SCHEFFEL; LANGE & LIEDER 2001). BAUM hörte den Balzruf 1975, 1980 und 1987 am Frießnitzer See,<br />
1987 auch zwischen Großebersdorf und Struth (LANGE & LIEDER 2001). Nach<strong>dem</strong> die Art in Thüringen als<br />
Brutvogel verschwunden war, erfolgte in den letzten Jahren im benachbarten Altenburger Raum eine Wiederbesiedlung.<br />
Nachweise von einzelnen Zwergdommeln zur Brutzeit 2008 sowohl am Speicher Söllmnitz<br />
(LIEDER) als auch am Weiderteich bei Niederpöllnitz (SCHUSTER) lassen auf eine erfolgreiche Wiederbesiedlung<br />
hoffen (LUMPE & LIEDER 2009).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 104
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Eutrophierung der Gewässer<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen<br />
- Verlust von Brutgewässern (Tinzer Teich, Teiche im Erlbachtal)<br />
- Intensive Fischwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Entwicklung eines größeren Schilfgebietes am Weiderteich bei Niederpöllnitz könnte die Weideransiedlung<br />
begünstigen<br />
- Extensivierung der Fischwirtschaft an den möglichen Brutgewässern<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 3.000 m Abstand)<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 105
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schwarzstorch – Ciconia nigra (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Erstbesiedlung um 1988, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen des<br />
Schwarzstorches im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
Seit ca. 1988 ist der Schwarzstorch Brutvogel im Landkreis Greiz und besiedelte das Auma- und Weidatal<br />
(BAUM, HILPMANN, FLEISCHER, KRAUSE). 1998 wurde Brutverdacht im Greiz-Werdauer Wald (TK 5339 / 1) und<br />
im Pöllwitzer Wald (TK 5338 / 4) festgestellt (SEWITZ & KLAUS 1999). 2001 bestand Brutverdacht in drei Gebieten<br />
(LANGE & LIEDER 2001): Vogtländisches Oberland (Brutzeitbeobachtungen seit 1994), Greiz-Werdauer<br />
Wald (Brutzeitbeobachtungen seit 1995) und Aumatal (Brutzeitbeobachtungen seit 1987). Für das Jahr 2008<br />
wird der Bestand auf 4 – 7 BP geschätzt (LUMPE & LIEDER 2009): Greiz-Werdauer Wald, Pöllwitzer Wald,<br />
Wälder zwischen Münchenbernsdorf und Schömberg, Wälder bei Auma. Dazu kommen Paare im nahen<br />
Grenzbereich der Nachbarkreise, deren Nahrungsreviere bis in unser Gebiet reichen: Rüdersdorf / Bad Klosterl<strong>aus</strong>nitz<br />
(JESCHONNEK), Zeitzer Forst und Schnaudertal (WEISSGERBER 2007), Sprottetal bei Vollmershain<br />
(KÖHLER). Direkte Brutnachweise gelangen erst seit 1999: Pöllwitzer Wald 1999, 2001, 2007 und 2008<br />
(KANIS, KLEHM, LANGE, LEO), Forstrevier Waldh<strong>aus</strong> 2007 (LANGE, LUMPE; LUMPE 2008 b).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Forstarbeiten zur Brutzeit<br />
- Abholzung von Altholzbeständen, damit Mangel an Horstbäumen<br />
- Naturferner Gewässer<strong>aus</strong>bau<br />
- Freizeitnutzung an Gewässern und an den Brutplätzen (Angeln, Wanderwege, Motocross)<br />
- Entwässerung waldnaher Feuchtgebiete<br />
- Kollision mit Stromleitungen und Vergrämung durch Windkraftanlagen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine Beunruhigung an den Horststandorten durch Forstarbeiten und Freizeitnutzung<br />
- Schutz von Altholzbeständen<br />
- Renaturierung von Fließgewässern<br />
- Wiedervernässung waldnaher Feuchtgebiete<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 3.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 106
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Weißstorch – Ciconia ciconia (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
18. Jahrhundert<br />
„Vor drei Menschenaltern gab es in <strong>dem</strong> ganzen Landstrich zwischen Braunsdorf, Mittelpöllnitz und Frießnitz<br />
zahlreiche Störche.“ (LIEBE 1873). Darauf weist auch HEYDER (1952) hin: „Es [das soeben genannte Gebiet]<br />
ist als Storchgebiet bereits bekannt durch eine Federzeichnung von etwa 1725, die auf <strong>dem</strong> Dach des Rath<strong>aus</strong>es<br />
von Triptis ein Storchnest zeigt (vgl. P.R. BEIERLEIN: Altes unbekanntes Vogtland. Dresden o.J. S.<br />
34.)“. 1736 soll 1 BP Weißstörche auf <strong>dem</strong> Schornstein der Darre in Frießnitz genistet haben (KLEMM 1998).<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) <strong>berichte</strong>t: „Bei mehrfachen Versuchen sich hier anzusiedeln (Langenberg,<br />
Niederndorf) wurden sie [die Weißstörche] stets weggeschossen.“ Auch bei Großebersdorf wurde<br />
eine Ansiedlung um 1870 durch Abschuss vernichtet. LIEBE (1873) sagt <strong>aus</strong>: „Ein Storchenpaar horstete bis<br />
vor kurzem bei Großebersdorf, ist aber zuletzt der Schießwuth als Opfer gefallen. Wiederholte Versuche<br />
dieser Tiere, sich auf <strong>dem</strong> Gebiet wieder einzubürgern, sind beharrlich mit Pulver und Blei vereitelt worden.“<br />
20. Jahrhundert<br />
HEYDER (1952) <strong>berichte</strong>t von einem neu angesiedelten Paar im Jahre 1934 zwischen Köthnitz und Neudeck<br />
bei Auma und beruft sich auf KÖNIG, Orn. Mber. 43, 1935, S. 116. Danach gab es nur noch sporadische<br />
Ansiedlungen. Bis 1946 brütete ein Paar in Frießnitz. (LORENZ 1978, GÜNTHER 1969). Der Beginn dieser<br />
Besiedlung ist unbekannt. Eventuell erfolgte die Ansiedlung schon am Ende des 19. Jahrhunderts, denn<br />
HELLER (1897) schreibt zum Gebiet Frießnitz, Burkersdorf und Weiderteich „… und neuerdings scheint auch<br />
der weiße Storch sich wieder einbürgern zu wollen.“ In den letzten Jahren wurden immer wieder besetzte<br />
Brutplätze festgestellt: Frießnitz 1975 (BAUM; LANGE & LIEDER 2001), Gera-Zeulsdorf 1984 (KRÜGER 1986 a),<br />
Seelingstädt 1988 bis 1990 (BAUM; KRÜGER 1997), Zeulenroda 1994 bis 2000 (LANGE; SCHMIDT 2000).<br />
21. Jahrhundert<br />
In Wittchendorf wurde im Mai 2007 von einem Weißstorchpaar auf einer stillgelegten Esse ein Horst angelegt,<br />
ohne das es zu einer Brut kam. Im Jahre 2008 hat das BP dann drei Jungvögel erfolgreich großgezogen.<br />
Im Folgejahr kehrte jedoch nur ein Brutpartner zum Horst zurück. (FRÜHAUF, LANGE, LUMPE, SIMON,<br />
MÜLLER; LUMPE 2009).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 107
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft (Entwässerung und Grundwasserabsenkung, Verbauung von Freiflächen,<br />
Umwandlung von Grünland in Ackerland, Einsatz großer Mengen von Agrochemikalien)<br />
- Kollision mit Freileitungen, Fahrzeugen und Windenergieanlagen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft (Wiedervernässung von Grünland, Beschränkung des Einsatzes von<br />
Agrochemikalien in potentiellen Brutgebieten wie Frießnitz – Großebersdorf – Niederpöllnitz<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
- Schaffung von Horstunterlagen in potentiellen Brutgebieten<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 108
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Fischadler – Pandion haliaetus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Wiederbesiedlung möglich<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1832) schreibt: „Auffallend ist es, daß sie [die Fischadler] hier nicht horsten. Man sollte glauben, die<br />
Gegend sey für ihren Brutort sehr geeignet; und dennoch wurde seit meinem Hierseyn kein Horst in der hiesigen<br />
Gegend bemerkt, und nur ein Mal erhielt ich ein altes Männchen im Junius; allein dieses schien nicht verpaart<br />
gewesen zu seyn.“ Ein Jahr später kann BREHM (1833) jedoch folgendes ergänzen: „Noch muß ich nachträglich<br />
bemerken, daß im Sommer 1832 ein Paar von Pandion alticeps in den Wäldern unsern des frießnitzer<br />
Sees gehorstet hat. Noch im September flogen die beyden Jungen, von denen eins in meine Hände kam,<br />
schreyend hinter den Alten her, um Futter zu erhalten. Diese Familie hatte der Fischerey jenes Teiches sehr<br />
großen Schaden gethan.“ Nach LIEBE (1878) horstete der Fischadler „in den Forsten von Großebersdorf“. In<br />
einem Brief vom 30.07.1893 teilt LIEBE mit, dass er [der Fischadler] seinen alten Horst in den Wäldern der Weißen<br />
Elster im Unteren Vogtland bezogen habe (HENNICKE 1893). Ein Paar horstete um 1880 in der Nähe der<br />
Bretmühle bei Greiz und wurde geschossen (HELLER 1926). Dieses Vorkommen muss noch bis Ende des<br />
19. Jahrhunderts bestanden haben, denn HELLER (1895) schreibt: „Am 5. April kreiste ein prachtvoll <strong>aus</strong>gefärbter<br />
Pandion haliaetus über <strong>dem</strong> Bahnhofe [Gera-Zwötzen]; wahrscheinlich der bei Neumühle seit vielen Jahren<br />
regelmäßig nistende Gast, welcher seine Beutezüge viele Stunden weit <strong>aus</strong>dehnt.“ HILDEBRANDT (1938) bezweifelt<br />
zu Unrecht die Brutvorkommen im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
Im Gebiet um Großebersd o r f – Niederpöllnitz bestand im Jahre 1969 Brutverdacht (AUERSWALD; LIEBERT 1983).<br />
Im Jahre 1988 brütete ein Paar erfolgreich bei Großebersdorf (BAUM; LANGE & LIEDER 2001).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störungen am Brutplatz durch Freizeitnutzung und Forstwirtschaft<br />
- Mutwillige Vergrämung als „Fischräuber“<br />
- Kollision mit Freileitungen und Windenergieanlagen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz der Horstbereiche in Waldgebieten<br />
- Schaffung von Kunsthorsten auf Strommasten<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
- Unterlassung jeglicher Vergrämung<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 109
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Kornweihe – Circus cyaneus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
LIEBE (1878) konnte lediglich 1842 im Bereich zwischen Gera und Weida ein BP der Kornweihe feststellen.<br />
HELLER (1926) vermerkt nach seinen Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881: „Die Weihen (Circus) fehlen als<br />
Brutvogel im [engeren] Gebiet.“ Als engeres Gebiet bezeichnet HELLER seine „Vaterstadt“ [Greiz] und „einen<br />
Umkreis von 2 – 3 Stunden [Wanderzeit].“<br />
20. Jahrhundert<br />
Im Jahre 1976 brütete ein Paar bei Nauendorf im Nordosten des Landkreises Greiz (AUERSWALD, ZÖRNER;<br />
LIEDER 1983 b).<br />
Im Bild ist ein Weibchen der Kornweihe zu sehen, das über den gesamten Sommer 2009 auf der Feldflur bei<br />
Fraureuth, nahe an der Grenze zum Landkreis Greiz, beobachtet wurde (HALBAUER).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft<br />
- Lebensraumzerstörung durch Flurbereinigung<br />
- Lebensraumzerstörung durch Entwässerung und damit Verlust von Grünland-Feuchtgebieten<br />
- Kollision mit Freileitungen und Windenergieanlagen<br />
- Verluste durch Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Störungen im Horstbereich durch Landarbeiten und Freizeitnutzung<br />
- Nahrungsmangel als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung sowie Mehrung von Brachflächen und feuchtem Grünland<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Bekämpfung des Fuchses an bekannten Brutplätzen<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 3.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 110
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wiesenweihe – Circus pygargus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Wiesenweihe<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
Im Jahre 1994 wurde ein BP direkt an der Landesgrenze zu Sachsen bei Seelingstädt festgestellt (HÄSSLER;<br />
STEFFENS, KRETZSCHMAR & RAU 1998). Der Horststandort befand sich im Landkreis Greiz (HALBAUER).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Entwässerung und Verlust<br />
von Grünland-Feuchtgebieten<br />
- Kollision mit Freileitungen und Windenergieanlagen<br />
- Verluste durch Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Störungen im Horstbereich durch Landarbeiten und Freizeitnutzung<br />
- Nahrungsmangel als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung sowie Mehrung von Brachflächen und feuchtem Grünland<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Bekämpfung des Fuchses an bekannten Brutplätzen<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 111
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rohrweihe – Circus aeruginosus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, gleichbleibend<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Rohrweihe<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.<br />
Ab 1950<br />
Erste Hinweise auf Bruten der Rohrweihe lassen sich bei GÜNTHER (1969) finden: „Etwa 1958 stand ein<br />
Horst auf einem feuchten Feld in der Nähe eines Tümpels bei Ronneburg (Me.). 1960 nistete die Rohrweihe<br />
im Kauernschen Teich, wurde aber gestört (R.L.). Am 13.4.1969 trug ein Männchen Geniste in den<br />
Frießnitzer Teich, zu einer Brut kam es jedoch nicht (Wo., Gü., Kra., Sche.).“ Um 1980 brüteten bereit ca. 10<br />
Paare, besonders im Norden des Gebietes. LIEDER (1983 a) nennt neben den oben angeführten Orten folgende<br />
Brutvorkommen: Großer Teich bei Kauern 1977 – 1981, Baldenhain – Nauendorf 1972, 1976, 1979 (2<br />
BP) und 1980, Frießnitzer See 1970, 1971, 1980, Mäderteich bei Burkersdorf 1978 – 1980, Burkersdorfer<br />
Feldteich 1979 , Feld bei Uhlersdorf 1980 und Schilfwiese bei Dorna 1976. Außer<strong>dem</strong> wurden 1980 in vier<br />
Gebieten ständig Rohrweihen festgestellt, bei denen angenommen wurde, dass es sich um Feldbrüter handelte:<br />
Hirschfeld – Sachsenroda, Brahmenau – Nauendorf, Korbußen – Großenstein und Hilbersdorf –<br />
Pohlen. Nach einer weiteren Bestandszunahme konnten um das Jahr 2000 etwa 20 – 25 BP geschätzt werden<br />
(LANGE & LIEDER 2001). Dies entspricht auch den Angaben bei SCHMIDT (2001) für eine Bestandserfassung<br />
im Jahr 1999. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden 17 – 22 BP ermittelt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Entwässerung und Verlust<br />
von Grünland-Feuchtgebieten<br />
- Kollision mit Freileitungen und Windenergieanlagen<br />
- Verluste durch Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Störungen im Horstbereich durch Landarbeiten und Freizeitnutzung an Gewässern<br />
- Brutverluste bei Feldbruten durch frühere Mahd bzw. Ernte<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung sowie Mehrung von Brachflächen und feuchtem Grünland<br />
- Erhaltung von Röhrichtzonen an Gewässern<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Bekämpfung des Fuchses an bekannten Brutplätzen<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 112
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 3: Rohrweihe<br />
1 1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 113
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rotmilan – Milvus milvus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, gleichbleibend<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) schreibt: „Die Königsweih ist, im Gegensatz zu Nassau und Hessen, in unserem Gebiet sehr<br />
selten. Ich sah den Vogel 1860 und 1861 und dann wieder 1871 zur Brutzeit am Südrand des Zeitzer Forstes;<br />
1869 fand ich in jener Waldung einen Horst, vermochte denselben aber nicht zu erreichen.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1976) vermelden für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts das gänzliche Fehlen<br />
des Rotmilans als Brutvogel in Ostthüringen.<br />
Ab 1950<br />
Um 1960 erfolgte die Wiederbesiedlung unseres Gebietes. Erstmals bestand 1956 / 58 Brutverdacht im Altkreis<br />
Greiz (BRÄSICKE; GRÜN 1971). Ein weiterer Brutverdacht ergab sich 1962 bei Wünschendorf (GÜNTHER,<br />
KÖHLER; GRÜN 1971). Vier Brutreviere nennt GÜNTHER (1969) im Elstertal: bei Bad Köstritz, bei<br />
Wünschendorf und bei Münchenbernsdorf. Nach LANGE & LEO (1978) bestand in den Jahren 1964 und 1970<br />
Brutverdacht bei Tschirma. Hier gelang 1971 auch der erste Brutnachweis für den Altkreis Greiz. Im Jahre<br />
1980 ermittelte ZAUMSEIL (1986) für den Altkreis Gera 7 BP, für den Altkreis Greiz 2 BP und für den Altkreis<br />
Zeulenroda 2 BP. Für 1984 / 85 nennt ZAUMSEIL (1987) 13 – 23 BP für die Altkreise Gera, Greiz und<br />
Zeulenroda. Im Ergebnis einer Bestandserfassung im Jahr 2000 schätzt PFEIFER (2001) für den Landkreis<br />
Greiz einen Bestand von 59 BP und für die Stadt Gera von 11 BP ein. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes<br />
2005 – 2008 wurden 55 – 83 BP ermittelt. Der Rotmilan siedelt somit nahezu flächendeckend im Landkreis<br />
Greiz und der Stadt Gera.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft, insbesondere Nahrungsverknappung<br />
durch ungünstige Fruchtfolgen bzw. Anbau von schnell hochwachsenden Kulturen (Wintergetreide, Raps),<br />
Grünlandumbruch, Einsatz von Agrochemikalien und Rückgang der Weidetierhaltung<br />
- Kollision mit Freileitungen, Windenergieanlagen und Fahrzeugen<br />
- Störungen im Horstbereich durch Forstarbeiten im Frühjahr und Freizeitnutzung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft und Erhaltung von Wiesenflächen<br />
- Nutzung des KULAP-Förderprogramms zum Rotmilanschutz im Landkreis Greiz<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen (Forstarbeiten, Freizeitnutzung)<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 114
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schwarzmilan – Milvus migrans (Boddaert)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen des<br />
Schwarzmilans im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
Bis 1980 fehlte der Schwarzmilan als Brutvogel im Landkreis Greiz und der Stadt Gera. Die ersten Bruten<br />
wurden mit je 1 BP in den Jahren 1985 – 1987 in Feldgehölzen zwischen Kleinaga und Reichenbach gefunden<br />
(SCHULZE).<br />
21. Jahrhundert<br />
Für das Jahr 2000 schätzen LANGE & LIEDER (2001) den Bestand mit 15 – 20 BP ein.<br />
Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden 20 – 24 BP ermittelt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft, Nahrungsverknappung durch ungünstige<br />
Fruchtfolgen bzw. Anbau von schnell hochwachsenden Kulturen (Wintergetreide, Raps), Grünlandumbruch,<br />
Einsatz von Agrochemikalien und Rückgang der Weidetierhaltung<br />
- Kollision mit Freileitungen, Windenergieanlagen und Fahrzeugen<br />
- Störungen im Horstbereich durch Forstarbeiten im Frühjahr und Freizeitnutzung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Kein Umbruch von Wiesenflächen<br />
- Nutzung des KULAP-Förderprogramms zum Schwarzmilanschutz auch im Landkreis Greiz<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen, keine Forstarbeiten zwischen März und Juli und<br />
keine Freizeitnutzung in Horstbereichen<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 115
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 4: Schwarzmilan<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
1 1<br />
2 – 3 1 2 – 3 1<br />
1 1<br />
1 1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 116
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Baumfalke – Falco subbuteo L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1832) entdeckte ein BP des Baumfalken in der Nähe von Renthendorf. In der Umgebung von Gera<br />
fand LIEBE (1873) die Art nur als seltenen Brutvogel vor. Als Brutplätze nennt LIEBE (1872) den Geraer Wald<br />
und den Kulmberg zwischen Loitzsch und Otticha. Für Ostthüringen bezeichnet LIEBE (1878) den Baumfalken<br />
als unstet mit einem Bestand von einem bis drei Paaren. Später muss der Baumfalke ganz als Brutvogel<br />
gefehlt haben (LIEBE 1893). Auch HELLER (1926) kann nur einen Brutnachweis von 1873 bei Elsterberg nennen.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist der Baumfalke kein Brutvogel mehr in Ostthüringen. HIRSCHFELD (1932) kennt<br />
den Baumfalken als seltenen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben und ROßBACH (1937) nennt Vorkommen<br />
bei Meilitz und 1932 bei Sirbis. LUMPE (2008 c) schreibt: „MARTIN MÜLLER gab Anfang der 1980er-<br />
Jahre an LUTZ MÜLLER seine Kenntnisse vom Brüten des Baumfalken in den 1930er- und 1940er-Jahren am<br />
Hang unterhalb des Weißen Kreuzes [Greiz] auf einer Kiefer weiter. Ein von ihm Anfang der 1940er-Jahre<br />
geschossenes Männchen ist noch heute als Präparat im Besitz seiner Tochter ERIKA KAUL. Er vermutete<br />
auch noch Bruterfolge in den 1950er-Jahren. Diese Aussage wird durch Beobachtungen jagender Baumfalken<br />
in dieser Zeit im Greizer Park gestützt (S. TOLKMITT).“<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist die Art seltener Brutvogel. Als Brutplätze werden das Ronneburger und Weidaer<br />
Gebiet benannt. Nach LANGE & LEO (1978) nahm der Bestand um 1950 zu und wird für den Altkreis Greiz auf<br />
5 BP geschätzt. Bis Ende der 1960er-Jahre war ein Rückgang zu verzeichnen. Am Katzenberg bei<br />
Mohlsdorf wurde 1 BP letztmalig 1970 festgestellt (LEO & LANGE 1981). Aus <strong>dem</strong> Jahre 1978 ist nur noch ein<br />
BP bekannt, das in der Nähe von Kleinreinsdorf nistete (LANGE & LEO 1978) . Ein weiteres Paar siedelte<br />
1978 bei Zogh<strong>aus</strong> (KITTELMANN; KRÜGER 1980). Eine Brutvogelerfassung des Baumfalken von 1980 / 81<br />
führt für den Altkreis Gera nur noch eine letzte Brut von 1978 an, für den Altkreis Greiz werden 0 BP und für<br />
den Altkreis Zeulenroda 1 BP aufgeführt (KRÜGER 1983 b). Von 1980 bis 1984 werden Brutvorkommen in<br />
den Altkreisen Greiz und Zeulenroda dargestellt (KRÜGER 1985 a, 1986 b). 1982 gab es 2 erfolgreiche BP im<br />
Altkreis Greiz (PIEHLER, TOLKMITT; KRÜGER 1986 b). Weitere Nachweise in den folgenden Jahren sind in den<br />
jeweiligen Jahres<strong>berichte</strong>n für Thüringen genannt, wobei sicherlich nicht immer der vollständige Bestand<br />
erfasst wurde: mind. 1 BP 1985 Altkreis Greiz, mind. 1 BP 1986 Altkreis Gera, 1 BP 1988 Altkreis<br />
Zeulenroda, 1 BP 1990 Altkreis Zeulenroda (KRÜGER 1990, 1992, 1995 a, 1996), je 1 BP 1991 bei<br />
Hohenölsen (HILPMANN) und Seelingstädt (HALBAUER), 1 BP 1992 bei Hohenölsen (HILPMANN; HEYER 1998 /<br />
99 a), je 1 BP 1993 bei Hohenölsen und Pohlen (HILPMANN, LANGE; HEYER 1998 / 99 b), 1 BP 1994, 2 BP<br />
1995, 3 BP 1996, 3 BP 1997, 1 BP 1998, 6 Reviere 1999 (ROST, FRIEDRICH & LANGE 1995, 1996, 1997,<br />
1998, 1999, 2000),<br />
1 BP 2000, 2 BP 2002, 1 BP 2003 (ROST 2001, 2003, 2004). LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbe-<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 117
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
stand mit jährlich 1 – 3 BP an. In den Jahren 2005 – 2008 wurde der Bestand erneut im Rahmen des ADE-<br />
BAR-Projektes eingeschätzt. Demnach siedeln gegenwärtig etwa 10 BP im Gesamtgebiet, wobei nicht sicher<br />
ist, ob die gründlichere Erfassung eine aktuelle Zunahme nur vortäuscht.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust von geeigneten Horstbäumen, besonders Kiefernaltbestände<br />
- Kollision mit Windenergieanlagen<br />
- Störungen im Horstbereich durch Forstarbeiten im Frühjahr und Freizeitnutzung<br />
- Verschlechterung der Nahrungshabitate durch Intensivierung der Landwirtschaft, gekoppelt mit einer Verringerung<br />
der Beutetiere (Großinsekten und Kleinvögel)<br />
- Rückgang der Schwalbenbestände als wichtigen Nahrungsanteil<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen, keine Forstarbeiten zwischen April und August und<br />
keine Freizeitnutzung in Horstbereichen<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Erhaltung von alten Kiefernbeständen<br />
- Anbringung von Kunstnestern<br />
- Schutz der Brutplätze von Rauch- und Mehlschwalben (wichtige Beutetiere)<br />
Verbreitungskarte 5: Baumfalke<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 1 1<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 118
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wanderfalke – Falko peregrinus Tunstall<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Wiederbesiedlung, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Wanderfalke Brutvogel im Göltzsch- und Elstertal (LIEBE<br />
1890). Der letzte bekannte Nachweis von brütenden Wanderfalken im 19. Jahrhundert stammt <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
Jahre 1872. Das BP bewohnte das Aumatal zwischen den Städten Weida und Auma (LIEBE 1878). Nach<br />
seinen Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 schreibt HELLER (1926): „Aeltere Greizer Vogelkenner versicherten<br />
mir, daß dieser stolze Falke früher am ,Hohen Stein‘ im Göltzschtal (ein sehr geeigneter Nistplatz)<br />
genistet habe.“<br />
20. Jahrhundert<br />
Im Zuge der neuerlichen Bestandszunahme in Thüringen gibt es auch erste Brutnachweise in unserem Gebiet:<br />
2005 bei Neumühle (Mitt. UNB Greiz) und 2006 sowie 2007 am Mischfutterwerk Niederpöllnitz (KANIS,<br />
LANGE, LIEDER, LUMPE; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008). Nach den Kriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE &<br />
SCHRÖDER (2005) besteht seit 2006 Brutverdacht für Gera-Nord (BECHER; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Mangel an geeigneten Brutplätzen<br />
- Kollision mit Windenergieanlagen und Freileitungen<br />
- Störungen im Horstbereich durch Freizeitnutzung<br />
- Verluste an den Brutplätzen durch den Uhu<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
- Bewachung von Bruten<br />
- Schaffung weiterer Nistmöglichkeiten an hohen Gebäuden und in geeigneten Steinbrüchen, z.B. Rohna<br />
und Hohenölsen / Steinsdorf<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 119
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wasserralle – Rallus aquaticus L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach LIEBE (1878) war die Wasserralle im Teichgebiet zwischen Frießnitz und Wittchenstein nicht selten.<br />
Ebenso fand er Brutvorkommen bei Schüptitz und im Elstertal nördlich von Gera. HELLER (1926) verweist<br />
nach seinen Aufzeichnungen von 1881 auf frühere Vorkommen am Binsenteich [Parkteich] in Greiz und bei<br />
Schönfeld.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HIRSCHFELD (1919) ist die Wasserralle als Brutvogel an den verschilften Teichen Ostthüringens nicht<br />
selten. Als gelegentlichen Brutvogel kennt sie HILDEBRANDT (1932) im Elstertal und bei Frießnitz.<br />
Ab 1950<br />
Für die 1950er-Jahre wird die Wasserralle als Brutvogel am Steinermühlenteich östlich von Leiningen angegeben<br />
(DANNHAUER 1963). GÜNTHER (1969) nennt Brutnachweise für die Teiche bei Röpsen (1961) und bei<br />
Kleinbocka (1967). HEYER (1967) fand die Wasserralle 1966 zur Brutzeit am Weiderteich bei Niederpöllnitz.<br />
Am Frießnitzer See bestand 1983 Brutverdacht (BAUM; LANGE 1988). BARNIKOW, SCHÜTZ und STÖSSEL<br />
(1971) vermuten die Art als Brutvogel in der Leschke bei Auma. BAUM (1987) erwähnt ein Brutvorkommen<br />
am Mäderteich bei Burkersdorf. 1989 balzten 1 – 2 Vögel in der Culmitzsch-Aue (LANGE; KRÜGER 1995 b).<br />
Nach 1990 waren folgende Gewässer besetzt: regelmäßig 2 – 3 BP Frießnitzer See, 1 – 2 BP Culmitzsch-<br />
Aue bei Zwirtzschen, je 1 BP Schilfwiese Struth, Floßteich Lederhose, Teich bei Leitlitz, Dorfteich<br />
Wolfersdorf und Teich bei Gottesgrün (LANGE & LIEDER 2001). Als Brutgewässer ab <strong>dem</strong> Jahr 2000 wurden<br />
die Teiche südöstlich von Tischendorf, der Speicher Söllmnitz, die Reichenbacher Teiche südlich Großaga<br />
(LIEDER 2004), der Weiderteich bei Niederpöllnitz, der Frießnitzer See, der Große Teich bei Kauern und der<br />
Teich im RNG Gessenhalde bei Ronneburg bekannt (HÖSELBARTH, LANGE, LIEDER, SCHUSTER). Maximal 4<br />
rufende Männchen wurden 2002 am Frießnitzer See festgestellt (LIEDER; ROST 2003). Am 23.08.2009 wurde<br />
eine Wasserralle mit 3 Jungen beobachtet, die im Schilf der Halbinsel des Weiderteiches bei Niederpöllnitz<br />
kletterten (SCHUSTER). Nach den Ermittlungen im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 siedeln gegenwärtig<br />
11 – 15 BP im Landkreis Greiz und der Stadt Gera. Der tatsächliche Bestand könnte auf Grund<br />
der heimlichen Lebensweise der Wasserralle noch größer sein.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen<br />
- Rückgang des Schilfs und anderer Wasserpflanzen durch Gewässerverschmutzung, Eutrophierung und<br />
überhöhten Fischbesatz<br />
- Verlust von Brutgewässern (Culmitzsch-Aue bei Zwirtzschen)<br />
- Verluste der Jungvögel durch Raubfische (Wels, Hecht)<br />
- Freizeitnutzung an Gewässern<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 120
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Beseitigung der Raubfischbesetzung an den Brutgewässern<br />
- Verhinderung der Freizeitnutzung an den Brutgewässern bzw. an Gewässern mit größeren Röhrichtzonen<br />
Verbreitungskarte 6: Wasserralle<br />
1<br />
1<br />
1<br />
4 – 7 2 – 3<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 121
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wachtelkönig – Crex crex (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Unregelmäßiger Brutvogel, Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach BREHM (1820 – 22) war der Wachtelkönig Brutvogel auf den Wiesen in Thüringen, der seinen Sommeraufenthalt<br />
bald dahin, bald dorthin verlegte. Um Gera war er ein häufiger Brutvogel (Ornithologische<br />
Sektion Gera 1859). Für das Jahr 1862 vermerkt MÜLLER (1862) für die Umgebung von Gera: „... wenigstens<br />
wurden nur auffallend wenige Exemplare bemerkt und ihr Gekrächze heuer als etwas Seltenes gehört, während<br />
in den schönen Abenden anderer früherer Sommer es nicht selten für Spaziergänger lästig war, fast auf<br />
je<strong>dem</strong> Felde oder Raine dicht an der Stadt schon einem solchen Krächzer sein Weibchen locken zu hören.“<br />
LIEBE (1873) stellt fest, dass die Art nicht mehr so zahlreich wie früher ist, wo er besonders im Elstertal häufig<br />
vorkam. Nach seinen Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 schreibt HELLER (1926): „Wiesenralle (Wachtelkönig,<br />
Wiesenschnärz). Sehr unregelmäßiger, nicht alljährlich hier brütender Vogel. In manchen Jahren<br />
fast häufig, in anderen fast gar nicht zu hören. Brütend festgestellt: bei Rothenthal, Dölau, Caselwitz, Elsterberg,<br />
Kleingera, Moschwitz, Naitschau, Kurtschau, Gommla.“ KOEPERT (1896) kannte bei Ronneburg ein<br />
Vorkommen.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist die Art nur noch selten einmal in Ostthüringen zu hören. HIRSCHFELD (1932)<br />
bezeichnet den Wachtelkönig als unregelmäßigen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben. Am<br />
31.05.1930 hörte HIRSCHFELD (1931) gleichzeitig zwei rufende Vögel bei Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schreibt, dass der Wachtelkönig seit den letzten 20 Jahren wohl ganz als Brutvogel verschwunden<br />
ist und nur <strong>aus</strong>nahmsweise einmal gehört wird. Er nennt folgende Beobachtungen: 1960 bei<br />
Hohenölsen, 1965 und 1969 bei Nauendorf im nordöstlichen Landkreis Greiz und 1968 bei Großenstein.<br />
LANGE & LEO (1978) beziffern den Bestand im Altkreis Greiz auf 5 – 10 BP. FLÖßNER (1977 a) nennt als gegenwärtige<br />
Verbreitungsschwerpunkte in Ostthüringen unter anderem den Raum Ronneburg – Gera und die<br />
Umgebung von Greiz. KRÖBER konnte 1983 einen Brutnachweis bei Großenstein erbringen (LANGE 1988).<br />
BAUM äußert Brutverdacht am Frießnitzer See für die Jahre 1986 bis 1989. In den <strong>ornithologische</strong>n Jahres<strong>berichte</strong>n<br />
für Thüringen sind folgende Rufnachweise festgehalten (KRÜGER 1992, 1993 / 94, HEYER 1996):<br />
1986 bei Kauern (SCHEFFEL) und bei Moschwitz (PIEHLER), 1987 bei Korbußen (REICHARDT) und bei<br />
Großenstein (KRÖBER), 1988 im RNG Großkundorf (LANGE), bei Baldenhain (KRÖBER) und bei Korbußen<br />
(REICHARDT), 1994 bei Kahmer und bei Bad Köstritz (FG Greiz). LANGE & LIEDER (2001) bezeichnen den<br />
Wachtelkönig als nicht alljährlichen Brutvogel mit maximal 8 rufenden Männchen im Jahre 1998. Im Rahmen<br />
des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden in drei Gebieten (Gera, Triebes und Greiz) rufende Vögel registriert.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 122
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, frühe Mahdtermine,<br />
Pestizideinsatz, Überdüngung, Entwässerung und Verlust von Grünland-Feuchtgebieten<br />
- Kollision mit Freileitungen und Windenergieanlagen<br />
- Verluste durch Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Störungen durch Landarbeiten und Freizeitnutzung<br />
- Nahrungsmangel als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Mehrung von Brachflächen und feuchtem Grünland<br />
- Erhaltung von Ausweichflächen bei der Wiesenmahd<br />
- Späte Mahdtermine und Änderung der Mahdtechnik (Balkenmäher, Mahd von innen nach außen)<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Bekämpfung von Waschbär und Fuchs an bekannten Brutplätzen<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 123
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Tüpfelsumpfhuhn – Porzana porzana (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Vermutlich regelmäßiger Brutvogel, Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach BREHM (1820 – 22) brütet das Tüpfelsumpfhuhn ganz einzeln am Frießnitzer See. 1859 wird die Art als<br />
häufig bezeichnet und Brutvorkommen bei Gera-Tinz, Reichenbach und Aga genannt (Ornithologische Sektion<br />
Gera 1859). LIEBE (1873) fand Brutvorkommen bei Raitzhain, in den kleinen Teichen oberhalb von<br />
Frießnitz und an den Ausschachtungen der Eisenbahn im Elstertal nördlich von Gera. Später fügt er noch<br />
Zeulenroda als bekannten Brutplatz hinzu (LIEBE 1878). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt<br />
HELLER (1926): „... getüpfeltes Sumpfhuhn. Oefter hier [Greiz und Umgebung] beobachtet und erlegt.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist das Tüpfelsumpfhuhn ein nicht seltener Brutvogel an den Teichen Ostthüringens.<br />
HIRSCHFELD (1932) erhielt öfters tote Exemplare <strong>aus</strong> der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Weder GÜNTHER (1969) noch LANGE & LEO (1978) kennen neuere Brutvorkommen. Erst LANGE & LIEDER<br />
(2001) verweisen auf Brutzeitbeobachtungen 1981 und 1988 in der Culmitzsch-Aue bei Zwirtzschen und in<br />
den 1990er-Jahren am Frießnitzer See. Rufende Vögel wurden zur Brutzeit 2002 wiederum am Frießnitzer<br />
See (MÜLLER), an den Teichen nördlich von Muntscha (LANGE) sowie 2003 und 2008 an den Hammerwiesenteichen<br />
im Greizer Park (MÜLLER; LUMPE 2008 c) gehört. Sicherlich werden einige Vorkommen übersehen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen und Trockenlegung angrenzender Wiesenflächen<br />
- Rückgang des Schilfs und anderer Wasserpflanzen durch Gewässerverschmutzung, Eutrophierung und<br />
überhöhten Fischbesatz<br />
- Verlust von Brutgewässern (Culmitzsch-Aue bei Zwirtzschen)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Vernässung gewässernaher Wiesenflächen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 124
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Kleines Sumpfhuhn – Porzana parva (Scopoli)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Unklare Bestandssituation<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Sowohl die deutsche als auch die wissenschaftliche Namensgebung im 19. Jahrhundert für das Kleine<br />
Sumpfhuhn führte wie bei anderen Arten auch, z.B. Schwarzhalstaucher (LIEDER, Ms.), in späteren Jahren<br />
zu Fehlinterpretationen. LIEBE (1878) führt <strong>aus</strong>: „Gallinula minuta Pall. Vielleicht noch seltener als die<br />
porzana ist das kleine Wasserhuhn [Kleines Sumpfhuhn, Porzana parva], aber es fehlt in keinem Jahr und<br />
bleibt bei gleichem Bestand. Es brütet (nach Dr. R. MÜLLER) am Frießnitzer See alljährlich, ... bei Kauern<br />
unweit Ronneburg, bei Weida ...“ Auch NAUMANN (1897 – 1905) bezieht das Brutvorkommen am Frießnitzer<br />
See auf das Kleine Sumpfhuhn. Spätere Autoren haben die Angaben von LIEBE irrtümlicherweise auf das<br />
Zwergsumpfhuhn bezogen (u.a. HILDEBRANDT 1919, V. KNORRE 1977). HEYER (1993 / 94) konnte jedoch eindeutig<br />
belegen, dass mit den Angaben „Gallinula minuta Pall.“ das Kleine Sumpfhuhn gemeint ist. In diesem<br />
Sinne sind auch weitere Angaben von LIEBE (1873) zu werten, in denen er Vorkommen 1871 bei Schüptitz<br />
(wohl identisch mit <strong>dem</strong> Brutort Weida in der Veröffentlichung 1878) sowie 1872 bei Kauern und am<br />
Frießnitzer See erwähnt. Sicherlich beziehen sich die Angaben der Ornithologischen Sektion Gera (1859)<br />
nach denen „Rallus pusillus, kleines Sumpfhuhn“ selten bei Leumnitz brütet, ebenfalls auf Porzana parva.<br />
HELLER (1926) schreibt nach seinen Aufzeichnungen von 1881: „(Gallinula pygmaea, Zwergsumpfhuhn.<br />
Nach Prof. Ludwig und Lehrer Weidhaas ist dieser niedliche Vogel zur Brutzeit am Wahlteich bei<br />
Hohenleuben, am Hirsch- und Krümmeteich beobachtet worden, doch konnte nicht genau festgestellt werden,<br />
ob es sich um G. pygmaea oder minuta handelt.)“.<br />
20. Jahrhundert<br />
Seit 1989 liegen mehrere Beobachtungen <strong>aus</strong> den Gebieten Großkundorf, Speicher Falka, Frießnitzer See<br />
und Schilfgebiet Struht vor, welche aber erst bei Anerkennung durch eine Seltenheitenkommission als gesichert<br />
gelten können und deshalb vorab nicht verwendet werden sollten. Wahrscheinlich ist die heimliche Art<br />
auch heute noch bei uns gelegentlicher Brutvogel.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen und Trockenlegung angrenzender Wiesenflächen<br />
- Rückgang des Schilfs und anderer Wasserpflanzen durch Gewässerverschmutzung, Eutrophierung und<br />
überhöhten Fischbesatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages<br />
- Schutz der Röhrichtzonen<br />
- Vernässung gewässernaher Wiesenflächen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 125
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Teichhuhn – Gallinula chloropus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, zurzeit Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Schon BREHM (1820 – 22) schreibt, dass das Teichhuhn auf fast allen Gewässern, die Schilf haben, vorkommt.<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Art als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera, u.a. bei Leumnitz und Aga. LIEBE (1873) zählt ebenfalls mehrere Brutplätze auf: zwischen<br />
Frießnitz und Niederpöllnitz, bei Aga und Reichenbach, bei Schüptitz, Kauern und an Ausschachtungen der<br />
Bahn nördlich von Gera. Später schreibt er von einer außerordentlichen Zunahme (LIEBE 1878). HELLER<br />
(1926) nennt nach seinen Aufzeichnungen von 1881 nur einzelne Brutorte um Greiz: „Binsenteich [Parkteich]<br />
und Hirschteich in Greiz, bei der Schlötenmühle und bei Mohlsdorf.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist das Teichhuhn auf allen Teichen und Flüssen, deren verschilfte Ufer nur einige<br />
Deckung bieten, häufig. Von HIRSCHFELD (1932) wird die Teichralle als stellenweise häufiger Brutvogel um<br />
Hohenleuben bezeichnet.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) rechnet mit einem Gesamtbestand von 100 – 200 BP im Altkreis Gera. Vor 1965 war die Art<br />
selten, erholte sich aber bis 1967. Die Abnahme war sicherlich auf den Extremwinter 1962 / 63 zurückzuführen.<br />
Eine überregionale Bestandserfassung 1972 / 73 brachte folgendes Ergebnis (SCHEFFEL & GÜNTHER<br />
1975): 3 BP um Dorna, 5 BP um Ronneburg,1 BP um Kaimberg, 15 – 30 BP um Münchenbernsdorf, 7 BP<br />
um Auma, 4 BP um Frießnitz – Burkersdorf, 10 BP (geschätzt) im Altkreis Greiz und BP an allen größeren<br />
und mit Schilf besetzten Teichen im Altkreis Zeulenroda. LANGE & LEO (1978) verzeichnen eine geringe Zunahme<br />
und geben für den Altkreis Greiz ca. 25 BP an. In den 1970er-Jahren setzte erneut ein Rückgang ein.<br />
LIEDER (1986) ermittelte 1982 / 83 folgenden Bestand: Altkreis Gera 13 – 19 BP, Altkreis Greiz 8 – 9 BP und<br />
Altkreis Zeulenroda 1 BP. Eine weitere Erfassung fand 1987 statt (LIEDER 1989): Altkreis Gera 2 BP, Altkreisen<br />
Greiz und Zeulenroda 0 BP. 1994 erfolgte eine Erfassung des Brutbestandes in Thüringen. Demnach<br />
brüteten im Altkreis Gera keine Teichhühner mehr, im Altkreis Greiz wurden 7 BP und im Altkreis Zeulenroda<br />
nur noch 2 BP gezählt (ROST 1995). Danach erfolgte wieder eine Zunahme und 1999 / 2000 konnten ca. 20<br />
BP festgestellt werden (LANGE & LIEDER 2001). Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde eine<br />
Zunahme auf 52 – 76 BP registriert.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 126
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Beseitigung der Röhrichtzonen und der Ufergehölze<br />
- Rückgang des Schilfs und anderer Wasserpflanzen durch Gewässerverschmutzung, Eutrophierung und<br />
überhöhten Fischbesatz<br />
- Störung an Brutplätzen durch Freizeitnutzung und Verlust von Brutgewässern<br />
- Zunahme der Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Konkurrenz durch das Blässhuhn an kleinen Gewässern mit wenig Deckungsmöglichkeiten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verminderung des Nährstoffeintrages<br />
- Schutz der Röhrichtzonen und der Ufergehölze<br />
- Vermeidung von Störungen an Brutgewässern und Bekämpfung von Fuchs und Waschbär<br />
Verbreitungskarte 7: Teichhuhn<br />
2 – 3 2 – 3<br />
1<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 1 2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7 2 – 3<br />
4 – 7 2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 127
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Kiebitz – Vanellus vanellus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, starke Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) schreibt: „An den Teichen und auf den Wiesen Thüringens … sah ich ihn überall, wo er<br />
wohnen konnte“. Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war zu dieser Zeit die Art ein häufiger<br />
Brutvogel um Gera. LIEBE (1873) bemerkt einen Rückgang und führt zwei schwache Kolonien zwischen<br />
Kauern und Gera-Kaimberg und zwischen Korbußen und Gera-Leumnitz sowie eine stärkere Kolonie bei<br />
Niederpöllnitz, Geroda und Porstendorf auf. SEYDEL (1883) fand eine Brutkolonie zwischen Niederpöllnitz<br />
und Frießnitz. Einzelne Vorkommen gab es nach LIEBE (1873) unter anderem auch bei Vogelgesang, wo der<br />
Kiebitz vor<strong>dem</strong> häufig gewesen sein soll. Erloschen war nach LIEBE das Brutvorkommen auf den Wiesen bei<br />
Gera-Pforten. HELLER (1926) bezeichnet den Kiebitz nach seinen Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 als<br />
seltenen Brutvogel bei „Moschwitz, Tremnitz, Naitschau, Mohlsdorf, Brunn (immer nur in kleinen Kolonien).“<br />
KOEPERT (1896) nennt als Brutplatz Kauern bei Ronneburg.<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) stellte eine starke Neigung zur Ausbreitung in Ostthüringen fest. Er fand ihn unter anderem<br />
brütend bei Großenstein. HIRSCHFELD (1932) kennt ihn als vereinzelten Brutvogel in der Umgebung von<br />
Hohenleuben. Als Orte werden genannt: Ölsengrund [Wiesengrund südwestlich von Hohenölsen],<br />
Wittchendorf, Hainsberg, Zeulenroda und Naitschau.<br />
Ab 1950<br />
BAUCH (1952) konnte 1951 noch 7 BP bei Hohenölsen und 2 BP bei Wittchendorf feststellen. 1952 waren<br />
diese Brutplätze nicht mehr besetzt. Als ein ständiger Brutplatz seit 1953 wird mit 1 – 5 BP hingegen Kahmer<br />
(TK 5339/2) mit angeführt (CZERLINSKY 1966). Um 1960 erfolgte dann auch die Wiederbesiedlung an früher<br />
bekannten Brutplätzen. So brüteten 1961 drei Paare bei Pahren (Anonym 1962). Im Jahr 1966 fand HEYER<br />
(1967 a) 2 – 4 BP am Frießnitzer See und 8 – 10 BP am Weiderteich. 1967 und 1968 wurden bei<br />
Großenstein etwa 10 Paare festgestellt (GÜNTHER 1969). LANGE & LEO (1978) vermelden eine Bestandszunahme<br />
ab Mitte der 1960er-Jahre bis etwa 1978 auf 50 BP im Altkreis Greiz. Eine Erfassung von 1978 bis<br />
1981 erbrachte folgende Zahlen: 38 BP im Altkreis Greiz, 20 – 23 BP im Altkreis Zeulenroda und 67 – 77 BP<br />
im Altkreis Gera, insgesamt also 125 – 138 BP im gesamten Untersuchungsgebiet (LIEDER 1983 c). Danach<br />
verlief die Bestandentwicklung stark negativ. Im Jahre 2000 waren es noch maximal 10 BP (LANGE & LIEDER<br />
2001). In den Jahren 2005 – 2008 wurde der Bestand im Rahmen des ADEBAR-Projektes auf 18 – 35 BP<br />
geschätzt. Der reale Bestand liegt sicherlich eher an der unteren Grenze oder sogar darunter, da nicht alle<br />
Brutgebiete jährlich besetzt sind.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 128
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, frühe Mahdtermine,<br />
Pestizideinsatz, Überdüngung, Entwässerung und Verlust von Grünland-Feuchtgebieten, Umstellung auf<br />
Wintergetreide<br />
- Verluste durch Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Störungen durch Landarbeiten und Freizeitnutzung<br />
- Nahrungsmangel als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft (Insekten und Ackerwildkräuter)<br />
- Verlust von Brutplätzen durch Bebauung (z.B. Gera-Stublach) oder Sanierung von Bergbauflächen (RNG<br />
Culmitzsch)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Mehrung von Brachflächen und feuchtem Grünland<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Späte Mahdtermine<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Bekämpfung von Waschbär und Fuchs an bekannten Brutplätzen<br />
- Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen (z.B. durch Wismut-Sanierung)<br />
Verbreitungskarte 8: Kiebitz<br />
1<br />
8 – 20 4 – 7 2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 129
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Flussregenpfeifer – Charadrius dubius (Scopoli)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Der ersten Hinweis auf das Vorkommen ist bei BREHM (1833) zu finden: „Nur auf den Kiesstrecken der Saale<br />
und Elster brütet der Flußregenpfeifer.“ LIEBE (1873) schreibt: „Der kleine Uferpfeifer belebt in kleinen Gesellschaften<br />
die sämmtlichen größeren, kahlen Kiesablagerungen an der Elster, ist aber nicht mehr ganz so<br />
häufig wie früher.“ LIEBE (1878) führt <strong>aus</strong>: „Die einzelnen Colonien werden aber von Jahr zu Jahr kleiner, und<br />
auf vielen Kiesfeldern, wo er früher in grösserer Anzahl wohnte, ist er verschwunden.“ Nach HELLER (1926)<br />
war der Flussregenpfeifer bei Greiz schon um 1881 nicht mehr anzutreffen: „Nach Verseuchung der Elster<br />
und Göltzsch scheint er als Brutvogel <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Gebiet verschwunden zu sein. Früher brütend auf den Kiesbänken<br />
der Elster am Schützenh<strong>aus</strong>e, an der Göltzschmündung, bei Rothenthal, Elsterberg, Dölau,<br />
Neumühle, Berga.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) schreibt allgemein, dass er ein nicht seltener Brutvogel auf den Kiesbänken der Flüsse<br />
und in abgelassenen Fischteichen in Ostthüringen sei, ohne konkrete Orte zu nennen.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) führt sporadische Brutvorkommen für 1962 an der Elster bei Wünschendorf, für 1966 und<br />
1967 in einer Kiesgrube bei Cretzschwitz, für 1968 im Raitzhainer Teich und für 1969 in einem Teich bei<br />
Kauern an. In den 1960er-Jahren wurden die Bergbauflächen der Wismut besiedelt. So brüten seit 1966 z.B.<br />
2 – 6 BP im RNG Großkundorf (LANGE & LEO 1978). Ein weiteres BP wurde 1976 am St<strong>aus</strong>ee Greiz-<br />
Aubachtal gefunden (LANGE & LEO 1978). Aus einer Erfassung in den Jahren 1979 – 1981 und unter Einbeziehung<br />
der Kenntnisse <strong>aus</strong> früheren Zeiträumen gehen folgende Nachweise für das Untersuchungsgebiet<br />
hervor (LANGE 1983): Für den Altkreis Gera werden, außer den von GÜNTHER (1969) bereits erwähnten Brutvorkommen,<br />
1 BP 1973 bei Paitzdorf, 1 BP 1973 bei Söllmnitz sowie 1 BP 1978 bei Hain [TK 5038 / 4] genannt.<br />
Für den Altkreis Greiz wurden 4 – 5 BP im RNG Großkundorf, 1 BP im RNG Culmitzsch, 1 BP am<br />
Schuttteich Greiz-Aubachtal und 3 BP im Schieferbruch bei Tschirma ermittelt. Für den Altkreis Zeulenroda<br />
konnten 2 BP in einem Teich bei Auma registriert werden. Für das Jahr 2000 geben LANGE & LIEDER (2001)<br />
den Bestand mit 15 – 20 BP an. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden 35 – 56 BP für<br />
den Landkreis Greiz und die Stadt Gera geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Vernichtung von Brutplätzen durch Sanierungsarbeiten des Bergb<strong>aus</strong> (Aga, Wismutgebiet)<br />
- Vernichtung von Brutplätzen durch Bebauung (Straßenbau, Gewerbegebiete)<br />
- Verluste durch Prädatoren (Waschbär, Fuchs)<br />
- Störungen durch Freizeitnutzung<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 130
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Mehrung von vegetationsarmen Offenlandflächen mit Feuchtstellen<br />
- Renaturierung von Flussabschnitten der Weißen Elster<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Bekämpfung von Waschbär und Fuchs an bekannten Brutplätzen<br />
- Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen im Zusammenhang mit der Sanierungstätigkeit im Bergbau<br />
Verbreitungskarte 9: Flussregenpfeifer<br />
1<br />
1 1 1<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
1 2 – 3 1<br />
1<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 3<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 131
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Bekassine – Gallinago gallinago (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, starke Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1833): fand sie brütend „an unsern Teichufern, an diesen brütet auch die Teichheerschnepfe [Bekassine],<br />
z. B. am frießnitzer See.“ Für die Umgebung von Gera wird die Bekassine von der Ornithologischen<br />
Sektion Gera (1859) als seltener Brutvogel angeführt, ohne das konkrete Brutplätze benannt werden. LIEBE<br />
(1873) fand die Bekassine zwischen Frießnitz und Geroda alljährlich in mehreren Paaren sowie unterhalb<br />
und oberhalb von Waltersdorf [TK 5137 / 2]. Später führt LIEBE (1878) <strong>aus</strong>: „... im übrigen Gebiet nur selten<br />
einmal ein Paar – am seltensten im Nordosten (z.B. 1872 bei Waltersdorf unweit Gera und 1873 bei Kauern<br />
unweit Ronneburg).“ Später wird Waltersdorf auch nach Beobachtungen von HELLER als Brutplatz genannt<br />
(KOEPERT 1896). HELLER (1926) führt nach seinen Aufzeichnungen von 1881 die Bekassine als Brutvogel „an<br />
den Krümmeteichen und bei der Schlötenmühle“ an. Um 1896 gab es auch ein Brutvorkommen am<br />
Weiderteich (HELLER 1897).<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) betont <strong>aus</strong>drücklich das Nichtbrüten in Ostthüringer Teichgebieten. Nach HIRSCHFELD<br />
(1932) gab es jedoch das Vorkommen der Bekassine am Frießnitzer See auch weiterhin.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) bezieht sich auf Beobachtungen von WOLF und erwähnt das Vorkommen am Frießnitzer<br />
See ebenfalls. HEYER (1967 b) sah am 21.05.1967 drei Vögel am Weiderteich. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL<br />
(1971) fanden 1970 in der Umgebung von Auma (Wolche, Wöhlsdorfer Grund und besonders Leschke, damals<br />
sumpfiges Quellgebiet mit 14 Teichen, später melioriert) balzende Bekassinen und vermuteten 3 – 4<br />
BP. GRÜN, HEYER & Mitarbeiter (1973) nennen als Brutplätze Frießnitz, Zickra bei Berga (1954) und Auma<br />
(1971), hier mit einem Gelege. In den Jahren 1979 / 81 erfolgte im ehemaligen Bezirk Gera eine Bestandserfassung<br />
(GÜNTHER 1981 a). Danach gab es bis 1975 Hinweise auf ein Brutvorkommen am Frießnitzer See<br />
(LIEDER), welches aber später erloschen ist (BAUM). Weiterhin führt GÜNTHER (1981) <strong>aus</strong>, dass ein Brutvorkommen<br />
mit 1 – 2 BP bis 1965 am St<strong>aus</strong>ee Greiz-Aubachtal, sowie Brutverdacht für die Jahre 1972, 1973<br />
und 1978 bei Großkundorf, 1978 bei Wellsdorf, um 1972 auf den Hammerwiesen bei Greiz und eventuell<br />
1976 bei Korbußen bestand. Für die Umgebung von Auma werden Ende der 1970er-Jahre 2 – 3 BP angegeben.<br />
Bei Krölpa wurde 1983 ein Brutnachweis erbracht (FG Auma; LANGE 1983). Von LANGE & LIEDER<br />
(2001) werden 1 – 3 BP am Frießnitzer See, für 1999 ein balzender Vogel auf <strong>dem</strong> ehemaligen Truppenübungsplatz<br />
„Muna“ bei Rüdersdorf sowie 1 – 2 unregelmäßig vorkommende BP in der Culmitzsch-Aue bei<br />
Zwirtzschen genannt. Balzflüge zur Brutzeit von 1 Vogel wurden 2006 (BECHER) und 2007 (LIEDER) sowie<br />
von 2 Vögeln 2002 (LIEDER) und 2009 (BECHER) im NSG Frießnitzer See / Struth beobachtet. Im Rahmen<br />
der Bestandserfassung zum ADEBAR-Projekt 2005 – 2008 wurden nur noch 2 – 3 BP zwischen Frießnitz<br />
und Struht (BECHER, LIEDER) festgestellt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 132
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Trockenlegung nasser Wiesenflächen<br />
- Nutzungsaufgabe feuchter Wiesenflächen<br />
- Absenkung des Grundwasserspiegels im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung<br />
- Verlust von Brutgewässern (Culmitzsch-Aue bei Zwirtzschen)<br />
- Kollision mit Freileitungen<br />
- Störung durch Freizeitnutzung<br />
- Erhöhter Prädatorendruck durch Fuchs und Waschbär<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Vernässung von Wiesenflächen<br />
- Beweidung von Feuchtwiesen, z.B. durch Wasserbüffel<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen (z.B. am Frießnitzer See)<br />
- Keine Freizeitnutzung an Brutplätzen<br />
- Bekämpfung der Prädatoren Fuchs und Waschbär<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 133
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Flussuferläufer – Actitis hypoleucos (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Erstmals <strong>berichte</strong>te BREHM (1820 – 22) über ein Brutvorkommen des Flussuferläufers: „Der trillernde<br />
Strandläufer [Flussuferläufer], Tringa hippoleucus, nistete im Jahr 1816 am frießnitzer See, früher oder<br />
später traf ich ihn dort nur auf <strong>dem</strong> Frühlings- und Herbstzuge an.“ Später schreibt BREHM (1831): „Da die<br />
Strandpfeifer [Flussuferläufer], Actitis Boje (Tringa cinclus auct.) das ganze Frühjahr am frießnitzer See<br />
verweilen: vermuthe ich, daß sie auch an seinen Ufern nisten mögen, ob es uns gleich bis jetzt noch nicht<br />
gelang, ein Nest derselben aufzufinden.“ Ob die Angabe der Ornithologischen Sektion Gera (1859) zutreffen,<br />
dass der Flussuferläufer ein häufiger Brutvogel um Gera war, muss bezweifelt werden. LIEBE (1873) kann ihn<br />
nur als seltenen Brutvogel angeben: „Der Strandpfeifer brütet – ob regelmäßig alle Jahre vermag ich nicht<br />
anzugeben – auf <strong>dem</strong> Strich zwischen Thieschitz und der Elster, und zwar in höchstens zwei Paaren.“ Die<br />
Anzahl hatte sich auch in späteren Mitteilungen nicht geändert. So <strong>berichte</strong>t LIEBE (1878) von 1 – 2 BP, die<br />
unregelmäßig an alten abgeschnittenen Flussläufen und größeren Lachen an der Elster und Saale brüten.<br />
(HELLER 1926) schreibt: „Dieser bei uns sehr seltene Vogel brütete 1870 bei Elsterberg am Elsterufer in der<br />
Nähe des ,Felsen‘ unweit des ehemaligen v. Schlieben’schen Gutes.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) nennt ihn einen nicht seltenen Brutvogel an den Flüssen und Teichen Ostthüringens.<br />
Später stand er diesen Angaben kritisch gegenüber (HILDEBRANDT & SEMMLER 1978).<br />
Ab 1950<br />
Brutverdacht bestand nur in den Jahren 1965, 1966 und 1974 im RNG Großkundorf (LA N G E & LEO 1978).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Vernichtung von Brutplätzen durch Sanierungsarbeiten des Bergb<strong>aus</strong> (RNG Großkundorf)<br />
- Vernichtung von Brutplätzen durch Gewässer<strong>aus</strong>bau an der Weißen Elster<br />
- Störungen durch Freizeitnutzung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Ausgleich für den Verlust von Brutplätzen durch die Sanierungstätigkeit im Wismut-Bergbau<br />
- Renaturierung von Flussabschnitten und Altwässern an der Weißen Elster (z.B. bei Bad Köstritz)<br />
- Einschränkung der Freizeitnutzung an naturnahen Flussabschnitten der Weißen Elster<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 134
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Waldwasserläufer – Tringa ochropus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Streng geschützt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen des Waldwasserläufers<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
1975 gelang ein Brutnachweis am Krähenteich auf <strong>dem</strong> Sandberg bei Niederpöllnitz (BAUM). Von GÜNTHER<br />
(1981 b) wird Brutverdacht für das Jahr 1977 im RNG Großkundorf geäußert. Im RNG Großkundorf, im RNG<br />
Culmitzsch und in der dazwischenliegenden Culmitzsch-Aue bei Zwirtzschen war der Waldwasserläufer in<br />
13 Jahren zur Brutzeit anwesend (LANGE & LIEDER 2001). Ebenso bestand Brutverdacht im NSG Frießnitzer<br />
See / Struth (LANGE & LIEDER 2001).<br />
21. Jahrhundert<br />
Ein Brutnachweis gelang im Jahre 2003 an den Teichen bei Wöhlsdorf (LANGE; ROST 2004). Weitere Brutverdachte<br />
bestanden an folgenden Orten: Teiche bei Neugernsdorf im Jahre 2002 (LANGE) und Teiche bei<br />
Tischendorf im Jahre 2007 (BÖTTCHER; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Entwässerung von Bruchwäldern und waldnahen Feuchtgebieten<br />
- Gewässer<strong>aus</strong>bau an naturnahen Fließgewässern mit Überschwemmungsbereichen<br />
- Störungen im Nestbereich durch Forstbetrieb und Freizeitnutzung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz naturnaher fließender und stehender Gewässer am Rande störungsarmer Wälder<br />
- Vernässung ehemaliger waldnaher Feuchtgebiete<br />
- Renaturierung von Altwässern der Weißen Elster<br />
- Renaturierung von Fließgewässern in Waldgebieten<br />
- Schaffung von Schlickflächen in Stillgewässern an Waldrändern<br />
- Vermeidung von Störungen durch Forstwirtschaft und Freizeitnutzung an bekannten Brutplätzen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 135
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schleiereule – Tyto alba (Scopoli)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr. 11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, gleichbleibend<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Schleiereule als seltenen Brutvogel um Gera. Als<br />
Brutplätze werden der Turm des Waisenh<strong>aus</strong>es und Schloss Osterstein in Gera genannt. Weiterhin wird Bad<br />
Köstritz als Brutplatz angeführt. Später kann LIEBE (1873) feststellen, dass die Schleiereule im ganzen Gebiet<br />
in den letzten zehn Jahren häufiger geworden ist. Zum Vorkommen schreibt LIEBE: „In <strong>dem</strong> weiten Thal<br />
von Scheubengrobsdorf bis St. Gangloff, in <strong>dem</strong> Sprottathal von Paitzdorf an abwärts bis über Schmölle, im<br />
obern Brahmethale und im obern Wipsethale wohnen sie, wie es scheint, vorzugsweise gern. Alte Weiden,<br />
Kirchthürme und alte Dachböden wählt sie zu ihren Brutstätten.“ LIEBE (1878) <strong>berichte</strong>t über die weitere<br />
langsame Zunahme der Art. Nach seinen Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 schreibt HELLER (1926) zur<br />
Schleiereule: „Nicht selten auf Kirchtürmen, in Scheunen, auf Böden in Greiz und Umgebung brütend.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) ist die Schleiereule Brutvogel in der Umgebung von Greiz und Gera sowie auf <strong>dem</strong><br />
Kirchturm von Tschirma. 30 Jahre früher war die Schleiereule Brutvogel auf <strong>dem</strong> Schloss Reichenfels [heute<br />
Burgruine Reichenfels bei Hohenleuben], bis dieses 1903 abgebrochen wurde.<br />
Ab 1950<br />
WICHLER (1952) kennt einen Brutplatz „seit Jahren“ auf <strong>dem</strong> Rath<strong>aus</strong>turm von Gera. Nach GÜNTHER (1969)<br />
ist die Schleiereule nicht gerade häufiger Brutvogel in der Umgebung von Gera. Nach<strong>dem</strong> die Art vor einigen<br />
Jahren fast ganz verschwunden war (Jahrhundertwinter 1962 / 63!), brütet sie wieder 1967 / 68 in Gera,<br />
Gera-Langenberg, Ronneburg, Großenstein, Niederpöllnitz und Dorna. LANGE & LEO (1978) führen als Brutplätze<br />
die Kirchtürme Caselwitz, Gottesgrün, Hohndorf, Teichwolframsdorf, Sorge-Settendorf, Waltersdorf<br />
und Tschirma sowie eine Scheune in Greiz-Reinsdorf an, wo die Schleiereule regelmäßig brütet. Bei einer<br />
Kontrolle 1968 in der Umgebung von Auma und Zeulenroda war die Schleiereule von den Kirchtürmen verschwunden<br />
und nur in Piesigitz bestand Brutverdacht. 1969 wurde dann auf <strong>dem</strong> Kirchturm in Auma eine<br />
Brut gefunden (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971). Flächendeckend wurde der Brutbestand 1971 bis 1973<br />
im damaligen Bezirk Gera in 118 Ortschaften erfasst (RITTER & V. KNORRE 1975). Dar<strong>aus</strong> ergibt sich folgendes<br />
Bild: Altkreis Gera in 75 Ortschaften 18 BP, Altkreis Greiz in 16 Ortschaften 7 BP, Altkreis Zeulenroda in<br />
27 Ortschaften 10 – 13 BP, in Summe 35 – 38 BP. GÖRNER (1978) vermutet ein BP in einer Kalksteinwand<br />
bei Kraftsdorf 1974 oder in den Jahren davor. Im Jahre 2001 wird der Bestand auf 20 – 30 BP geschätzt<br />
(LANGE & LIEDER 2001). Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden 33 – 49 BP angegeben.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 136
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Vernichtung von Brutplätzen durch Abbruch, Restauration und Modernisierung von Kirchen, Gehöften,<br />
Scheunen und Dachnischen<br />
- Vergitterung der Zugänge zu vielen Gebäuden<br />
- Rückgang der Kleinsäugerbestände und Beeinträchtigung ihrer Jagdgebiete durch Modernisierung der<br />
Landwirtschaft<br />
- Flurbereinigung, Grünlandumbruch, Beseitigung von wichtigen Strukturen in der Landschaft<br />
- Gifteintrag in der Landwirtschaft und damit Vergiftung der Nahrungstiere (Kleinsäuger)<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
- Überbauung und Aufforstung von Nahrungsrevieren<br />
- Störungen am Brutplatz<br />
- Prädation durch Marder und Katzen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Förderung der Ansiedlung durch Anbringung von Nisthilfen oder Erhaltung bzw. Öffnung von Einflugmöglichkeiten<br />
an Kirchen und an anderen geeigneten Gebäuden<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Wiederherstellung einer reich strukturierten Kulturlandschaft<br />
- Absicherung gefährlicher Straßenabschnitte<br />
- Ermöglichung des Zugangs zu Scheunen, vor allem im Winter<br />
- Erhaltung ursprünglicher strukturreicher Dorfrandbereiche trotz Ausdehnung von Baugebieten<br />
Verbreitungskarte 10: Schleiereule<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 1<br />
4 – 7<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 137
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Raufußkauz – Aegolius funereus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, vermutlich gleichbleiben<strong>dem</strong> Bestand<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) fand den Raufußkauz als Brutvogel bei Renthendorf. Demzufolge kann angenommen<br />
werden, dass der Raufußkauz auch im angrenzenden Landkreis Greiz zur damaligen Zeit heimisch war.<br />
1900 bis 1950<br />
Ende November 1907 wurde ein Raufußkauz bei Reichenbach / St. Gangloff an der westlichen Gebietsgrenze<br />
gefunden (FEUSTEL 1908). Er befindet sich als Präparat im Naturkun<strong>dem</strong>useum Gera.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) wurde im März 1964 ein rufender Raufußkauz auf <strong>dem</strong> Buchenberg bei Weida gehört<br />
(BAUCH, SEHMISCH). Auch LANGE & LEO (1978) können noch keine sichere Brut nachweisen und führen nur<br />
einen rufenden Vogel vom 04.02.1965 im Forstrevier Waldh<strong>aus</strong> an (SCHÜTZ). Von maximal drei besetzten<br />
Brutrevieren seit 1964 bei Zeulenroda <strong>berichte</strong>n RITTER & GÜNTHER (1974). GRÜN (1972) meldet einen Brutnachweis<br />
von KLEHM zwischen Zeulenroda und P<strong>aus</strong>a von 1971. In den folgenden Jahren wurden weitere<br />
Brutnachweise gemeldet (KRÜGER 1980, 1983 a, 1992, 1995 b, HEYER 2006): 2 BP 1978 bei Wüstenwetzdorf<br />
(BARNIKOW, SCHÜTZ), 1 BP 1980 bei Großebersdorf (BAUM), 1 BP 1986 im Forstrevier Waldh<strong>aus</strong> bei<br />
Greiz (KÖHLER, REIßMANN), 2 BP und 1 balzendes Männchen 1989 im Forstrevier Waldh<strong>aus</strong> bei Greiz und im<br />
Wald bei Greiz-Moschwitz (HALBAUER, LANGE), je 1 BP 1992 (HILPMANN, ROTT) und 1993 (FRANKE,<br />
HILPMANN) im Forstrevier Waldh<strong>aus</strong> bei Greiz sowie 1996 rufende Vögel an drei Stellen im Forstrevier Waldh<strong>aus</strong><br />
bei Greiz (FG Greiz). Infolge einer noch intensiveren Suche nach <strong>dem</strong> Raufußkauz inzwischen liegen<br />
mehrere Brutnachweise <strong>aus</strong> folgenden Gebieten vor: Greiz-Werdauer Wald, Moschwitzer Wald, Pöllwitzer<br />
Wald, Köthenwald bei Leitlitz, Schömberger Forst, Aumaer Forst und Wälder um Langenwolschendorf,<br />
Kleinwolschendorf, Zeulenroda und Weckersdorf. Auf 15 – 20 BP schätzen deshalb LANGE & LIEDER (2001)<br />
den Bestand im Untersuchungsgebiet ein und können sich auf die Vorkommen in den genannten Forsten<br />
stützen. Der Triebeser Wald, das Triebitzbachtal bei Frotschau, die Haardt bei Niederndorf, das Waldgebiet<br />
bei Rüdersdorf und das Waldgebiet „Eichert“ bei Münchenbernsdorf kommen als weitere Brutorte hinzu. Im<br />
Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand mit 27 – 41 BP angegeben.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraum- und Brutplatzverlust durch waldbauliche Maßnahmen<br />
- Aufforstung von Windwurfflächen und damit Verlust von Jagdgebieten<br />
- Straßenbaumaßnahmen in Waldgebieten<br />
- Brutverluste durch Störung oder Beunruhigung<br />
- Belastung mit Umweltgiften<br />
- Prädation durch Marder und Waldkauz<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 138
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz von Altholzbeständen, besonders von Höhlenbäumen<br />
- Erhöhung der Umtriebszeiten<br />
- Naturnahe Waldbewirtschaftung<br />
- Verzicht auf forstliche Maßnahmen während der Brutzeit<br />
- Keine künstliche Aufforstung von Windwurfflächen<br />
- Anlegung eines Baumhöhlenkatasters und Information der Forstverwaltung<br />
- Einsatz von Nisthilfen in höhlenarmen Gebieten<br />
- Keine Förderung des Waldkauzes im Verbreitungsgebiet des Raufußkauzes<br />
Verbreitungskarte 11: Raufußkauz<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1 2 – 3 1 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3 4 – 7 2 – 3<br />
4 – 7<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 139
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Steinkauz – Athene noctua (Scopoli)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel, starke Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt den Steinkauz als häufigen Brutvogel in der Umgebung von<br />
Gera auf. Nach LIEBE (1873) ist er ein nicht seltener Bewohner der breiten Talsohlen um Gera, der in Kopfweiden<br />
und hohlen Obstbäumen brütet. Auf der Lasur bei Gera fand LIEBE sogar eine Brut in einem Eichhornnest<br />
im Fichtenwald. Später spricht er von langsamer Zunahme des Steinkauzbestandes (LIEBE 1878).<br />
In der Umgebung von Greiz war der Steinkauz nach Aufzeichnungen von 1881 „regelmäßiger, wenn auch<br />
nicht häufiger Brutvogel: Schlossberg, Dölau, Elsterberg, Pohlitz, Kleinreinsdorf.“ (HELLER 1926).<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1976) brütete der Steinkauz nach 1900 in ganz Thüringen. Im strengen Winter<br />
1929 / 30 war der Bestand stark zurückgegangen. Diesen Rückgang registrierte auch HIRSCHFELD (1932)<br />
für die Umgebung von Hohenleuben. Danach erholte sich der Bestand wieder.<br />
Ab 1950<br />
Bereits um 1960 setzte wieder ein Bestandsrückgang ein. GÜNTHER (1969) schreibt zum Vorkommen im<br />
Altkreis Gera: „Ob der derzeit schwache Bestand nur eine Folge des strengen Winters 1962 / 63 ist, möchte<br />
ich bezweifeln, denn andere Arten haben sich längst wieder erholt, der Steinkauz nicht. Während er vorher<br />
fast in jeder Ortschaft und in jeder Reihe alter Kopfweiden und -pappeln anzutreffen war, vermissen wir ihn<br />
heute an den meisten dieser Stellen.“ LANGE & LEO (1978) stellen einen deutlichen Rückgang im Altkreis<br />
Greiz fest. Der vorerst letzte Brutnachweis erfolgte im Jahr 1963. Um 1978 bestand nur noch für drei Gebiete<br />
Brutverdacht. Im Gebiet um Auma wurde der Steinkauz seit 1967 nicht mehr festgestellt. Der letzte Brutnachweis<br />
bei Auma erfolgte 1964 (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971). In den Jahren 1972 / 73 wurde der<br />
Brutbestand flächendeckend erfasst (RITTER 1974). Demnach siedelten im Altkreis Gera 12 Paare, im Altkreis<br />
Greiz 3 Paare und im Altkreis Zeulenroda 1 Paar. Erneut wurde der Bestand in diesen Gebieten 1980<br />
festgestellt. Während im Altkreis Gera wieder 12 Brutreviere gefunden wurden, gab es in den Altkreisen<br />
Greiz und Zeulenroda keine Nachweise mehr (GÜNTHER 1982). Für 1980 wurde dennoch im Nachgang noch<br />
eine letzte Brut <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Norden des Altkreises Greiz bekannt (PRAUTZSCH; KRÜGER 1983 a). Brutreviere des<br />
Steinkauzes waren inzwischen nur noch auf ein Gebiet östlich von Gera begrenzt. Für die Zeit von 1980 bis<br />
1985 meldet BAUM, bezogen auf dieses Gebiet, lediglich noch 5 BP (GRIMM 1985). In den darauffolgenden<br />
Jahren wurde der Bestand von KNEIS und BAUM mit folgen<strong>dem</strong> Ergebnis kontrolliert: 14 besetzte Reviere<br />
1986, 10 besetzte Reviere von 1988 – 1990, 5 besetzte Reviere 1991 und nur noch 4 besetzte Reviere 1992<br />
(BAUM & GRIMM 1993). 1998 wurden bei Gera 4 BP und an 7 Orten Brutverdacht festgestellt (BAUM, LIEDER<br />
u. a.; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1999). Ende der 1990er-Jahre siedelten maximal 5 Paare östlich von Gera<br />
(BAUM, LIEDER; LANGE & LIEDER 2001). Letztmalig wurden 3 BP im Jahr 2000 registriert und an 4 weiteren<br />
Stellen bestand Brutverdacht (LIEDER; ROST 2001). Danach konnten nur noch Einzelvögel beobachtet oder<br />
verhört werden (BAUM, KUMMER, LIEDER, PRÖHL und PATZELT). Im Jahre 2007 begann östlich von Gera unter<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 140
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Leitung des NABU ein Programm zur Bestandsstützung des Steinkauzes. Bisher wurden lediglich 11 in Gefangenschaft<br />
gezüchtete Vögel <strong>aus</strong>gewildert. Ein sicherer Freiland-Brutnachweis liegt bisher noch nicht vor.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraum- und Brutplatzverlust durch Rodung von Streuobstwiesen und alten Kopfbäumen, Aufgabe<br />
alter bäuerlicher Landnutzungsformen, Eutrophierung der Landschaft, Überbauung und Flurbereinigung<br />
- Verinselung von Populationen<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
- Belastung mit Umweltgiften<br />
- Prädation durch Katzen, Marder und Waldkauz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Langfristige Sicherung und Mehrung von extensiv genutztem Grünland<br />
- Erhaltung und Schutz von alten Streuobstwiesen und Kopfbäumen<br />
- Einsatz künstlicher Nisthilfen<br />
- Sicherung gefährlicher Straßenabschnitte<br />
- Senkung der Belastung mit Umweltgiften<br />
- Schutz der Brutplätze vor Prädatoren<br />
- Weitere Bestandstützung durch Auswilderung<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 141
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Uhu – Bubo bubo (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, gleichbleibend<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1820) schreibt, dass der Uhu „weit häufiger in den Gebirgen des Vogtlandes“ vorkommt. Bis 1855<br />
war der Uhu nach LIEBE (1878) Brutvogel in den Felswänden des Göltzsch- und Elstertals zwischen Greiz<br />
und Rentzschmühle und noch 1861 fand eine Brut im heutigen NSG „Steinicht“ bei Cossengrün statt. Die<br />
Ornithologische Sektion Gera (1859) führt den Uhu als seltenen Brutvogel bei Cronschwitz auf. Dieser<br />
Horststandort wird auch durch LIEBE (1873) bestätigt: „Der Schuhu horstete noch vor 15 Jahren in den Felsen<br />
gegenüber Kronschwitz; – jetzt nicht mehr.“ HELLER (1926) schreibt: „Noch vor 60 – 70 Jahren horstete<br />
ein Paar im Göltzschtale und im Pöllwitzer Walde.“<br />
1900 bis 1950<br />
FEUSTEL (1903) <strong>berichte</strong>t von einem am 31.12.1902 tot aufgefundenen weiblichen Uhu in Porstendorf bei<br />
Niederpöllnitz und von einem am 04.04.1903 gefangenen Uhu bei Berga. Im letzteren Fall könnte es sich<br />
auch um einen Brutvogel <strong>aus</strong> diesem Gebiet gehandelt haben. HELLER (1926) <strong>berichte</strong>t nach Beobachtungen<br />
von PIETZOLD: „1918, zur Zeit der Heuernte, wurden 2 Uhus in der Nähe des Elsterberger Bahnhofes<br />
beobachtet, von denen einer erbeutet wurde.“ Nach Mitteilung von PIETZOLD <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1925 wurden<br />
hier noch immer Uhus beobachtet (DERSCH 1933). Ein Weibchen und Männchen wurden 1919 bei<br />
Hohenölsen gefangen bzw. erlegt und HIRSCHFELD (1932) vermutete, dass sie sich hier ansiedeln wollten.<br />
1930 wurde ein Uhu auf der Höhe zwischen Albersdorf und Wernsdorf geschossen (WEBENDÖRFER & BLAM<br />
1963).<br />
Ab 1950<br />
1962 fand BAUCH ein Brutpaar bei Hohenölsen (BAUCH 1963, 1964). In den darauffolgenden Jahren war kein<br />
Brutplatz mehr bekannt (GÖRNER 1974). Im Frühjahr 1978 beobachtete LANGE einen Vogel bei Greiz<br />
(KRÜGER 1980). Auch PIEHLER entdeckte Ende März 1980 zwei Vögel in einem geeigneten Bruthabitat bei<br />
Greiz (KRÜGER 1983 a). 1981 registrierten LANGE, PIEHLER, PLEYER und SEIFERT die Anwesenheit in drei<br />
Gebieten des Altkreises Greiz und stellten einen erfolglosen Brutversuch fest (KRÜGER 1985 b). 1982 gab es<br />
dann zwei erfolgreiche BP im Altkreis Greiz (PIEHLER, TOLKMITT; KRÜGER 1986). Danach wurde der Uhu alljährlich<br />
als Brutvogel festgestellt (KRÜGER 1990, 1992, LANGE 1988), aber nicht mehr in allen Fällen publiziert.<br />
Die Brutorte wurden <strong>aus</strong> Gründen des Artenschutzes streng geheim gehalten. GÖRNER (1998) nennt<br />
als Brutgebiete das Elstertal, welches im angrenzenden sächsischen Teil ab 1972 und im Landkreis Greiz ab<br />
1982 besiedelt war sowie das untere Weidatal, wo die Wiederbesiedlung ab 1981 erfolgte. 2001 wird der<br />
Bestand von LANGE & LIEDER (2001) mit mindestens 8 BP <strong>aus</strong> folgenden sicheren bzw. potentielle Brutgebieten<br />
des Landkreises Greiz angegeben: NSG „Steinicht“ bei Cossengrün, „Hoher Stein“ im Göltzschtal bei<br />
Greiz, Neuhammer im Tal der Weißen Elster bei Greiz, Baumberg Berga, Steinbruch Loitsch, Steinbruch<br />
Schüptitz, Steinbruch Tschirma, Steinbruch an der Talsperre Weida, Steinbruch Hohenölsen, Fichtleite bei<br />
Großdraxdorf, Steinbruch Wünschendorf. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand<br />
mit 9 BP eingeschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 142
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Ob der Uhu wirklich über größere Zeiträume im 19. und 20. Jahrhundert gefehlt hat oder nur wegen der geringen<br />
Nachforschung übersehen wurde, lässt sich heute nicht mehr feststellen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Abschuss und Fang in früheren Zeiten (vereinzelt auch noch heute Fang und Tötung)<br />
- Kollision mit Windenergieanlagen und Freileitungen<br />
- Störungen im Horstbereich durch Freizeitnutzung<br />
- Nahrungsmangel durch Intensivierung der Landwirtschaft und damit Fehlen wichtiger Beutetiere wie Feldhamster<br />
und Wildkaninchen<br />
- Schließung der großen Mülldeponien mit gutem Nahrungsangebot (Wanderratte)<br />
- Prädation durch Marder, Fuchs und Waschbär<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Windenergieanlagen und Horststandorten (Länder-<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2007: 1.000 m Abstand)<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
- Vermeidung von Störungen an den bekannten Horsten<br />
- Schaffung künstlicher Brutnischen<br />
- Erhaltung und Ausweitung großräumiger extensiv genutzter Kulturlandschaften mit hohem Grünlandanteil<br />
- Bekämpfung der Prädatoren im Umfeld der Horststandorte<br />
Verbreitungskarte 12: Uhu<br />
1<br />
1 1 1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 143
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Ziegenmelker – Caprimulgus europaeus L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Wahrscheinlich nur noch unregelmäßiger Brutvogel, starke<br />
Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt den Ziegenmelker als seltenen Brutvogel für die Umgebung<br />
von Gera auf. LIEBE (1873) schreibt: „Die Nachtschwalben sind im Gebiet zwar nicht häufig, aber doch auch<br />
nicht zu selten: mir sind leider fast jedes Jahr zur Nistzeit geschossene oder gefangene Exemplare gebracht<br />
worden. Im Geraer Forst hält sich ein Paar regelmäßig in der Nähe des Rondels auf; andere im Naulitzer<br />
Grund, unterhalb Berga, im Ronneburger Forst.“<br />
1900 bis 1950<br />
Laut Beobachtungen von PIETZOLD nennt HELLER (1926) mehrere Brutort in der Umgebung von Greiz: „Gilt<br />
als seltener Brutvogel, ist aber häufiger, als angenommen wird (nächtliche Lebensweise!). Brütend gefunden:<br />
am Gasparinenberge, Brand, bei der Schäferei (Rothenthal), bei Hohndorf, Tremnitz, Pöllwitz.“ Nach<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1976) brütet der Ziegenmelker in allen Teilen Thüringens, besonders in <strong>dem</strong> Buntsandsteingebiet<br />
zwischen Elster und Saale, aber auch im Vogtland. Bei Hohenölsen wurden im August 1907<br />
fünf Vögel beobachtet (VÖLCKEL; GÜNTHER 1969). In den 1930er-Jahren fand ihn SCHNAPPAUF noch vereinzelt<br />
westlich der Elster (GÜNTHER 1969). ROßBACH (1935 / 36) konnte noch eine Zunahme feststellen: „Breitet<br />
sich erfreulicherweise im Gebiet <strong>aus</strong>. In der ,Wüstung Wolfersdorf‘, im ,Langen Grund‘ südlich Zedlitz, in den<br />
Waldungen um die ,Hohe Reuth‘ Seifersdorf, Burkersdorf Landkreis Gera, traf ich den ,Ziegenmelker‘ in den<br />
letzten Jahren wiederholt an.“<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) kann kein konkretes Vorkommen mehr nennen. Ebenso unbestimmt äußern sich LANGE &<br />
LEO (1978): „War er bis Mitte der [19]60er-Jahre noch regelmäßiger festzustellen, so dürfte die Art heute nur<br />
noch vereinzelt bei uns brüten, mitunter wohl völlig fehlen.“ GÜNTHER (1979 a) bekam bei einer späteren<br />
Umfrage folgende Feststellungen genannt: 1 Ind. am 11.06.1965 bei Korbußen (REICHERT), 1 Ind. am 31.05.<br />
und 01.06.1976 bei Bad Köstritz (KIRSCH), 1 Ind. am 22.05.1977 bei Waldh<strong>aus</strong> (LUMPE, KÖNIG), Brutverdacht<br />
1955 – 1957 an der Talsperre Weida (FG Zeulenroda) sowie 1975 bei Merkendorf (SCHMIDT).<br />
Um das Jahr 2000 schätzen LANGE & LIEDER (2001) den Bestand mit 1 – 3 BP ein, wobei regelmäßige<br />
Nachweise nur von Neumühle bei Greiz vorliegen. Daneben werden Beobachtungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Greiz –<br />
Werdauer Wald, vom Seilersbach bei Zedlitz und vom ehemaligen Truppenübungsplatz „Muna“ bei Rüdersdorf<br />
genannt. Brutzeitbeobachtungen gelangen 2001 und 2003 bei Neumühle, OT Lehnamühle (DUDAT) und<br />
2002 bei Mohlsdorf (LANGE). Danach sind keine Nachweise mehr bekannt geworden. Es wurde aber auch<br />
nicht gezielt nach der Art gesucht!<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 144
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Abschuss in früheren Zeiten<br />
- Lebensraumverlust durch Eutrophierung und Vergrasung magerer Offenlandstandorte in Waldrandlagen,<br />
Abnahme großer Kahlschläge und Sukzession auf ehemaligen Truppenübungsplätzen<br />
- Rückgang von Alt- und Totholz<br />
- Rückgang nachtaktiver Großinsekten<br />
- Aufgabe traditioneller Waldbewirtschaftung<br />
- Verluste im Straßenverkehr und an Freileitungen<br />
- Störungen an den Brutplätzen durch Freizeitnutzung<br />
- Verluste durch Prädatoren (Fuchs, Marder, Waschbär, Ratten)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherung gefährlicher Freileitungen<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
- Erhaltung und Ausweitung großräumiger extensiver Waldnutzung mit Rohböden oder niedriger Vegetation<br />
- Verhinderung der Sukzession auf ehemaligen Truppenübungsplatzen im Pöllwitzer Wald, bei Rüdersdorf<br />
und im Zeitzer Forst<br />
- Verringerung des Biozid- und Düngereinsatzes in der Forstwirtschaft<br />
- Bekämpfung der Prädatoren im Umfeld der Brutplätze<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 145
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Eisvogel – Alcedo atthis (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel mit starken witterungsbedingten Bestandsschwankungen<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt den Eisvogel als häufigen Brutvogel in der Umgebung von<br />
Gera auf. LIEBE (1873) fand die Art nicht sehr häufig. Als Brutorte nennt er die Elster zwischen<br />
Wünschendorf und Berga, wo mehrere Paare brüten, die Sprotte an der Teufelskirche, den Rubitzer Bach<br />
und die Weida zwischen der Naddelmühle [Nattermühle nördlich Steinbruch Loitsch] und Döhlen. Bisweilen<br />
soll er auch an anderen Orten brüten. Später bezeichnet er die Art als nicht selten, obwohl sie an vielen Bächen<br />
wegen Wassermangels nicht mehr vorgekommen sein soll. HELLER (1926) beklagt bereits den starken<br />
Rückgang des Eisvogels um 1880: „Früher im ganzen Elstertale und den Seitentälern regelmäßiger Brutvogel,<br />
ist dieser farbenprächtige Vertreter unserer Vogelwelt leider infolge Verpestung unserer Wasserläufe<br />
durch Fabrikabwässer so gut wie <strong>aus</strong>gerottet.“<br />
1900 bis 1950<br />
Der Eisvogel brütete nach Beobachtungen von PIETZOLD noch [um 1926] im „Triebtale“ (HELLER 1926). An<br />
der Elster bei Pohlitz [TK 5038 / 3] verschwand der Eisvogel in den 1930er-Jahren (SCHNAPPAUF; GÜNTHER<br />
1969). HIRSCHFELD (1930, 1932) fand ihn 1922 – 1935 regelmäßig an den Flüssen Leuba, Triebes, Auma,<br />
Weida und Elster brütend. LANGE & LEO (1978) <strong>berichte</strong>n: „So sind <strong>aus</strong> den [19]20er Jahren Brutstätten <strong>aus</strong><br />
<strong>dem</strong> Schlöten- und Krümmetal [Greiz-Werdauer Wald] belegt (L. H.).“<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) kennt noch Brutplätze im Fuchsbach-, Weida- und Aumatal sowie an der Elster bei Wolfsgefährt.<br />
Das Brutvorkommen im Leubatal wird von DANNHAUER (1963) bestätigt. GÖRNER (1973) erwähnt <strong>aus</strong><br />
<strong>dem</strong> Zeitraum 1960 bis 1969 Bruten an der Weida bei Leitlitz und Zeulenroda, bei Wünschendorf und im<br />
Auma- und Leubatal sowie Brutverdachte an mehreren Stellen bei Greiz. An der Talsperre Weida bestand<br />
nach WERNER (1964) ein Brutvorkommen. Nach LANGE & LEO (1978) gab es 1976 im Altkreis Greiz fünf besetzte<br />
Brutplätze: Steinbruch Neumühle, Krümmetal, Schlötental, Elstertal bei der Clodramühle und nordwestlich<br />
des Leninparks [Greizer Park] sowie Brutverdachte in weiteren vier Gebieten.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 146
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Eine Bestandserfassung von FLÖßNER (1979 a) ergab Bruten des Eisvogels an der Elster und ihren Zuflüssen:<br />
Elsterufer Clodramühle, Elsteraue bei Greiz zwei Brutplätze, Neumühle bei Greiz, Schlötental,<br />
Krümmetal, Mohlsdorf, Erlbach bei Töppeln, Schafbach bei Grüna, Brahme bei Dorna und Brutverdacht an<br />
weiteren drei Stellen im Altkreis Greiz und bei Münchenbernsdorf, an der Weida: Läwitz und zwischen Talsperre<br />
Weida und Döhlen sowie an der Auma: Stadt Auma und unterhalb Rohna. ÖLSCHLEGEL fand 1976 auf<br />
einer Strecke von 15 km zwischen Reinsdorf [SOK] und der Talsperre Auma 12 BP. LANGE & LIEDER (2001)<br />
schätzen den Bestand mit 50 – 60 BP ein. Für die Jahre 2004 – 2008 wurden 44 Reviere im Untersuchungsgebiet<br />
festgestellt und der Bestand auf 40 – 50 BP geschätzt (LIEDER & LUMPE 2009). Starke Bestandeinbrüche<br />
infolge strenger Winter treten regelmäßig auf. So dürften nach <strong>dem</strong> kalten Winter 2008 /<br />
2009 nur noch drei BP im Gebiet vorkommen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Abschuss und Fang in früheren Zeiten<br />
- Zerstörung des Lebensraumes durch Gewässer<strong>aus</strong>bau und Gewässerverschmutzung<br />
- Störung an den Brutplätzen durch Freizeitnutzung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz naturnaher Fließgewässer<br />
- Renaturierung verbauter Gewässer<br />
- Verbesserung der Wasserqualität an Still- und Fließgewässern<br />
- Einschränkung der Freizeitnutzung an Fließgewässern<br />
- Schaffung von Abbruchkanten an Fließgewässern<br />
- Anlage von künstlichen Niströhren<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 147
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wiedehopf – Upupa epops L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Wiedehopf noch häufig. BREHM (1820 – 22) schreibt für das Gebiet<br />
an der Grenze zum heutigen Saale-Holzland-Kreis: „Dieser Vogel war noch vor 20 Jahren zwar nicht häufig,<br />
aber doch auch nicht selten in unseren Thälern. Um meinen Wohnort brüteten zwei Paare, und fast bei je<strong>dem</strong><br />
benachbarten Dorfe wenigstens ein Paar, so dass in einem nicht sehr großen Bezirke 10 Paare wohnten,<br />
… jetzt ist in einem Umfange von mehreren Geviertstunden nicht eins mehr zu finden.“ Nach der Ornithologischen<br />
Sektion Gera (1859) war die Art ein sehr seltener Brutvogel, der mehrere Jahre hintereinander<br />
bei Lichtenberg brütete. LIEBE (1873) führt <strong>aus</strong>: „Der Wiedehopf soll früher auf <strong>dem</strong> Debschwitzer Anger<br />
gebrütet haben und hat nach <strong>dem</strong> Bericht von 1859 bei Lichtenberg sich mehrere Jahre hintereinander aufgehalten.<br />
Seit jener Zeit ist er als Brutvogel verschwunden.“ Am 06.Mai 1873 sah er am Rande des Zeitzer<br />
Forstes ein Paar, konnte aber kein Nest finden (LIEBE 1878). HELLER (1926) kann ebenfalls nur auf Brutzeitbeobachtungen<br />
<strong>aus</strong> den Jahren vor 1880 bei Thürndorf und zwischen Waltersdorf und Reinsdorf verweisen,<br />
ohne das ein konkreter Nachweis gelang. Brutzeitbeobachtungen von 1883 im Rehgrund bei Gera-<br />
Langenberg erwähnt HENNICKE (Fußnote bei LIEBE 1873; FLÖßNER 1979 b).<br />
1900 bis 1950<br />
In diesem Zeitraum gibt es keine Hinweise auf ein Brüten des Wiedehopfes in unserem Gebiet.<br />
Ab 1950<br />
Um 1950 wurde eine Brut bei Gottesgrün / Reudnitz gefunden (KANIS; LANGE & LIEDER 2001). Bemerkenswert<br />
ist die Beobachtung von 1 – 2 Vögeln im Sommer 1987 und 1988 im Gebiet Kauern – Lunzig –<br />
Wittchendorf (HILPMANN, HOFMANN, KRAUSE; KRÜGER 1993 / 94; KRÜGER 1995 a).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraum- und Brutplatzverlust durch Rodung von Streuobstwiesen und alten Kopfbäumen, Aufgabe<br />
alter bäuerlicher Landnutzungsformen, Eutrophierung der Landschaft, Überbauung und Flurbereinigung<br />
- Entfernung oder umweltschädliche Sanierung alter Gebäude<br />
- Belastung mit Umweltgiften, Rückgang der Großinsekten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Langfristige Sicherung und Mehrung von extensiv genutztem Grünland<br />
- Erhaltung und Schutz von alten Streuobstwiesen und Kopfbäumen<br />
- Einsatz künstlicher Nisthilfen<br />
- Senkung der Belastung mit Umweltgiften<br />
- Erhaltung nährstoffarmer halboffener Landschaften auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und im Bergbau-<br />
Sanierungsgebiet der Wismut<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 148
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wendehals – Jynx torquilla L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Nach starker Abnahme gleichbleibender Bestand<br />
auf niedrigerem Niveau<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Wendehals als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) fand die Art in den wärmeren Tälern des Gebietes als nicht seltenen Brutvogel<br />
und erwähnt Nistkastenbruten bei Gera und Weida. Später schreibt er, dass die Art „etwas rarer geworden“<br />
sei (LIEBE 1878). HELLER (1926) erwähnt für die Zeit um 1880 Brutvorkommen im Greizer Park, bei Gommla,<br />
Dölau, Caselwitz und etwas häufiger bei Elsterberg.<br />
1900 bis 1950<br />
SCHEIN (1910) fand im Jahre 1907 eine Brut in einem Nistkasten zwischen Gera-Lusan und Oberröppisch.<br />
HIRSCHFELD (1932) kennt den Wendehals als seltenen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben, häufiger<br />
aber bei Weida, Greiz und Elsterberg.<br />
Ab 1950<br />
Für 1961 wird das Brutvorkommen im Pöllwitzer Wald erwähnt (Anonym 1962). Nach BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖSSEL (1971) ist der Bestand bei Auma starken Schwankungen unterworfen. Regelmäßig ist der Wendehals<br />
in einer Kleingartenanlage am Sophienbad, im Untendorfer Wald und am Waldh<strong>aus</strong> im Aumaer Forst zu<br />
hören. LANGE & LEO (1978) bezeichnen den Wendehals als vereinzelten Brutvogel im Altkreis Greiz: „Noch<br />
bis in die [19]60er Jahre unseres Jahrhunderts konnte mit etwa 20 Paaren gerechnet werden. Durch weiteren<br />
Rückgang der Art steht der Bestand zurzeit allerdings nahe <strong>dem</strong> Erlöschen.“ Bei einer überregionalen<br />
Erfassung 1975 / 76 wurden im Altkreis Greiz keine Bruten mehr gefunden, während im Altkreis Zeulenroda<br />
noch 3 BP bei Auma heimisch waren. Im Altkreis Gera wurden auf sechs Kontrollflächen noch 13 – 15 BP<br />
registriert (SCHEFFEL 1978). Um das Jahr 2000, so schätzen LANGE & LIEDER (2001) ein, gab es einen Bestand<br />
von etwa 30 BP im Untersuchungsgebiet. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden<br />
25 – 37 BP ermittelt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Nahrungsengpässe durch Rückgang der Ameisen oder deren verringerte Zugänglichkeit durch zunehmend<br />
unterirdisch angelegte Nester als Folge der Überdüngung und Ausräumung der Landschaft<br />
- Lebensraumzerstörung durch Intensivierung der Landwirtschaft<br />
- Rodung, Überbauung oder intensivere Nutzung von Obstgärten und Streuobstwiesen<br />
- Verlust höhlenreicher Laubbäume<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 149
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung einer reich strukturierten Kulturlandschaft auf großen Flächen mit hohem Angebot alter Bäume<br />
- Reduktion der Intensität von land- und forstwirtschaftlicher Nutzung<br />
- Wiederherstellung und Erhaltung nahrungsreicher und extensiv genutzter Wiesen, Weiden, Streuobstwiesen<br />
sowie Gärten<br />
- Förderung und Erhaltung von Magerrasen und Ruderalflächen, insbesondere auf den ehemaligen militärisch<br />
und bergbaulich genutzten Flächen<br />
- Maßnahmen zur Ansiedlung und zum Schutz von Ameisenvölkern<br />
- Reduktion der Düngemittel- und Biozidanwendung<br />
- Angebot von Nisthilfen<br />
Verbreitungskarte 13: Wendehals<br />
2 – 3 4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
1<br />
2 – 3 1<br />
1 2 – 3 1 2 – 3<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 150
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Mittelspecht – Dendrocopos medius (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr. 11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, vermutlich gleichbleibender<br />
Bestand<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1847) schreibt: „… der Mittelbuntspecht … gehört im Osterland zu den Seltenheiten; doch dürften<br />
wohl einzelne Paare in unsern Laubwäldern nisten.“ Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war der<br />
„Weißspecht“ ein seltener Brutvogel in der Umgebung von Gera. Dagegen schreibt LIEBE (1873): „Der mittlere<br />
Buntspecht gehört als Brutvogel unserm Gebiet nicht an.“ Diese Auffassung vertritt er auch später noch<br />
(LIEBE 1878). HILDEBRANDT & SEMMLER (1976) bezweifeln diese Aussage von LIEBE und vermuten mangelnde<br />
Artkenntnisse. HELLER (1926) erwähnt den Mittelspecht in seinen Aufzeichnungen von 1881 nicht als<br />
Brutvogel in und um Greiz. Nach DOMBROWSKI (1893) hingegen ist der Mittelspecht in den reußischen Wäldern<br />
ein spärlicher Brutvogel.<br />
1900 bis 1950<br />
GÜNTHER (1969) folgert <strong>aus</strong> Beobachtungen von SCHNAPPAUF <strong>aus</strong> den letzten vier Jahrzehnten, dass der<br />
Mittelspecht in den Wäldern um Bad Köstritz Brutvogel sei.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) kann einen Brutnachweis für 1960 im Brunnenholz bei Ronneburg aufführen und vermutet<br />
weitere Vorkommen bei Bad Köstritz. LANGE & LEO (1978) kennen die Art nur als gelegentlichen Gast im<br />
Altkreis Greiz. WOLF (1975) kann nur Einzelbeobachtungen bei Gera, Ronneburg und Greiz nennen und<br />
vermutet, dass die Art nicht alljährlich im damaligen Bezirk Gera gebrütet hat. 1980 wurde ein Brutrevier des<br />
Mittelspechtes bei Neuärgerniß gefunden (SCHÜTZ), welches auch 1981 besetzt war (KRÜGER 1985 b). Ebenfalls<br />
1981 gelang im Geraer Stadtwald ein Brutnachweis durch SCHULZE und im Greizer Park wurde ein balzendes<br />
Paar von F. und W. LEO beobachtet (KRÜGER 1985 b). Für die Zeit um das Jahr 2000 schätzen LAN-<br />
GE & LIEDER (2001) den Bestand mit 10 – 20 BP ein. Als Brutgebiete werden das Elstertal zwischen Greiz<br />
und Bad Köstritz, Weida, Neuärgerniß und Ronneburg genannt. In den Jahren 2001 und 2002 erfolgte eine<br />
Erfassung für ganz Thüringen. Der Landkreis Greiz meldete hierfür 5 BP und die Stadt Gera 9 BP. Für beide<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 151
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Gebiete (Landkreis Greiz und Gera) schätzt FRICK (2004) 25 BP ein. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes<br />
2005 – 2008 wurden 10 – 14 BP eingeschätzt. Die meisten Angaben sind sicher unvollständig, da keine<br />
flächendeckende Erfassung mit den geeigneten Hilfsmitteln (Klangattrappe) erfolgte. Selbst in regelmäßig<br />
besiedelten und gut besuchten Mittelspecht-Brutrevieren wird der Vogel häufig übersehen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Verlust von totholzreichen, großborkigen Bäumen und Wäldern<br />
- Fehlende Nachpflanzung von Eichen<br />
- Zu kurze Umtriebszeiten, insbesondere der Buche<br />
- Verlust der Hartholzauen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- großflächiger Schutz von reich strukturierten Laub- und Mischwäldern und Erhalt aller verbliebenen Hartholzauen<br />
mit bekannten Brutorten im Untersuchungsgebiet<br />
- Nachpflanzung von Eichen<br />
Verbreitungskarte 14: Mittelspecht<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 152
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rotkopfwürger – Lanius senator L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts muss die Art noch verbreit gewesen sein. Nach BREHM (1820 – 22 und 1833)<br />
bewohnt der Rotkopfwürger das östlich der Saale gelegene waldreiche Buntsandsteingebirge. Nach Angaben<br />
der Ornithologischen Sektion Gera (1859) ist die Art ein sehr seltener Brutvogel bei Gera. Als Brutplatz<br />
wird Thränitz genannt. LIEBE (1873) kann nur einen Brutplatz des Rotkopfwürgers bei Grobsdorf nennen, teilt<br />
aber 1878 mit, dass die Art etwas häufiger geworden sei und den Schwarzstirnwürger im Bestand überholt<br />
hätte. 1879 beobachtete LIEBE die Art bei Gera-Kaimberg (Fußnote bei LIEBE 1878; GÜNTHER 1979 b). Nach<br />
HELLER (1926) brütete der Rotkopfwürger vor 1881 einmal bei Teichwitz.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist der Rotkopfwürger „ …in der Umgebung von Greiz einzelner, aber regelmäßiger<br />
Durchzügler, der auch <strong>aus</strong>nahmsweise zu brüten scheine.“ Ende Juli 1935 beobachtete ROßBACH ein<br />
Paar mit bereits flüggen Jungvögeln bei Wolfsgefährt (ROßBACH 1935 / 36).<br />
Ab 1950<br />
Am 20. Mai 1956 sah WERNER einen Rotkopfwürger bei Braunsdorf (DANNHAUER 1963). Sowohl 1974 als<br />
auch 1975 brütete der Rotkopfwürger am Ortsrand von Nauendorf im Nordosten des heutigen Landkreises<br />
Greiz (BABARIKA, ZÖRNER; AUERSWALD 1979) und 1978 bei Bethenh<strong>aus</strong>en (ZÖRNER, GÜNTHER 1979 b). Von<br />
1979 bis 1987 fand ZÖRNER alljährlich ein BP wiederum bei Nauendorf (LANGE & LIEDER 2001) und PATZELT<br />
stellte 1987 ein BP bei Friedmannsdorf fest (KRÜGER 1994). Danach gab es im Untersuchungsgebiet keine<br />
Brutnachweise mehr. Nach 1987 gab es nur zwei Sichtbeobachtungen: 1 Ind. am 29.08.2000 in der<br />
Culmitzsch-Aue (PATZELT) und 1 Ind. am 19.08.2007 im RNG Culmitzsch (LANGE).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Rodung von Streuobstwiesen und Obstgärten, Überbauung von Obstgärten<br />
- Ausräumung der Landschaft und Zerstörung der Strukturvielfalt<br />
- Verlust von Magerrasen, exzessiver Biozid- und Düngemitteleinsatz mit erheblicher Verringerung der<br />
Arthropodennahrung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Neuanlage <strong>aus</strong>gedehnter Obstgärten und Streuobstwiesen<br />
- Entwicklung und Schutz strukturreicher Feldfluren<br />
- Drastische Reduzierung des Biozideinsatzes<br />
- Förderung der extensiven Weidewirtschaft<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 153
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schwarzstirnwürger – Lanius minor (Gmelin)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Ausgestorben<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) nennt als Brutplatz für die Umgebung von Gera nur „Speutewitz“,<br />
ein Gebiet zwischen Gera-Bieblach und Dorna. LIEBE (1873) <strong>berichte</strong>t: „Ich habe ein Paar in den letzten drei<br />
Jahren zwischen Kaimberg und Zwötzen beobachtet und ein anderes 1870 bei Kleinaga“. LIEBE fand 1879<br />
ein weiteres Paar bei Gera-Röppisch (HIRSCHFELD 1932). HELLER (1926) kann <strong>aus</strong> der Zeit vor 1881 ein<br />
Brutvorkommen bei Weckersdorf anführen.<br />
20. Jahrhundert<br />
Am 08. Mai 1956 wurden zwei Schwarzstirnwürger von WERNER bei Zeulenroda festgestellt (DANNHAUER<br />
1963). 1976 gelang bei Nauendorf im Nordosten des heutigen Landkreises Greiz der letzte Brutnachweis<br />
des Schwarzstirnwürgers durch BABARIKA und ZÖRNER für das Untersuchungsgebiet (AUERSWALD 1979).<br />
Auch Sichtbeobachtungen sind danach nicht mehr dokumentiert worden.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Rodung von Streuobstwiesen und Obstgärten<br />
- Überbauung von Obstgärten<br />
- Ausräumung der Landschaft und Zerstörung der Strukturvielfalt<br />
- Verlust von Magerrasen sowie exzessiver Biozid- und Düngemitteleinsatz mit erheblicher Verringerung der<br />
Arthropodennahrung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Neuanlage <strong>aus</strong>gedehnter Obstgärten und Streuobstwiesen<br />
- Entwicklung und Schutz strukturreicher Feldfluren<br />
- Drastische Reduzierung des Biozideinsatzes<br />
- Förderung der extensiven Weidewirtschaft<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 154
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Raubwürger – Lanius excubitor L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Stark gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Vom Aussterben bedroht, starke Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1833) fand den Raubwürger als regelmäßigen Brutvogel auf den Viehweiden um Renthendorf. Die<br />
Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Art als häufigen Brutvogel in der Umgebung von Gera.<br />
Nach LIEBE (1873) ist er ziemlich selten. Aus den letzten fünf Jahren waren ihm u.a. folgende Brutorte bekannt:<br />
Kaimberg, Rubitz, Kleinsaara, Steinschenke bei Weida und Berga. Später schreibt er von durchschnittlich<br />
5 BP im Jahr und das die Art früher häufiger gewesen sei (LIEBE 1878). HELLER (1926) schreibt<br />
nach seinen Aufzeichnungen von 1881: „... Raubwürger (wälsche Elster). Sehr seltener Brutvogel des Gebietes:<br />
Cunsdorf bei Elsterberg [benachbartes Sachsen], Berga. Außerhalb der Brutzeit, aber wahrscheinlich<br />
als Standvogel, 1873 bei der Gippe [Elsterberg] beobachtet.“<br />
1900 bis 1950<br />
Sowohl HILDEBRANDT (1919) als auch HIRSCHFELD (1932) kennen keine Brutvorkommen in Ostthüringen.<br />
Ab 1950<br />
Nach<strong>dem</strong> die Art lange Zeit gefehlt hat, begann in den 1960er-Jahren die Wiederbesiedlung. So brüteten<br />
erstmals wieder Raubwürger 1967 bei Raitzhain und Großenstein, 1968 bei Großenstein und 1969 bei<br />
Baldenhain (GÜNTHER 1969). LANGE & LEO (1978) können Brutnachweise <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahr 1974 von Gottesgrün<br />
und Tremnitz anführen. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL (1971) fanden 1967 ein BP am Sophienbad in<br />
Auma und 1968 je ein BP im Gebiet Leschke sowie in Wüstenwetzdorf. 1969 und 1970 waren diese Brutplätze<br />
nicht mehr besetzt, dafür wurde bei Krölpa ein neues BP entdeckt. FLÖßNER (1979 c) stellt ab 1967,<br />
<strong>aus</strong>gehend vom Raum Ronneburg – Gera, eine rasche Wiederbesiedlung des Gebietes fest und nennt nach<br />
einer Bestandserhebung in den Jahren 1977 / 78 folgende Brutvorkommen: Zeulenroda 2 – 3 BP 1976 und<br />
1977, je ein BP Baldenhain 1978, Pölzig 1971, Collis 1972, Nauendorf 1973, Pohlitz 1974, Kleinaga 1975,<br />
Reichenbach 1975, Ronneburg 1978, Münchenberndorf 1969, Frießnitz / Struth 1975 und 1976 sowie Reust<br />
1975 und 1978, dazu Brutzeitbeobachtungen seit 1962 an 12 weiteren Orten. Im besonders dicht vom<br />
Raubwürger besiedelten Gebiet Dorna – Frankenau – Beerwalde – Schwaara siedelten zu dieser Zeit auf<br />
einer Fläche von 35 km² Größe regelmäßig 2 – 5 BP. Um 1975 gab es, ebenfalls nach FLÖßNER (1979 c),<br />
einen Bestandshöhepunkt mit ca. 20 – 25 BP. Nach 1975 wurden lediglich noch folgende Bruten registriert:<br />
je 1 BP 1978 am Krähenteich bei Niederpöllnitz (BAUM), 1983 bei Pansdorf (WOLF), 1987 am Stau Tremnitz<br />
(WOLF) und 1995 bei Zschippach (LIEDER, BAUM). LANGE & LIEDER (2001) bezeichnen die Art nur noch als<br />
unregelmäßigen Brutvogel. Danach war der Raubwürger offensichtlich als Brutvogel mehrere Jahre ganz<br />
verschwunden. 2008 bestand Brutverdacht im Gebiet Leschke (Balz) und bei Paitzdorf, wo sich zur Brutzeit<br />
ständig ein Vogel aufhielt (HERRMANN, HALBAUER, HOFFMANN, KRAFT; LUMPE & LIEDER 2009).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 155
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Rodung von Streuobstwiesen<br />
- Ausräumung der Landschaft und Zerstörung der Strukturvielfalt<br />
- Verbauung der Landschaft<br />
- Intensivierung der Wiesennutzung sowie exzessiver Biozid- und Düngemitteleinsatz<br />
- Verringerung des Nahrungsangebotes und der Zugänglichkeit zur Beute durch Eutrophierung der Landschaft<br />
- Zunehmend <strong>aus</strong>bleibende Feldm<strong>aus</strong>gradationen<br />
- Zunehmende Störung durch Übererschließung und Freizeitnutzung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Neuanlage <strong>aus</strong>gedehnter Streuobstwiesen<br />
- Entwicklung und Schutz strukturreicher Kulturlandschaften<br />
- Erhaltung von Brachflächen in Bergbau-Sanierungsgebieten der Wismut und auf ehemaligen Truppenübungsplätzen<br />
bei Pöllwitz, Rüdersdorf und im Zeitzer Forst<br />
- Drastische Reduzierung des Biozideinsatzes<br />
- Förderung der extensiven Weidewirtschaft<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 156
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Dohle – Coloeus monedula L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) ist die Dohle ein sehr häufiger Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Auch LIEBE (1873) schreibt: „Dohlen haben ihren Wohnsitz in fast allen großen Ortschaften aufgeschlagen<br />
und sind namentlich in Gera und Weida stark vertreten. In alten hohlen Bäumen nisten sie auf <strong>dem</strong><br />
Hainberg bei Gera. – 1871 ward ihre Zahl durch den Genuß vergifteter Feldmäuse sehr bedeutend<br />
reduciert.“ Nach HELLER (1926) fehlt die Dohle um 1880 als Brutvogel in Greiz. Brutvorkommen gab es nur<br />
an der Göltzschtal- und Elstertalbrücke und in Elsterberg außerhalb des heutigen Landkreises Greiz im benachbarten<br />
Sachsen. Das Vorkommen am „Hochstein“ [Hoher Stein] an der Papiermühle bei Greiz war noch<br />
in den 1870er-Jahren besetzt.<br />
1900 bis 1950<br />
Im Schlötengrund bei Greiz gab es bis etwa 1925 eine Baumbrüterkolonie (LANGE & LEO 1978). Auch für<br />
Hohenleuben wird die Art als Baumbrüter erwähnt: „Drei mit Dohlen besetzte Nisthöhlen in einer Buche!“<br />
(HIRSCHFELD 1931). Nach 1945 kam es zu einem starken Anwachsen des Bestandes in Gera, als die Art<br />
zahlreiche zerbombte Häuser besiedelte (GÜNTHER 1969).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt den Bestand auf ca. 30 Brutpaare. Der Bestand in Gera soll wieder zurückgegangen<br />
sein und eine Baumbrüterkolonie im Brunnenholz bei Ronneburg mit 5 – 6 BP wurde 1965 aufgegeben.<br />
Im Altkreis Greiz fehlte die Art bis in die 1950er-Jahre als Brutvogel. 1978 konnten ca. 15 BP in Greiz nachgewiesen<br />
werden (LANGE & LEO 1978). Um Auma brüteten in den 1960er-Jahren nur wenige Paare. In der<br />
Stadt selbst gab es 10 BP auf <strong>dem</strong> Kirchturm (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971). Eine überregionale Bestandserfassung<br />
1973 / 74 brachte folgendes Ergebnis: 3 Kolonien mit 11 BP und 2 Einzelpaare in Greiz,<br />
2 Kolonien mit 18 BP in Auma (1960 nur 7 BP), 1 BP Braunsdorf, 1 BP Döhlen, 4 BP Gütterlitz, 2 BP<br />
Merkendorf, 1 BP Muntscha, 1 BP Pahren, 9 BP Zeulenroda (früher fehlend), 3 BP Frießnitz und 9 BP Gera<br />
(RUDAT 1975). In den Jahren 1988 bis 1993 wurde der Brutbestand erneut erfasst (Maximalzahlen): 7 BP<br />
Gera, ca. 30 BP Niederpöllnitz, 2 – 3 BP Uhlersdorf, 2 BP Weida, 25 BP Greiz, 20 – 22 BP Auma, 1 – 2 BP<br />
Braunsdorf, 3 BP Döhlen, 2 BP Gütterlitz, 5 BP Hohenleuben, 3 BP Kleinwolschendorf, 1 BP<br />
Langenwetzendorf, 1 – 3 BP Langenwolschendorf, 5 – 7 BP Merkendorf, 2 – 5 BP Muntscha und 1 BP<br />
(Baumbrüter) Quingenberg (PETER 1993). 1999 wurden im gesamten Gebiet 126 BP ermittelt und der Bestand<br />
auf 130 BP geschätzt (LANGE & LIEDER 2001). Im Jahr 2002 wurde der Brutbestand für ganz Thüringen<br />
erfasst. Zu diesem Zeitpunkt brüteten in der Stadt Gera keine Dohlen mehr. Im Landkreis Greiz wurde mit<br />
135 BP als Gebäudebrüter in 16 Kolonien und mit 14 BP als Baumbrüter in 2 Kolonien die größte Dichte für<br />
Thüringen ermittelt (SCHMIDT 2004). In den Jahren 2005 bis 2008 ergab die Schätzung im Rahmen des<br />
ADEBAR-Projektes 123 – 284 BP. Der effektive Brutbestand dürfte eher in der Nähe des unteren Wertes<br />
liegen. Die aktuelle Verbreitung und Häufigkeit der Dohle für das Untersuchungsgebiet kann der nachfolgenden<br />
Verbreitungskarte 14 entnommen werden.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 157
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung der Brutplätze durch Gebäudesanierung und Abriss<br />
- Verringerung des Nahrungsangebotes durch Intensivierung der Landwirtschaft, insbesondere Verlust extensiven<br />
Grünlandes, Verlust von Brachflächen und Beseitigung von Kleinstrukturen<br />
- Zunehmender Einsatz von Bioziden und Saatgutbeize<br />
- Schließung der Mülldeponien<br />
- Nistplatzkonkurrenz mit Straßentauben<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt oder Förderung einer strukturreichen Kulturlandschaft<br />
- Einschränkung des Düngemittel-, Biozid- und Beizmitteleinsatzes<br />
- Schutz geeigneter Brutplätze an Gebäuden<br />
- Erhaltung höhlenreicher Altholzbestände<br />
- Einsatz von Nisthilfen<br />
Verbreitungskarte 15: Dohle<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
4 – 7 2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
21 – 50 8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 158
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Saatkrähe – Corvus frugilegus L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Ausgestorben<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) kennt keine Brutansiedlungen in der Umgebung von Gera. LIEBE<br />
(1873) schreibt „Eine sehr kleine Colonie der Saatkrähe, bestehend <strong>aus</strong> 3 oder 4 Paaren, nistete vor zwei<br />
Jahren östlich von Großenstein an einem Nebenflüsschen der Sprotte, … und eine ganz schwache Ansiedlung<br />
von nur 2 Paaren entdeckte ich 1872 bei Neu-Gernsdorf …“ Später teilt LIEBE (1878) mit: „Colonien der<br />
Saatkrähe waren ehe<strong>dem</strong> über das ganze Gebiet zerstreut. Es gab deren grössere z.B. … Grossenstein,<br />
Ronneburg, … Sie sind sämtliche zersprengt worden, und die Krähen sind nach den nördlichen Theilen des<br />
Gebietes entwichen.“ HELLER (1926) erwähnt <strong>aus</strong> der Zeit vor 1880 eine kleine Kolonie bei Mohlsdorf.<br />
Die von LIEBE (1873) genannte „stärkere“ Kolonie bei „Borstendorf“ dürfte nicht, wie FLÖßNER (1975) zuordnet,<br />
das „Porstendorf b. Triptis“ betreffen, sondern den Ort Porstendorf an der Saale mit der dortigen Brutansiedlung<br />
auf der Rabeninsel. Auch RÖHRIG (1900) schreibt von 3000 BP bei Porstendorf und ordnet diesen<br />
Brutplatz wohl irrtümlich <strong>dem</strong> damaligen Oberamt Neustadt / Orla zu. Tatsächlich bestand bis etwa 1925<br />
eine starke Kolonie auf der Rabeninsel bei Porstendorf nördlich von Jena (UHLMANN 1940).<br />
20. Jahrhundert<br />
Bis auf folgende Ausnahme gab es keine Brutvorkommen der Saatkrähe mehr im Untersuchungsgebiet:<br />
1976 fand am Stadtrand von Greiz [Park] ein Brutversuch von 5 bis 6 Paaren statt (REISSMANN; LANGE & LEO<br />
1978). Heute sind Saatkrähen nur noch als Wintergäste anzutreffen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Direkte Verfolgung durch Abschuss, Vergiftung und Vernichtung der Brutplätze bzw. Störungen an den<br />
Brutplätzen<br />
- Verringerung des Nahrungsangebotes durch Intensivierung der Landwirtschaft, insbesondere Verlust extensiven<br />
Grünlandes, Verlust von Brachflächen und Beseitigung von Kleinstrukturen<br />
- Zunehmender Einsatz von Bioziden und Saatgutbeize<br />
- Schließung der Mülldeponien<br />
- Lebensraumverlust durch Zerstörung von Auwäldern, Altholzbeständen und Feldgehölzen in der Kulturlandschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt oder Förderung einer strukturreichen Kulturlandschaft<br />
- Einschränkung des Düngemittel-, Biozid- und Beizmitteleinsatzes<br />
- Umfassender Schutz bei möglichen Neuansiedlungen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 159
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Beutelmeise – Remiz pendulinus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Vom Aussterben bedroht, starke Abnahme,<br />
19.Jahrhundert<br />
In der uns bekannten <strong>ornithologische</strong>n Literatur finden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen der Beutelmeise<br />
im Landkreis Greiz und Gera im 19. Jahrhundert.<br />
20. Jahrhundert<br />
1987 gelang der erste Nestfund der Beutelmeise im Gessental südlich von Grobsdorf (GÜNTHER). 1988 wurden<br />
zwei Nester und wahrscheinlich drei sM am Elsteraltwasser bei Pohlitz [TK 5038 / 3] und nördlich von<br />
Caaschwitz gefunden (HAUBENREIßER 1990). In der Zeit um 1990 fand HAUBENREIßER (mündliche Mitteilung<br />
an LIEDER) bis zu 10 BP pro Jahr zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz. Weitere Brutvorkommen wurden<br />
1995 bei Baldenhain (GÜNTHER), 1996 und 1997 in Teichwolframsdorf am Bad (LANGE), 1997 am Speicher<br />
Pohlen (LANGE), 1997 im RNG Großkundorf (JAKOB, KRÜGER, LANGE), 1991 und 1992 bei Großebersdorf<br />
(BINDERNAGEL, LIEDER) und 1991 und 1998 im NSG Frießnitzer See / Struth (BECHER, LIEDER, LEO) festgestellt.<br />
Seit Mitte der 1990er-Jahre geht der Brutbestand stark zurück.<br />
21 Jahrhundert<br />
Um das Jahr 2000 schätzten LANGE & LIEDER (2001), dass nicht mehr alljährlicher 1 – 2 Paare im Untersuchungsgebiet<br />
brüten. Während einer Bestandserfassung im Jahre 2004 für Thüringen wurden nur noch 2 BP<br />
mit fertigen Nestern bei Struth gefunden (BECHER; ROST 2005).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Biotopzerstörung, insbesondere von Flussauen, Altwässern, Verlandungszonen und Gehölzbeständen an<br />
Stillgewässern (z.B. Abholzung der Teichränder bei Großebersdorf oder Abholzung aller Bäume im Hochwasserabflussprofil<br />
der Weißen Elster)<br />
- Störungen durch Freizeitaktivitäten an Gewässern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung oder Schaffung von geeigneten Feuchtgebieten und Übergangsbiotopen (Sukzessionsflächen<br />
an den Gewässerrändern)<br />
- Vermeidung von Freizeitaktivitäten in der Nähe der Brutplätze<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 160
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Haubenlerche – Galerida cristata (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Bestand zurzeit erloschen<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Haubenlerche ist nach LIEBE (1878) in den vierziger Jahren des 19.Jahrhunderts im <strong>mittleren</strong> Elstertal<br />
eingewandert und hat sich entlang der Landstraßen (!) weiter nach Süden <strong>aus</strong>gebreitet. Er schreibt weiter:<br />
„Die Nähe breiter trockener Ch<strong>aus</strong>seen ist Bedingung, wenn sie sich häuslich niederlassen, und die unmittelbare<br />
Nähe von Städten oder größeren Dörfern eine höchst willkommene Zugabe“. Bereits 1859 wird die<br />
Haubenlerche für Gera als häufiger Brutvogel erwähnt (Ornithologische Sektion Gera 1859). Nach seinen<br />
Aufzeichnungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Jahre 1881 schreibt HELLER (1926): „Bekannter und regelmäßiger Brutvogel des<br />
engeren Gebietes [Greiz und Umgebung] an Bahnböschungen, auf Bahnhöfen (Eisenbahnvogel), Brachländereien,<br />
so im Aubachthale, bei der Schäferei, an der Staatsstraße nach Elsterberg und anderen, nicht in<br />
Waldnähe liegenden Plätzen.“<br />
1900 bis 1950<br />
In der Umgebung von Hohenleuben fand HIRSCHFELD (1932) die Haubenlerche als häufigen Brutvogel. Während<br />
die Haubenlerche 1934 auf den Straßen von Auma noch zahlreich vertreten war, wurden die Vögel hier<br />
letztmalig 1946 gesehen (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971).<br />
Ab 1950<br />
1957 wurden Haubenlerchen in Weißendorf und 1965 / 66 in Zeulenroda zur Brutzeit festgestellt (FLÖßNER<br />
1977 b). Der Bestands-Tiefstand in Gera war in den 1950er-Jahren erreicht. Danach erholte sich die Haubenlerche<br />
im Umfeld zahlreicher Plattenb<strong>aus</strong>iedlungen. 1975 / 76 wurden für Gera 15 BP und für Greiz-<br />
Raasdorf 1 BP angegeben (FLÖßNER 1977 b). Von 1984 bis 1999 brüteten regelmäßig 2 – 3 BP der Haubenlerche<br />
im Wohngebiet Greiz-Reißberg (LANGE, REUTER, ZAPF). Von 1995 bis 1997 waren in Gera mindestens<br />
noch 3 – 5 BP anwesend (BAUM, MERZWEILER; GRIMM 2000). 2001 wird für Gera und Greiz noch ein Restvorkommen<br />
von jeweils 1 – 2 BP genannt (LANGE & LIEDER 2001). Während einer Brutvogelkartierung 1999<br />
bis 2003 wurde noch ein Brutplatz in der Ziegelei Aga gefunden, der gegenwärtig nicht mehr besetz ist<br />
(WEISSGERBER 2007). Die vorläufig letzen Beobachtungen im Untersuchungsgebiet gelangen im Frühjahr<br />
2002 in Gera-Lusan (FRÜHAUF), im Juni 2004 im Geraer Stadtgebiet (HÖSELBARTH), im April 2009 in Dittersdorf<br />
(NICKLAUS) und im Dezember 2009 in Gera (EISENHUTH).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 161
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust trockenwarmer, offener Flächen mit niedriger und lückiger Vegetation<br />
- Versiegelung „ungepflegter“ Offenlandflächen<br />
- Die von GRIMM (2001) genannten Faktoren, sind auch für unser Gebiet zutreffend:<br />
· Eutrophierung der Landschaft (Verschwinden von offenen Flächen)<br />
· Verinselung der Populationen<br />
· Anstieg der Prädatorendichte<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutzmaßnahmen sind nach <strong>dem</strong> Erlöschen des Bestandes nicht mehr möglich<br />
- Bei Wiederbesiedlung sind vegetationsarme Offenlandflächen zu sichern und die Prädatorendichte zu<br />
senken<br />
- Lebensraum- und Nahrungssicherung durch extensive Landwirtschaft<br />
- Verzicht auf Biozideinsatz<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 162
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Heidelerche – Lullula arborea (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Heidelerche ein häufiger Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) bezieht sich ebenfalls auf die weitere Umgebung von Gera und schreibt: „Die<br />
Zahl der letzteren ist schon seit vielen Jahren im Abnehmen begriffen. Am zahlreichsten sind sie noch im<br />
westlichen Theil des Gebiets, auf den Nadelwaldschlägen der Buntsandsteinformation, – am seltensten im<br />
östlichen Theil; im Ganzen sind sie nicht mehr häufig.“ Später beschreibt LIEBE (1878) nochmals den anhaltenden<br />
Rückgang der Art: „… sind der Haidelerchen in Ostthüringen weniger geworden. Verschiedene Bergrücken<br />
der Buntsandsteinformation, welche sich eine Achtel- bis eine Viertelmeile weit erstrecken, beherbergten<br />
vor 40 und noch vor 30 Jahren 8 bis 12 Paar und jetzt ein einziges oder keins.“ KOEPERT (1896)<br />
nennt Brutvorkommen an der westlichen Gebietsgrenze bei St. Gangloff und Hermsdorf – Bad Klosterl<strong>aus</strong>nitz.<br />
1900 bis 1950<br />
In den Kiefernheiden östlich der Saale war die Heidelerche ein häufiger Brutvogel (HILDEBRANDT 1919). Nach<br />
den Angaben von PIETZOLD brütete die Art Anfang des 20. Jahrhunderts vereinzelt auf den Höhenzügen bei<br />
Gommla, Nitschareuth, Kühdorf, Waldh<strong>aus</strong>, Caselwitz, Wellsdorf und Pöllwitz (HELLER 1926). VÖLCKEL fand<br />
1906 ein Nest bei Hohenölsen (GÜNTHER 1969). DERSCH (1925) fand die Heidelerche im Pöllwitzer Wald.<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) ist die Heidelerche bei Hohenleuben ein „nicht häufiger Brutvogel auf Waldblößen<br />
und im Heidelbeergestrüpp des Kiefernholzes, stellenweise gut vertreten“.<br />
Ab 1950<br />
Bei Münchenbernsdorf brütete die Art von 1950 bis 1954 (GERTH 1958). DANNHAUER (1963) nennt als Brutplatz<br />
Albersdorf bei Berga. GÜNTHER (1969) <strong>berichte</strong>t, dass in den 1960er-Jahren wenige Paare im Gebiet<br />
um Weida brüteten und im Sommer 1960 einige Vögel im Forst bei Ernsee gesehen wurden. GÜNTHER<br />
(1969) kann ebenfalls auf eine Brut bei Hohenölsen verweisen, die „vor mehreren Jahren“ von BAUCH gefunden<br />
wurde. LANGE & LEO (1978) nennen als Brutplätze das Gebiet zwischen Greiz-Moschwitz und Wellsdorf<br />
sowie das Forstrevier Waldh<strong>aus</strong>, wobei es max. 3 BP gewesen sein dürfen. In der Umgebung von Auma<br />
wurden in den 1960er-Jahren nur wenige BP festgestellt (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971). Bei einer<br />
Bestandserfassung 1975 / 76 wurden im Untersuchungsgebiet nur bei Zeulenroda 3 – 4 BP nachgewiesen<br />
(LORENZ, FLÖßNER 1977 c). Im Jahr 1997 stellte KLEHM 13 BP auf <strong>dem</strong> ehemaligen Truppenübungsplatz im<br />
Pöllwitzer Wald fest (ROST, FRIEDRICH & LANGE 1998). Um 2000 waren lediglich die ehemaligen Truppenübungsplätze<br />
besetzt: Pöllwitzer Wald 8 – 11 BP, Zeitzer Forst bei Lessen 2 BP und „Muna“ bei Rüdersdorf<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 163
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
1 – 3 BP (LANGE & LIEDER 2001). Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurden 18 – 27 BP erfasst,<br />
wobei besonders die Neuansiedlungen auf den ehemaligen Wismut-Bergbauflächen bei Ronneburg<br />
und Culmitzsch erwähnenswert sind (LIEDER & LUMPE Ms.), während im südlichen Bereich (ehemaliger Truppenübungsplatz<br />
im Pöllwitzer Wald) der seit Jahren durch Sukzession stark rückläufige Bestand trotz der<br />
angegebenen BP heute eher an der Grenze zum Erlöschen liegt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung und Rückgang geeigneter Bruthabitate wie Ödland, Brachflächen und Magerstandorte mit Offenbodenstellen<br />
durch Aufforstung und Sukzession der Bergbauflächen der Wismut und der ehemaligen<br />
Truppenübungsplätze<br />
- Bautätigkeit auf Brutplätzen (Erlebnispark „Weltentor“ in Ronneburg)<br />
- Intensivierung der forst- und landwirtschaftlichen Nutzung<br />
- Überdüngung von Mager- und Halbtrockenrasen<br />
- Störung durch Freizeitaktivitäten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt oder Förderung einer strukturreichen Kulturlandschaft, insbesondere Brachflächen und extensiv<br />
genutztes Weideland auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und Bergbauflächen der Wismut<br />
- Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Brutplätzen durch die Wismut-Sanierung<br />
- Einschränkung des Düngemittel- und Biozideinsatzes<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
Verbreitungskarte 16: Heidelerche<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
4 – 7 2 – 3<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 164
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Uferschwalbe – Riparia riparia (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Bestand zurzeit erloschen<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Uferschwalbe als häufigen Brutvogel in der näheren<br />
Umgebung von Gera. LIEBE (1873) stellt einen Bestandsrückgang fest: „Auch der Bestand der Uferschwalben<br />
hat sich sehr gemindert. Die Colonien dieser Thiere im Diluvial- und Alluviallehm der Elsterufer am<br />
Debschwitzer Anger, oberhalb Wolfsgefährt, bei Köstritz und unterhalb Krossen sind weit schwächer als sie<br />
noch vor 15 Jahren waren. Bei Debschwitz nisteten 1872 nur noch 8 Paare.“ LIEBE (1881) erwähnt eine Kolonie<br />
mit 25 BP bei Gera an einer Dolomitfelswand („Sandgrube Lindenthal“). Im Jahre 1893 nahm die Zahl<br />
der Brutpaare in einer Lehmgrube bei Gera-Zwötzen zu. HELLER zählte hier 234 Höhlen (LIEBE 1893; HELLER<br />
1894). Im Jahre 1894 fand HELLER (1895) in derselben Grube 155 neu angelegte Höhlen. Aus der Greizer<br />
Umgebung teilt HELLER (1926) mit: „Noch vor 50 Jahren befand sich eine kleine Kolonie dieser bei uns recht<br />
seltenen Schwalbe am ,Schaltis‘ bei Dölau.“<br />
1900 bis 1950:<br />
HELLER (1926): „Sie [die Uferschwalbe] scheint jetzt [1926] in unserer Umgebung nicht mehr zu brüten.“ In<br />
den 1930er-Jahren befand sich eine kleine Kolonie in einer Sandgrube bei Sachsenroda (GÜNTHER 1969).<br />
Ab 1950:<br />
„Noch bis 1954 brüteten Uferschwalben in einigen Paaren am Elsterufer bei der Clodramühle“ (LANGE & LEO<br />
1978). 1971 bestand Brutverdacht bei Nauendorf im nordöstlichen Teil des Landkreises Greiz und 1976 am<br />
Speicher Söllmnitz (AUERSWALD; KNORRE 1982). In den 1980er-Jahren fand BAUM eine kleine Kolonie mit nur<br />
3 BP in der Sandgrube am Sandberg bei Niederpöllnitz und Struth. Seit 1997 bestand noch eine Brutkolonie<br />
mit max. 10 BP in einer Tongrube bei Aga (LANGE & LIEDER 2001). Diese Kolonie war letztmalig im Jahre<br />
2002 besetzt (LANGE, LIEDER, SCHULZE).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung und Rückgang geeigneter Bruthabitate durch Verfüllung von Gruben bzw. Sukzession und<br />
Verwitterung an den Brutwänden (Sachsenroda, Niederpöllnitz) und Fluss<strong>aus</strong>bau der Weißen Elster<br />
- Störung durch Freizeitaktivitäten (Motocross in der Tongrube Aga)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherung von Sekundärbiotopen in Kies-, Sand- und Tongruben (Raum Aga)<br />
- Renaturierung von Flussabschnitten der Weißen Elster<br />
- Schaffung geeigneter Brutwände durch Abstechen abgeflachter Böschungen oder durch Kunstwände<br />
- Vermeidung von Störungen an bekannten Brutplätzen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 165
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rauchschwalbe – Hirundo rustica L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Rauchschwalbe ein sehr häufiger Brutvogel. LIEBE<br />
(1873) beschreibt einen Bestandsrückgang: „Die Rauchschwalbe ist im Lauf der letzten 15 Jahre seltener<br />
geworden. Vorzugsweise waren es schwere Nachwinter und Frühjahrsfröste während des Zeitraums von<br />
1859 bis 1865, welche die zu bald heimgekehrten Schwalben in die bitterste Nahrungsnoth brachten.“<br />
20. und 21. Jahrhundert<br />
Alle späteren Faunisten bezeichnen die Rauchschwalbe als verbreiteten und überall häufigen Brutvogel, u.a.<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975). In den 1960er-Jahren hatte sich die Zahl der Rauchschwalben im ehemaligen<br />
Landkreis Gera wesentlich verringert, wird aber immer noch als häufiger Brutvogel eingeschätzt<br />
(GÜNTHER 1969). BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL (1971) stellen ebenfalls eine Bestandsabnahme der Rauchschwalbe<br />
um Auma fest. Für den Altkreis Greiz registrierten LANGE & LEO (1978) nur einen geringen Rückgang.<br />
Eine Bestandserfassung in den Jahren 1980 / 81 brachte für unser Gebiet nur unzureichende Angaben:<br />
11 BP (15 BP geschätzt) in Frießnitz, 10 BP (12 BP geschätzt) in Gera-Pforten, 6 BP (15 BP geschätzt)<br />
in Collis, 40 – 50 BP (geschätzt) in 8 Ortschaften um Auma und Brutvorkommen in allen Ortschaften des<br />
Altkreises Greiz (HÖPSTEIN 1983). LANGE & LIEDER (2001) schätzen den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
auf 3.000 bis 5.500 BP und die Erfassung auf einer Fläche von 83 km² erbrachte eine Großflächendichte<br />
von 2,92 bis 5,58 BP/km². Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand auf<br />
1.009 – 2.780 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust von Brutplätzen (Verschwinden kleinbäuerlicher Betriebe und abgeschlossene Großviehställe)<br />
- Nahrungsverlust durch Intensivierung der Landwirtschaft (Aufgabe der Milchkuh- und Fleischviehhaltung)<br />
- Mangel an Nistbaumaterial durch zunehmende Versiegelung<br />
- Intensivere Grünlandnutzung mit Überdüngung und Biozideinsatz<br />
- Versiegelung der Landschaft und Ausdehnung städtischer Strukturen<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Stärkung der traditionellen extensiven Formen landwirtschaftlicher Nutzung, besonders Weideviehhaltung<br />
- Förderung des Insektenreichtums durch geringen Biozid- und Düngemitteleinsatz<br />
- Erhalt von Brach- und Ruderalflächen<br />
- Bereitstellung von Nestbaumaterial (Schlammpfützen) und künstlichen Schwalbennester<br />
- Freilassen von Einflugöffnungen an Ställen und Gebäuden<br />
- Aufklärung der Bevölkerung<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 166
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 17: Rauchschwalbe<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
51 – 150<br />
21 – 50 21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
8 – 20 21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
8 – 20 51 – 150<br />
51 – 150<br />
51 – 150 8 – 20 21 – 50<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
21 – 50 21 – 50<br />
8 – 20<br />
21 – 50 21 – 50 8 – 20 51 – 150<br />
51 – 150 8 – 20<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50 51 – 150<br />
51 – 150<br />
151 – 400 51 – 150<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 167
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Mehlschwalbe – Delichon urbicum (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Mehlschwalbe ein sehr häufiger Brutvogel. LIEBE<br />
(1873) beschreibt einen Bestandsrückgang infolge von schweren Nachwintern und Frühjahrsfrösten in den<br />
Jahren 1859 bis 1865, wovon die Art sich bis 1872 nicht erholen konnte: „Sie ist noch jetzt kaum häufig zu<br />
nennen, während sie sonst in dichten Schaaren durch die Straßen aller unserer Städte tummelte. Man<br />
kommt <strong>dem</strong> Thierchen in den Städten übrigens nicht mehr so gastfreundlich entgegen wie in früheren Zeiten<br />
und wie es auf <strong>dem</strong> Lande noch jetzt geschieht.“<br />
20. und 21. Jahrhundert<br />
Alle späteren Faunisten bezeichnen die Mehlschwalbe als verbreiteten und überall häufigen Brutvogel, u.a.<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975). GÜNTHER (1969) bemerkt eine starke Abnahme der Art und kann das Vorkommen<br />
im ehemaligen Landkreis Gera nicht mehr als häufig bezeichnen. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL<br />
(1971) stellen ebenfalls eine Abnahme fest, besonders in Auma. 1970 / 71 wurden in mehreren Orten des<br />
Altkreises Gera die Mehlschwalbenbrutpaare erfasst (GÜNTHER 1972). In 72 kontrollierten Orten konnten<br />
1.547 Nester gezählt werden, die meisten davon (199) in Zossen. LANGE & LIEDER (2001) schätzen den Gesamtbestand<br />
auf 2500 bis 4500 BP und eine Erfassung auf einer Fläche von 84 km² erbrachte eine Großflächendichte<br />
von 2,73 bis 4,52 BP/km². Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand<br />
auf 1.181 – 3.227 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung von Nestern und Verluste von Brutplätzen (Beispiele: die größte bekannte Kolonie von Mehlschwalben<br />
im Landkreis Greiz nach Sanierungsarbeiten der Wismut befand sich in einem Bauernhof in<br />
Zossen und zählte 178 BP im Jahr 1978 (AUERSWALD, LIEDER). Ein weiteres Brüten wurde nach 1990<br />
durch Anbringen von Gittern zur Abwehr der Schwalben dauerhaft verhindert; in Raitzhain befand sich eine<br />
Kolonie von 24 BP. Durch Sanierungsarbeiten im Jahre 1996 wurde eine Wiederansiedlung verhindert)<br />
- Mangel an Nistbaumaterial (Lehm) durch zunehmende Versiegelung der Landschaft<br />
- Rückgang der Insektennahrung<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Anbringung von Kunstnestern<br />
- Aufklärung der Bevölkerung<br />
- Bereitstellung von Nestbaumaterial (Schlammpfützen) und künstlichen Schwalbennester<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 168
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 18: Mehlschwalbe<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
51 – 150<br />
21 – 50<br />
51 – 150 8 – 20 51 – 150<br />
21 – 50<br />
51 – 150 51 – 150<br />
51 – 150<br />
21 – 50 21 – 50<br />
51 – 150<br />
51 – 150<br />
51 – 150<br />
4 – 7 8 – 20 51 – 150 8 – 20<br />
21 – 50 21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50 21 – 50 8 – 20 151 – 400<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50 51 – 150<br />
21 – 50<br />
51 – 150<br />
51 – 150<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 169
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schlagschwirl – Locustella fluviatilis (Wolf)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
HELLER (1926) traf den Schlagschwirl an der Mündung der Göltzsch südlich von Greiz an: „Dieser sehr seltene<br />
Vogel brütete 1874 in einem Paar oberhalb des Papiermühlenwehres, später habe ich ihn nicht wiedergefunden.“<br />
Ob es wirklich ein Brutnachweis war, muss offen bleiben. LIEBE (1878) beobachtete je ein sM<br />
1875 und 1876 im Göltzschtal. Danach sind 100 Jahre lang keine weiteren Feststellungen mehr vom<br />
Schlagschwirl dokumentiert worden.<br />
20. und 21. Jahrhundert<br />
Die P<strong>aus</strong>e dauerte bis 1976, als vier sM auf den Hammerwiesen im Greizer Park festgestellt wurden und<br />
Brutverdacht geäußert wurde (LANGE & LEO 1978; TOLKMITT 1979). Die folgende Übersicht zeigt die weitere<br />
Bestandsentwicklung bis 2009 (PETER 1980, LIEDER 2001, Datenbank VOOG), wobei die Nachweise hauptsächlich<br />
auf der Beobachtung sM basieren:<br />
Jahr 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987<br />
n 4 2 1 2 0 3 1 1 1 3 2 0<br />
Jahr 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />
n 1 2 6 1 2 5 3 4 5 20 36 22<br />
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
n 17 16 13 16 15 31 34 14 8 8<br />
Die Beobachtungen erfolgten vorwiegend an der Weißen Elster und einiger ihrer Nebenbäche, in Verlandungszonen<br />
kleinerer Teiche, auf Schilfwiesen und an Kleinspeichern mit Uferbewuchs. Im Rahmen des<br />
ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand auf 42 – 70 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Zerstörung von Feuchtgebieten (Trockenlegung der Culmitzsch-Aue) und Ausräumung<br />
der Landschaft<br />
- Zu frühe Mahd an Gehölz- und Gewässerrändern (Elsterufer zwischen Gera und Caaschwitz)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung von Feuchtgebietslebensräumen mit Hochstaudenfluren und Röhrichtzonen an Gewässerrändern<br />
- Mahdtermine am Elsterufer nicht vor Ende August<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 170
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 19: Schlagschwirl<br />
4 – 7 2 – 3<br />
1<br />
1<br />
8 – 20<br />
4 – 7 2 – 3<br />
1<br />
1 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
4 – 7 1<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 171
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Rohrschwirl – Locustella luscinioides (Savi)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Streng geschützt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Der Rohrschwirl wird von keinem Faunisten erwähnt.<br />
20. Jahrhundert<br />
Selten einmal werden singende Rohrschwirle zur Brutzeit gehört: 1973 auf der Leibewiese bei Dorna (BAUM;<br />
LANGE & LIEDER 2001), 1983 bis 1985 (1985 zwei Altvögel) am Frießnitzer See (BAUM; LANGE 1988; LANGE &<br />
LIEDER 2001), 1990 im RNG Großkundorf (LANGE, MÜLLER; KRÜGER 1996), 1994 in der Culmitzsch-Aue<br />
(LANGE; ROST, FRIEDRICH, & LANGE 1995) Begründeter Brutverdacht bestand nur bei den Beobachtungen von<br />
1985 am Frießnitzer See. Bei den anderen Beobachtungen muss der Status der Vögel offen bleiben.<br />
21. Jahrhundert<br />
Ein singender Rohrschwirl zur Brutzeit wurden des weiteren 2004 im Teichtal bei Münchenbernsdorf gehört<br />
(MERZWEILER; ROST 2005). Auch hier kann keine Aussage zum Status erfolgen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Zerstörung von Feuchtgebieten und Röhrichtzonen (Culmitzsch-Aue und RNG<br />
Großkundorf)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung von Feuchtgebieten mit <strong>aus</strong>gedehnten Röhrichtzonen, insbesondere Schilf<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 172
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schilfrohrsänger – Acrocephalus schoenobaenus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr. 11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Streng geschützt<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
NACH BREHM (1820 – 22) brüten jährlich 1 – 2 Paare am Frießnitzer See. LIEBE (1873) führt zum Vorkommen<br />
um Gera folgendes <strong>aus</strong>: „Der Schilfsänger wird schon von Chr. L. Brehm als Anwohner des Frießnitzer Sees<br />
aufgeführt. Ich habe ihn zwar dort lange nicht mehr gesehen, aber Herr Dr. Rud. Müller P. schreibt mir, dass<br />
er noch dort brüte. Dagegen brüten im engeren Gebiet 1870 einige Pärchen in einem Teich bei Kauern, im<br />
weiteren Gebiet neuerdings auch bei Münchenbernsdorf und Großebersdorf.“ An drei Ausschachtungen<br />
neben der Eisenbahn im Elstertal bei Gera fand LIEBE (1875) im Jahre 1873 ein Brutpaar. LIEBE (1878) teilt<br />
mit: „Der Ufersänger findet sich durch das ganze Gebiet ... Der trotz unseres Reichtums an Teichen geringe<br />
Bestand, der nur im äussersten Nordosten etwas stärker erscheint, ist die ganze Zeit her derselbe geblieben.“<br />
Nach BRETSCHNEIDER (1883) soll die Art im Göltzschtal vorgekommen sein.<br />
20. Jahrhundert<br />
Spätere Beobachtungen und Brutvorkommen fehlen bis 1953. Am 04.06.1954 wurde ein Vogel bei<br />
Wenigenauma festgestellt (WILLINGSHOFER; GÜNTHER 1973). Weitere sM wurden am 16.05.1967 an den<br />
Röpsener Teichen und am 31.05.1973 an den Reichenbacher Teichen wahrgenommen (BAUM). Der Status<br />
dieser Vögel muss offen bleiben. Nach 1990 bestand in einzelnen Jahren Brutverdacht: Schilfwiese Struth 1<br />
– 3 Paare, Weiderteich 1 Paar, Speicher Letzendorf 1 Paar (LANGE & LIEDER 2001).<br />
21. Jahrhundert<br />
Weitere Brutnachweise: 1 BP 2003 in Greiz-Dölau, Goldene Aue (FRÜHAUF; ROST 2004); 1 BP 2004 am<br />
St<strong>aus</strong>ee Greiz-Sachswitz, unfertiges Nest, (FRÜHAUF; ROST 2005); Brutverdachte: 2002 und 2003 im NSG<br />
Frießnitzer See / Struth (LIEDER; ROST 2003, 2004), 2005 (mehrfach 3 sM im Mai / Juni) und 2006 (2 sM) am<br />
Weiderteich (BECHER, HALBAUER, KANIS, LANGE, LUMPE, MÜLLER, SCHUSTER; ROST 2006, 2007); Beobachtungen<br />
sM zur Brutzeit deuten auf weitere Vorkommen hin: 21.05.2005 Kläranlage Korbußen (LIEDER; ROST<br />
2006), 13.05.2007 Dorfteich Wolfersdorf (MÜLLER; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008), 14.06.2008 Schafteich<br />
Greiz-Untergrochlitz (LANGE; LUMPE & LIEDER 2009) und 12.05.2009 Weiderteich (LUMPE). Auch bei dieser<br />
Art fehlt eine gezielte Nachsuche.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Zerstörung von Feuchtgebieten und Röhrichtzonen (RNG Großkundorf, Kläranlage<br />
Korbußen, Speicher Letzendorf)<br />
- Störungen durch Freizeitaktivitäten und Kormoranvergrämung (Weiderteich)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung von Feuchtgebieten mit <strong>aus</strong>gedehnten Röhrichtzonen, insbesondere Schilf<br />
- Keine Freizeitaktivitäten an wichtigen Brutgewässern<br />
- Renaturierung von Abschnitten der Weißen Elster, Anbindung der Altwässer (z.B. Pohlitz, Wünschendorf)<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 173
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Drosselrohrsänger – Acrocephalus arundinaceus (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens: Stark gefährdet<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Streng geschützt<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera: Unregelmäßiger Brutvogel, Wiederbesiedlung 2009<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) führt folgende Brutplätze bei Gera an: „Ein Pärchen der Rohrdrossel brütete 1868 in <strong>dem</strong> schilfreichen<br />
Teiche südöstlich bei Laasen, also noch im engeren Gebiet. Auch am Frießnitzer See habe ich sie<br />
zur Brutzeit beobachtet, und Herr Dr. Rud. Müller P. <strong>berichte</strong>t mir, dass sie noch jetzt als seltener Bewohner<br />
des Teichgebietes von Frießnitz aufzuführen ist.“ An drei Ausschachtungen neben der Eisenbahn im Elstertal<br />
bei Gera fand LIEBE 1873 drei BP (LIEBE 1875). LIEBE (1878) schreibt: „Vor 25 Jahren und früher gab es<br />
im <strong>mittleren</strong> und südlichen Ostthüringen noch keine Drosselsänger (Rohrdrosseln), wie ich mit Bestimmtheit<br />
behauten kann, und Ch. L. Brehm hebt in seinem schon oben angeführten, 1834 erschienen Werk (I, 442)<br />
<strong>aus</strong>drücklich als nächste Brutplätze für die eine Varietät den Eislebener See und für die andern Oberlödla<br />
bei Altenburg hervor. Seit dieser Zeit sind diese Vögel … immer weiter nach West und Süd vorgedrungen,<br />
so dass sie jetzt bis an die Vorberge des Frankenwaldes hin wohnen und sich nach erfolgter Einwanderung<br />
allenthalben langsam mehren.“<br />
20. Jahrhundert<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fehlte der Drosselrohrsänger offensichtlich (HIRSCHFELD 1932).<br />
1951 hörte PIETZOLD ein sM am Parksee in Greiz (LUMPE 2008 c). Um 1960 erfolgte dann eine erneute Besiedlung<br />
des Gebietes bei Röpsen, bei Nauendorf im nordöstlichen Teil des Landkreises Greiz und am Großen<br />
Teich bei Kauern (GÜNTHER 1969). In den Jahren 1958 / 59 brüteten am Großen Teich bei Kauern 3 BP<br />
(GÜNTHER; LIEDER & GÜNTHER 2002). Letztmalig in dieser Besiedlungsphase wurde 1965 1 BP an den<br />
Röpsener Teichen festgestellt und ein sM wurde noch am 08.06.1968 dort gehört (BAUM). Danach fehlen<br />
weitere Brutdaten bis 1988, als sich 1 – 2 BP im RNG Großkundorf ansiedelten (LANGE, MÜLLER). In den<br />
1990er-Jahren war der Drosselrohrsänger wieder unregelmäßiger Brutvogel im RNG Großkundorf, bei<br />
Teichwolframsdorf und an den Reichenbacher Teichen (M. LANGE; LANGE & LIEDER 2001).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 174
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
21. Jahrhundert<br />
Am 07.07.2009 gelang vom Drosselrohrsänger ein Nestfund mit Gelege (AUERSWALD, BECHER) und am<br />
09.08.2009 die Beobachtung eines Futter tragenden Altvogels am Weiderteich bei Niederpöllnitz (MÜLLER).<br />
Feststellungen von 1 – 4 sM in der Zeit vom 17.04. bis 26.07.2009 am gleichen Gewässer deuten auf weitere<br />
BP hin (BECHER, KANIS, LANGE, LUMPE, MÜLLER, SCHUSTER, SEEMANN). Begründeter Brutverdacht bestand<br />
an folgenden Orten: 2002 am Frießnitzer See (LANGE, MÜLLER), 2005 am Weiderteich (HALBAUER, LANGE,<br />
LUMPE, MÜLLER), 2006 und 2007 am Burkersdorfer Feldteich (LIEDER, LUMPE, SIMON), 2004, 2006, 2007,<br />
2008 und 2009 am Großen Teich bei Kauern (BECHER, HÖSELBARTH, LANGE, LIEDER, LUMPE, MERZWEILER,<br />
MÜLLER, SCHUSTER) und 2009 im RNG Gessenhalde bei Kauern (HÖSELBARTH, HOFFMANN, REICHARDT).<br />
Einmalige Beobachtungen von sM gab es 2002 an den Reichenbacher Teichen (LANGE), 2004 bei Grobsdorf<br />
(BECHER), 2005 bei Caaschwitz (BECHER), 2007 am Speicher Baldenhain (LIEDER), an den Hammerwiesenteichen<br />
im Greizer Park (MÜLLER) und an der Weißen Elster bei Meilitz (BECHER), 2008 an den Schafteichen<br />
bei Greiz-Untergrochlitz (LANGE) und 2009 an einem Kleinteich NW von Paitzdorf (KRAFT), im RNG<br />
Gessenhalde bei Kauern (HÖSELBARTH, GRAUPNER) und am Strandbad Aga (GEHROLDT). Zumindest bei einem<br />
Teil der genannten Orte sind Brutvorkommen möglich. Es wurde aber nicht intensiv genug danach gesucht.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Zerstörung von Feuchtgebieten und Röhrichtzonen (RNG Großkundorf)<br />
- Störungen durch Freizeitaktivitäten und Kormoranvergrämung (Weiderteich)<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit verstärkter Nutzung der Ufersäume<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung von Feuchtgebieten mit <strong>aus</strong>gedehnten Röhrichtzonen, insbesondere Schilf<br />
- Keine Freizeitaktivitäten an wichtigen Brutgewässern<br />
- Verbesserung der Wasserqualität an den Brutgewässern durch geringeren Dünger- und Pflanzenschutzmitteleintrag<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 175
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Sperbergrasmücke – Sylvia nisoria (Bechstein)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1824) sah und erlegte nur einmal eine Sperbergrasmücke bei Renthendorf. LIEBE (1873) kannte<br />
folgende Brutvorkommen: „... nistet in drei bis vier Paaren regelmäßig im Weidathal zwischen Weida und<br />
Zeulenroda. Außer<strong>dem</strong> habe ich sie zur Nistzeit im Agaischen Forst gesehen.“ Später schreibt er: „... recht<br />
unstäter Brutvogel ...; 1867 und das folgende Jahr im Agaischen Laubwald nördlich bei Gera; 1870 bis 1872<br />
im Weidathal oberhalb Loitsch, wo er durch den Eisenbahnbau vertrieben wurde; …“ (LIEBE 1878).<br />
1900 bis 1950<br />
Bei Pohlitz [TK 5038 / 3] wurde am 20.Juni 1902 ein Nest der Sperbergrasmücke mit einem jungen Kuckuck<br />
gefunden (FEUSTEL 1903). An diesem Ort wurde die Sperbergrasmücke in den folgenden Jahrzehnten noch<br />
mehrfach von SCHNAPPAUF beobachtet (GÜNTHER 1969). Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnen<br />
auch HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) die Art als unsteten Brutvogel für die Gegend von Altenburg und<br />
Ronneburg, der in manchen Jahren recht häufig auftritt und in anderen Jahren ganz fehlt.<br />
Ab 1950<br />
GERTH (1958) fand ein Nest um 1952 bei Münchenbernsdorf. GÜNTHER (1969) führt Beobachtungen <strong>aus</strong><br />
<strong>dem</strong> Zaufensgraben bei Gera und von Nauendorf im nordöstlichen Teil des Landkreises Greiz an. Bei<br />
Nauendorf gelang 1976 ein Brutnachweis (ZÖRNER; ÖLSCHLEGEL 1978). Brutzeitbeobachtungen gelangen<br />
nach ÖLSCHLEGEL (1978) in den Jahren 1971, 1972, 1974 bei Frankenau (ZÖRNER) sowie 1975, 1976 bei<br />
Gera-Roschütz (SCHMEISSER). Nach LANGE & LIEDER (2001) brütet die Sperbergrasmücke jetzt regelmäßig<br />
im Gebiet mit einem Gesamtbestand von 3 – 10 BP. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde<br />
der Bestand auf 13 – 15 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Ausräumung der Landschaft<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft<br />
- Einsatz von Bioziden mit direkten und indirekten Auswirkungen<br />
- Freizeitaktivitäten an Brutplätzen (Weinleite bei Gera-Pforten)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung reich strukturierter Feldgehölze<br />
- Dornbüsche und Dickichte in extensiv genutzten Wiesenflächen<br />
- Vermeidung von Freizeitaktivitäten an Brutplätzen<br />
- Schaffung neuer Lebensräume im Rahmen der Sanierung von Bergbauflächen der Wismut<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 176
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Verbreitungskarte 20: Sperbergrasmücke<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 2 – 3<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 177
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Zwergschnäpper – Ficedula parva (Bechstein)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Vermutlich regelmäßiger spärlicher Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) teilt mit: „Musicapa [sic] parva habe ich noch nicht beobachten können.“ HILDEBRANDT & SEMM-<br />
LER (1975) halten die von NAUMANN (1897 – 1905) mitgeteilten Beobachtungen bei Eisenach, Gera und<br />
Rüdigsdorf für unsicher. Da im Geraer Stadtwald (Hainberg / Weinberg) ab 1964 immer wieder Zwergschnäpper<br />
beobachtet wurden, erscheint die Mitteilung doch glaubhaft.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) soll vor 1932 der Zwergschnäpper einmal bei Gera beobachtet worden sein: „Nach<br />
zuverlässigen Angaben soll er sich im Küchengarten und in der Küchengartenallee (Gera) aufgehalten haben.“<br />
Ab 1950<br />
1964 wurde ein Brutversuch auf <strong>dem</strong> Weinberg bei Gera festgestellt (GÜNTHER, PIETRUSKY; GÜNTHER 1969).<br />
1985 konnte BAUM den Zwergschnäpper zur Brutzeit im NSG Buchenberg bei Weida beobachten. Singende<br />
Männchen wurden nach LANGE & LIEDER (2001) in den 1980er- und 1990er-Jahren in vier Gebieten beobachtet:<br />
Weinberg bei Gera (PETRUSKY, SCHULZE), Gänseberg bei Bad Köstritz 1983 (SCHULZE; LANGE<br />
1988), Wald östlich von Negis (BAUM) und zwischen Greiz und Waldh<strong>aus</strong> (FG Greiz). Lediglich 1997 wurde<br />
ein Brutnachweis am Laagweg / Viehut bei Greiz erbracht (REISSMANN; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1998).<br />
Singende Männchen, zum Teil über längere Zeiträume, wurden in den letzten Jahren an folgenden Orten<br />
beobachtet: 2001 in Neumühle (Lange, Solbrig; Rost 2002), 2002 am Laagweg / Viehut bei Greiz (LANGE,<br />
REIßMANN; ROST 2003) und am Weinberg bei Gera (LIEDER; ROST 2003), 2003 am Hainberg bei Gera<br />
(HÖSELBARTH, LANGE, LIEDER, WIESNER), 2004 im Gommlaer Wald bei Greiz (MOTSCHMANN; ROST 2005),<br />
2005 am Laagweg / Viehhut mit Brutverdacht (REIßMANN; ROST 2006), 2006 im Pöllwitzer Wald (LANGE; ROST<br />
2007) und 2009 im NSG Buchenberg bei Weida (LIEDER).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust naturnaher alt- und totholzreicher Wälder durch intensive Forstwirtschaft mit frühen Umtriebszeiten<br />
und zu konsequenter Durchforstung<br />
- Mangel an Bruthöhlen durch Entfernung von alten, höhlentragenden Bäumen<br />
- Einsatz von Bioziden mit direkten und indirekten Auswirkungen<br />
- Freizeitaktivitäten an Brutplätzen (Weinleite bei Gera-Pforten)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz bzw. schonende Bewirtschaftung alter, naturnaher Laubmischwälder sowie deutliche<br />
Erhöhung der Umtriebszeiten<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 178
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Halsbandschnäpper – Ficedula albicollis (Temminck)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Unregelmäßiger Brutvogel, Bestand zurzeit erloschen<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) macht als erster auf den Halsbandschnäpper aufmerksam: „Voriges Jahr sah ich zur Nistzeit<br />
ein Paar an der Kosse und fand ihr Nest in einer ganz niedrigen Kopfeiche und darin die kennzeichnenden<br />
gefleckten Eier. Auch ward mir im Sommer 1872 ein Junger gebracht, den ich für diese Art hielt …“ In seiner<br />
späteren Arbeit teilt LIEBE (1878) mit: „Bei uns halten sich einzelne oft 8 Tage lang auf, singen dabei, als ob<br />
sie dableiben wollten, und sind dann plötzlich verschwunden. Namentlich bevorzugen sie dabei gewisse<br />
Localitäten, wie z. B. die nächste Umgebung des Schlossteiches im Tinzer Park bei Gera, wo sie sich gern<br />
auf die Planken am Teichrand setzen, oder gewisse Parktheile bei Greiz … Er brütete nämlich ein einziges<br />
Mal (1871) auf der Kosse unterhalb Gera ... Ein anderer junger Vogel dieser Art, der mir gebracht wurde,<br />
konnte möglicher Weise von weiter her verflogen sein.“<br />
1900 bis 1950:<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) soll die Art bei Neumühle gebrütet haben. Etwa 1934 bis 1936 brütete für 2 oder 3<br />
Jahre ein Paar in einem Nistkasten bei Weida (PRASSE; KNEIS & LANGE 1990).<br />
Ab 1950:<br />
1966 brütete ein Paar am westlichen Stadtrand von Gera, wobei unklar blieb, ob dass Weibchen ein Halsbandschnäpper<br />
oder ein Trauerschnäpper war (BINDERNAGEL; GÜNTHER 1968). Bei einer weiteren Mischbrut<br />
1970 im Ronneburger Forst (GÜNTHER; BARNIKOW 1978) wurden im Nachgang Zweifel an der sicheren Bestimmung<br />
des Halsbandschnäpperweibchens geäußert (KNEIS & LANGE 1990). Von 1980 bis 1989 (außer<br />
1982) wurden alljährlich sM im Greizer Park beobachtet und 1984 ein Brutnachweis erbracht (KNEIS & LANGE<br />
1990). Singende Männchen wurden auch 1990 und 1992 sowie ein Hybridmännchen (F. albicollis x F.<br />
hypoleuca) 2002 im Greizer Paar beobachtet (LUMPE 2008 c). Weitere sM ohne Brutverdacht wurden 1967<br />
im Pölziger Wald (GÜNTHER 1968), 1969 im Brunnenholz bei Ronneburg (GÜNTHER 1969), 1974 in Waldh<strong>aus</strong><br />
bei Greiz (LUMPE, REISSMANN; LANGE & LEO 1978), 1982 bei Greiz-Obergrochlitz (MACHOLD; KRÜGER 1985 b)<br />
und 1995 im Geraer Stadtwald (M. LANGE, SCHULZE) sowie am Laagweg bei Greiz (REIßMANN) festgestellt.<br />
Einen Brutnachweis gab es 2009 zwischen Greiz-Moschwitz und Noßwitz im benachbarten Sächsischen<br />
Vogtland direkt an der Grenze zum Landkreis Greiz. Von dort stammt auch die Aufnahme vom oben abgebildeten<br />
Männchen (LEO).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 179
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust naturnaher alt- und totholzreicher Wälder durch intensive Forstwirtschaft mit frühen Umtriebszeiten<br />
sowie zu konsequenter Durchforstung<br />
- Verlust von Streuobstbeständen und Kopfbäumen<br />
- Mangel an Bruthöhlen durch Entfernung von alten, höhlentragenden Bäumen<br />
- Einsatz von Bioziden mit direkten und indirekten Auswirkungen<br />
- Hohe Verluste durch Prädatoren<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz oder schonende Bewirtschaftung alter, naturnaher Laubmischwälder sowie deutliche<br />
Erhöhung der Umtriebszeiten<br />
- Erhaltung und Schutz alter Streuobstbestände und Neuanlage<br />
- Reduktion des Biozideinsatzes<br />
- Angebot von künstlichen Nisthilfen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 180
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Braunkehlchen – Saxicola rubetra (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Gefährdet<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme nach starkem Rückgang<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) brütet das Braunkehlchen häufig „in den Weidengebüschen<br />
längs der Elster“ bei Gera. Demgegenüber macht LIEBE (1873) folgende Angaben zum Vorkommen: „Der<br />
braunkehlige Wiesenschmätzer (Wiesensänger) ist zwar während der Zugzeiten Wochen hindurch in großer<br />
Menge im Gebiet anzutreffen, nistet aber sehr selten bei uns, und zwar auf den Wiesen der flacheren<br />
Seitenthäler. In der Elsterau habe ich brütende Paare noch nie gesehen.“ LIEBE (1878) stellt jetzt eine Zunahme<br />
fest: „… seine Zahl aber steigt seit 15 Jahren langsam, in den letzten Jahren schneller. Während er<br />
früher in den Auen des unteren Elster- und Saalthals recht selten aufzufinden war, h<strong>aus</strong>en jetzt daselbst<br />
ziemlich viele, so dass man etwa auf eine Viertel- oder höchstens halbe Stunde Wegs ein Pärchen rechnen<br />
kann. Aehnlich verhält es sich im Sprotte- und Pleißethal. Weiter südwärts wird er rasch seltener und brütet<br />
im gebirgigen Süden gar nicht mehr.“ HELLER (1926) führt für die Zeit vor 1881 <strong>aus</strong>: „Nicht häufiger, aber<br />
regelmäßiger Brutvogel auf den Elsterwiesen bei Rothenthal, Dölau, Elsterberg. Scheint zugenommen zu<br />
haben.“<br />
1900 bis 1950:<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) war das Braunkehlchen ein ziemlich häufiger Brutvogel um Hohenleuben.<br />
Ab 1950:<br />
Um 1960 setzte ein starker Bestandsrückgang ein. GÜNTHER (1969) teilt mit: „Es [das Braunkehlchen] ist<br />
inzwischen recht selten geworden und nur im Nordosten des Gebietes noch regelmäßiger Brutvogel mit<br />
höchstens 10 Paaren geblieben. Vor zehn Jahren gab es noch das Fünffache des heutigen Bestands.“ Nach<br />
BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971) ist das Braunkehlchen ein regelmäßiger Brutvogel in einigen Paaren<br />
um Auma (Leschke, Wöhlsdorfer Grund und „Himmelreich“). LANGE & LEO (1978) geben den Bestand Ende<br />
der 1970er-Jahre im Altkreis Greiz mit weniger als 20 BP an. In den Jahren 1975 / 76 wurde der Bestand mit<br />
folgen<strong>dem</strong> Ergebnis erfasst (ZSCHIEGNER 1977): Altkreis Gera: Großenstein – Korbußen 4 – 5 BP 1975,<br />
Bethenh<strong>aus</strong>en – Sachsenroda 1 BP 1975 (1957 – 1962 hier mehr als 5 BP), Weiderteich – Frießnitz etwa 5<br />
BP bis 1967, danach Rückgang auf 1 – 2 BP 1975; Altkreis Greiz: geschätzt ca. 40 BP 1976; Altkreis<br />
Zeulenroda: bei Auma ca. 6 BP um 1975, bei Krölpa 2 – 3 BP 1974; bei Zeulenroda als Brutvogel verschwunden.<br />
LANGE & LIEDER (2001) schätzen den Bestand in den 1990er-Jahre auf 2 – 4 BP an verschiedenen<br />
Plätzen ein, die nicht alljährlich belegt sind: Frießnitzer See 1 – 3 BP, Weiderteich 1 BP, Tongrube Aga<br />
1 – 2 BP, Kläranlage Korbußen 1 BP, Speicher Pohlen 1 BP, Pöllwitzer Wald 1 BP, Dorna 1 BP, RNG<br />
Großkundorf<br />
1 BP, Reust 1 BP und Reudnitz 2 BP. Im Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand<br />
auf 17 – 23 BP geschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 181
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust und erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Umwandlung extensiver Grünlandflächen<br />
in Intensivgrünland, durch Aufforstung von Grünlandflächen sowie durch großräumige Landwirtschaft<br />
- Verlust von Brutplätzen durch Aufforstung sanierter Bergbauflächen der Wismut<br />
- Verstärkte Düngung und zu frühe und zu häufige Mahd<br />
- Drainage von Feuchtwiesen<br />
- Aufgabe der extensiven Nutzung<br />
- Rückgang der Nahrung durch Biozideinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz von Feuchtwiesen (NSG Frießnitz / Struth) oder Wiedervernässung ehemaliger<br />
Feuchtgebiete (z.B. Leschke bei Auma)<br />
- Erhaltung (keine Aufforstung) und extensive Nutzung von sanierten Bergbauflächen der Wismut<br />
- Extensive Grünlandbewirtschaftung<br />
- Reduktion des Biozideinsatzes<br />
Verbreitungskarte 21: Braunkehlchen<br />
2 – 3 4 – 7<br />
1<br />
1<br />
1 1<br />
2 – 3 1 1 2 – 3<br />
1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 182
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Schwarzkehlchen – Saxicola rubicola (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Stark gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) fand das Schwarzkehlchen als Brutvogel im Saale-, Orla- und Rodatal. In seiner Sammlung<br />
befinden sich viele Stücke u.a. <strong>aus</strong> Renthendorf und <strong>dem</strong> Rodatal (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) brütet das Schwarzkehlchen „selten bei Liebschwitz an der<br />
Elster.“ LIEBE (1873) führt <strong>aus</strong>: „Sie brüten sehr vereinzelt im südlichen Theil des Gebietes auf steinigen und<br />
felsigen Lehden des Schiefer- und Grauwackengebirges.“ LIEBE (1878) stellt fest, dass das Schwarzkehlchen<br />
„noch seltener“ geworden ist. HELLER (1926) hat die Art bis 1881 zur Brutzeit in „Grochlitz –<br />
Moschwitz und bei Mohlsdorf“ beobachtet.<br />
20. Jahrhundert<br />
Aus diesem Zeitraum gibt es keine Mitteilungen über Brutvorkommen.<br />
21. Jahrhundert<br />
Seit 2004 hat das Schwarzkehlchen die ehemaligen Bergbauflächen der Wismut besiedelt. Brutnachweise<br />
von je 1 BP gab es 2004, 2005 und 2006 im RNG Culmitzsch (JAKOB, LANGE) sowie 2007 und 2008 ebenfalls<br />
im RNG Culmitzsch (JAKOB, LANGE; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008; LUMPE & LIEDER 2009). Je 1 BP siedelte<br />
2007 und 2008 bei Korbußen (REICHARDT; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008; LUMPE & LIEDER 2009), je<br />
1 BP wurde 2007 und 2008 im RNG Gessenhalde bei Ronneburg nachgewiesen (BECHER, HOFFMANN,<br />
HÖSELBARTH, GRAUPNER, LIEDER, LUMPE; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008; LUMPE & LIEDER 2009). 2 BP brüteten<br />
2008 auf der Fläche der ehem. Spitzkegelhalden der Wismut bei Paitzdorf (KRAFT, MENGEL; LUMPE & LIEDER<br />
2009). 1 BP mit Jungen konnte 2009 im RNG Finkenbach bei Friedmannsdorf festgestellt werden (KANIS,<br />
LANGE, LUMPE).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust und erhebliche Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Umwandlung extensiver Grünlandflächen<br />
in Intensivgrünland, durch Aufforstung von Grünlandflächen sowie durch großräumige Landwirtschaft<br />
- Verlust von Brutplätzen durch Aufforstung sanierter Bergbauflächen der Wismut<br />
- Verstärkte Düngung und zu frühe und zu häufige Mahd<br />
- Aufgabe der extensiven Nutzung<br />
- Rückgang der Nahrung durch Biozideinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung (keine Aufforstung) und extensive Nutzung von sanierten Bergbauflächen der Wismut<br />
- Extensive Grünlandbewirtschaftung<br />
- Reduktion des Biozideinsatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 183
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Blaukehlchen – Luscinia svecica (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologischen Sektion Gera (1859) schreibt: „Nistend noch nicht beobachtet, obschon anzunehmen.“<br />
Dazu äußert LIEBE (1873) folgendes: „Das Blaukehlchen, von <strong>dem</strong> der Bericht 1859 sagt, es brüte wahrscheinlich<br />
bei uns, gehört nach meinen und nach allen andern Beobachtungen, die mir zugänglich geworden,<br />
nicht zu den Brutvögeln unseres Gebiets.“ HELLER (1926) bezweifelt Brutvorkommen im Elstertal bei<br />
Greiz: „Soll früher in der Nähe der <strong>Verein</strong>sbrauerei beobachtet worden sein und im Steinicht sogar vor <strong>dem</strong><br />
Bau der Weischlitzer Bahn gebrütet haben. Es handelt sich aber wohl nur um Durchzügler, da die genannten<br />
Stellen sich als Brutplätze kaum eignen dürften.“ Ein Brüten ist in unserem Gebiet zu dieser Zeit nicht belegt.<br />
20. Jahrhundert<br />
Der erste sichere Brutnachweis gelang 1994 am Frießnitzer See (BAUM; ROST, FRIEDRICH, & LANGE 1995).<br />
Brutzeitnachweise gab es 1999 am Speicher Letzendorf (SCHOLZ) und am Hainteich Aga (LIEDER; LANGE &<br />
LIEDER 2001).<br />
21. Jahrhundert<br />
Nach der Jahrt<strong>aus</strong>endwende sind folgende Vorkommen bekannt geworden: ein sM und zusätzlich 1 BP<br />
2000 und wiederum ein sM 2001 am Frießnitzer See (LANGE, LIEDER, LUMPE, SIMON; LANGE & LIEDER 2001),<br />
1 BP 2002 am Frießnitzer See (MÜLLER, SCHUSTER), ein sM und zusätzlich 1 BP 2008 im RNG Gessenhalde<br />
bei Ronneburg (GRAUPNER, HÖSELBARTH, LIEDER; LUMPE & LIEDER 2009), 1 BP 2009 bei Korbußen<br />
(REICHARDT), wobei im letzteren Fall der männliche Brutpartner möglicherweise ein Rotsterniges Blaukehlchen<br />
war. Die genaue Bestimmung der Subspezies, L. s. svecica oder L. s. cyanecula war nicht möglich.<br />
Dazu sei auch auf LIEBE (1873) verwiesen: „Ich bemerke hier, daß eine schöne Cyanecula Wolffi<br />
[Rotsterniges Blaukehlchen], welche <strong>aus</strong> meinem Besitze in den des Herren VON KNEISENBERG überging,<br />
sich nach <strong>dem</strong> Bericht des letztgenannten Herrn in eine C. leucocyana [Weißsterniges Blaukehlchen]<br />
umm<strong>aus</strong>erte.“ Auch ROST & GRIMM (2004) weisen darauf hin, dass das „Vorhandensein des roten Kehlfleckes<br />
in gar nicht so seltenen Fällen auch bei cyanecula nachgewiesen“ wurde.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 184
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust von Feuchtwiesen mit Röhricht, Drainage von Feuchtwiesen<br />
- Sukzessionsbedingte Lebensraumverluste<br />
- Verlust von Brutplätzen durch Aufforstung sanierter Bergbauflächen der Wismut<br />
- Ausbau von Kleingewässern zu intensiv genutzten Fischteichen<br />
- Rückgang der Nahrung durch Biozideinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz von Feuchtwiesen (NSG Frießnitz / Struth), Wiedervernässung ehemaliger Feuchtgebiete<br />
(z.B. Leschke), Schutz von Röhrichtflächen an Gewässern<br />
- Erhaltung (keine Aufforstung) und extensive Nutzung von sanierten Bergbauflächen der Wismut<br />
- Erhaltung von Elsteraltwässern<br />
- Reduktion des Biozideinsatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 185
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Steinschmätzer – Oenanthe oenanthe (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Regelmäßiger Brutvogel, Abnahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) ist der Steinschmätzer ein häufiger Brutvogel. LIEBE (1873)<br />
schreibt: „Die Steinklitzsche ist zwar immer noch ziemlich häufig, im Ganzen aber doch nicht mehr so häufig<br />
wie früher.“ Später schreibt LIEBE (1878), dass der Bestand „doch recht merklich heruntergegangen“ sei.<br />
HELLER (1926) stellte den Steinschmätzer um 1880 als seltenen „Brutvogel in Steinbrüchen unweit der<br />
,Grünen Linde‘ [Greiz]“ und „Elsterberg (Ruine)“ fest. Ein Nest fand HELLER (1893) unter den Schienen der<br />
Bahnanlage Gera-Zwötzen. Die Besiedlung der Bahnanlagen im Untersuchungsgebiet führte zu einer Zunahme<br />
des Steinschmätzers am Ende des 19. Jahrhunderts (HELLER 1899).<br />
1900 bis 1950<br />
HIRSCHFELD (1932) fand den Steinschmätzer nur noch als seltenen Brutvogel bei Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Ab 1960 entwickelte sich eine Population von mehreren Paaren an den „Bergwerkshalden bei Ronneburg“<br />
(GÜNTHER 1969). Zu dieser Zeit erfolgte auch die Besiedlung der Bergbaufolgelandschaften bei Culmitzsch<br />
und Großkundorf. TOLKMITT schätzte Ende der 1960er-Jahre 6 BP im RNG Großkundorf ein (LANGE & LEO<br />
1978). Im Rahmen einer Bestandserfassung 1975 / 76 konnten von HABICHT (1977) folgende Bestandangaben<br />
gemacht werden: Altkreis Gera: 1 BP Steinbruch Gera-Leumnitz (AUERSWALD), 1 BP Steinbruch bei<br />
Gera-Rubitz (SCHULZE), als weitere Brutorte werden der Holz- u. Materiallagerplatz bei Ronneburg und von<br />
der FG Ronneburg die Orte Raitzhain und Paitzdorf sowie die Bergbauhalden bei Ronneburg angegeben<br />
[Nach GÜNTHER (mündl. an LIEDER) gab es zu dieser Zeit ca. 20 BP um Ronneburg]; Altkreis Greiz: weniger<br />
als 20 BP im Gesamtgebiet (TOLKMITT), 6 BP 1966, 1 BP 1968, 3 – 4 BP 1973 / 74 jeweils im Haldengebiet<br />
bei Großkundorf, 3 BP 1970 in Hermannsgrün (LEO), 2 – 3 BP 1971 in Greiz-Pohlitz (LEO). LANGE & LIEDER<br />
(2001) geben den Gesamtbestand mit 1 – 2 BP an und können nur noch auf nicht mehr alljährlich besetzte<br />
Brutplätze verweisen: RNG Großkundorf, Reust, Halden bei Ronneburg und Tongrube Aga. Für die Erfassung<br />
des Steinschmätzers im Jahr 2002 in Thüringen (GRIMM 2004) wurden <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Untersuchungsgebiet<br />
nur zwei Plätze mit Brutverdacht gemeldet: Steinbruch Rohna (LIEDER) und Steinbruch Hohenölsen<br />
(GÖRNER). In den letzten zehn Jahren konnte folgender Brutbestand ermittelt werden: 1 BP 2002 im RNG<br />
Culmitzsch (JAKOB, LANGE, LUMPE), 1 BP 2004 im RNG Gessenhalde (BECHER), 1 BP 2005 im RNG Lichtenberg<br />
(HÖSELBARTH), 3 BP 2005 im RNG Gessenhalde (BECHER), 1 BP 2005 am Steinberg Gera-Leumnitz<br />
(JAHN), 6 BP 2006 im renaturierten Bergbaugebiet südlich von Ronneburger (BECHER), je 1 BP 2007 und<br />
2008 im RNG Gessenhalde (BECHER, HÖSELBARTH, KRAFT; LUMPE, LANGE, & LIEDER 2008; LUMPE & LIEDER<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 186
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
2009; LIEDER & LUMPE Ms.) sowie Brutverdacht 2007 in der Tongrube Aga (LIEDER; LUMPE, LANGE, & LIEDER<br />
2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust des Lebensraumes durch intensivere Nutzung der Kulturlandschaft<br />
- Umwandlung und Nutzung von Ödland (Aufforstung sanierter Bergbauflächen der Wismut)<br />
- Intensivierung der Weidewirtschaft<br />
- Eutrophierung der Landschaft<br />
- Beseitigung von Kleinstrukturen<br />
- Freizeitnutzung an Brutplätzen (Motocross in der Tongrube Aga)<br />
- Schließung großer Mülldeponien<br />
- Verfüllung von Abbaugruben<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Erhaltung (keine Aufforstung) und extensive Nutzung von sanierten Bergbauflächen der Wismut und der<br />
ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Rüdersdorf und im Zeitzer Forst.<br />
- Erhaltung nicht mehr genutzter Abbaugruben (Aga, Rohna, Hohenölsen) für den Artenschutz<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 187
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Steinsperling – Petronia petronia (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr. 11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Ausgestorben<br />
Streng geschützt<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach LIEBE (1873) gab es ein Vorkommen im Weidatal bei Loitsch: „Den Felsensperling habe ich vor vielen<br />
Jahren zur Nistzeit im untern Weidathal oberhalb Loitzsch beobachtet. Jetzt scheint er <strong>dem</strong> Gebiet nicht<br />
mehr anzugehören.“ Später nimmt LIEBE (1878) noch einmal darauf Bezug: „Früher nistete er auch bei<br />
Weida in allen Steinbrüchen…“ HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ziehen die Angaben von LIEBE in Zweifel.<br />
„Ob diese Angaben auf eigene Beobachtungen oder auf LIEBE zugegangene Nachrichten gegründet sind,<br />
wird nicht gesagt, ein Gewährsmann nicht genannt.“ Dem steht gegenüber, das LIEBE (1873) sich selbst als<br />
Beobachter angibt und damit die Angabe zum Brüten bei Loitzsch [Loitsch] glaubwürdig erscheint.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- nicht bekannt<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wiederbesiedlung ist gegenwärtig <strong>aus</strong>geschlossen und Schutzmaßnahmen deshalb nicht erforderlich<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 188
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Brachpieper – Anthus campestris (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Vom Aussterben bedroht<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) schreibt zum Brachpieper: „An der Orla und Roda aber wohnt er, obgleich einzeln (häufig<br />
ist er nirgends) fast auf allen sandigen Bergen, die mit einzelnen Nadelbüschen besetzt sind, sandige Felder<br />
haben und an Wälder grenzen.“ Ein Brachpieper-Weibchen vom 03.06.1829 <strong>aus</strong> Renthendorf befindet sich<br />
in BREHMS Sammlung (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975). Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war<br />
der Brachpieper seltener Brutvogel bei Gera-Zschippern. LIEBE (1873) führt <strong>aus</strong>: „Die Brachlerche ist im Bericht<br />
von 1859 als bei Zschippern vorkommend aufgeführt. Dort habe ich sie in den letzten 12 Jahren während<br />
der Brutzeit nicht gesehen, wohl aber 1871 zwei Paare und 1872 ein Paar am Königsberg unweit<br />
Loitzsch. 1872 sah ich im Sommer einige Junge am Krippenberg bei Weida.“ LIEBE (1878) schreibt zu weiteren<br />
Brutvorkommen des Brachpiepers: „Das Nest habe ich allemal in einer tiefer eingedrückten Fussspur<br />
von Pferd oder Rind gefunden; so auf den Steinbergen zwischen Ronneburg und Crimmitschau, bei Kayna<br />
und Starkenberg (westlich von Altenburg), auf den Katzthaler Höhen (nordöstlich von Ronneburg) u. s. w.“<br />
HELLER (1926) äußert nach seinen Aufzeichnungen von 1881 nur Vermutungen zum Vorkommen zwischen<br />
Waltersdorf und Linda, ohne konkrete Anhaltspunkte. Als Brutplatz nennt er Mensdorf bei Ronneburg.<br />
1900 bis 1950<br />
Auf ein Brutvorkommen bei Hohenölsen deutet ein Belegexemplar in der Sammlung VÖLCKEL hin: 28.6.1911<br />
Hohenölsen (Museum Gera, Invent.-Nr. 276 / 79).<br />
Ab 1950<br />
1967 wurde ein Brutnachweis bei Cretzschwitz erbracht (DIETZMANN, GÜNTHER, ZÖRNER; GÜNTHER 1969) und<br />
1972 wurde eine Brut auf den Katztaler Höhen bei Großenstein gefunden (AUERSWALD; GÜNTHER 1977 a).<br />
Ein sM wurde am 29.05.2005 im RNG Lichtenberg festgestellt (BECHER; ROST 2006) und 2008 gab es einen<br />
Brutversuch auf der Fläche der ehemaligen Spitzkegelhalden Paitzdorf (KRAFT, LIEDER; LUMPE & LIEDER<br />
2009). 2009 gelang nach 37 Jahren wieder der Nachweis einer erfolgreichen Brut, diesmal im RNG<br />
Culmitzsch (LANGE).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 189
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Aufgabe extensiver Grünlandnutzung<br />
- Aufforstung sanierter Bergbauflächen der Wismut<br />
- Eutrophierung der Landschaft<br />
- Insektenarmut durch Biozid- und Düngemitteleinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung der bestehenden und potenziellen Brutplätze im Sanierungsgebiet der Wismut bei Culmitzsch,<br />
Ronneburg und Paitzdorf<br />
- Extensive Weidewirtschaft auf mageren Standorten<br />
- Reduzierung des Biozid- und Düngemitteleinsatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 190
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wiesenpieper – Anthus pratensis (L.)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Vorwarnliste<br />
Regelmäßiger Brutvogel, gleichbleibend<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt als einzigen Brutplatz des Wiesenpiepers in der Umgebung<br />
von Gera die Pfortner Wiesen an. LIEBE (1873) fand ihn nicht mehr vor: „Anthus pratensis wird im Bericht von<br />
1859 als Bewohner der Pfortner Wiesen aufgeführt. Ich habe ihn dort seit<strong>dem</strong> nicht gesehen – vielleicht infolge<br />
der Austrocknung jener Wiesen.“ In der weiteren Umgebung von Gera gab es nach LIEBE (1878) folgende<br />
Brutvorkommen: „Im Mühlthal bei Eisenberg, im Pleissethal unterhalb Altenburg, im Elsterthal oberhalb<br />
und unterhalb Pegau, bei Corbusan [Korbußen] und Gera, bei Waltersdorf zwischen Roda und Gera,<br />
bei Meineweh zwischen Zeitz und Naumburg habe ich sie als Brutvogel angetroffen.“ In der Umgebung von<br />
Greiz war die Art um 1880 nur Durchzügler (HELLER 1926).<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) fand VÖLCKEL ein Gelege bei Hohenölsen. HILDEBRANDT kannte den Wiesenpieper<br />
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht als Brutvogel in Ostthüringen (HILDEBRANDT & SEMMLER<br />
1975).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) teilt mit, dass „im letzten Jahrzehnt“ der Wiesenpieper mehrfach bei Baldenhain (ZÖRNER),<br />
bei Röpsen und Aga (G. u. J. BAUM), bei Korbußen (JAHN), im Gessental bei Collis (AUERSWALD) und am<br />
Reuster Berg (GÜNTHER) gebrütet hat. 1975 / 76 erfolgte eine Bestandserfassung (GÜNTHER 1977 b), wonach<br />
folgenden Angaben zum Brutvorkommen gemacht werden: Altkreis Gera: ca. 6 BP zwischen<br />
Nauendorf und Baldenhain bis 1974, danach erloschen, 1 – 2 BP bei Grobsdorf, 2 BP bei Reust, 1 – 2 BP<br />
bei Trebnitz, 1 BP bei Kauern (alle FG Ronneburg), 1 BP bei Lengefeld 1974 (SCHEFFEL); Altkreis<br />
Zeulenroda:<br />
4 BP bei Auma (FG Auma) und 1 BP bei Zeulenroda (TITZ); Altkreis Greiz: 15 – 20 BP Großkundorf –<br />
Wolfersdorf, sonst nur vereinzelter Brutvogel. Nach LANGE & LEO (1978) beschränkt sich das Vorkommen mit<br />
50 – 100 BP auf den Raum Großkundorf – Culmitzsch – Wolfersdorf. Danach setzte ein Rückgang ein. Für<br />
die 1990er-Jahre schätzen LANGE & LIEDER (2001) das Vorkommen zwischen Aga und Großkundorf sowie<br />
auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen im Pöllwitzer Wald mit insgesamt 10 – 20 BP ein. Im Rahmen<br />
des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand mit 29 – 52 BP eingeschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 191
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Aufgabe extensiver Grünlandnutzung<br />
- Aufforstung sanierter Bergbauflächen der Wismut und ehemalige Truppenübungsplätze<br />
- Entwässerung von Feuchtwiesen<br />
- Verfüllung von Abbaugruben (Aga)<br />
- Freizeitnutzung (Motocross in Tongrube Aga, Badebetrieb am Speicher Schöna)<br />
- Insektenarmut durch Biozid- und Düngemitteleinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung der bestehenden und potenziellen Brutplätze im Sanierungsgebiet der Wismut bei Culmitzsch,<br />
Ronneburg und Paitzdorf und in Abbaugebieten bei Aga<br />
- Extensivierung und Wiedervernässung von Grünlandbereichen<br />
- Keine Freizeitnutzung an bekannten Brutplätzen<br />
- Reduzierung des Biozid- und Düngemitteleinsatzes<br />
Verbreitungskarte 22: Wiesenpieper<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
2 – 3 1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 192
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Wiesenschafstelze – Motacilla flava L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Regelmäßiger Brutvogel, gleichbleibend<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Wiesenschafstelze ein seltener Brutvogel bei Lichtenberg.<br />
LIEBE (1873) schreibt: „Die Schafstelze (die gelbe Bachstelze) brütet sehr selten im Gebiet: so bei<br />
Weimarisch-Rußdorf und Wolfersdorf, bei Posterstein, nördlich bei Eisenberg.“ Wenige Jahre später trat<br />
bereits ein Rückgang ein. LIEBE (1878) vermerkt dazu: „Ihr Verbreitungsbezirk umfasst mehr die Tiefebene,<br />
aber auffällig bleibt es immer, dass sie sich <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Hügelland nordwärts zurückzieht, … In früherer Zeit<br />
standen die am weitesten nach <strong>dem</strong> Gebirge zu vorgeschobenen Posten bei Lichtenberg (südöstlich von<br />
Gera), Wolfersdorf (b. Berga), Russdorf (westlich von Crimmitschau), Posterstein (bei Schmölln), Dürrengleina<br />
(südlich von Jena). Jetzt brüten dort keine mehr.“ Von dieser Zeit an fehlte bis ca. 1955 die Wiesenschafstelze<br />
als Brutvogel im Untersuchungsgebiet.<br />
20. Jahrhundert<br />
Zur Neubesiedlung stellte GÜNTHER (1969) fest: „In den letzten 15 Jahren trat sie wieder als Brutvogel auf<br />
und besiedelte erneut das einstige Brutgebiet. 1968 wurden auf einer Probefläche bei Großenstein 2 Brutpaare<br />
je Quadratkilometer gezählt, so dass mindestens 200 Paare im besiedelten Teil des Kreises vorhanden<br />
sind.“ Von 1968 bis 1970 ist die Wiesenschafstelze nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL (1971) bei<br />
Auma „auch in den Sommermonaten durch singende Männchen – vorwiegend in der Wolge – festgestellt<br />
worden.“ 1977 wurde die Wiesenschafstelze erstmals für den Altkreis Greiz im RNG Großkundorf als Brutvogel<br />
nachgewiesen (LANGE & LEO 1978). Eine Bestandserfassung 1975 / 76 erbrachte folgende Verbreitungssituation:<br />
„Gegenwärtig reicht die geschlossene Verbreitung gebirgswärts bis zu einer Linie Mensdorf –<br />
Hilbersdorf – Zossen – Gera – Etzdorf – Eisenberg – Bürgel – Jena – Isserstedt, … Vorposten befinden sich,<br />
unter Umgehung der großen, weitestgehend geschlossenen Waldgebiete zwischen Jena und Gera bei<br />
Burkersdorf, Frießnitz, Niederpöllnitz (3 – 5 BP), Auma (1 – 2 BP), …“ (FLÖßNER 1977 d). Bei Ronneburg<br />
wurden im Jahre 1975 auf einer Probefläche von 65 km² mindestens 35 BP gezählt (GÜNTHER, MENGEL,<br />
REICHARDT; FLÖßNER 1977 d). LANGE & LIEDER (2001) führen folgendes zur Wiesenschafstelze <strong>aus</strong>: „Die<br />
Schafstelze der UA M .f. flava besiedelt vor allem den östlichen Teil des Landkreises und der Stadt Gera<br />
zwischen Aga und Großkundorf. Der Gesamtbestand wird hier auf 40 bis 70 BP geschätzt. Eine isolierte<br />
Population gibt es zwischen Weiderteich und Auma (5 – 10 BP). Selten sind kurzzeitig auch Vorkommen an<br />
anderen Stellen festzustellen, z.B. 1973 bei Zossen und Burkersdorf je ein Brutpaar (LIEDER).“ Im Rahmen<br />
des ADEBAR-Projektes 2005 – 2008 wurde der Bestand auf 39 – 78 BP geschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 193
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust des Feuchtgrünlandes durch Entwässerung und Grundwasserabsenkung<br />
- Verlust der Brutgebiete in den Sanierungsgebieten des Wismutbergb<strong>aus</strong> durch Trockenlegung und Aufforstung<br />
- Mahd von Wegrändern in der Feldflur zur Brutzeit<br />
- Intensivierung der Grünlandnutzung<br />
- Zunehmende Versiegelung und Verbauung der Landschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung und Wiedervernässung von Grünlandbereichen<br />
- Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
- Mahdtermine in den Brutgebieten nach der Brutzeit<br />
- Förderung bewachsener Wegränder<br />
- Sicherstellung oder Wiederherstellung von Kleingewässern und vernässten Stellen in der großräumigen<br />
Agrarlandschaft<br />
Verbreitungskarte 23: Wiesenschafstelze<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
4 – 7 4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20 1<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 194
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Karmingimpel – Carpodacus erythrinus (Pallas)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Extrem selten<br />
Streng geschützt<br />
Seltener Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
In BREHMS Sammlung befindet sich ein altes Karmingimpel-Männchen, welches am 12.06.1836 bei<br />
Renthendorf erlegt wurde (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975) und vorher mit einem Weibchen gepaart angetroffen<br />
wurde (BAEDEKER 1855). Danach fehlen 150 Jahre lang weitere Beobachtungen von dieser Art.<br />
20. Jahrhundert<br />
Nachfolgend sind alle bisherigen Beobachtungen von Karmingimpeln im Untersuchungsgebiet aufgeführt:<br />
12.06.1987 bis 16.07.1987 ein singendes weibchenfarbenes Männchen im Schilfgebiet bei Struth (BAUM;<br />
BAUM & AUERSWALD 1990; KRÜGER 1993 / 94)<br />
27.05.1987 ein Männchen bei Ronneburg (GÜNTHER; KRÜGER 1993 / 94)<br />
28.06.1989 zwei weibchenfarbene Ind. in den Hammerwiesen im Greizer Park (MÜLLER, KRÜGER 1995 b)<br />
06.08.1990 zwei Männchen und ein weibchenfarbenes Ind. im RKG Großkundorf (LANGE; KRÜGER 1996)<br />
27.09.1998 ein Männchen an den Teichen bei Frotschau (LANGE, SOLBRIG; ROST, FRIEDRICH & LANGE 1999)<br />
02.06.2000 ein sM am Haldenrandteich des RNG Culmitzsch, zwei km südlich von Wolfersdorf (LANGE,<br />
SOLBRIG; ROST 2001)<br />
23.06.2002 ein sM an der Kläranlage in Korbußen (LIEDER; ROST 2003)<br />
03.09.2002 sechs weibchenfarbene Ind. an den Hammerwiesenteichen im Greizer Park (MÜLLER)<br />
25.08.2003 drei Ind. im Elstertal bei Greiz zwischen Kupferhammer und Neuhammer (MÜLLER, ROST 2004)<br />
05.06.2005 ein weibchenfarbenes Ind. mit Futter in den Hammerwiesen im Greizer Park (MÜLLER)<br />
(Bei dieser Beobachtung kann es sich um ein einjähriges Männchen gehandelt haben, welches<br />
sein brütendes Weibchen fütterte)<br />
13.06.2006 ein weibchenfarbenes Ind. in Greiz-Moschwitz (LANGE; ROST 2007)<br />
24.07.2006 ein Ind. im 1. Kalenderjahr in Greiz-Moschwitz (LANGE; ROST 2007)<br />
13.09.2006 zwei Ind. im 1. Kalenderjahr in Greiz-Moschwitz (LANGE)<br />
Nach ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) können die Beobachtungen bei Struth 1987, in<br />
den Hammerwiesen im Greizer Park 1989 und 2005 als begründete Brutverdachte gewertet<br />
werden. Auch für Greiz-Moschwitz ist ein Brutvorkommen 2006 nicht <strong>aus</strong>zuschließen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Freizeitaktivitäten am Brutplatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Vermeidung von Störungen am Brutplatz<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 195
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Grauammer – Emberiza calandra L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11.<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Gefährdet<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Erneute Wiederbesiedelung, Zunahme<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) wird zur Grauammer als Brutvogel in der Umgebung von<br />
Gera <strong>aus</strong>gesagt: „Scheint sich erst in neuerer Zeit hier anzusiedeln.“ Zur Besiedlung des Untersuchungsgebietes<br />
schreibt LIEBE (1873): „Die Gerstenammer ist erst etwa im Jahr 1856 im Gebiet eingewandert … In<br />
diesem Jahre erschien bei Debschwitz am Anger ein Paar um dort zu nisten. 1857 kam dies Paar wieder<br />
und blieben noch ein zweites und drittes von den Wintergästen zurück, welche sich bei Tinz und Ronneburg<br />
niederließen. 1860 traf ich schon bei Pohlitz, Groitzschen und Heuckewalde je ein Paar, und jetzt sind sie<br />
häufig geworden, dass man in den flacheren Thälern des östlichen Gebietstheils mindestens alle Viertelstunden<br />
Wegs auf ein neues Paar stößt, und dass auch in den westlichen Thälern einzelne Paare brüten.“<br />
Diese Ausbreitung hielt weiter an, denn später teilt LIEBE (1878) mit: „Jahr für Jahr dehnt sich der Wohnbezirk<br />
des Grauammers weiter über das Gebiet hin <strong>aus</strong>, so dass sie jetzt im Roda- und Orlathal, im obern Saalethal,<br />
im Elsterthal bis oberhalb Plauen, Wisentthal bei Schleiz, auf Wiesen bei Mühltroff, – kurz in den breiteren<br />
Thälern des ganzen Gebietes h<strong>aus</strong>en ...“ Nach HELLER (1926) ist die Grauammer erst in den 1870er-<br />
Jahren um Greiz eingewandert.<br />
1900 bis 1950<br />
PIETZOLD stellte die Grauammer als Brutvogel bei Pöllwitz – Kurtschau, bei Moschwitz, Christgrün und<br />
Ruppertsgrün fest (HELLER 1926). HILDEBRANDT (1919) kannte die Grauammer als häufigen Brutvogel Ostthüringens<br />
„mit Ausnahme der dicht bewaldeten Teile“. Auch HIRSCHFELD (1932) kennt sie als stellenweise<br />
häufigen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
GERTH (1958) fand sie in den 1950er-Jahren als Brutvogel bei Münchenbernsdorf. Auch in den 1960er-<br />
Jahren war die Art noch häufig. GÜNTHER (1969) schreibt für den Altkreis Gera: „Die Zählung auf einer Probefläche<br />
bei Großenstein erbrachte 1968 auf <strong>dem</strong> Quadratkilometer 4 singende Männchen. Allerdings wurden<br />
kaum Weibchen beobachtet. Im Kreis Gera dürften über 500 singende Männchen vorkommen, was aber<br />
nicht auf die gleiche Zahl von Brutpaaren schließen lässt.“ Auch im Altkreis Zeulenroda gab es zu der Zeit<br />
noch Vorkommen an der Weidatalsperre (WERNER 1964). HEYER (1967 a) fand zur Brutzeit 1966 2 – 3 Vögel<br />
am Frießnitzer See und 1 – 5 Vögel am Weiderteich. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL (1971) bestanden<br />
Brutvorkommen in der Leschke (8 – 10 singende Männchen 1967), im Wöhlsdorfer Grund und an der damals<br />
neuen Ortsverbindungsstraße Zeulenroda – Auma (4 singende Männchen im Abstand von je 100 Metern<br />
1966). LANGE & LEO (1978) stellen einen Rückgang fest: „Der Bestand dürfte 10 Brutpaare sicher nie<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 196
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
überschritten haben, was vermutlich in den [19]50er und Anfang der [19]60er Jahre zutraf ... Seit etwa<br />
10 – 15 Jahren ist ein Rückgang zu verzeichnen, der fast zum völligen Verschwinden dieser Vogelart führte.<br />
Zur Zeit dürften nicht mehr als drei Paare im Kreisgebiet vorkommen, wobei die letzten Beobachtungen im<br />
Raum Reudnitz / Gottesgrün bzw. Großkundorf / Sorge-Settendorf gelangen.“ Bei FLÖßNER (1981 a) werden<br />
die Vorkommen bei Greiz zeitlich konkretisiert: 1974 bei Großkundorf / Sorge-Settendorf und 1974 sowie<br />
1976 im Gebiet Gottesgrün – Reudnitz – Mohlsdorf. FLÖßNER (1981 a) hält die Schätzung von 500 sM bei<br />
GÜNTHER (1969) für zu hoch. Bei einer Erfassung in den Jahren 1979 / 80 wurde die Grauammer in folgenden<br />
Gebieten nicht mehr angetroffen: Münchenbernsdorf, Umgebung Greiz, Umgebung Auma (schon ab<br />
1970 nicht mehr), Umgebung Weidatalsperre. Brutvorkommen wurden noch bei Bethenh<strong>aus</strong>en (1979),<br />
Baldenhain (1978), Großenstein (1979) und Reust (1979) festgestellt (FLÖßNER 1981 a). GÜNTHER (1991)<br />
dokumentiert den Rückgang der Grauammer. Außer den bereits genannten Daten werden für folgende Orte<br />
die letzten Grauammerbeobachtungen genannt: Münchenbernsdorf 1967 / 68 (WOLF), Dorna 1968 (BAUM),<br />
Mohlsdorf / Raasdorf 1968 – 1970 (W. LEO), Reudnitz / Gottesgrün 1976 / 1977 (LANGE, W. LEO) und<br />
Ronneburg 1979 (GÜNTHER). Danach fehlen für viele Jahre Brutnachweise. JANSEN (2001) kann für den Zeitraum<br />
vom 1994 bis 1999 kein Brutrevier im Untersuchungsgebiet feststellen und verweist auf lediglich drei<br />
Beobachtungen von GÜNTHER, LANGE, WOLF. Auch LANGE & LIEDER (2001) können nur auf einzelne sM verweisen,<br />
ohne dass ein Brutverdacht bestand.<br />
Aus den letzten Jahren liegen u. a. Nachweise <strong>aus</strong> folgenden Gebieten vor:<br />
RNG Culmitzsch: 1 sM 2005 (LANGE)<br />
Aufstandsfläche der ehemaligen Spitzkegelhalden bei Paitzdorf: 1 sM (östlich auf Aufforstungsfläche) 2005<br />
(LIEDER), 2 BP 2008 (HALBAUER, LIEDER, MENGEL, KRAFT), 1 BP 2009 (KRAFT)<br />
Ehemaliges Ronneburger Bergbaugebiet: 4 – 5 sM 2008 (GÖL Weida, LIEDER), 1 BP 2009 (MENGEL)<br />
Gebiet Rüdersdorf – Harpersdorf – A 4: 1 BP 2004 (SCHULZE), 3 BP 2008 (HÖLZER, SANCHES & SAUER 2008)<br />
Gewerbegebiet Hermsdorf: 1 sM 2007 (HÖSELBARTH)<br />
Ehemaliger Truppenübungsplatz bei Lessen (Zeitzer Forst): 1 sM 2005 (M. LANGE)<br />
Halde Korbußen – Großenstein: 1 BP 2008 (REICHARDT)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft<br />
- Aufforstung (sanierte Bergbauflächen der Wismut, ehemalige Truppenübungsplätze)<br />
- Entwässerung von Feuchtwiesen und Verfüllung von Abbaugruben<br />
- Verbauung der Landschaft<br />
- Verlust von Ödlandflächen<br />
- Umpflügen der Getreidefelder nach der Ernte – keine Stoppelbrachen im Winter<br />
- Intensiver Biozid- und Düngemitteleinsatz<br />
- Saatgutbeize mit quecksilberhaltigen Mitteln<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine Aufforstung auf bestehenden und potenziellen Brutplätzen im Sanierungsgebiet der Wismut bei<br />
Culmitzsch, Ronneburg, Korbußen und Paitzdorf sowie auf <strong>dem</strong> ehemaligen Truppenübungsplatz im<br />
Zeitzer Forst<br />
- Extensivierung von größeren Flächen der Landwirtschaft<br />
- Erhalt von Brachflächen<br />
- Erhalt von Stoppelbrachen nach der Ernte<br />
- Reduzierung des Biozid- und Düngemitteleinsatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 197
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Ortolan – Emberiza hortulana L.<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Thüringens:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie:<br />
Landkreis Greiz und Stadt Gera:<br />
Ausgestorben<br />
Gefährdet<br />
Streng geschützt<br />
Anhang I<br />
Ausgestorben<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19.Jahrhundert<br />
„Emberiza hortulana ist im Gebiet nicht vorgekommen“, schreibt LIEBE (1873).<br />
1900 bis 1950<br />
HELLER (1926) schreibt: „Diesen anscheinend westwärts vordringenden Vogel habe ich 1907 zur Brutzeit<br />
einmal bei Waltersdorf – Reinsdorf beobachtet, konnte aber sein Brüten nicht feststellen.“ Am 10. August<br />
des gleichen Jahres wurde ein Ortolan <strong>aus</strong> Markersdorf <strong>dem</strong> Museum in Gera übergeben (FEUSTEL 1908).<br />
Ab 1950<br />
Am 28.05.1958 sah REICHARDT ein Männchen bei Korbußen (FLÖßNER 1981 b). In den Jahren um 1960 hat<br />
sich der Ortolan „... in den Fluren zwischen Pölzig, Baldenhain und Brahmenau angesiedelt. Drei singende<br />
Männchen auf Bäumen entlang der Landstraßen hatten feste Reviere eingenommen …“ (GÜNTHER 1969).<br />
Brutnachweise wurden 1960 bei Bethenh<strong>aus</strong>en (DIETZMANN, ZÖRNER) und bei Sachsenroda (GÜNTHER) sowie<br />
1961 nochmals bei Bethenh<strong>aus</strong>en (DIETZMANN, ZÖRNER) erbracht (GÜNTHER 1969). Ende der 1950er-<br />
Jahre stellte KLEHM einen singenden Ortolan bei Wenigenauma fest (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL 1971).<br />
Im Elstergebiet bei Weida bestand bis 1977 ein Brutvorkommen mit 2 – 3 BP (Mitt. SCHRÖDER an BAUM;<br />
FLÖßNER 1981 b). Am 28.06.1977 sang ein Männchen in Waldh<strong>aus</strong> bei Greiz (TOLKMITT; LANGE & LEO 1978).<br />
1988 brütete ein Paar im RNG Großkundorf (LANGE, PATZELT; KRÜGER 1995 a). Ein sM wurde am<br />
14.07.2002 auf <strong>dem</strong> ehemaligen Truppenübungsplatz im Zeitzer Forst bei Lessen festgestellt (LIEDER; WIES-<br />
NER, KLAUS, WENZEL, NÖLLERT & WERRES 2008). Ein Brutverdacht kann dar<strong>aus</strong> jedoch nicht abgeleitet werden.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft<br />
- Entwässerung von Feuchtwiesen und Verfüllung von Abbaugruben<br />
- Verbauung der Landschaft<br />
- Verlust von Gehölzen in der Agrarlandschaft<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
- Intensiver Biozid- und Düngemitteleinsatz mit Verringerung des Nahrungsangebotes<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung von größeren Flächen der Landwirtschaft , verstärkter Anbau von Sommergetreide<br />
- Erhalt von Brachflächen<br />
- Erhaltung und Neuanpflanzung von Gehölzen in der <strong>aus</strong>geräumten Agrarlandschaft<br />
- Reduzierung des Biozid- und Düngemitteleinsatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 198
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Diskussion<br />
In dieser Arbeit werden Vögel <strong>aus</strong> 74 Arten der Roten Liste Thüringens (WIESNER 2001) behandelt, die<br />
gegenwärtig im Landkreis Greiz und der Stadt Gera entweder zu den aktuellen Brutvögeln zählen oder<br />
bereits <strong>aus</strong>gestorben sind. Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen zur Vogelwelt unseres Untersuchungsgebietes<br />
verdanken wir CHRISTIAN LUDWIG BREHM, der im Jahre 1813 die Predigerstelle im benachbarten<br />
Renthendorf übertragen bekam (STRESEMANN 1951) und mit seiner Vogelflinte u. a. auch die Natur<br />
um Frießnitz und Niederpöllnitz durchstreifte. Ein Rückblick auf 200 Jahre Vogelforschung wäre ohne seine<br />
Arbeiten nicht möglich gewesen.<br />
Gewaltige Veränderungen haben sich in dieser Periode vollzogen und die Vogelwelt nachhaltig negativ<br />
beeinflusst. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren „die Wälder licht und stark fragmentiert, die Übergänge<br />
Feld-Wald unter Auswirkung der Waldweide fließend. Die Nutzung dieser offenen, strukturreichen Landschaft<br />
war äußerst intensiv, aber anders als in der Gegenwart, von permanentem Nährstoffmangel geprägt.“<br />
(GRIMM 2004). In dieser Zeit erreichten Arten der offenen und halboffenen Landschaft wie Wiedehopf, Ziegenmelker,<br />
Rotkopfwürger, Schwarzstirnwürger, Brachpieper und Steinschmätzer auch im Untersuchungsgebiet<br />
ihren Bestandshöhepunkt. Durch die Zunahme der Schusswaffen wurden besonders die großen Vogelarten<br />
wie der Weißstorche und viele Greifvögel stark dezimiert. Mit Beginn der technischen Revolution<br />
verschlechterte sich der Einfluss des Menschen auf die Natur weiter dramatisch. Abwässer gelangten in die<br />
Flüsse und zerstörten die Lebensbedingungen ihrer Bewohner. Wesentliche Abschnitte der Weißen Elster<br />
wurden begradigt und die angrenzenden Auen entwässert. Das hatte den Rückgang von Wachtelkönig,<br />
Wasseramsel, Eisvogel und Schilfrohrsänger in dieser Zeit zur Folge.<br />
Der veränderte Charakter der Landnutzung schränkte den Lebensraum vieler Vögel weiter merkbar ein.<br />
Feldraine und Feuchtgebiete vielen der Intensivierung der Landwirtschaft zum Opfer. Der verstärkten Einsatz<br />
von Agrochemikalien richtete bei Ackerkräutern, Insekten und Offenlandbrütern enorme irreversible<br />
Schäden an. Besonders das Rebhuhn bekommt die negativen Auswirkungen nachhaltig zu spüren. Greifvögeln<br />
wie <strong>dem</strong> Rotmilan und Eulen wie der Schleiereule wird die Nahrungssuche durch große Schläge von<br />
Wintergetreide oder Raps erschwert. Die Wälder wurden zunehmend von Laub- auf Nadelhölzer umgebaut<br />
und intensiv bewirtschaft. Die Umtriebszeiten verkürzten sich, und Alt- bzw. Totholz wurde zunehmend seltener.<br />
Als Folge dieser Entwicklung starben die Raufußhühner <strong>aus</strong>. Die Teichbewirtschaftung hat sich auf<br />
fast alle nennenswerten Gewässer <strong>aus</strong>gedehnt. Die Folgen zeigen sich vor allem im Rückzug von Enten,<br />
Rallen und Rohrsängern. Eine weitere Beeinträchtigung entsteht durch die Freizeitnutzung in diesen Lebensräumen.<br />
Positiv hat sich die seit 1990 anhaltende Verbesserung der Wasserqualität in unseren Flüssen<br />
und Bächen <strong>aus</strong>gewirkt. Wasseramsel und Eisvogel kehrten in einstige Reviere zurück.<br />
Von tief greifen<strong>dem</strong> Einfluss im Landkreis Greiz und der Stadt Gera war der gewaltige Eingriff in die Natur<br />
durch den Uran-Erzbergbau, der sich um Ronneburg und Berga in den Jahren von 1949 (Tagebauaufschlüsse<br />
Sorge-Settendorf und Trünzig-Katzendorf) bis 1991 (Beendigung der Uranerzgewinnung) vollzog<br />
und bis heute mit der Sanierung der Wismut-Hinterlassenschaften nachwirkt. Mit der Inbetriebnahme der<br />
Erzaufbereitung Seelingstädt und <strong>dem</strong> Fluten der Schlamm-Absetzbecken bei Großkundorf und Culmitzsch<br />
ab 1960 entwickelte sich dieses künstliche Seengebiet zu einem bedeutenden Trittstein für den Vogelzug.<br />
Aus den Gehölzanpflanzungen auf den Tagebau-Dämmen und -Halden war in nahezu einem halben Jahrhundert<br />
ein Wald-Lebensraum mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt entstanden. Heute erfordert die Sanierung<br />
wiederum einen Eingriff in diese gewachsenen Strukturen. Die Arbeiten der bundeseigene Wismut<br />
GmbH bieten aber auch die Chance, wertvolle Lebensräume der Natur zurückzugeben. Positiv gestaltete<br />
sich die Renaturierung der Bergbauflächen um Ronneburg. Die extensive Nutzung großer Grünlandflächen<br />
im Gessental und auf der ehemaligen Gessenhalde brachte z.B. Heidelerche, Steinschmätzer und Grauammer<br />
zurück.<br />
Momentan zählen im Untersuchungsgebiet Ind. <strong>aus</strong> 59 Arten der Roten Liste Thüringens zu den Brutvögeln,<br />
während 15 Arten dar<strong>aus</strong> nicht mehr vorkommen. Im Landkreis Greiz und der Stadt Gera sind bisher<br />
folgende Arten <strong>aus</strong>gestorben (letzter Brutnachweis vor 15 Jahren oder früher): Haselhuhn, Birkhuhn, Auerhuhn,<br />
Rohrdommel, Zwergdommel, Fischadler, Kornweihe, Wiesenweihe, Flussuferläufer, Wiedehopf, Rotkopfwürger,<br />
Schwarzstirnwürger, Saatkrähe, Steinsperling und Ortolan. Ein starker Bestandsrückgang ist bei<br />
folgenden Vogelarten zu verzeichnen: Rebhuhn, Kiebitz, Bekassine, Steinkauz, Ziegenmelker und Raubwürger.<br />
Bei Haubenlerche, Uferschwalbe und Halsbandschnäpper ist der Bestand zurzeit erloschen. Dem<br />
stehen Erstbesiedelungen mit Graugans, Brandgans, Löffelente, Schnatterente und Rothalstaucher gegenüber.<br />
Von 14 Vogelarten gibt es keine Hinweise auf Vorkommen im 19. bzw. 20. Jahrhundert: Graugans (fehlte<br />
im 19. und 20. Jh.), Brandgans, Schnatterente, Knäkente, Löffelente (fehlte im 19. und 20. Jh.), Rothalstaucher,<br />
Schwarzstorch, Wiesenweihe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Waldwasserläufer, Beutelmeise, Rohrschwirl<br />
und Ortolan. Ungenügende Kenntnisse liegen von den heimlich lebenden Arten der Familie Rallidae vor,<br />
insbesondere vom Kleinen Sumpfhuhn. Zu Status und Bestandstrends siehe Tabelle auf Seite 201 ff.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 199
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Zur Erhalt und Förderung der Artenvielfalt der Brutvögel der Roten Liste Thüringens wären im Landkreis<br />
Greiz und der Stadt Gera folgende Schutzmaßnahmen erforderlich:<br />
1. Stillgewässer<br />
- Extensivierung der Fischwirtschaft an wichtigen Brutgewässern (Weiderteich, Burkersdorfer Feldteich,<br />
Teiche im NSG Frießnitzer See / Struth, Reichenbacher Teiche, Hainteich Aga, Großer Teich<br />
bei Kauern, Vorsperren der Talsperren Zeulenroda und Weida, Teiche bei Wöhlsdorf und Auma)<br />
- Schutz naturnaher Gewässer und Erhaltung der Röhrichtzonen<br />
- Schutz der Uferstreifen auf einer Breite von mind. 10 Metern (Erhaltung von Gehölzen, Hochstaudenfluren,<br />
Röhrichten, feuchtem Grünland)<br />
- Verhinderung von Nährstoff- und Gifteintrag <strong>aus</strong> umliegenden Agrarflächen<br />
- Her<strong>aus</strong>nahme großer Raubfischarten, wie Wels und Hecht <strong>aus</strong> wichtigen Brutgewässern von Wasservögeln<br />
- Unterlassung der Freizeitnutzung an Brutgewässern wie Surfen (Weiderteich) und Angeln (Reichenbacher<br />
Teiche)<br />
- Keine akustische Kormoranvergrämung während er Brutzeit an Brutgewässern<br />
- Schaffung von Ersatzmaßnahmen für den Verlust der Schlammabsatzbecken in der IAA Culmitzsch<br />
2. Fließgewässer<br />
- Renaturierung von Flussabschnitten und Altwässern an der Weißen Elster und ihrer Nebenflüsse<br />
- Einschränkung der Freizeitnutzung an naturnahen Flussabschnitten der Weißen Elster<br />
- Schutz der Uferstreifen auf einer Breite von mind. 10 Metern (Erhaltung von Gehölzen, Hochstaudenfluren,<br />
Röhrichten, feuchtem Grünland)<br />
- Verhinderung von Nährstoff- und Gifteintrag <strong>aus</strong> umliegenden Agrarflächen<br />
3. Agrarflächen<br />
- Extensivierung und Wiedervernässung von Grünlandbereichen<br />
- Beweidung großer, extensiver Grünlandbereiche<br />
- Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf den Feldflächen (insbesondere Verringerung<br />
des Düngemittel- und Gifteinsatzes)<br />
- Mahdtermine in den Brutgebieten nach der Brutzeit<br />
- Förderung bewachsener Wegränder und Erhaltung bzw. Anpflanzung von Hecken<br />
- Sicherstellung bzw. Wiederherstellung von Kleingewässern und ehemals vernässter Stellen in der<br />
großräumigen Agrarlandschaft sowie Öffnung von verrohrten Bachläufen<br />
- Keine weiteren Flächenversiegelungen durch Straßenbau und Gewerbegebiete<br />
- Neubau von Windenergieanlagen nur außerhalb der Brutgebiete und Nahrungshabitate gefährdeter<br />
Vogelarten (Empfehlungen zur Abstandsregelung beachten!)<br />
- Nutzung des Kulturlandschaftsprogramms<br />
4. Wälder<br />
- Großflächiger Schutz von reich strukturierten Laub- und Mischwälder und Erhalt von Hartholzauen<br />
- Nachpflanzung von Eichen<br />
- Erhöhung der Umtriebszeiten bei Eiche und Buche auf über 250 Jahre<br />
- Schutz von Höhlenzentren des Schwarzspechtes<br />
- Her<strong>aus</strong>nahme wertvoller naturnaher Wälder <strong>aus</strong> der forstlichen Nutzung<br />
- Verhinderung der Sukzession auf ehemaligen Truppenübungsplätzen im Zeitzer Forst, bei Rüdersdorf<br />
und im Pöllwitzer Wald<br />
5. Bergbauflächen<br />
- Erhaltung stillgelegter Tagebauflächen für den Artenschutz (Aga, Rohna, Tschirma, Hohenölsen)<br />
- Erhaltung von Rohbodenflächen bei der Sanierung von Wismut-Bergbaugebieten<br />
6. Siedlungen<br />
- Keine Bebauung wertvoller Außenbereiche mit neuen Wohn- und Gewerbeflächen<br />
- Erhaltung und Förderung alter Bauerngärten und ortsnaher Streuobstbestände<br />
- Sicherung von Brutmöglichkeiten an und in Gebäuden<br />
- Aufklärung der Bevölkerung zur Erhöhung der Akzeptanz von Gebäudebrütern, insbesondere für<br />
Rauch- und Mehlschwalben<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewahrung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 200
Status und Bestandstrend der betrachteten 74 Vogelarten<br />
Vogelart 1800 – 1849 1850 – 1899 1900 – 1949 1950 – 2009<br />
ADEBAR<br />
2005 – 2008<br />
Graugans Fehlt Fehlt Fehlt Erstbesiedlung 2008 1 BP<br />
Brandgans Fehlt Fehlt Fehlt Erstbesiedlung 1998 2 – 3 BP<br />
Schnatterente Fehlt Fehlt Fehlt Erstbesiedlung 1997 0 BP<br />
Krickente Unregelmäßiger Brutvogel Unregelmäßiger Brutvogel Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
Bruten nur 1993, 2002<br />
1 BP<br />
Knäkente Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
lückenhaft von 1993 – 2007<br />
1 BP<br />
Löffelente Fehlt Fehlt Fehlt Erstbesiedlung 2003 0 – 1 BP<br />
Wachtel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Häufiger Brutvogel mit Häufiger Brutvogel mit<br />
Starker Rückgang erloschen um 1970, seit<br />
Bestandsschwankungen Bestandsschwankungen<br />
1975 Zunahme<br />
~ 50 BP<br />
Rebhuhn<br />
Häufiger Brutvogel mit Häufiger Brutvogel mit Häufiger Brutvogel mit Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Bestandsschwankungen Bestandsschwankungen Bestandsschwankungen starke Abnahme<br />
18 – 26<br />
Haselhuhn Spärlicher Brutvogel Ausgestorben Ausgestorben Ausgestorben 0 BP<br />
Birkhuhn<br />
Verbreiteter Brutvogel mit Verbreiteter Brutvogel mit Aufgabe vieler<br />
Ausgestorben nach 1956<br />
0 BP<br />
Auerhuhn<br />
starkem Rückgang<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
schwindender Bestand<br />
starkem Rückgang<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
schwindender Bestand<br />
Brutgebiete<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
schwindender Bestand<br />
Zwergtaucher Häufiger Brutvogel Häufiger Brutvogel Häufiger Brutvogel<br />
Rothalstaucher Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Schwarzhalstaucher Unregelmäßiger Brutvogel Unregelmäßiger Brutvogel Brutvogel nur um 1932<br />
Rohrdommel<br />
Seltener Brutvogel<br />
Seltener Brutvogel, Mitte<br />
des 19. Jh. <strong>aus</strong>gestorben<br />
Zwergdommel Sehr seltener Brutvogel Sehr seltener Brutvogel Sehr seltener Brutvogel<br />
Schwarzstorch Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Weißstorch Unregelmäßiger Brutvogel Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Fischadler<br />
Unregelmäßiger und<br />
seltener Brutvogel<br />
Unregelmäßiger und<br />
seltener Brutvogel<br />
Kornweihe Brutnachweis nur 1842 Fehlt Fehlt<br />
Ausgestorben um 1980<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Abnahme von 1963 – 1993,<br />
danach Zunahme<br />
Erstbesiedlung 1996,<br />
bisher einziger Brutnachweis<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
Brutnachweise seit 1981<br />
0 BP<br />
40 – 50 BP<br />
0 BP<br />
2 – 3 BP<br />
Ausgestorben Ausgestorben 0 BP<br />
Brutvogel bis 1946 in<br />
Frießnitz<br />
Keine Nachweise bekannt<br />
Mehrfache Brutverdachte bis<br />
1987, dann <strong>aus</strong>gestorben<br />
Erstbesiedlung um 1988,<br />
Zunahme<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Brutnachweis nur 1988,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Brutnachweis nur 1976,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
0 BP<br />
4 – 7 BP<br />
1 BP<br />
0 BP<br />
0 BP<br />
201
Vogelart 1800 – 1849 1850 – 1899 1900 – 1949 1950 – 2009<br />
ADEBAR<br />
2005 – 2008<br />
Wiesenweihe Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Brutnachweis nur 1994,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
0 BP<br />
Rohrweihe Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Besiedlungsbeginn ~ 1958, 17 – 22 BP<br />
gleichbleibender Bestand<br />
Rotmilan Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel Fehlt<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Wiederbesiedlung ~ 1960, 55 – 83 BP<br />
gleichbleibender Bestand<br />
Schwarzmilan Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Erstbesiedlung ~ 1984,<br />
20 – 24 BP<br />
Zunahme<br />
Baumfalke Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
schwankender Bestand,<br />
10 BP<br />
Zunahme<br />
Wanderfalke Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel Fehlt<br />
Wiederbesiedlung 2005,<br />
Zunahme<br />
2 – 3 BP<br />
Wasserralle Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Zunahme<br />
11 – 15 BP<br />
Wachtelkönig<br />
Regelmäßiger und Regelmäßiger und<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
Starke Abnahme<br />
häufiger Brutvogel häufiger Brutvogel<br />
Abnahme<br />
2 – 3 BP<br />
Vermutlich regelmäßiger<br />
Tüpfelsumpfhuhn Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Starke Abnahme<br />
Brutvogel seit 1981,<br />
0 – 1 BP<br />
Abnahme<br />
Kleines Sumpfhuhn Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Unklare Bestandssituation Unklare Bestandssituation ?<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Teichhuhn<br />
z.Zt. Zunahme<br />
Regelmäßiger und Regelmäßiger und Regelmäßiger und Rückgang in den 1970erhäufiger<br />
Brutvogel häufiger Brutvogel häufiger Brutvogel und 1990er-Jahren<br />
52 – 76 BP<br />
Kiebitz<br />
Flussregenpfeifer<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Starke Abnahme<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Bekassine Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Starke Abnahme<br />
Flussuferläufer Spärlicher Brutvogel Spärlicher Brutvogel Abnahme<br />
Waldwasserläufer Fehlt Fehlt Keine Nachweise<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
starke Abnahme<br />
nach 1980<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Zunahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
starke Abnahme<br />
Brutverdachte 1965 / 66 / 74<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
Brutnachweise 1975, 2003<br />
18 – 34 BP<br />
35 – 56 BP<br />
2 – 3 BP<br />
0 BP<br />
2 – 3 BP<br />
202
Vogelart 1800 – 1849 1850 – 1899 1900 – 1949 1950 – 2009<br />
Schleiereule<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Zunahme<br />
Raufußkauz Seltener Brutvogel Keine Nachweise<br />
Steinkauz<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Vermutlich Brutvogel,<br />
keine intensive Suche<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Uhu Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel<br />
Ziegenmelker Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel<br />
Eisvogel<br />
Wiedehopf<br />
Wendehals<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Häufig zu Anfang des 19.<br />
Jh., dann Abnahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
starker Rückgang durch<br />
Wasserverschmutzung<br />
Seltener und<br />
unregelmäßiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
mit leichter Abnahme<br />
Seltener Brutvogel,<br />
lokale Zunahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
starker Rückgang durch<br />
Wasserverschmutzung<br />
Keine Nachweise<br />
Regelmäßiger aber<br />
seltener Brutvogel<br />
Mittelspecht Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel<br />
Rotkopfwürger<br />
Häufig zu Anfang des 19.<br />
Jh., dann Abnahme<br />
Selten, aber leichte<br />
Zunahme um 1878<br />
Schwarzstirnwürger Sehr seltener Brutvogel Sehr seltener Brutvogel<br />
Raubwürger<br />
Dohle<br />
Saatkrähe<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger und<br />
häufiger Brutvogel<br />
Fehlt vermutlich<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Abnahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Abnahme<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Abnahme<br />
Seltener und<br />
unregelmäßiger Brutvogel<br />
Weder Sicht- noch Brutnachweise<br />
Fehlt<br />
Beutelmeise Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Zunahme nach 1945<br />
Keine Nachweise mehr<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
gleichbleibender Bestand<br />
mit Schwankungen<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
vermutlich gleichbleibender<br />
Bestand, intensive Suche<br />
erst ab den späten 1980er-<br />
Jahren<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
starke Abnahme seit 1960,<br />
letzte Bruten 2000<br />
Zunahme bis 1990, dann<br />
gleichbleibender Bestand<br />
Vermutlich nur noch<br />
unregelmäßiger Brutvogel,<br />
starke Abnahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Zunahme seit 1990,<br />
witterungsbedingte<br />
Bestandsschwankungen<br />
Letzter Brutnachweis 1950,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Nach starker Abnahme niedrigeres<br />
Bestandsniveau<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
vermutlich gleichbleibender<br />
Bestand<br />
Letzte Brutnachweise 1987,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Brutnachweis nur 1976,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Wiederbesiedlung ~ 1960,<br />
vom Aussterben bedroht<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Zunahme<br />
Brutversuch 1976,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Erster Brutnachweis 1987,<br />
vom Aussterben bedroht<br />
ADEBAR<br />
2005 – 2008<br />
33 – 49 BP<br />
27 – 41 BP<br />
0 BP<br />
9 BP<br />
0 BP<br />
40 – 50 BP<br />
0 BP<br />
25 – 37 BP<br />
10 – 14 BP<br />
0 BP<br />
0 BP<br />
2 – 3 BP<br />
123 – 284 BP<br />
0 BP<br />
2 – 3 BP<br />
203
Halsbandschnäpper<br />
Fehlt<br />
Vogelart 1800 – 1849 1850 – 1899 1900 – 1949 1950 – 2009<br />
ADEBAR<br />
2005 – 2008<br />
Haubenlerche<br />
In den 1840er-Jahren Regelmäßiger und Regelmäßiger und Letzte Brut 2003,<br />
eingewandert<br />
häufiger Brutvogel häufiger Brutvogel Bestand z.Zt. erloschen<br />
0 BP<br />
Heidelerche<br />
Regelmäßiger und Regelmäßiger Brutvogel, Regelmäßiger Brutvogel, Regelmäßiger Brutvogel,<br />
häufiger Brutvogel starke Abnahme<br />
weitere Abnahme Zunahme seit ~ 2005<br />
16 – 24 BP<br />
Uferschwalbe<br />
Regelmäßiger und Regelmäßiger Brutvogel, Regelmäßiger Brutvogel, Letzte Brut 2002,<br />
häufiger Brutvogel Abnahme<br />
starke Abnahme<br />
Bestand z.Zt. erloschen<br />
0 BP<br />
Rauchschwalbe<br />
Regelmäßiger und Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel,<br />
häufiger Brutvogel mit Schwankungen mit Schwankungen Abnahme seit ~ 1960<br />
1009 – 2780 BP<br />
Mehlschwalbe<br />
Regelmäßiger und Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel<br />
häufiger Brutvogel mit Schwankungen mit Schwankungen Abnahme seit ~1960<br />
1181 – 3227 BP<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Schlagschwirl Fehlt Unregelmäßiger Brutvogel Fehlt<br />
Wiederbesiedlung 1976<br />
42 – 70 BP<br />
Zunahme<br />
Rohrschwirl Fehlt Fehlt Fehlt Unregelmäßiger Brutvogel 0 – 1 BP<br />
Schilfrohrsänger<br />
Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Keine Nachweise<br />
mit geringem Bestand mit geringem Bestand<br />
Zunahme<br />
2 – 3 BP<br />
Drosselrohrsänger Fehlt<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Fehlt<br />
Wiederbesiedlung 1958,<br />
nach Einwanderung<br />
fehlte von 1969 – 1988<br />
2 – 3 BP<br />
Sperbergrasmücke Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Zunahme<br />
13 – 15 BP<br />
Zwergschnäpper Fehlt<br />
Vermutlich unregelmäßi-<br />
Vermutlich unregelmäßi-<br />
Vermutlich regelmäßiger<br />
0 – 1 BP<br />
ger spärlicher Brutvogel<br />
Brutvogel nur<br />
<strong>aus</strong>nahmsweise<br />
ger spärlicher Brutvogel<br />
Brutvogel nur<br />
<strong>aus</strong>nahmsweise<br />
Braunkehlchen ? Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel<br />
Schwarzkehlchen Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel Fehlt<br />
Blaukehlchen Fehlt Fehlt Fehlt<br />
Steinschmätzer<br />
Steinsperling ?<br />
Häufiger Brutvogel<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Abnahme<br />
Einziger Bruthinweis<br />
bei Loitsch,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
Seltener Brutvogel,<br />
weitere Abnahme<br />
spärlicher Brutvogel<br />
Unregelmäßiger Brutvogel<br />
Bestand z.Zt. erloschen<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Bestandsrückgang ~ 1960,<br />
erneute Zunahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Wiederbesiedlung 2004,<br />
Zunahme<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Besiedelung seit 1994<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
Zunahme ~ 1960,<br />
erneute Abnahme<br />
0 BP<br />
17 – 23 BP<br />
~ 5 BP<br />
2 – 3 BP<br />
4 – 7 BP<br />
<strong>aus</strong>gestorben <strong>aus</strong>gestorben 0 BP<br />
204
Vogelart 1800 – 1849 1850 – 1899 1900 – 1949 1950 – 2009<br />
Brachpieper Regelmäßiger Brutvogel Regelmäßiger Brutvogel<br />
Wiesenpieper<br />
Regelmäßiger (?)<br />
Brutvogel<br />
Nur ein Brutzeitnachweis<br />
1911<br />
Regelmäßiger Brutvogel Nur ein Nachweis ~ 1930<br />
Wiesenschafstelze Seltener Brutvogel Seltener Brutvogel Keine Nachweise<br />
Karmingimpel<br />
Grauammer<br />
Möglicherweise Brutvogel<br />
1836<br />
Fehlt<br />
Fehlt<br />
Ortolan Fehlt Fehlt<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
nach Einwanderung 1856<br />
Fehlt<br />
Regelmäßiger Brutvogel.<br />
Beobachtungen zur<br />
Brutzeit nur 1907<br />
Unregelmäßiger Brutvogel,<br />
Wiederbesiedlung 1967,<br />
weitere Bruten nur 1972 und<br />
2009, eventuell auch 2005<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Wiederbesiedlung ~ 1960,<br />
gleichbleibender Bestand<br />
Regelmäßiger Brutvogel,<br />
Wiederbesiedlung ~ 1955,<br />
gleichbleibender Bestand<br />
Seltener Brutvogel,<br />
Wiederbesiedlung 1987<br />
Regelmäßiger Brutvogel<br />
in den 1950-Jahren,<br />
ab 1970 starker Rückgang,<br />
zwei Jahrzehnte fehlend,<br />
Brutnachweise ab 2004,<br />
Zunahme<br />
Wiederbesiedlung ~ 1958,<br />
letzter Brutnachweis 1988,<br />
<strong>aus</strong>gestorben<br />
ADEBAR<br />
2005 – 2008<br />
1 BP<br />
29 – 52 BP<br />
39 – 78 BP<br />
0 – 1 BP<br />
8 – 20 BP<br />
0 BP<br />
205
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Bildnachweis<br />
Bildautoren<br />
fokus-natur / Frank Leo<br />
fokus-natur / Torsten Pröhl<br />
Seitenangaben<br />
86 – 88 – 89 – 90 – 91 – 98 – 106 – 107 – 120 –- 128 – 130 – 132 – 134<br />
140 – 144 – 146 – 149 – 151 – 153 – 155 – 161 – 163 – 166 – 170 – 174<br />
176 – 179 – 181 – 183 – 186 – 189 – 191 – 193 – 196<br />
87 – 93 – 109 – 111 – 112 – 114 – 115 – 117 – 119 – 126 – 135 – 136<br />
138 – 142 – 148 – 154 – 157 – 159 – 168 – 184 – 188 – 195 – 198<br />
Andreas Winkler 122 – 160 – 172 – 173 – 178<br />
Jens Halbauer 92 – 103 – 104 – 110 – 124<br />
Dr. Jochen Wiesner 95 – 96<br />
Fotonatur / Sönke Morsch 101<br />
Fotonatur / Frank Derer 125<br />
Dr. Siegfried Kl<strong>aus</strong> 97<br />
Annette Frühauf 100<br />
Wolfgang Frühauf 165<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 206
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Literaturverzeichnis<br />
ANDRETZKE, H., T. SCHIKORE & K. SCHRÖDER (2005): Artensteckbriefe. In: SÜDBECK, P. et al. (Hrsg.): Methodenstandards<br />
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. S.135 – 695. Radolfzell.<br />
Anonym (1962): Phänologie und Faunistik. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief 6, 2 – 7.<br />
AUERSWALD, J. (1979): Erneutes Brutvorkommen vom Schwarzstirnwürger, Lanius minor Gmelin, und vom<br />
Rotkopfwürger, Lanius senator L., in Ostthüringen. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 26, 62 – 63.<br />
BAEDEKER, FR. W. J. (1855): Die Eier der europäischen Vögel nach der Natur gemalt. Mit einer Beschreibung<br />
des Nestbaues von Brehm. – Iserlohn.<br />
BARNIKOW, G. (1978): Halsbandschnäpper – Ficedula albicollis TEMM. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera. Loseblattsammlung, 2 S.<br />
-, E. SCHÜTZ, & W. STÖSSEL (1971): Ornithologische Notizen <strong>aus</strong> Auma und Umgebung. – Jahrbuch des<br />
Museums Hohenleuben – Reichenfels 19, 73 – 90.<br />
BAUCH, W. (1952): Verschwinden des Kiebitz. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen 3, 69.<br />
- (1963): Uhubrut – eine seltene Beobachtung. – Heimatbote, Kulturspiegel für den Kreis Greiz 9, 205 –<br />
208.<br />
- (1963 / 64): Ungewöhnlich erfolgreiche Uhubrut im Bezirk Gera. – Beiträge zur Vogelkunde 9, 396 – 401.<br />
BAUER, H.-G., P. BERTHOLD, P. BOYE, W. KNIEF, P. SÜDBECK & K. WITT (2002): Rote Liste der Brutvögel<br />
Deutschlands. 3., überarbeitete Fassung, 08.05.2002. – Berichte zum Vogelschutz 39, 13 – 60.<br />
- E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. 2. Auflage. – Wiebelsheim.<br />
BAUM, H.-G. (1987): Die Vogelwelt von Weida und Umgebung. – Kreismuseum Weida 5, 38 – 44.<br />
- & J. AUERWALD (1990): Karmingimpel (Carpodacus erythrinus) im Bezirk Gera. – Veröffentlichungen der<br />
Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 17, 93 – 94.<br />
BREHM C. L. (1820 – 22): Beiträge zur Vögelkunde in vollständigen Beschreibungen mehrerer neu entdeckter<br />
und vieler seltener, oder nicht gehörig beobachteter deutscher Vögel. – Neustadt / Orla. [Band 3 mit W.<br />
SCHILLING].<br />
- (1823 – 24): Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel. – Jena.<br />
- (1832): Einige Beobachtungen über die Vögel um Renthendorf vom Februar 1830 an nebst mehreren<br />
anderen. – Isis (Oken) 16, 734 – 752, 836 – 858.<br />
- (1833): Einige Beobachtungen über die Vögel um Renthendorf vom Februar 1830 an nebst mehreren<br />
anderen. – Isis (Oken) 17: 771 – 790.<br />
BRETSCHNEIDER, P. (1883): Die Vögel des Vogtlandes. – Plauen.<br />
CZERLINSKY, H. (1966): Die Vogelwelt im nördlichen Vogtland. – Veröffentlichungen des Heimatmuseums<br />
Burg Mylau, Heft 3.<br />
DANNHAUER, K. (1963): Die Vogelwelt des Vogtlandes. – Vogtländisches Kreismuseum Plauen, Museumsreihe<br />
26, 1 – 88.<br />
DERSCH, F. (1925): Die Brutvögel des Vogtlandes. – Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung<br />
1.<br />
DERSCH, F. (1933): Die Vogelwelt des Vogtlandes. – Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung<br />
8, 2 – 7.<br />
DETMERS, E. (1912): Ein Beitrag zur Verbreitung einiger jagdlich wichtiger Brutvögel in Deutschland. – Jahrbuch<br />
des Institutes für Jagdkunde Neudamm 1, 65 – 164.<br />
DOMBROWSKI, E. V. (1893): Beiträge zur Ornis des Fürstenthums Reuß ä. L. – Ornithol. Jahrb. 4, 131 – 140.<br />
FEUSTEL, C. (1903): Seltene Vögel in der Umgebung von Gera. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde<br />
der Naturwissenschaften zu Gera 43 – 45, 79 – 80.<br />
- (1908): Seltenheiten der Avifauna von Gera im Jahre 1907. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde<br />
der Naturwissenschaften zu Gera 49 – 50, 103 – 104.<br />
- (1912): Seltenheiten der Avifauna von Gera in den Jahren 1910 bis 1911. – Jahresbericht der Gesellschaft<br />
der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 53 – 54, 123 – 124.<br />
FLÖßNER, D. (1975): Saatkrähe – Corvus frugilegus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1977 a): Wachtelkönig – Crex crex (L.) – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1977 b): Haubenlerche – Galerida cristata (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1977 c): Heidelerche – Lullula arborea (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1977 d): Schafstelze – Motacilla flava L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 207
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
FLÖßNER D. (1979 a): Eisvogel – Alcedo atthis L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
6 S.<br />
- (1979 b): Wiedehopf – Upupa epops L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1979 c): Raubwürger – Lanius excubitor L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
6 S.<br />
- (1981 a): Grauammer – Emberiza calandra L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1981 b): Ortolan – Emberiza hortulana L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1984 a): Birkhuhn – Tetrao tetrix (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1984 b): Auerhuhn – Tetrao urogallus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
6 S.<br />
FRICK, S. (2004): Thüringenweite Erfassung des Mittelspechtes Dendrocopos medius in den Jahren 2001<br />
und 2002. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 5, 57 – 66.<br />
FRITZLAR, F. & W. WESTHUS (2001): Rote Listen Thüringens – Gefährdungskategorien und Gefährdung der<br />
Arten und Lebensräume. – Naturschutzreport 18, 9 – 29.<br />
GERTH, W. (1958): Ornithologische Beobachtungen in Baumschulen. – Der Falke 5, 185 – 190.<br />
GÖRNER, M. (1973): Über das Vorkommen und den Bestand des Eisvogels, Alcedo atthis L., in Thüringen. –<br />
Beiträge zur Vogelkunde 19, 376 – 389.<br />
- (1974): Uhu – Bubo bubo (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung, 2 S.<br />
- (1978): In Felsen, Steinbrüchen und Lockergesteinswänden Thüringens brütende Vögel. – Ornithologische<br />
Jahres<strong>berichte</strong> des Museums Heineanum 3, 43 – 62.<br />
- (1998): Zur Populationsdynamik des Uhus (Bubo bubo) in Thüringen I. Bestandsentwicklung und<br />
Schutzmaßnahmen. – Acta ornithoecologica 4, H. 1, 3 – 27.<br />
GOTTSCHALK, C. (1982 a): Wachtel – Coturnix coturnix (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1982 b): Rebhuhn – Perdix perdix (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
GRIMM, H. (1985): Zum Vorkommen und Schutz des Steinkauzes (Athene noctua) in Thüringen. – Veröffentlichungen<br />
der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 11, 83 – 89.<br />
- (2000): Zur historischen und aktuellen Situation der Haubenlerche Galerida cristata in Thüringen. – Anzeiger<br />
des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 4, 59 – 76.<br />
- (2004): Der Brutbestand des Steinschmätzers Oenanthe oenanthe im Jahr 2002 in Thüringen mit Anmerkungen<br />
zur historischen Entwicklung der thüringischen Kulturlandschaft und ihrer Eignung als Lebensraum<br />
für im Offenland brütende Vogelarten. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 5,<br />
85 – 104.<br />
GRÜN, G. (1971): Verbreitung und Brutbestand des Rotmilans, Milvus milvus (L.), in Thüringen. – Thüringer<br />
Ornithologischer Rundbrief 17 / 18, 25 – 30.<br />
- (1972): Avifaunistischer Sammelbericht <strong>aus</strong> Thüringen (Bezirke Erfurt, Gera und Suhl) für das Jahr<br />
1971. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief 19 / 20, 48 – 51.<br />
-, J. HEYER & Mitarbeiter (1973): Verzeichnis der Vögel Thüringens 1945 – 1971. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief, Sonderheft 1.<br />
GÜNTHER, R. (1968): Bemerkenswerte Veränderungen in der Vogelwelt Ostthüringens. – Der Falke 15, 196 –<br />
199.<br />
- (1969): Die Vogelwelt Geras und seiner Umgebung. – Veröffentlichungen der Städtischen Museen Gera<br />
1, 1 – 63.<br />
- (1972): Mehlschwalbe – Delichon urbica (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1973): Schilfrohrsänger – Acrocephalus schoenobaenus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 2 S.<br />
- (1975 a): Krickente – Anas crecca L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
1 S.<br />
- (1975 b): Knäkente – Anas querquedula L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1977 a): Brachpieper – Anthus campestris (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1977 b): Wiesenpieper – Anthus pratensis (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1979 a): Ziegenmelker – Caprimulgus europaeus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 208
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
GÜNTHER. R.(1979 b): Rotkopfwürger – Lanius senator L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1981 a): Bekassine – Gallinago gallinago (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1981 b): Waldwasserläufer – Tringa ochropus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1982): Zur Bestandssituation des Steinkauzes, Athene noctua (SCOPOLIE), im Bezirk Gera. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 28, 39 – 42.<br />
- (1991): Zum Vorkommen der Grauammer, Emberiza calandra L. einst und jetzt. – Thüringer Ornithologische<br />
Mitteilungen 41, 75 – 78.<br />
HABICHT, K. (1977): Steinschmätzer – Oenanthe oenanthe (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 2 S.<br />
HAUBENREISSER, M. (1990): Nestfunde der Beutelmeise (Remiz pendulinus) im Bezirk Gera. – Veröffentlichungen<br />
der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 17, 98.<br />
HELLER, F. (1893): Seltsame Brutstätten. – Ornithologische Monatsschrift 18, 293 – 295.<br />
- (1894): Von der Uferschwalben-Kolonie bei Zwötzen a.d. Elster. – Ornithologische Monatsschrift 19,<br />
129 – 130.<br />
- (1895): Einige Beobachtungen <strong>aus</strong> Gera`s Umgebung 1894. – Ornithologische Monatsschrift 20,<br />
67 – 69.<br />
- (1897): Am Wojderteich. – Ornithologische Monatsschrift 22, 98 – 102.<br />
- (1899): Eisenbahnvögel. – Ornithologische Monatsschrift 24, 176 – 178.<br />
- (1926): Die Brutvögel in der Umgebung von Greiz. – In: Festschrift zu der Feier des 50jährigen Bestehens<br />
„<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ zu Greiz, 51 – 63.<br />
HENNICKE, C. R. (1893): K. Th. Liebes Ornithologische Schriften. – Leipzig.<br />
- (1896): Vogelfang im Mittelalter in Reuß j. L. – Ornithologische Monatsschrift 21, 70 – 71.<br />
HEYDER, R. (1952): Die Vögel des Landes Sachsen. – Leipzig.<br />
HEYER, J. (1967 a): Beobachtungen am Frießnitzer Teich und am Weiderteich. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief 10, 10 –12.<br />
- (1967 b): Avifaunistische Beobachtungen am Frießnitzer Teich und an den Pöllnitzer Teichen. – Thüringer<br />
Ornithologischer Rundbrief 11, 10 – 11.<br />
- (1993 / 94): Hat das Zwergsumpfhuhn, Porzana pusilla (Pallas), in Ostthüringen gebrütet? – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 43 / 44, 95 – 97.<br />
- (1997): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1991. – Thüringer<br />
<strong>ornithologische</strong> Mitteilungen 47, 53 – 73.<br />
- (1999 a): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1992. – Thüringer<br />
<strong>ornithologische</strong> Mitteilungen 48, 43 – 71.<br />
- (1999 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1993. – Thüringer<br />
<strong>ornithologische</strong> Mitteilungen 48, 72 – 96.<br />
- (2000): Beobachtungsbericht über <strong>aus</strong>gewählte Vogelarten für Thüringen 1994. – Thüringer <strong>ornithologische</strong><br />
Mitteilungen 49, 43 – 71.<br />
HILDEBRANDT, H. (1919): Beitrag zur Ornis Ostthüringens. – Mitteilungen <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Osterlande Neue Folge<br />
16, 289 – 371.<br />
- (1938): Hat der Fischadler in Thüringen gebrütet? – Mitteilungen des <strong>Verein</strong>s sächsischer Ornithologen<br />
5, 234 – 238.<br />
- & W. SEMMLER (1975): Ornis Thüringens. Teil 1 Passeriformes. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief,<br />
Sonderheft 2.<br />
- & - (1976): Ornis Thüringens. Teil 2 Nonpasseriformes z.T. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief,<br />
Sonderheft 3.<br />
- & - (1978): Ornis Thüringens. Teil 1 Nonpasseriformes Rest. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief,<br />
Sonderheft 4.<br />
HIRSCHFELD, K. (1930): Der Eisvogel. – Der Pflüger 7, 477 – 479.<br />
- (1931): Ornithologische Beobachtungen von Februar bis September 1930 in der Gegend von<br />
Hohenleuben. – Ornithologische Monatsschrift 56, 20 – 28.<br />
- (1932): Die Vogelwelt der Umgebung von Hohenleuben. – Jahresbericht des Vogtländischen Altertumsforschenden<br />
<strong>Verein</strong>s Hohenleuben 91 – 102, 95 – 141.<br />
HÖPSTEIN, G. (1983): Rauchschwalbe – Hirundo rustica L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
6 S.<br />
JANSEN, S. (2001): Verbreitung und Habitatwahl der Grauammer (Miliaria calandra L.) in Thüringen 1994 bis<br />
1999. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 38, 17 – 23.<br />
KLEMM, W. (1998): Das Naturschutzgebiet Frießnitzer See – Struth im Kreis Greiz (Thüringen), Arbeitsgruppe<br />
Artenschutz Thüringen e. V. Unveröffentlichtes Gutachten.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 209
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
KNEIS, P. & H. LANGE (1990): Brütende Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) im Schwarzatal und im Tal<br />
der Weißen Elster (Bezirk Gera). – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche<br />
Reihe. 17, 86 – 92.<br />
KNORRE, D. V. (1972): Rotmilan – Milvus milvus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1977): Zwergralle – Porzana pusilla (PALLAS). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
1 S.<br />
- (1982): Uferschwalbe – Riparia riparia (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1986): Die Vogelwelt Thüringens. – Jena.<br />
KOEPERT, O. (1896): Die Vogelwelt des Herzogtums Sachsen – Altenburg. – Journal für Ornithologie 44,<br />
217 – 248, 305 – 331.<br />
KRÜGER, H. (1982): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1979. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 28, 59 – 76.<br />
- (1983 a): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1980. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 30, 49 – 68.<br />
- (1983 b): Baumfalke – Falco subbuteo L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1985 a): Zur Bestandsentwicklung des Baumfalken (Falco subbuteo) in Thüringen. – Veröffentlichungen<br />
der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 11, 105 – 108.<br />
- (1985 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1981. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 33, 53 – 76.<br />
- (1986 a): Zur Bestandsentwicklung des Weißstorches, Ciconia ciconia (L.) in Ostthüringen. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 34, 29 – 33.<br />
- (1986 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1982. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 35, 51 – 76.<br />
- (1989): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1984. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 39, 33 - 60.<br />
- (1990): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1985. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 40, 25 – 54.<br />
- (1992): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1986. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 42, 26 – 51.<br />
- (1993 / 94): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1987. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 43 / 44, 34 – 52.<br />
- (1995 a): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1988. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 45, 33 - 57.<br />
- (1995 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen. – Jahresbericht 1989. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 45, 58 – 83.<br />
- (1996): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1990. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 46, 58 – 89.<br />
- (1997): Rückläufige Bestandsentwicklung des Weißstorches, Ciconia ciconia (L.), in Ostthüringen. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 47, 88 – 93.<br />
Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelwarten (2007): Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen<br />
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen <strong>aus</strong>gewählter Vogelarten. – Berichte zum Vogelschutz<br />
44, 151 – 153.<br />
LANGE, H. (1983): Flußregenpfeifer – Charadrius dubius SCOP. - Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 3 S.<br />
- (1988): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen <strong>aus</strong> Thüringen – Jahresbericht 1983. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 38, 53 – 76.<br />
- (1997): Die Vogelwelt des Greizer Parks. – Greizer Heimatkalender 1997, 144 – 146.<br />
- & F. LEO (1978): Die Vögel des Kreises Greiz. – Staatliche Museen Greiz.<br />
- & K. LIEDER ( 2001): Kommentierte Artenliste der Vögel des Landkreises Greiz und der Stadt Gera. –<br />
Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 28, 16 – 70.<br />
LEO. F & H. LANGE (1981): Die Vogelwelt des Aubachtales. – Jahrbuch des Museums Hohenleuben – Reichenfels<br />
26, 44 – 67.<br />
LIEBE, K. T. (1873): Die der Umgebung von Gera angehörigen Brutvögel. – Jahresbericht der Gesellschaft<br />
der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 14 – 15, 26 – 53.<br />
- (1875): Zur Verbreitung der Rohrsänger. – Journal für Ornithologie 23, 207.<br />
- (1878): Die Brutvögel Ostthüringens und ihr Bestand. – Journal für Ornithologie 26, 1 – 88.<br />
- (1881): Die Witterung des Frühjahres 1881. – Ornithologisches Centralblatt 6, 113 – 117.<br />
- (1890): Ornithologische Skizzen. XV. Der Wanderfalke. – Ornithologische Monatsschrift 15, 365 – 370.<br />
- (1893): Der Baumfalke (Falco subbuteo L.). – Ornithologische Monatsschrift 18, 126 – 133.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 210
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
LIEBE, K. T. (1893): Aus Ostthüringen. – Ornithologische Monatsschrift 18, 403 – 406.<br />
LIEBERT, H. – P. (1983): Fischadler – Pandion haliaetus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
LIEDER, K. (1983 a): Rohrweihe – Circus aeruginosus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1983 b): Kornweihe – Circus cyaneus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1983 c): Kiebitz – Vanellus vanellus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1986): Zur Bestandsentwicklung der Teichralle , Gallinula chloropus (L.) im Bezirk Gera. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 34, 1 – 9.<br />
- (1987): Zur Entwicklung des Brutbestandes des Zwergtauchers, Tachybaptus ruficollis (PALL.), im Bezirk<br />
Gera im Zeitraum 1960 – 1984. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 37, 51 – 55.<br />
- (1989): Zur Bestandsentwicklung von Zwergtaucher (Podiceps ruficollis) und Teichralle (Gallinula chloropus)<br />
im Bezirk Gera. – Beiträge zur Vogelkunde 35, 148 – 152.<br />
- (2001): Die Besiedlung Thüringens durch den Schlagschwirl Locustella fluviatilis im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
– Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen. 4, 163 – 172.<br />
- (2004): Zur Brutvogelfauna der Gewässer um Gera. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera,<br />
Naturwissenschaftliche Reihe 31, 22 – 37 (Teil 1), 27 – 29 (Teil 2).<br />
- (Ms.): Zum Vorkommen der Lappentaucher (Podicipedidae) Anfang des 19.Jahrhundert im Landkreis<br />
Greiz.<br />
- & R. GÜNTHER (2002): Die Vogelwelt des Flächennaturdenkmales „Teich bei Kauern“. – Veröffentlichungen<br />
der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 29, 116 – 140.<br />
- & J. LUMPE (Ms.): Die Auswirkungen des Uranerzbergb<strong>aus</strong> in Ostthüringen auf einige Brutvogelarten.<br />
LORENZ, L. (1978): Weißstorch – Ciconia ciconia (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung<br />
4 S.<br />
LUMPE, J. (2008 a): Ein Grauganspaar mit Jungen im Hirschteich Greiz-Aubachtal. – Der Heimatbote, Beiträge<br />
<strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Landkreis Greiz und Umgebung. 6, 36 – 38.<br />
- (2008 b): Neuer Brutplatz des Schwarzstorches im Landkreis Greiz. – Der Heimatbote, Beiträge <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
Landkreis Greiz und Umgebung. 3, 37 – 39.<br />
- (2008 c): Die Vogelwelt im Greizer Park. – Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal. 1,<br />
96 – 176.<br />
- (2009): Weißstörche im Landkreis Greiz. – Der Heimatbote, Beiträge <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> Landkreis Greiz und Umgebung<br />
8, 38 – 39.<br />
-, H. LANGE & K. LIEDER (2008): Ornithologischer Jahresbericht 2007. – Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong><br />
<strong>mittleren</strong> Elstertal. 1, 23 – 84.<br />
- & K. LIEDER (2009): Ornithologischer Jahresbericht 2008. – Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong><br />
Elstertal. 2, 3 – 72.<br />
MÜLLER, L. (1862): Beobachtungen über Ankunft und Abzug unserer Wandervögel im Jahr 1862. – Jahresbericht<br />
der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 5, 67 – 74.<br />
NAUMANN, J. F. (1897 – 1905): Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. – Hrsg. C. R. HENNICKE, Gera-<br />
Untermh<strong>aus</strong>.<br />
NOWAK, E., J. BLAB & R. BLESS (1994): Rote Listen der gefährdeten Wirbeltierarten in Deutschland. – Schriftenreihe<br />
Landschaftspflege und Naturschutz 42.<br />
ÖLSCHLEGEL, H. (1974): Zwergtaucher – Podiceps ruficollis (Pallas). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera. Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- (1978): Sperbergrasmücke – Sylvia nisoria (BECHSTEIN). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 2 S.<br />
Ornithologische Sektion Gera (1859): Verzeichniß der in der Umgebung von Gera beobachteten Vögel. –<br />
Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 2, 31 – 37.<br />
PETER, H.-U. (1980): Schlagschwirl – Locustella fluviatilis (WOLF). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera. Loseblattsammlung, 3 S.<br />
- (1993): Verbreitung und Häufigkeit der Dohle (Corvus monedula L.) in Ostthüringen. – Jenaer Geographische<br />
Schriften 1, 37 – 43.<br />
PFEIFER, T. (2001): Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans Milvus milvus im Jahr 2000 in Thüringen.<br />
– Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen. 4, 129 – 137.<br />
RITTER, F. (1974): Steinkauz – Athene noctua (Scopoli). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- & D. V. KNORRE (1975): Schleiereule – Tyto alba (Scopoli). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- & R. GÜNTHER (1974): Raufußkauz – Aegolius funereus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 2 S.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 211
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
RÖHRIG, G. (1900): Die Verbreitung der Saatkrähe in Deutschland. – Arbeiten der Biologischen Abteilung für<br />
Land- und Forstwirtschaft 1, 271 – 284.<br />
ROßBACH, R. (1935 / 36): Ornithologische Seltenheiten in der Umgebung von Gera. – Jahresbericht der Gesellschaft<br />
der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 78 – 79, 52 – 54.<br />
ROST, F. (1995): Der Brutbestand von Bläßhuhn (Fulcia ater) und Teichhuhn (Gallinula chloropus) in Thüringen<br />
1994. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 2, 145 – 157.<br />
- (1998): Der Brutbestand der Lappentaucher (Podicipidae) 1997 in Thüringen. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s<br />
Thüringer Ornithologen 3, 185 – 201.<br />
- (1999): Der Brutbestand der Gänse (Anser, Branta) und Enten (Anatidae) 1998 in Thüringen. – Anzeiger<br />
des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 3, 103 – 116.<br />
- (2001): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2000. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 19, 1 – 30.<br />
- (2002): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2001. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 21, 1 – 34.<br />
- (2003): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2002. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 24, 1 – 29.<br />
- (2004): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2003. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 26, 1 – 34.<br />
- (2005): Brutvorkommen und Durchzug der Beutelmeise Remiz pendulinus in Thüringen. – Anzeiger des<br />
<strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 5, 117 – 127.<br />
- (2006): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2005. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 28, 1 – 35.<br />
- (2007): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2006. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 29, 1 – 39.<br />
-, B. FRIEDRICH & H. LANGE (1995): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1994. – <strong>Verein</strong> Thüringer<br />
Ornithologen e. V.– Mitteilungen und Informationen, Sonderheft.<br />
-, -, - (1996): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1995. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 10, 1 – 25.<br />
-, -, - (1997): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1996. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 12, 1 – 26.<br />
-, -, - (1998): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1997. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 14, 1 – 31.<br />
-, -, - (1999): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1998. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 15, 1 – 28.<br />
-, -, - (2000): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1999. – <strong>Verein</strong> Thüringer Ornithologen e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 18, 1 – 29.<br />
- & H. GRIMM (2004): Kommentierte Artenliste der Vögel Thüringens. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer<br />
Ornithologen 5, Sonderheft. 3 – 78.<br />
RUDAT, V. (1975): Dohle – Corvus monedula (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
SCHEFFEL, J. (1978): Wendehals – Jynx torquilla L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- & R. Günther (1975): Teichralle – Gallinula chloropus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 4 S.<br />
SCHEIN, E. (1903): Ein Wachtelgelege. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften<br />
zu Gera, 43 – 45, 86.<br />
SCHEIN, E. (1910): Wendehals im Starkasten brütend. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften<br />
zu Gera 51 – 52, 120 – 121.<br />
SCHMIDT, K. [Barchfeld] (2000): Bestandssituation, Vorkommen und Bruterfolg des Weißstorches, Ciconia<br />
ciconia (L.), von 1994 bis 2000 in Thüringen. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 49 / 50, 113 –<br />
117.<br />
- (2004): Vorkommen, Bestandssituation und Bruterfolg der Dohle, Corvus monedula, in Thüringen – Ergebnisse<br />
einer Bestandserfassung im Jahr 2002. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 5,<br />
67 – 76.<br />
SCHMIDT, K. [Erfurt / Großfahner] (2001): Die Rohrweihe Circus aeruginosus 1999 in Thüringen – Versuch<br />
einer Bestandsermittlung. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer Ornithologen 4, 139 – 147.<br />
SCHMIDT, R. (1926): Allerlei Beobachtungen. – In: Festschrift zu der Feier des 50jährigen Bestehens „<strong>Verein</strong><br />
der Naturfreunde“ zu Greiz, 202 – 204.<br />
SEWITZ, A. & S. KLAUS (1999): Bestandsentwicklung und Bruterfolg des Schwarzstorches (Ciconia nigra) in<br />
Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 36, 48 – 54.<br />
SEYDEL, J. C. (1860): Spaziergänge in`s Holzland, besonders in naturwissenschaftlicher Hinsicht. – Jahresbericht<br />
der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 3, 39 – 51.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 212
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
SEYDEL, J. C. (1883): Der Frießnitzer See. Ein Heimatbild. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der<br />
Naturwissenschaften zu Gera 21 – 26, 225 – 231.<br />
STEFFENS, R., R. KRETZSCHMAR & S. RAU (1998): Atlas der Brutvögel Sachsens. In: Sächsisches Landesamt<br />
für Umwelt und Geologie (Hrsg.). – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden.<br />
STRESEMANN, E. (1951): Die Entwicklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart. – Aachen<br />
(Limberg).<br />
SÜDBECK, P., H-G. BAUER, M. BOSCHERT, P. BOYE & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands.<br />
4. Fassung, 30. November 2007. – Berichte zum Vogelschutz 44, 23 – 81.<br />
THEOPHIL, U. & H. WEIDNER (1990): Zur Situation des Rebhuhns, Perdix perdix (L.) im Bezirk Gera – eine<br />
vergleichende Bestandsanalyse. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 40, 19 – 24.<br />
TOLKMITT, S. (1979): Nachweis des Schlagschwirls, Locustella fluviatilis (Wolf) bei Greiz. – Thüringer Ornithologische<br />
Mitteilungen 25, 43 – 44.<br />
UHLMANN, E.(1940): Die Tierwelt Jenas. In LEHMANN, W. – Jena Thüringens Universitätsstadt in Vergangenheit<br />
und Gegenwart 1, 61 – 102.<br />
WEBENDÖRFER, F. & K. BLAM (1963): Aus der Vogelwelt des nördlichen Vogtlands zwischen Greiz und<br />
Wünschendorf. – In: DANNHAUER, K. – Die Vogelwelt des Vogtlandes. – Vogtländisches Kreismuseum<br />
Plauen, Museumsreihe 26, 66 – 67.<br />
WEISSGERBER, R. (2007): Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes. – Apus 13, Sonderheft.<br />
WERNER, J. (1964): Der Vogelbestand einer Talsperre. – Jahrbuch des Museums Hohenleuben – Reichenfels<br />
12 / 13, 84 – 111.<br />
WIESNER, J. (2001): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens. – Naturschutzreport 18, 35 – 39.<br />
-, S. KLAUS, H. WENZEL, A. NÖLLERT & W. WERRES (2008): Die EG-Vogelschutzgebiete Thüringens. – Naturschutzreport<br />
25, 1 – 360.<br />
WICHLER, E. (1952): Zur Ernährung der Schleiereule. – Mitteilungen Thüringer Ornithologen 3, 32.<br />
WOLF, E. (1975): Mittelspecht – Dendrocopos medius (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera. Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
ZAUMSEIL, J. (1985): Zur Bestandssituation des Roten Milans (Milvus milvus) in Thüringen. – Veröffentlichungen<br />
der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 11, 117 – 120.<br />
- (1986): Rotmilan. – In: KNORRE, D. V. u.a. (Hrsg.). – Die Vogelwelt Thüringens. Jena.<br />
- (1987): Die Bestandsentwicklung des Rotmilans Milvus milvus (L.) in Thüringen. – Wissenschaftliche<br />
Beiträge der Universität Halle 14, Populationsökologie Greifvögel- u. Eulenarten 1, 255 – 266.<br />
ZSCHIEGNER, W. (1977): Braunkehlchen – Saxicola rubetra (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera.<br />
Loseblattsammlung, 3 S.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 213
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Index der deutschen Vogelnamen<br />
Auerhuhn 97 Rohrweihe 112<br />
Baumfalke 117 Rothalstaucher 100<br />
Bekassine 132 Rotkopfwürger 153<br />
Beutelmeise 160 Rotmilan 114<br />
Birkhuhn 96 Saatkrähe 159<br />
Blaukehlchen 184 Schilfrohrsänger 173<br />
Brachpieper 189 Schlagschwirl 170<br />
Brandgans 87 Schleiereule 136<br />
Braunkehlchen 181 Schnatterente 88<br />
Dohle 157 Schwarzhalstaucher 101<br />
Drosselrohrsänger 174 Schwarzkehlchen 183<br />
Eisvogel 146 Schwarzmilan 115<br />
Feldschwirl 172 Schwarzstirnwürger 154<br />
Fischadler 109 Schwarzstorch 106<br />
Flussregenpfeifer 130 Sperbergrasmücke 176<br />
Flussuferläufer 134 Steinkauz 140<br />
Grauammer 196 Steinschmätzer 186<br />
Graugans 86 Steinsperling 188<br />
Halsbandschnäpper 179 Teichhuhn 126<br />
Haselhuhn 95 Tüpfelsumpfhuhn 124<br />
Haubenlerche 161 Uferschwalbe 165<br />
Heidelerche 163 Uhu 142<br />
Karmingimpel 195 Wachtel 92<br />
Kiebitz 128 Wachtelkönig 122<br />
Kleines Sumpfhuhn 125 Waldwasserläufer 135<br />
Knäkente 90 Wanderfalke 119<br />
Kornweihe 110 Wasserralle 120<br />
Krickente 89 Weißstorch 107<br />
Löffelente 91 Wendehals 149<br />
Mehlschwalbe 168 Wiedehopf 148<br />
Mittelspecht 151 Wiesenpieper 191<br />
Ortolan 198 Wiesenschafstelze 193<br />
Raubwürger 155 Wiesenweihe 111<br />
Rauchschwalbe 166 Ziegenmelker 144<br />
Raufußkauz 138 Zwergdommel 104<br />
Rebhuhn 93 Zwergschnäpper 178<br />
Rohrdommel 103 Zwergtaucher 98<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 214
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal 2 (2010)<br />
Bisher erschienene<br />
Ornithologische Berichte <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>mittleren</strong> Elstertal<br />
Band 1, Heft 1<br />
LIEDER, K. Dr. Günther Bindernagel (1926 – 2007) 3<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE Der Höckerschwan Cygnus olor (J. F. Gmelin 1789) 4 – 17<br />
LUMPE, J.<br />
Rotmilan Milvus milvus und Neuntöter Lanius collurio in der<br />
Gemeinde Kraftsdorf 18 – 22<br />
LUMPE, J., H. LANGE & K. LIEDER Ornithologischer Jahresbericht 2007 23 – 78<br />
LUMPE, J Aus <strong>dem</strong> <strong>Verein</strong>sleben 79 – 83<br />
Band 1, Heft 2<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE Der Singschwan Cygnus cygnus (Linnaeus 1758) 89 – 95<br />
LUMPE, J. Die Vogelwelt im Greizer Park 96 – 176<br />
Band 2, Heft 1<br />
LUMPE, J. & K. LIEDER Ornithologischer Jahresbericht 2008 3 – 72<br />
MÜLLER, F.<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE<br />
Erste Ergebnisse von Zugplanbeobachtungen im Raum<br />
Plauen 73 – 74<br />
Die Brutvorkommen des Eisvogels Alcedo atthis (Linnaeus<br />
1758) in den Jahren 2004 bis 2008 im Landkreis Greiz und<br />
der Stadt Gera 75 – 78<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Bewährung der Artendiversität im Landkreis Greiz und der Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel... 215