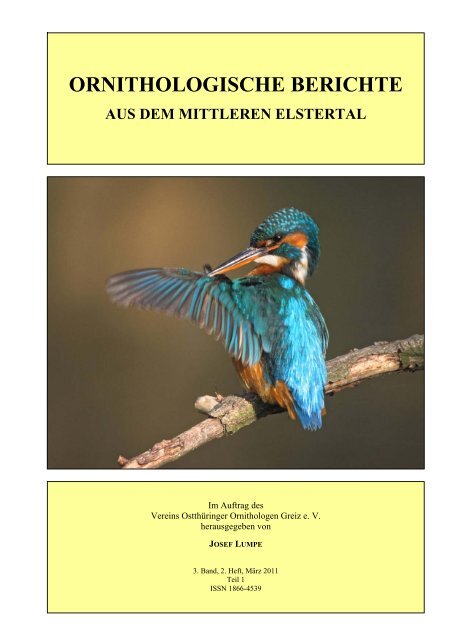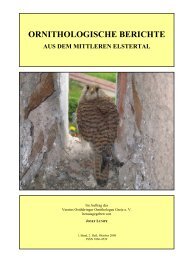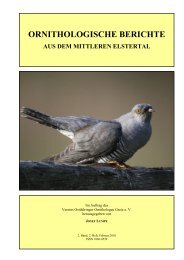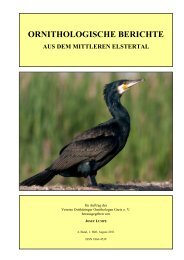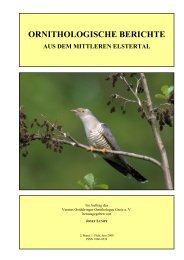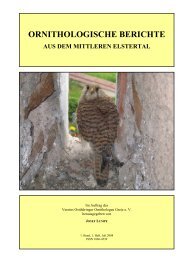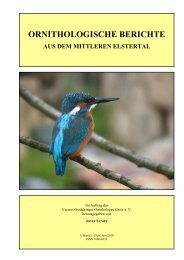E-Mail Dokumentvorlage - Verein Ostthüringer Ornithologen Greiz eV
E-Mail Dokumentvorlage - Verein Ostthüringer Ornithologen Greiz eV
E-Mail Dokumentvorlage - Verein Ostthüringer Ornithologen Greiz eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ORNITHOLOGISCHE BERICHTE<br />
AUS DEM MITTLEREN ELSTERTAL<br />
Im Auftrag des<br />
<strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />
herausgegeben von<br />
JOSEF LUMPE<br />
3. Band, 2. Heft, März 2011<br />
Teil 1<br />
ISSN 1866-4539
ORNITHOLOGISCHE BERICHTE<br />
AUS DEM MITTLEREN ELSTERTAL<br />
Im Auftrag des<br />
<strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />
herausgegeben von<br />
JOSEF LUMPE<br />
3. Band, 2. Heft, März 2011<br />
Teil 2<br />
ISSN 1866-4539
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal<br />
Verlagsrechte beim <strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V. (VOOG)<br />
Erscheinungsort: <strong>Greiz</strong><br />
Heft 2, Band 3, März 2011<br />
Teil 1, Nonpasseriformes<br />
Herausgeber und Schriftleiter im Auftrag des VOOG:<br />
Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />
Redaktionelle Bearbeitung:<br />
Dipl.-Ing. Klaus Lieder, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg<br />
(Tel.: 0 36 60 2 / 3 58 61; e-mail: lieder-ornis@gitta-regner.de)<br />
<strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />
1952 – Gründung als Fachgruppe Ornithologie<br />
1993 – <strong>Verein</strong>sgründung<br />
Geschäftsstelle ist der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden<br />
Bankverbindung: Sparkasse Gera-<strong>Greiz</strong>, Konto-Nr.: 620 130, BLZ: 830 500 00<br />
Mitgliedsbeitrag: 15,00 €/Jahr<br />
Homepage: www.ornithologen-greiz.de<br />
Vorstand<br />
1. Vorsitzender:<br />
Dipl.-Fachlehrer Wolfgang Frühauf, An der Eichleite 28, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
(Tel.: 0 36 61 / 67 46 40; e-mail: verein@ornithologen-greiz.de)<br />
2. Vorsitzender und Schatzmeister:<br />
Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />
Herstellung und Gestaltung<br />
Druck: VOOG – Computerdruck<br />
Bindung: VOOG – Thermo – Bindung<br />
Titelfoto: Torsten Pröhl, Eisvogel – Vogel des Jahres 2009<br />
ISSN 1866-4539
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal<br />
Verlagsrechte beim <strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V. (VOOG)<br />
Erscheinungsort: <strong>Greiz</strong><br />
Heft 2, Band 3, März 2011<br />
Teil 2, Passeriformes<br />
Herausgeber und Schriftleiter im Auftrag des VOOG:<br />
Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />
Redaktionelle Bearbeitung:<br />
Dipl.-Ing. Klaus Lieder, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg<br />
(Tel.: 0 36 60 2 / 3 58 61; e-mail: lieder-ornis@gitta-regner.de)<br />
<strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />
1952 – Gründung als Fachgruppe Ornithologie<br />
1993 – <strong>Verein</strong>sgründung<br />
Geschäftsstelle ist der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden<br />
Bankverbindung: Sparkasse Gera-<strong>Greiz</strong>, Konto-Nr.: 620 130, BLZ: 830 500 00<br />
Mitgliedsbeitrag: 15,00 €/Jahr<br />
Homepage: www.ornithologen-greiz.de<br />
Vorstand<br />
1. Vorsitzender:<br />
Dipl.-Fachlehrer Wolfgang Frühauf, An der Eichleite 28, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
(Tel.: 0 36 61 / 67 46 40; e-mail: verein@ornithologen-greiz.de)<br />
2. Vorsitzender und Schatzmeister:<br />
Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />
Herstellung und Gestaltung<br />
Druck: VOOG – Computerdruck<br />
Bindung: VOOG – Thermo – Bindung<br />
Titelfoto: Torsten Pröhl, Eisvogel – Vogel des Jahres 2009<br />
ISSN 1866-4539
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Ornithologische Elstertal 3, Berichte 94 – 156 aus (Teil dem 1) mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
März 2011<br />
Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten<br />
im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />
Eine Bilanz nach 200 Jahren ornithologischer Forschung<br />
TEIL 1<br />
NONPASSERIFORMES – NICHTSPERLINGSVÖGEL<br />
KLAUS LIEDER* & JOSEF LUMPE**<br />
Mit 40 Abbildungen, 13 Verbreitungskarten, 2 Karten zu Brutgewässern, 1 Karte zu Brutorten, 1 Übersichtskarte<br />
Einleitung 95<br />
Definitionen und Abkürzungen 96<br />
Übersichtskarte 97<br />
Brutvogelarten 98<br />
Index der deutschen Vogelnamen 156<br />
* Dipl.-Ing. K. Lieder, Gessentalweg K. Lieder & 3, J. Lumpe: 07580 Ronneburg, Zur Bestandsentwicklung ** Dipl.-Ing. J. Lumpe, von Brutvogelarten Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
94
Einleitung<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Zum Umfang der Arbeit<br />
In einer ersten Arbeit zu den Brutvögeln des Landkreises <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera (LIEDER & LUMPE 2010)<br />
wurden alle Arten der Roten Liste Thüringens (WIESNER 2001) behandelt. Mit der folgenden Niederschrift<br />
(Teil 1 und Teil 2) sollen auch die restlichen Brutvögel bearbeitet werden, die auf dem Gebiet des Landkreises<br />
<strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera gebrütet haben bzw. noch brüten oder für die begründeter Brutverdacht bestand.<br />
Damit schließt sich eine noch vorhandene Lücke. Besonders hingewiesen wird auf die Rote Liste der<br />
Brutvögel Deutschlands 2007, auf Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie, auf streng geschützte<br />
Arten gemäß BNatSchG, auf die „Prioritären Arten für den Vogelschutz in Deutschland“ (aktualisierte<br />
Liste 2009) und auf den Status für den Landkreis <strong>Greiz</strong> und die Stadt Gera. In einigen Fällen sind Verbreitungskarten<br />
zu Brutgewässern, Brutorten oder der geschätzten Häufigkeit auf der Basis der TK 25 angefügt.<br />
Es wird in vielen Artkapiteln Bezug genommen auf die Ergebnisse der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />
2005 bis 2009 im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera.<br />
Danksagung<br />
Allen Mitgliedern des <strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V. und weiteren Naturfreunden, die uns ihr<br />
Datenmaterial zur Verfügung gestellt haben, sei hiermit herzlich gedankt. Unser Dank gilt besonders FRANK<br />
LEO und TORSTEN PRÖHL (Bildagentur fokus-natur.de), STEFAN OTT, SÖNKE MORSCH, HOLGER DUTY und GERD<br />
ROSSEN (Bildagentur Fotonatur.de), ECKHARD LIETZOW (Bildagentur lietzow-naturfotografie.de), BILL DRAKER<br />
(Imagebroker/Avenue Images) sowie SILVIO HEIDLER für die Bereitstellung der Abbildungen. Der Thüringer<br />
Anstalt für Umwelt und Geologie Jena danken wir für das Kartenmaterial.<br />
Vorbemerkungen<br />
Die „Lokalen Gefährdungsfaktoren“ und „Lokalen Schutzmaßnahmen“ orientieren sich an den umfassenden<br />
Angaben bei BAUER, BEZZEL & FIEDLER (2005). Für jede Art wurde geprüft, ob die entsprechenden Faktoren<br />
bzw. Schutzmaßnahmen für unser Gebiet zutreffen bzw. anwendbar sind. Gebietsspezifische Besonderheiten<br />
wurden ergänzt.<br />
In den einzelnen Artkapiteln wird oftmals auf die von HUGO HILDEBRANDT hinterlassene „Ornis Thüringens“<br />
verwiesen, die in mehreren Teilen in den 1970er-Jahren herausgegeben wurde (HILDEBRANDT & SEMMLER<br />
1975, 1976 und 1978). HILDEBRANDT lebte von 1889 bis zu seinem Tod 1946 in Thüringen und hinterließ<br />
eine umfassende Avifauna des Landes. Seine eigenen Feststellungen wurden in den nachfolgenden Artbearbeitungen<br />
dem Zeitraum „1900 bis 1950“ zugeordnet. Die Beobachtungen von CHRISTIAN LUDWIG BREHM<br />
aus Renthendorf wurden ebenfalls in diese Arbeit einbezogen, da sein Beobachtungsgebiet „um<br />
Renthendorf“ auch Teile des Landkreises <strong>Greiz</strong> einbezog, auch wenn dies nicht ausdrücklich von ihm in den<br />
betreffenden Fällen so erwähnt wurde.<br />
Mit „Untersuchungsgebiet“ werden bis 1990 der Altkreis <strong>Greiz</strong>, der Altkreis Zeulenroda sowie der Altkreis<br />
Gera-Land und Gera-Stadt bzw. nach 1990 der heutige Landkreis <strong>Greiz</strong> und die Stadt Gera (endgültige Gebietsreform<br />
1994) bezeichnet. Beide Gebiete sind flächenmäßig identisch. Der Landkreis <strong>Greiz</strong> hat eine<br />
Größe von 834,52 km² und die kreisfreie Stadt Gera hat eine Größe von 151,93 km².<br />
Beobachtungen, die nur mit dem Namen des Beobachters und ohne Verweis auf eine Literaturstelle angegeben<br />
sind, stammen aus der Datenbank des <strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />
Aufgezählte Beobachternamen sind untereinander durch Kommas und von Literaturstellen durch Semikolons<br />
getrennt. Aufgezählte Literaturstellen sind untereinander ebenfalls durch Semikolons abgeteilt.<br />
Als im Untersuchungsgebiet ausgestorben gelten Vogelarten, von denen 15 Jahre und länger hier keine Ind.<br />
mehr gebrütet haben.<br />
Die kalendarische Gliederung des Textes in den Artkapiteln (Jahrhunderte oder kürzere Spannen) erfolgt<br />
angepasst an den Umfang der gefundenen Daten.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 95
Definitionen und Abkürzungen<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Definitionen<br />
Für die einzelnen Vogelarten wurden die offiziellen Gefährdungskategorien angegeben, die folgendermaßen<br />
definiert sind:<br />
- Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen:<br />
Arten, deren dauerhaftes Vorkommen in Thüringen belegt ist, die in der Zwischenzeit aber mit Sicherheit<br />
oder großer Wahrscheinlichkeit erloschene sind.<br />
Diesen Arten muss bei Wiederauftreten in der Regel besonderer Schutz gewährt werden.<br />
- Vom Aussterben bedroht:<br />
In Thüringen von der Ausrottung oder dem Aussterben bedrohte Arten.<br />
Für diese Arten sind Schutzmaßnahmen in der Regel dringend notwendig. Das Überleben in Thüringen ist<br />
unwahrscheinlich, wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende<br />
Schutz- und Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen.<br />
- Stark gefährdet:<br />
Im nahezu gesamten Verbreitungsgebiet in Thüringen gefährdete Arten.<br />
Wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und<br />
Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen, ist damit zu rechnen, dass die<br />
Arten innerhalb der nächsten zehn Jahre vom Aussterben bedroht sein werden.<br />
- Gefährdet:<br />
In großen Teilen des Verbreitungsgebietes in Thüringen gefährdete Arten.<br />
Wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und<br />
Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen, ist damit zu rechnen, dass die<br />
Arten innerhalb der nächsten zehn Jahre stark gefährdet sein werden.<br />
- Extrem selten:<br />
Seit jeher extrem seltene oder sehr lokal vorkommende Arten, für die kein merklicher Rückgang und keine<br />
aktuelle Gefährdung erkennbar sind.<br />
Die wenigen und kleinen Vorkommen in Thüringen können aber durch derzeit nicht absehbare menschliche<br />
Einwirkungen oder durch zufällige Ereignisse schlagartig ausgerottet oder erheblich dezimiert werden<br />
(FRITZLAR & WESTHUS 2001).<br />
Abkürzungen<br />
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz RNG Renaturierungsgebiet<br />
BNG Bundesnaturschutzgesetz RLD Rote Liste Deutschland<br />
BP Brutpaar, Brutpaare RLT Rote Liste Thüringen<br />
BV Brutvogel SOK Saale-Orla-Kreis<br />
FG Fachgruppe sic Tatsächlich so<br />
in litt. In Mitteilungen, Briefen TK Topographische Karte<br />
Ind. Individuum, Individuen UNB Untere Naturschutzbehörde<br />
KULAP Kulturlandschaftsprogramm vgl. Vergleiche<br />
Ms. Manuskript VOOG <strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />
Mündl. Mündlich VSR Vogelschutzrichtlinie<br />
NSG Naturschutzgebiet VTO <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 96
Übersichtskarte<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera<br />
Auma<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Großaga<br />
Bad Köstritz Söllmnitz<br />
Kraftsdorf<br />
Gera<br />
Pölzig<br />
Großenstein<br />
Ronneburg<br />
Münchenbernsdorf Rückersdorf<br />
Niederpöllnitz<br />
Triebes<br />
Zeulenroda<br />
Weida<br />
Seelingstädt<br />
Teichwolframsdorf<br />
Hohenölsen<br />
Pöllwitz<br />
Bernsgrün<br />
Langenwetzendorf<br />
<strong>Greiz</strong><br />
Maßstab: 1 cm = 1,5 km<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 97
Brutvogelarten<br />
Höckerschwan, Cygnus olor (Gmel.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Höckerschwan<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nachrichten aus dem 19. Jahrhundert sind spärlich und betreffen keine Brutvögel. Das auch zu dieser Zeit<br />
schon Parkschwäne in der Nähe herrschaftlicher Residenzen gehalten wurden, ist sehr wahrscheinlich.<br />
BREHM (1823 – 1824) schreibt von zahmen Schwänen in Deutschland, nennt aber keinen konkreten Ort.<br />
Nach einem Gemälde im benachbarten Schloss Blankenstein (Sachsen) zu urteilen, wurden dort schon vor<br />
200 Jahren Höckerschwäne angesiedelt. Eine Postkarte von 1896 zeigt Höckerschwäne auf dem Baderteich<br />
in Ronneburg.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach einer Fotografie in der „Festschrift zu der Feier des 50jährigen Bestehens ‚<strong>Verein</strong> der Naturfreunde‘ zu<br />
<strong>Greiz</strong>“ vom 11. April 1926 zu urteilen, war der Höckerschwan in den 1920er-Jahren Brutvogel auf dem<br />
<strong>Greiz</strong>er Parksee.<br />
Ab 1950<br />
Nach starkem Bestandsrückgang, vor allem zwischen den Weltkriegen, wurden zur Rettung der Art 1953 die<br />
ersten halbzahmen Paare im <strong>Greiz</strong>er Park ausgesetzt und bis 1985 im Schwanenhaus überwintert (KRÜGER<br />
1989). Vor 1970 wurden auch Höckerschwäne auf dem Hirschteich in <strong>Greiz</strong>-Aubachtal gehalten, die ab 1970<br />
als freifliegendes Brutpaar auf dem benachbarten Schuttteich siedelten (LEO & LANGE 1981). Die seit 1972<br />
bei <strong>Greiz</strong>-Dölau brütenden Vögel dürften ebenfalls vom <strong>Greiz</strong>er Parksee oder vom Schuttteich <strong>Greiz</strong>-<br />
Aubachtal stammen. Seit 1976 brüten auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee in fast allen Jahren freifliegende Paare.<br />
Nach GÜNTHER (1969) wurden in den 1960er-Jahren zahme Schwäne in der Umgebung von Gera auf einigen<br />
Parkteichen gehalten. Von diesen Vögeln, die zunehmend verwilderten, dürften die Ansiedlungen 1970<br />
in Münchenbernsdorf (WOLF) und 1973 in Röpsen (BAUM) hervorgegangen sein. In den Jahren bis 1979<br />
wurden weitere 6 Brutplätze besiedelt (PETER 1984). Neben den verwilderten Parkschwänen aus unserer<br />
Region erfolgte auch eine Zuwanderung aus den mittleren Teilen Ostdeutschlands (SCHMIDT, SIEFKE &<br />
PÖRNER 1979) und aus anderen Teilen Thüringens. Nach LIEDER & LUMPE (2008) war der Höhepunkt der<br />
Bestandsentwicklung mit 15 BP im Jahre 2001 erreicht und ist seither stabil bis leicht rückläufig.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verletzungen an Angelgewässer durch Angelhaken und Angelschnüre (Speicher Wittchendorf)<br />
- Gefährdungen durch Kältewintern und an Energiefreileitungen<br />
- Mangel an gewässernahen Grünlandflächen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Einhaltung der Sorgfaltspflicht der Angler und Bergung gerissener Angelschnüre und Angelhaken<br />
- Vermeidung von gefährlichen Energiefreileitungsabschnitten (z.B. Frießnitzer See)<br />
- Erhalt von gewässernahen Grünlandflächen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 98
Nilgans Alopochen aegyptiaca (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Nilgans<br />
Foto: S. Heidler<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
21. Jahrhundert<br />
Im Zuge der allgemeinen Ausbreitung der Nilgans wurde Anfang des 21. Jahrhunderts auch das Untersuchungsgebiet<br />
erreicht. Nach LUMPE (2009 a) konnte hier das erste freifliegende Individuum am 01. Mai 2001<br />
im RNG Culmitzsch beobachtet werden (JAKOB). Danach mehrte sich das Auftreten von Nilgänsen mit einer<br />
raschen Zunahme ab 2007. Die bisher größten Konzentrationen wurde mit 6 Ind. am 24. Juni 2007 (LANGE)<br />
und mit 8 Ind. am 15. Juli 2007 (JAKOB; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008), jeweils im RNG Culmitzsch festgestellt.<br />
Weitere je 6 Ind. befanden sich am 17. November 2007 am Speicher Wittchendorf (MÜLLER) und am<br />
05. Dezember 2007 am Speicher Schöna (LIEDER). 17 Ind. wurden am 30. März 2008 im RNG Gessenhalde<br />
bei Kauern (HOFFMANN) und 12 Ind. am 24. März 2008 am Frießnitzer See (KANIS, LANGE, LUMPE, MÜLLER)<br />
beobachtet. An weiteren größeren und kleineren Stand- sowie Fließgewässern im Untersuchungsgebiet, wie<br />
Weiderteich, Burkersdorfer Feldteich, <strong>Greiz</strong>er Park, Speicher Pohlen, Speicher Baldenhain, Raitzhainer Teiche,<br />
Teiche bei Bernsgrün, Teichgebiet bei Muntscha/Zickra, Talsperren Hohenleuben, Zeulenroda, Weida<br />
sowie Auma und Weiße Elster, können mittlerweile Nilgänse angetroffen werden. LUMPE (2009 a) schreibt:<br />
„Die erste Brut im Landkreis <strong>Greiz</strong> mit 6 Jungvögeln wurde 2006 am Speicher Wittchendorf registriert<br />
(A. GROH, J. LUMPE). 2007 waren es bereits zwei Bruten mit 5 bzw. 3 Jungvögeln, wiederum am Speicher<br />
Wittchendorf (A. GROH, L. NOLL) und am Speicher Schöna (K. HARTWIG). Zu drei Bruten kam es 2008 mit 8,<br />
nochmals 8 und 5 Jungvögeln, erneut am Speicher Wittchendorf (L. MÜLLER), an einem Haldenteich zwischen<br />
Kauern und Rußdorf (D. HÖSELBARTH) sowie im Culmitzscher Renaturierungsgebiet der Wismut<br />
GmbH bei Zwirtzschen (R. JAKOB, H. LANGE u. a.).“ Nach LUMPE & LIEDER (2010) siedelten 2009 ein bis zwei<br />
BP im Bereich Hilbersdorf/Kauern/Ronneburg. Aufgrund des starken Wanderverhaltens der Nilgansfamilien<br />
konnten Beobachtungen im FND „Teich bei Kauern“ (KINAST), an Rückhaltebecken in der „Neuen Landschaft“<br />
Ronneburg (HOFFMANN, HÖSELBARTH) und an einem Auffangbecken der ehemaligen Halde Kauern/Hilbersdorf<br />
(HÖSELBARTH) nicht genau abgegrenzt werden. Ein weiteres BP wurde 2009 im RNG „Finkenbach“<br />
bei Friedmannsdorf festgestellt (LANGE, LUMPE). Aus dem Jahr 2010 sind 6 Bruten bekannt geworden:<br />
Weiderteich bei Niederpöllnitz, FND „Finkenbach“ bei Friedmannsdorf, RNG Culmitzsch, Teiche 1,5 km<br />
SW Wöhlsdorf, FND „Teich bei Kauern“, RNG „Gessenhalde“ bei Kauern (Datenbank VOOG).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Derzeit ist keine Gefährdung erkennbar<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 99
Brautente, Aix spona (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Gefangenschaftsflüchtling<br />
Brautente<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
20./21. Jahrhundert<br />
Erstmals konnte die Brautente verwildert brütend angetroffen werden. Am 04. Juli 1999 führte am Speicher<br />
Krölpa ein ♀ sieben Jungvögel. Von diesen waren am 17. Juli noch fünf übriggeblieben. Zusätzlich war eine<br />
weitere Brautente mit drei nichtflüggen Jungen anwesend. Bei der Beobachtung am 04. Juli konnte ebenfalls<br />
ein Erpel im Schlichtkleid registriert werden. Nach dem ersten Brutnachweis im Jahre 1999 folgte der zweite.<br />
Am 28.06.2000 führte ein ♀ auf einem Nebenteich des Speichers Krölpa fünf nichtflügge Jungvögel (LANGE,<br />
SOLBRIG; ROST 1999, 2000).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Derzeit ist keine Gefährdung erkennbar<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 100
Stockente, Anas platyrhynchos (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Stockente<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Art als seltenen Brutvogel in der Umgebung von<br />
Gera. LIEBE (1873) stellte einen Rückgang der Art fest. LIEBE (1878) schreibt: „Die Stockente, die noch häufigste<br />
Ente im Gebiet, hat von Jahr zu Jahr beträchtlich abgenommen, und erst in neuster Zeit scheint es, als<br />
ob ein Stillstand und vielleicht eine Wendung zum Bessern eintreten wolle.“ In seinen Aufzeichnungen zur<br />
Stockente aus dem Jahre 1881 schreibt HELLER (1926): „Die auf dem [<strong>Greiz</strong>er] Parksee brütenden Stockenten<br />
sind halbgezähmt ausgesetzt. Sie streichen von hier weit fort und siedeln sich auch auswärts an, wo sie<br />
dann ganz verwildern, so im Burgteich bei Kürbitz [Vogtlandkreis]. (P.) Sonst als Brutvogel im weiteren Gebiet<br />
(Frießnitz).“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) bezeichnet die Stockente als häufigen Brutvogel auf allen Gewässern. Auf dem Turm<br />
des Rittergutes Niederpöllnitz fand FEUSTEL brütende Stockenten in 25 m Höhe (KRETSCHMAR 1914).<br />
Ab 1950<br />
In den Jahren 1971 bis 1973 erfolgte eine überregionale Erfassung. Danach wurde der Brutbestand von elf<br />
Untersuchungsflächen (insgesamt 77,95 km²) und 42 Fließgewässerkilometern mit 106 bis 123 Paaren angegeben<br />
(GÜNTHER 1975). Für die Altkreise Gera-Stadt und Gera-Land schätzt GÜNTHER (1969) den Bestand<br />
auf über 500 BP. Nach LANGE & LEO (1978) zählt die Stockente im Altkreis <strong>Greiz</strong> zu den häufigen Arten,<br />
und der Bestand wird auf 300 BP geschätzt. Ölschlegel (1982 b) fand 1967 auf einem 700 m langen<br />
Flussabschnitt der Weida bei Mildenfurth 7 Weibchen mit Jungvögeln. LIEDER (1985) zählte bei einer Untersuchung<br />
1980 bis 1982 im Altkreis Gera-Stadt und -Land 67 BP und gibt den Bestand mit insgesamt 150 BP<br />
an. Für Ende der 1990er-Jahre geben LANGE & LIEDER (2001) 800 bis 1000 BP an und nehmen Bezug auf<br />
eine Fläche von 91 km² Größe, auf der 131 bis 167 BP ermittelt wurden. Über die gegenwärtige Häufigkeit<br />
wird die Untersuchung im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 Auskunft geben.<br />
Auffällig ist jedoch der geringe Bruterfolg in den letzten Jahren auf vielen Gewässern.<br />
Im <strong>Greiz</strong>er Park und auf der angrenzenden Weißen Elster wurden schon bis zu 30 Bastard- oder<br />
Hybridenten registriert (LUMPE 2009 b). Hybridenten können auch fruchtbaren Nachwuchs hervorbringen, so<br />
z.B. 2001, 2002 und 2008 am Baderteich Ronneburg, 2002 am Mühlteich Ronneburg, 2002 am Raitzhainer<br />
Teich (LIEDER), 2007, 2009 und 2010 im <strong>Greiz</strong>er Parksee (LUMPE, MÜLLER).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verluste durch Jagd, Verluste durch Botulismus<br />
- Genetische Veränderungen der Art durch Hybridisierung mit Hausentenrassen<br />
- Brutverluste durch große Raubfische und Säugetiere (Fuchs, Waschbär, Wildschwein)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Im Rahmen der Jagd sollte Wert auf den Abschuss von wildlebenden Bastarden zwischen Stock- und<br />
Hausenten gelegt werden<br />
- Kein Besatz mit großen Raubfischarten (Wels, Hecht) auf wichtigen Brutgewässern<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 101
Moorente, Aythya nyroca L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vom Aussterben bedroht<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Wahrscheinlich ehemaliger Brutvogel<br />
Moorente<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Im Jahr 1818 stellte C. L. BREHM ein übersommerndes Paar ohne Junge auf dem Frießnitzer See fest<br />
(BREHM 1820 – 22). Da die Art im 19. Jahrhundert Brutvogel in Ostthüringen war (u.a. FRICK 2009), kann die<br />
Beobachtung nach den Kriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) als Brutverdacht gewertet<br />
werden.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Der einzige wahrscheinliche Brutplatz im Gebiet, der Frießnitzer See, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
wesentlich verkleinert<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Im Falle einer Wiederbesiedlung ist ein entsprechend abgestimmter Gebietsschutz erforderlich<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 102
Tafelente, Aythya ferina L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Tafelente<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) schreibt: „Von der Tafelente bleiben nach Herrn Dr. Rud. Müller P. im Frühjahr immer noch<br />
einige im Frießnitzer See zurück, um daselbst zu brüten.“ LIEBE (1877) kann eine Zunahme in Ostthüringen<br />
melden. LIEBE (1878) stellte erneut folgendes zur Tafelente fest: „Nächst der Stockente ist die Tafelente die<br />
häufigste Ente auf dem Gebiet; es hat ihr Bestand, der eine Zeit lang sehr reducirt war, seit etwa 19 Jahren<br />
wieder zugenommen, so daß man sie namentlich auf den Teichen des reussischen Oberlandes bis zum<br />
Frankenwald hin jetzt häufiger sieht. Während die Enten sich hausmütterlich mit den Eiern und Jungen plagen,<br />
thun sich die Enteriche in kleine Ketten zusammen und weiden in der Nähe der Enten bald da, bald<br />
dort; solche Ketten habe ich neuerdings in der Brutzeit gesehen, welche 7 bis 11 Stück zählen (am<br />
Frießnitzer See und am Pörmitzer Teich).“ Ein Jahr später befürchtet er jedoch wieder eine Abnahme des<br />
Bestandes (LIEBE 1879). In seinen Aufzeichnungen zur Tafelente aus dem Jahre 1881 schreibt HELLER<br />
(1926): "Gehört als Brutvogel dem weiteren Gebiet [um <strong>Greiz</strong>] an (Kirschkau)."<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) bezeichnet die Tafelente als häufigen Brutvogel in Ostthüringen, die der Stockente nur<br />
wenig nachstehe. HIRSCHFELD (1932) sah sie zur Brutzeit am Weiderteich.<br />
Ab 1950<br />
In den 1960er-Jahren erfolgte eine Wiederbesiedlung des Gebietes. Nach dem ersten Brutnachweis am<br />
Weiderteich 1966 durch HEYER (1967 a) konnte folgende Bestandsentwicklung erfolgreicher Brutpaare festgestellt<br />
werden (GÜNTHER 1976 a; HEYER 1967 b; LIEDER 1987; Datenbank VOOG):<br />
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980<br />
1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 4 8 12<br />
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996<br />
6 15 4 9 2 0 0 0 2 1 0 2 4 5 5<br />
1981 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
8 1 7 1 3 2 3 0 1 2 2 1 3 6 3<br />
Die Brutplätze konzentrieren sich auf folgende drei Bereiche:<br />
1. Gebiet zwischen Burkersdorf, Uhlersdorf und Lederhose:<br />
Feldteich Burkersdorf, Mäderteich Burkersdorf, Schafteich Burkersdorf, Frießnitzer See, Teiche zwischen<br />
Frießnitzer See und Großebersdorf, Teiche am östlichen Ortsrand Großebersdorf, Weiderteich bei<br />
Niederpöllnitz, Floßteich Lederhose, Teich an der B 2 bei Birkhausen, Teich am Ortsrand Birkhausen<br />
2. Gebiet zwischen Aga, Baldenhain und Röpsen:<br />
Hainteich Aga, Speicher Söllmnitz, Teiche westlich von Caasen, Röpsener Teiche, Speicher Baldenhain<br />
3. Gebiet Gera-Kaimberg/Kauern:<br />
FND „Teich bei Kauern“, Dorfteich Kaimberg<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 103
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Weitere sporadische Brutvorkommen in einzelnen Jahren fanden an folgenden Orten statt:<br />
1. Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />
2. FND „Teich mit Uferzone in Gottesgrün“<br />
3. Talsperren Weida<br />
Eine Brut fand 1977 im Bereich der Talsperren Weida und Zeulenroda statt. Der genaue Ort wurde vom<br />
Beobachter H. HERRNBERG nicht genannt. Von GRÜN, HEYER & Mitarbeiter (1973) werden für den Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land 1 bis 3 BP genannt und für die Altkreise <strong>Greiz</strong> und Zeulenroda wird die Tafelente als<br />
unregelmäßiger Brutvogel eingestuft. Nach LANGE & LIEDER (2001) schwankt der Bestand im Untersuchungsgebiet<br />
zwischen 0 und 12 BP (nur erfolgreiche Bruten) und liegt in günstigen Jahren unter Berücksichtigung<br />
von erfolglosen BP sicherlich noch höher.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Freizeitnutzung an Brutgewässern (Surfen, Baden, Angeln)<br />
- Entfernung der Röhrichtzone<br />
- Trockenfallen der Brutgewässer im Mai/Juni durch Abfischen von Satzkarpfen<br />
- Vergrämung durch Böllerschüsse zur Kormoranabwehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz der Brutgewässer vor allen Störungen<br />
- Erhaltung und Neuanlage von Röhrichtzonen,<br />
- Stabiler Wasserstand zur Brutzeit<br />
Brutgewässer 1: Tafelente<br />
1 7<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1 2<br />
2<br />
Anzahl Brutgewässer je Quadrant<br />
Gera N<br />
5038/2:<br />
1. Hainteich Aga<br />
5038/4:<br />
1. Speicher Söllmnitz<br />
2. Röpsener Teiche<br />
Kayna<br />
5039/3:<br />
1. Speicher Baldenhain<br />
2. Teiche westlich von Caasen<br />
Gera<br />
5138/4:<br />
1. FND „Teich bei Kauern“<br />
2. Dorfteich Kaimberg<br />
Triptis<br />
5237/1:<br />
1. Teich am Ortsrand Birkhausen<br />
5237/2:<br />
1. Feldteich Burkersdorf<br />
2. Frießnitzer See<br />
3. Teiche zwischen Frießnitzer See und Großebersdorf<br />
4. Teiche am östlichen Ortsrand Großebersdorf<br />
5. Weiderteich bei Niederpöllnitz<br />
6. Floßteich Lederhose<br />
7. Teich an der B 2 bei Birkhausen<br />
Weida<br />
5238/1:<br />
1. Mäderteich Burkersdorf<br />
2. Schafteich Burkersdorf<br />
Zeulenroda<br />
5337/2:<br />
1. Talsperren Weida<br />
<strong>Greiz</strong><br />
5339/2:<br />
1. Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />
2. FND „Teich mit Uferzone in Gottesgrün“<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 104
Reiherente, Aythya fuligula L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Reiherente<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Während das benachbarte sächsische Gebiet im Zuge der Westausbreitung der Reiherente schon Ende des<br />
19. Jahrhunderts sporadisch besiedelt wurde, ist die Reiherente im Untersuchungsgebiet erst seit 1971<br />
Brutvogel.<br />
Ab 1971<br />
Der erste Brutnachweis gelang SEHMISCH 1971 am Weiderteich (GÜNTHER 1976 b). Die nächsten Brutvorkommen<br />
wurden 1977 an der Talsperre Weida (Brutverdacht schon 1973) und 1980 an mehreren Orten<br />
festgestellt. 1981 waren es bereit 14 erfolgreiche BP im Untersuchungsgebiet (LIEDER 1987). Eine starke<br />
lokale Ausbreitung der Reiherente wurde in der Mitte der 1980er-Jahre und 1990 auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee<br />
festgestellt. Die Höhepunkte auf diesem Gewässer wurden mit 11 BP 1985, mit 10 BP 1986 und mit 11 BP<br />
1990 erreicht (LUMPE 2008). In den 1990er-Jahren stieg der Bestand im gesamten Untersuchungsgebiet<br />
stark an und fast alle möglichen Stillgewässer wurden zeitweise besiedelt. Auch auf der Weißen Elster wurden<br />
mehrfach Junge führende Weibchen beobachtet. Bemerkenswert sind Brutvorkommen über mehrere<br />
Jahre auf dem stark frequentierten Bad von Gera-Kaimberg und auf einem nur 100 m² großen Feuerlöschteich<br />
in Ronneburg. Nach LANGE & LIEDER (2001) wird der Brutbestand in den 1990er-Jahren auf 70 bis 80<br />
BP geschätzt. ROST (1999) gibt für den Landkreis <strong>Greiz</strong>, bezogen auf das Jahr 1998, 29 BP an. Gezählt<br />
wurden dabei Nestfunde und Junge führende Weibchen. Da die Schlüpferfolge meist zwischen 30 und 70 %<br />
liegen und zudem Totalverluste bei nichtflüggen Jungvögeln auftreten (BAUER, BEZZEL & FIEDLER 2005), ist<br />
die vorgenannte Schätzung von LANGE & LIEDER durchaus realistisch. In den folgenden Jahren schwankte<br />
die Anzahl der erfolgreich brütenden Weibchen beträchtlich (Datenbank VOOG):<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
19 30 49 9 32 28 12 10 28 10 16 4<br />
Bemerkenswert ist das Spitzenjahr 2001 im Vergleich zum schlechten Bruterfolg im Jahr 2010.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verluste durch Jagd<br />
- Verluste durch Botulismus<br />
- Brutverluste durch große Raubfische und Säugetiere (Fuchs, Waschbär, Wildschwein)<br />
- Beseitigung der Ufervegetation<br />
- Störung durch Freizeitaktivitäten im Uferbereich (Angeln, Baden, Surfen)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Kein Besatz mit großen Raubfischarten (Wels, Hecht) auf wichtigen Brutgewässern<br />
- Erhalt naturnaher Uferbereiche an stehenden Gewässern<br />
- Keine vollständige Nutzung der Uferbereiche für Freizeitaktivitäten<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 105
Gänsesäger, Mergus merganser L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Stark gefährdet<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gänsesäger<br />
Foto: S. Heidler<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
21. Jahrhundert<br />
Der erste Brutnachweis für das Untersuchungsgebiet wurde am 13. Mai 2004 erbracht. Ein Weibchen führte<br />
neun Jungvögel auf der Weißen Elster am „Lochgut“ zwischen Berga und Wünschendorf (LANGE; LIEDER &<br />
LANGE 2010).<br />
In mehreren Jahren bestand berechtigter Brutverdacht auf folgenden Flussabschnitten der Weißen Elster<br />
(LIEDER & LANGE 2010):<br />
2001: Berga – Wünschendorf<br />
2006: Berga – Wünschendorf<br />
Gera-Milbitz – Bad Köstritz<br />
2008: Berga – Gera-Liebschwitz<br />
2009: <strong>Greiz</strong> – Neumühle<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störungen durch Freizeitaktivitäten (Bootsfahrten, Angeln)<br />
- Verluste durch Prädatoren in der Bruthöhle<br />
- Mangel an geeigneten Bruthöhlen, insbesondere Baumhöhlen in alten Laubbäumen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine Störungen durch Freizeitaktivitäten (Bootsfahrten, Angeln) während der Brutzeit<br />
- Erhalt alter Laubbäume entlang der Weißen Elster und eine langfristige Förderung naturnaher Laubholzbestände<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 106
Jagdfasan, Phasianus colchicus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Jagdfasan<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
18. und 19. Jahrhundert<br />
Ab wann die ersten frei lebenden Fasane in unserem Gebiet auftraten, ist nicht bekannt. Zum Vorkommen<br />
berichtet BECHSTEIN (1791 – 1795), dass sich in verschiedenen Gegenden Thüringens wild lebende Fasane<br />
finden. Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt die Art als häufigen Brutvogel auf, der u.a. in der<br />
„Cosse“ bei Gera-Thieschitz, in Trebnitz und in Aga brütet. LIEBE (1873) schreibt: „Die außerhalb der Fasanerieanlagen<br />
von Tinz sich aufhaltenden Fasanen sind nur verwildert und nicht wildlebend. Rekrutierten sie<br />
sich nicht fortwährend aus der Fasanerie, so würden von ihnen nach Verlauf zweier Jahre nur sehr wenige<br />
übrig bleiben, da sie den Nachstellungen der Menschen und des Raubzeugs gegenüber zu täppisch sind.“<br />
Nach KOEPERT (1896) hatte sich der Jagdfasan bei Altenburg und Ronneburg mit Erfolg angesiedelt.<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) bezeichnet den Fasan als verbreiteten Brutvogel in Ostthüringen, der in den Kriegsjahren<br />
1914 – 1918 mangels Winterfütterung und infolge starken Abschusses weit im Bestand zurückgegangen<br />
war. HIRSCHFELD (1932) nannte die Art einen vielerorts recht häufigen und fest eingebürgerten Brutvogel in<br />
der Umgebung von Hohenleuben. Starker Rückgang wurde erneut während des Zweiten Weltkrieges festgestellt<br />
(GOTTSCHALK 1982). In der Umgebung von Auma kam er in den 1930er-Jahren häufig vor. An manchen<br />
Plätzen wurden bis zu 30 Tiere beobachtet (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971).<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis <strong>Greiz</strong> war der Bestand nach dem Zweiten Weltkrieg erloschen (LANGE & LEO 1978). In den<br />
1950er-Jahren wurden erneut Jagdfasane durch die Jagdkollektive ausgesetzt (GOTTSCHALK 1982). In dem<br />
Gebiet zwischen Ronneburg und Gera gab es von 1945 und 1960 noch einen Restbestand (GÜNTHER 1969).<br />
Im Raum Auma war die Art völlig verschwunden. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) können auf einen Federfund<br />
aus dem Jahre 1964 verweisen. Während einer überregionalen Bestandserfassung 1980 wurden<br />
um Ronneburg 4 BP, bei Zschippach 10 BP und im Altkreis <strong>Greiz</strong> 30 BP geschätzt. Weitere Vorkommen<br />
bestanden zu dieser Zeit bei Auma und Großebersdorf (GOTTSCHALK 1982). LANGE & LIEDER (2001) geben<br />
den Bestand Ende der 1990er-Jahre mit 30 bis 50 Vögeln an. Der Verbreitungsschwerpunkt lag dabei im<br />
Norden des Landkreises <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera. Die gegenwärtige Häufigkeit dürfte die gleiche Größenordnung<br />
erreichen, jedoch mit beträchtlichen Schwankungen und immer wieder größeren Aussetzungen<br />
durch die Jagdpächter, z.B. 110 Tiere im Jahr 2006 bei Untergeißendorf.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust und -beeinträchtigung durch Intensivierung und Änderung der Landwirtschaft<br />
- Einsatz von Bioziden<br />
- Dezimierung durch Fressfeinde infolge mangelnder Deckung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Erhaltung und Erneuerung kleinräumiger Strukturen (Hecken, Ruderalstreifen) in offener Landschaft<br />
- Verringerung des Biozideinsatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 107
Haubentaucher, Podiceps cristatus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Haubentaucher<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Zum Vorkommen im jetzigen Landkreis <strong>Greiz</strong> teilt BREHM (1820 – 1822) mit: „Der gehaubte Steißfuß,<br />
Podiceps cristatus, brütet sonst in hiesiger Gegend auf zwei Teichen, auf dem frießnitzer See und auf dem<br />
weidaer Teiche. Schon vor einigen Jahren verließ er den letzteren, lebte aber immer noch auf dem ersten<br />
und vertheidigte seinen Brutplatz hartnäckig gegen andere Paare, welche sich eindrängen wollen. Wir<br />
schossen in einem Frühjahr das Weibchen, in einem andern das Männchen; aber das schadete Nichts; im<br />
nächsten Frühlinge war das Paar wieder vollzählig. Im Sommer 1819 kamen alle Junge aus und beide Alten<br />
blieben am Leben. Dennoch erschien im Frühjahre 1820 und 1821 kein Haubensteißfuß auf dem frießnitzer<br />
See und dieser schöne Teich, welcher sonst so hartnäckig von dem Paar dieser Art behauptet wurde, ist nun<br />
schon zwei Sommer von demselben verlassen.“ Als Brutvogel der hiesigen Gewässer wird der Haubentaucher<br />
später noch von BREHM (1833) erwähnt: „Außer den Zahnschnäblern brüten auf unsern Teichen 2 Gattungen<br />
Hauben- und kleine Steißfüße.“ Nach LIEBE (1878) brütet der Haubentaucher nicht ganz regelmäßig<br />
auf dem Frießnitzer See und 1875 auf dem Weiderteich. Nach seinen Aufzeichnungen aus dem Jahre 1881<br />
schreibt HELLER (1926): „Auch dieser große Taucher soll früher den Binsenteich [Parkteich <strong>Greiz</strong>] bewohnt<br />
haben, im übrigen gehört er als Brutvogel der weiteren Umgebung an (Niederpöllnitz, Plothen).“<br />
1900 bis 1950<br />
Auch VÖLCKEL sah ihn am 04.05.1918 auf dem Frießnitzer See (HIRSCHFELD 1932). HIRSCHFELD (1932)<br />
kannte den Haubentaucher als Brutvogel vom Frießnitzer See und dem Weiderteich, wo 1932 Brutpaare mit<br />
Jungvögeln beobachtet wurden.<br />
Ab 1950<br />
Je eine Brut fand UHL 1959 auf dem Stausee Dölau sowie 1961 und 1964 auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee<br />
(ÖLSCHLEGEL 1974; LANGE & LEO 1978). Seit 1971 brütet die Art regelmäßig an verschiedenen Gewässern.<br />
Ein detaillierter Überblick zur Bestandsentwicklung auf den einzelnen Gewässern bis 2001 findet sich bei<br />
LIEDER (2003). Danach brüteten auf 21 Gewässern insgesamt zwischen 1 und 27 BP (Maximum 1996). Weitere<br />
Brutdaten stammen aus der Datenbank des VOOG:<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
20 33 28 30 – 31 30 – 31 22 21 18 10<br />
Folgende Gewässer werden seit 1971 mehr oder weniger besiedelt: Parksee <strong>Greiz</strong> 1 bis 3 BP, Hirschteich<br />
<strong>Greiz</strong>-Aubachtal unregelmäßig 1 BP, Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal unregelmäßig 1 BP, Talsperre Hohenleuben<br />
unregelmäßig 1 bis 18 BP (Maximum 2004), Krebsbachstau unregelmäßig 1 BP (2007 zurückgebaut), Talsperre<br />
Weida 1 bis 10 BP; Talsperre Zeulenroda mit Vorsperren 2 bis 15 BP (Maximum 1976), Frießnitzer<br />
See 1 bis 3 BP, Weiderteich bei Niederpöllnitz unregelmäßig 1 bis 2 BP, Feldteich Burkersdorf unregelmäßig<br />
1 BP, FND „Teich bei Kauern“ unregelmäßig 1 BP, Reichenbacher Teiche unregelmäßig 1 BP, Stausee<br />
<strong>Greiz</strong>-Dölau unregelmäßig 1 bis 4 BP, Speicher Söllmnitz unregelmäßig 1 bis 2 BP, Speicher Schöna 1 bis 4<br />
BP, Grube Beerweinschänke bei Gera-Trebnitz unregelmäßig 1 BP, Raitzhainer Teich unregelmäßig 1 BP,<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 108
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Speicher Pohlen 1 bis 3 BP, Krähenteich bei Niederpöllnitz unregelmäßig 1 BP, Tremnitzstau unregelmäßig1<br />
BP, RNG Großkundorf unregelmäßig 1 BP (trockengelegt), Speicher Letzendorf unregelmäßig 1 BP, Teiche<br />
bei Krölpa/Sorna (z.T. SOK) unregelmäßig 1 BP, RNG Culmitzsch unregelmäßig 1 bis 3 BP, Teiche<br />
Muntscha/Zickra unregelmäßig 1 BP.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störung an den Brutplätzen durch Freizeitaktivitäten (Baden, Surfen, Angeln)<br />
- Störung durch Böllerschussanlagen zur Vertreibung von Kormoranen<br />
- Verluste der Jungvögel durch große Raubfische (Wels, Hecht)<br />
- Zerstörung der Ufervegetation<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Vermeidung von Freizeitaktivitäten an den Brutplätzen<br />
- Abbau der Böllerschussanlage am Weiderteich<br />
- Entnahme der großen Raubfische an den Brutgewässern<br />
- Schutz der Ufervegetation und<br />
- Neuanlage von Röhrichtzonen<br />
Brutgewässer 2: Haubentaucher<br />
1<br />
2 2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
4 1 2<br />
1<br />
3<br />
1<br />
Anzahl Brutgewässer je Quadrant<br />
Gera N<br />
5038/1<br />
Reichenbacher Teiche<br />
5038/4<br />
Speicher Söllmnitz<br />
Münchenbernsdorf<br />
5137/4<br />
Speicher Schöna<br />
Gera<br />
5138/2<br />
Grube Beerweinschänke bei Gera-Trebnitz<br />
5138/4<br />
FND „Teich bei Kauern“<br />
Ronneburg<br />
5139/1<br />
Raitzhainer Teiche<br />
5139/3<br />
Speicher Pohlen<br />
Triptis<br />
5237/2<br />
Krähenteich bei Niederpöllnitz<br />
Weiderteich bei Niederpöllnitz<br />
Frießnitzer See<br />
Feldteich Burkersdorf<br />
Weida<br />
5238/2<br />
Speicher Letzendorf<br />
5238/3<br />
Talsperre Hohenleuben<br />
Teichwolframsdorf<br />
5239/1<br />
RNG Culmitzsch<br />
RNG Großkundorf (trockengelegt)<br />
5239/3<br />
Krebsbachstau (2007 zurückgebaut)<br />
Zeulenroda<br />
5337/1<br />
Teiche Muntscha/Zickra<br />
Teiche bei Krölpa/Sorna (z.T. SOK)<br />
5337/2<br />
Talsperre Weida<br />
Talsperre Zeulenroda mit Vorsperren<br />
<strong>Greiz</strong><br />
5339/1<br />
Parksee <strong>Greiz</strong><br />
Hirschteich <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />
Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />
5339/3<br />
Stausee <strong>Greiz</strong>-Dölau<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 109
Graureiher, Ardea cinerea (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Graureiher<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Bis ca. 1840 befand sich eine Brutkolonie im Zeitzer Forst (Ornithologische Sektion Gera 1859; LIEBE<br />
1878). Auf den Erlen an der Weißen Elster zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz bestand bis zum Anfang<br />
der 1830er-Jahre eine Kolonie (LIEBE 1873; 1878). Um 1870 erlosch eine Ansiedlung in der Umgebung des<br />
Frießnitzer Sees, wo der Graureiher regelmäßig bis ca. 1860 brütete und dann noch unregelmäßig bis<br />
1870 vorkam (LIEBE 1873; LIEBE 1878; SEYDEL 1883). LIEBE (1878) schreibt zum Erlöschen des Brutbestandes<br />
in unserem Gebiet: „Seine zur Vernichtung führende Abnahme hat ausser dem unbedeutenden<br />
Verlust durch Raubzeug der Mensch mit dem Schiessgewehr herbeigeführt“. Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Grauer Fischreiher. Er gehört dem engeren Gebiet als Brutvogel nicht<br />
an, wenn auch behauptet wird, daß er vor 60 – 70 Jahren bei der Knottenmühle gehorstet haben soll. Außerhalb<br />
der Brutzeit habe ich ihn öfters bei Dölau-, Neu- und Lehnamühle, auch bei Berga und Weida beobachtet.“<br />
1900 bis 1950<br />
Aus diesem Zeitraum sind uns keine Brutvorkommen bekannt.<br />
Ab 1950<br />
Erst ab den 1970er-Jahren nehmen die Beobachtungen zur Brutzeit an mehreren Stellen des Tales der<br />
Weißen Elster, bei Auma, um Frießnitz/Niederpöllnitz und im Leubatal zu, ohne dass ein Brutnachweis<br />
gelang (KRÜGER 1989; AUERSWALD & LIEDER 1991; SEMMLER 1981). 1987 bestand erstmals Brutverdacht<br />
am Speicher Schöna, wo sich in den folgenden Jahren eine Brutkolonie entwickelte (AUERSWALD, LIEDER,<br />
WOLF;<br />
AUERSWALD & LIEDER 1991). Die Koloniegröße am Speicher Schöna stieg bis zum Jahr 2001 auf 45 BP an<br />
(LANGE & LIEDER 2001). Von den vorgenannten Autoren werden nach Beobachtungen von DUDAT, KANIS,<br />
LANGE und LIEDER weiterhin 3 bis 4 BP am Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal 1991/93, 1 BP bei Frotschau 1999,<br />
4 BP Leubatalsperre [Talsperre Hohenleuben] 2000 und 2 BP Elster bei Neumühle 2000 angegeben.<br />
2001: 45 BP Speicher Schöna (LIEDER), 2 BP Talsperre Hohenleuben (NOLL), 2 BP Lehnamühle/Neumühle<br />
(DUDAT), 1 BP Rüßdorf/Eulamühle (DUDAT), 1 BP Reichenbacher Teich (SCHULZE), 1 BP Elsteraltwasser<br />
bei Pohlitz (SCHULZE), 1 BP Bernsgrün (LANGE), 2 BP Merkendorf (LANGE).<br />
2002: 40 BP Speicher Schöna (LIEDER), 1 BP Lehnamühle/Neumühle (LANGE), 1 BP Rüßdorf/Eulamühle<br />
(DUDAT), 3 BP an der Talsperre Hohenleuben (NOLL), 1 BP Hammerwiesen <strong>Greiz</strong>er Park (LUMPE,<br />
REIßMANN), 1 BP Piesigitz (STEIN), 1 BP Reichenbacher Teiche (M. LANGE, LIEDER, SCHULZE).<br />
2003: 39 BP Speicher Schöna (BECHER, LIEDER), 2 BP Talsperre Hohenleuben (NOLL), 2 BP<br />
Lehnamühle/Neumühle (DUDAT), 1 BP Rüßdorf/Eulamühle (DUDAT), 1 BP Triebitzbachtal bei Frotschau<br />
(LANGE), 1 BP Elsteraltwasser Pohlitz (M. LANGE), 1 BP Piesigitz (STEIN).<br />
2004: 37 BP Speicher Schöna (BECHER, LIEDER), 3 BP FND „Teichgebiet Poser“ bei Auma (BARNIKOW),<br />
1 BP Triebitzbachtal bei Frotschau (LANGE), 2 BP Talsperre Hohenleuben (NOLL), 1 BP<br />
Lehnamühle/Neumühle (DUDAT).<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 110
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
2005: 31 BP Speicher Schöna (BECHER, KRAFT, LIEDER, ZSCHIEGNER), 5 BP FND „Teichgebiet Poser“ bei<br />
Auma (BARNIKOW), 2 bis 3 BP Lehnamühle/Neumühle (DUDAT).<br />
2006: 23 BP Speicher Schöna (LIEDER, ZSCHIEGNER), 3 BP Lehnamühle/Neumühle (DUDAT), 1 BP Speicher<br />
Letzendorf (SCHOLZ).<br />
2007: 34 BP Speicher Schöna (LIEDER), 8 BP Lehnamühle/Neumühle (DUDAT)<br />
2008: 44 BP Speicher Schöna (LIEDER), 1 BP SE von Wolfsgefärth (GRAUPNER, HÖSELBARTH), mehrere BP<br />
Lehnamühle/Neumühle (DUDAT, HÖSELBARTH, MÜLLER).<br />
2009: 18 BP Speicher Schöna (LIEDER), 1 BP SE von Wolfsgefärth (GRAUPNER, HÖSELBARTH), mehrere BP<br />
Lehnamühle/Neumühle (LUMPE, MÜLLER)<br />
2010: 21 BP Speicher Schöna (LIEDER), 25 BP Lehnamühle/Neumühle (KANIS, LANGE, LUMPE, MÜLLER)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störung in den Brutkolonie durch forstliche Arbeiten und Freizeitnutzung<br />
- Verfolgung durch Jagd<br />
- Verlust von Nahrungshabitaten durch Gewässerausbau<br />
- Giftbelastung durch Biozide und Pestzide<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz der Brutkolonien vor Störungen<br />
- Ganzjährige Schonzeit ohne Sondergenehmigung zum Abschuss<br />
- Renaturierung von Gewässern<br />
- Senkung des Einsatzes von Bioziden und Pestiziden auf gewässernahen Feldflächen<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 1<br />
1 2<br />
2 2<br />
2<br />
1<br />
Brutorte 1: Graureiher<br />
Anzahl Brutorte je Quadrant<br />
Gera N<br />
5038/1<br />
Reichenbacher Teiche<br />
5038/3<br />
Elsteraltwasser bei Pohlitz<br />
Münchenbernsdorf<br />
5137/4<br />
Speicher Schöna<br />
Gera<br />
5138/3<br />
SE von Wolfsgefärth<br />
Triptis<br />
5237/4<br />
FND „Teichgebiet Poser“ bei Auma<br />
Weida<br />
5238/2<br />
Speicher Letzendorf<br />
5238/3<br />
Talsperre Hohenleuben<br />
5238/4<br />
Lehnamühle/Neumühle<br />
Rüßdorf/Eulamühle<br />
Zeulenroda<br />
5337/2<br />
Merkendorf<br />
Piesigitz<br />
<strong>Greiz</strong><br />
5339/1<br />
Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />
Hammerwiesen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
Plauen N<br />
5438/1<br />
Bernsgrün<br />
Triebitzbachtal bei Frotschau<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 111
Wespenbussard, Pernis apivorus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Wespenbussard<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war der Wespenbussard seltener Brutvogel im Gera-<br />
Ernseer Forst und im Agaer Forst. LIEBE (1873) fand ihn nicht mehr bei Ernsee, konnte aber im August 1869<br />
ein Paar mit 3 Jungen bei Großaga beobachten. Später führte LIEBE (1878) aus: „Am ersten trifft man seinen<br />
Horst in den Feldgehölzen des Altenburger Ostkreises, wo zwischen Schmölln, Ronneburg und Crimmitschau<br />
alljährlich mindestens ein Paar wohnt. ... Seltener trifft man ihn im Bereich der Nadelwaldungen, wie<br />
z.B. an der Lisiere des Zeitzer Forstes, unweit Klosterlausnitz, an der Auma bei Weida.“ Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr seltener und unregelmäßiger Brutvogel im Gebiet:<br />
Pöllwitzer Wald, Neumühle, Noßwitz, Friesener Wald (noch 1907!).“<br />
1900 bis 1950<br />
Bis 1912 brütete ein Paar bei Steinsdorf (HIRSCHFELD 1932). ROßBACH (1935/1936 b) kann verschiedene<br />
Vorkommen nennen: „Dieser seltsame Vogel, bei uns noch nie eine häufige Erscheinung, war in den Jahren<br />
nach dem Kriege gleich anderen Raubvogelarten durch Horstplünderung Unberufener wie auch durch Nachstellung<br />
aus Kreisen der Jägerschaft (Horstausschießen, Abschießen der ausgeflogenen Jungvögel, der<br />
sog. „Ästlinge“) in seinem Bestande dermaßen gefährdet, daß bis zu seiner völligen Ausrottung nicht viel<br />
mehr fehlte. Mir sind z. B. Fälle bekanntgeworden, wonach Einwohner von Langenberg/Thür. Horste des<br />
Vogels aushoben und die Jungen mitsamt Nestlingen von Krähen, Mäusebussarden und andern Vögeln in<br />
den Kochtopf steckten. Heute ist der Wespenbussard dank der Einflüsse oben erwähnter Gesetze [Reichsjagdgesetz<br />
von 1934, Reichsnaturschutzgesetz von 1935] überall heimisch. ... So ist er in den Waldungen<br />
um die Ortschaft Hain, im Wipsetal, in der Wüstung Wolfersdorf, in den Forsten um die „Hohe Reuth“ –<br />
Groß-ebersdorf, in den sogen. „Tälern“ bei Wittchendorf – Schwarzbach, in den Wäldern um Markersdorf –<br />
Schöna, St. Gangloff, Kraftsdorf usw. überall zu finden.“<br />
Ab 1950<br />
1952/53 brütete ein Paar auf dem Buchenberg bei Weida (SOMMERLATTE 1953). Ein ständiges Brutvorkommen<br />
bei Weida wird auch von GÜNTHER (1969) erwähnt. WICHLER (1951) schildert einen Brutversuch bei<br />
Gera 1951: „Anfang Juni beobachtete ich im Tinzer Wald bei Gera-Langenberg ein Pärchen (ein auffallend<br />
helles und ein dunkles Exemplar) Wespenbussarde. Ende Juni schritten sie zum Nestbau. Eine Zeitungsveröffentlichung<br />
war der Anlaß zu ihrer Vernichtung.“ 1960 glückte ein Horstfund zwischen Auma und<br />
Untendorf (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). LANGE & LEO (1978) nennen als Brutplätze den<br />
Ruppertsgrüner Grund nahe der Kreisgrenze bis 1955 und Tremnitz bis 1970. GÜNTHER (1969) schätzt den<br />
Bestand im Altkreis Gera-Land und der Stadt Gera auf 4 bis 5 BP und verweist auf Brutvorkommen 1968<br />
östlich von Gera und bei Münchenbernsdorf sowie Brutzeitfeststellungen 1960 im Ernseer Forst und 1968<br />
bei Hohenölsen. Bei einer überregionalen Erfassung 1974/75 wurde folgender Bestand ermittelt (KNORRE<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 112
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
1976 b): Altkreis Gera-Stadt und -Land 4 bis 6 BP (Lasur, Großebersdorf, Aga, Porstendorf, Köstritz,<br />
Wünschendorf, Ernsee), Altkreis Zeulenroda 1 bis 2 BP (Auma, Leitlitz) und Altkreis <strong>Greiz</strong> 1 bis 2 BP<br />
(Moschwitzer Wald, LSG „Steinicht“). LANGE & LIEDER (2001) schätzen Ende der 1990er-Jahre den Bestand<br />
auf 10 bis 15 BP. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 22 bis 28 BP geschätzt,<br />
wobei kaum eine Bestandszunahme stattfand, wohl aber eine bessere Erfassung erfolgte.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verringerung des Nahrungsangebotes durch Ausräumung der Landschaft und Einsatz von Pestiziden<br />
- Zerstörung und Eutrophierung ursprünglich insektenreicher Kulturlandschaften, insbesondere blütenreicher<br />
Wiesenflächen<br />
- Eingriff in Altholzbestände (kurze Umtriebszeiten, Entnahme des Laubholzes)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung einer reich strukturierten Kulturlandschaft mit extensiven Grünlandflächen und Saumbiotopen an<br />
den Waldrändern und Wegrändern<br />
- Kein Wiesenumbruch<br />
- Schutz der Altholzbestände<br />
- Verringerung des Pestizideinsatzes<br />
Verbreitungskarte 1: Wespenbussard<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1 1 2 – 3 2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 113
Habicht, Accipiter gentilis L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Habicht<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1832) schreibt: „Von den Habichten brütete der deutsche, Astur gallinarium, wie gewöhnlich in unserer<br />
Gegend, aber sehr einzeln. In der Nähe meiner Wohnung, wo in früheren Jahren immer einer zum großen<br />
Schaden meiner Haustauben herumschwärmte, hatte im Jahre 1830 und 1831 kein Paar gehorstet, was mir<br />
sehr lieb war.“ Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Art häufiger Brutvogel u.a. im<br />
„Rathswald, Ernseer- und Roschitzer Forst“. Nach LIEBE (1873) ist der Habicht durch Abschuss „zum Glück“<br />
nicht mehr so häufig wie früher: „Auf dem Tinzer Revier wurden 1872 nur 3 geschossen. Im Ernseer und<br />
Niederndorfer Forst pflegt noch alljährlich ein Paar zu horsten – ebenso in den Forsten von Tautenhain und<br />
Klosterlausnitz. Oertlichkeiten, wo sie im Verlauf der letzten Jahre sich immer häuslich niederließen, sind<br />
ferner der Wald zwischen Schwarzbach und Wittgenstein, der Wald bei Reichenfels, die Thalwand an der<br />
unteren Auma“. Auch später wünscht sich LIEBE (1878) einen stärkeren Rückgang der Art: „Seit etwa 1860<br />
haben sich die Verhältnisse etwas anders gestaltet, und verfolgt man ihn mit besseren Erfolg. Als Beweis,<br />
daß seine Zahl noch nicht auf ein Minimum herabgesunken, möge die auch in anderer Hinsicht bemerkenswerte<br />
Thatsache dienen, daß im Jahr 1873 im Ronneburger Forst zugleich drei besetzte Habichthorste standen,<br />
an denen auch glücklich die Alten vom Förster erlegt wurden.“ Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong><br />
beschließt 1877, nachdem genügend Spendengelder eingegangen waren, „Schußgeld für Raubvögel“ zu<br />
zahlen, darunter „für einen Hühnerhabicht M. 1,50“ (MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen von<br />
1881 schreibt HELLER (1926): „Hühnerhabicht. Seltener Brutvogel des Gebietes: Leiningen bei Elsterberg,<br />
Pohlitz, Pöllwitz.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1917) schätzte ein: „Es brüten zum Beispiel Hühnerhabicht und Sperber, obwohl sie stets in<br />
rücksichtslosester Weise verfolgt, und ihre Bruten nach Möglichkeit zerstört wurden, jetzt durchaus nicht in<br />
geringerer Zahl bei uns als zur Zeit Brehms.“ ROßBACH (1935/1936 a) beklagt den Rückgang infolge starker<br />
Verfolgung: „In den letzten Jahren hier und da noch bezogene Horste stehen dieses Jahr infolge unverständiger<br />
Verfolgung ausnahmslos leer. In der Umgebung Geras stehen eine große Anzahl neuerbauter, gesetzlich<br />
leider erlaubter Habichtfänge, in denen sich jahrein jahraus eine Unzahl Vögel fängt. Mir sind Fangresultate<br />
bekannt geworden, wonach im letzten Winter in einem einzigen dieser Apparate in kurzer Zeit sich dreizehn<br />
Habichte fingen. In einem anderen elf, in einem dritten sieben, im vierten zwei. Und noch sollen, wie<br />
man hört, in einigen Jagdrevieren weitere Fänge aufgestellt werden!“<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) brüteten im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt nicht mehr als 10 BP. Der Brutplatz im<br />
Ronneburger Forst war erloschen. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) nennen als bekannte Brutplätze in<br />
der Umgebung von Auma: Aumühle, Wenigenauma, Himmelreich, Braunsdorfer Wald und Wolge. Bei einer<br />
überregionalen Bestandserfassung 1978/79 wurden im ehemaligen Bezirk Gera 58 Brutreviere erfasst und<br />
der Gesamtbestand auf 100 bis 140 BP geschätzt (KRÜGER 1980). Wie groß der konkrete Bestand im Untersuchungsgebiet<br />
damals war, wird nicht mitgeteilt. Genannt werden lediglich die erloschenen Brutvorkom-<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 114
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
men: Reust (seit 1977), Cosse bei Thieschitz (seit 1975), Köthnitzer Wald (seit 1975), Wolge, Braunsdorfer<br />
Wald und Aumühlenwald (seit 1976). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass verstärkt BP ohne Bruterfolg<br />
beobachtet werden (u.a. Günther 1979 a) Nach Beobachtungen zwischen 1995 und 2001 siedelten im Gesamtgebiet<br />
20 bis 25 BP (LANGE & LIEDER 2001).<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurde der Gesamtbestand auf 61 bis 91 BP<br />
geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Illegale Verfolgung (Tötung, Zerstörung der Brut) durch Taubenzüchter und Geflügelhalter<br />
- Entnahme von Jungvögeln als Beizvögel für Falkner<br />
- Belastung mit Bioziden<br />
- Störung am Brutplatz durch Forstarbeiten und Freizeitaktivitäten<br />
- Zerstörung der Lebensräume (Forstliche Nutzung der Altholzbestände und Ausräumung der Landschaft<br />
mit Verringerung des Nahrungsangebotes)<br />
- Unfälle im Straßenverkehr und an Freileitungen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Strikte Ahndung illegaler Tötung<br />
- Keine Entnahme von Jungvögeln als Beizvögel<br />
- Verringerung des Biozideinsatzes<br />
- Schutz der Brutplätze in Altholzbeständen vor forstlicher Nutzung und Freizeitaktivitäten<br />
- Erhalt oder Schaffung reich strukturierter Feldfluren<br />
- Aufklärung der Bevölkerung<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
1 2 – 3<br />
1<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
Verbreitungskarte 2: Habicht<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 115
Sperber, Accipiter nisus (Pall.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Sperber<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war der Sperber ein häufiger Brutvogel um Gera. Schon früh<br />
beklagt LIEBE (1873) einen zu hohen Bestand: „... nistet leider nur zu häufig noch auf unserem Gebiet, wenn<br />
auch seine Anzahl, Dank sei es den Maßregeln der Forstbeamten, neuerdings stark abgenommen hat. 1869<br />
standen allein im Geraer Forst und im östlichen Theile des Ernseer Forstes bis zum Thiergarten nicht weniger<br />
als 4 besetzte Horste. 1872 wurden auf dem Tinzer Revier noch 10 geschossen.“ LIEBE (1878) teilt mit:<br />
„Er hat in gleicher Weise und aus denselben Ursachen, wie der Habicht, bis 1848 an Zahl ab-, dann wieder<br />
eine Zeit lang zu- und endlich wieder abgenommen: jetzt giebt es weit weniger Sperber wie vor 50 Jahren,<br />
wenn auch ihr Bestand kein schwacher ist.“ Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong> beschließt 1877 „Schußgeld<br />
für Raubvögel“ zu zahlen, darunter „für einen Sperber M. 1,00“. ... „Eingelöst wurden [bis 1902] 21 alte und<br />
15 junge Sperber.“(MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Unser<br />
häufigster, hier brütender Raubvogel: Gommla, Brand, Pohlitz, Dölau, Elsterberg, Tiergarten.“<br />
1900 bis 1950<br />
Anfang des 20.Jahrhunderts war der Sperber ein verbreiteter Brutvogel in Thüringen (HILDEBRANDT 1917;<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER 1976).<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) brüteten im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt etwa 5 BP, wobei auf einen starken<br />
Rückgang im letzten Jahrzehnt verwiesen wird. Für das Gebiet zwischen Ronneburg, Gera und Brahmenau<br />
(150 km²) gibt GÜNTHER (1979) im langjährigen Schnitt 4 bis 6 BP an. In den Jahren 1978/79 wurde eine<br />
überregionale Bestandserfassung durchgeführt (BARNIKOW 1981). Demnach brüteten im Altkreis Zeulenroda<br />
21 BP, für die Altkreise Gera (Stadt und Landkreis) werden 6 BP und für <strong>Greiz</strong> 14 BP geschätzt, wobei auf<br />
eine Bestandsabnahme verwiesen wird. BARNIKOW & LANGE (1985) schätzen den Bestand auf 45 BP. LANGE<br />
& LIEDER (2001) geben für Ende des 20. Jahrhunderts die Größe mit 25 bis 35 BP an.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden für das Untersuchungsgebiet mindestens<br />
90 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Belastung mit Bioziden<br />
- Störung am Brutplatz durch Forstarbeiten und Freizeitaktivitäten<br />
- Zerstörung der Lebensräume (Forstliche Nutzung der Fichtenbestände<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft und Verringerung des Nahrungsangebotes<br />
- Unfälle im Straßenverkehr, Glasfassaden und an Freileitungen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verringerung des Biozideinsatzes<br />
- Schutz der Brutplätze in Fichtenbeständen vor forstlicher Nutzung und Freizeitaktivitäten<br />
- Erhalt oder Schaffung reich strukturierter Feldfluren<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 116
Mäusebussard, Buteo buteo (Bodd.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Mäusebussard<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Mäusebussard als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Als Brutplätze werden der Ernseer und der Roschitzer Forst genannt. LIEBE (1873)<br />
schreibt: „Der Mäusebussard (Schwarzgeier und Graugeier) horstet bei uns lange nicht mehr so häufig wie<br />
früher, theils weil der plumpe und der zuversichtliche Vogel rohen und ungebildeten Jägern sich als leicht<br />
erlegbare Beute darbietet, theils wol auch mit infolge der massenhaften Mäusevergiftung im Jahre 1871.<br />
8 bis 10 Paare, deren Horste sich auf die größeren Forste vertheilen, mögen im Gebiet noch heimisch sein.“<br />
LIEBE teilt 1878 mit, dass es vor 50 Jahren mehr Bussarde gab als gegenwärtig, sich aber der Bestand seit<br />
1851 „unter verschiedenen, theilweis erheblichen Schwankungen sich so ziemlich auf derselben Höhe erhalten<br />
hat“. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Mäusebussard (Bussard). Früher<br />
regelmäßiger Brutvogel aller größeren Waldungen (Tiergarten, Gommla, Pöllwitz, Pohlitz), scheint er, wie<br />
alle anderen Raubvögel, im Bestand sehr zurückgegangen zu sein.“<br />
1900 bis 1950<br />
Anfang des 20.Jahrhunderts war der Mäusebussard ein verbreiteter und häufiger Brutvogel in Thüringen<br />
(HILDEBRANDT & SEMMLER 1976).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt „den jetzigen guten Bestand“ auf etwa 100<br />
BP. Der starke Rückgang im Kältewinter 1962/63 war bis 1967 wieder ausgeglichen. Bei einer überregionalen<br />
Bestandserfassung 1974/75 (KNORRE 1976 a) wurden folgende Bestände geschätzt: Altkreis Gera-Stadt<br />
und -Land auf 23,5 km² 22 BP bzw. auf 35 km² 20 bis 30 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 220 km² 50 BP, Altkreis<br />
Zeulenroda auf 40 km² 19 bis 20 BP. LANGE & LEO (1978) geben den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> mit etwa 50<br />
BP an und verweisen auf 32 bekannte und 13 vermutliche Brutplätze. LANGE & LIEDER (2001) gehen für das<br />
Untersuchungsgebiet von 500 bis 600 BP aus. Grundlage dieser Schätzung war eine halbquantitative Erfassung<br />
auf 91 km² Fläche von 1995 bis 2000, bei der eine Dichte von 0,82 bis 0,89 BP/km² ermittelt wurde. Im<br />
Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 bis 2009 ergaben sich 151 bis 400 BP (LUMPE & LIEDER 2009).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verringerung des Nahrungsangebotes durch intensive Landwirtschaft und Ausräumung der Landschaft<br />
- Illegale Verfolgung<br />
- Unfälle an Strommasten, Freileitungen, Bahn, Straßenverkehr und Windkraftanlagen<br />
- Forstliche Arbeiten zur Brutzeit in der Horstumgebung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schaffung extensiver landwirtschaftlicher Flächen mit reich strukturiertem Offenland<br />
- Aufklärung der Bevölkerung bei illegaler Verfolgung<br />
- Entschärfung gefährlicher Maststandorte und Freileitungen<br />
- Keine forstlichen Arbeiten im Brutrevier zur Brutzeit<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 117
Turmfalke, Falco tinnunculus (Brehm)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Turmfalke<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) schätzt die Art als häufigen Brutvogel um Gera ein. Spezielle Orte<br />
werden nicht genannt. LIEBE (1873) schreibt: „Der Thurmfalken giebt es bei uns so viel, daß wir sie – wenigstens<br />
in der östlichen Hälfte des Gebiets - verhältnißmäßig als sehr häufig bezeichnen müssen. ... Regelmäßig<br />
stehen, um nur einige der nächstliegenden Oertlichkeiten zu nennen, Horste im Gessenthal, in den Feldhölzern<br />
bei Niebra, Tröbnitz [Trebnitz], Hain, Tinz, Rubitz, Mensdorf, Posterstein, Linda, Mildenfurt ...“. Für<br />
Ostthüringen wird der Turmfalke als sehr häufiger Brutvogel bezeichnet, dessen Bestand seit langer Zeit<br />
etwas abgenommen hat (LIEBE 1878). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926):<br />
„Turmfalke (Rüttelfalke). Die Zeiten sind leider vorüber, wo dieses schmucke Fälkchen überall die Umgebung<br />
(Dölau, Pohlitz, Gommla, Pöllwitz, bei der Papiermühle, Elsterberg, Mohlsdorf) belebte. Jetzt wird es<br />
nur noch selten anzutreffen sein. Vor etwa 50 Jahren soll es sogar auf dem Schloßturme [Oberes Schloss<br />
<strong>Greiz</strong>] gebrütet haben.“<br />
1900 bis 1950<br />
Anfang des 20.Jahrhunderts war der Turmfalke ein häufiger Brutvogel in Thüringen, der „überall im Gemäuer<br />
alter Burgen und Ruinen, in Steinbrüchen, an Felswänden und auch in alten Krähennestern sowohl in<br />
Baumgruppen des offenen Geländes, wie in Feldgehölzen und im Randbereich größerer Wälder nistet“<br />
(HILDEBRANDT & SEMMLER 1976). HIRSCHFELD (1932) fand ihn in der Umgebung von Hohenleuben als Brutvogel<br />
in kleinen Feldgehölzen und an Waldrändern.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzte im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt knapp 200 BP. Der Bestand war im strengen<br />
Winter 1962/63 auf wenige BP zusammengeschmolzen. Vorwiegend wurden Baumbrüter festgestellt. In<br />
Weida und Gera gab es mehrere BP an Gebäuden, 6 BP allein an der Johanniskirche in Gera. LANGE & LEO<br />
(1978) stellten eine Bestandszunahme fest, wobei Gebäudebrüter deutlich zunahmen. Von den ca. 80 BP im<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong> wurden 10 bis 15 BP als Gebäudebrüter in <strong>Greiz</strong> festgestellt. Bei Auma war die Art um 1970<br />
Brutvogel in den Feldgehölzen und an den Waldrändern. Regelmäßig versuchten einige Vögel auf dem<br />
Kirchturm in Auma zu brüten (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). 1980/81 wurde der Brutbestand überregional<br />
erfasst (PETER 1983), wobei folgende Bestandszahlen geschätzt wurden: Altkreis Zeulenroda auf<br />
40 km² 8 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 227,8 km² 60 bis 80 BP, Altkreis Gera-Stadt und -Land auf 173,75 km² 77 bis<br />
81 BP (davon in Weida 16 bis 18 BP und in Ronneburg 3 BP). LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />
im Untersuchungsgebiet mit 300 bis 500 BP an. Grundlage dieser Schätzung war eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 88 km² Fläche zwischen 1995 und 2000, bei der eine Dichte von 0,37 bis 0,49 BP/km² ermit-<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 118
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
telt wurde. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurde die Häufigkeit im Untersuchungsgebiet<br />
auf 177 bis 368 BP geschätzt, wobei der Bestand eher an der Obergrenze liegen wird.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Einsatz von Bioziden und quecksilberhaltigen Saatgut-Beizmittel<br />
- Umbruch von Dauergrünland in Ackerflächen<br />
- Beseitigung der kleinteiligen Parzellierung des Offenlandes zugunsten großer Schlageinheiten<br />
- Einbruch der Feldmausbestände<br />
- Verlust von Feldgehölzen als potenzielle Brutplätze,<br />
- Verluste im Straßenverkehr, Verdrahtung und Windenergieanlagen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Wiederherstellung stark strukturierter landwirtschaftlicher Flächen und Erhöhung des Grünlandanteils<br />
- Verringerung des Einsatzes von Düngemitteln und Bioziden<br />
- Erhalt und besserer Schutz oder Neuanlage von Feldgehölzen<br />
- Anbringen von Nistkästen in der ausgeräumten Feldflur und in Siedlungsbereichen<br />
Verbreitungskarte 3: Turmfalke<br />
2 – 3 4 – 7 4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7 4 – 7 8 – 20<br />
4 – 7 8 – 20 8 – 20 8 – 20<br />
2 – 3 2 – 3 8 – 20 4 – 7<br />
4 – 7 2 – 3 4 – 7 2 – 3 8 – 20<br />
4 – 7 8 – 20 2 – 3 8 – 20 4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3 4 – 7 8 – 20 21 – 50 4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 8 – 20<br />
4 – 7 4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 119
Blässhuhn, Fulica atra (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Blässhuhn<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war das gemeine Wasserhuhn häufiger Brutvogel u.a. bei<br />
Reichenbach, Röpsen und auf der Elster. LIEBE (1873) nennt es einen recht häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera, der u.a. selbst auf kleinen Teichen bei Münchenbernsdorf und am Bahnhof Gera brütet.<br />
„In jedem größeren Teiche wohnen mehrere Paare.“ 1878 spricht LIEBE er von einer „starken Hebung seines<br />
Bestandes“. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Wasserhuhn (Bläßhühnchen).<br />
Solange der Binsenteich noch einen Schilfgürtel hatte, war das Bläßhühnchen (Tauchhühnel) der häufigste<br />
Brutvogel des Teiches, seitdem ist es dort verschwunden. Sonst nicht gerade selten in der Umgebung:<br />
Schlötenmühle, Hirschmühle, Mohlsdorf, Reudnitz, Moschwitz, Naitschau, Kurtschau.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) war die Art Anfang des 20.Jahrhunderts häufiger Brutvogel in Ostthüringen: „Auf<br />
allen Teichen, die neben Schilfrändern auch genügende Wasserflächen bieten, brütet es in Menge.“ Auch<br />
HIRSCHFELD (1932) fand das Blässhuhn als häufigen Brutvogel um Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) siedelten in den 1960er-Jahren 100 bis 200 BP im Altkreis Gera-Stadt und -Land.<br />
Auch BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) konnten das Blässhuhn als häufigen Brutvogel auf fast allen Teichen<br />
um Auma feststellen. LANGE & LEO (1978) stellten seit etwa 1960 eine Bestandszunahme im Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong> fest. Ende der 1970er-Jahre betrug der Bestand etwa 25 BP. 1972/73 schätzten TOLKMITT u.a. für den<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong> noch etwa 15 BP (SCHEFFEL 1976 a). Im Altkreis Gera-Stadt und -Land fand LIEDER (1985)<br />
maximal 88 BP in den Jahren 1980 bis 1982. Im Jahr 1994 wurden dort 90 BP ermittelt (ROST 1995).Nach<br />
flächendeckenden Untersuchungen von KLEHM, LANGE und LIEDER in den Jahren 1995/96 konnte der Gesamtbestand<br />
mit ca. 250 BP ermittelt werden (LANGE & LIEDER 2001). Für die Messtischblätter 5138 (Gera)<br />
und 5038 (Gera-Nord) konnte LIEDER (2004) mehr als 50 BP feststellen. Auf dem 7,9 ha großen <strong>Greiz</strong>er<br />
Parksee haben sich die Bruten seit 1980 wie folgt entwickelt (LUMPE 2008):<br />
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989<br />
3 2 2 5 2 1 0 8 1 2<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />
4 ? ? ? 1 1 2 1 2 4<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
6 5 6 8 8 5 16 7 2 2<br />
2010<br />
0<br />
Bemerkenswert ist das starke Brutjahr 2006 im Verhältnis zu den Jahren 1986 und 2010.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurde die Häufigkeit im Gebiet auf mindestens<br />
243 BP geschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 120
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Störungen am Brutplatz durch Freizeitaktivitäten<br />
- Verluste durch große Raubfische (Wels, Hecht)<br />
- Gewässerausbau mit Zerstörung der Röhrichtzone<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung von Ruhezonen an größeren Gewässern<br />
- Vermeidung von Störungen an Kleingewässern<br />
- Entfernung großer Raubfische aus Brutgewässern<br />
- Schutz und Neuanlage von Röhrichtzonen<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 121
Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vom Aussterben bedroht<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Ehemaliger Brutvogel<br />
Goldregenpfeifer<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach LIEBE (1873) war der Goldregenpfeifer Brutvogel am Frießnitzer See: „Charadrius auratus. Vor mehreren<br />
Jahren brütete ein Paar Goldregenpfeifer am Frießnitzer See und ward von Herrn Dr. RUD. MÜLLER P.<br />
dabei beobachtet und später erlegt.“ 1878 erwähnt LIEBE nochmals den Fall und beschreibt eigene Beobachtungen:<br />
„Der Goldregenpfeifer nistet ausnahmsweise bei uns. So z.B. am Frießnitzer See zwischen Weida<br />
und Triptis, wo ihn Herr Dr. R. MÜLLER P. dabei beobachtete und später erlegte. An demselben See sah ich<br />
ihn zur Brutzeit hindurch im Jahre 1875. In demselben Jahr sah ich zur Pfingstzeit am grossen Plothener<br />
Teiche in dem Teichdisdrict zwischen Neustadt und Schleiz ein Paar.“ HELLER (1897) kann zum Brutvorkommen<br />
folgendes mitteilen: „Auch mein väterlicher Freund LIEBE, unter dessen Leitung ich hier meine ersten<br />
ornithologische Studien machen konnte, kannte den Woyderteich und Frießnitzer See noch als Brutplatz<br />
mancher nun aus der Gegend verschwundener Vögel, wie Colymbus cristatus, Charadrius pluvialis, Ardea<br />
minuta, Botaurus stellaris u. A. Den Goldregenpfeifer habe ich selbst noch vor 20 Jahren brütend dort beobachtet,<br />
jetzt lässt er sich, wie so viele andere früher heimische Vögel, nur noch auf dem Zuge sehen.“<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1978) bezweifeln die Angaben von LIEBE, MÜLLER und HELLER. Sie beziehen sich<br />
auf die Angaben von NIETHAMMER (1937 – 42), dass übersommernde Stücke nicht allzu selten auch in<br />
Deutschland beobachtet werden. Dem Artbearbeiter des Goldregenpfeifers OXFORT (1986) lagen 162 Daten<br />
mit 1076 Individuen aus Thüringen vor. Eine Übersommerung wird darin nicht erwähnt. Junidaten fehlen<br />
offenbar völlig. Aus Sachsen wird nur von einem Einzelvogel zwischen dem 18.05. und dem 12.07.1981 bei<br />
Zittau berichtet (GRÖSSLER & HÄDECKE 1998). Auch in Bayern sind keine Übersommerungen bekannt<br />
(WÜST 1990).<br />
Alle Beobachtungen zum Brutvorkommen von LIEBE, MÜLLER und HELLER beziehen sich auf einen engen<br />
Zeitraum in den 1870er-Jahren. Als Ort wird der Frießnitzer See genannt, in dessen Umfeld sich noch heute<br />
größere Feuchtwiesenkomplexe befinden. Auch die Beobachtungen der brütenden Vögel von HELLER beziehen<br />
sich wohl auf den Frießnitzer See, sind aber bezüglich der Ortsbezeichnung nicht ganz eindeutig. Es<br />
erscheint unwahrscheinlich, dass sich alle drei gestandenen Beobachter geirrt haben sollten. Wir halten die<br />
Angaben zur Brut am Frießnitzer See für zutreffend.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Eine Ansiedlung ist derzeit unwahrscheinlich<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Spezielle Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 122
Waldschnepfe, Scolopax rusticola (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Waldschnepfe<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) schreibt: „Im Jahre 1829 brütete die Waldschnepfe nach Ch. L. BREHM bei Renthendorf. In den<br />
westlichen Waldstrichen [westlich der Weißen Elster] brütet sie auch jetzt noch (nach Herrn Oberförster<br />
HOFFMANN), wenn schon ganz vereinzelt und selten.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE 1878 mit: „Die Waldschnepfe<br />
brütet nur sehr vereinzelt im Gebiet, in den Wäldern des Altenburger Westkreises, des Reussischen<br />
Vogtlandes und des Frankenwaldes.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926):<br />
„Sehr selten. Einmal 1874 brütend am Gänsbach bei Elsterberg gefunden.“<br />
1900 bis 1950<br />
Aus diesem Zeitraum sind uns keine Angaben zum Brutvorkommen der Waldschnepfe bekannt.<br />
Ab 1950<br />
Erst im Jahre 1973 gelang ein Brutnachweis im Forstrevier Waldhaus, wo bereits 1970 Brutverdacht bestand<br />
(GÜNTHER 1981; LANGE & LEO 1978). Nach Einschätzung der beiden vorgenannten Autoren ist die Art ein<br />
vereinzelter sporadischer Brutvogel im Altkreis <strong>Greiz</strong>. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit<br />
„nicht mehr als 10 Paaren“ an. Es mangelte zu allen Zeiten an einer artspezifischen Erfassung in den potentiellen<br />
Brutgebieten. Ein deutlicheres Verbreitungsbild liefert erst die Erfassung im Rahmen der Kartierung<br />
zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009, wobei auch hier die Ergebnisse sicher noch lückenhaft sind. Für das<br />
Untersuchungsgebiet wurden 24 bis 34 BP ermittelt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Entwässerung von Waldgebieten<br />
- Intensivierung der Waldbewirtschaftung<br />
- Zunehmende Fragmentierung der Wälder<br />
- Verringertes Nahrungsangebot durch Wiesenumbruch<br />
- Biozideinsatz und Überdüngung auf Nahrungsflächen<br />
- Störungen durch Freizeitnutzung und Forstbetrieb<br />
- Verluste an Leitungen, Wildschutzzäunen und im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- schonende Waldwirtschaft mit Erhalt von Nass- und Feuchtstandorten<br />
- Entwicklung einer Kraut- und Strauchschicht durch Ausdünnung geeigneter Wälder<br />
- Ersatz der Fichtenwälder gegen standorttypische Mischwälder<br />
- Wiedervernässung von Bruchwäldern, Waldsenken und anderen drainierten Waldstandorten<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 123
Verbreitungskarte 4: Waldschnepfe<br />
4 – 7<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
1<br />
1 1<br />
2 – 3 2 – 3<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 124
Lachmöwe, Larus ridibundus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Lachmöwe<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Im Juli 1875 beobachtete Prof. LIEBE junge,<br />
nicht ausgefärbte Lachmöwen bei Zeulenroda. Da in der Nähe der Stadt größere Teiche liegen, ist ein Brüten<br />
dieses Vogels im Gebiet nicht ausgeschlossen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Aus diesem Zeitraum sind uns keine Angaben zum Brutvorkommen der Lachmöwe bekannt.<br />
Ab 1950<br />
Alle bisher festgestellten Brutorte mit der Anzahl der Bruten im Überblick:<br />
1. Feld bei Nauendorf:<br />
Erstmals wurde 1978 eine Brut der Lachmöwe auf einem Feld neben den Dorfteichen Nauendorf gefunden<br />
(ZÖRNER; MEY 1982).<br />
2. RNG Großkundorf:<br />
Im RNG Großkundorf kam es zur stärksten Ansiedlung:<br />
1979 Brutverdacht von mindestens 1 Paar (Lange, MEY 1982), ca. 10 BP 1980 – 1985, 160 BP 1986, ca.<br />
10 BP 1987, 63 BP 1988 (JAKOB, LANGE, MEY 1982; AUERSWALD & LIEDER 1991). Letztmalig brüteten<br />
hier 1990 15 BP (JAKOB, LANGE, ROST 2000) und 1996 1BP (LANGE)<br />
3. Weiderteich bei Niederpöllnitz:<br />
Der Weiderteich wurde zeitweise besiedelt: 1 BP 1980 (LIEDER, MEY 1982); 1 BP 1987, 1 BP 1989 (LIE-<br />
DER, AUERSWALD & LIEDER 1991), 1BP 1991, 7 BP 1994 (LIEDER, ROST 2000)<br />
4. RNG Culmitzsch:<br />
Im RNG Culmitzsch kam es zu den bisher letzten Bruten:<br />
1 BP 2003 (JAKOB, LANGE), 4 BP 2005 (LANGE)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung der Brutgewässer durch Trockenlegung (RKG Großkundorf, RNG Culmitzsch)<br />
- Zerstörung des Nistplatzes (Abgestorbener Baum im Weiderteich)<br />
- Störung am Brutplatz durch Freizeitaktivitäten (Surfen am Weiderteich)<br />
- Verlust der Gelege durch Prädatoren (Fuchs – Halbinsel im Weiderteich)<br />
- Rückgang der Nahrung durch Intensivierung der Landwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung von Ersatzlebensräumen für den Verlust der Brutplätze im Wismutgebiet<br />
- Schaffung einer ungestörten Brutmöglichkeit (Insel im Weiderteich)<br />
- Umwandlung von Ackerflächen in Wiesen im Umfeld des Weiderteiches, was auch anderen Arten helfen<br />
würde (Kiebitz, Wiesenschafstelze) und den Nährstoff- und Biozideintrag aus den umliegenden Feldflächen<br />
ins Gewässer verringern könnte<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 125
Sturmmöwe, Larus canus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Ehemaliger Brutvogel<br />
Sturmmöwe<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
21. Jahrhundert<br />
Bisher wurden nur Brutvorkommen im RNG Culmitzsch festgestellt: 1 BP 2004 (JAKOB), 1 BP 2005 (LANGE;<br />
ROST 2006). Diese Vorkommen stehen im Zusammenhang mit den Brutvorkommen auf dem Schachtturm<br />
Löbichau und in der Kiesgrube Untschen, die sich nur wenig außerhalb unseres Gebietes im Landkreis Altenburger<br />
Land befinden (KÖHLER).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust des Brutplatzes infolge der Sanierung durch die Wismut GmbH<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung eines gleichwertigen Ersatzgewässers für den Verlust des Brutplatzes<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 126
Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vom Aussterben bedroht<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Einmaliger Brutversuch<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nur im Jahr 1817 stellte BREHM (1820 – 22) einen Brutversuch auf dem Frießnitzer See fest.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren und<br />
- Eine Weideransiedlung ist derzeit nicht wahrscheinlich<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Auf Schutzmaßnahmen wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen<br />
Trauerseeschwalbe<br />
Foto: S. Morsch/Fotonatur.de<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 127
Straßentaube, Columba livia f. domestica (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Straßentaube<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Art („Haus- (Feld-) Taube“) als sehr häufigen Brutvogel<br />
in der Umgebung von Gera. Da in diesem Verzeichnis eingangs erwähnt wird, dass alle „wild im Fürstenthum<br />
Reuß – Gera und den angrenzenden Orten angetroffenen Vögel“ abgehandelt werden, dürfte dies<br />
ein wertvoller früher Hinweis auf die Vorkommen in der Stadt Gera sein.<br />
Ab 1980<br />
Eine Bestandsaufnahme der Straßentaube ist sehr schwierig (hohe Anzahl an Nichtbrütern, freifliegende<br />
Schlag- oder Zuchttauben, fehlen einer festen Brutzeit, unauffälliges Territorialverhalten). Erstmals in jüngerer<br />
Zeit wird die Verbreitung der Straßentaube von GOTTSCHALK (1980 a) untersucht. Danach zählte<br />
ZSCHIEGNER 1977/78 in Gera auf 6,5 ha bis zu 100 Tauben und LIEDER schätzte für ganz Gera ca. 200 BP.<br />
BARNIKOW zählte zu dieser Zeit in Auma 15, in Braunsdorf 2, in Gütterlitz und Muntscha je 1 und in Köthnitz<br />
15 BP. Für Ronneburg und Pölzig wurden 1977/78 einzelne Bruten gemeldet. LANGE & LIEDER (2001) nehmen<br />
im Untersuchungsgebiet, mit Schwerpunkt in den Städten, einen Bestand von 1000 BP an und erwähnen<br />
auch die ehemalige Rindermastanlage Gera-Rusitz mit ständig ca. 400 Vögeln. In den letzten 10 Jahren<br />
sind folgende Beobachtungen erwähnenswert, die Hinweise auf die etwaige Bestandsgröße geben könnten:<br />
1. Großenstein, Agrargenossenschaft: 200 Ind. am 09.01.2004 (REICHART)<br />
2. Korbußen/Schwaara/Mückern: 590 Ind. am 29.09.2004 (BECHER), 300 Ind. am 19.8.2007, 70 Ind. am<br />
27.6.2009 Rinderstall Korbußen (REICHARDT)<br />
3. Trebnitz: 400 Ind. am 14.11.2005, 400 Ind. am 18.02.2006 (REICHARDT)<br />
4. Gera: 2 BP 2002 auf 15 ha im Ostviertel (LIEDER), 400 Ind. am 11.02.2009 (REICHARDT)<br />
5. Gera-Milbitz: 51 Ind. am 21.11.2004 (BECHER)<br />
6. Ronneburg: 60 Ind. am 05.12.2004, 120 Ind. am 04.11.2005 (REICHARDT), 144 Ind. am 10.01.2006, 3 BP<br />
2006 Rathaus (LIEDER), 120 Ind. am 11.12.2007 (REICHARDT)<br />
7. Rückersdorf: 80 Ind. am 15.12.2002 (LIEDER)<br />
8. Linda/Rußdorf: 75 Ind. am 15.11.2009 (LUMPE)<br />
9. Großebersdorf: 3 BP 2002 Kirche (LIEDER)<br />
10. Frießnitz: 33 Ind. am 11.04.2003 (LUMPE)<br />
11. Niederpöllnitz: 60 Ind. am 15.01.2006 Getreidesilo (LIEDER)<br />
12. <strong>Greiz</strong>: 25 Ind. am 15.05.2008 (LUMPE)<br />
13. Zeulenroda: 3 Ind. 03.02.2005 (STEIN)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Die Art wird gelegentlich mit Gift bekämpft<br />
- Schließung von Einflugsmöglichkeiten an Gebäuden durch Sanierung von Altbauten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Es sind keine Schutzmaßnahmen erforderlich, da der Bestand aus hygienischen Gründen und wegen der<br />
Brutplatzkonkurrenz zu anderen Höhlenbrütern (Dohle, Turmfalke) niedrig gehalten werden sollte<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 128
Hohltaube, Columba oenas (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Hohltaube<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Hohltaube in den 1850er-Jahren ein häufiger Brutvogel<br />
um Gera. LIEBE (1873) beklagt den Rückgang der Art: „Die Hohltaube ist gar nicht häufig und ihre<br />
Zahl nahm sichtlich im Verlauf des letzten Jahrzehnts ab. Es werden der Nistgelegenheiten für diese Taube<br />
von Jahr zu Jahr weniger, und die wenigen hohlen Bäume, deren Fortleben der gesunde Sinn für Natur und<br />
Naturschönheiten der materiell-praktischen Forstwirthschaft abgerungen hat, werden von anderen, den<br />
unbewehrten Tauben überlegenen Vögeln in Besitz genommen. So haben am Hainberg und Weinberg bei<br />
Gera Dohlen und Staare die Hohltauben (1872) bis auf zwei Paare verdrängt. Entsprechende Beobachtungen<br />
sind auch bei Krossen und Weida gemacht worden.“ Dieser Rückgang muss sich fortgesetzt haben.<br />
LIEBE (1878) schreibt: „Im Gegensatz zu der Ringeltaube wird die Hohltaube, welche vor 70 Jahren bei uns<br />
in den meisten Strichen zahlreicher war wie die Ringeltaube, immer seltener. Schon Chr. L. Brehm klagt,<br />
dass sie mit der Zahl der hohlen Bäume im Wald abnehme. ... Ich glaube kaum, dass jetzt mehr als etwa<br />
noch 6 bis 8 Paare auf dem Gebiete brüten. Bei Gera auf dem Hain- und Weinberg, … im Tinzer Fasanenpark,<br />
…“. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr selten. Nur einmal (1873)<br />
am Gänsbach bei Elsterberg brütend festgestellt.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) erwähnt zwar keinen Ort in unserem Gebiet, vermerkt aber ihr Vorkommen in alten<br />
Buchenbeständen um Kahla und Stadtroda, bei Jena und in allen Forsten um Altenburg, wo sich ihr Bestand<br />
von Jahr zu Jahr vermehrt. Es ist anzunehmen, dass auch bei uns die Art zu dieser Zeit vorkam.<br />
SCHNAPPAUF fand sie in den 1930er-Jahren als Brutvogel bei Gera-Langenberg (GÜNTHER 1969).<br />
Ab 1950<br />
SOMMERLATTE (1953) stellte im NSG „Buchenberg“ bei Weida 4 BP fest. In den 1960er-Jahren wurden<br />
Brutvorkommen bei Weida und westlich von Gera gefunden (GÜNTHER 1969). BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL<br />
(1971) entdeckten die Art zur Brutzeit 1967 im Untendorfer Wald. LANGE & LEO (1978) gehen von 10 BP im<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong> aus. Bei einer überregionalen Bestandserfassung 1976 bis 1978 (GÜNTHER 1979 b) wurden<br />
folgende Brutvorkommen festgestellt:<br />
Altkreis Gera: nur die bei GÜNTHER (1969) erwähnten Vorkommen werden aufgeführt<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong>: weniger als 10 BP, regelmäßig nur im Forstrevier Waldhaus (FG <strong>Greiz</strong>, LANGE)<br />
Altkreis Zeulenroda: ständig 1 BP im Pöllwitzer Wald (FG Zeulenroda), unregelmäßig (1BP 1976) im<br />
Untendorfer Wald (FG Auma).<br />
Ein wesentlich höherer Bestand mit 100 bis 200 BP wird von LANGE & LIEDER (2001) geschätzt. LIEDER &<br />
LIEDER-SÖLDNER (2010) fanden 2009 im NSG „Buchenberg“ bei Weida 9 BP.<br />
Ein deutlicheres Verbreitungsbild liefert die Erfassung im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />
2005 bis 2009. Danach brüten im Untersuchungsgebiet 99 bis 195 BP.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 129
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Waldwirtschaft mit verkürzten Umtriebszeiten, Verluste von höhlenreichen alten Buchen<br />
und Eichen und Entfernung kranker Bäume<br />
- Verringertes Nahrungsangebot durch Intensivierung der Landwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Änderung der Waldnutzung mit Erhöhung des Altholzanteils, langfristige Erhaltung der Bruthöhlen und<br />
Schaffung von Naturwaldreservaten<br />
- Nistkästen in geeigneten Altholzbeständen<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
Verbreitungskarte 5: Hohltaube<br />
4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
1 1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 130
Ringeltaube, Columba palumbus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Ringeltaube<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Art als häufigen Brutvogel in der Umgebung von<br />
Gera. Nach LIEBE (1873) war die Ringeltaube häufiger als in früheren Jahren anzutreffen. Als Beispiele für<br />
ihr Brutvorkommen nannte er Feldgehölze östlich von Leumnitz, südwestlich bei Tröbnitz, im Wäldchen nördlich<br />
von Roschütz und besonders viele BP in den Anlagen der Fasanerie Gera-Tinz. Wenige Jahre später<br />
stellte LIEBE (1878) bereits eine Verstädterung der Art fest: „Ich habe in dem letzten Jahrzehnt sie oft auf<br />
dem eben gemähten Rasen in Obstgärten mitten in den Dörfern weiden und ihr Nest auf Birn- und<br />
Äpfelbäumen, gestutzten Pappeln und Nadelbäumen dicht neben den Häusern stehen sehen, und zwar<br />
vorzugsweise in den Strichen, wo die Wälder abgetrieben worden waren.“ Nach seinen Aufzeichnungen von<br />
1881 schreibt HELLER (1926): „Ringeltaube (Holztaube). Nicht seltener Brutvogel unserer Waldungen:<br />
Gommla (bei der Hartmannswiese), Kupferhammer, Gasparinenberg, Kalkgrube, Dölau, Rothental, Elsterberg,<br />
Pöllwitz, Tremnitz, Arnsgrün, Ruppertsgrün. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) nannte die Ringeltaube einen häufigen Brutvogel in Ostthüringen, sowohl in den Wäldern<br />
und Feldgehölzen, als auch in den Gärten und Anlagen innerhalb der Ortschaften.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) vermutet eine Abnahme des Bestandes in den Städten nach der Einwanderung der Türkentaube.<br />
Er schätzt den Bestand im Altkreis Gera auf 500 BP. LANGE & LEO (1978) beziffern den Bestand im<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong> auf weniger als 100 BP und verweisen darauf, dass bisher nur zwei Stadtbruten bekannt geworden<br />
sind. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Ringeltaube um Auma ein regelmäßiger und<br />
gleichbleibend häufiger Brutvogel in Wäldern und Feldgehölzen. Brutvorkommen in Siedlungen werden nicht<br />
erwähnt. In Rahmen einer überregionalen Bestandserfassung 1977/78 wurden folgende Brutpaardichten<br />
ermittelt (GOTTSCHALK 1980 b): Bezirkskrankenhaus Gera auf 10 ha 4 BP, Weinberg bis Ernsee/Gera auf 28<br />
ha 4 BP, Umgebung Pölzig auf 10 ha 1 BP, Reust bis Rußdorf auf 25 ha 2 bis 3 BP, Ort Ronneburg auf 150<br />
ha 4 BP, westlich Ronneburg auf 60 ha 1 bis 3 BP, Auma und Umgebung auf 25 ha 1 BP und<br />
Aubachtal/<strong>Greiz</strong> auf 22,5 ha 3 bis 4 BP. LANGE & LIEDER (2001) gehen von einem Gesamtbestand von 1000<br />
bis 1500 BP aus. Grundlage war eine Untersuchung auf 88 km² Fläche in den Jahren 1995 bis 2000, bei der<br />
88 bis 133 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 3 bis 8 BP geschätzt<br />
(LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Vergiftung durch gebeiztes Saatgut<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verbot toxischer Beizmittel<br />
- Reduktion von Bioziden in der Landwirtschaft<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 131
Türkentaube, Streptopelia decaocto (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Türkentaube<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
Ab 1950<br />
Seit 1947 ist die Art im Zuge der Westausbreitung Brutvogel in Thüringen (OXFORT & WERNER 1971). Nach<br />
diesen Autoren vollzog sich die Besiedlung des Untersuchungsgebietes bis 1960 folgendermaßen: den ersten<br />
Vogel beobachtete WEBENDÖRFER im Frühjahr 1954 in Büna, 1956 gab es ein Vorkommen in<br />
Münchenbernsdorf (WICHLER), 1957 wurde in Zeulenroda eine Brut gefunden (WERNER), 1958 stellte<br />
SEHMISCH das Vorkommen in Weida fest und WICHLER fand eine Brut in Ronneburg, 1959 wurden 4 Vögel in<br />
Naitschau von WEBENDÖRFER und WERNER beobachtet und WEBENDÖRFER stellte ein Vorkommen in <strong>Greiz</strong><br />
fest, 1960 konnten dann Bruten in Weida (SEHMISCH), <strong>Greiz</strong>-Irchwitz (WEBENDÖRFER) und Gera (WICHLER)<br />
gefunden werden, in Auma wurden 2 Vögel beobachtet (NÖLLER). 1960 war folgender Bestand erreicht: bis 5<br />
Vögel in Münchenbernsdorf (WICHLER), bis 10 Vögel in Ronneburg (WICHLER), bis 20 Vögel in Weida<br />
(SEHMISCH), <strong>Greiz</strong> (WEBENDÖRFER) und Gera (WICHLER). In diesem Jahr fehlte die Art in Berga (BLAM) und<br />
Zeulenroda (WERNER).<br />
Nach GÜNTHER (1969) können noch folgende Daten ergänzt werden: 1957 im Frühjahr 3 Vögel in<br />
Ronneburg und 6 Vögel in Münchenbernsdorf. Bruten wurden 1960 in Gera und 1961 in Pölzig nachgewiesen.<br />
Der Bestand wird im Altkreis Gera-Stadt und -Land Ende der 1960er-Jahre auf wenige hundert BP geschätzt.<br />
Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) brüten um Auma ca. 50 BP. LANGE & LEO (1978) melden<br />
1958 den ersten Brutnachweis für <strong>Greiz</strong> und schätzen den Bestand nach einem Höhepunkt Ende der<br />
1960er-Jahre als leicht rückläufig ein und Mitte der 1970er-Jahre brüteten im Altkreis <strong>Greiz</strong> ca. 100 BP.<br />
1977/78 wurde eine überregionale Erhebung der Turteltaube durchgeführt (GOTTSCHALK 1980 d). Danach<br />
wurden folgende Bestände ermittelt bzw. geschätzt: Gera 250 BP, Ronneburg 25 bis 27 BP, Korbußen 3 bis<br />
4 BP, Lengefeld 2 BP, Pölzig 1 BP, Sachsenroda 4 BP, Großenstein 8 bis 10 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> 100 BP,<br />
Auma 30 bis 35 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet Ende der<br />
1990er-Jahre mit 300 bis 500 BP an. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden<br />
mindestens 321 BP ermittelt. Die Verbreitung ist flächendeckend. Keine Feststellungen gab es lediglich<br />
in folgenden Quadranten: 5338/3 und 5338/4<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Nahrungsverknappung infolge des Rückgangs der häuslichen Geflügelhaltung und des sicheren Verschlusses<br />
von Getreidelagerstätten führt insbesondere in den Wintermonaten zu Verlusten<br />
- Prädation durch Greifvögel, Eulen, Rabenvögel, Marder und Hauskatzen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Sicherstellung entsprechender Futterangebote in den Wintermonaten<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 132
Turteltaube, Streptopelia turtur (Bodd.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Gefährdet<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Turteltaube<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) schreibt: „Ich habe sie am Oeftersten in der Nähe der Roda und Orla, weil die an diesen<br />
Flüssen liegenden Wälder mit Felder abwechseln, außerdem in Feldhölzern, in Laubwäldern, sogar an Flußufern,<br />
welche mit vielen Erlen besetzt sind, zur Brutzeit angetroffen.“ Die Ornithologische Sektion Gera<br />
(1859) bezeichnet die Art als häufigen Brutvogel in der Umgebung von Gera. Dem schließt sich auch LIEBE<br />
(1873) an, wobei er bemerkt, dass der Bestand großen Schwankungen unterworfen ist: „In manchen Jahren<br />
findet man auf dem ganzen Gebiet kaum 3 oder 4 Paare, und in anderen wiederum erschallt aus jedem größeren<br />
Fichtenbestand das schnurrende Rucksen dieser zierlichen Taube.“ Nach seinen Aufzeichnungen von<br />
1881 schreibt HELLER (1926): „Selten und unregelmäßig: bei Grochlitz, am Hirschstein, bei der Herrenreuth,<br />
Coschütz, Elsterberg.“ In den Revieren Pohlitz und Hermannsgrün bei <strong>Greiz</strong> brüteten nach DOMBROWSKI<br />
(1893) je 2 bis 3 BP.<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) nannte die Turteltaube als verbreiteten Brutvogel in Ostthüringen, ist aber der Meinung,<br />
dass der Bestand zurückgegangen sei. Nach HIRSCHFELD (1932) ist die Turteltaube ein seltener und unregelmäßiger<br />
Brutvogel bei Hohenleuben. Roßbach (1935/1936 a) stellte ein Zunahme fest. Er beobachtete<br />
die Art im Geraer Stadtwald, in Zeulsdorf, Unterröppisch, Wolfsgefährt, Sirbis, Zedlitz und Hain. 10 Jahre<br />
zuvor war die Turteltaube im Gebiet noch selten.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) beziffert den Bestand der Turteltaube im Altkreis Gera-Stadt und -Land auf nicht mehr als<br />
40 Paare. Um Auma wird die Turteltaube als regelmäßiger Brutvogel in geringer Zahl bezeichnet (BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL 1971). LANGE & LEO (1978) schätzen für den Altkreis <strong>Greiz</strong> 40 bis 50 BP. Der Bestand<br />
konzentrierte sich auf den Nordteil des Kreises, weniger stark auf die ausgedehnten Waldungen östlich von<br />
<strong>Greiz</strong>. Im Rahmen einer überregionalen Bestandserfassung 1977/78 spricht GOTTSCHALK (1980 d) von<br />
nachstehenden Vorkommen in den Altkreisen Zeulenroda, <strong>Greiz</strong> und Gera: Schottergruben bei Großenstein,<br />
Leitholdshain bei Reichstädt, Pfarrhölzer bei Röpsen, Rödel bei Aga, bei Wünschendorf, Frießnitz und<br />
Großebersdorf. Folgende flächenbezogene Dichten wurden damals ermittelt: Reust bis Rußdorf auf 25 ha 1<br />
bis 2 BP, Ronneburger Forst auf 72 ha 1 BP, Kauern/Falka/Lengefeld auf 600 ha 2 BP, Auma und Umgebung<br />
auf 25 ha 5 BP und Haldengelände Großkundorf 4 bis 6 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />
im Untersuchungsgebiet Ende der 1990er-Jahre mit 100 bis 300 BP an. Im Rahmen der Kartierung<br />
zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 129 bis 267 BP genannt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 133
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust der Lebensräume durch Intensivierung der Landwirtschaft und durch Flurbereinigungen<br />
- Zerstörung der Auengebiete durch Gewässerausbau und Grundwasserabsenkung<br />
- Umstellung der Waldwirtschaft auf monotone Altersklassewälder<br />
- Verlust der Ackerwildkräuter durch Intensivbewirtschaftung mit hohem Einsatz von Agrochemikalien<br />
- Wechsel zu ertragreichen Monokulturen in der Landwirtschaft, dadurch Abnahme der Wildkräutersamen<br />
- Störung durch Freizeitnutzung an den Brutplätzen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Renaturierung oder Erhaltung heckenreicher, extensiv genutzter Kulturlandschaften<br />
- Schutz verbliebener Auengebiete, naturnaher mehrstufiger Laub- und Mischwälder und extensiv bewirtschafteter<br />
Wiesengebiete<br />
- Reduktion des Herbizideinsatzes<br />
Verbreitungskarte 6: Turteltaube<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
8 – 20 4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1 1 4 – 7<br />
1 1 2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20 8 – 20<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 134
Kuckuck, Cuculus canorus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Kuckuck<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) fand den Kuckuck in der Umgebung von Renthendorf bei folgenden Wirtsvogelarten:<br />
bevorzugt bei Bach- und Gebirgsstelze, weiterhin Dorn-, Garten- und Klappergrasmücke, Rotkehlchen, Heckenbraunelle<br />
und Zaunkönig. Die Ornithologische Sektion Gera (1859) schätzt den Kuckuck als häufigen<br />
Vogel ein. Auch LIEBE (1873) bezeichnet die Art als häufigen Brutvogel, der in den letzten Jahren noch zugenommen<br />
hat. Als Wirtsvogel konnte er die Klappergrasmücke nachweisen. LIEBE teilte 1878 mit: „Der Bestand<br />
der Kukuke ist in der ganzen Reihe der Jahre daher, mit unausgesetzten Schwankungen von etwa 25<br />
Procent, derselbe geblieben.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr vereinzelter,<br />
aber regelmäßiger Brutvogel des Gebietes. Brutpfleger sind hier meistens Grasmücken und weiße<br />
Bachstelzen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) war die Art in Ostthüringen ein häufiger Brutvogel. FEUSTEL (1902) fand einen<br />
Jungvogel 1902 bei Pohlitz im Nest der Sperbergrasmücke. SCHEIN (1906 b) fand bei Poris 1904 zwei Nester<br />
des Neuntöters mit je einem Kuckucksei. Nach seinen Ausführungen gelangen SCHEIN mehrere Funde von<br />
Kuckuckseiern in Neuntöternestern, die er systematisch zerstörte (SCHEIN 1906 a). Nach GÜNTHER (1969)<br />
wurde zwischen 1930 und 1940 im Gessental zwischen Ronneburg und Gera vorwiegend der Neuntöter als<br />
Kuckuckswirt festgestellt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die bei FEUERSTEIN (1951) genannten<br />
Funde aus dem Gessen- und Wipsetal im Geraer Museum: 9-mal Neuntöter (davon ein Nest mit 2 Kuckuckseiern),<br />
1-mal Goldammer und 1-mal Gartengrasmücke. HIRSCHFELD (1932) führt als Wirtsvögel in der<br />
Umgebung von Hohenleuben Bachstelze, Gartengrasmücke und Neuntöter an.<br />
Ab 1950<br />
WICHLER (1951) fand ein Gelege der Dorngrasmücke mit einem Kuckucksei. Im Altkreis Gera war der Kuckuck<br />
nicht mehr so häufig wie früher (GÜNTHER 1969). Er schätzte den Bestand auf weniger als 100 Tiere.<br />
1950 fand er im Gessental einige Nester der Gartengrasmücke mit jungen Kuckucken. Als weitere Wirtsvögel<br />
erwähnt er zwischen 1950 und 1969 Zaunkönig, Bachstelze, Laubsänger (Fitis oder Zilpzalp), Gartenrotschwanz<br />
und Rotkehlchen, ohne dass eine Spezialisierung erkennbar war. In der Umgebung von Auma war<br />
die Art regelmäßig, aber nicht häufig anzutreffen (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Auch im Altkreis <strong>Greiz</strong><br />
lag der Bestand unter 50 Vögeln (LANGE & LEO 1978). Als bevorzugter Wirt wird die Bachstelze genannt.<br />
GOTTSCHALK (1980 e) führte 1977/78 eine Bestandserfassung durch und nennt folgende Ergebnisse von<br />
einigen Kontrollflächen: Gera-Pforten auf 70 ha 1 BP, Krankenhaus Gera auf 6 ha 1BP, Pölzig und Umgebung<br />
auf 10 ha 1 BP, Ronneburg und Umgebung auf 7500 ha 8 bis 12 BP, Ronneburg bis Gera auf 750 ha 1<br />
BP. Als Kuckuckswirte wurden bei Umfragen genannt: 7-mal Bachstelze, 1-mal Hausrotschwanz, > 5-mal<br />
Neuntöter, 2-mal Zaunkönig, 1-mal Gartenrotschwanz, 1-mal Gartengrasmücke und 1-mal Amsel. In den<br />
folgenden Jahren wurden weitere Wirtsvögel festgestellt (Datenbank VOOG): 1984 Bachstelze (DUDAT) und<br />
Amsel (DUDEK), 1996 Amsel (REIßMANN), 1996 Bachstelze (DUDAT) und 1999 Zaunkönig (REIßMANN). LANGE<br />
& LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 500 bis 800 rufende Männchen an.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 135
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde.<br />
Es wurden dabei 58 bis 80 rufende Männchen geschätzt bzw. erfasst. Im Jahre 2008 erfolgte eine<br />
Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald,<br />
auf 115 ha ökologisch wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier<br />
wurden elf Reviere vom Kuckuck ermittelt (VOOG). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005<br />
bis 2009 wurden 125 bis 202 BP bzw. rufende Männchen ermittelt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Starker Rückgang vieler Wirtsvogelarten als Folge der Zerstörung und Verlust der Lebensräume, insbesondere<br />
durch Ausräumung der Agrarlandschaft<br />
- Starker Rückgang der Insektennahrung durch Einsatz von Bioziden und Verlust der Nahrungspflanzen der<br />
Insekten durch Herbizideinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Schutz oder Wiederherstellung vielfältiger Randstrukturen und blütenreicher Säume, erhebliche Einschränkung<br />
des Biozideinsatzes zur Erholung des Wirtsvogelbestandes sowie der Nahrungstiere<br />
Verbreitungskarte 7: Kuckuck<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
1 4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3 2 – 3<br />
4 – 7 2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
1 1 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 136
Sperlingskauz, Glaucidium passerinum Tunst.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Sperlingskauz<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) schreibt: „Aus Erfahrung weiß ich, daß der Zwergkauz auf dem thüringer Walde vorkommt;<br />
doch wohnt er nicht bloß auf den höchsten Bergen desselben.“ BREHM berichtet über Funde von<br />
Jungvögeln und Eiern in der Umgebung von Renthendorf. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt<br />
HELLER (1926): „Aus meiner Knabenzeit ist mir genau erinnerlich, daß Kaufmann Ottomar Helfer zwei winzige<br />
Eulen im Käfig hielt, die nach seiner Aussage bei <strong>Greiz</strong> erbrütet waren. Einige Jahre später bekam ich bei<br />
Prof. Liebe lebende Sperlingskäuze zu sehen, die den obenerwähnten vollständig glichen.“ HILDEBRANDT<br />
(1917 b) bezweifelt die Richtigkeit sämtlicher Angaben aus dem 19.Jahrhundert, jedoch gehören all die genannten<br />
Orte heute zum Vorkommensgebiet des Sperlingskauzes.<br />
1900 bis 1950<br />
WEISS (1908) führt 5 Jungvögel von Pfersdorf auf, was von RINGLEBEN (1970) bezweifelt wird. (1984 gelang<br />
in unmittelbarer Nähe bei Forstwolfersdorf ein Brutnachweis durch BAUM, was die Angaben von WEISS realistisch<br />
erscheinen lässt.) Nach HIRSCHFELD (1932) beobachtete VÖLCKEL die Art zweimal bei Loitsch.<br />
Ab 1950<br />
RUDAT & WIESNER (1981) untersuchten die aktuelle Verbreitung des Sperlingskauzes in Thüringen. Die Angaben<br />
sind auf einzelne Messtischblätter bezogen: TK 5237 Reviernachweis durch BAUM, TK 5338 Revierverdacht,<br />
TK 5339 Reviernachweis durch WIESNER und SCHÖNN. Nach GÜNTHER (1982) hörte BAUM einen<br />
rufenden Sperlingskauz bei Forstwolfersdorf. SCHÖNN fand die Art bei Reudnitz (GÜNTHER 1986).<br />
Weitere Nachweise von je 1 BP nach TK (Datenbank VOOG):<br />
5137: 2003 Großebersdorf/1 km N (K. LIEDER, J. WIESNER)<br />
5237: 1984 Forstwolfersdorf (H. BAUM), 2006 Wöhlsdorf/1,5 km SW (VTO)<br />
5238: 1995 Schömberger Forst (K. KLEHM)<br />
5239: 1988 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Schwarzer Teich (W. ROTT), 1989 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Schwarzer Teich<br />
(H. LANGE), 2007 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Schwarzer Teich (VTO)<br />
5337: 1995 Auma/1,5 km SW (J. WIESNER), 1996 Weckersdorf/Köthenwald (K. KLEHM), 2000 Leitlitz/1km S<br />
(H. LANGE), 2008 Zeulenroda/Teufelsberg, 2008 Leitlitz/Köthenwald, 2008 Langenwolschendorf/1 km<br />
W (K. KLEHM)<br />
5338: 1991 Pöllwitzer Wald/2 km N Wolfshain, 1992 Pöllwitzer Wald/2 km N Wolfshain, 1992 Pöllwitzer<br />
Wald/2 km W Wellsdorf, 1992 Pöllwitzer Wald/1 km SSE Neuärgerniß, 1995 Pöllwitzer<br />
Wald/Fichtenaltholz, 1996 Pöllwitzer Wald/Abt. Abt. 44, 1998 Pöllwitzer Wald/Abt. 89 (K. KLEHM), 1999<br />
Dobia/1km N, 1999 Wolfshain/1,5 km N (H. LANGE), 1999 Pöllwitzer Wald/Abt. 117, 1999 Pöllwitzer<br />
Wald/Abt. Abt. 122, 2000 Pöllwitzer Wald/Abt. 57 (K. KLEHM), 2007 Pöllwitzer Wald (VTO)<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 137
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
5339: 1983 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Sächs. Laagweg (W. ROTT), 1986 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Schlötengrund<br />
(J. WIESNER), 1987 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Schlötengrund (H. LANGE), 1996 Nitschareuth/1,7 km SE<br />
(J. WIESNER), 2002 <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald/Marksloch (E. DÖRING, A. KANIS, H. LANGE)<br />
LANGE & LIEDER (2001) beziffern den Bestand auf 20 bis 30 BP. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-<br />
Projekt 2005 bis 2009 wurden 34 bis 50 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Einrichtung monotoner Altersklassenwälder, Fehlen von Altholzbeständen, intensive<br />
Waldpflege, Waldwegebau, Höhlenmangel und touristische Erschließung<br />
- Biozidbelastung<br />
- Prädation durch Waldkauz, Sperber und Baummarder<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Nachhaltige Sicherung und Schutz von Altholzbeständen sowie höhlenreichen Einzelbäumen und deren<br />
Umgebung in stark gegliederten, grenzlinien- und strukturreichen Nadel- und Mischbeständen<br />
- Kein Einsatz von Insektiziden in Waldgebieten<br />
- Kartierung der Bruthöhlen und Information der zuständigen Forstverwaltung<br />
Verbreitungskarte 8: Sperlingskauz<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 138
Waldohreule, Asio otus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Waldohreule<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Waldohreule früher noch weit häufiger. Als Brutplätze<br />
werden u.a. Gera-Kaimberg und Gera-Collis genannt. LIEBE (1873) schreibt: „Die Ohreulen waren jetzt<br />
häufig und horsteten nicht bloß in den größeren Waldungen, sondern auch in kleinen Gehölzen, wie z.B.<br />
hinter der Lasur nach Kaimberg zu, zwischen Niebra und Peßneck, bei Zschippach ...“. Später stellt er eine<br />
Abnahme des Bestandes fest (LIEBE 1878). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926):<br />
„Nicht selten in größeren Waldungen, aber auch in Feldgehölzen: Waldhaus, Gommla, Dölau, Elsterberg,<br />
Pohlitz, Pöllwitz; Tremnitzgrund. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1976) bezeichnen die Waldohreule in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als<br />
verbreiteten Brutvogel in ganz Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist die Waldohreule die häufigste Eulenart im Altkreis Gera-Stadt und -Land mit mindestens<br />
200 BP. In der unmittelbaren Umgebung vom Auma kannten BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971)<br />
7 Brutplätze. LANGE & LEO (1978) schätzen für den Altkreis <strong>Greiz</strong> etwa 30 BP. Im Rahmen einer Bestandserfassung<br />
1972/73 wurden folgende Brutpaarzahlen ermittelt (RITTER 1974): Pölzig auf 600 ha 6 BP,<br />
Röpsen/Dorna auf 360 ha 4 BP, Roschütz/Schwaara auf 1700 ha 5 bis 7 BP, Münchenbernsdorf auf 800 ha<br />
2 bis 3 BP, Gera/Pforten/Lasur auf 80 ha 3 BP, Rußdorf/Reust auf 450 ha 8 bis 9 BP, Naulitz/Kauern auf 700<br />
ha 7 BP, Paitzdorf/Ronneburg auf 200 ha 1 BP, Auma auf 4000 ha 20 BP, Mildenfurth 1 BP, Umgebung<br />
Zeulenroda 7 BP, Frankenau 1 BP, Finstertal bei Weida 1 BP, Tremnitz 4 BP und Raasdorf 2 BP. LANGE &<br />
LIEDER (2001) geben den stark schwankenden Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet in günstigen Jahren<br />
mit 150 bis 200 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen<br />
1995 und 2000 zugrunde, bei der 19 bis 33 BP geschätzt bzw. erfasst wurden. Im Rahmen der Kartierung<br />
zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 56 bis 94 BP veranschlagt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 139
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Nahrungsmangel in Folge der Intensivierung der Landwirtschaft (Ausbleiben der Kleinsäuger-<br />
Gradationsjahre, Ausräumung der Landschaft und exzessiver Düngemittel- und Biozideinsatz)<br />
- Verkehrsopfer<br />
- Prädation durch Greifvögel, große Eulen und Gelegeverluste durch Marder<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Reduzierung des Düngemittel- und Biozideinsatzes<br />
- Einsatz künstlicher Nisthilfen<br />
- Erhalt traditioneller Schlafbäume<br />
Verbreitungskarte 9: Waldohreule<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 140
Sumpfohreule, Asio flammeus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vom Aussterben bedroht<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutverdacht<br />
Sumpfohreule<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
20. Jahrhundert<br />
Folgende Beobachtungen liegen aus den Steinwiesen zwischen Nauendorf und Baldenhain vor:<br />
1972: 11. April 1 Ind. (AUERSWALD, LIEDER, ZÖRNER)<br />
1973: April 1 Ind. (AUERSWALD; KNORRE 1974)<br />
Anf. Mai 2 Ind. (♂/♀) (AUERSWALD; KNORRE 1974)<br />
Nach Mitteilung von AUERSWALD wurde die Sumpfohreule auch später noch beobachtet,<br />
es gelang jedoch kein Nestfund.<br />
1974: 24. März 1 Ind. (AUERSWALD)<br />
30. März 1 Ind. (AUERSWALD, LIEDER, ZIEGLER)<br />
08. April 1 Ind. (LIEDER)<br />
22. August 1 Ind. (AUERSWALD, LIEDER)<br />
Nach den Kriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) bestand 1973 Brutverdacht für diese Art<br />
in den Steinweisen zwischen Nauendorf und Baldenhain<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Das vermutliche ehemalige Brutgebiet wurde entwässert, die Wiesen wurden in Ackerland umgewandelt<br />
und ein größeres Schilfgebiet zu einem Kleinspeicher (Speicher Baldenhain) ausgebaut<br />
- Ausbleiben oder erhebliche Minderung der Mäusegradationen durch Lebensraumverlust, Bodenverdichtung<br />
und Überdüngung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wiederherstellung und Schutz des extensiven Grünlandes im ehemaligen Brutgebiet, einschließlich einer<br />
Wiedervernässung der Steinwiesen<br />
- Starke Reduktion des Düngemittel- und Rodentizideinsatzes<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft in anderen Feuchtgebieten, z.B. NSG Frießnitzer See/Struth,<br />
- Erhaltung feuchter Offenlandflächen mit Beweidung auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Rüdersdorf<br />
und im Zeitzer Forst<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 141
Waldkauz, Strix aluco (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Waldkauz<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) nennt den Waldkauz einen häufigen Brutvogel um Gera. LIEBE<br />
(1873) bezeichnet den Waldkauz als die häufigste Eule um Gera, die 1871 doppelt so häufig war wie die<br />
Waldohreule. Als Nistplätze wurden zu dieser Zeit offensichtlich Horste von anderen Vögel häufiger als heute<br />
genutzt: „Als Horst benutzen sie bei uns vorzugsweise alte Habichts- und Sperberhorste, Krähen- und<br />
Hähernester, seltener hohe, hohle Kopfweiden.“ Auch für Ostthüringen bezeichnet LIEBE (1878) die Art als<br />
häufigste und verbreitete Eule. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Seltener<br />
Brutvogel: Gasparinenberg, Rothenthal, Dölau, Noßwitz.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) bezeichnet sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als häufige Eulenart in Ostthüringen.<br />
In der Umgebung von Hohenleuben kannte HIRSCHFELD (1932) den seit 10 Jahren besetzten Brutplatz<br />
in einem hohlen Kirschbaum bei Reichenfels.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) kommt der Waldkauz nicht mehr so häufig wie früher im Altkreis Gera-Stadt und<br />
-Land vor: „Es sind nur wenige Brutpaare (wohl nicht über 30) im Gebiet vorhanden. In letzter Zeit sind vorkommen<br />
in Gera, bei Ronneburg, Münchenbernsdorf und Weida bekannt geworden.“ In der unmittelbaren<br />
Umgebung vom Auma brütete der Waldkauz im Untendorfer Wald und auf dem Kirchturm in Wöhlsdorf sowie<br />
in einer abgebrochenen Birke im Poser (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL1971). Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> bezeichnen<br />
LANGE & LEO (1978) den Waldkauz als häufigste Eulenart und schätzen den Bestand auf etwa 30<br />
BP. Bei einer Bestandserfassung 1972/73 wurde folgende Anzahl BP ermittelt (RITTER & GÜNTHER 1974):<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land 23 bis 26 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> 10 bis 20 BP und Altkreis Zeulenroda (weniger als<br />
die Hälfte kontrolliert) 6 bis 7 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 100 bis 150 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 88 km² Fläche zwischen<br />
1995 und 2000 zugrunde, bei der 12 bis 14 BP ermittelt wurden. Im Rahmen der Kartierung zum<br />
ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 92 bis 172 BP geschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 142
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust und geringeres Nahrungsangebot durch Siedlungsverdichtung, Zerschneidung und<br />
Ausräumung der Landschaft und Intensivierung der Landwirtschaft<br />
- Verstärkter Einsatz von Bioziden und Düngemitteln<br />
- Verlust der Brutplätze durch Abholzung und Abräumen der Höhlenbäume und Renovierung bzw. Abbruch<br />
von Gebäuden<br />
- Verluste an Freileitungen sowie im Bahn- und Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz von Altholzbeständen<br />
- Anbringung von Nistkästen in altholzarmen Wäldern (Beachtung des Schutzes der Kleineulen !)<br />
Verbreitungskarte 10: Waldkauz<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7 4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 143
Mauersegler, Apus apus (Scop.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Mauersegler<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die „Mauerschwalbe“ war in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein sehr häufiger Brutvogel in Gera (Ornithologische<br />
Sektion Gera 1859). LIEBE (1873) berichtet von einer weiteren Zunahme: „Sie haben sich im Gegentheil<br />
im Ganzen vermehrt und namentlich in den Jahren 1859 bis 1861 erschienen sie in sehr großer Anzahl.<br />
Dieser Vergrößerung ihrer Gesellschaft entsprach aber die Zahl der passenden Mauerlöcher nicht, und daher<br />
war ein Theil von Ihnen genöthigt, seine Wohnung in Baumlöchern und Staarkästen aufzuschlagen.“ Für<br />
Ostthüringen teilt LIEBE (1878) mit: „Früher beschränkten sie sich auf die grösseren Ortschaften, verschmähten<br />
sogar die vielen kleineren Städte und wohnten fast ausschliesslich auf Thürmen. Jetzt haben sie auch<br />
eine Anzahl Dörfer bezogen und sich in den Städten so gemehrt, dass Wohnungsmangel eingetreten ist.“<br />
Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Mauersegler (Turm-, Mauerschwalbe).<br />
Nicht seltener Brutvogel in der Stadt: altes Schloß, Kirchtürme, Elsterberger Ruine. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
In der Umgebung von Hohenleuben war nach HIRSCHFELD (1932) der Mauersegler auch ein Brutvogel, der in<br />
Starennistkästen gefunden wurde.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) beziffert den Bestand im Altkreis Gera-Stadt und -Land auf 100 bis 200 BP. BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL (1971) kennen nur einen Brutplatz in der alten Porzellanfabrik in Auma mit 6 bis 8 BP und<br />
ab 1967 mit 15 BP. Nach LANGE & LEO (1978) besiedelt der Mauersegler <strong>Greiz</strong>, Elsterberg und Berga mit<br />
insgesamt mindestens 120 BP. Sie erwähnen auch eine Brut in einem Starennistkasten in Caselwitz. Im<br />
Rahmen einer Bestandserfassung 1977/78 wurden folgende Brutpaarzahlen ermittelt (LIEDER 1979): Gera<br />
350 BP, Ronneburg 25 bis 30 BP, Münchenbernsdorf 10 bis 20 BP, <strong>Greiz</strong>, Berga und Elsterberg 120 BP,<br />
Auma 30 BP und Zeulenroda 50 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Bestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 250 bis 400 BP an, hauptsächlich in Gera, <strong>Greiz</strong>, Weida und Zeulenroda, aber auch in Dörfern und in<br />
Industriebauten außerhalb von Ortschaften. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84<br />
km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, nach der 115 bis 132 BP ermittelt wurden. Im Rahmen der<br />
Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden für das Untersuchungsgebiet mindestens 544 BP<br />
geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust der Brutplätze durch Sanierung oder Abbruch von Altbauten<br />
- Abnahme des Nahrungsangebotes (Fluginsekten)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung und Sicherung von Einflugöffnungen und Nischen an Gebäuden in mindestens 4 m Höhe<br />
- Anbringen von Nistkästen an größeren Gebäuden<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 144
Blauracke, Coracias garrulus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Ausgestorben<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Nur Brutzeitbeobachtungen im 19. Jahrhundert<br />
Blauracke<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) teilt folgendes mit: „Coracias garrulus. Die Mandelkrähe hat, soweit meine Erkundigungen reichen,<br />
noch nie im Gebiet gebrütet. Vor mehreren Jahren ward ein Paar in der Brutzeit bei Mensdorf erlegt,<br />
welches vielleicht im Begriff war, sich dort häuslich niederzulassen.“ Es sei jedoch darauf verwiesen, dass<br />
die Art zu dieser Zeit in unmittelbarer Nachbarschaft als Brutvogel gefunden wurde. KOEPERT (1896) berichtet<br />
über ein Brutpaar im Taupadeler Holz bei Schmölln und HEYDER (1952) über ein Brutvorkommen 1846 in<br />
Remse bei Glauchau. Beide Orte befinden sich nur 17 bzw. 31 km von Mennsdorf entfernt. Nach seinen<br />
Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Zur Brutzeit früher mehrfach bei Dölau und Thürndorf<br />
erlegt. Ein Brüten konnte aber nicht festgestellt werden.“ Die Beobachtungen von LIEBE und HELLER sind<br />
nach den Kriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) nicht als Brutverdachte zu werten.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren<br />
- Eine Ansiedlung der gegenwärtig in Deutschland ausgestorbenen Vogelart ist sehr unwahrscheinlich<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Es werden an dieser Stelle deshalb keine Schutzmaßnahmen genannt<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 145
Bienenfresser, Merops apiaster (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Bienenfresser<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
21. Jahrhundert<br />
Im Jahr 2008 brüteten erstmals 2 Paare erfolgreich im Untersuchungsgebiet und zwar am südlichen Stadtrand<br />
von Ronneburg (LUMPE & LIEDER 2009).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Brutplatz wurde im Zug der Sanierungsmaßnahmen des Uranerz-Bergbaues beseitigt<br />
- Störung durch Freizeitaktivitäten, u.a. auch durch <strong>Ornithologen</strong><br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung von geeigneten Brutwänden an Stellen mit gutem Nahrungsangebot an Insekten<br />
- Vermeidung von Störungen an Brutplätzen<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 146
Grauspecht, Picus canus (Licht.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Stark gefährdet<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Grauspecht<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) nennt den Grauspecht einen seltenen Brutvogel, der u.a. im Tinzer<br />
Park vorkommt. LIEBE (1873): „Der Grauspecht, den schon Ch. L. Brehm für das Rodathal als häufig anführt,<br />
ist bei uns wol oft mit dem Grünspecht verwechselt worden. Er ist ebenso wie dieser viel seltener geworden,<br />
vielleicht noch etwas seltener. 1872 nistete ein Paar im Forst westlich bei Hayn und eins am Mühlberg unweit<br />
Krossen.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Weit seltener als voriger<br />
[Grünspecht]. Sicher brütend festgestellt auf dem Gasparinenberge, bei Thürnhof, Dölau.<br />
1900 bis 1950<br />
HEINROTH erhielt durch HENNICKE junge Grauspechte, die aus einem Nest in einem Obstbaum bei Gera entnommen<br />
wurden (HILDEBRANDT & SEMMLER 1976). Bei HEINROTH (1931) ist zu lesen: „Wir erhielten diese hier<br />
in der Mark Brandenburg seltne Art [Grauspecht] durch Herrn Hennicke aus Gera. Er schickte uns liebenswürdigerweise<br />
durch einen Boten vier Junge, die sich leider später sämtlich als Männchen erwiesen. Es<br />
waren noch fünf in der Höhle verblieben, sodaß die Brut aus neun Geschwistern bestanden hatte.“<br />
HIRSCHFELD (1932) bezeichnet den Grauspecht in der Umgebung von Hohenleuben als seltenen Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
SOMMERLATTE (1953) stellte auf dem Buchenberg bei Weida ein BP fest. Den Bestand im Altkreis Gera-Stadt<br />
und -Land schätzt GÜNTHER (1969) auf unter 20 BP. Ein Brutversuch wurde 1963 bei Gera-Roschütz nachgewiesen.<br />
In der Umgebung von Auma war die Art nicht selten (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Bekannte<br />
Vorkommen waren: Untendorfer Wald, Waldhaus, Sophienbad, Hirtenholz, Wolge und Ambiwald. LANGE &<br />
LEO (1978) schätzen den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> auf unter 20 BP. Im Rahmen einer Bestandserfassung<br />
1972/73 wurden folgende Angaben zum Vorkommen gemacht (SEMMLER & KNORRE 1975): Gera/Roschütz/Brahmenau<br />
auf 70 ha Wald 1 BP, Auma auf 1540 ha Wald ca. 10 BP, Umgebung Zeulenroda<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 147
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
3 BP, Münchenbernsdorf 1 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 23 km² Fläche 9 Reviere gezählt, aber nur 3 BP geschätzt.<br />
In der Umgebung von Ronneburg (Brunnenholz und Gessental) war der Grauspecht Brutvogel in den<br />
1960er-Jahren und bei der Bestandserfassung 1972/73 hier nicht mehr nachzuweisen. LANGE & LIEDER<br />
(2001) geben den Bestand im Untersuchungsgebiet mit 80 bis 100 BP an. Für diese Schätzung lag eine<br />
halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 7 BP ermittelt<br />
wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).Im Rahmen<br />
der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 65 bis 100 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Umwandlung von reich strukturierten, alten Laub- und Mischholzbeständen in<br />
nadelbaumdominierte Altersklassenwälder mit frühen Umtriebszeiten und Entnahme von Überhältern sowie<br />
Schwach-, Bruch- und Totholz<br />
- Verlust alter Obstbestände und der Auwälder<br />
- Rückgang des Nahrungsangebotes durch Eutrophierung der Landschaft, insbesondere Ameisen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung alter und reich strukturierter Laub- und Mischwälder<br />
- Reduktion der intensiven forstlichen Nutzung<br />
- Erhalt von Bruch-, Alt- und Totholz als potentielle Höhlenbäume<br />
- Ersatz der Fichtenmonokulturen durch natürliche Mischwälder<br />
- Reduktion des Düngemitteleinsatzes zur Förderung und Erhaltung extensiver Wiesenlandschaften an<br />
Waldränder sowie zur Steigerung des Nahrungsangebotes<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3 4 – 7<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
Verbreitungskarte 11: Grauspecht<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 148
Grünspecht, Picus viridis Scop.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Grünspecht<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Grünspecht als einen sehr häufigen Brutvogel in<br />
der Umgebung von Gera, ohne dass einzelne Orte genannt werden. LIEBE (1873) beklagt den Rückgang der<br />
Art in der Umgebung von Gera. Er ist „nicht einmal mehr häufig zu nennen. ... Die Grün- und Grauspechte,<br />
die kleineren Buntspechte und die Schwarzspechte werden bei uns aussterben wie die Indianer, - infolge der<br />
Kultur.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE (1878) mit: „Sein Bestand ist im mittleren und nördlichen Gebiet im Ganzen<br />
derselbe. ... Im südlichen und westlichen Gebiet, wo er von je nicht so häufig war, ist er seltener geworden,<br />
- jedenfalls infolge der veränderten Waldcultur.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HEL-<br />
LER (1926): „Nicht seltener Brutvogel der Wälder und Auen: Dölau, Elsterberg (Rödelanlage), Steinicht (P.),<br />
Gasparinenberg, Park, Tiergarten.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) vermerkt, dass der Grünspecht überall verbreitet und recht häufig ist. Auch in der Umgebung<br />
von Hohenleuben fand HIRSCHFELD (1932) den Grünspecht als Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Den Bestand im Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) auf kaum 100 BP, wobei in den letzten<br />
Jahren eine Abnahme stattfand. In der Umgebung von Auma konnten BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL<br />
(1971) keinen Rückgang feststellen. Im Untendorfer Wald war er besonders zahlreich vertreten. LANGE &<br />
LEO (1978) schätzen den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 25 bis 30 BP. Im Rahmen einer Bestandserfassung<br />
1972/73 wurden folgende Angaben zum Vorkommen gemacht (LORENZ 1975 a): Gera/Röpsen/Hain auf 1700<br />
ha 1 bis 2 BP, Auma auf 4000 ha 15 BP, Münchenbernsdorf auf 2500 ha 4 bis 5 BP, Thränitz auf 700 ha<br />
2 BP, Rußdorf/Reust auf 450 ha 0 BP, Gera-Pforten auf 75 ha 1 BP, Gera-Langenberg auf 25 ha 1 BP und<br />
Aubachtal auf 140 ha 0 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit<br />
150 bis 200 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen<br />
1995 und 2000 zugrunde, bei der 33 bis 35 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 149
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis<br />
2009 wurden 124 bis 238 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Rückgang der Ameisennahrung durch Eutrophierung der Landschaft<br />
- Zu häufige oder ausbleibende Mahd der Wiesen<br />
- Massiver Biozideinsatz<br />
- Verlust der Randstrukturen<br />
- Saurer Regen<br />
- Lebensraumverlust durch Ausräumung der Landschaft<br />
- Umwandlung von Laub- und Mischwäldern in Nadelwälder<br />
- Zerstörung der Auwälder<br />
- Verlust alter Obstbaumbestände<br />
- Verlust von Halbtrockenrasen, Magerstreifen, Brachen und extensiv genutzter Wiesen<br />
- Unfälle im Straßenverkehr und Bahnbetrieb<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt alter Baumbestände in reich strukturierter Kulturlandschaft auf großen Flächen<br />
- Extensivierung der Land- und Forstwirtschaft<br />
- Ersatz der Fichtenmonokulturen durch natürliche Mischwälder<br />
- Wiederherstellung nahrungsreicher, extensiv genutzter Wiesen, Weiden und Streuobstwiesen<br />
- Erhaltung von Magerrasen und Ruderalflächen<br />
- Reduktion der Wiesenmahd<br />
- Einschränkung des Pestizideinsatzes<br />
- Erhaltung typischer Dorfstrukturen und Förderung der Nebenerwerbslandwirtschaft<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 150
Schwarzspecht, Dryocopus martius (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Schwarzspecht<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) kennt den Schwarzspecht nicht als Brutvogel in der Umgebung von<br />
Gera, obwohl er öfters gesehen wurde. LIEBE (1873) fand ihn nur noch im äußersten Süden und Westen des<br />
Gebietes um Gera als seltenen Brutvogel. Für Ostthüringen teilt LIEBE (1878) mit, dass der Schwarzspecht<br />
noch vor 50 Jahren in Forsten von Gera, Zeitz, Altenburg, Neustadt u.a. brütete. Derzeit stellte er in Ostthüringen<br />
nur noch Restvorkommen im „Altenburger Westkreis“, dem „Werdau-<strong>Greiz</strong>er Waldland“ und im „Frankenwald“<br />
fest. Ein früheres Vorkommen im Ernseer Forst bei Gera war offensichtlich erloschen. Nach seinen<br />
Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Brütet regelmäßig in einem Paar in den ,Buchen‘ beim<br />
Waldhaus. Sonst noch: Ruppertsgrün, Pöllwitz (P.). Da er anderwärts zugenommen hat, könnte das auch in<br />
unserer Umgebung der Fall sein.“ Im Stadtwald von Gera brüteten seit 1880 wieder ein und bei Berga seit<br />
1878 zwei Paare (WERNER 1961).<br />
1900 bis 1950<br />
In den 1930er-Jahren brütete der Schwarzspecht bei Ronneburg (GÜNTHER 1969). Nach DERSCH (1925) war<br />
der Schwarzspecht Brutvogel im Pöllwitzer Wald. HIRSCHFELD (1932) bezeichnet ihn als regelmäßigen Brutvogel<br />
unserer Waldungen, u.a. bei Weida und Zeulenroda. Von 1900 bis 1910 nisteten im Ernseer Revier<br />
bei Gera 4 BP und da das Holz geschlagen wurde, letztmalig 1946 oder 1947 (BAUCH; WERNER 1961).<br />
Ab 1950<br />
In den 1950er-Jahren brütete ein Paar auf dem Buchenberg bei Weida (SOMMERLATTE 1953; GÖRNER,<br />
HAUPT, HIEKEL, NIEMANN & WESTHUS 1984). WERNER (1961) hatte Kenntnis von folgenden Brutvorkommen in<br />
den 1950er-Jahren: Umgebung von Gera 5 BP, Wälder bei Ronneburg mindestens 1 BP, Buchenberg<br />
Weida 1 BP, <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald 5 bis 6 BP, Stadtpark <strong>Greiz</strong> 1 BP und im Altkreis Zeulenroda insgesamt<br />
13 BP. Das Vorkommen auf dem Buchenberg bei Weida bestätigt auch SOMMERLATTE (1953). Den Bestand<br />
im Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) auf wenige BP in den größeren Waldgebieten bei<br />
Weida und Gera. In der Umgebung von Auma konnten BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) im Untendorfer<br />
Wald 1 BP feststellen. LANGE & LEO (1978) geben den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> mit weniger als 10 BP an.<br />
Im Rahmen einer Bestandserfassung 1970/71 wurden folgende Angaben zum Vorkommen aufgezeichnet<br />
(LORENZ 1972): Altkreis Gera auf 55 km² Fläche 8 BP, Altkreis Zeulenroda 5 BP und Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 228<br />
km² Fläche 5 bis 10 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet auf 50<br />
bis 100 BP an. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Das seit langem bekannte Brutvorkommen im NSG „Buchenberg“ bei Weida bestand auch noch 2009 (LIE-<br />
DER & LIEDER-SÖLDNER 2010). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt zwischen 2005 bis 2009<br />
wurden 74 bis 120 BP geschätzt.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 151
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Forstmaßnahmen (früher Umtrieb von Althölzern, insbesondere Buche, Entfernung<br />
von Höhlenbäumen und Verlust von Totholz)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung von Altholzbeständen<br />
- Sicherung von Höhlenbäumen<br />
- Belassen von Totholz<br />
- Umwandlung von Fichtenmonokulturen in Laub- und Mischwälder<br />
Verbreitungskarte 12: Schwarzspecht<br />
1<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
4 – 7 2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 152
Buntspecht, Dendrocopos major (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Buntspecht<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Während der Grünspecht von der Ornithologischen Sektion Gera (1859) als sehr häufiger Brutvogel in der<br />
Umgebung von Gera eingestuft wird, ist der Buntspecht nur als häufiger Brutvogel aufgeführt. LIEBE (1873)<br />
bezeichnet den Buntspecht als nicht seltenen Brutvogel um Gera. Für Ostthüringen führt er ihn als den am<br />
zahlreichsten vertretenen Specht auf (LIEBE 1878). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER<br />
(1926): „Großer Buntspecht. Ständiger, wenn auch nicht gerade häufiger Brutvogel unserer Wälder:<br />
Gommla, Hirschstein, Brand, Dölau, Coschütz, Elsterberg.“<br />
1900 bis 1950<br />
Auch HIRSCHFELD (1932) bezeichnet den Buntspecht als häufigen Brutvogel in der Umgebung von<br />
Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) mehr als 500 BP ein. In der Umgebung von<br />
Auma war die Art nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ein häufiger Brutvogel. LANGE & LEO (1978) geben<br />
den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> mit fast 150 BP an. Im Rahmen einer Bestandserfassung 1972/73 wurden<br />
folgende Angaben zum Vorkommen auf den Untersuchungsflächen notiert (WOLF 1974): Altkreis Gera auf<br />
2889 ha Wald 68 bis 77 BP und im Altkreis Zeulenroda auf 1600 ha Wald 40 BP. LANGE & LIEDER (2001)<br />
geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 1000 bis 1500 BP an. Für diese Schätzung lag eine<br />
halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 124 bis 141 BP<br />
ermittelt wurden. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch<br />
auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 19 Reviere vom Buntspecht ermittelt<br />
(VOOG). Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 7 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust der für Bruthöhlen geeigneten Bäume durch zu frühe Umtriebszeiten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Naturnahe Waldbewirtschaftung und Belassen eines hohen Alt- und Totholz-Anteils<br />
- Länger Umtriebszeiten<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 153
Kleinspecht, Dryobates minor (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Kleinspecht<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der Umgebung von Gera war der Kleinspecht ein seltener Brutvogel (Ornithologische Sektion Gera 1859).<br />
Auch LIEBE (1873) fand die Art nur selten brütend: „Der kleine Buntspecht ist ziemlich selten. 1870 sah ich<br />
ein brütendes Pärchen im Ronneburger Forst und 1871 eins bei Tauchlitz.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE<br />
(1878) mit: Der Kleinspecht ist im Gebiet selten und vorzugsweise Bewohner der wärmeren Striche im Norden<br />
und Nordwesten.“ Als Brutort nennt er den Tinzer Park bei Gera. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881<br />
schreibt HELLER (1926): „Kleiner Buntspecht (Kleinspecht). Sehr seltener Brutvogel: Park, Elsterberg. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Auch HIRSCHFELD (1932) bezeichnet den Kleinspecht in der Umgebung von Hohenleuben als einen seltenen<br />
Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) weniger als 30 BP. In der Umgebung von<br />
Auma waren BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) nur drei Beobachtungen bekannt. Auch im Altkreis <strong>Greiz</strong><br />
war die Art selten und LANGE & LEO (1978) schätzen den Bestand auf etwa 20 BP. Im Rahmen einer Bestandserfassung<br />
1972/73 wurden folgende Angaben zum Vorkommen auf Untersuchungsflächen gemacht<br />
(LORENZ 1975 b): Altkreis Gera auf 1300 ha Wald 8 bis 9 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 22 ha Wald 1 BP und Altkreis<br />
Zeulenroda auf 1600 ha Wald 3 BP. Um Zeulenroda und Auma wurden jeweils 3 Brutreviere festgestellt.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 50 bis 100 BP an. Für diese<br />
Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 86 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei<br />
der 27 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt<br />
(LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 77 bis 127 BP angegeben.<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 154
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust (Verlust sehr alter Laubbäume in Waldgebieten, Umwandlung der Laub- in Nadelwälder,<br />
Verlust von Streuobstwiesen und Auwäldern)<br />
- Frühe Umtriebszeiten<br />
- Entfernung von Totholz<br />
- Einsatz von Bioziden<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz und Erhalt von Auenlandschaften<br />
- Erhalt und Schutz von Altholzbeständen und Streuobstwiesen<br />
- Neuanlage von Streuobstwiesen<br />
- Belassen von weichholzreichen Sukzessionsstadien (Birke, Pappel und Weide)<br />
- Einschränkung des Biozideinsatzes<br />
Verbreitungskarte 13: Kleinspecht<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1 1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7 2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 155
Index der deutschen Vogelnamen<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Bienenfresser 146 Moorente 102<br />
Blässhuhn 120 Nilgans 99<br />
Blauracke 145 Reiherente 105<br />
Brautente 100 Ringeltaube 131<br />
Buntspecht 153 Schwarzspecht 151<br />
Gänsesäger 106 Sperber 116<br />
Goldregenpfeifer122 Sperlingskauz 137<br />
Graureiher 110 Stockente 101<br />
Grauspecht 147 Straßentaube 128<br />
Grünspecht 149 Sturmmöwe 126<br />
Habicht 114 Sumpfohreule 141<br />
Haubentaucher 108 Tafelente 103<br />
Höckerschwan 98 Trauerseeschwalbe 127<br />
Hohltaube 129 Türkentaube 132<br />
Jagdfasan 107 Turmfalke 118<br />
Kleinspecht 154 Turteltaube 133<br />
Kuckuck 135 Waldkauz 142<br />
Lachmöwe 125 Waldohreule 139<br />
Mauersegler 144 Waldschnepfe 123<br />
Mäusebussard 117 Wespenbussard 112<br />
K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 156
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Ornithologische Elstertal 3, Berichte 157 – 273 aus (Teil dem 2) mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
März 2011<br />
Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten<br />
im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />
Eine Bilanz nach 200 Jahren ornithologischer Forschung<br />
TEIL 2<br />
PASSERIFORMES – SPERLINGSVÖGEL<br />
KLAUS LIEDER* & JOSEF LUMPE**<br />
Mit 67 Abbildungen, 21 Verbreitungskarten<br />
Brutvogelarten 158<br />
Diskussion 264<br />
Literatur 265<br />
Index der deutschen Vogelnamen 273<br />
* Dipl.-Ing. K. Lieder, Klaus Gessentalweg Lieder & Josef 3, 07580 Lumpe: Ronneburg, Zur Bestandsentwicklung ** Dipl.-Ing. J. Lumpe, von Brutvogelarten Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />
157
Brutvogelarten<br />
Pirol, Oriolus oriolus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Pirol<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Pirol als häufigen Brutvogel um Gera. LIEBE<br />
(1873) traf die Art häufig in der Umgebung von Gera an: „Der Pirol ist in den wärmeren Strichen recht häufig<br />
geworden, – weit häufiger als früher. So besteht kein Laubgehölz, keine größere Gruppe von Bauerngärten,<br />
wo man ihn nicht findet. 1872 hat sich sogar ein Pärchen, wahrscheinlich weil es zwischen den anderen<br />
keinen rechten Platz gefunden hatte, im Martinsgrund niedergelassen, wo doch die Laubbäume zwischen<br />
den mächtigen Nadelholzbeständen eine recht unbedeutende Rolle spielen. In dem ehemaligen<br />
Klostergarten zu Mildenfurt nistet er, weil er sich dort ganz ungestört weiß, so niedrig in Apfelbäumen, daß<br />
man das Nest mit der Hand erreichen kann.“ Später stellt er eine Abnahme auf Grund starker Nachstellungen<br />
durch die Pächter von Kirschplantagen in den nördlichen und nordöstlichen Teilen von Ostthüringen<br />
fest, während in den übrigen Teilen von Ostthüringen eine Zunahme registriert wird (LIEBE 1878). Nach<br />
seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Brütend gefunden bei Noßwitz, Kleingera,<br />
Thürnhof, hinter Trifle (Carolinenfeld). Jetziges Vorkommen [1926] wohl fraglich.“ CZERLINSKY (1966) erwähnt<br />
ein Vorkommen in den 1880er-Jahren bei Kahmer. Auch KOEPERT (1896) bezeichnet die Art noch als<br />
verbreiteten und häufigen Brutvogel.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) war der Pirol ebenfalls noch ein verbreiteter und häufiger Brutvogel. Nachdem<br />
HELLER (1926) bereits das aktuelle Vorkommen bei <strong>Greiz</strong> in Frage stellte, wurde von HIRSCHFELD (1932)<br />
auch der Rückgang in der Umgebung von Hohenleuben festgestellt. Das Vorkommen bei Berga war erloschen.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist das derzeitige Brutgebiet im Altkreis Gera nach Westen und Süden von der Weißen<br />
Elster und der Wipse begrenzt. Der Bestand wird auf nicht mehr als 30 Paare geschätzt. Im Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong> gab es keine Brutvorkommen mehr (LANGE & LEO 1978). In den 1970er-Jahren muss dann eine Zunahme<br />
und erneute Arealausweitung stattgefunden haben. FLÖßNER (1982) konnte bei einer Bestandsumfrage<br />
1980/81 folgende Zahlen ermitteln: Altkreis Gera-Land insgesamt 70 bis 90 BP und im Einzelnen<br />
folgende Bestände: Umgebung Ronneburg auf 40 km² Fläche 20 BP, Gera/Roschütz/Aga/Brahmenau 16<br />
bis 20 BP, Gera/Roschütz/Wernsdorf/Söllmnitz/Schwaara auf 17 km² Fläche 12 bis 15 BP, Weida/Frießnitz<br />
2 BP. Altkreis <strong>Greiz</strong>: seit 1978 auf dem Haldengelände Großkundorf 5 bis 6 BP und Brutverdacht bei Elsterberg.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 80 bis 120 BP<br />
nördlich einer Linie Großkundorf – Weida – Münchenbernsdorf an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 38 bis 46 BP ermittelt wurden.<br />
Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 158
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 20 Reviere vom Pirol ermittelt (VOOG). Im Rahmen<br />
der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 77 bis 127 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust (Vernichtung von Auwäldern, Altholzbeständen, Umwandlung von Laub- in Nadelwälder)<br />
- Einsatz von Bioziden<br />
- Kollision mit Fahrzeugen, Glasscheiben und Leitungsdrähten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Schutz geeigneter Lebensräume (Auwälder, alte Obstgärten, Feldgehölze, Pappelalleen)<br />
- Verlängerung der Umtriebszeiten in Wirtschaftswäldern<br />
- Förderung einer strukturreichen Kulturlandschaft<br />
- Reduktion des Biozideinsatzes<br />
Verbreitungskarte 14: Pirol<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7 8 – 20<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7 1 1 21 – 50 1<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 159
Neuntöter, Lanius collurio (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Neuntöter<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der Umgebung von Gera war der Neuntöter Mitte des 19. Jahrhunderts ein sehr häufiger Brutvogel (Ornithologische<br />
Sektion Gera 1859). LIEBE (1873) macht auf eine Zunahme aufmerksam: „Der Neuntödter<br />
(Rohrsperling) nistet leider in so großer Zahl auf unserem Gebiet, daß er allenthalben zu finden ist, wo geeignetes<br />
Buschwerk steht und daß z.B. der westlichen Flanke des Elsterthals entlang auf etwa je 10 Minuten<br />
Wegs ein Pärchen kommt. Er hat sich entschieden zu stark vermehrt.“ Auch für Ostthüringen stellte LIEBE<br />
(1878) eine Bestandszunahme fest: „Im Gegensatz zu Grauwürger ist der Neuntödter von Jahr zu Jahr häufiger<br />
geworden und jetzt ein gemeiner Vogel, der in jeder nur einigermassen in die Augen springenden Rainhecke,<br />
in jedem hochaufgeschossenen Feldzaun, in jedem Stück niedern Laubwaldes mit Sicherheit anzutreffen<br />
ist und ausserdem, jedenfalls wegen mangelnden Platzes, sehr gewöhnlich umzäunte, vor den Dörfern<br />
liegende Obstgärten und noch lieber niedere Fichtendickichte mit einzelnen höher aufgeschossenen<br />
jungen Fichtengruppen, wie sie in Waldungen häufig vorkommen, zu seinem Revier wählt, – sogar dann,<br />
wenn sie nicht an Felder oder Wiesengründe angrenzen.“ Von LIEBE geht schon 1873 folgender Aufruf aus:<br />
„Es ist sehr wünschenswert, daß die Forstbeamten eine Zeit lang diesem schädlichen Würger nachstellen,<br />
damit sein Bestand auf eine bescheidene Zahl beschränkt wird.“ Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong> beschließt<br />
1877, nachdem genügend Spendengelder eingegangen waren, „Schußgeld für Raubvögel“ zu zahlen,<br />
darunter „für einen rotrückigen Würger M. 0,10.“ ... Eingelöst wurden [bis 1902] 64 rotrückige Würger.“<br />
(MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Rotrückiger Würger<br />
(Neuntöter). Früher ein häufiger Brutvogel (...) scheint jetzt sein Bestand sehr zurückgegangen zu sein, wie<br />
anderwärts auch. Ist jetzt fast als ,selten' zu bezeichnen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Auch SCHEIN (1906 a) kam der Aufforderung von LIEBE zur Bestandsreduzierung des Neuntöters nach und<br />
teilt mit: „Seit einer Reihe von Jahren habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dem kleinen Räuber nachzustellen<br />
und ihm besonders seine ersten Gelege wegzunehmen.“ So konnte SCHEIN z.B. am 02. Juni 1900 drei<br />
Nester bei Mildenfurth, sechs Nester an der Straße von Weida nach Gera und ein Nest bei Kaimberg ausnehmen.<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) war die Art in Ostthüringen häufig, was auch HIRSCHFELD (1932) für die<br />
Umgebung von Hohenleuben bestätigen konnte.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) stellte eine Abnahme in den 1960er-Jahren fest. So brüteten im Gessental zwischen Gera<br />
und Ronneburg 1950 etwa 10 BP und von 1965 bis 1968 höchstens noch 1 BP. Auf 50 km² Fläche im Osten<br />
des Altkreises Gera wurden 1966 nur 11 BP gefunden. Der damalige Gesamtbestand im Altkreis Gera-Stadt<br />
und -Land wird mit 50 bis 100 BP angegeben. In der Umgebung von Auma stellten BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖßEL (1971) einen starken Rückgang fest. Während die Art 1960 noch ein häufiger Brutvogel war, kann er<br />
1970 nur noch als unregelmäßiger Brutvogel mit wenigen Brutpaaren vor. LANGE & LEO (1978) schätzen den<br />
Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> auf etwa 200 BP. GÜNTHER (1979 c) konnte bei einer Bestandsumfrage 1977/78<br />
folgende Zahlen ermitteln: Altkreis Gera-Stadt und -Land: Umgebung von Ronneburg auf 4300 ha 43 BP,<br />
Rubitz/Töppeln auf 400 ha 12 BP, Münchenbernsdorf auf 2000 ha 10 bis 15 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: Aubachtal<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 160
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
auf 140 ha 3 BP, Großkundorf auf 450 ha 20 BP, Altkreis Zeulenroda: Auma auf 4000 ha 17 BP. Zur Bestandsentwicklung<br />
wurden bei GÜNTHER (1979) folgende Angaben gemacht: Bestandsrückgang bei<br />
Großenstein und im Altkreis <strong>Greiz</strong>, bei Zeulenroda starker Bestandsrückgang, aber 1977 wieder eine Zunahme,<br />
östlicher Altkreis Gera Bestandsminimum um 1966, Maximum 1971/72, danach wieder leichter<br />
Rückgang. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 150 bis 200 BP<br />
an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000<br />
zugrunde, bei der 110 bis 152 BP ermittelt wurden. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet<br />
Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald und auf 115 ha ökologisch<br />
wertvollem Offenland. Hier wurden 20 Reviere vom Neuntöter ermittelt (VOOG). Im 60 ha großen<br />
<strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung zum<br />
ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 278 bis 622 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Ausräumung der Agrarlandschaft, Aufforstung, Grünlandumbruch und Bebauung<br />
- Abnahme der Nahrung durch Intensivierung der Landwirtschaft, insbesondere durch Zerstörung der Strukturvielfalt<br />
und Biozid- sowie Düngemitteleinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Grünlandbewirtschaftung<br />
- Erhalt und Neuanlage von Heckenstreifen im Kulturland<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
21 – 50 8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7 8 – 20 8 – 20<br />
4 – 7 4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7<br />
8 – 20<br />
4 – 7 8 – 20<br />
8 – 20 4 – 7<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
1<br />
21 – 50<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
Verbreitungskarte 15: Neuntöter<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 161
Elster, Pica pica (Scop.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Elster<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der Umgebung von Gera war die Elster Mitte des 19. Jahrhunderts ein häufiger Brutvogel (Ornithologische<br />
Sektion Gera 1859). LIEBE (1873) teilt mit: „Auch die Zahl der Elstern (Ulstern) war, weil die Fänge<br />
nicht ausgelöst wurden, bis 1872 wieder recht sehr bedeutsam geworden, obgleich sie von den Landleuten<br />
oft genug auf ihren dem jungen Geflügel so verderblichen Pirschgängen im Gehöfte belauscht und bestraft<br />
wurden. ... 1872 wurden auf dem kleinen Tinzer Revier 20 Stück geschossen.“ Kurze Zeit später trat nach<br />
einer übermäßigen Verfolgung ein starker Rückgang ein: „So ward die Elster geradezu zum seltneren Vogel,<br />
und erst seit einigen Jahren lässt sich in einzelnen Thälern eine schwache Zunahme constatieren“<br />
(LIEBE 1878). Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong> beschließt 1877, nachdem genügend Spendengelder<br />
eingegangen waren, „Schußgeld für Raubvögel“ zu zahlen, darunter „für eine Elster M. 0,10“ (MOERICKE<br />
1926). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Elster (Adelhetsch). Früher nicht<br />
eben selten, ist dieser schöngezeichnete Vogel im Bestand sehr zurückgegangen. Er [der Adelhetsch] brütete<br />
bis 1873 noch mitten in der Stadt in größeren Gärten (Park des ,grünen Palais‘). Auf den Dörfern<br />
(Gommla, Dölau, Naitschau, Pohlitz, u. a. O.) wird er noch hier und da brütend anzutreffen sein. Bei Elsterberg<br />
häufiger (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) schreibt, dass sich „die Elster, seitdem sie einige Schonung genießt, in den letzten<br />
Jahren wieder erheblich vermehrt.“<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) bezeichnet die Elster als nicht häufigen Brutvogel im Altkreis Gera, dessen Bestand seit<br />
über 100 Jahren möglichst klein gehalten wird. „Lediglich in den Nachkriegsjahren war sie sehr zahlreich<br />
vertreten, weil von 1945 bis 1953 die Jagd nicht gesetzlich geregelt war. Ihr Vorkommen ist jetzt vorwiegend<br />
auf Ortschaften beschränkt, weil sie hier vor Verfolgung ziemlich sicher ist.“ BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖßEL (1971) stellten eine Abnahme durch starke Bejagung im Gebiet um Auma fest. Insgesamt dürften<br />
nicht mehr als 10 BP vorkommen. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> treffen LANGE & LEO (1978) die gleiche Einschätzung.<br />
Der Bestand wird von den Autoren auf etwa 30 BP geschätzt. Abnahme durch starke Bejagung seit<br />
Ende des 19. Jahrhunderts, Zunahme nach dem 2. Weltkrieg, danach wieder Abnahme durch die jagdliche<br />
Verfolgung kennzeichnen die Größenordnungen in dieser Zeit. SCHEFFEL (1976 b) konnte bei einer Umfrage<br />
1973/74 den Bestand wie folgt ermitteln, Altkreis Gera-Stadt und -Land: Gera/Kaimberg auf 350 ha 3<br />
BP, Aga/Steinbrücken auf 1000 ha 2 bis 3 BP, Ronneburg auf 7000 ha 38 BP, Münchenbernsdorf auf 2500<br />
ha 1 bis 3 BP, Gera 12 bis 15 BP, Münchenbernsdorf, Lederhose, Neuensorga, Goßsaara, Geißen, Nieder-<br />
, Ober- und Mittelpöllnitz, Neuendorf, Großebersdorf, Geroda und Schöna 20 bis 30 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf<br />
140 ha 0 BP, <strong>Greiz</strong> 19 BP, Berga 2 BP, Wolfersdorf 3 BP, Teichwolframsdorf 2 BP, gesamter Altkreis <strong>Greiz</strong><br />
50 bis 60 BP, Altkreis Zeulenroda: Auma auf 4000 ha 10 BP, weitere Umgebung von Zeulenroda 10 bis 15<br />
BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 800 bis 1000 BP an.<br />
Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 88 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 86 bis 122 BP ermittelt wurden.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 162
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verfolgung durch den Menschen<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit Verlust von Feldgehölzen und Umbruch von Grünland<br />
- Hohe Belastung mit Umweltgiften (Bioziden und Schwermetalle)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Einstellung der biologisch nicht zu rechtfertigenden Verfolgung durch den Menschen<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Förderung einer reich strukturierten Agrarlandschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 163
Eichelhäher, Garrulus glandarius (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Eichelhäher<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) schreibt: „Die Nusshacker hatten sich während der Zeit von 1849 bis 1870 bei uns so sehr vermehrt,<br />
daß dem Waldläufer aus jeder Ecke des Forstes ihr warnender, heißerer Schrei entgegentönte, und<br />
daß dem Naturkundigen das Herz weh that, wenn er an die Menge von Eiern und jungen Vögeln dachte,<br />
welche diesen listigen Dieben als Opfer fallen mussten. Erst seit 1870 ist es auf allerhöchsten Befehl anders<br />
geworden: im Jahre 1872 wurden auf dem Revier Tinz 20 und auf dem Revier Ernsee 90 Häher erlegt. Es<br />
steht zu erwarten, daß der Bestand dieser Vögel von jetzt ab ein normales niederes Maß behalten wird.“ Die<br />
Zahl der Eichelhäher wurde in den folgenden Jahren reduziert, aber LIEBE (1878) klagt über den immer noch<br />
zu großen Bestand. Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong> beschließt 1877, nachdem genügend Spendengelder<br />
eingegangen waren, „Schußgeld für Raubvögel“ zu zahlen, darunter „für einen Nußhäher M. 0,10.“ ...<br />
Eingelöst wurden [bis 1902] 47 Eichelhäher.“ (MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881<br />
schreibt HELLER (1926): „Eichelhäher (Nussert). Häufiger Brutvogel unserer Waldungen, bevorzugt Mischwald.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) benennen den Eichelhäher als verbreiteten Brutvogel in allen Wäldern Thüringens.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt den Bestand im Altkreis Gera-Stadt und -Land auf etwa 200 BP. BARNIKOW, SCHÜTZ<br />
& STÖßEL (1971) bezeichnen den Eichelhäher als zahlreichen Brutvogel im Gebiet um Auma. Für den Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong> wird der Eichelhäher von LANGE & LEO (1978) mit mehr als 50 BP als häufigster Krähenvogel<br />
genannt. Nach FLÖßNER (1975) wurde bei einer Umfrage 1973/74 der Bestand wie folgt ermittelt, Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land: Reust/Rußdorf auf 130 ha Wald 5 bis 10 BP, Ronneburg auf 4 ha Wald 1 BP,<br />
Naulitz/Kauern/Hilbersdorf auf 100 ha Wald 20 BP, Paitzdorf/Ronneburg auf 11 ha Wald 2 BP, Umgebung<br />
Gera auf 70 ha Wald 10 BP, Münchenbernsdorf auf 1000 ha Wald 20 bis 30 BP, Altkreis Zeulenroda: Auma<br />
auf 1600 ha Wald 120 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit<br />
1000 bis 1200 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen<br />
1995 und 2000 zugrunde, bei der 92 bis 120 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der<br />
Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- direkte menschliche Verfolgung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine weitere ökologisch nicht zu rechtfertigende Verfolgung<br />
- Aufklärung der Bevölkerung zum Abbau von Vorurteilen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 164
Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Tannenhäher<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
In Mitteleuropa brütet die Nominatform Nucifraga c. caryocatactes (L.), auf die sich die weiteren Ausführungen<br />
beziehen.<br />
19. Jahrhundert<br />
In der Sammlung von BREHM befinden sich 6 Belegexemplare aus Ostthüringen (Rodatal, Kahla, <strong>Greiz</strong>,<br />
Renthendorf und Auma), die jedoch alle im September und Oktober, also außerhalb der Brutzeit, gesammelt<br />
wurden (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975). BREHM (1820 – 22) schreibt: „Nur in den Gebirgen des Vogtlandes<br />
entdeckte Herr von Beust, der Jüngere in der Nähe von <strong>Greiz</strong> ein Nest dieses Vogels. Es stand in einer hohlen<br />
Tanne etwa 1 Fuß unter dem großen Eingangsloch ...“. Diese Angaben werden von HILDEBRANDT &<br />
SEMMLER (1975) bezweifelt, ebenso die Angaben von LIEBE (1873), wonach die Art früher bei St. Gangloff<br />
und Klosterlausnitz gebrütet hat. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Kommt<br />
nur als unregelmäßiger Gast zu uns, brütet aber nicht hier.“<br />
1900 bis 1950<br />
ISRAEL (1914) beobachtete am 16. Mai 1913 und dann den ganzen Sommer über ein Paar im Ernseer Forst<br />
bei Gera.<br />
Ab 1950<br />
Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) sind aus der Umgebung von Auma Sommerbeobachtungen bekannt,<br />
die ein Brutvorkommen nicht ausschließen. Auf Grund wiederholter Beobachtungen in den Monaten<br />
Mai bis August nehmen LANGE & LEO (1978) ein Brutvorkommen im Altkreis <strong>Greiz</strong> an. LORENZ vermutet den<br />
Tannenhäher als Brutvogel im Köthenwald bei Leitlitz (RUDAT 1975). Nach Beobachtungen aus der Datenbank<br />
des VOOG schätzen LANGE & LIEDER (2001) das Vorkommen auf 30 bis 50 BP. Als Verbreitungsschwerpunkte<br />
werden der <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald mit dem angrenzenden Tal der Weißen Elster, der<br />
Pöllwitzer Wald bis zum Vogtländischen Oberland bei Bernsgrün und der Eichert bei Münchenbernsdorf<br />
genannt. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 63 bis 124 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Biotopverlust durch Erschließungsmaßnahmen in Waldgebieten<br />
- Freizeitnutzung in Waldgebieten<br />
- Langfristiger Verlust der Fichtenwälder infolge der Klimaerwärmung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung naturnaher, stufig aufgebauter Nadelwälder<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 165
Verbreitungskarte 16: Tannenhäher<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
1<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
2 – 3 4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 166
Rabenkrähe, Corvus corone L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Rabenkrähe<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) berichtet über erhebliche Bestandsschwankungen im 19. Jahrhundert: „Der Bestand der Krähen<br />
war in dem Zeitraum nach 1849 ebenfalls ein viel zu starker geworden, denn wenn diese Thiere sehr<br />
häufig werden, dann sind es zu viele für die kleine Vogelwelt, wie für die niedere Jagd und die Getreidefelder.<br />
Unter ihnen hat aber das Jahr 1871 furchtbar aufgeräumt: damals lagen die Leichen von solchen Krähen,<br />
die vergiftete Feldmäuse gefressen hatten, in Menge in Wald und Feld umher. Ich fand allein auf der<br />
Flur von Mensdorf bei Gelegenheit meiner geognostischen Aufnahmen an einem Tag 11 Stück. Jetzt werden<br />
etwa noch 10 Procent des früheren starken Bestandes übrig, und wird damit das rechte Maß hergestellt<br />
sein.“ Für Ostthüringen kann er später eine außerordentliche Zunahme feststellen (LIEBE 1878). Der „<strong>Verein</strong><br />
der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong> beschließt 1877, nachdem genügend Spendengelder eingegangen waren, „Schußgeld<br />
für Raubvögel“ zu zahlen, darunter „für eine Krähe M. 0,05“ (MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Rabenkrähe (Krähe, Krah). Überall häufiger und bekannter Brutvogel.“<br />
1900 bis 1950<br />
Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Rabenkrähe als verbreiteter Brutvogel in Thüringen bezeichnet<br />
(HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt den Bestand im Altkreis Gera-Stadt und -Land auf etwa 500 BP. Nach BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Rabenkrähe in der Umgebung von Auma als Brutvogel zahlreich vertreten.<br />
Nach HEYER (1975) erfolgte 1973/74 eine Bestandsumfrage (gezählt bzw. geschätzt) mit folgendem Ergebnis,<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 5704 ha 69 BP, Stadtkreis Gera 20 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 800 ha 6<br />
BP, Altkreis Zeulenroda: auf 5075 ha 110 BP, weitere Umgebung von Zeulenroda 20 BP. LANGE & LEO<br />
(1978) sprechen von einem Rückgang auf Grund umfangreicher menschlicher Verfolgung im Altkreis <strong>Greiz</strong>.<br />
Der Gesamtbestand wird mit weniger als 50 BP angegeben. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />
im Untersuchungsgebiet mit 800 bis 1000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung<br />
auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 82 bis 120 BP ermittelt wurden. Im 60<br />
ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 2 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Direkte Verfolgung durch den Menschen<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit Verlust von Feldgehölzen<br />
- Belastung mit Bioziden und Schwermetallen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine weitere und ökologisch unvertretbare Verfolgung<br />
- Aufklärung der Bevölkerung zum Abbau von Vorurteilen<br />
- Förderung und Erhalt einer reich strukturierten Agrarlandschaft durch Extensivierung und Wiederherstellung<br />
zerstörter Landschaftsstrukture<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 167
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Nebelkrähe, Corvus cornix L. und Raben-Nebelkrähen-Bastarde C. corone L. x C cornix L.<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Ehemaliger Brutvogel<br />
Nebelkrähe<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) schreibt: „Die Nebelkrähe brütet im Gebiet, aber sehr selten. Ich fand vor 4 Jahren ein brütendes<br />
Paar in der Nähe des Eichelteichs am Rand des Zeitzer Forstes. Herr Kratzsch a. K.-T. ist schon öfter in<br />
der Gegend von Schmölle auf brütende Nebelkrähen gestoßen. In einem Feldgehölz unweit der Linda’schen<br />
Windmühle fand ich 1870 ein Nest von Corvus corone, worin 4 fast flügge Junge waren und zwar zwei<br />
schwarze und zwei etwas größere graue mit schwarzen Flügeln und Köpfen. Leider ward ich tags darauf<br />
verhindert, meine Beobachtungen fortzusetzen und die Jungen auszuheben.“ Später schreibt LIEBE (1878):<br />
„Die Lisieren des Zeitzer und Ronneburger Forstes scheinen die äussersten Punkte zu sein, bis zu welchen<br />
sie von ihrem Wohngebiet aus die letzten Vorposten vorschiebt; wenigstens habe ich von einem Brüten weiter<br />
südwestlich nach Thüringen hinein nie gehört. Mischehen mit der Rabenkrähe kommen auch vor: bei<br />
Ronneburg, wo mir leider die Bastarde entgingen, und bei Schmölln, wo J. Kratzsch die flüggen Jungen<br />
einmal erlegte.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Nebelkrähe (Graukrähe).<br />
Im Winter nicht seltener Strichvogel, dürfte sie als Brutvogel im engeren Gebiet wohl fehlen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden keine Nebelkrähen als Brutvögel in Thüringen gefunden<br />
(HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
LANGE & LEO (1978) erwähnen eine Mischbrut mit der Rabenkrähe, die W. LEO um 1957 im <strong>Greiz</strong>er Park<br />
fand. In einer Karte zu sicheren und wahrscheinlichen Brutplätzen von Mischpaaren mit der Rabenkrähe in<br />
Thüringen kann GRIMM (2006) Vorkommen in unserem Gebiet aufzeigen: MTBL 5039 1, 5138 2, 5139 1 und<br />
5237 2 (vor 1970). Insgesamt liegen 169 Beobachtungen von 1969 bis 2010 vor.<br />
Nach ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) liegt die Wertungsgrenze für die Erfassung der Brutvögel<br />
zwischen Anfang März und Ende Juni. Aus der Datenbank des VOOG ergibt sich unter der Beachtung der<br />
vorgenannten Kriterien folgendes Bild zu Brutzeitvorkommen der Nebelkrähe:<br />
1969: 29.04. 5 Nebelkrähen Weiderteich (AUERSWALD)<br />
1974: 17.03. 1 Nebelkrähe RKG Culmitzsch (LANGE)<br />
1975: 18.04. 1 Nebelkrähe Moschwitz (LEO)<br />
1978: 11.03. 1 Bastardkrähe Stausee Dölau (LANGE)<br />
20.04. 1 Nebelkrähe RKG Großkundorf (LEO)<br />
1979: 18.03 und 25.03. 1 Nebelkrähe RKG Großkundorf (DUDEK, JAKOB, LEO)<br />
1980: 22.05. 1 Nebelkrähe RKG Großkundorf ((JAKOB)<br />
1981: 19.03. 1 Nebelkrähe RKG Großkundorf (JAKOB)<br />
1983: 14.05. 1 Nebelkrähe Korbußen (REICHARDT; LANGE 1988)<br />
1984: 07.03 und 12.03. 1 Nebelkrähe Trebnitz (REICHARDT; KRÜGER 1989)<br />
1986: 16.04. 1 Nebelkrähe RKG Großkundorf (JAKOB)<br />
1990: 07.04. 1 Nebelkrähe Friedmannsdorf (PATZELT; KRÜGER 1996)<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 168
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
1995: 22.04. 1 Nebelkrähe Erbengrün (SIMON)<br />
2002: 17.03., 26.03., 01.04. und 01.05. 1 Bastardkrähe Korbußen (REICHARDT)<br />
2003: 28.04. 1 Bastardkrähe Weiderteich (LANGE)<br />
29.05 1 Bastardkrähe Lerchenbachtal Kleinkundorf (LUMPE)<br />
24.06. 1 Bastardkrähe Korbußen (REICHARDT)<br />
2004: 07.03., 09.03. und 18.06. 1 Bastardkrähe Korbußen (REICHARDT)<br />
01.04. 1 Nebelkrähe Weiderteich (LUMPE)<br />
02.05. 2 Nebelkrähen Weiderteich (REICHARDT)<br />
2005: 20.03., 31.03. und 16.04. 1 Bastardkrähe Korbußen (REICHARDT)<br />
20.03. 1 Bastardkrähe Weiderteich (REICHARDT)<br />
05.05. 1 Nebelkrähe Weiderteich (REICHARDT)<br />
2006: 02.04. 1 Nebelkrähe Struth (REICHARDT)<br />
04.04. 1 Nebelkrähe Bernsgrün (SCHUSTER)<br />
2007: 20.03. – 02.06. 1 Nebelkrähe Korbußen (REICHARDT)<br />
22.04. 1 Bastardkrähe x Rabenkrähe auf Erle bei Korbußen (REICHARDT)<br />
2008: 06.03., 24.03. und 05.04. 1 Bastardkrähe Weiderteich (LUMPE, MÜLLER)<br />
24.03. 1 Nebelkrähe Struth (MÜLLER)<br />
04.06. 1 Bastardkrähe Korbußen (REICHARDT)<br />
2009: 18.03. 1 Nebelkrähe Korbußen/Mückern (LIEDER, LUMPE)<br />
15.03. 1 Bastardkrähe Sorge-Settendorf (KANIS, LANGE)<br />
22.03. 1 Nebelkrähe RNG Culmitzsch (JAKOB)<br />
15.05. 1 Nebelkrähe Trebnitz, Beerenweinschänke (HOFFMANN)<br />
2010: 20.03., 02.05. und 22.05. 1 Nebelkrähe westlich Korbußen (REICHARDT)<br />
19.04., 18.05. und 22.05. 1 Bastardkrähe östlich Korbußen (REICHARDT)<br />
Die Beobachtungen konzentrieren sich auf drei Gebiete:<br />
1. Struth/Weiderteich<br />
2. Korbußen/Trebnitz<br />
3. Sorge-Settendorf/Großkundorf/Culmitzsch/Friedmannsdorf,<br />
in denen sowohl Nebelkrähen als auch Bastardkrähen über viele Jahr zur Brutzeit nachgewiesen wurden.<br />
Auch außerhalb der Brutzeit gibt es zahlreiche Beobachtungen in diesen drei Bereichen, oftmals von mehreren<br />
Vögeln. Da die Art in Mitteleuropa kaum Zugvogel ist, muss davon ausgegangen werden, dass sich die<br />
zur Brutzeit beobachteten Vögel und ihre Nachkommen ganzjährig im weiteren Umfeld der Brutreviere aufhalten.<br />
Bei Korbußen gelang 2007 der bisher einzige Brutnachweis zwischen einer Nebel- und einer Rabenkrähe<br />
(ROST 2008). Nach der großen Anzahl der festgestellten Bastarde zu urteilen, finden regelmäßig<br />
Mischbruten zwischen beiden Arten im Untersuchungsgebiet statt. Ungeklärt ist noch, ob es sich bei den<br />
gemeldeten Nebelkrähen immer um artreine Vögel oder um Bastarde gehandelt hat. Bei zukünftigen Beobachtungen<br />
sollte die Einstufung nach den Färbungstypen entsprechend dem Vorschlag von ECK (2001)<br />
erfolgen.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Direkte Verfolgung durch den Menschen<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit Verlust von Feldgehölzen<br />
- Belastung mit Bioziden und Schwermetallen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine weitere ökologisch nicht zu rechtfertigende Verfolgung<br />
- Aufklärung der Bevölkerung zum Abbau von Vorurteilen<br />
- Förderung und Erhalt einer reich strukturierten Agrarlandschaft durch Extensivierung und Wiederherstellung<br />
zerstörter Landschaftsstrukturen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 169
Kolkrabe, Corvus corax L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Kolkrabe<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
18. und 19. Jahrhundert<br />
LANGE & LEO (1978) fanden heraus, dass der Kolkrabe zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein spärlicher und<br />
später seltener Brutvogel in der Umgebung von <strong>Greiz</strong> war. Nach ihren Recherchen wurden in den Jahren<br />
zwischen 1786 und 1831 in <strong>Greiz</strong>er Jagdrevieren 59 Vögel geschossen. In der Sammlung von BREHM befinden<br />
sich neun Stücke von Renthendorf und Umgebung aus den Jahren 1816 bis 1818 und ein Stück von<br />
Gera aus dem Jahre 1851 (HILDEBRANDT & SEMMLER 1875). Die Ornithologische Sektion Gera (1859) erwähnt<br />
das seltene Brutvorkommen im Ernseer Forst bei Gera. LIEBE (1873) nennt das frühere Vorkommen<br />
von zwei BP im Ernseer und Geraer Forst. Letztmalig wurde im April 1869 ein kreisendes Paar über dem<br />
Ernseer Forst gesehen, hat hier aber nicht gebrütet. In Bezug auf Ostthüringen schreibt LIEBE (1878) später:<br />
„Der Kolkrabe, der zu Chr. L. Brehm`s Zeit in der Umgebung von Renthendorf (bei Roda) nach sicheren<br />
Nachrichten noch bis 1853 in der Nähe von Gera im Ernseer und weiterhin in den westlichen<br />
altenburgischen Forsten horstete, und noch bis vor wenig Jahren wenigsten bisweilen sein Domicil auf dem<br />
Frankenwald nahm, ist jetzt, wie es scheint, vollständig verschwunden.“ Nach seinen Aufzeichnungen von<br />
1881 schreibt HELLER (1926): „Er soll vor Jahrzehnten noch im Pöllwitzer Wald gebrütet haben, dürfte aber<br />
verschwunden sein.“ Letztmalig sah DOMBROWSKI am 20.04.1892 einen Kolkraben bei Hermannsgrün<br />
nordöstlich von <strong>Greiz</strong> (DOMBROWSKI 1893; HILDEBRANDT 1919).<br />
1900 bis 1950<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden keine Kolkraben als Brutvögel in Thüringen gefunden.<br />
Ab 1950<br />
1973 wurden 12 Kolkraben in Ostthüringen ausgesetzt (BRÄSECKE 1974). Einige Jahre später erreichte die<br />
Art während der erneuten Ausbreitung ebenfalls Ostthüringen. Der erste Horstfund gelang 1986 bei Auma<br />
(FG Auma; KRÜGER 1982). Danach erfolgte eine rasche Zunahme. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />
im Untersuchungsgebiet mit 40 bis 60 BP an. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />
2005 bis 2009 wurden 66 bis 101 BP genannt. Danach hat der Kolkrabe in kurzer Zeit das Gebiet flächendeckend<br />
besiedelt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Direkte Verfolgung durch Abschuss, Vergiftung, Vernichtung von Nestern und Gelegen, Fällen der<br />
Horstbäume und Aushorstung der Jungvögel<br />
- Verringerung des Nahrungsangebotes durch Schließung offener Mülldeponien<br />
- Störungen an Brutplätzen durch Freizeitaktivitäten und forstliche Maßnahmen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Aufklärung der Bevölkerung, Jagdverschonung und langfristige Überführung in das Naturschutzrecht<br />
- Verfolgung illegaler Bekämpfungsaktionen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 170
Verbreitungskarte 17: Kolkrabe<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
1 1<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3 4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 171
Blaumeise, Parus caeruleus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Blaumeise<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Blaumeise als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) schreibt: „Die Blaumeise, sonst so reichlich vertreten in den Thälern des Gebietes,<br />
wo sie alte Pflaumbaumanlage, Weidichte und gemischten Wald oft genug zu ihrer Befriedigung dicht beisammen<br />
findet, ist jetzt seltener geworden – zumal seit dem Winter von 1870 auf 1871.“ Für Ostthüringen<br />
schätzt LIEBE (1878) ein: „Der Bestand der Blaumeisen ist in jener Zeit weit geringer gewesen, wie derjenige<br />
der Finkmeisen, hat sich aber wegen ihrer grossen Accommodationsfähigkeit und ihrer Lebensweise auf<br />
gleicher Höhe erhalten.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Seltener als vorige<br />
[Kohlmeise] gehört sie doch zu unseren regelmäßigen Brutvögeln und kann allenthalben beobachtet werden.“<br />
1900 bis 1950<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Blaumeise als Brutvogel aus der Umgebung von<br />
Hohenölsen aufgeführt (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) fand sie etwas geringer im Bestand als die Kohlmeise, nur in Laubwäldern ist sie etwas<br />
häufiger. Hier übersteigt ihre Zahl oft die der Kohlmeisen. Im Ronneburger Forst konnte auf je 4 ha Waldfläche<br />
1 BP festgestellt werden. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Blaumeise in der Umgebung<br />
von Auma als Brutvogel wesentlich geringer als die Kohlmeise vertreten. LANGE & LEO (1978) fanden die Art<br />
sehr häufig im Altkreis <strong>Greiz</strong>, jedoch seltener als die Kohlmeise. Nach SCHEFFEL (1976 d) wurden 1974/75<br />
die Bestandszahlen (gezählt oder geschätzt) in einer Umfrage wie folgt ermittelt, Altkreis Gera-Stadt und -<br />
Land: auf 35 ha Wald ohne Nistkästen 13 bis 20 BP, auf 2219 ha mit 541 Nistkästen 205 bis 263 BP, Altkreis<br />
Zeulenroda: auf 350 ha mit 602 Nistkästen 6 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im<br />
Untersuchungsgebiet mit 5000 bis 7000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf<br />
91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 475 bis 653 BP ermittelt wurden. Im Jahre 2008<br />
erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem<br />
Anteil Nadelwald. Hier wurden 14 Reviere der Blaumeise ermittelt (VOOG). Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er<br />
Park wurde der Bestand auf 20 bis 30 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Keine lokalen Gefährdungsfaktoren bekannt<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine speziellen Schutzmaßnahmen erforderlich<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 172
Kohlmeise, Parus major L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Kohlmeise<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Kohlmeise als sehr häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Ausführlich äußert sich LIEBE (1873) zu den festgestellten Bestandsschwankungen: „Die<br />
Pinkmeisen (Pinkhähne) sind zwar in neuster Zeit wieder sehr zahlreich geworden, aber ihre Häufigkeit war<br />
entschieden vor 30 Jahren eine noch viel größere, und doch fand damals der später mit Fug und Recht allenthalben<br />
streng verpönte Meisenfang für die Küche statt. Seit 20 Jahren giebt es weit und breit keine<br />
Meisenhütten mehr und dennoch nahm die Zahl der Finkmeisen sowohl wie die der anderen Meisenarten in<br />
dieser Zeit im Ganzen mehr und mehr ab; nur 1861, 1868 und vorzüglich 1872 war eine stärkere Zunahme<br />
zu konstatieren.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Kohlmeise (Finkmeise).<br />
Unsere häufigste und bekannteste, überall an zusagenden Plätzen brütende Meise.“<br />
1900 bis 1950<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Kohlmeise als Brutvogel aus der Umgebung von<br />
Hohenölsen aufgeführt (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist sie die häufigste Meisenart mit einigen Tausend Brutpaaren im Altkreis Gera-Stadt<br />
und -Land. Im Ronneburger Forst konnte auf je 2 ha Waldfläche 1 BP festgestellt werden. Auch im Gebiet<br />
um Auma bezeichnen BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) die Kohlmeise als häufigste Meisenart. Für den<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong> treffen LANGE & LEO (1978) die gleiche Einschätzung. Nach SCHEFFEL (1976 c) wurde in den<br />
Jahren 1974/75 der Brutbestand (gezählt oder geschätzt) wie folgt ermittelt, Altkreis Gera-Stadt und -Land:<br />
auf 35 ha Wald ohne Nistkästen 12 bis 20 BP, auf 2219 ha mit 541 Nistkästen 406 bis 523 BP, Altkreis<br />
Zeulenroda: auf 350 ha mit 602 Nistkästen 126 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im<br />
Untersuchungsgebiet mit 6000 bis 9000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf<br />
91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 581 bis 763 BP ermittelt wurden. Im Jahre 2008<br />
erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem<br />
Anteil Nadelwald. Hier wurden 19 Reviere der Kohlmeise ermittelt (VOOG). Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er<br />
Park wurde der Bestand auf 40 bis 60 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Keine lokalen Gefährdungsfaktoren bekannt<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine speziellen Schutzmaßnahmen erforderlich<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 173
Haubenmeise, Parus cristatus Gmel.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Haubenmeise<br />
Foto: S. Morsch/Fotonatur.de<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
17. bis 19. Jahrhundert<br />
Bereits das „Vogell Register Derer Von Metsch zu Triebes Jagtbüchlein Von 1611 biß 1818 worinnen Verzeichnet<br />
wo und wie jedes stük gefangen und erlegt worden“ erwähnt die „Kopmeiße“, wie die Haubenmeise<br />
damals genannt wurde. LIEBE (1873) fand die Art nur westlich von Gera: „Die Kuppmeise ist nur in den<br />
Nadelwaldungen westlich vom Elsterthale zu finden und auch hier eine ziemlich seltene Erscheinung. Ich<br />
habe nistende Paare beobachtet zwischen Hohenreuth und Großebersdorf, westlich der Oelsdorfmühle, bei<br />
Münchenbernsdorf, bei St. Gangloff – überhaupt fast nur im weiteren Gebiet.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE<br />
(1878) mit: „Sie haben im Lauf der letzten Jahrzehnte viel Terrain aufgegeben, – namentlich im Osten und<br />
Norden von Ostthüringen, weil die dichten ausgedehnteren Nadelholzbestände dort allmählich fast ganz<br />
verschwunden sind. In den schönen Nadelwäldern, welche sich in einem breiten Streifen vom Frankenwald<br />
bis ziemlich nach Eisenberg und Zeitz erstrecken, sind zwar auch vielorts durch Rodung Lücken entstanden,<br />
immerhin aber nicht so grosse, dass die Haubenmeisen hätten weit zurückweichen mögen, und hier<br />
hat in der That eine Mehrung derselben stattgefunden, so dass ihr Bestand ungefähr derselbe geblieben<br />
ist.“ Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) ist die Haubenmeise ein seltener Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Haubenmeise<br />
(Kuppmeise). In Nadelwäldern nicht selten: Hirschstein, Pulverturm, Tempel, Waldhaus, Schöne Aussicht,<br />
Rothenthal, Dölau, Caselwitz, Göltzschtal, Elsterberg (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezeichnen die Art als häufigen Brutvogel der Nadelwälder in ganz Thüringen.<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Haubenmeise als Brutvogel aus der Umgebung von<br />
Hohenölsen aufgeführt (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist die Haubenmeise die seltenste Meisenart mit höchstens 200 BP im Altkreis Gera-<br />
Stadt und -Land. Im Gebiet um Auma kommt die Haubenmeise nur in wenigen Paaren vor, fehlt aber in<br />
keinem Fichtenwald (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> bezeichnen LANGE & LEO<br />
(1978) die Haubenmeise als häufigen Brutvogel. Der Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> wird auf unter 500 BP geschätzt.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 500 bis 800 BP an.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch intensive Nutzung und Durchforstung der Wälder und Verlust von Nadelaltholzbeständen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Waldwirtschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 174
Tannenmeise, Parus ater L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Tannenmeise<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
17. bis 19. Jahrhundert<br />
Im „Vogell Register Derer Von Metsch zu Triebes Jagtbüchlein Von 1611 biß 1818 worinnen Verzeichnet<br />
wo und wie jedes stük gefangen und erlegt worden“ wird die „Danmeis“, wie die Tannenmeise damals genannt<br />
wurde, erwähnt. Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Tannenmeise als häufigen<br />
Brutvogel in der Umgebung von Gera. LIEBE (1873) konnte dies bestätigen: „Tannenmeisen sieht man jetzt<br />
verhältnismäßig viel. Sie haben offenbar weniger durch die oben genannten Unbilden [Kohlmeise: Verluste<br />
durch Witterung, Nahrungsknappheit und Mangel an Bruthöhlen in Wirtschaftwäldern, Blaumeise: Winterverluste]<br />
gelitten, als die anderen Arten und stehen bezüglich ihrer Zahl zwar den Finkmeisen und<br />
Schwanzmeisen [!] nach, nicht aber den Blaumeisen.“ Später spricht LIEBE (1878) von einer Abnahme in<br />
Ostthüringen. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Regelmäßiger, wenn auch<br />
nicht allzuhäufiger Bewohner unserer Nadelwaldungen.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezeichnen die Tannenmeise als häufigen Brutvogel der Wälder in ganz<br />
Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist die Tannenmeise mit 500 bis 1000 BP im Altkreis Gera-Stadt und -Land kein allzu<br />
häufiger Brutvogel. Er verweist auf Bestandsschwankungen. So war die Tannenmeise 1965 an manchen<br />
Orten verschwunden, an denen sie sonst brütete. Im Gebiet um Auma kommt die Tannenmeise häufiger<br />
als die Blaumeise vor. (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Nach LANGE & LEO (1978) hat die Art im Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong> einen wesentlich höheren Bestand erreicht als früher. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />
im Untersuchungsgebiet mit 1000 bis 2000 BP an. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der<br />
Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch intensive Nutzung und Durchforstung der Wälder und Verlust von Nadelaltholzbeständen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Waldwirtschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 175
Sumpfmeise, Parus palustris L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Sumpfmeise<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) ist die Sumpfmeise ein häufiger Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) schreibt: „Die Sumpfmeise (Kohlmeise), welche noch der Bericht von 1859<br />
häufig nennt, ist jetzt im Ganzen genommen keineswegs sehr zahlreich und steht in dieser Beziehung der<br />
Tannenmeise weit nach. Nur im Osten, wo die Nadelwälder fehlen, giebt es weniger Tannenmeisen als<br />
Sumpfmeisen.“ Für Ostthüringen stellt LIEBE (1878) fest: „Die Sumpfmeisen ersetzen im an Nadelwald armen<br />
Osten und Nordosten die dort fast fehlenden Tannenmeisen. Sie bilden daselbst noch immer die häufigste<br />
Art, obgleich ihr Bestand sich verringert hat, – vorzüglich infolge der Ausrodung der Laub- und<br />
Buschwälder. Im Westen, wo sie lediglich die cultivierten Thäler mit ihren Gärten und umbuschten alten<br />
Hohlwegen einzeln bewohnen, ist ihre Herabminderung noch merklicher.“ Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Nicht selten: Dölau, Göltzschtal, Park, Neue Welt [Trödenwiese am<br />
<strong>Greiz</strong>er Park], Krümmetal, überhaupt mit Vorliebe in kleinen Seitentälern.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist die Sumpfmeise ein häufiger Jahresvogel in ganz Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
Um die Weidatalsperre fand WERNER (1964) auf einer Fläche von 180 ha 13 BP 1954, 12 BP 1955, 13 BP<br />
1956, 14 BP 1957 und 14 BP 1958. Im Altkreis Gera-Stadt und -Land dürfte nach GÜNTHER (1969) die Gesamtzahl<br />
300 BP nicht übersteigen. Er verweist auf Bestandsschwankungen. Im Gebiet um Auma wurde<br />
die Sumpfmeise regelmäßig angetroffen (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Nach LANGE & LEO (1978) hat<br />
die Art im Altkreis <strong>Greiz</strong> eine wesentlich höhere Dichte erreicht als früher. 1974/75 wurde der Bestand überregional<br />
erfasst (GÜNTHER 1976 c). Während im Altkreis Gera-Stadt und -Land auf 72 ha Laubmischwald<br />
bei Gera-Pforten und Grobsdorf 1 bis 2 BP festgestellt wurden, gab es auf 1500 ha Nadelwald bei<br />
Münchenbernsdorf, auf 130 ha Nadelwald bei Reust/Rußdorf und auf 17 ha Nadel-Laubmischwald bei<br />
Hilbersdorf keine Vorkommen. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> brüteten auf 60 ha Laub-Nadelmischwald in <strong>Greiz</strong>-<br />
Aubachtal<br />
2 BP, im Altkreis Zeulenroda auf 64 ha Auwald im Weidatal 2 BP und auf 285 ha Nadelwald (Köthenwald)<br />
0 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 150 bis 250 BP an.<br />
Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 15 bis 25 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2<br />
BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch forstliche Maßnahmen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Waldwirtschaft<br />
- Erhaltung und Schutz von Altholzbeständen und Auwäldern<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 176
Weidenmeise, Parus montanus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Weidenmeise<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Als erster hatte BREHM (1831) festgestellt, dass die Weidenmeise eine eigene, von der Sumpfmeise unterschiedene<br />
Art ist und schreibt zum Vorkommen: „Sie … lebt in unseren Thälern, besonders an den mit<br />
Weiden besetzten Bach, Fluß- und Teichufern.“ Erst 1896 gelang KLEINSCHMIDT (1897) die „Wiederentdeckung“<br />
der Weidenmeise bei Renthendorf. HELLER (1926): „Weidenmeise. Diese, neuerdings als Art aufgenommene,<br />
der Sumpfmeise sehr ähnliche Meise, ist in meinen früheren Aufzeichnungen möglicherweise<br />
als Sumpfmeise aufgenommen worden. Ich glaube aber, daß sie auch bei uns brütet. Pietzold stellte sie bei<br />
Elsterberg, Ruppertsgrün, Wolfshain fest.“<br />
1900 bis 1950<br />
Bis 1913 wurde die Weidenmeise von vielen Faunisten als eigenständige Art nicht anerkannt. In der ersten<br />
Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte die Suche nach Vorkommen dieser Art ein. Als erster fand VOIGT an der<br />
Weida und am Triebesbach die Weidenmeise (FENK 1913). HELLER (1926) kennt inzwischen die Weidenmeise<br />
als eigenständige Art und schreibt: „Diese, neuerdings als Art aufgenommene, der Sumpfmeise sehr<br />
ähnliche Meise, ist in meinen Aufzeichnungen [1881] möglicherweise als Sumpfmeise aufgenommen worden.<br />
Ich glaube aber, daß sie auch bei uns [1926] brütet. Pietzold stellte sie bei Elsterberg, Ruppertsgrün,<br />
Wolfshain fest.“ HIRSCHFELD (1932) bezeichnet die Weidenmeise in der Umgebung von Hohenleuben noch<br />
als selten. In den 1930er-Jahren stellten dann HIRSCHFELD, VÖLCKEL und BAUCH die Weidenmeise an mehreren<br />
Stellen um Hohenleuben fest (HIRSCHFELD 1970). Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) wurde die<br />
Weidenmeise in ganz Thüringen nachgewiesen.<br />
Ab 1950<br />
In der Umgebung von Hohenölsen war die Art keine seltene Erscheinung (BAUCH 1952). Er nennt mehrere<br />
Brutnachweise aus dieser Gegend. Angeregt durch BAUCH fand GÜNTHER die Weidenmeise als Brutvogel in<br />
der Umgebung von Ronneburg. Den ersten Brutnachweis erbrachte er 1952 bei Thränitz. Später fand er<br />
auch die Art in den Waldgebieten westlich von Gera (HIRSCHFELD 1970). Um die Weidatalsperre brüteten<br />
nach WERNER (1964) auf einer Waldfläche von 180 ha 5 BP 1954, 6 BP 1955, 7 BP 1956, 7 BP 1957 und<br />
6 BP 1958. Im Altkreis Gera-Stadt und -Land ist die Weidenmeise nach GÜNTHER (1969) in den letzten<br />
Jahrzehnten etwas häufiger geworden und bewohnt die Nadel- und Mischwälder. Die Gesamtzahl schätzt<br />
er auf 300 BP. Im Gebiet um Auma ist die Weidenmeise nicht selten (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971).<br />
Nach LANGE & LEO (1978) ist die Art im Altkreis <strong>Greiz</strong> die seltenste Meisenart mit nicht mehr als 50 BP. In<br />
den Jahren 1972/73 wurde der Bestand überregional erfasst (GÜNTHER 1974). Danach brüteten im Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land auf 5025 ha großen Untersuchungsflächen mit 1069 ha Wald 38 bis 51 BP, im Altkreis<br />
Zeulenroda auf einer Untersuchungsfläche von 4000 ha mit 1600 ha Waldanteil 15 BP und im Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong> auf 85 ha Untersuchungsflächen mit 53 ha Waldanteil 7 bis 8 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den<br />
Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 300 bis 500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 32 bis 46 BP ermittelt wur-<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 177
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
den. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen<br />
der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 257 bis 615 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung und Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Vernichtung der Auwälder, intensive Durchforstung<br />
der Wälder, Trockenlegung von feuchten Waldgebieten und Ausräumung und Verbauung der<br />
Kulturlandschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Neuanlage von Auwäldern<br />
- Extensivierung in der Forstwirtschaft, insbesondere Erhalt von Totholz und Wiedervernässung von Waldgebieten<br />
- Erhalt einer reich strukturierten Kulturlandschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 178
Feldlerche, Alauda arvensis (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Gefährdet<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Feldlerche<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts war die Feldlerche um Gera ein sehr häufiger Brutvogel (Ornithologische Sektion<br />
Gera 1859). Diese Einschätzung kann auch LIEBE (1873) bestätigen. Für Ostthüringen stellt LIEBE (1878)<br />
fest: „Die Feldlerche hat sich seit 50 Jahren in demselben Maasse gemehrt, wie sich die Waldstrecken in<br />
Feld umwandeln. Auf schon seit längerer Zeit waldfreien Feldfluren ist einige Male ein Schwanken des Bestandes<br />
namentlich infolge von schlimmen Nachwintern eingetreten. Im Ganzen aber hat er sich in solchen<br />
Strichen auf gleicher Höhe erhalten oder sogar ein wenig gehoben.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881<br />
schreibt HELLER (1926): „Häufiger allbekannter Bewohner unsrer Felder.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist die Feldlerche ein sehr häufiger Brutvogel aller Feldfluren in ganz<br />
Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land ist die Feldlerche nach GÜNTHER (1969) sehr häufig. Auf einer Probefläche<br />
bei Großenstein siedelte 1968 ein BP/Hektar. Im Gebiet um Auma wird die Feldlerche als die häufigste Art<br />
der Feld- und Wiesenflächen bezeichnet (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Nach LANGE & LEO (1978) ist<br />
die Art im Altkreis <strong>Greiz</strong> die dominierende Art der Wiesen und Felder, hat aber in den letzten Jahren scheinbar<br />
abgenommen. 1975/76 wurde der Bestand überregional erfasst (FLÖßNER 1977). Danach brüteten auf<br />
einer Untersuchungsfläche im Altkreis Zeulenroda bei Auma mit 31 ha 14 BP, im Altkreis <strong>Greiz</strong> auf zwei<br />
Untersuchungsflächen mit 103 ha 41 BP. Am höchsten war der Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> auf Grünlandflächen<br />
mit 75 BP/km², dagegen auf intensiv bewirtschaftetem Ackerland mit nur 20 BP/km². LANGE & LIEDER<br />
(2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 2500 bis 5000 BP an. Für diese Schätzung<br />
lag eine halbquantitative Erfassung auf 81 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 425 bis<br />
780 BP, allerdings im wenig bewaldeten Nordosten des Landkreises <strong>Greiz</strong>, ermittelt wurden. Diese Dichteangaben<br />
liegen deutlich unter denen von FLÖßNER (1977) genannten Werten und belegen den weiteren<br />
Rückgang der einst sehr häufigen Art. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-<br />
Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 115 ha ökologisch wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der<br />
Wismut GmbH. Hier wurden 28 Reviere der Feldlerche ermittelt (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 179
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit<br />
- Zu dichter und zu hoher Pflanzenwuchs als Folge zu starker Düngung<br />
- Massenhafter Biozideinsatz<br />
- Vergrößerung der Schlagflächen und Verringerung der Kulturenvielfalt<br />
- Vernichtung der Saumbiotope und Ruderalflächen<br />
- Grünlandumbruch und intensive Weidewirtschaft<br />
- Zunahme der Prädatoren (Fuchs, Dachs, Waschbär)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung zusätzlicher Brach- und Ausgleichsflächen ohne Mahd zur Brutzeit<br />
- Umsetzung der NABU-Aktion „Feldlerchenfenster“ auf möglichst vielen Ackerflächen<br />
- Extensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft<br />
- Erhalt und Widerherstellung von Ackerrandstreifen<br />
- Reduzierung des Pestizid- und Düngereinsatzes,<br />
- Verzicht auf das herbstlich Totspritzen mit „Roundup“<br />
- Keine Spritzung von Ackerrainen und Wegerändern<br />
- Vermehrter Anbau von Sommergetreide<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 180
Schwanzmeise, Aegithalos caudatus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Schwanzmeise<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Schwanzmeise als sehr häufigen Brutvogel in der<br />
Umgebung von Gera. Dies kann LIEBE (1873) bestätigen: „Die Schwanzmeisen sind wieder recht zahlreich<br />
geworden und erreichen in dieser Beziehung fast die Finkmeisen [Kohlmeisen]. Sie und die Blaumeisen<br />
scheuen die Unruhe der Stadt so wenig, daß sie bisweilen im Küchengarten und in anderen städtischen<br />
Gärten nisten.“ Später spricht LIEBE (1878) von einer Abnahme in Ostthüringen: „Die Zahl der im Gebiet<br />
brütenden Schwanzmeisen ist aber jetzt beträchtlich kleiner als die jener [Tannenmeisen]; sie war vielleicht<br />
vor 4 Jahrzehnten eben so gross, doch hat sie seit jener Zeit beständig abgenommen. Die Ursache ist leider<br />
nicht zu benennen.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Schwanzmeise<br />
(Pfannenstiel). Regelmäßiger Brutvogel am Gasparinenberg, bei Caselwitz, Dölau, im Park, Göltzschtal;<br />
Elsterberg (Rödelanlagen), Tremnitz (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist die Schwanzmeise ein in allen Teilen Thüringens vorkommender<br />
Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land stellt GÜNTHER (1969) eine Abnahme fest: „Vor 10 bis 20 Jahren waren<br />
Schwanzmeisen noch in jedem Waldgebiet in einigen Paaren vertreten. Seit etwa 5 Jahren haben wir aber<br />
einen wesentlich geringeren Bestand und vielerorts sind sie verschwunden. Zur Zeit gibt es wohl weniger<br />
als 100 Paare im ganzen Gebiet.“ Während er Brutzeit wurde die Schwanzmeise öfters um Auma beobachtet<br />
(BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Nach LANGE & LEO (1978) ist der Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> großen<br />
Schwankungen unterworfen. Im Durchschnitt rechnen sie mit 50 BP. 1974/75 wurde der Bestand überregional<br />
auf Probeflächen erfasst (HEYER 1976) und brachte folgendes Ergebnis: Altkreis Gera-Stadt und<br />
-Land: auf 6230 ha mit 1810 ha Wald 9 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: mit 60 ha Wald 1 BP und Altkreis Zeulenroda:<br />
auf 100 ha mit 7 ha Wald 5 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 300 bis 500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche<br />
zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 19 bis 33 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurde der Bestand auf 2 bis 5 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-<br />
Projekt 2005 bis 2009 wurden 286 bis 644 BP geschätzt.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 181
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Ausräumung der Landschaft, Verlust von Feldgehölzen, intensive Durchforstung<br />
und zunehmende Verbauung in Siedlungsbereichen, Umwandlung von Nieder- in Hochwälder<br />
- Hohe Brutverluste durch Prädation<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt einer reich strukturierten Kulturlandschaft und Neuanpflanzung von Gehölzen<br />
- Extensivierung in der Forstwirtschaft<br />
Verbreitungskarte 18: Schwanzmeise<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
2 – 3<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7<br />
8 – 20 4 – 7<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 182
Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Waldlaubsänger<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
19. Jahrhundert<br />
In der Umgebung von Gera war der Waldlaubsänger ein seltener Brutvogel (Ornithologische Sektion Gera<br />
1959). LIEBE (1873) schreibt: „Der kleine Weidenzeisig [Waldlaubsänger] ist in den warm gelegenen Laubhochwäldern<br />
am Elsterthal nicht selten und scheint sich zu mehren. ... Im rauh gelegenen und mit zu viel<br />
Schwarzholz versehenen Laubholzbeständen ist er selten.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE (1878) folgendes mit:<br />
„Der Waldlaubvogel ist im Gebiet nicht gerade häufig und ist im Westen und Süden eine sehr vereinzelte<br />
Erscheinung – wohl wegen des vorherrschenden Nadelwaldes und der rauheren Landschaft. ... Etwas häufiger<br />
ist er in dem an Laubgehölzen reichern Nordosten. Sein Bestand ist mit merkwürdig geringen Schwankungen<br />
derselbe geblieben.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Waldlaubvogel.<br />
Im Gebiet der seltenste, hier brütende Laubvogel. Er bevorzugt Laubwald.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Waldlaubsänger ein in ganz Thüringen vorkommender Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land stellte GÜNTHER (1969) starke Bestandsschwankungen fest: „Die hiesige<br />
Population hatte etwa 1958 einen Höhepunkt erreicht, allein auf dem Weinberg bei Gera-Untermhaus wurden<br />
8 Nester mit Jungen gefunden (Gü.). Wenige Jahre danach war die Art wesentlich rarer geworden, und<br />
sie fehlte an manchen Stellen gänzlich. Erst 1967 und 1968 kam es wieder zu einer hohen Zahl an Brutpaaren,<br />
die im Kreis Gera bei 300 liegen mag. Jetzt wurden selbst lichte Stellen im Nadelwald mit wenigem<br />
Laubholz besiedelt.“ In der Umgebung von Auma wurde der Waldlaubsänger u.a. im Untendorfer Wald, am<br />
Sophienbad, bei Wenigenauma, Leschke und Waldhaus festgestellt. In den Nadelforsten um Auma fehlte er<br />
dagegen (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Nach LANGE & LEO (1978) kann der Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong><br />
auf 100 bis 200 BP geschätzt werden. Bei einer überregionalen Bestandserfassung 1976/77 (HÖPSTEIN 1978<br />
c) wurde der Brutbestand auf Probeflächen wie folgt festgestellt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 110 ha<br />
Laubmischwald 17 bis 19 BP, auf 10 ha Laubmischwald, auf denen Jahre zuvor 1 bis 3 BP ermittelt wurden,<br />
sowie auf 25 ha Fichtenaltholz mit Laubholzrand jeweils 0 BP, weitere 5 Untersuchungsgebiete ohne Flächenangabe<br />
ergaben 139 bis 162 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 23 ha Mischwald 6 BP (1971/72), Altkreis<br />
Zeulenroda: auf 1600 ha Wald mit 90 % Fichtenanteil ca. 10 BP. Weiterhin wurden langjährige Zählergebnisse<br />
aus dem Raum Roschütz/Hirschfeld/Aga auf 550 ha Laub- und Mischwald wie folgt festgestellt:<br />
1972 1973 1974 1975 1976<br />
35 30 42 35 37<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 200 bis 400 BP an. Für diese<br />
Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei<br />
der 53 bis 72 BP ermittelt wurden. Bei Untersuchungen des Brutvogelbestandes auf einer Fläche von 8,1 ha<br />
im NSG „Buchenberg“ bei Weida wurden 14 BP im Jahre 1988 (BAUM) und 7 BP im Jahre 2009 (LIEDER &<br />
LIEDER-SÖLDNER 2010) festgestellt. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt<br />
(LUMPE 2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet<br />
Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 12 Reviere vom Waldlaubsän-<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 183
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
ger ermittelt (VOOG). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 173 bis 366<br />
BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Umwandlung von Laubwäldern in Nadelwälder und<br />
- Raschen Aufwuchs des Unterholzes (geringere Durchlichtung der Waldgebiete)<br />
- Brutverluste durch Prädation<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Rückführung von standortwidrigen Fichtenreinbeständen in standortangepasste, durchlichtete Waldgesellschaften<br />
Verbreitungskarte 19: Waldlaubsänger<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
21 – 50 4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
2 – 3 4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
4 – 7 2 – 3<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 184
Fitis, Phylloscopus trochilus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Fitis<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Für die Umgebung von Gera wird der Fitis als häufiger Brutvogel aufgeführt (Ornithologische Sektion Gera<br />
1859). LIEBE (1873) kann eine Zunahme der Art feststellen: „Daß der Fitis in unserem Gebiet in den letzten<br />
15 Jahren immer zahlreicher geworden, ist auch weniger aufmerksamen Beobachtern nicht entgangen. War<br />
er sonst (v. Bericht v. 1859) nur häufig, so ist er jetzt sehr häufig, und zwar nicht bloß in den milder gelegenen<br />
Theilen unseres Gebiets.“ Für Ostthüringen schreibt LIEBE (1878): „Sein Bestand hat sich fast allenthalben<br />
gehoben – auf das Doppelte und darüber. Nur im Nordosten des Gebiets, in den fruchtbaren Getreidesteppen<br />
des Altenburger Ostkreises hat er etwas abgenommen, eine Folge der ziemlich radikalen Umwandelung<br />
von Wald in Feld ...“. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Häufiger als<br />
der vorige [Waldlaubsänger] bevorzugt auch er Laubholz, nimmt aber mit Strauchwerk vorlieb.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezeichnen den Fitis als einen häufigen, überall in Thüringen vorkommenden<br />
Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land ist der Fitis nach GÜNTHER (1969) fast so häufig wie der Zilpzalp: „ doch<br />
kommt er besonders im reinen Nadelwald nicht so zahlreich vor. Er besiedelt unser Gebiet mit einigen tausend<br />
Paaren.“ In der Umgebung von Auma fanden BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) keine großen Unterschiede<br />
in der Häufigkeit im Vergleich zum Zilpzalp. Nach LANGE & LEO (1978) ist der Fitis im Altkreis <strong>Greiz</strong><br />
ein sehr häufiger Brutvogel. Bei einer überregionalen Bestandserfassung 1976/77 (HÖPSTEIN 1978 b) wurde<br />
der Brutbestand auf Probeflächen wie folgt festgestellt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 550 ha Laub-,<br />
Misch- und Nadelwald 160 bis 170 BP, auf weitere 5 Untersuchungsflächen mit 187 ha Wald 44 bis 52 BP,<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 23 ha Mischwald 6 BP (1971/72), Altkreis Zeulenroda: auf 25 ha Nadelmischwald 5 BP.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 4000 bis 5000 BP an. Für<br />
diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 199 bis 265 BP ermittelt wurden. Heute ist der Bestand vom Fitis bedeutend geringer als der vom<br />
Zilpzalp. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Jahre<br />
2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit<br />
geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 32 Reviere vom Fitis ermittelt (VOOG).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Habitatverlust durch forstliche Eingriffe oder Sanierungstätigkeiten des Wismutbergbaus<br />
- Verlust von Auwäldern<br />
- Verbauung (Wohn- und Gewerbegebiete)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz von unterholzreichen Auwäldern und bachbegleitenden buschreichen Lebensräumen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 185
Zilpzalp, Phylloscopus trochilus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Zilpzalp<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Zilpzalp als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) stellte fest: „Dasselbe, wie vom Fitis, gilt auch vom großen Weidenzeisig [Zilpzalp]:<br />
auch sein Bestand hat sich in den letzten Jahren außerordentlich vergrößert. Bei uns zieht er den Nadelwald<br />
dem Laubwald vor.“ Zur Bestandsentwicklung in Ostthüringen schreibt LIEBE (1878): „Der Weidenlaubvogel<br />
ist im Osten des Gebiets seltener geworden. Es erklärt sich dies einfach daraus, dass dort eine grosse Menge<br />
Privatwaldungen ausgerodet worden sind, da im Königreich Sachsen, im Herzogthum Altenburg und in<br />
den Fürstenthümern Reuss gerade hier wenig herrschaftliche Forsten stehen und die Ausrodung der Wälder<br />
nicht gesetzlich untersagt oder erschwert ist. Im Westen von Ostthüringen hingegen, wo sich von Nord nach<br />
Süd grosse Flächen herrschaftlichen Waldes hinziehen, hat sich der Vogel stark vermehrt, das seine Abnahme<br />
im Osten mehr als ausgeglichen wird und sein Bestand sich demzufolge im Allgemeinen gehoben<br />
hat.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Weidenlaubsänger (Zilpzalp). Unser<br />
häufigster Laubvogel. Er bevorzugt Nadelwald und lässt im zeitigen Frühjahr als erster seiner Verwandten<br />
überall an geeigneter Stelle seinen einförmigen Ruf hören.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) charakterisieren den Zilpzalp als einen verbreiteten und häufigen Brutvogel<br />
in ganz Thüringen. HIRSCHFELD (1932) bezeichnet die Art als häufig in der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) brüten im Altkreis Gera-Stadt und -Land einige Tausend BP. In der Umgebung von<br />
Auma ist der Zilpzalp ein häufiger Brutvogel im gesamten Gebiet (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Auch<br />
LANGE & LEO (1978) schätzen ein, dass der Zilpzalp eine sehr häufiger Brutvogelart ist und mit über 1000<br />
Paaren brütet. Bei einer überregionalen Bestandserfassung 1976/77 (HÖPSTEIN 1978 a) wurde auf Probeflächen<br />
der Brutbestand wie folgt festgestellt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 550 ha Laub-, Misch- und<br />
Nadelwald 150 BP 1968, 230 bis 250 BP 1972 und 180 bis 200 BP 1976, auf weiteren 5 Untersuchungsflächen<br />
mit 187 ha Wald 43 bis 46 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 23 ha Mischwald 6 BP 1971/72, Altkreis Zeulenroda:<br />
auf 25 ha Nadelmischwald 5 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 4000 bis 5000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche<br />
zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 402 bis 574 BP ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurde der Bestand auf 2 bis 4 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung<br />
im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden<br />
37 Reviere vom Zilpzalp ermittelt (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 186
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Waldrodung im Bergbausanierungsgebiet der Wismut<br />
- Intensive Durchforstung von Waldflächen<br />
- Rodung von Waldrändern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Förderung einer ökologisch orientierten Waldbewirtschaftung mit Zielrichtung eines reich strukturierten<br />
Waldes<br />
- Erhalt der Pufferbereiche am Waldrand zu den angrenzenden Feldflächen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 187
Feldschwirl, Locustella naevia (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Feldschwirl<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) bezeichnet die Art als Heuschreckenschilfsänger und schreibt: „Sommer 1817 wohnte<br />
ein Pärchen am frießnitzer See.“ Im Bericht vom „Ausschuß für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands<br />
(1887)“ führt HELLER zehn Brutplätze zwischen Schmölln, Gößnitz und Ronneburg an. KOEPERT (1896)<br />
gibt als Brutplatz Mückern bei Ronneburg an.<br />
1900 bis 1950<br />
HIRSCHFELD (1932) fand den Feldschwirl bei Weida.<br />
Ab 1950<br />
GRÜN (1968) kann aus unserem Gebiet folgende Brutzeitfeststellungen (singende Männchen) nennen: 1962<br />
Göttlingstein bei Zeulenroda, 1966 Vorsperre der Weidatalsperre, 1967 Ronneburger Forst und Auma. Nach<br />
GÜNTHER (1969) kann für den Altkreis Gera-Stadt und -Land acht Beobachtungen singender Männchen zwischen<br />
1956 und 1968 aufführen. LANGE & LEO (1978) sind der Meinung, dass die Besiedlung des Altkreises<br />
<strong>Greiz</strong> erst im 20. Jahrhundert erfolgte. Der erste Nachweis für das Untersuchungsgebiet gelang am<br />
08.05.1955 in der Nähe des Schlötenteiches im Forstrevier Waldhaus bei <strong>Greiz</strong>. Ab 1968 tritt dann der Feldschwirl<br />
alljährlich auf. Die überregionale Bestandserfassung 1978/79 (FLÖßNER 1980 b) brachte folgende<br />
Ergebnisse:<br />
Brutnachweise: 1973 Großenstein, 1973 und 1976 Gera-Roschütz, seit 1975 Dorna, 1979 <strong>Greiz</strong>.<br />
Brutzeitfeststellungen: seit 1968 Stadtkreis Gera an mindestens zehn Stellen, seit 1978 Kauern/Kaimberg/<br />
Falka an vier Stellen, ab 1970 Roschütz/Dorna an mehreren Stellen, ab 1967 Umgebung Ronneburg an<br />
zwei bis vier Stellen, 1969 und 1972 bei <strong>Greiz</strong> an zwei Stellen, 1978 Sorge-Settendorf und seit 1974 RKG<br />
Großkundorf bis zu drei Stellen.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 100 bis 150 BP an. Für diese<br />
Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei<br />
der 30 bis 36 Reviere ermittelt wurden. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-<br />
Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald, auf 115 ha ökologisch<br />
wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier wurden acht Reviere vom Feldschwirl<br />
ermittelt (VOOG). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 50 bis 84<br />
BP geschätzt. Diese Zahlen deuten eine Abnahme in den letzten Jahren an (vgl. LANGE & LIEDER 2001).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 188
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumzerstörung durch Entwässerung und Grundwasserabsenkung, Zerstörung von Hochstaudenfluren,<br />
Erschließungsmaßnahmen und Überbauung, Ausräumung der Landschaft und intensive landwirtschaftliche<br />
Nutzung<br />
- Ausmähen der Nester<br />
- Prädation durch Säugetiere zur Brutzeit<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt der Auengebiete und einer naturnahen Ufervegetation an Fließgewässern<br />
- Schutz von Feuchtgebieten mit Landschilfvorkommen und Hochstaudenfluren<br />
- Ausgleichsmaßnahmen für den Lebensraumverlust bei Sanierungsarbeiten des Wismutbergbaus und bei<br />
Überbauung von Brutplätzen<br />
Verbreitungskarte 20: Feldschwirl<br />
2 – 3<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3<br />
4 – 7<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
1<br />
1<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 189
Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris (Wolf)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Sumpfrohrsänger<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) fand den „Sumpfschilfsänger“ nur im Saaletal brütend. In den Rodatälern war er ein nicht<br />
alljährlicher Durchzügler. LIEBE (1873) schreibt: „Der Sumpfsänger, ein in früheren Jahren bei uns seltener<br />
Vogel, kommt jetzt in den geschützteren und wärmeren Parthien des Elsterthales häufiger vor und mehrt<br />
sich von Jahr zu Jahr. Wo Korbweiden und von Winden und Buschwicken durchwobene Weidengebüsche<br />
mit Dornbüschen, Obstbäumen und üppig aufgeschossenen Kräutern abwechseln, da findet sich dieser liebliche<br />
fleißige Sänger: so thalwärts bis Kuba [heute Gera-Untermhaus], nördlich bei Wünschendorf und oberhalb<br />
Liebschwitz, zwischen Stublach und Köstritz. ... Nach Herrn Dr. Rud. Müller P. nistet er auch, obschon<br />
selten, in der Umgebung von Niederpöllnitz ...“. Für „die Auweidichte unterhalb Gera und oberhalb bei<br />
Wünschendorf“ kann LIEBE (1878) „sogar eine verhältnissmässig starke Erhöhung des Bestandes<br />
constatieren. Dieser liebliche Sänger war früher sehr selten in Ostthüringen und wanderte um 1852 im<br />
Sprottethal ein; noch jetzt ist seine Verbreitung beschränkt; allein wo früher höchstens ein oder höchstens<br />
zwei Paare ihr Hauswesen einrichteten, da leben jetzt doppelt so viele und noch mehr.“<br />
Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr seltener, recht vereinzelt hier vorkommender<br />
Brutvogel.“<br />
1900 bis 1950<br />
Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Sumpfrohrsänger ein in ganz Thüringen verbreiteter<br />
Brutvogel (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist der Sumpfrohrsänger die häufigste aller Rohrsängerarten im Altkreis Gera-Stadt<br />
und -Land. 1968 wurden im Nordosten des Kreises 6 bis 7 Paare je Quadratkilometer ermittelt, die vor allem<br />
sumpfige Stellen, Gräben mit üppigem Pflanzenwuchs sowie Rapsfelder bewohnten. Der Bestand wird auf<br />
500 BP geschätzt. Im Gebiet von Auma ist der Bestand auf wenige Paare beschränkt (BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖßEL 1971). Genannt werden Leschke, Wöhlsdorfer Straße, Gütterlitz und Mittelmühle in Auma. LANGE &<br />
LEO (1978) schätzen den Bestand im Altkreises <strong>Greiz</strong> auf über 100 BP. Im Rahmen einer überregionalen<br />
Erfassung 1971/72 (GÜNTHER1973) wurden die Bestände auf Probeflächen wie folgt ermittelt: Altkreis Gera-<br />
Stadt und -Land: auf neun Flächen mit insgesamt 4540 ha 107 bis 121 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: (geschätzter Gesamtbestand<br />
100 bis 200 BP) auf zwei Flächen mit insgesamt 40 ha 4 BP und Altkreis Zeulenroda: auf drei<br />
Flächen mit insgesamt 5875 ha 15 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 500 bis 1000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km²<br />
Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 96 bis 140 Reviere ermittelt wurden. Im 60 ha großen<br />
<strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet auf 115 ha ökologisch wertvollem<br />
Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier wurden 13 Reviere des Sumpfrohrsängers<br />
ermittelt. Weitere 7 Reviere wurden im benachbarten GLB „Culmitzsch-Aue“ gefunden (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 190
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit Verlust von Ackerrainen und Gebüschstreifen, exzessiver<br />
Biozideinsatz und Rückgang von Ruderalflächen<br />
- Gewässerregulierung und Gewässerausbau<br />
- Ausmähen der Nester<br />
- Verbauung der Landschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt von Randstreifen, Ruderalflächen und Brachen<br />
- Erhalt und Verbreiterung einer uferbegleitenden Hochstaudenflur<br />
- Mahd an Gewässerufern nicht vor Ende August<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 191
Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus (Savi)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Teichrohrsänger<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In der Umgebung von Gera war der Teichrohrsänger Mitte des 19. Jahrhunderts ein seltener Brutvogel<br />
(Ornithologische Sektion Gera 1859). LIEBE (1873) hingegen schreibt: „Die Wassergrasmücke [Teichrohrsänger]<br />
ist nicht selten in den an Teichen reichen Strichen zwischen Frießnitz und Geroda, an den Ufern der<br />
Elster, sowie an den Teichen und in den Sümpfen des Sprottethals. ... Sonst kommt sie noch hie und da<br />
vereinzelt vor.“ Für Ostthüringen bezeichnet LIEBE (1878) den Teichrohrsänger als den „gemeinsten“ und<br />
„verbreitesten“ Rohrsänger, der im Bestand zugenommen „und sich vornehmlich auch an den Ufern der<br />
grösseren Flüsse gemehrt“ hat, „so dass sich z.B. in der unmittelbaren Nähe des Elsterwehres oberhalb<br />
Gera ... jetzt 3 und 4 Paare in dasselbe Rohrrevier theilen, welches früher nur ein Paar inne hatte. ... Auch<br />
beziehen die Thiere jetzt im Frühjahr ihre sommerliche Heimath etwas eher und treiben sich, da das Rohr<br />
noch gar nicht über dem Wasserspiegel erschienen ist, wochenlang im Gebüsch in der Nähe der Gewässer<br />
umher, so z.B. im Schlosspark bei <strong>Greiz</strong>.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926):<br />
„Teichrohrsänger (Rohrsperling). Seitdem der Binsenteich zum [<strong>Greiz</strong>er] Parksee geworden ist und seinen<br />
Schilfgürtel eingebüßt hat, ist der Bestand dieses lebhaften Vogels und fleißigen Sängers sehr zurückgegangen.<br />
Er brütet nur noch recht vereinzelt am Elsterufer im Park, bei Dölau, sonst auch bei Mohlsdorf, am<br />
Krümme- und Schlötenmühlenteich, bei Moschwitz.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) schreiben, dass der Teichrohrsänger an den Gewässern Thüringens, die<br />
einigen Rohrbewuchs aufweisen, vorkommt.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land brüten nach GÜNTHER (1969) nicht mehr als 20 BP an den Teichen bei<br />
Frießnitz, Niederpöllnitz und Röpsen. LANGE & LEO (1978) stufen den Teichrohrsänger im Altkreis <strong>Greiz</strong> als<br />
ehemaligen Brutvogel ein. Letztmalig bestand 1971 am Schuttteich Aubachtal Brutverdacht. Im Rahmen der<br />
überregionalen Bestandserfassung 1971/72 wurden ÖLSCHLEGEL (1973) die folgenden Brutplätze gemeldet:<br />
Röpsener Teiche 4 BP, Laasener Teich 1 BP, Sumpfgebiet bei Dorna 4 BP, Frießnitzer See 5 BP, Teichtal<br />
bei Münchenbernsdorf 4 BP, Krähenteiche bei Münchenbernsdorf 4 BP, Eckardtsteich bei<br />
Münchenbernsdorf 1 BP und Weidatal bei Mildenfurth 1 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbe-<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 192
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
stand im Untersuchungsgebiet mit 25 bis 40 BP an. Für diese Schätzung lag eine Zählung von 1997 zugrunde,<br />
bei der 35 sM im gesamten Gebiet ermittelt wurden. Nach LIEDER (2004) und den Daten aus der Datenbank<br />
des VOOG sind aus den letzten 40 Jahren folgende Brutplätze bekannt geworden (Maximalzahl sM):<br />
Gewässer: Röpsener Teiche (4), Hainteich Aga (2), Großer Reichenbacher Teich (12), FND „Teich bei Kauern“<br />
(3), Regenrückhaltebecken Gera-Trebnitz (1), Elster-Wehr Bad Köstritz (1), Speicher Söllmnitz (1),<br />
Teich am Strandbad Aga (1), Teiche Caasen (2), Speicher Baldenhain (1), Teich westlich Hirschfeld (1),<br />
Teiche westlich Lederhose (2), Floßteich Lederhose (3), Straßenteich Kleinbernsdorf (1), Teich am Bad<br />
Münchenbernsdorf (1), RNG Gessenhalde bei Kauern (2), Kläranlage Korbußen (1), Burkersdorfer Feldteich<br />
(2), Weiderteich bei Niederpöllnitz (8), Frießnitzer See (10), Teich westlich Uhlersdorf (3), Straßenteich<br />
Hohenölsen Richtung Loitsch (1), Teich Lehnamühle (1), Teich 600 m NW Steinsdorf (1), RNG Großkundorf<br />
(4), Dorfteich Wolfersdorf (7), Herrenteich Zeulenroda (1), Teich an der B 2 N Muntscha (1), Schuttteich<br />
<strong>Greiz</strong>-Aubachtal (3), Parksee <strong>Greiz</strong> (1), Stausee Dölau (1), Schafteich Untergrochlitz (3), Hammerwiesenteiche<br />
<strong>Greiz</strong>er Park (1), Teich Kölbelmühle (1).<br />
Landschilfflächen: Großsaara (2), Feuchtwiese Struth (1), Leibewiese Dorna (1), Culmitzsch-Aue (4).<br />
Weitere singende Männchen an untypischen Orten abseits von Gewässern waren sicherlich Durchzügler<br />
oder umherstreifende Nichtbrüter.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 50 bis 82 BP geschätzt.<br />
Verbreitungskarte 21: Teichrohrsänger<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Trockenlegung<br />
von Gewässern (Sanierung Wismut-<br />
Bergbaugebiet), Flussbegradigungen,<br />
Trockenlegung von Feuchtgrünland mit<br />
Landschilfröhrichten und Beseitigung der<br />
Röhrichtzone in Gewässern<br />
- Freizeitnutzung an Gewässern (Angeln,<br />
Bootsfahrten, Badebetrieb)<br />
- Belastung der Gewässer mit Nährstoffen<br />
und Bioziden<br />
- Nahrungsverknappung als Folge der<br />
Eutrophierung<br />
- Intensivierung der Fischwirtschaft<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Schutz von Feuchtgebieten,<br />
insbesondere der Röhrichtzonen<br />
- Keine Störungen an den Brutgewässern<br />
durch Freizeitaktivitäten<br />
- Wiedervernässung von ehemaligen<br />
Feuchtwiesen<br />
- Verringerung des Nährstoff- und Schadstoffeintrages<br />
in Gewässer<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 193
Gelbspötter, Hippolais icterina (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gelbspötter<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Gelbspötter als häufigen Brutvogel. LIEBE (1873)<br />
stellte für Gera fest: „hat sich von Jahr zu Jahr merklich gemehrt und ist jetzt sehr häufig.“ Für Ostthüringen<br />
teilt LIEBE (1878) mit: „Der Gartensänger hat sich stetig vermehrt, namentlich in den Thälern der südlichen,<br />
höher gelegenen Gebietstheilen und in den Dörfern zwischen den grösseren Schwarzwaldbeständen, ... sein<br />
Bestand hat sich in den wärmer gelegenen nördlichen Gebietstheilen ungefähr auf das Doppelte, in den<br />
südlichen raueren hingegen auf das Dreifache und im Frankenwald sogar wohl auf das Vierfache vermehrt.“<br />
Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Gartenspötter (Spottvogel). Dieser Meister<br />
im Nachahmen aller möglichen Vogelstimmen und ungemein fleißige Sänger brütet in und um <strong>Greiz</strong> nicht<br />
selten in Gärten und Buschwerk: Park, größere Privatgärten, sonnige Hänge zählen ihn als regelmäßigen<br />
Bewohner. Auch bei Elsterberg (P.). Scheint zugenommen zu haben.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Gelbspötter ein verbreiteter Brutvogel in Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) vermerkt für den Altkreis Gera-Stadt und -Land: „Im Ronneburger Brunnenholz brüteten in<br />
den letzten Jahren 3 bis 4 Paare, im Kreis Gera mögen es über 500 sein.“ BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL<br />
(1971) machen zum Bestand um Auma folgende Angaben: „Der Gelbspötter nistet vereinzelt in Gärten,<br />
Laubwäldern – auch Fichtenaltholz – mit viel Holunderunterwuchs, zum Beispiel am Pfarrteich, in Schrebergärten,<br />
Laubwald bei Wenigenauma, Untendorf sowie im Hirtenholz.“ Im Altkreis <strong>Greiz</strong> war der Gelbspötter<br />
ein häufiger Brutvogel mit 100 bis 200 BP (LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1976/77 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (ÖLSCHLEGEL 1978 a). Auf folgenden Probflächen wurde der Brutbestand ermittelt,<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: Gera-Roschütz, Hain, Cretzschwitz, Brahmenau, Schwaara, Wacholderbaum<br />
und Röpsen auf 1700 ha ca. 80 BP (fehlt jedoch in manchen Jahren fast völlig), Schlosspark Gera-<br />
Tinz auf 2 ha 4 bis 6 BP schwankend, Gera-Zwötzen, Kauern, Loitsch, Falka, Lengefeld auf 600 ha 12 BP,<br />
Stadt Ronneburg auf 150 ha 10 BP, Pölzig (Ort) auf 25 ha 3 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: <strong>Greiz</strong>-Aubachtal auf 140 ha 2<br />
bis 3 BP, Altkreis Zeulenroda: Auma auf 4000 ha 6 bis 7 BP (Zunahme). LANGE & LIEDER (2001) geben den<br />
Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 400 bis 800 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 48 bis 81 Reviere ermittelt<br />
wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Jahre<br />
2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit<br />
geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 5 Reviere des Gelbspötters ermittelt (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 194
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Habitatverlust durch Ausräumung der Landschaft sowie übertriebene Wald- und Gartenpflegemaßnahmen<br />
- Verlust von Auwäldern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Wiederherstellung einer reich gegliederten Kulturlandschaft<br />
- Erhalt mehrstufiger Waldränder<br />
- Wiederherstellung zerstörter Auengebiete<br />
- Wiederherstellung naturbelassener Gärten und unterholzreicher Parks<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 195
Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Mönchsgrasmücke<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Mönchsgrasmücke ein häufiger Brutvogel in der<br />
Umgebung von Gera. Ebenfalls für die Umgebung von Gera schätzt LIEBE (1873) die weitere Bestandsentwicklung<br />
wie folgt ein: „Der Plattmönch hat sich im Verlauf der letzten zehn Jahre sichtlich vermehrt und ist<br />
recht häufig geworden – zumal in den Gehölzen westlich von der Elster.“ Für Ostthüringen trifft LIEBE (1878)<br />
folgende Einschätzung: „Die Mönchsgrasmücke ist im Ganzen genommen gegenwärtig noch seltener wie<br />
vor 40 bis 50 Jahren. Ihr Bestand war in stetigem Rückgang und hatte sein Minimum ungefähr in den Jahren<br />
1866 bis 1869 erreicht, wo er recht auffällig zusammengeschmolzen war. Seit jener Zeit hebt er sich aber<br />
allmählich wieder.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Schwarzköpfige Grasmücke<br />
(Plattmönch, Schwarzplättchen). Dieser vorzügliche Sänger ist die seltenste der bei uns brütenden<br />
Grasmücken.“<br />
1900 bis 1950<br />
In Thüringen ist die Mönchsgrasmücke ein häufiger Brutvogel (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) verweist auf beträchtliche Bestandsschwankungen für den Altkreis Gera-Stadt und -Land:<br />
„Einen Tiefstand im Vorkommen dieser Art konnten wir auch bis in die fünfziger Jahre registrieren, als sie in<br />
manchem Waldgebiet fehlte, wo wir sie heute wieder brütend antreffen. Ihr Bestand mag 300 Paare betragen.“<br />
BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) können im Gebiet um Auma eine Zunahme in den letzten Jahren<br />
feststellen. Vorkommen werden im Untendorfer und Wenigenaumaer Wald, Waldhaus, Ambiwald u.a. genannt.<br />
Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde von LANGE & LEO (1978) eine Zunahme festgestellt. Die Mönchsgrasmücke<br />
war hier ein sehr häufiger Brutvogel mit über 500 BP. In den Jahren 1976/77 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (ÖLSCHLEGEL 1978 c). Auf einigen Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt:<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf sechs Flächen von insgesamt 2437 ha 57 bis 58 BP und auf 2,1 km<br />
Flussstrecke der Weida bei Mildenfurth 8 Reviere, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf einer Fläche von 140 ha 2 bis 3 BP.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 4000 bis 6000 BP an. Für<br />
diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 343 bis 505 Reviere ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 5 bis 10<br />
BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet<br />
Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 43 Reviere der Mönchsgrasmücke<br />
ermittelt (VOOG).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Habitatverlust durch Ausräumung der Landschaft, Entfernung der buschbestandenen Waldränder und<br />
Beseitigung des Unterwuchses in den Wäldern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt einer reich strukturierten Landschaft, Schutz der buschbestandenen Waldränder und des Unterholzes<br />
im Wald<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 196
Gartengrasmücke, Sylvia borin (Bechstein)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gartengrasmücke<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Gartengrasmücke ein häufiger Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Danach nahm der Bestand zu und die Gartengrasmücke wurde nach LIEBE (1873) zur<br />
häufigsten Grasmückenart: „Auch das große Weißkehlchen (die wälsche Grasmücke) hat an Zahl im Ganzen<br />
beträchtlich zugenommen; - namentlich zeichneten sich die Jahre 1869 und 1870 durch große Häufigkeit<br />
dieser Thiere aus. Ihre Zahl mag jetzt noch im Ganzen etwa doppelt so groß sein wie die der schwarzköpfigen<br />
Grasmücken, so daß man sie als sehr häufig bezeichnen kann.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE (1878)<br />
mit: „Der Bestand der Gartengrasmücken hat sich im Ganzen genommen erheblich gehoben. Im waldarmen<br />
Nordosten, im altenburgischen Ostkreis sind in allen Dörfern ihrer mehr geworden. Im übrigen Gebiete habe<br />
ich und viele Andere eine Abnahme in der nächsten Umgebung der Dörfer vielfach beobachtet, dagegen<br />
aber auch eine im Verhältnis zur Abnahme weit stärkere Zunahme in den niedrigen Schwarzholzschlägen.“<br />
Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Bis 1881 im Park und größeren Privatgärten<br />
regelmäßiger und nicht eben seltener Brutvogel, scheint sich dieser ausgezeichnete Sänger, vielleicht<br />
der vielen Katzen und des Lärmes wegen, nach ungestörten Plätzen zurückgezogen zu haben.“<br />
1900 bis 1950<br />
HIRSCHFELD (1932) stellte eine Abnahme in Dörfern und eine Zunahme in den Wäldern (Nadelholzschonungen)<br />
fest. Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist die Gartengrasmücke ein häufiger Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schreibt für den Altkreis Gera-Stadt und -Land: „Heute sind Gartengrasmücken in Gehölzen,<br />
besonders in Laubwäldern mit Unterholz und in Fichtenschonungen stark vertreten. In Ortschaften brüten<br />
sie nur vereinzelt. Insgesamt haben wir mit etwa 2000 Brutpaaren zu rechnen.“ Nach BARNIKOW, SCHÜTZ<br />
& STÖßEL (1971) ist die Gartengrasmücke um Auma die häufigste Grasmückenart. Auch LANGE & LEO (1978)<br />
bezeichnen sie als häufigste Grasmückenart im Altkreis <strong>Greiz</strong>. In den Jahren 1976/77 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (ÖLSCHLEGEL 1978 b). Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt:<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf fünf Flächen von insgesamt 2395 ha 228 bis 234 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf<br />
einer Fläche von 140 ha 5 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 3500 bis 5500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen<br />
1995 und 2000 zugrunde, bei der 320 bis 455 Reviere ermittelt wurden. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung<br />
im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden<br />
26 Reviere der Gartengrasmücke ermittelt (VOOG).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Habitatverlust durch Ausräumung der Landschaft, Entfernung der buschbestandenen Waldränder und<br />
Beseitigung des Unterwuchses in den Wäldern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt reich strukturierter Landschaften, Schutz der buschbestandenen Waldränder und des Unterholzes<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 197
Klappergrasmücke, Sylvia curruca (Bechstein)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Klappergrasmücke<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Klappergrasmücke ein sehr häufig Brutvogel in der<br />
Umgebung von Gera. Sie wurde damals als häufigste Grasmückenart eingestuft. Danach muss wohl eine<br />
Abnahme erfolgt sein, denn LIEBE (1873) teilt mit: „Der Zaunhitscher (die kleine Grasmücke) den das<br />
Verzeichniß von 1859 als ,sehr häufig‘ aufführt, ist weniger zahlreich geworden und nur noch ,häufig‘ zu<br />
nennen.“ Die Abnahme muss sich weiter fortgesetzt haben, denn später schreibt LIEBE (1878): „Die Klappergrasmücke,<br />
früher ein im Gebiet gemeiner Vogel, ist jetzt gar nicht mehr so häufig. An der starken und<br />
stetigen Abnahme ist neben den schon oben besprochenen Witterungsverhältnissen und neben der Zunahme<br />
des rothen Würgers [Neuntöter] die eben erwähnte Ausrodung der Dornhecken auf den Rändern<br />
schuld und der Umstand, dass die Klappergrasmücken die Nähe der menschlichen Wohnungen weit lieber<br />
aufsuchen, wie die Dorngrasmücken. Hier aber schaden die Katzen erheblich ...“. Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Zaungrasmücke (Müllerchen). Häufiger Brutvogel der gesamten<br />
Umgebung in Büschen der Feld-, Wald- und Wiesenränder, lebenden Zäunen.“<br />
1900 bis 1950<br />
In den Wäldern sowie in den Gärten ganz Thüringens war die Klappergrasmücke ein häufiger Brutvogel<br />
(HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
Im Vergleich zur Bestandsentwicklung im 19. Jahrhundert stellt GÜNTHER (1969) für den Altkreis Gera-Stadt<br />
und -Land fest: „Eine Zunahme scheint bis heute ausgeblieben zu sein. Es brüten einige hundert Paare im<br />
Gebiet. Sie wählen Dornhecken, anderes dichtes Buschwerk und Fichtenschonungen für ihren Neststand<br />
und finden sich auch gern in den Ortschaften ein.“ Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Klappergrasmücke<br />
um Auma in Schrebergartenanlagen, in der Leschke und im Untendorfer Wald häufig und in<br />
anderen Flurteilen seltener als die anderen Grasmückenarten. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde der Bestand der<br />
Klappergrasmücke auf unter 500 BP geschätzt (LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1975/76 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (ÖLSCHLEGEL 1978 e). Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt<br />
ermittelt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf vier Flächen von insgesamt 2385 ha 42 bis 62 BP, Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong>: auf einer Fläche von 140 ha 5 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 1000 bis 1500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 82<br />
km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 98 bis 129 Reviere ermittelt wurden. Im 60 ha großen<br />
<strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Habitatzerstörung durch Beseitigung von Hecken und Flurgehölzen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Neuanlage von Hecken und Flurgehölzen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 198
Dorngrasmücke, Sylvia communis (Temminck)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Dorngrasmücke<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Dorngrasmücke ein häufiger Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) stellte eine Abnahme fest: „Der kleinen Weißkehlchen sind in den letzten<br />
Jahren eher weniger als mehr geworden. Wenn sie auch immer noch als häufig aufgeführt sind, so sind sie<br />
doch entschieden weit weniger zahlreich als die Gartengrasmücken. Sie lieben vorzugsweise die östlichen<br />
Seitenthäler der Elster.“ Für Ostthüringen trifft LIEBE (1878) folgende Einschätzung: „Die Dorngrasmücke ist<br />
nicht ganz so häufig im Gebiet und verteilt sich anders wie die Gartengrasmücke, denn sie zieht die waldarmen<br />
und milderen Gegenden vor, - eine auffallende Erscheinung, wenn man bedenkt, dass ihr Verbreitungskreis<br />
weiter nach Norden hinaufreicht als derjenige ihrer Verwandten. Ihr Bestand ist nach und nach<br />
geringer geworden.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Dorngrasmücke<br />
(Weißkehlchen, Staudenklitscher). Wie vorige [Klappergrasmücke] und an denselben Orten, vielleicht etwas<br />
sparsamer vertreten.“<br />
1900 bis 1950<br />
In der Umgebung von Hohenleuben war die Dorngrasmücke ein häufiger Brutvogel (HIRSCHFELD 1932).<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist die Dorngrasmücke häufiger Brutvogel des offenen Geländes in<br />
ganz Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) nennt die Dorngrasmücke einen häufigen Brutvogel mit etwa 1000 BP im Altkreis Gera-<br />
Stadt und -Land. Auf einer Kontrollfläche mit Feldern und Wiesen bei Großenstein wurden je Quadratkilometer<br />
3 BP gezählt. Im Gebiet um Auma kommt die Dorngrasmücke überall außerhalb der Wälder vor<br />
BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971). LANGE & LEO (1978) bemerkten eine geringfügige Abnahme im Altkreis<br />
<strong>Greiz</strong> und schätzen den Bestand auf unter 500 BP ein. In den Jahren 1976/77 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (ÖLSCHLEGEL 1978 d). Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt:<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf zwei Flächen von 2300 ha 25 bis 35 BP, auf zwei weiteren Flächen in<br />
Pölzig und im Erlicht bei Reust 0 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf einer Fläche von 140 ha 3 BP und Altkreis<br />
Zeulenroda: auf einer Fläche von 4000 ha 10 BP. Dabei schätzt ÖLSCHLEGEL ein, dass noch vor wenigen<br />
Jahren ein wesentlich höherer Dorngrasmückenbestand vorhanden war. LANGE & LIEDER (2001) geben den<br />
Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 1000 bis 1500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 97 bis 169 Reviere ermittelt<br />
wurden. Nach einem Bestandstief zwischen 1970 und 1990 konnten die Autoren auf eine erneute Zunahme<br />
verweisen. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE<br />
2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 115 ha<br />
ökologisch wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier wurden 33 Reviere<br />
der Dorngrasmücke ermittelt (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 199
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Habitatverlust durch Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung und veränderte Landnutzung;<br />
insbesondere Verlust von Feldgehölzen, Hecken, Gras- und Kräutersäume sowie Ödland und Brachflächen<br />
- Verlust des Lebensraumes durch Bebauung von Ödland und Sanierung der Bergbaugebiete des Uran-<br />
Bergbaus<br />
- Mahd von Wegrändern, Bach- und Grabenrändern zur Brutzeit<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Neuschaffung geeigneter Lebensräume durch Extensivierung in der Landwirtschaft,<br />
Umsäumung der Felder mit Hecken und Ruderalstreifen sowie Belassen von Brachflächen<br />
- Schaffung von Ausgleichsflächen bei Verlust durch Bebauung und Bergbausanierung<br />
- Keine Mahd der Wege-, Bach- und Grabenränder zur Brutzeit<br />
- Erhalt von Sekundärlebensräumen wie Sand- und Kiesgruben<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 200
Wintergoldhähnchen, Regulus regulus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Wintergoldhähnchen<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) stuft das Wintergoldhähnchen als sehr häufigen Brutvogel um<br />
Gera ein. Auch nach LIEBE (1873) ist die Art um Gera häufig: „Die safranköpfigen Goldhähnchen haben<br />
ebenfalls unter dem Einfluß der vorher erwähnten Winter arg gelitten, wenn auch nicht in dem Maße wie die<br />
Zaunkönige. Auch ist ihnen in den letzten beiden Jahren wieder viel Brut zugewachsen, so daß man sie als<br />
häufig bezeichnen kann.“ Für Ostthüringen trifft LIEBE (1878) folgende Einschätzung: „So viel hat sich aber<br />
doch bei meinen vielfachen Beobachtungen herausgestellt, dass der Bestand des Gelbköpfchens in den<br />
Nadelwaldregionen des westlichen Ostthüringens derselbe geblieben ist, dagegen im Osten, wo fast überall<br />
und vorzugsweise auf Kgl. sächsischem Boden gerodet worden ist, mit den Nadelwäldern selbst stark abgenommen<br />
hat.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Gelbköpfiges Goldhähnchen.<br />
Nicht seltener regelmäßiger Brutvogel bei Dölau, Caselwitz, Rothental, im Göltzschtale, am Hirschstein<br />
bei Gommla, Elsterberg.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist das Wintergoldhähnchen als häufiger Brutvogel in ganz Thüringen<br />
verbreitet und überall häufig.<br />
Ab 1950<br />
Nach WERNER (1964) siedelten 12 bis 17 BP im Gebiet der Weidatalsperren von 1954 bis 1958. GÜNTHER<br />
(1969) bezeichnet die Art als häufiger Brutvogel unserer Nadelwälder und schätzt den Bestand vorsichtig<br />
auf 1000 BP. Im Aumaer Gebiet ist das Sommergoldhähnchen nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971)<br />
häufig und übertrifft das Vorkommen des Sommergoldhähnchens um ein Vielfaches. (LANGE & LEO 1978)<br />
schätzen im Altkreis <strong>Greiz</strong> den Bestand auf mehr als 100 BP. In den Jahren 1976/77 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1978 a). Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt:<br />
auf 10 ha Laubwald bei Pölzig 0 BP, auf 3 ha Laubwald mit Fichten NE von Gera 5 bis 7 BP, auf 10 ha<br />
Laubmischwald mit 3 ha Fichtenaltholz SE von Gera 2 BP, auf 7 ha Laubwald SE von Gera 0 BP, auf 25 ha<br />
Fichtenaltholz bei Reust 3 BP, auf 25 ha in einem 10 bis 30-jährigen Fichten-Kiefernwald bei Auma 3 BP.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 2000 bis 5000 BP an.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Kollision durch Anflug an Freileitungen, Windenergieanlagen, Hausfronten u.ä.<br />
- Immissionsschäden in den Nadelwäldern mit Verringerung des Nahrungsangebotes und des ausreichenden<br />
Schutzes<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wirksame Eindämmung der Schadstoffimmissionen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 201
Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapilla (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Sommergoldhähnchen<br />
Foto: S. Ott/Fotonatur.de<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt das Sommergoldhähnchen nicht als Brutvogel auf und<br />
schreibt: „Sylvia ignicapilla, feuerköpfiges Goldhähnchen, soll sehr einzeln nur vorgekommen sein.“ Diese<br />
Einschätzung teilt LIEBE (1873) nicht: „Das feuerköpfige Goldhähnchen, welches zur Herbstzeit in wärmere<br />
Gegenden zieht, ist jenen Einflüssen [kalte Winter] nicht ausgesetzt gewesen und daher schreibt sich vielleicht<br />
seine jetzt größere Häufigkeit. Im Bericht von 1859 ist es als sehr selten oder fraglich aufgeführt. Ich<br />
habe es vorzugsweise in den kleinen Nadel-Feldgehölzen der Buntsandsteinregion unseres Gebietes häufig<br />
genug beobachtet.“ Für Ostthüringen stellt LIEBE (1878) eine Zunahme fest: „Das Feuerköpfchen war in<br />
früherer Zeit weit seltener als das Gelbköpfchen, in den tiefer gelegenen Gegenden geradezu eine Seltenheit.<br />
Jetzt ist es weit häufiger als sonst und namentlich auch in kleinen Feldgehölzen zu finden.“ Nach seinen<br />
Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Feuerköpfiges Goldhähnchen. Seltener als der<br />
vorige: bei Caselwitz und bei der Papiermühle brütend gefunden; Pöllwitz, Fröbersgrün, Tremnitz (P.).“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist das Sommergoldhähnchen in ganz Thüringen verbreitet mit Unterschieden<br />
in der Häufigkeit: „In der Umgebung Altenburgs trifft man es im Sommer nur wenig, in den ausgedehnten<br />
Nadelwäldern des Buntsandsteingebietes zwischen Elster und Saale häufiger und im Thüringer<br />
Wald und in der Rhön ebenso häufig wie das Wintergoldhähnchen.“ In der Umgebung von Hohenleuben<br />
war es seltener als das Wintergoldhähnchen (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Nach WERNER (1964) siedelten 10 bis 14 BP (0,5 – 0,8 BP/10 ha) im Gebiet der Weidatalsperren von 1954<br />
bis 1958. Auch GÜNTHER (1969) kommt zu der Feststellung, dass diese Art im Altkreis Gera seltener ist als<br />
das Wintergoldhähnchen. Er verweist lediglich auf Brutzeitbeobachtungen bei Weida, Münchenbernsdorf,<br />
westlich von Gera, bei Bad Köstritz und im Ronneburger Forst. Im Gebiet um Auma ist das Vorkommen<br />
unregelmäßig und gering (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971). Ständige Vorkommen befinden sich in der<br />
Leschke und im Braunsdorfer Wald. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> war die Art etwas spärlicher als das Wintergoldhähnchen<br />
(LANGE & LEO 1978). 1976/77 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1978 b). Auf<br />
Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt: auf 10 ha Laubwald bei Pölzig 0 BP, auf 28 ha Fichtenforsten<br />
bei Gera-Ernsee 9 BP, auf 550 ha Laubwald und Mischwald NE von Gera 0 BP, auf 10 ha<br />
Laubmischwald mit 3 ha Fichtenaltholz SE von Gera 1 BP, auf 7 ha Laubwald SE von Gera 0 BP, auf 25 ha<br />
Fichtenaltholz bei Reust 2 BP, auf 25 ha im 10 bis 30 jährigen Fichten-Kiefernwald bei Auma 1 BP. LANGE<br />
& LIEDER (2001) schätzen den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 2000 bis 3000 BP ein. Im 60 ha<br />
großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Immissionsschäden in den Nadelwäldern mit Verringerung von Nahrung und ausreichenden Schutzes<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wirksame Eindämmung der Schadstoffimmissionen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 202
Kleiber, Sitta europaea (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Kleiber<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Um Gera war der Kleiber ein sehr häufiger Brutvogel (Ornithologische Sektion Gera 1859). LIEBE (1873)<br />
schreibt: „Die Spechtmeisen haben in den letzten harten Wintern furchtbar gelitten. Der Winter von 1870 auf<br />
1871 ließ nur noch einzelne Exemplare zurück, und seit der Zeit ist der frühere gute Bestand noch lange<br />
nicht erreicht, obgleich unser Gebiet diesen Thieren in seinen Eichenbeständen und älteren Waldungen<br />
recht zusagenden Aufenthalt darbieten.“ Diese Abnahme muss nach LIEBE (1878) über einen längeren Zeitraum<br />
erfolgt sein: „Die Spechtmeise ist leider noch recht selten, obgleich in den letzten zwei Jahren eine<br />
kleine Zunahme nicht zu verkennen ist. Ehedem war es anders. Da waren sie recht häufig und belebten im<br />
Winter mit ihren muntern Lockrufen und mit dem Gefolge von kleinen Meisen den Wald auf das köstlichste.<br />
Schon vor 30 Jahren jedoch bemerkte ich eine Abnahme, und seit jener Zeit nahm der Bestand sprungweise<br />
ab, bis er nach dem Winter von 1870 auf 1871 auf ein Minimum reduciert war. Da die Thiere den Laub- oder<br />
gemischten Wald gegenüber dem reinen Nadelwald bevorzugen, ist in letzterem ihre Abnahme noch weit<br />
auffälliger wie dort; ich durchwandere jetzt oft wochenlang die Schwarzhölzer des westlichen und südlichen<br />
Ostthüringens, ehe ich einmal eine Spechtmeise höre, und auch im Norden bei Gera, Ronneburg und<br />
Weida, wo im Winter vielfach Futterplätze etabliert werden, halten sie sich jetzt doch noch recht vereinzelt<br />
auf." Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Spechtmeise (Kleiber). Nicht selten:<br />
...“.<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezeichnen den Kleiber als regelmäßigen Brutvogel Thüringens.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt den Bestand im Altkreis Gera auf 300 BP. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971):<br />
„Besonders in den alten Buchen-Eichen-Mischbeständen des Untendorfer Waldes recht häufiger Brutvogel.<br />
Der Bestand scheint in den letzten Jahren etwas zugenommen zu haben.“ Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> wurden<br />
300 BP geschätzt (LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1980/81 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
auf Probflächen (WOLF 1983 a) mit folgendem Ergebnis statt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf sieben Fläche<br />
mit 222,5 ha 21 bis 22 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf drei Flächen mit 82 ha 16 bis 20 BP. LANGE & LIEDER<br />
(2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 1500 bis 2000 BP an. Für diese Schätzung<br />
lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, beim der 132 bis<br />
177 Reviere ermittelt wurden. BAUM stellte 1988 im 8,1 ha großen NSG "Buchenberg" bei Weida 3 BP fest.<br />
LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) kamen 2009 im gleichen Gebiet auf 5 BP. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurden 10 bis 12 BP 1980, 12 BP 2001, 12 BP 2003 und 9 BP 2006 ermittelt (WOLF 1983; LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust des Lebensraumes durch starken Holzeinschlag in Altholzbeständen<br />
- Umwandlung der Laub- und Mischwälder in Nadelwälder<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt von Altholzinseln und verlängerte Umtriebszeiten in den Waldgebieten<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 203
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
- Anbringen von Nistkästen in forstlich stark genutzten Wäldern mit wenig Spechthöhlen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 204
Waldbaumläufer, Certhia familiaris (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Waldbaumläufer<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Baumläufer als sehr häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Eine Unterscheidung nach Wald- und Gartenbaumläufer erfolgte auch bei LIEBE und späteren<br />
<strong>Ornithologen</strong> bis 1919 nicht (siehe Erläuterungen beim Gartenbaumläufer). Nach LIEBE (1873) sind die<br />
Baumläufer wieder zahlreich als Brutvögel um Gera vertreten. Für Ostthüringen gibt LIEBE (1878) an: „Der<br />
Bestand der Baumläufer ist auffällig gleich geblieben.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt<br />
HELLER (1926): „Baumläufer (Baumrutscher). Häufiger Brutvogel in allen größeren Gärten, namentlich Obstgärten.<br />
(Eine Trennung von C. familiaris und C. brachydactyla, Garten- und Waldbaumläufer ist in meinen<br />
früheren Aufzeichnungen nicht geschehen. Wahrscheinlich kommen beide Arten vor).“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Waldbaumläufer ein verbreiteter Brutvogel in ganz Thüringen.<br />
HIRSCHFELD (1932) beobachtete die Art nur selten in der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt den Bestand der Waldbaumläufer im Altkreis Gera auf wenige Paare. Sie treten nur<br />
westlich der Elster regelmäßig auf, wobei Nachweise bei Bad Köstritz und im Aumatal genannt werden. Für<br />
das Gebiet um Auma teilen BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) mit: „Der Waldbaumläufer ist jetzt recht<br />
selten festgestellt worden. Singende Männchen wurden besonders im Braunsdorfer Wald, in der Wolge sowie<br />
bei Wüstenwetzdorf verhört.“ Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde der Bestand auf 100 BP geschätzt (LANGE & LEO<br />
1978). Das Hauptvorkommen befindet sich im <strong>Greiz</strong>-Werdauer Wald. Im Jahr 1980 fand eine überregionale<br />
Erfassung statt (FLÖßNER1983 b). Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt: Altkreis Gera-<br />
Stadt und -Land: auf 25 ha Fichtenforsten bei Reust 1 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 22 ha Mischwald bei <strong>Greiz</strong>-<br />
Aubachtal 0 bis 1 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 500<br />
bis 800 BP an. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten 2009 auf 8,1 ha im NSG "Buchenberg" bei Weida 3<br />
BP fest. Für den 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurden 2 bis 3 BP ermittelt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensiver Holzeinschlag in Altholzbeständen und kurze Umtriebszeiten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verlängerung der Umtriebszeiten<br />
- Erhalt von Totholz<br />
- Verzicht von Bioziden bei der Bekämpfung von Insektenkalamitäten<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 205
Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gartenbaumläufer<br />
Foto: G. Rossen/Fotonatur.de<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
C. L. BREHM hat den Gartenbaumläufer 1816 als eigenständige Art entdeckt und in seinen „Beiträgen zur<br />
Vogelkunde“ 1820 und 1822 ausführlich beschrieben. Die neu beschriebene Art wurde von BREHM bei Jena,<br />
Eisenberg, Zeitz und in einem großen Teil von Thüringen gefunden (BREHM 1830). (BREHM 1830). Von vielen<br />
<strong>Ornithologen</strong> wurde der Gartenbaumläufer zunächst nicht vom Waldbaumläufer unterschieden, so dass entsprechende<br />
Mitteillungen über das Vorkommen der Art fehlen bzw. nur auf einen der beide Baumläuferarten<br />
zutreffen. Fast hundert Jahre später fand die Art unter den Systematikern allgemeine Anerkennung (STRE-<br />
SEMANN 1919). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Baumläufer (Baumrutscher).<br />
Häufiger Brutvogel in allen größeren Gärten, namentlich Obstgärten. (Eine Trennung von C. familiaris und C.<br />
brachydactyla, Garten- und Waldbaumläufer ist in meinen früheren Aufzeichnungen nicht geschehen. Wahrscheinlich<br />
kommen beide Arten vor).“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezeichnen den Gartenbaumläufer als verbreiteten Brutvogel in ganz Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt den Bestand des Gartenbaumläufers im Altkreis Gera-Stadt und -Land auf 300 BP.<br />
Im Gebiet um Auma ist er überall vertreten (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde der<br />
Bestand auf 200 bis 300 BP geschätzt (LANGE & LEO 1978). Anfang der 1980er-Jahren fand eine überregionale<br />
Erfassung statt (FLÖßNER 1983 c). Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt, Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land: auf acht Flächen mit insgesamt 164 ha 21 bis 23 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf zwei Flächen<br />
mit insgesamt 72 ha 8 bis 11 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 1000 bis 1500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche<br />
zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 53 bis 91 Reviere ermittelt wurden. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER<br />
(2010) stellten 2009 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei Weida 5 BP fest. Für den 60 ha großen<br />
<strong>Greiz</strong>er Park wurden 2 bis 5 BP ermittelt (LUMPE 2008).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 206
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensiver Holzeinschlag in Altholzbeständen und kurze Umtriebszeiten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Verlängerung der Umtriebszeiten<br />
- Erhalt von Totholz<br />
- Verzicht von Bioziden bei der Bekämpfung von Insektenkalamitäten<br />
- Schutz von Streuobstwiesen und<br />
- Erhalt der Auwälder<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 207
Zaunkönig, Troglodytes troglodytes (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Zaunkönig<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt den Zaunkönig als häufigen Brutvogel um Gera auf. LIEBE<br />
(1873) teilt mit, daß die früher recht häufigen Zaunkönige infolge strenger Winter, insbesondere 1870/71, viel<br />
seltener geworden sind. Für Ostthüringen stellt LIEBE (1878) fest: „Der Zaunkönig ist jetzt von den Niederungen<br />
bis zu den höchsten Punkten des Frankenwaldes hinauf überall eben so häufig wie ehedem. Sein Bestand<br />
unterliegt aber beträchtlichen Schwankungen, und es gab Jahre (wie z.B. 1871 und 1872, 1863 u. d.<br />
folg., 1845 u. d. folg.), wo er sehr stark reducirt war. Plötzlich eintretendes Schneegestöber mit darauf folgender<br />
strenger Kälte schaden dem Vogel, so sehr dieser gegen die Unbilden des Wetters gestählt ist, –<br />
wohl hauptsächlich durch den Nahrungsmangel.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER<br />
(1926): „Zaunkönig (Zaunschlüpfer, Schneikönig). Im ganzen Elstertale, namentlich aber in den kleinen Seitentälern,<br />
brütet dieser ,Zwerg mit der Riesenstimme‘ alljährlich und ist auch regelmäßig im Winter zu finden.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezeichnen den Zaunkönig als verbreiteten und häufigen Brutvogel in ganz<br />
Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) verweist auf einen Rückgang im Altkreis Gera-Stadt und -Land Ende der 1960er-Jahre,<br />
wohl als Folge strenger Winter: „So ist auch das derzeitige Vorkommen noch schwächer, als es vor einem<br />
Jahrzehnt mit etwa 600 Paaren war.“ Ebenso hatte der Zaunkönig im Gebiet um Auma in den 1960er-Jahren<br />
abgenommen (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde der Bestand auf etwa 200 BP<br />
geschätzt (LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1980/81 fand eine überregionale Erfassung statt (WOLF 1983).<br />
Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf fünf Flächen<br />
von insgesamt 470 ha 26 bis 31 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf einer Fläche von 22 ha 2 bis 3 BP, Altkreis<br />
Zeulenroda: auf einer Fläche von 1600 ha 20 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im<br />
Untersuchungsgebiet mit 2000 bis 3000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf<br />
91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 131 bis 188 Reviere ermittelt wurden. BAUM stellte<br />
1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei Weida 2 BP fest. Auf der gleichen Fläche fanden 2009<br />
LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) 4 BP. Für den 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurden 5 bis 10 BP ermittelt<br />
(LUMPE 2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf<br />
145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 14 Reviere des Zaunkönigs gefunden<br />
(VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 208
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Durchforstung der Wälder zur Brutzeit<br />
- Prädation durch Hauskatzen<br />
- Verluste an Freileitungen und im Straßenverkehr<br />
- Störung durch Freizeitaktivitäten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Keine Durchforstungsarbeiten zur Brutzeit<br />
- Dezimierung freilaufender Hauskatzen<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 209
Star, Sturnus vulgaris (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Star<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach LIEBE (1873) war der Star zur damaligen Zeit häufiger Brutvogel mit Bestandseinbrüchen durch Witterungsunbilden:<br />
„Auch die Staare sind durch die Nachwinter der letzten Jahre gelichtet worden. Da sie aber<br />
gehegte Kulturvögel sind, so wird ihr Bestand in kürzester Zeit wieder der Frühere, starke sein.“ Eine allgemeine<br />
Zunahme stellte LIEBE 1878 fest: „Die Staare haben sich während des letzten halben Jahrhunderts<br />
ebenfalls ausserordentlich vermehrt. Ihre Zahl hat sich im Gebiet während dieser Zeit mindestens vervierfacht,<br />
obgleich hier schon zu Anfang dieses Jahrhunderts fast allenthalben Brutkästen für sie aufgerichtet<br />
wurden.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr verbreiteter, allgemein bekannter<br />
Brutvogel.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Star verbreiteter und häufiger Brutvogel in ganz Thüringen.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) den Bestand auf mehrere Tausend BP. Für das<br />
Gebiet um Auma wird der Star als häufiger Brutvogel angegeben (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971).<br />
Ebenso wird der Star im Altkreis <strong>Greiz</strong> als sehr häufiger Brutvogel mit mehreren Tausend BP eingeschätzt<br />
(LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1977/1978 fand eine überregionale Erfassung statt (GÜNTHER 1979 d).<br />
Auf Probflächen wurde der Brutbestand wie folgt ermittelt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf sieben Flächen<br />
von insgesamt 432 ha 87 bis 92 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf einer Fläche von 22 ha 40 BP, Altkreis Zeulenroda:<br />
auf einer Fläche von 6 ha 15 BP. Weiterhin wurde bei Auma auf je 10 ha Fichtenwald 1 BP festgestellt. Um<br />
1980 setzte vielerorts ein Bestandsrückgang ein, den GÜNTHER (1989) näher untersucht hat:<br />
Ort Größe in ha BP 1977/78 BP 1984 BP 1988<br />
Weinberg bei Gera 72 12 15 16<br />
Aubachtal bei <strong>Greiz</strong> 22 40 (1972) 40 35<br />
Untendorfer Wald 6 15 8 8<br />
Erlicht bei Reust 25 5 3 0 (Holzeinschlag)<br />
Ronneburg 2 7 ? 3<br />
Großenstein 72 20 16 11<br />
Summe 199 99 82+ 73<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 6000 bis 8000 BP an. Für<br />
diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 578 bis 770 Reviere ermittelt wurden. BAUM stellte 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 210
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Weida 8 BP fest. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) fanden 2009 im gleichen Gebiet 7 BP. Für den 60 ha<br />
großen <strong>Greiz</strong>er Park wurden 15 bis 20 BP ermittelt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung (Wiesenumbruch, Aufgabe der<br />
Weidewirtschaft, Drainage, Aufforstung von Feuchtwiesen, Zunahme der Monokulturen, Rodung von<br />
Streuobstwiesen)<br />
- Hoher Einsatz von Bioziden und Düngemitteln<br />
- Verluste im Straßenverkehr und Anflug an Leitungsdrähte und Windenergieanlagen<br />
- Durchforstung von Altholzbeständen und kurze Umtriebszeiten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft<br />
- Erhalt und Neuanlage von Weideflächen und großen Grünlandflächen<br />
- Schutz von höhlenreichen Altholzbeständen und Verlängerung der Umtriebszeiten<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 211
Wasseramsel, Cinclus cinclus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Wasseramsel<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) fand die Wasseramsel im Thüringer Wald und im Vogtland an allen Bächen und kleinen<br />
Flüssen. Nach Mitteilung der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Wasseramsel ein seltener<br />
Brutvogel bei Töppeln, Gera-Liebschwitz und Berga. Wahrscheinlich machte sich ein Bestandrückgang<br />
durch Gewässerverschmutzung schon im 19. Jahrhundert bemerkbar. Nach LIEBE (1873) scheint die Art<br />
„früher etwas häufiger gewesen zu sein“. LIEBE (1873) zu Brutvorkommen: „Regelmäßig brütend habe ich<br />
in den letzten Jahren gesehen ein Paar in der Nähe der Mühle von Töppeln, eins zwischen Wünschendorf<br />
und Berga und eins im Weidathal zwischen Döhlen und der Naddelmühle. Auch im Raudathal und im<br />
Wipsenthal sah ich zuweilen während der Brutzeit ein Paar.“ Etwas später war die Wasseramsel seltener<br />
geworden, denn LIEBE (1878) schreibt: „So hat er [der Wasserschmätzer] das Gebiet der Mulde im Osten<br />
und den Norden von Ostthüringen fast ganz verlassen und findet sich nur noch in vereinzelten Pärchen<br />
und nicht alljährlich an der Göltsch, Orla, im Bereich der oberen Elster und mittlern Saale u. s. w.“ Nach<br />
seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Bachamsel (Wasseramsel, Wasserstar). Dieser<br />
schmucke, muntere Vogel belebte früher alle klaren Bäche und Flüsse (Elster und Zuflüsse). Nach Verseuchung<br />
derselben durch Fabrikabwässer ist er verschwunden und nur zufällig findet man noch ein Pärchen<br />
an einem reingebliebenen Wasserlaufe. Als z. Zt. einzigen Brutplatz kenne ich das Triebtal (2 Paare),<br />
wo ihn Pietzold noch 1923 brütend antraf.“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) fanden die Wasseramsel nur noch regelmäßig an den Bächen des Buntsandsteingebietes<br />
zwischen Elster und Saale. Um 1930 kannte HIRSCHFELD (1932) einen besetzten Brutplatz<br />
an der Weißen Elster im Bereich der Clodramühle, während ein Vorkommen an der Weida schon um<br />
1920 erloschen war.<br />
Ab 1950<br />
Nach CREUTZ (1966) bestand ein Vorkommen in den 1960er-Jahren an der Triebes. 1966 siedelte sich ein<br />
Paar bei Weida an und brütete dort alljährlich (GÜNTHER 1969). Für das Gebiet um Auma wird nur die Beobachtung<br />
einer Wasseramsel im Mai 1968 am Aumaer Wehr angegeben (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL<br />
1971). Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde 1972 eine Brut am Triebitzbach bei Elsterberg gefunden. Danach fehlen<br />
weitere Beobachtungen (LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1980/1981 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (FLÖßNER 1983 a). Folgende Vorkommen werden aus unserem Untersuchungsgebiet genannt:<br />
1 BP an der Auma oberhalb von Weida von 1966 bis 1975, 1 BP am Triebitzbach bei Elsterberg<br />
1972 und 1 BP am Tremnitzbach bei Elsterberg 1972 (?) und ab 1979. LANGE & LIEDER (2001) machen<br />
folgende Aussage: „Bis 1985 bestanden Brutvorkommen an der Auma bei Weida und den Nebenbächen<br />
der Elster bei <strong>Greiz</strong>. Nach dem Bau vieler Kläranlagen und der Verbesserung der Wasserqualität der<br />
Fließgewässer nach 1990 kam es ab 1992 zur erneuten Ausbreitung der Wasseramsel, die noch anhält.<br />
Gegenwärtig ist mit 15 bis 20 BP zu rechnen (Weiße Elster flussabwärts bis Neumühle, unteres<br />
Göltzschtal, Erlbach, Saarbach, Auma und Triebes).“ Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />
2005 bis 2009 wurden 40 bis 59 BP geschätzt. Der positive Trend scheint sich weiter fortzusetzen.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 212
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverschlechterung und -zerstörung durch Flussverbauung, Gewässerverschmutzung, Belastung<br />
mit Umweltchemikalien, Beseitigung von Ufergehölzen und Wasserentzug an Fließgewässer<br />
- Mangel an Brutmöglichkeiten durch Abriss oder Sanierung von Gebäuden und Brücken an Gewässern<br />
- Störung am Brutplatz durch Freizeitaktivitäten<br />
- Direkte Störung an Brutplätzen mit Vernichtung der Brut<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt naturnaher Flusslandschaften<br />
- Keine Verbauung der Gewässer<br />
- Minderung des Eintrages von Abwässern und Umweltchemikalien<br />
- Erhalt von Brutmöglichkeiten an gewässernahen Bauwerken<br />
- Anbringen spezieller Wasseramselnistkästen an geeigneten Stellen<br />
- Keine Störung am Brutplatz durch Freizeitaktivitäten<br />
- Ahndung illegaler Verfolgung<br />
Verbreitungskarte 22: Wasseramsel<br />
1<br />
2 – 3 4 – 7<br />
1 1<br />
1 2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
1<br />
2 – 3<br />
1<br />
1 1<br />
1<br />
4 – 7<br />
1<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 213
Misteldrossel, Turdus viscivorus (Pallas)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Misteldrossel<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) kannte die Misteldrossel als sehr häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Diese Häufigkeitseinschätzung war sicherlich übertrieben. LIEBE (1873) schreibt: „Der<br />
Schnärr hat sich in den letzten 10 Jahren in seinem Bestand sehr gleichmäßig erhalten: er brütet nicht<br />
eben häufig in den Nadelwäldern des engeren Gebiets von Gera, und etwas häufiger in denen des weiteren<br />
Gebiets. Im engeren Gebiet habe ich immer gegen 10 heimische Paare beobachtet, - ein Paar davon<br />
in einem Laubwäldchen bei Tröbnitz [Trebnitz].“ Für Ostthüringen gibt LIEBE (1878) an, dass der Bestand<br />
gleichmäßig geblieben sei, wobei es zu Änderungen im Lebensraum der Misteldrossel kam: „Da, wo ihm<br />
ein Schwarzwald durch Ausrodung entzogen wurde, verlegt er seinen Brutplatz in eine von dem Wald übrig<br />
gebliebene Schlucht mit bewaldeten Rändern, oder in ein benachbartes kleines Feldgehölz oder endlich<br />
sogar in seltenen Fällen in grössere Obstgärten, woselbst er in dem äussern Zweiggewirr der höchsten<br />
Apfelbäume sein Nest recht gut verstecken weiss.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt<br />
HELLER (1926): „Misteldrossel (Schnärrer). Nicht häufig, brütend gefunden: am Brand, im Krümmetal,<br />
Waltersdorf bei Berga. Im Pöllwitzer Wald häufiger. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Um 1930 war die Misteldrossel ein nicht häufiger Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben, deren<br />
Bestand etwas zugenommen hatte (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) verweist auf eine Abnahme der Misteldrossel in früheren Jahren. In den letzten Jahren<br />
konnte er eine Zunahme registrieren. So wurden Misteldrosseln zur Brutzeit bei Weida, Gera,<br />
Münchenbernsdorf und Brahmenau festgestellt. Den Bestand im Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt er<br />
auf weniger als 100 BP. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) stellten die Mistdrossel im Gebiet um Auma<br />
als vereinzelten Brutvogel fest. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> fanden LANGE & LEO (1978) Brutvorkommen vor allem in<br />
den Nadelwaldbeständen des östlichen Kreisgebietes, ansonsten nur vereinzelt. Der Bestand wird von<br />
beiden Autoren auf weniger als 80 BP geschätzt. In den Jahren 1978/1979 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (SCHEFFEL 1981 a). Folgendes Ergebnis wird aus dem Untersuchungsgebiet genannt:<br />
Gera-Ernsee auf 70 ha Laub-, Misch- und Nadelwald 1 BP, Reust/Rußdorf auf 25 ha Nadelwald 1<br />
BP, Triebes auf 2500 ha Fichtenwald ca. 10 BP, Auma auf 1850 ha Wald mit einem Großteil Fichtenbestand<br />
ca. 60 BP, Münchenbernsdorf auf 2000 ha Wald 50 bis 100 BP, Brahmetal auf 130 ha Feldgehölze<br />
und Parks 0 BP, Gera-Pforten auf 70 ha Laubwald mit Fichtenbeständen 0 BP und Thränitz auf 12 ha<br />
Laubwald mit Fichtengruppen 0 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 500 bis 700 BP an. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden<br />
253 bis 590 BP genannt.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 214
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Nahrungsmangel durch veränderte landwirtschaftliche Nutzung (Anbau von Wintergetreide, Raps, Mais,<br />
Umbruch von Wiesen)<br />
- Forstarbeiten zur Brutzeit<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Neuanlage von extensiven Wiesen und Weiden, Streuobstbeständen und Waldwiesen<br />
- Reduzierung des Biozideinsatzes<br />
Verbreitungskarte 23: Misteldrossel<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20<br />
21 – 50 21 – 50<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
4 – 7<br />
21 – 50<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 215
Ringdrossel, Turdus torquatus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Ehemaliger Brutvogel<br />
Ringdrossel<br />
Foto: S. Morsch/Fotonatur.de<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
Nach LIEDER (1981 a) gelang bei Auma folgender Nachweis: „(3.5.1974 bei Auma 1,0 Ex. STÖSSEL). Letztere<br />
Beobachtung ist insofern bemerkenswert, da das beobachtete Männchen drei Wochen lang in einer<br />
Fichtenhecke sang und am gleichen Ort auch ein Weibchen beobachtet wurde.“ Dieser Aussage liegt folgende<br />
Meldung zugrunde: 12.04. – 03.05.1974 1 Paar bei Auma, am 03.05.1974 nur ein Männchen (STÖßEL).<br />
BARNIKOW (in litt.), der ebenfalls im Gebiet beobachtete, ergänzt dazu: „Über die Ringdrossel möchte<br />
ich folgendes aus meinen Aufzeichnungen übermitteln. Am 03.05.1974 flogen aus einer Fichtenhecke 1/1<br />
Ind. auf das angrenzende Feld (Ruf ähnlich Wacholderdrossel). Nach Rücksprache mit Reiner Herrmann,<br />
dem Besitzer des Grundstücks im Flurteil Leschke, sang eine Drossel mit weißem Brustband fast täglich in<br />
der Fichtenhecke. Ende Mai zeigte mir R. Herrmann das Nest in dem Teil der ca.100 m langen Hecke, in<br />
welcher der Vogel immer gesungen hat. Leider war die Brut nicht erfolgreich verlaufen. Im Nest in etwa<br />
1,70 m Höhe lagen nur Eischalen. Die Ringdrosseln waren nicht mehr im Gebiet. Eine Verwechslung mit<br />
Amsel ist auszuschließen.“<br />
Ein einmaliges Brutvorkommen, wenn auch in einer für diese Art untypischen Höhenlage, kann als gesichert<br />
gelten.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Da es sich bei dem genannten Brutvorkommen um einen Nachweis außerhalb der Brutverbreitung dieser<br />
Art handelt und eine Wiederholung ausgeschlossen scheint, ist es nicht sinnvoll, über mögliche Gefährdungsfaktoren<br />
oder Schutzmaßnahmen zu berichten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Siehe “Lokale Gefährdungsfaktoren”<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 216
Amsel, Turdus merula L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Amsel<br />
Foto: J. Lumpe<br />
Nach LIEBE (1873) war die Amsel schon damals häufiger Brutvogel mit starken Bestandsschwankungen:<br />
„Die Amseln sind im Ganzen weniger zahlreich wie die Zippen [Singdrosseln]. Früher war das anders: Der<br />
schneereiche Winter von 1870 bis 1871 hat unter diesen Thieren furchtbar aufgeräumt, wie die zahlreichen<br />
Leichen bewiesen, die man damals nach dem Weggang des Schnees unter sonnig gelegenen Gebüschen<br />
fand. ... Es wird Jahre dauern, bis die frühere hohe Zahl wieder erreicht ist …“. In der zweiten Hälfte des<br />
19.Jahrhunderts finden sich auch die ersten Hinweise auf die Besiedlung von Stadthabitaten. So schreibt<br />
LIEBE (1878): „Die Amseln haben bei uns im Wald und ausserhalb des Waldes beträchtlich zugenommen,<br />
obgleich sie hie und da noch im Dohnenstieg [Dohne = Fangschlinge] gefangen werden und überdem in<br />
schneereichen Spätwintern (wie z.B. 1870 und 1871) bisweilen massenweis zu Grunde gehen. Sie bequemen<br />
sich den veränderten Umständen leichter an wie die Zippen und nisten gegenwärtig in bedeutender<br />
Anzahl in den Gärten und Anlagen der Dörfer und Städte, was sie früher nur sehr vereinzelt thaten. So nisten<br />
sie z.B. in Neustadt, <strong>Greiz</strong>, Gera und anderen Städten in Gärten ziemlich im Inneren der Stadt und benutzen<br />
hier gern Reisighaufen zur Anlage des Nestes.“ Die Zunahme in den Stadthabitaten muss nach LIEBE<br />
(1985) ziemlich schnell vonstatten gegangen sein: „In den zu Gera gehörigen Gärten nisteten im Jahr 1884<br />
mindestens 20 Paare, - mehr als in den ausgedehnten bei Gera gelegenen fürstlichen und städtischen Waldungen<br />
zusammen.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Kohlamsel (Amsel,<br />
Schwarzdrossel). Sehr häufiger Brutvogel unserer Wälder und besonders der großen Gärten in und außerhalb<br />
der Stadt.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) „ist die Amsel in allen Teilen Thüringens ein verbreiteter Gartenvogel<br />
und wohl allgemein in den Ortschaften noch häufiger als in den Wäldern.“<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) nimmt an, dass der Bestand durch die Einwanderung der Amsel in die Siedlungen seit dem<br />
19. Jahrhundert zugenommen hat und heute einige Tausend BP im Altkreis Gera-Stadt und -Land nisten.<br />
Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) brütet die Amsel in beträchtlicher Zahl in Auma sowie in den umliegenden<br />
Ortschaften: „Die Waldamseln werden von den in der Stadt brütenden Paaren um ein vielfaches<br />
übertroffen.“ Im Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand auf weit über 1000 BP. In den<br />
Jahren 1978/1979 fand eine überregionale Erfassung statt (SCHEFFEL 1981 c). Folgend Vorkommen werden<br />
aus dem Untersuchungsgebiet genannt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf neun Kontrollflächen mit insgesamt<br />
289,5 ha 108 bis 124 BP, nach Bestandsschätzungen in vier Gebieten mit insgesamt 5250 ha 410 bis<br />
540 BP, Altkreis Zeulenroda: in einem Kontrollgebiet mit 25 ha 3 BP, nach Bestandsschätzungen auf 4000<br />
ha 300 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Bestand im Untersuchungsgebiet mit 7000 bis 10000 BP an.<br />
Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 635 bis 888 Reviere ermittelt wurden. BAUM fand 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“<br />
bei Weida 3 BP. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten 2009 bei einer Erfassung auf der gleichen Fläche<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 217
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
6 BP fest. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145<br />
ha Laubwald mit geringen Anteilen Nadelwald. Hier wurden 31 Reviere der Amsel ermittelt (VOOG). Im 60<br />
ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 10 bis 20 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Prädation durch Hauskatzen und Verluste der Brut durch Rabenvögel<br />
- Übertriebene Ordnungsliebe in den Ortschaften beeinträchtigt Brutstandorte<br />
- Störungen am Brutplatz<br />
- Unfälle im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt einer reich strukturierten Kulturlandschaft<br />
- Erhalt und Schaffung naturnaher Gärten<br />
- Bekämpfung freilaufender Katzen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 218
Wacholderdrossel, Turdus pilaris L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Wacholderdrossel<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Wacholderdrossel ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der Taiga Mittel- und Westsibiriens<br />
auch in das Untersuchungsgebiet eingewandert. Als erste Ansiedlungen nennt LIEBE (1878): 1832 Forst von<br />
Klosterlausnitz, 1848 bei Schmölln. Die Mitteilung von LIEBE zum Vorkommen von 1832 bei Klosterlausnitz<br />
wird von HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) angezweifelt, da kein Gewährsmann genannt wurde, BREHM das<br />
Gebiet kannte und nichts davon berichtete. BREHM (1850) stellte das erste Brutvorkommen 1847 bei Geroda<br />
und 1848 bei Lindenkreuz und Gera fest. LIEBE (1873) teilt über die weitere Besiedlung mit: „Südlich traten<br />
sie unweit der Grenze unseres Gebietes auf dem Neu - Ärgernisser Revier 1853 auf. Sodann erschienen in<br />
größerer Nähe die ersten noch sehr schwachen Brutcolonien 1856 bei Caasen, als im nordöstlichen Theil<br />
des Gebietes, - und 1857 im Hain bei Kleinaga (Bericht von 1859), 1859 bei Braunichswalde und am südlichen<br />
Rande des Ronneburger Forstes und um 1861 im Gessenthal … Im östlichen Theil des Gebiets sind<br />
sie vielfach nicht blos in parkartigen Anlagen (Tinz, Posterstein, Nöbdenitz ec.), sondern sogar in den Obstgärten<br />
eingezogen (Collis, Dorna ec.).“ LIEBE (1878) berichtet über die „ausserordentliche“ Zunahme der<br />
Wacholderdrossel in Ostthüringen, besonders in den nördlichen und mittleren Teilen. Ab 1880 erfolgte eine<br />
erhebliche Bestandsabnahme (LIEBE 1891). HELLER (1926): „(Krammetsvogel, Zeimer). Erst seit Mitte des<br />
vorigen Jahrhunderts als Brutvogel hier ansässig: Grochlitz, Gommla, Naitschau, Bretmühle, Waltersdorf bei<br />
Berga, am Pulverturm, im Obstgarten der Dölaumühle (ob heute noch?), Rödelanlagen bei Elsterberg. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
GÜNTHER (1969) schildert die Bestandsentwicklung folgendermaßen: „Ab 1880 setzte ein Rückgang ein,<br />
wonach sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch unregelmäßig brütete und vielleicht ganz verschwand.<br />
In den Jahren um 1930 traten wieder Brutkolonien auf, danach fehlte diese Drossel überall.“ Brutvorkommen<br />
gab es in den 1930er-Jahren noch bei Ronneburg (GÜNTHER 1968). Auch HILDEBRANDT (1919) bezeichnet<br />
sie nur noch als unregelmäßigen Brutvogel und erwähnt ein Vorkommen bei Reichstädt. HIRSCHFELD (1932)<br />
fand eine Brutkolonie am Seeteich bei Hohenölsen, die von 1926 bis 1932 bestand.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) brüteten 1954 erstmals wieder Wacholderdrosseln im Nordosten des Landkreises<br />
Gera. Danach kam es zu einer raschen Ausbreitung, und um 1969 lag der Bestand bei mehr als 1000 BP.<br />
Zwischen Großenstein und Baldenhain wurden 1963, 1964 und 1965 jeweils 12 Nester, 1966 19 Nester und<br />
1967 22 Nester der Wacholderdrossel gezählt (GÜNTHER 1968). Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971)<br />
„ist die Wacholderdrossel auch in der Brutzeit an verschiedenen Stellen fast in jedem Jahr in schwankender<br />
Stärke anzutreffen. Das Hirtenholz in der Leschke dient jedes Jahr als Brutplatz. Die meisten Nester wurden<br />
auf Seitenästen hoher Lärchen am Waldrand gefunden. So am 20.4.1964 über 20 Nester. 1970 brüteten<br />
Wacholderdrosseln auch in 30- bis 40jährigen Fichtengürteln zwischen den Wolgeteichen. Am 26.6.1966<br />
wurde eine brütende Drossel in 3 m Höhe auf dem Dach eines Nistkastens gefunden. Der Kasten hing an<br />
einem Apfelbaum der Aumaer Schrebergartenanlage.“ Im Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den<br />
Bestand auf etwa 300 BP. 1978/1979 fand eine überregionale Erfassung statt (FLÖßNER 1981 a). Folgende<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 219
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Vorkommen werden genannt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 7 km² SE Gera 8 bis 12 BP, auf 11 km² bei<br />
Großenstein und Baldenhain 8 bis 10 BP, auf 1 km Bachaue NE Baldenhain 27 BP. Auf 18 km² bei Röpsen<br />
und Dorna 40 bis 50 BP, auf 60 km² in der Umgebung von Münchenbernsdorf 100 bis 150 BP, Altkreis<br />
Zeulenroda: auf 40 km² in der Umgebung von Auma 200 BP. Erwähnt wird weiterhin eine Bestandsabnahme<br />
nach dem Maximum Ende der 1960er-Jahre bei Gera und Ronneburg, die zum Erlöschen einiger Kolonien<br />
1976/77 führte. LANGE & LIEDER (2001) schätzen den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet auf 500 bis<br />
800 BP und verweisen auf einen seit Jahren rückläufigen Bestand. Während einer Untersuchung von 1995<br />
bis 2000 auf einer Fläche von 88 km² wurden 97 bis 132 BP festgestellt. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde<br />
der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />
2005 bis 2009 wurden 482 bis 1104 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verschlechterung oder Verlust des Lebensraumes durch Intensivierung der Landwirtschaft, Beseitigung<br />
von Streuobstwiesen und Trockenlegung oder Vernichtung von Feuchtgebieten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Erhaltung und Neuanlage von Streuobstwiesen<br />
- Erhalt und Schutz von Grünlandflächen, kein Wiesenumbruch<br />
21 – 50<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
51 – 150<br />
21 – 50<br />
21 – 50 21 – 50<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20<br />
4 – 7<br />
8 – 20<br />
8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20<br />
8 – 20<br />
21 – 50 21 – 50<br />
4 – 7<br />
21 – 50<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20<br />
4 – 7<br />
21 – 50<br />
8 – 20<br />
Verbreitungskarte 24: Wacholderdrossel<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 220
Singdrossel, Turdus philomelos C. L. Brehm<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Singdrossel<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach LIEBE (1873) sind die Zippen im ganzen Gebiet ziemlich häufig und in den letzten Jahren noch zahlreicher<br />
geworden. Für Ostthüringen schätzt LIEBE (1878) den Bestand als gleichbleibend ein, obwohl es zu<br />
jährlichen Schwankungen kommen kann. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926):<br />
„Singdrossel (Zippe). Nicht selten, aber weit seltener als die Amsel.“ Als ursprünglicher Charaktervogel des<br />
Waldes drang sie im 19. Jahrhundert in die Ortschaften vor (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
1900 bis 1950<br />
HIRSCHFELD(1932) fand sie als häufigen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) kam es seit ca. 1960 zur Abnahme des Bestandes im Altkreis Gera-Stadt und -Land,<br />
den er mit „nicht mehr als 500 Paaren“ einschätzt. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Singdrossel<br />
recht zahlreich in allen Waldungen um Auma vertreten. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO<br />
(1978) den Bestand auf etwa 300 BP. Der Prozess der Besiedlung von Stadthabitaten war auch im 20. Jahrhundert<br />
noch feststellbar. LANGE & LEO (1978) schreiben: „Besonders in den letzten Jahren ist die Tendenz<br />
einer gewissen Verstädterung zu erkennen.“ In den Jahren 1978/1979 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (SCHEFFEL 1981 b). Folgend Vorkommen werden aus dem Untersuchungsgebiet genannt: Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land: auf 12 Kontrollflächen Wald mit 554,5 ha 88 bis 103 BP, auf 3600 ha Feldflur<br />
mit Feldgehölzen bei Gera/Roschütz/Aga/Zschippach 130 bis 150 BP, Altkreis Zeulenroda: auf 40 km² Fläche<br />
mit 1850 ha Wald in der Umgebung von Auma 130 bis 150 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf vier Kontrollflächen<br />
Wald und Parkanlagen von 53 ha Größe 17 bis 18 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />
im Untersuchungsgebiet mit 2500 bis 3500 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung<br />
auf 87 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 95 bis 279 Reviere ermittelt wurden. Im Jahre<br />
2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit<br />
geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 11 Reviere der Singdrossel gezählt (VOOG). Im 60 ha großen<br />
<strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Einsatz von Bioziden<br />
- Rückgang der Schneckenbestände und verstärkter Anbau von Wintergetreide verschlechtern die Nahrungssituation<br />
- Hohe Prädation zur Brutzeit<br />
- Verluste an Freileitungen, Sendemasten u.ä.<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Beschränkung des Biozideinsatzes<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 221
Rotdrossel, Turdus iliacus L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Ehemaliger Brutvogel<br />
Rotdrossel<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
LIEBE (1873) schreibt zunächst: „Turdus iliacus. Die Rothdrossel nistet nicht im Gebiet.“ 1878 korrigiert er<br />
diese Aussage und teilt eine früheres Brutvorkommen mit: „Die Rothdrossel hat einmal (im Jahre 1868) auf<br />
dem rothen Berg [Heidelberg, nach GÜNTHER 1969] bei Ronneburg genistet, wo ich das Nest, einen mit<br />
Haidekraut und Halmen durchwirkten Lehmbau, auf einem Birkenstockausschlag, etwa 1½ Fuss über dem<br />
Boden fand, belegt mit 5 Eiern, welche den Amseleiern ähnlich gefärbt und nicht ganz so gross wie die<br />
Zippeneier waren. Die Alten waren zutraulich genug, um sich dabei ganz in der Nähe beobachten zu lassen<br />
und haben wahrscheinlich ihre Brut glücklich durchgebracht. – Auch J. Kratzsch hat vor Jahren ein Pärchen<br />
bei Gimmel unweit Schmölln nisten sehen.“<br />
1886 beschreibt LIEBE seine Beobachtung noch einmal ausführlich: „Da verwundert es, daß der Zeimer bei<br />
uns als Brutvogel immer häufiger wird, während die Weindrossel [Rotdrossel] von vielen <strong>Ornithologen</strong> als<br />
deutscher Brutvogel nicht aufgeführt wird. Letzteres ist indeß nicht ganz richtig. Im Jahre 1868 fand ich Mitte<br />
Juni auf dem Rothen Berg bei Ronneburg in Ostthüringen ein Weindrosselnest und einige Jahre später fand<br />
J. Kratzsch ein solches bei Gimmel unweit Schmölln. ... Der Rothe Berg ist ein ziemlich felsiger und steiniger,<br />
dabei aber vielfach quelliger Hügelzug zwischen zwei wasserreichen Thälchen, welcher gemischt mit<br />
Laubbuschwald bestanden ist. Dort stand das Nest ganz niedrig, etwa zwei Spannen hoch über dem Boden<br />
auf einem Birkenstumpf, wie solche sich bei wenigjährigen Umtrieb der Laubniederwaldkultur erzeugen. Es<br />
stand zwischen theils dürren, theils noch grünen Schößlingen auf einer angefaulten alten Schnittstelle des<br />
Stockes. Der untere Theil des Nestes war sehr solid aus festem eingespeichelten Lehm mit eingewickelten<br />
Grashälmchen und feinen Haidezweigen ausgeführt und saß recht breit auf der Unterlage auf. Nach oben<br />
ward die Wand des Nestes dünner und bestand aus reichlicheren Haidezweigen und Grasblättern mit weniger<br />
eingekneteter Lehmmasse. Das Innere war mit einigen feineren Hälmchen von Gras und Labkraut ausgekleidet<br />
und mit (durch Speichel) fest anklebenden Lehm - und Kuhdüngerpartikeln bestrichen. Der ganze<br />
Bau war so fest angekittet, daß er später, als ich ihn wegnehmen wollte, zerbrach. In dem Nest lagen fünf<br />
Eier ähnlich denen der Amsel, ganz ähnlich denen des Zeimers, aber weit kleiner. Das Nest stand etwa 100<br />
Schritt vom Rand des Wäldchens gegen die Wiese, wo ein sehr viel frequentirter Fußweg sich hinzieht. Die<br />
Thiere waren vielleicht grade deshalb, vielleicht aber auch von Haus aus gar nicht scheu und ließen sich aus<br />
nahem Hinterhalt rechtgut beobachten. Das Männchen sang schöner als ich, allerdings vor langer Zeit, ein<br />
solches in Gefangenschaft hatte singen hören. ... Die Gesangsstrophen begannen oder endigten mit hübschen,<br />
nicht allzulauten Flötentönen, die einigermaßen an die Zippdrossel erinnerten, und bestanden sonst<br />
aus angenehmen, wenig lauten, klirrenden, leis pfeifenden, schnarrenden Tönen, die sich mit dem leisen<br />
studirenden Gesang der Zippdrossel vor Beginn der eigentlichen Singperiode recht gut vergleichen lassen. -<br />
Ich ließ die Eier unberührt, da ich dergleichen nicht sammle, und weil mir viel daran lag, die Alten recht lange<br />
zu beobachten, und machte auch, nachdem die Jungen ausgeschlüpft waren, noch zweimal Besuche am<br />
Nistplatz. Beim Atzen hörte ich die Jungen nicht schreien; indeß das kommt bei allen Vögeln vor, wenn die<br />
Alten recht reichliches Futter finden. Eine Abhaltung ließ mich erst etwa 15 Tage nach ihrem Ausschlüpfen<br />
wieder dahin gelangen, und war das Nest leer und von Alten und Jungen nichts zu sehen. Da das Nest ganz<br />
ungestört und reichlich voll Federhülsenschuppen war, darf ich wohl annehmen, daß die Jungen glücklich<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 222
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
davon gekommen sind. - Seit jener Zeit habe ich in Ostthüringen keine brütenden Weindrosseln wieder gesehen.“<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) bezweifeln diese Beobachtung von LIEBE, da er die Brut der Rotdrossel erst<br />
1878 und nicht schon in seiner Arbeit von 1873 erwähnt hat. Die angegebenen Ablehnungsgründe sind spekulativ.<br />
Auch wird die zweite Quelle (LIEBE 1886) nicht erwähnt. Warum sollte der sonst gewissenhaft berichtende<br />
LIEBE die Literatur zweimal mit einer unsicheren Beobachtung belastet haben, wenn er sich seiner<br />
Sache nicht ganz sicher gewesen wäre. Wir halten die Beobachtung für glaubhaft und ausreichend belegt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Das Brutvorkommen ist ein Ausnahmefall<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutzmaßnahmen werden deshalb hier nicht aufgeführt<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 223
Grauschnäpper, Muscicapa striata (Pall.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Grauschnäpper<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Grauschnäpper als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. LIEBE (1873) schreibt auf das gleiche Gebiet bezogen: „Der Fliegenschnapper ist in den<br />
milder gelegenen Strichen des Gebietes recht häufig, aber auch sogar in den raueren Gegenden nicht selten.<br />
Im Ronneburger Forst und im Weidathal z. B. giebt es viele.“ Für Ostthüringen teilt LIEBE (1878) mit:<br />
„Der graue Fliegenfänger hat sich seit 40 Jahren im Gebiet sehr stetig gemehrt. Während er früher vorzugsweise<br />
in Laubgehölzen und Parkanlagen Aufenthalt nahm und in Gärten nur hier und da einmal niederliess,<br />
hat er sich allmählich in letzteren vollkommen eingebürgert. Es gab bei uns schon vor etwa 20 Jahren kein<br />
grösseres Dorf in den wärmeren flachen Thälern des nördlichen Gebietes, worin nicht ein Paar graue Fliegenfänger<br />
wohnte; jetzt sind aber fast in jedem kleineren Dorf wenigstens ein Paar und in den Gärten jedes<br />
grösseren Ortes zwei bis vier Paar anzutreffen.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER<br />
(1926): „Regelmäßig hier in größeren Gärten brütend: Park, Erholungsgarten, Küchengarten, am Schloßberg,<br />
bei der Papier- und Dölaumühle, Trifle u. a. Orten; Elsterberg (P.)“.<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Grauschnäpper in ganz Thüringen verbreiteter Brutvogel. Weiter<br />
schreiben die Autoren: „Mehr als die Wälder bewohnt er Gärten und Anlagen, besonders gern auf dem<br />
Lande, wo Viehställe in der Nähe sind.“<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) verzeichnet eine Abnahme des Bestandes im Altkreis Gera-Stadt und -Land. Er schätzt den<br />
Grauschnäpper als nicht zu häufigen Brutvogel ein und gibt den Bestand mit etwa 300 BP an. BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL (1971) fanden erst 1970 ein BP im Hirtenholz bei Auma und betonen, dass die Art vor<br />
1970 hier nicht beobachtet werden konnte. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> ist der Grauschnäpper ein spärlicher Brutvogel<br />
(LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1975/1976 fand eine überregionale Erfassung statt (BARNIKOW 1978).<br />
Folgend Vorkommen werden aus dem Untersuchungsgebiet genannt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 80<br />
ha Ortschaft 3 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 10 ha Ortschaft 3 BP, auf 15 ha Wald 1 BP, auf 3500 ha ca. 10 BP,<br />
Altkreis Zeulenroda: auf 4000 ha, davon 1000 ha Wald, 1 BP. Zusätzlich wird von dem Autor folgende Einschätzung<br />
gegeben: Die von GÜNTHER (1969) für den Altkreis Gera genannte Zahl von rund 300 BP dürfte<br />
inzwischen noch geringer geworden sein. In den ländlichen Ortschaften im Altkreis Zeulenroda kommt der<br />
Grauschnäpper in wenigen Paaren vor, z. B. Untendorf und Wenigenauma. Aus der Umgebung von<br />
Zeulenroda sind jährlich 2 bis 3 BP bekannt. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> wird der Bestand als schwankend eingeschätzt,<br />
und in manchen Jahren fehlt die Art ganz. Für 1976 werden aus dem gesamten Altkreise <strong>Greiz</strong> nur<br />
10 BP angenommen. ÖLSCHLEGEL (1994/95) fand bei langjährigen Untersuchungen im ehemaligen Schlosspark<br />
Gera-Tinz auf 2 ha Fläche 1 bis 3 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 200 bis 300 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km²<br />
Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 15 bis 19 Reviere ermittelt wurden.<br />
Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald<br />
mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 3 Reviere des Grauschnäppers gezählt (VOOG). Im 60 ha<br />
großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 224
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung oder Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Ausräumung der offenen Landschaft (Entfernung<br />
der Feldgehölze und Kopfbäume sowie anderer Strukturen, Fällen alter Bäume)<br />
- Intensive Durchforstung der Wälder<br />
- Verlust wichtiger natürlicher Strukturen in den Siedlungen<br />
- Hoher Biozideinsatz<br />
- Störung durch Menschen am Brutplatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und langfristige Sicherung alter, höhlentragender Bäume in der Kulturlandschaft und in Gärten und<br />
Parks<br />
- Reduzierung der Durchforstung und längere Umtriebszeiten in den Wäldern<br />
- Erhalt von Altholzinseln und Schaffung von Naturwaldreservaten<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 225
Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca (Pall.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Trauerschnäpper<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den „schwarzen Fliegenschnapper“ als häufig vorkommende<br />
Art und als Brutvogel in der Umgebung von Gera. Diese Einschätzung kann LIEBE (1873) nicht bestätigen<br />
und schreibt: „Der Trauerfliegenfänger ist, wie mir scheint, erst seit etwa 20 Jahren als Brutvogel in den<br />
milderen Theilen des Gebietes eingewandert und noch immer eine seltene Erscheinung.“ LIEBE fand erstmals<br />
1852 eine Brut zwischen Jena und Burgau und 1866 bei Tauchlitz. Für Ostthüringen teilt LIEBE (1878)<br />
folgendes mit: „1873 bis 1875 brütete ein Pärchen in den alten Hainbuchen des Tinzer Parkes unterhalb<br />
Gera.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Bis 1881 konnte ich diesen seltenen<br />
Vogel nur einmal brütend im Obstgarten des Herrn W. von Schlieben in Elsterberg feststellen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Trauerschnäpper in neuerer Zeit in allen Teilen Thüringens ein<br />
ständiger Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt die Bestandsentwicklung im Altkreis Gera-Stadt und -Land folgendermaßen ein:<br />
„Besonders zahlreich waren Trauerschnäpperbruten in den Jahren um 1950, in Gartenanlagen konnte man<br />
von einer Stelle aus oft 3 – 4 singende Männchen gleichzeitig verhören. Zu dieser Zeit mögen einige tausend<br />
Paare das Gebiet bewohnt haben. Zuletzt waren es weniger, im Höchstfall noch 1000 Bruten. Zur Zeit<br />
scheint eine Vergrößerung des Bestandes zu beginnen.“ Im Gebiet um Auma war die Art „recht häufiger“<br />
Brutvogel (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Nach LANGE & LEO (1978) ist der Trauerschnäpper mit über<br />
500 BP ein nicht seltener Brutvogel im Altkreis <strong>Greiz</strong>. In den Jahren 1976/1977 fand eine überregionale Erfassung<br />
statt (GÜNTHER 1978 a). Folgende Vorkommen werden aus dem Untersuchungsgebiet genannt:<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: in fünf Gebieten auf 186 ha mit 345 Nistkästen 66 BP, auf 3500 ha bei<br />
Münchenbernsdorf geschätzte 100 bis 150 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: in einem Gebiet auf 22 ha mit Nistkästen 1 bis<br />
2 BP, Altkreis Zeulenroda: in einem Gebiet auf 10 ha mit 46 Nistkästen 8 BP, auf 4000 ha bei Auma 45 BP.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 1000 bis 1500 BP an. Für<br />
diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 108 bis 173 Reviere ermittelt wurden. BAUM fand 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei<br />
Weida 5 BP. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten 2009 auf der gleichen Fläche 3 BP fest. Im 60 ha<br />
großen <strong>Greiz</strong>er Park (80 Nistkästen) wurde der Gesamtbestand mit 35 bis 50 BP angegeben (LUMPE 2008).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 226
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Zerstörung des Lebensraumes durch Verlust naturnaher, höhlenreicher Altholzbestände und Obstgärten<br />
sowie Verbauung der Gärten<br />
- Nahrungsmangel durch Verarmung der Insektenfauna in Folge intensiver Waldpflege und Durchforstung<br />
und durch starken Düngemittel- und Biozideinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung und Schutz höhlentragender Altholzbestände und Obstgärten<br />
- Extensivierung der Forstwirtschaft<br />
- Bestandsstützung durch Nistkastenangebot<br />
Verbreitungskarte 25: Trauerschnäpper<br />
8 – 20 8 – 20 21 – 50<br />
8 – 20 8 – 20 8 – 20 8 – 20<br />
8 – 20 21 – 50 21 – 50 8 – 20<br />
21 – 50 8 – 20 21 – 50 21 – 50<br />
8 – 20 4 – 7 4 – 7 2 – 3<br />
8 – 20 4 – 7 4 – 7 4 – 7 4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3 8 – 20 8 – 20 51 – 150<br />
2 – 3 2 – 3 4 – 7 4 – 7 51 – 150<br />
8 – 20 8 – 20<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 227
Rotkehlchen, Erithacus rubecula (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Rotkehlchen<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet das Rotkehlchen als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />
von Gera. Auch LIEBE (1873) ist dieser Meinung und vermerkt gelegentliche Vorkommen in Gärten:<br />
„Sie sind bisweilen so zahlreich, daß einzelne Paare im Wald zwischen ihren eifersüchtigen Genossen kein<br />
Revier erhalten und genöthigt sind, in Gärten Aufenthalt zu nehmen.“ Nach seinen jahrelangen Aufzeichnungen<br />
zum Bestand der Rotkehlchen in Ostthüringen kommt LIEBE (1878) zu folgender Einschätzung: „Die<br />
Rothkehlchen sind zwar noch durch ganz Ostthüringen hindurch sehr häufig, – selbstverständlich in den<br />
waldreichen Strichen mehr als in den Getreidegegenden, haben aber im Ganzen doch abgenommen.“ Nach<br />
seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): Nicht seltener Brutvogel in den Seitentälern und<br />
im Stangenwalde: Quirl-, Göltzschtal, Neue Welt, Krümmetal, Trifle, Moschwitz, Elsterberg u. a. O.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist das Rotkehlchen ein verbreiteter Brutvogel in ganz Thüringen und<br />
HIRSCHFELD (1932) bezeichnet es als häufigen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) vermutet eine Abnahme des Bestandes im Altkreis Gera-Stadt und -Land und schätzt den<br />
Bestand auf wenige Tausend Paare. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Art um Auma ein häufiger<br />
Brutvogel. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand auf weit über 500 Paare.<br />
In den Jahren 1978/1979 fand eine überregionale Erfassung statt (LIEBERT 1980). Folgende Vorkommen<br />
werden aus dem Untersuchungsgebiet genannt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: in zehn Gebieten auf 214 ha<br />
51 bis 54 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: in zwei Gebiete auf 26 ha 7 bis 8 BP, Altkreis Zeulenroda: in einem Gebiet auf<br />
25 ha 5 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 2500 bis 3500 BP an. Für diese Schätzung<br />
lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 226<br />
bis 301 Reviere ermittelt wurden. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet<br />
Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 15 Reviere des Rotkehlchens<br />
ermittelt (VOOG). BAUM fand 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei Weida 11 BP. LIEDER<br />
& LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten 2009 auf der gleichen Fläche 13 BP fest. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurde der Bestand auf 10 bis 15 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust in der offenen Kulturlandschaft<br />
- Unfälle im Straßenverkehr<br />
- Nestzerstörung durch Prädatoren<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wiederherstellung einer reich strukturierten, gehölz- und heckenreichen Kulturlandschaft<br />
- Belassen von Unterholz in Wirtschaftswäldern<br />
- Erhaltung und Anlage breiter Vegetationssäume an Waldrändern<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 228
Nachtigall, Luscinia megarhynchos C. L. Brehm<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Nachtigall<br />
Foto: H. Duty/Fotonatur.de<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) teilt mit: „Oefters hier nistend, bisher jedoch noch regelmäßig<br />
schon vor beendigter Brut weggefangen, so daß eine weitere Ansiedlung in unserer Gegend stets im Keime<br />
erstickt wurde.“ LIEBE (1873) vermutet, dass sich diese Aussage nur auf Gefangenschaftsflüchtlinge bezieht<br />
und eine natürliche Ansiedlung nicht stattfand. Konkrete Angaben kann LIEBE 1878 machen: „Im Elsterthal<br />
gab es brütende Nachtigallen bei Gera noch bis 1817 oder nach einer anderen Nachricht bis 1827, bei<br />
Crossen bis Ende der dreissiger Jahre. … Versuche durch Aussetzung Nachtigallen wieder einzubürgern,<br />
die auf Befehl S. D. des Fürsten Reuss bei Gera gemacht wurden, misslangen.“ 1883 wurden 34 Vögel im<br />
<strong>Greiz</strong>er Park ausgesetzt, wovon sieben Paare sofort brüteten. Im folgenden Jahr wurden 11 singende<br />
Männchen festgestellt (BEYER 1884). Auch in den Jahren 1885 bis 1887 kehrten mehrere Vögel aus ihren<br />
Winterquartieren in den <strong>Greiz</strong>er Park zurück und wurden zur Brutzeit dort beobachtet (BEYER 1888 a). Auch<br />
1888 waren wieder Nachtigallen im Park anwesend, da aber keine guten Sänger darunter waren, sollten im<br />
folgenden Jahr neue Vögel ausgesetzt werden (BEYER 1988 b). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881<br />
schreibt<br />
HELLER (1926): „Als Brutvogel ist die Nachtigall meines Wissens niemals in unserer, für diesen Zweck viel zu<br />
kühlen Gegend beobachtet worden, durchziehend freilich öfters. 1883 unternahm der <strong>Verein</strong> der Naturfreunde<br />
den Versuch, mehrere Paare im [<strong>Greiz</strong>er] Park auszusetzen. Er schlug trotz aller Sorgfalt fehl, wie auch<br />
der in den Rödelanlagen bei Elsterberg unternommene. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Aus diesem Zeitraum fehlen Brutvorkommen der Nachtigall völlig (FLÖßNER 1980).<br />
Ab 1950<br />
Ab 1963 erfolgte die Wiederbesiedlung des Gebietes, über die GÜNTHER (1968, 1969) berichtet. Zunächst<br />
wurde ein Brutvorkommen im Gessental bei Gera von 1963 bis 1965 festgestellt. 1964 wurde bei Weida ein<br />
singendes Männchen bemerkt und 1965 konnte dort eine Brut nachgewiesen werden. 1966 bestand an dieser<br />
Stelle Brutverdacht. Weitere Reviere (singende Männchen) bestanden 1965 im Gessental, 1966 am<br />
nordöstlichen Stadtrand von Gera, 1966 und 1967 bei Töppeln, 1966 und 1967 bei Ronneburg (hier wurde<br />
auch ein Weibchen gefangen). DWENGER (1967) konnte 1967 bei Bad Köstritz eine erfolgreiche Brut beobachten.<br />
In den Jahren 1978/1979 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1980 a).<br />
Folgend Vorkommen werden außer denen bei GÜNTHER (1968, 1969) genannt Orten noch mitgeteilt:<br />
Zschippach, Großaga, Gera-Roschütz und Pölzig. BARNIKOW (2010 in litt.) berichtet von einer Brut im Jahre<br />
1995 westlich von Auma im Flurstück Leschke. LANGE & LIEDER (2001) schätzen den Gesamtbestand im<br />
Untersuchungsgebiet auf kaum 15 BP. Sie verweisen auch auf singende Männchen in höheren Lagen bei<br />
<strong>Greiz</strong>.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 229
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust geeigneter Lebensräume (Auenlandschaften, reich strukturierte und unterholzreiche Wälder sowie<br />
Buschlandschaften) durch Veränderung der Bewirtschaftung, Senkung des Grundwasserspiegels, Flurbereinigung,<br />
Beseitigung und Überbauung geeigneter Fluren<br />
- Brutverluste durch Prädatoren (Hauskatzen, Ratten)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhaltung reich strukturierter, unterholzreicher Laub- und Mischwälder<br />
- Renaturierung von Flüssen und Bächen und naturnaher Randstrukturen<br />
- Keine intensive Durchforstung der Gehölze<br />
- Verringerung des Biozideinsatzes<br />
- Bekämpfung freilaufender Hauskatzen<br />
Verbreitungskarte 26: Nachtigall<br />
4 – 7 4 – 7 1<br />
8 – 20 4 – 7<br />
1 2 – 3 1 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3 1<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 230
Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros (Gmel.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Hausrotschwanz<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In Gera und Umgebung war der Hausrotschwanz in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein sehr häufiger Brutvogel<br />
(Ornithologische Sektion Gera 1859). LIEBE (1873) stellte eine Abnahme fest: „Dagegen ist der<br />
Hausrothschwanz (die schwarze Rothsterze) im Laufe der letzten Jahre weniger häufig geworden: sicher die<br />
Hälfte der Gehöfte, die er sonst als regelmäßiger Gast bezog, hat er aufgegeben. ... Bemerkenswerth ist<br />
übrigens, daß bei uns fast jeder Steinbruch von einem Paar Hausrothschwänzchen besetzt ist, und daß an<br />
diesen Oertlichkeiten sich keine Abnahme bemerkbar gemacht hat.“ Für Ostthüringen kann LIEBE (1878)<br />
einen gleichbleibenden Bestand feststellen und widerspricht der Auffassung von BECHSTEIN, dass sich der<br />
Hausrotschwanz erst Ende des 18. Jahrhunderts in Thüringen ausgebreitet und vorher selten gewesen sein<br />
soll: „In Ostthüringen habe ich dafür keine Bestätigung gefunden: die ältesten Bauern und Forstleute, die ich<br />
vor 35 Jahren darum befragte, wussten nichts davon. Der früher beim Volk allgemein herrschende Aberglaube,<br />
dass das Hausröthel ähnlich wie die Schwalbe ein geweither Vogel sei, und dass die Störung der<br />
Brut mit Feuerbrunst bestraft werde, hat durchaus kein modernes Gepräge und spricht eher für einen uralten<br />
guten Bestand als für eine erst vor Kurzem erfolgte Einwanderung.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881<br />
schreibt HELLER (1926): „Häufiger und überall in der Nähe menschlicher Wohnungen lebender Brutvogel.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Hausrotschwanz ein häufiger Brutvogel in allen Orten Thüringens,<br />
auch in der Umgebung von Hohenölsen (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
In den 1960er-Jahren war der Hausrotschwanz im Altkreis Gera-Stadt und -Land nicht so stark vertreten wie<br />
der Gartenrotschwanz (GÜNTHER 1969). Er schätzt den Bestand auf etwa 1000 BP. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ<br />
& STÖßEL (1971) ist die Art um Auma „in den Ortschaften recht zahlreich vertreten. In den letzten Jahren<br />
wurden viele leerstehende Rauchschwalbennester bezogen.“ Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO<br />
(1978) den Bestand auf unter 500 Paare. In den Jahren 1978/1979 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (ZSCHIEGNER 1981 b). Auf Kontrollflächen wurden folgende Reviere gezählt oder geschätzt: Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land: auf 6 Kontrollflächen mit 471 ha 37 bis 40 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf 1 Kontrollfläche<br />
mit 10 ha 3 bis 4 BP. Bemerkt wird weiterhin, dass im Gebiet um Ronneburg die Bergwerkshalden besiedelt<br />
wurden. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 3000 bis<br />
4000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 87 km² Fläche zwischen 1995 und<br />
2000 zugrunde, bei der 270 bis 398 Reviere ermittelt wurden. Im Geraer Ostviertel (Altbau) wurden 2002 auf<br />
25 ha 9 BP gezählt und in der Ortslage Linda brüteten 2005 auf 25,5 ha 7 BP (LIEDER, unveröff.).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verringerung der Brutmöglichkeiten an Gebäuden durch geschlossene Bauweise und Sanierung<br />
- Aufgabe der Vieh- und Kleintierhaltung, Prädation der Bruten durch Katzen, Marder und Elstern<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Halbhöhlenkästen und Brutnischen an Gebäuden, Bekämpfung freilaufender Hauskatzen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 231
Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gartenrotschwanz<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war der Gartenrotschwanz ein sehr häufiger Brutvogel. Das<br />
war nach LIEBE (1873) auch später noch so: „Ruticella phoenicura, die wälsche Rothsterze. Der Buschrotschwanz<br />
ist allenthalben im ganzen Gebiet gemein; hohle Weidenköpfe und Pflaumenbäume mit ausgewitterten<br />
Astlöchern giebt es ja überall genug. Namentlich im Jahre 1870 gab es außergewöhnlich viel Buschrotschwänzchen.“<br />
Auch im Jahr 1862 notierte LIEBE (1878) auffällig viele Gartenrotschwänze: „Das<br />
Baumröthel tritt zwar in manchem Frühjahr in stärkerer Anzahl auf, hat aber im Allgemeinen seinen starken<br />
Bestand in den letzten 40 Jahren nicht geändert. ... Sie wohnen allenthalben in Ostthüringen, am dichtesten<br />
aber in den weiteren und tiefer liegenden Thälern.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER<br />
(1926): „Gartenrotschwanz (Buschrotschwanz). Wenn auch nicht sehr häufig, brütet dieser bunte Vogel doch<br />
überall in größeren, buschigen Gärten in und um <strong>Greiz</strong>.“<br />
1900 bis 1950:<br />
HILDEBRANDT (1919) bezeichnet die Art als recht zahlreichen Brutvogel in Ostthüringen.<br />
Ab 1950:<br />
Auch in den 1960er-Jahren waren im Altkreis Gera-Stadt und -Land noch einige Tausend Brutpaare vorhanden<br />
(GÜNTHER 1969). Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖSSEL (1971) war der Gartenrotschwanz in den Kleingartenanlagen<br />
und Gärten um Auma häufig anzutreffen und nur in den Waldgebieten war der Bestand aus<br />
Mangel an Nistmöglichkeiten geringer. Zudem wurde nach den Angaben der Autoren „in den letzten drei<br />
Jahren“ ein leichter Rückgang festgestellt. LANGE & LEO (1978) bezeichnen den Gartenrotschwanz noch als<br />
häufigen Brutvogel und schätzen den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> mit „vermutlich unter 500 Brutpaaren“ ein,<br />
„wobei es im Vergleich zu früheren Jahren keine wesentlichen Veränderungen gegeben haben mag.“ Im<br />
Gegensatz dazu stellte ZSCHIEGNER (1981 a) bei der Erfassung 1978/79 im ehemaligen Bezirk Gera einen<br />
eindeutigen Rückgang fest. Auf Kontrollflächen in den Altkreisen Gera und <strong>Greiz</strong> wurden folgende Brutpaarzahlen<br />
1978/79 ermittelt: Gera-Pforten auf 20 ha 3 BP, Brahmetal auf 10 ha 10 BP, Bad Köstritz auf 200 ha<br />
6 BP, Schwaara bis Mückern auf 4 ha 1 bis 2 BP, Großenstein auf 45 ha 3 BP, Thränitzer Grund auf 6 ha 0<br />
BP, Aubachtal auf 8 ha 1 bis 2 BP, Gera-Nord auf 5 km Zählstrecke (Gartenanlagen) 10 bis 12 BP.<br />
Der dramatische Rückgang des Gartenrotschwanzes in Mitteleuropa von 50 bis 90 % als Folge der Trockenheit<br />
in der Sahelzone in den 1970er-Jahren (BAUER, BEZZEL & FIEDLER 2005) ist für das Untersuchungsgebiet<br />
unzureichend dokumentiert. LANGE & LIEDER (2001) schätzen den Bestand auf 200 bis 400 BP ein. Im<br />
60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung<br />
zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 184 bis 385 BP angenommen.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 232
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust von Altholzbeständen, alten Korbweiden, Streuobst- und Parkbäumen<br />
- Ausräumung der Kulturlandschaft und Intensivierung der Landwirtschaft<br />
- Biozideinsatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schutz und Erhaltung von Altholzbeständen, alter Korbweiden, Hochstammobst und alter Parkbäume<br />
- Reduzierung des Biozideinsatzes<br />
- Erhöhung des Höhlenangebotes durch Nisthilfen<br />
- Schaffung einer reich strukturierten Kulturlandschaft<br />
Verbreitungskarte 27: Gartenrotschwanz<br />
4 – 7 8 – 20 8 – 20<br />
4 – 7 4 – 7 8 – 20 4 – 7<br />
4 – 7 8 – 20 8 – 20 2 – 3<br />
4 – 7 4 – 7 8 – 20 4 – 7<br />
4 – 7 2 – 3 2 – 3 4 – 7 2 – 3<br />
4 – 7 4 – 7 4 – 7 2 – 3 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3 4 – 7 21 – 50 8 – 20<br />
2 – 3 2 – 3 4 – 7 21 – 50<br />
2 – 3 4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 233
Heckenbraunelle, Prunella modularis (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Heckenbraunelle<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) ist die Heckenbraunelle ein seltener Brutvogel. Als Brutort<br />
wird Großdraxdorf genannt. Auch LIEBE (1873) bezeichnet die Art als seltenen Brutvogel und schreibt: „Die<br />
Braunelle ist bei uns gar nicht häufig und sind nur etwa 4 bis 8 Pärchen für das Gebiet anzunehmen, welche<br />
sich in den hochgelegenen Nadelwäldern zwischen Hohenreuth und Großebersdorf, bei Kraftsdorf und im<br />
Zeitzgrund, im Grunde abwärts von Wolfersdorf, bei Reust und am rothen Berg hinter Ronneburg -, also im<br />
weiteren Gebiet aufhalten. Nur 1869 brütete ein Paar hinter dem Martinsgrund bei Gera.“ 1898 stellt LIEBE<br />
fest, dass „ihre Zahl in neuerer Zeit sicher noch geringer wie ehedem“ ist. Nach seinen Aufzeichnungen von<br />
1881 schreibt HELLER (1926): „Seltener Brutvogel bei Sachswitz, am Kupferhammer; bei Elsterberg häufiger<br />
(P.). Scheint neuerdings zugenommen zu haben, namentlich in Fichtenschonungen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts muss eine Bestandszunahme erfolgt sein, denn HILDEBRANDT (1919)<br />
bezeichnet die Heckenbraunelle bereits als nicht seltenen Brutvogel in Ostthüringen. Nach HILDEBRANDT &<br />
SEMMLER (1975) ist die Heckenbraunelle ein verbreiteter Brutvogel in ganz Thüringen. Auch in der Umgebung<br />
von Hohenleuben soll die Art ein häufiger Brutvogel in den Nadelwaldschonungen gewesen sein<br />
(HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land wird der Bestand auf etwa 1000 BP geschätzt (GÜNTHER 1969). Er bemerkt<br />
weiterhin, dass die Art auch regelmäßig im Unterholz der Laubwälder und mitunter sogar in Gärten brütet.<br />
BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) bezeichnen die Art in der Umgebung von Auma als häufigen Brutvogel,<br />
der in Fichtendickichten, aber auch in Schrebergärten und Reisighaufen brütet. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen<br />
LANGE & LEO (1978) den Bestand auf etwa 300 Paare. In den Jahren 1976/1977 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (GÜNTHER 1978 b). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere gezählt<br />
oder geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf vier Kontrollflächen mit 74 ha 40 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf<br />
einer Kontrollfläche mit 22 ha 2 bis 3 BP, Altkreis Zeulenroda: auf zwei Kontrollflächen mit 17 ha 4 BP. Auf<br />
weiteren Flächen wurde der Bestand ebenfalls taxiert: Umgebung von Auma auf 4000 ha 50 BP und gesamter<br />
Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 22000 ha 1500 bis 2000 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im<br />
Untersuchungsgebiet mit 1500 bis 2000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf<br />
91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 55 bis 89 Reviere ermittelt wurden.<br />
Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald<br />
mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 4 Reviere der Heckenbraunelle gefunden (VOOG). BAUM<br />
fand 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei Weida 2 BP. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten<br />
2009 auf der gleichen Fläche ebenfalls 2 BP fest.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 234
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Prädation durch Katzen<br />
- Übertriebene „Ordnungsliebe“ in Parks und Gärten, Verlust von alten Hecken, Ruderalbeständen und<br />
Reisighaufen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Bekämpfung freilaufender Hauskatzen<br />
- Gestaltung naturnaher Gärten und Parkanlagen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 235
Haussperling, Passer domesticus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Haussperling<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In Gera und Umgebung war der Haussperling in der Mitte des 19.Jahrhunderts ein sehr häufiger Brutvogel.<br />
(Ornithologische Sektion Gera 1859). Auch LIEBE (1873) fand die Art noch als häufigen Brutvogel in der<br />
Stadt Gera und in den umliegenden Dörfern. Offenbar verschlechterte sich bereits zu dieser Zeit der innerstädtische<br />
Lebensraum des Haussperlings, und es kam zu Bestandsrückgängen. LIEBE vermerkt hierzu:<br />
„Theilweise mag freilich auch das Seltnerwerden des Sperlings in der innern Stadt einfach davon herrühren,<br />
daß die Thiere sich mehr in die Vorstädte ziehen, wo der Aufenthalt ihnen offenbar besser zusagt.“ Für Ostthüringen<br />
gibt LIEBE (1878) eine Zunahme an, aber auch das Fehlen in einigen kleineren Ortschaften und<br />
Einzelgehöften. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Gemeiner, allbekannter<br />
Brutvogel. Fehlt bei der Neu- und Knottenmühle (Mangel an Getreidefeldern, Nähe des Waldes!).“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) ist der Haussperling ein gemeiner Brutvogel in den Orten Thüringens.<br />
Auch in der Umgebung von Hohenölsen war er ein häufiger Brutvogel (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Noch in den 1950er-Jahren fand eine intensive Sperlingsbekämpfung statt, die staatlicherseits von den Bauern<br />
gefordert wurde. (WICHLER in Anonym 1952). Darüber berichtet WICHLER (1952): „Im vorigen Jahr (ich<br />
wohnte in einem Dorf bei Gera) bat mich der Bürgermeister des Ortes, die Pflichtablieferung für Sperlinge zu<br />
leiten. Jeder Bauer sah sich nun gezwungen, eine Zahl Sperlinge, die wie bekannt nach der ha-Zahl berechnet<br />
wurde, zusammenzubekommen. Was wurde nun abgeliefert? Zunächst mal Sperlinge, aber auch nackte<br />
Bachstelzen, Rotschwänze, Grün- und Rothänflinge. Man versuchte also, mich zu betrügen. Als die<br />
Ablieferer einsahen, daß sie bei mir nicht ankamen, hörten diese Übeltaten auf. In einem Falle brachte man<br />
mir Rauchschwalbeneier statt Sperlingseier, weil diese ja ersteren in Farbe sehr ähnlich sind. Ich glaube,<br />
eine derartige Sollerfüllung dürfte bald mehr Schaden als Nutzen verursachen. Wie wird es in Gemeinden<br />
aussehen, wo kein Vogelkenner die Ablieferung vornimmt?“<br />
Von GÜNTHER (1969) wird der Haussperling im Altkreis Gera-Stadt und -Land als sehr verbreiteter Brutvogel<br />
mit mehreren Tausend BP angegeben. Nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Art in und um Auma<br />
ein sehr häufiger Brutvogel. Auch für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand auf mehrere<br />
Tausend Paare. In den Jahren 1979/1980 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (WOLF 1984<br />
a). Auf zwei Kontrollflächen im Altkreis Gera-Stadt und -Land wurden die Reviere gezählt oder geschätzt: auf<br />
1 ha Altbaugebiet in Ronneburg 2 bis 5 BP und auf 75 ha Dorfgebiet von Großenstein 300 bis 400 BP. LAN-<br />
GE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 5000 bis 7000 BP an. Für diese Schätzung lag eine<br />
halbquantitative Erfassung auf 89 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 1057 bis 1485<br />
Reviere ermittelt wurden. Die Autoren verweisen auf einen starken Rückgang in den letzten Jahren. In einem<br />
Wohngebiet (Altbau) im Geraer Ostviertel wurden 2002 auf 25 ha 20 BP gezählt und in der Ortslage Linda<br />
brüteten 2005 auf 25,5 ha 23 BP (LIEDER, unveröff.). Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 2<br />
bis 5 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 236
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Frühere intensive Verfolgung<br />
- Drastische Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Verlust an Nistplätzen, Rückgang der verfügbaren<br />
Nahrung während der Jungenaufzucht sowie im Winter durch Veränderungen in der Viehhaltung und der<br />
Landbewirtschaftung<br />
- Verluste durch den Straßenverkehr<br />
- Prädation durch Hauskatzen, Schleiereulen und Sperber<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung in der Landwirtschaft<br />
- Erhalt und Wiederherstellung einer naturnahen, reich gegliederten Kulturlandschaft<br />
- Erhalt von Brutplätzen an Gebäuden<br />
- Winterfütterung<br />
- Bekämpfung freilaufender Hauskatzen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 237
Feldsperling, Passer montanus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Feldsperling<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In Gera und Umgebung war der Feldsperling ein sehr häufiger Brutvogel (Ornithologische Sektion Gera<br />
1859). LIEBE (1873) schreibt: „Auch der Feldsperling ist ein sehr gemeiner Vogel, der allerdings mehr als<br />
sein Vetter den Aufenthalt in der Nähe der Dörfer liebt. Er ist in neuerer Zeit entschieden häufiger geworden<br />
als früher, - wol infolge der fortgesetzten Waldrodung.“ Auch für Ostthüringen kann er eine Erhöhung feststellen<br />
„wie das bei der Zunahme des Ackerlandes nicht anders zu erwarten“ war (LIEBE 1878). Nach seinen<br />
Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Nicht seltener Brutvogel außerhalb der Stadt.“<br />
1900 bis 1950<br />
In der Umgebung von Hohenölsen war der Feldsperling ein häufiger Brutvogel (HIRSCHFELD 1932).<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land wird der Bestand auf über 1000 BP geschätzt (GÜNTHER 1969). Nach<br />
BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ist die Art in den Dörfern um Auma ein recht häufiger Brutvogel. In<br />
Auma erreicht er aber bei weiten nicht die Siedlungsdichte des Haussperlings. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen<br />
LANGE & LEO (1978) den Bestand auf über 1000 Paare. In den Jahren 1979/1980 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (WOLF 1984 b). Auf drei Kontrollflächen bei Ronneburg mit 20,5 ha wurden 24 bis<br />
39 BP gezählt bzw. geschätzt. Eine weitere Kontrollfläche bei Auma mit 0,75 ha hatte 6 BP. LANGE & LIEDER<br />
(2001) 1 geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 3000 bis 5000 BP an. Für diese Schätzung<br />
lag eine halbquantitative Erfassung auf 87 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 247 bis<br />
413 Reviere ermittelt wurden. Die Autoren verweisen auf einen starken Rückgang in den letzten Jahren.<br />
In der Ortslage Linda brüteten 2005 auf 25,5 ha 4 BP (LIEDER, unveröff.). Im ca. 6 ha großen Naturschutzlehrobjekt<br />
Rückersdorf mit einem reichlichen Angebot an Nistkästen wurde nach LIEDER (2009) folgende<br />
Bestandsentwicklung festgestellt (Anzahl BP): 1998 (1), 2003 (2), 2005 (3), 2006 (6), 2007 (6), 2008 (10). Im<br />
60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Nahrungsmangel infolge der Intensivierung der Landwirtschaft (Starke Düngung, Biozid- und Beizmitteleinsatz,<br />
häufige Mahd, Grünlandumbruch, Beseitigung der Randstreifen und Saumbiotope, früher Umbruch<br />
von Stoppelfeldern)<br />
- Verlust an Brutplätzen durch Zerstörung von Streuobstwiesen und Feldgehölzen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Neuschaffung von Feldgehölzen und Hecken<br />
- Extensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft, Angebot von Nisthilfen<br />
1<br />
Irrtümlicherweise wird in dieser Arbeit auf Seite 64 beim Feldsperling eine falsche Bestandsgröße von 5000 – 7000 BP angegeben.<br />
Dieser Wert ist zu streichen.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 238
Baumpieper, Anthus trivialis (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Baumpieper<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In Gera und Umgebung war der Baumpieper ein häufiger Brutvogel (Ornithologische Sektion Gera 1859).<br />
Nach LIEBE (1873) hat der Bestand „im Lauf der letzten 4 Jahrzehnte ganz allmälig so zugenommen, daß sie<br />
jetzt geradezu als gemein bezeichnet werden müssen. Auf jedem Waldschlag, dessen Bestand noch so<br />
klein ist, und auf jeder Waldblöße brüten mehrere Paare dieser verträglichen Thiere; an jeder Waldwand<br />
kann man die Männchen in die blaue Luft emporsteigen sehen. ... Sogar in der Nähe der Ortschaften und<br />
weitab vom Wald in den Obstanlagen auf freiem Feld lassen sich seit Jahren Spitzlerchen nieder, um zu<br />
brüten: so u. A. in den Pflaumbaumreihen östlich vom Geraer Krankenhaus.“ Diese Angaben werden von<br />
LIEBE 1878 nochmals bestätigt. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Häufiger<br />
Brutvogel unserer Waldblößen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) war der Baumpieper in der Umgebung von Hohenölsen ein häufiger Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land wird der Bestand auf mehr als 1000 BP geschätzt (GÜNTHER 1969). Im<br />
Gebiet um Auma besiedelt der Baumpieper die Kahlschläge der Wälder, die Waldränder und angrenzenden<br />
Wiesen (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand<br />
auf etwa 200 BP. In den Jahren 1975/1976 fand eine überregionale Bestandserfassung statt<br />
(GÜNTHER 1977). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere gezählt bzw. geschätzt: Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land: auf zwei Kontrollflächen mit 38 ha 31 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf zwei Kontrollfläche mit<br />
90 ha 13 bis 14 BP, Altkreis Zeulenroda: auf zwei Kontrollflächen mit 17 ha 4 BP. Auf weiteren Flächen wurde<br />
der Bestand geschätzt: Umgebung von Auma mit 1615 ha ca. 32 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den<br />
Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 500 bis 1000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 113 bis 196 Reviere ermittelt<br />
wurden. Die Autoren verweisen auf einen seit Jahren rückläufigen Bestand. Im 6 ha großen Naturschutzlehrobjekt<br />
Rückersdorf wurde folgende Bestandsentwicklung festgestellt (Anzahl BP): 1998 (4), 2000 (4),<br />
2002 (3), 2003 (2), 2004 (1), 2005 (1), 2006 (1), 2007 (1) (LIEDER 2009). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung<br />
im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald,<br />
auf 115 ha ökologisch wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier wurden<br />
55 Reviere des Baumpiepers ermittelt (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 239
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft (Trockenlegung und Umbruch von<br />
Grünland, frühe Mahd, Flurbereinigung, Ausräumung der Landschaft, extremer Biozid- und Düngemitteleinsatz,<br />
Aufgabe von extensiv genutzten Flächen, Entfernung von Hochstammobstbäumen, Eutrophierung<br />
mit schnellem Zuwachsen der Waldränder)<br />
- Intensive Freizeitnutzung (Spaziergänger mit Hunden)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung in der Land- und Forstwirtschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 240
Gebirgsstelze, Motacilla cinerea Tunn.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gebirgsstelze<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die „Wasserstelze“ wird für Gera und Umgebung als häufiger Brutvogel bezeichnet (Ornithologische Sektion<br />
Gera 1859). Diese Einschätzung teilt auch LIEBE (1873): „Die gelbe Bachstelze ist im ganzen Gebiet anzutreffen.<br />
Es mag auf jede an einem Fluß oder an einem stärkeren Bach gelegene Ortschaft im Durchschnitt<br />
so ziemlich ein Paar kommen. In der Nähe der Geraer Wasserkunst nistet ein Pärchen regelmäßig im Mühlgraben.“<br />
Eine ähnliche positive Aussage trifft LIEBE (1878) für ganz Ostthüringen. Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Gebirgsstelze (gelbe Bachstelze). Seltener wie vorige [Bachstelze],<br />
aber allenthalben an der Elster und ihren Zuflüssen brütend zu finden (Bretmühle, Neumühle, Rothenthal,<br />
Dölaumühle, Elsterberg, Steinicht; Triebtal, Tremnitzgrund. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) stellen für Thüringen einen Bestandsrückgang fest, der vermutlich auf die<br />
zunehmende Verschmutzung der Gewässer zurückzuführen ist.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land wird der Bestand auf weniger als 100 BP geschätzt und es wird auf<br />
einen Rückgang hingewiesen (GÜNTHER 1969): „Sicher ist die Gebirgsstelze heute seltener als früher, denn<br />
manches Gewässer ist zu stark verschmutzt und wird gemieden. So verschwand sie um 1960 aus dem Bereich<br />
des Gessenbachs und seiner Zuflüsse, wo es noch vor 10 Jahren mindestens 7 Brutpaare gab. An der<br />
Auma, die klares Wasser führt, blieb dagegen ein guter Bestand bis heute.“ Im Gebiet um Auma besiedelt<br />
die Gebirgsstelze nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) den gleichnamigen Flusslauf. Als weitere Brutplätze<br />
werden Aumühle, Sophienbad, Mahlteich bei Reinsdorf sowie sporadisch Wolge und Leschke genannt.<br />
Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand auf etwa 50 BP, wobei auf eine<br />
deutliche Abnahme gegenüber früher hingewiesen wird. In den Jahren 1979/1980 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1981 b). An verschiedenen Gewässern wurden die Reviere gezählt oder<br />
geschätzt: linke Nebenbäche der Elster bei Gera auf 16 km 18 bis 26 BP, Brahme auf 7 km 8 bis 10 BP,<br />
Auma auf 15 km 20 bis 25 BP, Elster oberhalb Elsterberg auf 6 km 4 BP, Aubach auf 3 km 2 BP,<br />
Tremnitzbach auf 6 km 4 BP, Gessenbach 1 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 200<br />
bis 400 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 88 km² Fläche zwischen 1995<br />
und 2000 zugrunde, bei der 23 bis 24 Reviere ermittelt wurden.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt zwischen 2005 und 2009 wurde der Bestand auf 146 bis<br />
290 BP geschätzt. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 241
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust bzw. Verschlechterung des Lebensraumes durch Flussverbauung, Abriss von Mühlen, Renovierung<br />
von Brücken und Wehren mit Betonverschalung, Verlust naturnaher Steilufer<br />
- Geringeres Nahrungsangebot an stark verschmutzten Gewässern<br />
- Störungen am Brutplatz<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Renaturierung von Fließgewässern<br />
- Schaffung von Brutnischen bei der Sanierung von Brücken und Wehren<br />
- Verbesserung der Wasserqualität der Fließgewässer<br />
- Angebot von künstlichen Nisthilfen<br />
Verbreitungskarte 28: Gebirgsstelze<br />
4 – 7 8 – 20 4 – 7<br />
4 – 7 8 – 20 4 – 7 1<br />
8 – 20 8 – 20 4 – 7 2 – 3<br />
4 – 7 4 – 7 4 – 7 1<br />
8 – 20 4 – 7 2 – 3 4 – 7 1<br />
4 – 7 8 – 20 1 2 – 3 4 – 7<br />
2 – 3 2 – 3 2 – 3 8 – 20 4 – 7<br />
4 – 7 2 – 3 2 – 3 2 – 3 4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 242
Bachstelze, Motacilla alba L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Bachstelze<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Bachstelze als einen sehr häufigen Brutvogel in<br />
Gera und Umgebung. Auch LIEBE (1873) kennt sie als häufigen Brutvogel mit gleichbleibendem Bestand. Für<br />
Ostthüringen bemerkt LIEBE (1878) eine zwar langsame, aber stetige Zunahme. Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr häufiger, allgemein bekannter Brutvogel an allen Wasserläufen.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HIRSCHFELD (1932) war die Bachstelze in der Umgebung von Hohenölsen ein häufiger Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land stellte GÜNTHER (1969) in den 1960er-Jahren eine Abnahme fest. Er<br />
schätzte den Bestand auf nicht über 500 BP. Im Gebiet um Auma ist die Bachstelze nach BARNIKOW, SCHÜTZ<br />
& STÖßEL (1971) ein häufiger Brutvogel. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> wird die Bachstelze als sehr häufiger Brutvogel<br />
bezeichnet (LANGE & LEO 1978). In den Jahren 1979/1980 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (ÖLSCHLEGEL 1982 a). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere gezählt oder geschätzt:<br />
Altkreis Gera-Stadt und -Land: Gera-Zwötzen/Kauern/Hilbersdorf auf 900 ha 11 bis 20 BP, Röpsen/Dorna/<br />
Gera-Roschütz auf 1500 ha 25 bis 30 BP, Gera-Pforten auf 100 ha 5 BP, Rußdorf auf 15 ha 2 BP, Rüdersdorf<br />
bis Hartmannsdorf auf 16 km Bachlauf 25 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: <strong>Greiz</strong>-Aubachtal auf 40 ha 5 BP, RNG<br />
Großkundorf auf 150 ha 6 bis 8 BP, Altkreis Zeulenroda: in der Umgebung von Auma auf 4000 ha 50 BP.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 2000 bis 3000 BP an. Für diese Schätzung lag eine<br />
halbquantitative Erfassung auf 87 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 125 bis 214 Reviere<br />
ermittelt wurden. In der Ortslage Linda brüteten 2005 auf 25,5 ha 3 BP (LIEDER, unveröff.). Im 60 ha großen<br />
<strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 10 bis 15 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
- Nahrungsmangel durch Schadstoffimmissionen<br />
- Verlust von Nistplätzen bei der Sanierung von Bauwerken<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Schaffung von Brutnischen bei der Sanierung von Brücken und Wehren<br />
- Angebot von künstlichen Nisthilfen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 243
Buchfink, Fringilla coelebs L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Buchfink<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
In Gera und Umgebung war der Buchfink ein sehr häufiger Brutvogel (Ornithologische Sektion Gera 1859;<br />
LIEBE 1873). Für Ostthüringen konnte LIEBE (1878) eine Zunahme des Bestandes feststellen. Nach seinen<br />
Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Allbekannter, häufiger Brutvogel.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) war der Buchfink in Thüringen ein sehr häufiger Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) den Bestand auf mehrere Tausend BP. Im<br />
Gebiet um Auma ist der Buchfink nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ebenfalls ein sehr häufiger Brutvogel.<br />
Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> geben LANGE & LEO (1978) über 1000 BP an. In den Jahren 1977 bis 1979 fand<br />
eine überregionale Bestandserfassung statt (LANGE 1984 c). Auf Kontrollflächen wurden die Reviere gezählt<br />
bzw. geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf zehn Flächen mit 825 ha 72 bis 86 BP (wobei sicherlich<br />
viele waldfreie Flächen einbezogen waren), Altkreis <strong>Greiz</strong>: <strong>Greiz</strong>-Aubachtal auf zwei Flächen mit 42 ha 22<br />
bis 25 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 8000 bis 12000 BP an. Für diese Schätzung<br />
lag eine halbquantitative Erfassung auf 91 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 478<br />
bis 733 Reviere ermittelt wurden. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im Wismut-<br />
Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald. Hier wurden 23 Reviere<br />
des Buchfinken festgestellt (VOOG). In der Ortslage Linda brüteten 2005 auf 25,5 ha 7 BP (LIEDER,<br />
unveröff.). BAUM stellte 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei Weida 9 BP fest. Bei einer Erfassung<br />
2009 fanden LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) auf der gleichen Fläche 7 BP. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurde der Bestand auf 5 bis 10 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Veränderungen der landwirtschaftlichen Nutzung mit erhöhtem Biozideinsatz, Rückgang der Brachflächen<br />
und zunehmend „verlustarme Ernte“.<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 244
Kernbeißer, Coccothraustes coccothraustes (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Kernbeißer<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Der Kernbeißer war in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein häufiger Brutvogel in Gera und Umgebung (Ornithologische<br />
Sektion Gera 1859). Diese Einschätzung teilt LIEBE (1873) nicht: „Der Kernbeißer gehört schon<br />
zu den seltenern Bewohnern des Gebiets; am häufigsten trifft man noch nistende Familien in dessen östlichen<br />
und westlichen Theilen bei Langenberg, Heukewalde, Aaga, Krossen, Nöbdenitz…. Er wird von Jahr<br />
zu Jahr seltner, da ihm von den Pächtern der Kirschbaumanlagen eifrig nachgestellt wird.“ 1878 bezeichnet<br />
LIEBE den Kernbeißer als „nicht selten im Gebiet. Früher war er häufiger, wenn auch nur in den nördlich und<br />
östlich gelegenen milderen Strichen … und so schwindet seine Zahl von Jahr zu Jahr mehr zusammen.“<br />
Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr selten: Thürnhof; Wesenitz bei Elsterberg.<br />
(P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) war der Kernbeißer in Thüringen ein verbreiteter Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
DANNHAUER (1963) erwähnt Vorkommen im Elstertal bei Elsterberg. Im Altkreis Gera-Stadt und -Land ist<br />
nach GÜNTHER (1969) der Kernbeißer ein seltener Brutvogel. Er schätzt den Bestand auf etwa 50 BP. Auch<br />
im Gebiet um Auma ist der Kernbeißer nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ein seltener Brutvogel. Als<br />
Brutplätze werden der Untendorfer Wald und die Schrebergartenanlage am Sophienbad genannt. LANGE &<br />
LEO (1978) schätzen im Altkreis <strong>Greiz</strong> den Bestand auf unter 100 BP. In den Jahren 1977/1978 fand eine<br />
überregionale Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1979 a). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die<br />
Reviere gezählt bzw. geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf acht Kontrollflächen (meist kleine Gehölze)<br />
mit 89 ha 12 bis 15 BP, auf ca. 2000 ha um Münchenbernsdorf ca. 15 BP, Altkreis Zeulenroda: in der<br />
Umgebung von Auma 4 bis 5 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet<br />
mit 500 bis 800 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 84 km² Fläche zwischen<br />
1995 und 2000 zugrunde, bei der 54 bis 66 Reviere ermittelt wurden. BAUM fand 1988 im 8,1 ha großen<br />
NSG „Buchenberg“ bei Weida kein BP. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten 2009 bei einer Erfassung<br />
auf der gleichen Fläche 1 BP fest. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 2 bis 5 BP<br />
geschätzt<br />
(LUMPE 2008). In der Ortslage Linda brüteten 2005 2 BP auf 25,5 ha (LIEDER, unveröff.).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensive Waldbewirtschaftung<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Weniger intensive Durchforstung, Erhalt von Altholzinseln und Überhältern, längere Umtriebszeiten<br />
- Ausdehnung parkartiger Altholzbestände in der Kulturlandschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 245
Gimpel, Pyrrhula pyrrhula (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Gimpel<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) kann kein konkretes Brutvorkommen aus der Umgebung von Gera<br />
benennen („Er soll in den südlichen Gebirgswäldern nisten“). Demgegenüber bezeichnet LIEBE (1873) den<br />
Gimpel als „nicht eben sehr selten.“ Er kannte Vorkommen „hinter dem Martinsgrund und im Forst nahe beim<br />
Wacholderbusch, - im weitern Gebiet im Niederndorfer Forst unweit Kaltenborn und vielerorts in den westlichen<br />
Fichtenwäldern von Weißenborn bis nach Geroda hin.“ Für Ostthüringen stellt LIEBE (1878) einen starken<br />
Rückgang fest. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Selten:<br />
Gasparinenberg, Tiergarten unweit des Sauwehres, Krümmetal, Pöllwitzer Wald.“<br />
1900 bis 1950<br />
In Thüringen ist der Gimpel als Brutvogel in den westlich der Elster gelegen Teilen bekannt und fehlt im östlichen<br />
Teil (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975). Nach HIRSCHFELD (1932) ist der Gimpel Brutvogel in der Umgebung<br />
von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land schätzt GÜNTHER (1969) den Bestand auf etwa 100 BP. Neben Nadelwäldern<br />
werden auch Brutvorkommen in Laubwäldern gefunden, so bei Gera-Untermhaus und im Brunnenholz<br />
bei Ronneburg. Im Gebiet um Auma brütet der Gimpel regelmäßig in spärlicher Anzahl (BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL 1971). Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand auf 100 bis 200<br />
BP, die über das ganze Kreisgebiet verteilt brüten. In den Jahren 1977/1978 fand eine überregionale Bestandserfassung<br />
statt (KLEHM 1980). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere gezählt bzw.<br />
geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf acht Kontrollflächen mit 273 ha Waldfläche 4 BP, Altkreis<br />
Zeulenroda: auf sechs Kontrollflächen mit 8 ha Fichtenschonungen 9 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den<br />
Gesamtbestand mit 300 bis 500 BP an. BAUM fand 1988 im 8,1 ha großen NSG „Buchenberg“ bei Weida<br />
kein BP. LIEDER & LIEDER-SÖLDNER (2010) stellten bei einer Erfassung 2009 auf der gleichen Fläche 1 BP<br />
fest. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt wurde der Bestand zwischen 2005 und 2009 auf 170 bis<br />
428 BP geschätzt.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust von Hecken und Feldgehölzen und starke Beeinträchtigung der Wildkrautflora<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Verbesserung der Strukturvielfalt in der Kulturlandschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 246
Verbreitungskarte 29: Gimpel<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
4 – 7 2 – 3<br />
8 – 20 2 – 3 2 – 3<br />
8 – 20 4 – 7 4 – 7 4 – 7<br />
8 – 20 4 – 7 4 – 7 4 – 7<br />
8 – 20 4 – 7 2 – 3 2 – 3<br />
8 – 20 8 – 20 2 – 3 4 – 7 2 – 3<br />
2 – 3 2 – 3 8 – 20 8 – 20 21 – 50 8 – 20<br />
2 – 3 2 – 3 8 – 20 2 – 3 21 – 50<br />
21 – 50 8 – 20<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 247
Girlitz, Serinus serinus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Girlitz<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Erstmals wird der Girlitz von der Ornithologischen Sektion Gera (1859) als seltener Brutvogel für die Küchengartenallee<br />
(Gera-Untermhaus) genannt. Danach fehlten für einige Jahre weitere Nachweise. Dazu<br />
berichtet LIEBE (1873): „Erst 1871 wanderten wieder zwei Pärchen ein, welche im Küchengarten und bei<br />
Kuba [beide Orte in Gera-Untermhaus] ihr Heim aufschlugen, in Linden und Kastanienbäumen nisteten und<br />
auch 3 und 4 Junge glücklich ausbrachten. 1872 erschienen 3 Pärchen, von denen das eine sich auf dem<br />
städtischen Friedhof einquartierte und die beiden übrigen wieder den Küchengarten und die Gärten von Kuba<br />
aussuchten.“ 1873 konnte LIEBE bereits sieben Paare feststellen (LIEBE 1875). Auch SCHUMANN (1878)<br />
erwähnt den Girlitz als Brutvogel bei Gera. Die weitere Ausbreitung schildert LIEBE (1878): „Jetzt sind sie<br />
nicht blos im ganzen Elster- und Saalethal heimisch, sondern auch in allen grösseren Nebenthälern, wo es<br />
nur hinreichend viel Obstgärten giebt.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Dieser<br />
seit etwa 100 Jahren aus dem Süden eingewanderte Vogel hat sich seit etwa 1870 auch in und um <strong>Greiz</strong><br />
eingebürgert. Er zählt heute zu den regelmäßigen, nicht seltenen Brutvögeln des Gebietes und bevorzugt<br />
Gärten, sowie mit Laubbäumen bepflanzte Straßen.“<br />
HILDEBRANDT, der 1889 nach Thüringen kam, fand den Girlitz bereit überall als ständigen Brutvogel vor (HIL-<br />
DEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
1900 bis 1950<br />
HILDEBRANDT (1919) bemerkte eine weitere auffällige Zunahme. HIRSCHFELD (1932) stellte fest, dass der<br />
Girlitz noch Verbreitungslücken bei uns aufweist. So besiedelte der Vogel die Umgebung von Hohenleuben<br />
erst 1932 und Berga noch später (FLÖßNER 1979).<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist der Girlitz im Altkreis Gera-Stadt und -Land ein seltener Brutvogel mit etwa 100<br />
BP. Im Gebiet um Auma war er nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) Brutvogel in Auma und den umliegenden<br />
Ortschaften. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> schätzen LANGE & LEO (1978) über 100 BP. In den Jahren<br />
1977/1978 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1979 b). Auf verschiedenen Kontrollflächen<br />
wurden die Reviere gezählt bzw. geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf fünf Kontrollflächen<br />
mit 224 ha 60 bis 67 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 500 bis 800 BP an. Für<br />
diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 88 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 105 bis 129 Reviere ermittelt wurden. In einen Wohngebiet (Altbau) im Geraer Ostviertel wurden<br />
2002 auf 25 ha 2 BP und in der Ortslage Linda 2005 auf 25,5 ha 1 BP festgestellt (LIEDER, unveröff.). Im 60<br />
ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 1 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt zwischen 2005 und 2009 wurde der Bestand auf 315 bis<br />
730 BP geschätzt.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 248
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Intensivierung der Landwirtschaft, Verbauung von Siedlungsbereichen, intensivere<br />
Nutzung von Gärten mit Biozideinsatz und Reduktion der Wildkräuter<br />
- Verlust von Streuobstwiesen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Wiederherstellung einer reich strukturierten Kulturlandschaft mit Brachflächen, Ackerrandstreifen und<br />
Ruderalflächen<br />
- Einstellung der Düngung und übertriebenen Pflege von städtischen Grünflächen<br />
- Reduzierung des Biozid- und Düngemitteleinsatzes in der Landwirtschaft und in Gärten<br />
- Keine Spritzung von Ackerrainen und Bahndämmen<br />
- Erhalt und Neuanlage von Streuobstwiesen<br />
Verbreitungskarte 30: Girlitz<br />
8 – 20 8 – 20 21 – 50<br />
4 – 7 21 – 50 8 – 20 8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20 21 – 50<br />
8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20 21 – 50 8 – 20<br />
21 – 50<br />
2 – 3 2 – 3 4 – 7 2 – 3<br />
21 – 50 21 – 50 2 – 3 2 – 3 2 – 3<br />
4 – 7 4 – 7 4 – 7 8 – 20 8 – 20 4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7 2 – 3 2 – 3 8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 249
Kiefernkreuzschnabel, Loxia pytyopsittacus Bork.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Ehemaliger Brutvogel<br />
Kiefernkreuzschnabel<br />
Foto: E. Lietzow,<br />
www.lietzow-naturfotografie.de<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
BREHM (1820 – 22) stellte im Mai 1817 Bruten in der Umgebung von Renthendorf fest. Die ersten Jungvögel<br />
beobachtete er Ende Juni, die letzten Jungvögel mit Federkielen noch am 10. August. Im November 1818<br />
erhielt er brutreife Vögel mit erbsengroßen Hoden. Im Februar 1819 wurden mehrere Paare beim Nestbau<br />
beobachtet. LIEBE (1878) führt nur Brutnachwiese außerhalb unseres Gebietes auf. Er schreibt jedoch: „Da<br />
nun ferner nicht 2 Jahre vergehen, wo ich nicht an irgend einem Punkte Ostthüringens diesen Kreuzschnabel<br />
höre, so dürfte es wohl gerechtfertigt sein, wenn ich ihn als einen ziemlich seltenen und noch immer seltener<br />
werdenden ostthüringischen Brutvogel mit einreihe.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt<br />
HELLER (1926): „Sehr seltener und ganz unregelmäßiger Brutvogel im Pöllwitzer Revier.“<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Gefährdungsursachen sind bei diesem ehemaligen Brutvogel nicht erkennbar<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Es sind keine speziellen Schutzmaßnahmen erforderlich<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 250
Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvirostra L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Fichtenkreuzschnabel<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. jahrhundert<br />
Nach BREHM (1820 – 22) kam der Fichtenkreuzschnabel in der Umgebung von Renthendorf vor. So traf er<br />
ihn von Mai 1818 bis März 1819 in größerer Zahl an. Der Fichtenkreuzschnabel wurde als Brutvogel in der<br />
Mitte des 19. Jahrhundert in der Umgebung von Gera festgestellt (Ornithologische Sektion Gera 1859). LIEBE<br />
(1873) schreibt: „Der Fichtenkreuzschnabel (Krinitz, Kreuzschnabel) erscheint nur in gewissen Jahrgängen<br />
auf dem Gebiet, aber dann sehr zahlreich. So brüteten vor kürzerer Zeit im Spätwinter (1868, wenn ich nicht<br />
irre) eine Menge im Stadtwald in der Nähe des Beck`schen Häuschens, und vor etwas längerer Zeit im zeitigen<br />
Frühjahr eine noch weit größere Zahl in den Forsten bei Klosterlausnitz.“ Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr selten und ganz unregelmäßig: Pöllwitz, Neuärgerniß, Göttendorf.“<br />
1900 bis 1950<br />
„Der Fichtenkreuzschnabel ist in den Wäldern Thüringens verbreiteter, in guten Zapfenjahren oft massenhaft<br />
auftretender Brutvogel. Doch kommen auch, wie schon Brehm feststellte, Jahre vor, in denen es massenhaft<br />
Fichtenzapfen und nur wenige Kreuzschnäbel gibt.“ (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land kann GÜNTHER (1969) keine sicheren Angaben zum erneuten Brutvorkommen<br />
machen. Im Gebiet um Auma trat der Fichtenkreuzschnabel 1966 bis 1968 nach BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ganzjährig auf. Die Autoren konnten 1968 eine Brut nachweisen. LANGE & LEO<br />
(1978) bezeichnen den Fichtenkreuzschnabel als unregelmäßigen Brutvogel im Altkreis <strong>Greiz</strong>. In den Jahren<br />
1979/1980 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (LANGE 1984 b). Danach gab es im Altkreis Gera<br />
nur 1968 die Beobachtung eines singenden Männchens. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wurde je ein Brutnachweis<br />
1978 im Forstrevier Waldhaus und bei <strong>Greiz</strong>-Moschwitz erbracht. Im Altkreis Zeulenroda bestand fast alljährlich<br />
Brutverdacht. Nach LANGE & LIEDER (2001) schwankt das Brutvorkommen zwischen 0 und 30 BP. Es<br />
gibt Jahre mit starken Einflügen und Jahre, in denen die Art ganz fehlt.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt zwischen 2005 und 2009 wurde der Bestand auf 108 bis<br />
249 BP geschätzt. Diese Dichte trifft sicherlich nur auf die guten Jahre zu.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 251
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch immissionsbedingte Waldschäden<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Langfristige Reduktion des Schadstoffausstoßes<br />
Verbreitungskarte 31: Fichtenkreuzschnabel<br />
8 – 20<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
2 – 3<br />
8 – 20 8 – 20 8 – 20 8 – 20 4 – 7<br />
21 – 50 21 – 50<br />
4 – 7 8 – 20<br />
8 – 20 8 – 20<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 252
Grünfink, Carduelis chloris (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Grünfink<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Der Grünfink wird von der Ornithologischen Sektion Gera (1859) als häufiger Brutvogel in Gera und Umgebung<br />
bezeichnet. LIEBE (1873) schreibt: „Der Grünfink ist recht häufig im Gebiet, und ist um so häufiger, je<br />
reicher die Gegend an Pappeln und Obstbäumen ist. Auch mehrt sich sein Bestand sichtlich, obgleich die<br />
Gärtner ihm todtfeind sind und ihn auf jede Weise verfolgen.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881<br />
schreibt HELLER (1926): „Sehr häufiger und bekannter Brutvogel des gesamten Gebietes.“<br />
1900 bis 1950<br />
In ganz Thüringen war der Grünfink ein häufiger Brutvogel (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975). Auch für die<br />
Umgebung von Hohenleuben nennt ihn HIRSCHFELD (1932) einen zahlreichen Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land ist der Grünfink GÜNTHER (1969) zufolge „nach dem Haussperling der häufigste<br />
Brutvogel im Bereich der Ortschaften. ... Außerhalb der Ortschaften brütet er in wesentlich geringerer<br />
Zahl.“ Er schätzt den Bestand auf einige Tausend BP. Für das Gebiet um Auma teilen BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖßEL (1971) folgendes mit: „Ein überaus häufiger Vogel im ganzen Gebiet. Die Häufigkeit in den Ortschaften<br />
überwiegt die im Walde bei weitem.“ Im Altkreis <strong>Greiz</strong> stufen LANGE & LEO (1978) den Grünfink als sehr<br />
häufigen Brutvogel ein. In den Jahren 1977/1978 fand eine überregionale Bestandserfassung statt<br />
(ZSCHIEGNER 1979 a). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere gezählt bzw. geschätzt: Altkreis<br />
Gera-Stadt und -Land: auf sechs Kontrollflächen mit 166,5 ha 31 bis 39 BP. Die höchste Dichte wurde auf<br />
einem 9 ha großen Friedhof gefunden, wo 15 bis 20 Paare brüteten. Dagegen fehlte die Art in einem 72 ha<br />
großen Waldgebiet. Für die Umgebung von Auma werden auf 4000 ha 150 bis 200 BP genannt. LANGE &<br />
LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 6000 bis 8000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 87 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 345 bis 439 Reviere ermittelt<br />
wurden. 2002 wurden in einen Wohngebiet (Altbau) im Geraer Ostviertel auf 25 ha 9 BP und 2005 in der<br />
Ortslage Linda auf 25,5 ha ebenfalls 9 BP festgestellt (LIEDER, unveröff.). Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde<br />
der Bestand auf 5 bis 10 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Verlust oder Monotonisierung der ehemals reich strukturierten Kulturlandschaft<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft (Überdüngung, zunehmender Biozideinsatz, Rückgang der Winterbrache,<br />
Einsatz giftiger Saatgut-Beizmittel)<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft mit reduzierten Dünger- und Biozideinsatz<br />
- Erhalt einer reich gegliederten Kulturlandschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 253
Stieglitz, Carduelis carduelis (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Stieglitz<br />
Foto: fokus-natur/Pröhl<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert:<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) stellte die Art als sehr häufigen Brutvogel in und um Gera fest.<br />
LIEBE (1873) spricht für Gera und Umgebung von einer Zunahme. Für Ostthüringen berichtet LIEBE (1878)<br />
sogar von einer Arealvergrößerung: „Im Gegensatz zum Hänfling hat sich der Stieglitz stark vermehrt. Einerseits<br />
hat sich sein Wohnbezirk, der im ersten Drittheil dieses Jahrhunderts die hochgelegenen Striche im<br />
Süden, als so ziemlich die Grafschaften Schleiz, Ebersdorf und <strong>Greiz</strong>, den Frankenwald und sogar einen<br />
guten Theil der sogenannten Haide (Buntsandsteinrücken zwischen dem Saal-, Roda- und Orlathal) nicht mit<br />
umfasste, über diese Striche ausgedehnt, und anderseits ist er in dem von ihm besetzten Terrain beträchtlich<br />
häufiger geworden.“ Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Nicht häufiger<br />
Brutvogel in Gärten und an Landstraßen: Küchengarten, alter Friedhof, Erholungsgarten; Elsterberg (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Der Stieglitz war in Thüringen ein verbreiteter Brutvogel (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975).<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) schätzt im Altkreis Gera-Stadt und -Land den Bestand auf über 1000 BP. Im Gebiet um<br />
Auma ist der Stieglitz nach BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) ein regelmäßiger Brutvogel. Im Altkreis <strong>Greiz</strong><br />
schätzen LANGE & LEO (1978) den Bestand auf über 100 BP. In den Jahren 1977/1978 fand eine überregionale<br />
Bestandserfassung statt (ZSCHIEGNER 1979 b). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere<br />
gezählt bzw. geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf vier Kontrollflächen mit 70,5 ha 28 bis 37 BP und<br />
auf einer Kontrollfläche von 72 ha Wald 0 BP. Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf einer Kontrollfläche von 140 ha 6 bis 8 BP.<br />
Im Altkreis Zeulenroda wird der Stieglitz als häufiger Brutvogel mit auffallend gutem Bestand 1977 aufgeführt.<br />
LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 500 bis 1000 BP an.<br />
Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 83 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde,<br />
bei der 147 bis 269 Reviere ermittelt wurden. 2002 wurden in einem Wohngebiet (Altbau) im Geraer<br />
Ostviertel auf 25 ha 4 BP und 2005 in der Ortslage Linda auf 25,5 ha 4 BP festgestellt (LIEDER, unveröff.). Im<br />
60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park wurde der Bestand auf 2 bis 5 BP geschätzt (LUMPE 2008).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft mit erhöhten Düngemitteleinsatz, Biozideinsatz und Vernichtung der<br />
Ödland-, Brach- und Ruderalflächen sowie der Ackerrandstreifen<br />
- Verlust von extensiver Gärten, Streuobstwiesen und Alleebäumen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft<br />
- Maßnahmen zur Erhöhung des Strukturreichtums der Kulturlandschaft<br />
- Erhalt und Förderung von Ruderalflächen und Ackerrainen<br />
- Deutliche Ausweitung der Stilllegungsflächen<br />
- Erhaltung und Schutz alter Obstgärten und Streuobstwiesen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 254
Erlenzeisig, Carduelis spinus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Erlenzeisig<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) kannte den Erlenzeisig als Brutvogel aus der Umgebung von Gera.<br />
Die dort gemachte Angabe des sehr häufigen Auftretens bezieht sich wohl auf das Vorkommen außerhalb<br />
der Brutzeit. LIEBE (1873) kannte mehrere Brutvorkommen: „Der Zeisig ist einer der selteneren Bewohner<br />
der Westhälfte unseres Gebiets. Einzelne oder wenige Paare nisten ziemlich regelmäßig im Geraer Stadtwald<br />
am Türkengraben und in der Nähe von Metzhöhe, im Niederndorfer Revier nordöstlich von der Käseschenke,<br />
bei Schleifreißen, unterhalb Weißenborn, im Großebersdorfer Revier.“ Die Unstetigkeit des Auftretens<br />
betont LIEBE in einer Arbeit von 1878: „Und was insbesondere die brütenden Zeisige betrifft, so treten<br />
diese – meist in Gesellschaft von 2 oder 3 Paaren – bald da, bald dort auf, denn die schönsten Gruppen<br />
alter, überständiger Fichten und Tannen vermögen die Thiere nicht bleibend an sich fesseln. Sicher ist, dass<br />
sie in allen grösseren Forsten brüten, merkwürdiger Weise aber im gebirgigen Süden weniger häufig wie in<br />
den grossen Forsten der Haide, des Altenburger Westkreises und bei Gera.“ Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Seltener Brutvogel im Pöllwitzer Wald, bei Dölau, am Brand, bei<br />
Kleinreinsdorf.“<br />
1900 bis 1950<br />
HIRSCHFELD (1932) erwähnt ihn als Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben und GÜNTHER(1969) verweist<br />
auf die Beobachtung mehreren Zeisigpaare im Sommer um 1930 bei Hain durch SCHNAPPAUF.<br />
Ab 1950<br />
Für den Altkreis Gera-Stadt und -Land kann GÜNTHER (1969) nur auf ein Vorkommen im Mai 1964 bei Collis<br />
verweisen. Im Gebiet um Auma können BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) keine Sommerbeobachtungen<br />
aufführen. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> vermuten LANGE & LEO (1978), dass „alljährlich einzelne Paare in den zusammenhängenden<br />
Nadelwaldbeständen des <strong>Greiz</strong>-Werdauer Waldes zur Brut schreiten.“ In den Jahren<br />
1977/1978 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (LIEDER 1981 b). Danach stellte GÜNTHER am<br />
24.05.1975 ein singendes Männchen bei Reust fest. Für den Altkreis Zeulenroda wird mitgeteilt, dass nach<br />
den Invasionen 1965/66, 1971 und 1974 regelmäßig zur Brutzeit Erlenzeisige festgestellt wurden, während<br />
1977 die Art völlig fehlte. LANGE & LIEDER (2001) stufen die Art als nicht alljährlichen Brutvogel mit einem<br />
Gesamtbestand bis zu 10 BP ein. Oft fehlen Nachweise über mehrere Jahre. Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park<br />
wurde der Bestand auf 2 bis 3 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />
zwischen 2005 und 2009 wurden 43 bis 91 BP geschätzt.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 255
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch „Waldsterben“<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Senkung des Schadstoffeintrages<br />
Verbreitungskarte 32: Erlenzeisig<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
8 – 20 8 – 20 1<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
4 – 7 4 – 7<br />
2 – 3 8 – 20 2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 256
Bluthänfling, Carduelis cannabina (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />
Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Bluthänfling<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Der Bluthänfling war Mitte des 19. Jahrhunderts ein häufiger Brutvogel um Gera (Ornithologische Sektion<br />
Gera 1859). LIEBE (1873) stellte starke Bestandsschwankungen im Gebiet um Gera fest: „Die Zahl der Hänflinge<br />
war vor einigen Jahren recht sehr zurückgegangen. In der letzten Zeit aber ist der frühere Bestand<br />
reichlich wieder hergestellt und es war ganz besonders im Jahr 1872 die Vermehrung außerordentlich stark -<br />
vielleicht deshalb, weil dies Jahr sich durch Ueberfluß an Kerbthieren und durch die Abwesenheit von Feldmäusen<br />
auszeichnete. In den Jahren vorher hielten gewaltige Schaaren jener kleinen Nager die Felder von<br />
allen anfliegenden Gesäme beständig rein, so daß die wenigstens zeitweis auf diese Nahrung angewiesenen<br />
Vögel Mangel leiden mussten.“ LIEBE stellte 1878 überall einen Rückgang fest. Nach seinen Aufzeichnungen<br />
von 1881 schreibt HELLER (1926): „Nicht häufiger, aber regelmäßiger Brutvogel: Schäferei bei<br />
Rothenthal, Caselwitz, Grochlitz, Gommla, Tremnitz und Ruppertsgrün. (P.)“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT & SEMMLER (1975) war der Bluthänfling in Thüringen ein häufiger Sommervogel. Auch<br />
HIRSCHFELD (1932) kannte ihn als nicht seltenen Brutvogel in der Umgebung von Hohenleuben.<br />
Ab 1950<br />
Im Altkreis Gera-Stadt und -Land war der Bluthänfling nach GÜNTHER (1969) ein zahlreicher Brutvogel. Er<br />
schätzt den Bestand auf etwa 1000 BP. Im Gebiet um Auma ist der Bluthänfling nach BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖßEL (1971) ein regelmäßiger Brutvogel. Für den Altkreis <strong>Greiz</strong> wird er von LANGE & LEO (1978) als häufiger<br />
Brutvogel angegeben. Der Bestand wird auf 300 BP geschätzt. In den Jahren 1977 bis 1979 fand eine<br />
überregionale Bestandserfassung statt (LANGE 1984 a). Auf verschiedenen Kontrollflächen wurden die Reviere<br />
gezählt bzw. geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf vier Kontrollflächen mit 63,5 bis 67,5 ha 18<br />
BP und auf einer Kontrollfläche von 72 ha Wald 0 BP. Altkreis <strong>Greiz</strong>: auf zwei Kontrollfläche mit 270 ha 11<br />
bis 13 BP, Altkreis Zeulenroda: auf zwei Kontrollflächen mit 26 ha 7 BP und auf einer Kontrollfläche mit 7 ha<br />
11 BP 1975 und 2 BP 1977. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand für das Untersuchungsgebiet<br />
mit 500 bis 1000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 88 km² Fläche<br />
zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 106 bis 145 Reviere ermittelt wurden.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt zwischen 2005 und 2009 wurde der Bestand auf 347 bis<br />
825 BP geschätzt.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 257
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Nahrungsmangel als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft<br />
- Verlust geeigneter Bruthabitate durch Rodung von Hecken, Vernichtung oder Nutzungsänderung früher<br />
extensiv genutzter Obstgärten<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
- Erhöhung des Strukturreichtums der Landschaft<br />
- Verringerung der Eingriffe und Erhaltung von Ruderalflächen sowie bewachsener Weg- und Ackerränder<br />
- Ausweitung der Stilllegungsflächen<br />
- Erhaltung und Schutz alter Obstgärten<br />
- Neupflanzung von Hecken<br />
Verbreitungskarte 33: Bluthänfling<br />
8 – 20 8 – 20 21 – 50<br />
8 – 20 8 – 20 21 – 50<br />
8 – 20 21 – 50 21 – 50 8 – 20<br />
8 – 20 21 – 50 8 – 20 8 – 20<br />
8 – 20 2 – 3 2 – 3 8 – 20 2 – 3<br />
8 – 20 8 – 20 1 4 – 7<br />
4 – 7 4 – 7 8 – 20 8 – 20 21 – 50 8 – 20<br />
4 – 7 4 – 7 8 – 20 8 – 20 8 – 20<br />
21 – 50 21 – 50<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 258
Birkenzeisig, Carduelis flammea (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Birkenzeisig<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
Ab 1970<br />
Der Birkenzeisig ist erst in den 1970er-Jahren im Untersuchungsgebiet eingewandert.<br />
Nach LIEDER (1981 c) konnte erstmals am 28. Juni 1970 ein Birkenzeisig in Ronneburg von GÜNTHER nachgewiesen<br />
werden und am 23. Mai. 1974 wurde ein Männchen bei Zeulenroda gefangen und als Alpenbirkenzeisig,<br />
C. f. cabaret, bestimmt. Im Mai 1981 hielt sich ein Paar in Teichwolframsdorf auf (KRÜGER 1985).<br />
Ende Juni 1983 wurde ein Paar in einer Gartenanlage bei <strong>Greiz</strong> festgestellt (LANGE 1988). 1985 bestand<br />
Brutverdacht für 1 bis 2 BP in Ronneburg (KRÜGER 1990), ebenso 1986 (KRÜGER 1992). ÖLSCHLEGEL<br />
(1994/95) gelang 1986 ein Nestfund im Tinzer Park in Gera. 1987 wurde in Ronneburg von GÜNTHER ein<br />
Brutnachweis erbracht (KRÜGER 1993/94). 1988 gelang MACHOLD ein Brutnachweis in <strong>Greiz</strong>-Raasdorf<br />
(KRÜGER 1995 a). 1993 und 1995 bestand Brutverdacht im Botanischen Garten von Gera (LIEDER 1996).<br />
1989 wurden 3 bis 4 sM in Ronneburg beobachtet (KRÜGER 1995 b). Nach mehreren Beobachtungen zur<br />
Brutzeit in Raitzhain und Ronneburg 1995 (ROST, FRIEDRICH & LANGE 1996) gelang 1997 ein Nestfund in<br />
Gera. An zwei weiteren Stellen in Gera bestand Brutverdacht und in Zeulenroda wurden 3 BP gefunden<br />
(ROST, FRIEDRICH & LANGE 1998). Für 1998 wurden 3 BP aus Zeulenroda und 1 BP aus Pöllwitz gemeldet<br />
(ROST, FRIEDRICH & LANGE 1999). Nach LANGE & LIEDER (2001) wird die Unterart cabaret seit 1970 bei uns<br />
beobachtet. Seit etwa 1980 ist der Alpenbirkenzeisig im Untersuchungsgebiet Brutvogel. Die Nachweise<br />
konzentrieren sich auf die Ortschaften <strong>Greiz</strong>, Zeulenroda, Gera und Ronneburg. Den Gesamtbestand geben<br />
die Autoren mit 10 bis 20 BP an.<br />
Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt zwischen 2005 und 2009 wurde der Bestand auf 26 bis 43<br />
BP geschätzt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es noch unentdeckte Vorkommen gibt, die übersehen<br />
werden.<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumveränderungen, insbesondere forstliche Eingriffe und Beseitigung der Strukturvielfalt in Parks<br />
und Gärten durch Abholzung und Heckenrodung sowie Beseitigung von Ruderalflächen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt einer reich strukturierten Kulturlandschaft<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 259
Verbreitungskarte 34: Birkenzeisig<br />
2 – 3<br />
1<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
4 – 7 4 – 7<br />
4 – 7<br />
4 – 7 1<br />
4 – 7<br />
2 – 3<br />
Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 260
Roter Kardinal, Cardinalis cardinalis (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel nach Aussetzung<br />
Roter Kardinal<br />
Foto: Bill Draker, Imagebroker/<br />
Avenue Images<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Im Frühjahr 1887 wurden 10 Paare im <strong>Greiz</strong>er Park ausgesetzt, die auch zur Brut schritten (BEYER 1888a).<br />
Bereits zur zweiten Brut waren nur noch wenige Paare übrig. Da man die Tiere durch Beschneidung einiger<br />
Schwungfedern an der vollen Flugfähigkeit gehindert hatte, wurden sie leichte Beute für Prädatoren. Die<br />
Vögel und deren Nachkommen waren 1888 (letztmalige Beobachtung im April 1888) verschwunden<br />
(BEYER 1888 b).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
-<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
-<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 261
Goldammer, Emberiza citrinella L.<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Goldammer<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Goldammer als sehr häufigen Brutvogel um Gera.<br />
LIEBE (1873) kommt zur gleichen Einschätzung, stellt aber 1878 eine ganz allmähliche Abnahme fest. Nach<br />
seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Überall häufiger Brutvogel.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach (HILDEBRANDT & SEMMLER 1975) war die Goldammer in Thüringen überall ein häufiger Brutvogel.<br />
Ab 1950<br />
Nach GÜNTHER (1969) ist die Goldammer im Altkreis Gera-Stadt und -Land ein nicht seltener Brutvogel mit<br />
einem Bestand von über 1000 BP. Im Gebiet um Auma ist die Goldammer nach BARNIKOW, SCHÜTZ &<br />
STÖßEL (1971) ein verbreiteter Brutvogel. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> wird die Goldammer als sehr häufiger Brutvogel<br />
bezeichnet (LANGE & LEO 1978). Sie verweisen jedoch auf einen dramatischen Bestandsrückgang: „Früher<br />
(21) dürfte sie noch häufiger gewesen sein, denn ein Anfang der 70er Jahre einsetzender Bestandsrückgang<br />
dieser Art ließ den Bestand in den letzten Jahren etwa auf die Hälfte absinken.“ In den Jahren 1979/1980<br />
fand eine überregionale Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1981 c). Auf Kontrollflächen wurden Reviere bzw.<br />
Siedlungsdichten ermittelt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: auf 450 ha Feldflur mit 50 ha Wald 40 BP, auf 0,7<br />
km Strecke 8 sM, in einem Steinbruch mit Gehölzen 0,8 bis 4,2 BP/10 ha (Abnahme von 1970 bis 1979 von<br />
4 bis 5 BP auf 1 BP), Altkreis <strong>Greiz</strong>: Bergbauhalde mit Birken- und Weiden-Jungholz 0,5 BP/10 ha, Altkreis<br />
Zeulenroda: in einem Fichten- und Kiefern-Stangenholz 0,4 BP/10 ha. LANGE & LIEDER (2001) geben den<br />
Gesamtbestand im Untersuchungsgebiet mit 2000 bis 3000 BP an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative<br />
Erfassung auf 89 km² Fläche zwischen 1995 und 2000 zugrunde, bei der 229 bis 296 Reviere ermittelt<br />
wurden. Die Autoren verweisen auf den drastischen Bestandseinbruch in den 1980er-Jahren und auf die<br />
positive Bestandsentwicklung in den 1990er-Jahren hin. Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung im<br />
Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald, auf 115 ha ökologisch<br />
wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier wurden 31 Reviere der<br />
Goldammer ermittelt (VOOG). Im 6 ha großen Naturschutzlehrobjekt Rückersdorf wurde folgender Bestand<br />
festgestellt (Anzahl BP): 1998 (5), 2000 (8), 2002 (8), 2003 (5), 2004 (3) und 2005 (6) (LIEDER 2009).<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Intensivierung der Landwirtschaft (Ausräumung der Landschaft, Rückgang der Pflanzendiversität, Entwässerung,<br />
Beseitigung von Ruderalflächen, hoher Einsatz von Bioziden, Ausbleiben der Druschabfälle,<br />
Rückgang der Kleintierhaltung, Verlust der Stoppelbrachen, Vergiftung durch Quecksilber-Beizmittel)<br />
- Verluste im Straßenverkehr<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Extensivierung der Landwirtschaft, Erhöhung des Strukturreichtums der Landschaft<br />
- Erhalt von Brachflächen<br />
- Senkung des Biozideinsatzes<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 262
Rohrammer, Emberiza schoeniclus (L.)<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Status:<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />
Rohrammer<br />
Foto: fokus-natur/Leo<br />
Chronik der Bestandsentwicklung:<br />
19. Jahrhundert<br />
Die Rohrammer war im 19. Jahrhundert ein seltener Brutvogel. LIEBE (1873) schreibt: „Den Rohrammer führt<br />
Ch. L. Brehm als am Frießnitzer See nistend auf. Ich habe sie dort in neuerer Zeit vergeblich gesucht -, jedenfalls<br />
weil die seit jener Zeit erbaute Landstraße und die Einschränkung der Sumpfwiesen den Aufenthalt<br />
am See unbehaglich gemacht haben. Dagegen beobachtete ich brütende Pärchen an den Teichen von<br />
Großebersdorf und Geroda.“ Nach LIEBE (1878) „brüten noch jetzt alljährlich einige Pärchen“ am Frießnitzer<br />
See. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Gehört als Brutvogel dem weiteren<br />
Gebiet an: Kürbitz (P.); Teiche bei Niederpöllnitz, Großebersdorf, Frießnitz.“<br />
1900 bis 1950<br />
Nach HILDEBRANDT (1919) ist die Rohrammer ein häufiger Brutvogel in ganz Ostthüringen. HIRSCHFELD<br />
(1932) fand sie als Brutvogel bei Frießnitz.<br />
Ab 1950<br />
GÜNTHER (1969) stellte eine Zunahme der Art fest: „Rohrammern fehlen jetzt an den wenigen für sie geeigneten<br />
Stellen, an Teichufern und in sumpfigem Gelände, fast nirgends. Mancherorts, so bei Kauern, Röpsen,<br />
Aga und Baldenhain sind sie erst in den letzten 15 Jahren regelmäßig als Brutvögel aufgetaucht. Nur das<br />
Frießnitzer Gebiet haben sie seit jeher ständig bewohnt (2, 3, 5). Der jetzige Bestand an Rohrammern wird<br />
die Zahl von 50 Brutpaaren nicht erreichen.“ Im Gebiet um Auma besiedelt die Rohrammer nach BARNIKOW,<br />
SCHÜTZ & STÖßEL (1971) die Teiche der Leschke, der Wolge, des Wöhlsdorfer Grundes und seltener im<br />
Himmelreich und Poser. Im Altkreis <strong>Greiz</strong> tritt die Art erst seit etwa 1973 als Brutvogel auf (LANGE & LEO<br />
1978). Seit diesem Jahr wurden alljährlich 1 bis 5 BP im RNG Großkundorf festgestellt. In den Jahren<br />
1979/1980 fand eine überregionale Bestandserfassung statt (FLÖßNER 1981 d). Auf verschiedenen Kontrollflächen<br />
wurden die Reviere gezählt bzw. geschätzt: Altkreis Gera-Stadt und -Land: Großebersdorf/Frießnitz/<br />
Burkersdorf 14 – 19 BP, Bad Köstritz 2 BP, Aga 5 BP, Söllmnitz 3 BP, Caasen 1 BP, Dorna 5 BP, Röpsen 2<br />
BP, Trebnitz und Naulitz/Thränitz 3 BP, Teich bei Kauern mind. 2 BP, Frankenau/Großenstein 3 BP,<br />
Baldenhain 3 bis 4 BP, Uhlersdorf 2 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong>: <strong>Greiz</strong>-Aubachtal 1 BP, RNG Großkundorf 1 bis 5 BP,<br />
Altkreis Zeulenroda: Umgebung von Auma 10 bis 15 BP, Umgebung von Zeulenroda früher 2 bis 3 BP, jetzt<br />
infolge Talsperrenbau etwa 20 BP. LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand mit 150 bis 200 BP<br />
an. Für diese Schätzung lag eine halbquantitative Erfassung auf 89 km² Fläche zwischen 1995 und 2000<br />
zugrunde, bei der 25 bis 46 Reviere ermittelt wurden. Auf 240 km² mit über 200 Standgewässern und 38<br />
Fließgewässern in der Umgebung von Gera wurden an nur 9 Gewässern 4 bis 17 BP zwischen 1990 und<br />
2004 festgestellt (LIEDER 2004). Im 60 ha großen <strong>Greiz</strong>er Park (Verlandungszone der Hammerwiesenteiche)<br />
wurde der Bestand auf 1 bis 2 BP geschätzt (LUMPE 2008). Im Jahre 2008 erfolgte eine Brutvogelkartierung<br />
im Wismut-Sanierungsgebiet Culmitzsch auf 145 ha Laubwald mit geringem Anteil Nadelwald, auf 115 ha<br />
ökologisch wertvollem Offenland und auf 195 ha Betriebsfläche der Wismut GmbH. Hier wurden 4 Reviere<br />
der Rohrammer ermittelt (VOOG).<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 263
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />
- Lebensraumverlust durch Grundwasserabsenkung und Entwässerung von Feuchtgebieten<br />
- Entfernen der Ufer- und Verlandungsvegetation<br />
- Verbauung von Gewässern<br />
- Bebauung von Ruderalflächen<br />
- Störung an Brutplätzen<br />
Lokale Schutzmaßnahmen:<br />
- Erhalt und Schutz bestehender Feuchtgebiete mit Schaffung beruhigter Zonen<br />
- Wiedervernässung und Renaturierung trockengelegter Gebiete und Feuchtbiotope<br />
- Ausdehnung der Ufervegetation entlang von Fließgewässern<br />
- Förderung von Brach- und Ödlandflächen<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 264
Diskussion<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Mit Band 3, Heft 2 (Teil 1 und Teil 2), wurde die noch vorhandene Lücke zu Band 2, Heft 2 (Lieder & Lumpe<br />
2010), geschlossen. Damit liegt eine komplette Übersicht über alle im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />
aktuell vorkommenden Brutvögel vor und über all jene, die schon früher einmal im Untersuchungsgebiet<br />
gebrütet haben oder für die Brutverdacht bestand. Aktuell brüten z.Z. im Untersuchungsgebiet Vögel aus<br />
147 Arten, davon aus 52 Arten, die in der Roten Liste Thüringens (WIESNER 2001) ausgewiesen sind.<br />
Die beiden Hefte wurden geschrieben, weil die Erhaltung der Biodiversität auch eine vordringliche Angelegenheit<br />
aller Landkreise und Gemeinden ist. Zur Häufigkeit der Individuen aus den vorkommenden Vogelarten<br />
und zu ihrer Verteilung im Untersuchungsgebiet sind Aussagen enthalten. An den Gefährdungsursachen<br />
und den sich daraus ergebenden Schutzmaßnahmen können sich alle haupt- und ehrenamtlich für den<br />
Schutz der Natur und Umwelt tätigen Menschen orientieren und für die Eindämmung des anhaltenden Artensterbens<br />
sorgen. Besonders mit der Sicht auf die großen Renaturierungs-Flächen der Wismut GmbH im<br />
Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera sollten sich im Sinne der „Mission 2020“ 2 weitere geeignete Möglichkeiten<br />
finden lassen.<br />
Sowohl geologische als auch kosmische Ursachen haben im Verlaufe der Evolution zum Aussterben von<br />
Tier- und Pflanzenarten geführt. Seit der Mensch eingegriffen hat, wurde dieser Prozess dramatisch verstärkt<br />
und erfuhr durch die industrielle Revolution eine besondere Beschleunigung. Nach der IUCN 3 ist gegenwärtig<br />
jede achte Vogelart in der Welt vom Aussterben bedroht. Es besteht also dringender Handlungsbedarf.<br />
Die Betrachtung eines Zeitraumes von rund 200 Jahren zeigt auch viele Parallelen zur Gegenwart auf. Neue<br />
Erkenntnisse setzten sich gegen altüberlieferte Ansichten schon immer sehr schwer durch. So hat es nahezu<br />
100 Jahre gedauert, bis die von BREHM nachgewiesenen Baumläuferarten (Garten- und Waldbaumläufer)<br />
Anerkennung fanden. Nicht anders erging es der Sumpf- und Weidenmeise.<br />
Nur allmählich kam es zu einer einheitlichen Benennung der deutschen und wissenschaftlichen Vogelnamen,<br />
und das große Durcheinander wurde entwirrt. Damit löste sich auch so mancher Irrtum auf, der sich in<br />
einigen Fällen (Ohrentaucher) hartnäckig bis in die Gegenwart gehalten hat.<br />
Auch wenn Verständnis für den damaligen Gebrauch der Flinte für wissenschaftliche Zwecke aufgebracht<br />
werden muss, detaillierte Bestimmungsbücher, optische Geräte oder leistungsfähige Kameras fehlten, ist<br />
auch dadurch leider die Gepflogenheit des Vogeltötens zur festgefügten Tradition geworden, die heute, namentlich<br />
in Südeuropa, massive Probleme bereitet.<br />
Mit der beginnenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert ging auch die starke Verschmutzung vieler Bäche,<br />
Flüsse und Seen einher. Ernsthaft Verbesserungen der geschädigten Lebensräume (Eisvogel, Wasseramsel)<br />
sind im Untersuchungsgebiet erst am Ende des 20. Jahrhunderts im geeinten Deutschland möglich geworden.<br />
Die unterschiedliche Waldnutzung und der relativ junge Wald mit wenig oder fehlendem Totholz im Fürstentum<br />
Reuß hatte auch Auswirkungen auf das Brutverhalten vieler Vögel. Der Waldkauz nahm auffällig oft alte<br />
Nester anderer Vögel an, da es an Höhlenbäumen mangelte. Andererseits zog es den Mauersegler in den<br />
Wald oder in Starenkästen, da die Quartiere in den Dörfern und Städten nicht ausreichten.<br />
Der noch immer vorherrschende Hass auf einige Vogelarten hat seine Wurzeln im Volks- und Aberglauben,<br />
als die Vögel noch in nützlich und schädlich eingeteilt wurden: ängstliche Bauern nagelten Eulen zur Abwehr<br />
von Unheil ans Scheunentor, Rabenvögel müssen noch heute für Verluste beim Niederwild büßen, und der<br />
Habicht bleibt der Todfeinde der Taubenzüchter. Daraus resultierte auch die Zahlung von Schussgeldern,<br />
die bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich waren. Der Chef der staatlich Ungarischen Ornithologischen<br />
Centrale in Budapest, OTTO HERMAN (1901), versuchte aufklärend zu wirken und schreibt: „es giebt [sic]<br />
keine an sich nützlichen und keine an sich schädlichen Vögel, es gibt nur nötige Vögel im Haushalt der Natur“.<br />
Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung zu den aufgenommenen Vogelarten. Zweifel als Brutvögel bleiben<br />
bei der Blauracke, während bei der Moorente und bei der Sumpfohreule von berechtigtem Brutverdacht und<br />
beim Goldregenpfeifer und der Rotdrossel von sicherer Brut gesprochen werden kann. Aussetzungsversuche<br />
führten beim Roter Kardinal zu kurzzeitigen Bruterfolgen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Brautente hat<br />
als Gefangenschaftsflüchtling 1999 und 2000 im Freiland gebrütet.<br />
2<br />
im Oktober 2010 in Nagoya/Japan verabschiedet<br />
3<br />
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Internationale Union für die Bewahrung der Natur und natürlicher<br />
Ressourcen)<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 265
Literatur<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
ANDRETZKE, H., T. SCHIKORE & K. SCHRÖDER (2005): Artensteckbriefe. In: SÜDBECK, P. et al. (Hrsg.): Methodenstandards<br />
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, S.135 – 695. – Radolfzell.<br />
Anonym (1952): Zur Sperlingsbekämpfung. – Mitteilungen Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 3, 27 – 28.<br />
AUERSWALD, J. & K. LIEDER (1991): Zum Brutvorkommen von Graureiher, Ardea cinerea L. und Lachmöwe,<br />
Larus ridibundus L., im Bezirk Gera. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 41, 69 – 72.<br />
Ausschuß für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands (ABVD) (1887): 10. Jahresbericht. – Journal<br />
für Ornithologie 35, 337 – 615.<br />
BARNIKOW, G. (1978): Grauschnäpper – Muscicapa striata (PALLAS). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- (1981): Sperber – Accipiter nisus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
7 S.<br />
- & H. LANGE (1985): Bestandsgröße und Fortpflanzung des Sperbers (Accipiter nisus) in Thüringen. –<br />
Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 11, 109 – 116.<br />
-, E. SCHÜTZ & W. STÖSSEL (1971): Ornithologische Notizen aus Auma und Umgebung. – Jahrbuch des<br />
Museums Hohenleuben – Reichenfels 19, 73 – 90.<br />
BAUCH, W. (1952): Weidenmeisenbeobachtungen. – Mitteilungen Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 3, 56 – 57.<br />
BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. 2. Auflage. –<br />
Wiebelsheim.<br />
BAUM, H.-G. (1987): Die Vogelwelt von Weida und Umgebung. – Kreismuseum Weida 5, 38 – 44.<br />
BEYER (1884): Ueber Ansetzung von Nachtigallen in <strong>Greiz</strong>. – Ornithologische Monatsschrift 9, 253 – 254.<br />
- (1888 a): Weiterer Bericht über die Akklimatisierung der Nachtigallen und Kardinäle in dem Elsterthal bei<br />
<strong>Greiz</strong>. – Ornithologische Monatsschrift 13, 159.<br />
- (1888 b): Die rothen Kardinäle und Nachtigallen bei <strong>Greiz</strong>. – Ornithologische Monatsschrift 13, 410 –<br />
411.<br />
BIBBY, C. J., N.D. BURGESS & D. A. HILL (1995): Methoden der Feldornithologie. – Radebeul.<br />
BRÄSECKE, R. (1974): Versuch einer Kolkrabeneinbürgerung im Bezirk Gera. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief 22, 39.<br />
BREHM C. L. (1820 – 22): Beiträge zur Vögelkunde in vollständigen Beschreibungen mehrerer neu entdeckter<br />
und vieler seltener, oder nicht gehörig beobachteter deutscher Vögel. – Neustadt/Orla. [Band 3 mit W.<br />
SCHILLING].<br />
- (1823 – 24): Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel. – Jena.<br />
- (1830): Übersicht der deutschen Vogelarten. – Okens Isis 14, 985 – 1013.<br />
- (1831): Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands, worin nach den sorgfältigsten Untersuchungen<br />
und den genauesten Beobachtungen mehr als 900 einheimische Vogelgattungen zur Begründung<br />
einer ganz neuen Ansicht und Behandlung ihrer Naturgeschichte vollständig beschrieben sind.<br />
– Ilmenau.<br />
- (1832): Einige Beobachtungen über die Vögel um Renthendorf vom Februar 1830 an nebst mehreren<br />
anderen. – Isis (Oken) 16, 734 – 752, 836 – 858.<br />
- (1833): Einige Beobachtungen über die Vögel um Renthendorf vom Februar 1830 an nebst mehreren<br />
anderen. – Isis (Oken) 17, 771 – 790.<br />
- (1850): Über das Nisten der Wacholderdrossel in Deutschland. – Naumannia 1, 23 – 24.<br />
CREUTZ, G. (1966): Die Wasseramsel in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 3,<br />
10 – 13.<br />
CZERLINSKY, H. (1966): Die Vogelwelt im nördlichen Vogtland. – Veröffentlichung des Heimatmuseums Burg<br />
Mylau 3, 1 – 110.<br />
DANNHAUER, K. (1963): Die Vogelwelt des Vogtlandes. – Vogtländisches Kreismuseum Plauen, Museumsreihe<br />
26, 1 – 88.<br />
DERSCH, F. (1925): Die Brutvögel des Vogtlandes. – Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung<br />
1.<br />
- (1933): Die Vogelwelt des Vogtlandes. – Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung<br />
8, 2 – 7.<br />
DOMBROWSKI , E. V.(1893): Beiträge zur Ornis des Fürstenthums Reuß ä. L. – Ornithol. Jahrb. 4, 131 – 140.<br />
DWENGER, R. (1967): Der Nachtigall ins Nest geschaut. – Thüringer Neuste Nachrichten Nr. 141/1967.<br />
ECK, S. (2001): Zwei Arten Aaskrähe (Corvus corone, C. cornix) in Sachsen? – Mitteilungen <strong>Verein</strong> Sächsischer<br />
<strong>Ornithologen</strong> 8, 567 – 575.<br />
FENK, R. (1913): Vorkommen der Weidenmeise in Mittelthüringen. – Berajah: Parus Solicarius, Anl. I, 1 – 4.<br />
FEUSTEL, C. (1903): Seltene Vögel in der Umgebung von Gera. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde<br />
der Naturwissenschaften zu Gera 43 – 45, 79 – 80.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 266
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
FEUSTEL, C. (1908): Seltenheiten der Avifauna von Gera im Jahre 1907. – Jahresbericht der Gesellschaft der<br />
Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 49 – 50, 103 – 104.<br />
- (1912): Seltenheiten der Avifauna von Gera in den Jahren 1910 bis 1911. – Jahresbericht der Gesellschaft<br />
der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 53 – 54, 123 – 124.<br />
FLÖßNER, D. (1975): Eichelhäher – Garrulus glandarius (L.) – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1977): Feldlerche – Alauda arvensis L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1978 a): Wintergoldhähnchen – Regulus regulus (L.) – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
FLÖßNER, D. (1978 b): Sommergoldhähnchen – Regulus ignicapillus (TEMM.). – Berichte zur Avifauna des<br />
Bezirkes Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- (1979 a): Kernbeißer – Coccothraustes coccothraustes (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera,<br />
Loseblattsammlung, 5 S.<br />
- (1979 b): Girlitz – Serinus serinus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
6 S.<br />
- (1980 a): Nachtigall – Luscinia magarhynchos BREHM. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1980 b): Feldschwirl – Locustella naevia (BODD.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
8 S.<br />
- (1981 a): Wacholderdrossel – Turdus pilaris L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
7 S.<br />
- (1981 b): Gebirgsstelze – Motacilla cinerea TUNSTALL. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera,<br />
Loseblattsammlung, 5 S.<br />
- (1981 c): Goldammer – Emberiza citrinella L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1981 d): Rohrammer – Emberiza schoeniclus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1982): Pirol – Oriolus oriolus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung, 3 S.<br />
- (1983 a): Wasseramsel – Cinclus cinclus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
7 S.<br />
- (1983 b): Waldbaumläufer – Certhia familiaris L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1983 c): Gartenbaumläufer – Certhia brachydactyla C. L. BREHM. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- FRICK, S. (2009): Zum Auftreten der Moorente Aythya nyroca in Thüringen. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer<br />
<strong>Ornithologen</strong> 6, 221 – 229.<br />
FRITZLAR, F. & W. WESTHUS (2001): Rote Listen Thüringens – Gefährdungskategorien und Gefährdung der<br />
Arten und Lebensräume. – Naturschutzreport 18, 9 – 29.<br />
GÖRNER, M. (1978): In Felsen, Steinbrüchen und Lockergesteinswänden Thüringens brütende Vögel. – Ornithologische<br />
Jahresberichte des Museums Heineanum 3, 43 – 62.<br />
- R. HAUPT, W. HIEKEL, W. NIEMANN & W. WESTHUS (1984): Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl<br />
und Gera. Band 4. – Leipzig, Jena, Berlin.<br />
GOTTSCHALK, C. (1980 a) Verwilderte Haustaube – Columba livia f. domestica. – Berichte zur Avifauna des<br />
Bezirkes Gera, Loseblattsammlung, 3 S.<br />
- (1980 b): Ringeltaube – Columba palumbus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1980 c): Turteltaube – Streptopelia turtur (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1980 d): Türkentaube – Streptopelia decaocto (FRIVALDSKY). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 8 S.<br />
- (1980 e): Kuckuck – Cuculus canorus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1982): Fasan – Phasianus colchicus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
GRIMM, H. (2006): Zum Auftreten der Nebelkrähe Corvus cornix und von Rabenkrähen-Nebelkrähen-<br />
Bastarden C. corone x C. cornix in Thüringen. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 5, 281 –<br />
293.<br />
GRÖSSLER, K. & K. HÄDECKE (1998) Goldregenpfeifer. – In: STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (Hrsg.):<br />
Die Vogelwelt Sachsens. – Jena<br />
GRÜN, G. (1968): Neuere Vorkommen des Feldschirls in Thüringen. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief<br />
13, 1 – 8.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 267
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
GRÜN, G., (1972): Avifaunistischer Sammelbericht aus Thüringen (Bezirke Erfurt, Gera und Suhl) für das<br />
Jahr 1971. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief 19/20, 48 – 51.<br />
-, J. HEYER & Mitarbeiter (1973): Verzeichnis der Vögel Thüringens 1945 – 1971. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief, Sonderheft 1.<br />
GÜNTHER, R. (1968): Bemerkenswerte Veränderungen in der Vogelwelt Ostthüringens. – Der Falke 15, 196 –<br />
199.<br />
- (1969): Die Vogelwelt Geras und seiner Umgebung. – Veröffentlichungen der Städtischen Museen Gera<br />
1, 1 – 63.<br />
- (1973): Stockente – Anas platyrhynchos L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
GÜNTHER, R. (1973): Sumpfrohrsänger – Acrocephalus palustris (Bechstein.). – Berichte zur Avifauna des<br />
Bezirkes Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- (1974): Weidenmeise – Parus montanus Baldenstein. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1976 a): Tafelente – Aythya ferina (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1976 b): Reiherente – Aythya fuligula L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1976 c): Sumpfmeise – Parus palustris L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1977): Baumpieper – Anthus trivialis (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1978 a): Trauerschnäpper – Ficedula hypoleuca (Pallas). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera,<br />
Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- (1978 b): Heckenbraunelle – Prunella modularis (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung<br />
4 S.<br />
- (1979 a): Notizen über einen Brutplatz des Habichts, Accipiter gentilis (L.), in Ostthüringen. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 25, 47 – 49.<br />
- (1979 b): Hohltaube – Columba oenas L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1979 c): Neuntöter – Lanius collurio L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1979 d): Star – Sturnus vulgaris L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1981): Waldschnepfe – Scolopax rusticola L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1982): Sperlingskauz – Glaucidium passerinum (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1986): Sperlingskauz. – In: KNORRE, D. V. u.a. (Hrsg.): Die Vogelwelt Thüringens. – Jena.<br />
- (1989): Zur Bestandsentwicklung des Stars, Sturnus vulgaris L., im Bezirk Gera. – Thüringer Ornithologische<br />
Mitteilungen 39, 67 – 70.<br />
HEINROTH, O. & M. HEINROTH (1931): Die Vögel Mitteleuropas. – IV. Band Nachtrag. Urania-Verlag Leipzig,<br />
Jena, Berlin.<br />
HERMAN, O. (1901): Nutzen und Schaden der Vögel. – Verlag von Willy Scheibe, Gera-Reuss, 17.<br />
HELLER, F. (1897): Am Wojderteich. – Ornithologische Monatsschrift 22, 98 – 102.<br />
- (1926): Die Brutvögel in der Umgebung von <strong>Greiz</strong>. - In: Festschrift zu der Feier des 50 jährigen Bestehens<br />
„<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ zu <strong>Greiz</strong>, 51 – 63.<br />
HENNICKE, C. R. (1896): Vogelfang im Mittelalter in Reuß j. L. – Ornithologische Monatsschrift 21, 70 – 71.<br />
- (1893): K. Th. Liebes Ornithologische Schriften. – Leipzig.<br />
HEYDER, R. (1952): Die Vögel des Landes Sachsen. – Leipzig.<br />
HEYER, J. (1967 a): Beobachtungen am Frießnitzer Teich und am Weiderteich. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief 10, 10 –12.<br />
- (1967 b): Avifaunistische Beobachtungen am Frießnitzer Teich und an dem Pöllnitzer Teichen. – Thüringer<br />
Ornithologischer Rundbrief 11, 10 – 11.<br />
- (1975): Aaskrähe – Corvus corone L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1976): Schwanzmeise – Aegithalos caudatus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1997): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1991. – Thüringer<br />
ornithologische Mitteilungen 47, 53 – 73.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 268
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
HEYER, J.(1999 a): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1992. –<br />
Thüringer ornithologische Mitteilungen 48, 43 – 71.<br />
- (1999 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1993. – Thüringer<br />
ornithologische Mitteilungen 48, 72 – 96.<br />
- (2000): Beobachtungsbericht über ausgewählte Vogelarten für Thüringen 1994. – Thüringer ornithologische<br />
Mitteilungen 49, 43 – 71.<br />
HILDEBRANDT, H. (1917 a): Das Vorkommen einiger Vögel im Beobachtungsgebiet C. L. Brehms einst und<br />
jetzt. – Journal für Ornithologie 65, 116 – 124.<br />
- (1917 b): Ist das Vorkommen von Glaucidium passerinum L. und Syrnium uralense Pall. im Osterlande<br />
erwiesen? – Ornithologische Monatsberichte 25, 25 – 28.<br />
- (1919): Beitrag zur Ornis Ostthüringens. – Mitteilungen aus dem Osterlande Neue Folge 16, 289 – 371.<br />
HILDEBRANDT, H. (1938): Hat der Fischadler in Thüringen gebrütet? – Mitteilungen des <strong>Verein</strong>s sächsischer<br />
<strong>Ornithologen</strong> 5, 234 – 238.<br />
HILDEBRANDT, H. & W. SEMMLER (1975): Ornis Thüringens. Teil 1 Passeriformes. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief, Sonderheft 2.<br />
- & - (1976): Ornis Thüringens. Teil 2 Nonpasseriformes z.T. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief,<br />
Sonderheft 3.<br />
- & - (1978): Ornis Thüringens. Teil 3 Nonpasseriformes Rest. – Thüringer Ornithologischer Rundbrief,<br />
Sonderheft 4.<br />
HIRSCHFELD, K. (1931): Ornithologische Beobachtungen von Februar bis September 1930 in der Gegend von<br />
Hohenleuben. – Ornithologische Monatsschrift 56, 20 – 28.<br />
- (1932): Die Vogelwelt der Umgebung von Hohenleuben. – Jahresbericht des Vogtländischen Altertumsforschenden<br />
<strong>Verein</strong>s Hohenleuben 91 – 102, 95 – 141.<br />
- (1970): Zum Vorkommen der Weidenmeise, Parus montanus salicarius C.L. Brehm in Ostthüringen. –<br />
Beiträge zur Vogelkunde 15, 353 – 380.<br />
HÖPSTEIN, G. (1978 a) Zilpzalp – Phylloscopus collybita (VIEILLOT). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 5 S.<br />
- (1978 b): Fitislaubsänger – Phylloscopus trochilus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1978 c): Waldlaubsänger – Phylloscopus sibilatrix (BECHST.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
ISRAEL, W. (1914): Tannenhäher bei Gera. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften<br />
zu Gera 55 – 56, 182.<br />
KLEHM, K. (1980): Gimpel – Pyrrhula pyrrhula (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
KLEINSCHMIDT, O. (1897): Parus salicarius C.L.Brehm und die ähnlichen Sumpfmeisenarten. – Journal für<br />
Ornithologie 45, 112 – 137.<br />
KNORRE, D. V.(1974): Sumpfohreule – Asio flammeus (Pontoppidan). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 2 S.<br />
- (1976 a): Mäusebussard – Buteo buteo (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1976 b): Wespenbussard – Pernis apivorus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1979): Blauracke – Coracias garrulus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1986): Die Vogelwelt Thüringens. Jena<br />
KOEPERT, O. (1896): Die Vogelwelt des Herzogtums Sachsen – Altenburg. – Journal für Ornithologie 44,<br />
217 – 248, 305 – 331.<br />
KRETSCHMER, E. (1914): Brütende Enten auf Weidenköpfen. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde<br />
der Naturwissenschaften zu Gera 55 – 56, 183 – 184.<br />
KRÜGER, H. (1980): Habicht – Accipiter gentilis (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
8 S.<br />
- (1982): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1979. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 28, 59 – 76.<br />
- (1983): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1980. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 30, 49 – 68.<br />
- (1985 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1981. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 33, 53 – 76.<br />
- (1986 a): Zur Bestandsentwicklung des Weißstorches, Ciconia ciconia (L.) in Ostthüringen. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 34, 29 – 33.<br />
- (1986 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1982. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 35, 51 – 76.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 269
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
KRÜGER, H. (1989): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1984. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 39, 33 – 60.<br />
- (1990): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1985. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 40, 25 – 54.<br />
- (1992): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1986. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 42, 26 – 51.<br />
- (1993/94): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1987. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 43/44, 34 – 52.<br />
- (1995 a): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1988. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 45, 33 - 57.<br />
- (1995 b): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen. – Jahresbericht 1989. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 45, 58 – 83<br />
- (1996): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1990. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 46, 58 – 89.<br />
- (1997): Rückläufige Bestandsentwicklung des Weißstorches, Ciconia ciconia (L.), in Ostthüringen. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 47, 88 – 93.<br />
Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelwarten (2007): Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen<br />
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. – Berichte zum Vogelschutz<br />
44, 151 – 153.<br />
LANGE, H. (1984 a): Bluthänfling – Acanthis cannabina (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1984 b): Fichtenkreuzschnabel – Loxia curvirostra L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1984 c): Buchfink – Fringilla coelebs L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1988): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen – Jahresbericht 1983. – Thüringer<br />
Ornithologische Mitteilungen 38, 53 – 76.<br />
- (1997): Die Vogelwelt des <strong>Greiz</strong>er Parks. – <strong>Greiz</strong>er Heimatkalender 1997, 144 – 146.<br />
- & F. LEO (1978): Die Vögel des Kreises <strong>Greiz</strong>. – Staatliche Museen <strong>Greiz</strong>.<br />
- & K. LIEDER ( 2001): Kommentierte Artenliste der Vögel des Landkreises <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera. –<br />
Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 28, 16 – 70.<br />
LIEBE, K. T. (1873): Die der Umgebung von Gera angehörigen Brutvögel. – Jahresbericht der Gesellschaft<br />
der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 14 – 15, 26 – 53.<br />
- (1875): Zur Einwanderung von Serinus hortulanus KOCH. – Journal für Ornithologie 23, 206.<br />
- (1877): Sollen unsere Wildenten ganz verschwinden? – Monatsschrift des Sächsisch – Thüringischen<br />
<strong>Verein</strong>s für Vogelkunde 2, 15 – 21.<br />
- (1878): Die Brutvögel Ostthüringens und ihr Bestand. – Journal für Ornithologie 26, 1 – 88.<br />
- (1879): Ornithologische Rundschau in Ostthüringen 1877 – 1879. – Ornithologische Monatsschrift 4,<br />
106 – 119.<br />
- (1886): Ornithologische Skizzen. X. Die Weindrossel (Turdus iliacus). – Ornithologische Monatsschrift<br />
11, 30 – 34.<br />
- (1891): Die Verbreitung des Zeimers in Deutschland. – Ornithologische Monatsschrift 16, 323.<br />
- (1893): Aus Ostthüringen. – Ornithologische Monatsschrift 18, 403 – 406.<br />
LIEBERT, H.-P. (1980): Rotkehlchen – Erithacus rubecula (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
LIEDER, K. (1979): Mauersegler – Apus apus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1981 a): Ringdrossel – Turdus torquatus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1981 b): Erlenzeisig – Carduelis spinus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1981 c): Birkenzeisig – Carduelis flammea (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1985): Der Wasservogelbrutbestand im Kreis Gera (Stadt- und Landkreis) in den Jahren 1980 – 1982. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 33, 1 – 7.<br />
- (1987): Zur Bestandsentwicklung von Reiherente, Aythya fuligula (L.) und Tafelente, Aythya ferina (L.),<br />
im Bezirk Gera. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 37, 63 – 67.<br />
- (1988): Eine Bestandserfassung des Höckerschwans, Cygnus olor (Gmelin), 1985 im Bezirk Gera. –<br />
Thüringer Ornithologische Mitteilungen 38, 1 – 5.<br />
- (1996): Die Vögel des Botanischen Gartens des Museum für Naturkunde der Stadt Gera. – Veröffentlichungen<br />
Museum für Naturkunde der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 23, 93 – 100.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 270
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
LIEDER, K. (2003): Zum Brutvorkommen des Haubentauchers, Podiceps cristatus (L.), im Landkreis <strong>Greiz</strong><br />
und der Stadt Gera. – Thüringer Ornithologische Mitteilungen 51, 35 – 40.<br />
- (2004): Zur Brutvogelfauna der Gewässer um Gera. – Veröffentlichungen Museum für Naturkunde der<br />
Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 31, Teil 1: 32 – 37, Teil 2: 27 – 29.<br />
- (2005): Eine Bodenbrut des Mäusebussards, Buteo buteo (L.) bei Großenstein im Landkreis <strong>Greiz</strong>. –<br />
Veröffentlichungen Museum für Naturkunde der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 32, 136 –<br />
137.<br />
- (2009): Die Avifauna des Naturschutzlehrobjektes Rückersdorf. – Veröffentlichungen Museum für Naturkunde<br />
der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 36, 86 – 94.<br />
- & R. GÜNTHER (2002): Die Vogelwelt des Flächennaturdenkmales „Teich bei Kauern“. – Veröffentlichungen<br />
Museum für Naturkunde der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 29, 116 – 140.<br />
- & H. LANGE (2010): Zum Brutvorkommen des Gänsesägers, Mergus merganser L., im Landkreis <strong>Greiz</strong><br />
und der Stadt Gera. – Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3, 85 – 91.<br />
- & G. LIEDER-SÖLDNER (2010): Die Vogelwelt des NSG „Buchenberg“ bei Weida im Landkreis <strong>Greiz</strong>. –<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3, 76 – 84.<br />
- & J. LUMPE (2008): Der Höckerschwan Cygnus olor (J.F. Gmelin 1789) im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt<br />
Gera. – Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 1, 4 – 17.<br />
- & J. LUMPE (2010): Bewahrung der Artendiversität im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera am Beispiel<br />
der Brutvögel der Roten Liste Thüringens. Eine Bilanz nach 200 Jahren ornithologischer Forschung. –<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 2, 81 – 214.<br />
LORENZ, L. (1972): Schwarzspecht – Dryocopus martius (l.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
- (1975 a): Grünspecht – Picus viridis (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1975 b): Kleinspecht – Dendrocopus minor (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
LUMPE, J. (2008): Die Vogelwelt im <strong>Greiz</strong>er Park. – Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 1,<br />
96 – 176.<br />
- (2009 a): Die Ausbreitung der Nilgans im Landkreis <strong>Greiz</strong>. – Der Heimatbote, Beiträge aus dem Landkreis<br />
<strong>Greiz</strong> und Umgebung 9, 34 – 36.<br />
- (2009 b): Bastardenten auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee. – Der Heimatbote, Beiträge aus dem Landkreis <strong>Greiz</strong><br />
und Umgebung 10, 37 – 39.<br />
-, H. LANGE & K. LIEDER (2008): Ornithologischer Jahresbericht 2007. – Ornithologische Berichte aus dem<br />
mittleren Elstertal. 1, 23 – 84.<br />
- & K. LIEDER (2009): Ornithologischer Jahresbericht 2008. – Ornithologische Berichte aus dem mittleren<br />
Elstertal. 2, 3 – 72.<br />
- & K. LIEDER (2010): Ornithologischer Jahresbericht 2009. – Ornithologische Berichte aus dem mittleren<br />
Elstertal, 3, 3 – 71.<br />
MEY, E. (1982): Lachmöwe – Larus ridibundus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
6 S.<br />
MOERICKE, H. (1926): Geschichte des „<strong>Verein</strong>s der Naturfreunde“. – In: Festschrift zu der Feier des<br />
50jährigen Bestehens „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ zu <strong>Greiz</strong>, 1 – 12.<br />
NIETHAMMER, G. (1937 – 42): Handbuch der deutschen Vogelkunde. – Leipzig<br />
NIPKOW, M. (2010): Das NABU – Grundsatzprogramm Vogelschutz. – Vogelschutz in Deutschland.<br />
ÖLSCHLEGEL, H. (1973): Teichrohrsänger – Acrocephalus scirpaceus (Hermann). – Berichte zur Avifauna des<br />
Bezirkes Gera. Loseblattsammlung, 4 S.<br />
- (1974): Haubentaucher – Podiceps cristatus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1978 a): Gelbspötter – Hippolais icterina (VIEILLOT). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1978 b): Gartengrasmücke – Sylvia borin (BODDAERT). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera,<br />
Loseblattsammlung, 3 S.<br />
- (1978 c): Mönchsgrasmücke – Sylvia atricapilla (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1978 d): Dorngrasmücke – Sylvia communis LATHAM. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1978 e): Klappergrasmücke – Sylvia curruca (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1982 a): Bachstelze – Motacilla alba L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1982 b): Ergebnisse der Vogelberingung im Gebiet um Mildenfurth – ein Beitrag zur Avifauna des unteren<br />
Weidatals. – Jahrbuch des Museums Hohenleuben-Reichenfels 27, 42 – 58.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 271
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
ÖLSCHLEGEL, H. (1994/95): Die Brutvögel des ehemaligen Schlossparks Gera-Tinz. – Veröffentlichungen<br />
Museum für Naturkunde der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 21/22, 149 – 166.<br />
Ornithologische Sektion Gera (1859): Verzeichniß der in der Umgebung von Gera beobachteten Vögel. –<br />
Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 2, 31 – 37.<br />
OXFORT M. (1986): Goldregenpfeifer. – In: KNORRE, D. V. u.a. (Hrsg.): Die Vogelwelt Thüringens. – Jena.<br />
PETER, H.-U. (1983): Turmfalke – Falco tinnunculus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
8 S.<br />
- (1984): Höckerschwan – Cygnus olor (Gmelin). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
8 S.<br />
RINGLEBEN, H. (1070): Kritische Anmerkungen zur „Fauna“ von A. WEISS. – Thüringer Ornithologischer<br />
Rundbrief 16, 38 – 39.<br />
RITTER, F. (1974): Waldohreule – Asio otus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,3<br />
S.<br />
- & R. GÜNTHER (1974): Waldkauz – Strix aluco L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
2 S.<br />
RITTER, F. & D. V. KNORRE (1975): Schleiereule – Tyto alba (Scopoli). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
ROßBACH, R. (1935/36 a): Ornithologische Seltenheiten in der Umgebung von Gera. – Jahresbericht der<br />
Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften zu Gera 78 – 79, 52 – 54.<br />
ROßBACH, R. (1935/36 b): Etwas vom Wespenbussard. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der<br />
Naturwissenschaften zu Gera 78 – 79, 54 – 56.<br />
ROST, F. (1995): Der Brutbestand von Bläßhuhn (Fulcia ater) und Teichhuhn (Gallinula chloropus) in Thüringen<br />
1994. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 2, 145 – 157.<br />
- (1998): Der Brutbestand der Lappentaucher (Podicipedidae) 1997 in Thüringen. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s<br />
Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 3, 103 – 116.<br />
- (1999): Der Brutbestand der Gänse (Anser, Branta) und der Enten (Anatidae) 1998 in Thüringen. – Anzeiger<br />
des <strong>Verein</strong>s Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 3, 185 – 201.<br />
- (2000): Der Brutbestand von Höckerschwan Cygnus olor und Möwen (Laridae) 1999 in Thüringen. –<br />
Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 4, 29 – 39.<br />
- (2001): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2000. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 19, 1 – 30.<br />
- (2002): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2001. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 21, 1 – 34.<br />
- (2003): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2002. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 24, 1 – 29.<br />
- (2004): Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2003. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e.V. Mitteilungen<br />
und Informationen 26, 1 – 34.<br />
- (2005). Brutvorkommen und Durchzug der Beutelmeise Remiz pendulinus in Thüringen. – Anzeiger des<br />
<strong>Verein</strong>s Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 5, 117 – 127.<br />
- B. FRIEDRICH & H. LANGE (1995): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1994. – <strong>Verein</strong> Thüringer<br />
<strong>Ornithologen</strong> e. V.– Mitteilungen und Informationen, Sonderheft.<br />
-, -, - (1996): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1995. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 10, 1 – 25.<br />
-, -, - (1997): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1996. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 12, 1 – 26.<br />
-, -, - (1998): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1997. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 14, 1 – 31.<br />
-, -, - (1999): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1998. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 15, 1 – 28.<br />
-, -, - (2000): Ornithologische Besonderheiten für Thüringen 1999. – <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.–<br />
Mitteilungen und Informationen 18, 1 – 29.<br />
- & H. GRIMM (2004): Kommentierte Artenliste der Vögel Thüringens. – Anzeiger des <strong>Verein</strong>s Thüringer<br />
<strong>Ornithologen</strong> 5, Sonderheft. 3 – 78.<br />
RUDAT, V. (1975): Tannenhäher – Nucifraga caryocatactes (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera,<br />
Loseblattsammlung, 2 S.<br />
- & J. Wiesner (1981): Zur gegenwärtigen Kenntnis der Verbreitung des Sperlingskauzes (Glaucidium<br />
passerinum L.) in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 18, 57 – 63.<br />
SCHEFFEL, J. (1976 a): Bleßralle – Fulcia ater L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1976 b): Elster – Pica pica (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung 4 S.<br />
- (1976 c): Kohlmeise – Parus major L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 272
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
SCHEFFEL, J. (1976 d): Blaumeise – Parus caeruleus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1981 a): Misteldrossel – Turdus viscivorus L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1981 b): Singdrossel – Turdus philomelos BREHM. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
5 S.<br />
- (1981 c): Amsel – Turdus merula L. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung, 5 S.<br />
SCHEIN, E. (1906 a): Ein Nachmittag unter Würgern. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften<br />
zu Gera 46 – 48, 172 – 174.<br />
- (1906 b): Würger, Goldammer und Kuckuck. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften<br />
zu Gera 46 – 48, 174 – 175.<br />
SCHUMANN, G. (1878): Über den Girlitz und die Wacholderdrossel. – Ornithologisches Centralblatt 3, 172.<br />
SEMMLER, W. & D. V. KNORRE (1975): Grauspecht – Picus canus Gmelin. – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 4 S.<br />
SEYDEL, J. C. (1883): Der Frießnitzer See. Ein Heimatbild. – Jahresbericht der Gesellschaft der Freunde der<br />
Naturwissenschaften zu Gera 21 – 26, 225 – 231.<br />
SOMMERLATTE, F. (1953): Der Buchenberg bei Weida – ein kostbares Kleinod unserer Heimat. – Jahrbuch<br />
des Kreismuseums Weida, 1, 31 – 33.<br />
STRESEMANN, E. (1919): Über die europäischen Baumläufer. – Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft<br />
in Bayern 13, 245 – 288.<br />
SÜDBECK, P., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT, P. BOYE & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands.<br />
4., überarbeitete Fassung, 30.November 2007. – Berichte zum Vogelschutz 44, 23 – 81.<br />
WEISS, A. (1908): Die Fauna (Tierwelt). I. Abteilung: Vertebrata (Wirbeltiere). In: Neue Landeskunde des<br />
Herzogtums Sachsen-Meinigen 7. Schriften des <strong>Verein</strong>s für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde<br />
5, 641 – 687.<br />
WEISSGERBER, R. (2007): Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes. – Apus 13, Sonderheft.<br />
WERNER, J. (1961): Zum Verbreitungswandel des Schwarzspechtes in Ostthüringen. – Jahrbuch des Museums<br />
Hohenleuben-Reichenfels10, 114 – 118.<br />
- (1964): Der Vogelbestand einer Talsperre. – Jahrbuch des Museums Hohenleuben-Reichenfels 12/13,<br />
84 – 111.<br />
WICHLER , E. (1951): Brutvorkommen des Wespenbussards Pernis apivorus (L.) bei Gera. – Mitteilungen<br />
Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 2, 31.<br />
- (1952): Kuckucksbeobachtungen. – Mitteilungen Thüringer <strong>Ornithologen</strong> 3, 10 – 11.<br />
WIESNER, J. (2001): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens. – Naturschutzreport 18, 35 – 39.<br />
WOLF, E. (1974): Buntspecht – Dendrocopos major (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1983 a): Kleiber – Sitta europaea (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1983 b): Zaunkönig – Troglodytes troglodytes (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
- (1984 a): Haussperling – Passer domesticus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1984 b): Feldsperling – Passer montanus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
3 S.<br />
WÜST, W. (1990): Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Band I. 3. Auflage. – München.<br />
ZSCHIEGNER, W. (1979 a): Grünfink – Carduelis chloris (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1979 b): Stieglitz – Carduelis carduelis (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera, Loseblattsammlung,<br />
4 S.<br />
- (1981 a): Gartenrotschwanz – Phoenicurus phoenicurus (L.). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes Gera,<br />
Loseblattsammlung, 5 S.<br />
- (1981 b): Hausrotschwanz – Phoenicurus ochruros (GMELIN). – Berichte zur Avifauna des Bezirkes<br />
Gera, Loseblattsammlung, 5 S.<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 273
Index der deutschen Vogelnamen<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Amsel 216 Kohlmeise 173<br />
Bachstelze 242 Kolkrabe 170<br />
Baumpieper 238 Misteldrossel 213<br />
Birkenzeisig 258 Mönchsgrasmücke 196<br />
Blaumeise 172 Nachtigall 228<br />
Bluthänfling 256 Nebelkrähe 168<br />
Buchfink 243 Neuntöter 160<br />
Dorngrasmücke 199 Pirol 158<br />
Eichelhäher 164 Rabenkrähe 167<br />
Elster 162 Ringdrossel 215<br />
Erlenzeisig 254 Rohrammer 262<br />
Feldlerche 179 Rotdrossel 221<br />
Feldschwirl 188 Roter Kardinal 260<br />
Feldsperling 237 Rotkehlchen 227<br />
Fichtenkreuzschnabel250 Schwanzmeise 181<br />
Fitis 185 Singdrossel 220<br />
Gartenbaumläufer 205 Sommergoldhähnchen 202<br />
Gartengrasmücke 197 Star 209<br />
Gartenrotschwanz 231 Stieglitz 253<br />
Gebirgsstelze 240 Sumpfmeise 176<br />
Gelbspötter 194 Sumpfrohrsänger 190<br />
Gimpel 245 Tannenhäher 165<br />
Girlitz 247 Tannenmeise 175<br />
Goldammer 261 Teichrohrsänger 192<br />
Grauschnäpper 223 Trauerschnäpper 225<br />
Grünfink 252 Wacholderdrossel 218<br />
Haubenmeise 174 Waldbaumläufer 204<br />
Hausrotschwanz 230 Waldlaubsänger 183<br />
Haussperling 235 Wasseramsel 211<br />
Heckenbraunelle 233 Weidenmeise 177<br />
Kernbeißer 244 Wintergoldhähnchen 201<br />
Kiefernkreuzschnabel 249 Zaunkönig 207<br />
Klappergrasmücke 198 Zilpzalp 186<br />
Kleiber 203<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 274
Band 1, Heft 1<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />
Bisher erschienene<br />
Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE Der Höckerschwan Cygnus olor (J. F. Gmelin 1789)<br />
im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />
LUMPE, J. Rotmilan Milvus milvus und Neuntöter Lanius collurio in der<br />
Gemeinde Kraftsdorf<br />
4 – 17<br />
18 – 22<br />
LUMPE, J., H. LANGE & K. LIEDER Ornithologischer Jahresbericht 2007 23 – 78<br />
LUMPE, J Aus dem <strong>Verein</strong>sleben 79 – 83<br />
Band 1, Heft 2<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE Der Singschwan Cygnus cygnus (Linnaeus 1758)<br />
im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />
89 – 95<br />
LUMPE, J. Die Vogelwelt im <strong>Greiz</strong>er Park 96 – 176<br />
Band 2, Heft 1<br />
MÜLLER, F. Erste Ergebnisse von Zugplanbeobachtungen im Raum<br />
Plauen<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE Die Brutvorkommen des Eisvogels Alcedo atthis (Linnaeus<br />
1758) in den Jahren 2004 bis 2008 im Landkreis <strong>Greiz</strong> und<br />
der Stadt Gera<br />
Band 2, Heft 2<br />
LIEDER, K. & J. LUMPE Bewahrung der Artendiversität im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der<br />
Stadt Gera am Beispiel der Brutvögel der Roten Liste<br />
Thüringens<br />
Eine Bilanz nach 200 Jahren ornithologischer Forschung<br />
73 – 74<br />
75 – 78<br />
81 – 214<br />
Band 3, Heft 1<br />
LUMPE, J. & K. LIEDER Ornithologischer Jahresbericht 2009 3 – 71<br />
MÜLLER, F. Zum Vorkommen von Gartenbaumläufer (Certhia<br />
brachydactyla) und Waldbaumläufer (Certhia familiaris) im<br />
mittleren Vogtland<br />
LIEDER, K. & G. LIEDER-SÖLDNER Die Vogelwelt des NSG „Buchenberg“ bei Weida im Landkreis<br />
<strong>Greiz</strong><br />
LIEDER, K. & H. LANGE Zum Brutvorkommen des Gänsesägers, Mergus merganser<br />
L., im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />
72 – 75<br />
76 – 84<br />
85 – 93<br />
Klaus Lieder & Josef Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 275